
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
» Den Vogel erkennt man an seinen Federn.« Mit diesem Sprichworte unterscheidet das Volk sehr richtig die gefiederten Rückgratthiere von allen übrigen Wirbelthieren. Wenn man dem Sprichworte hinzufügt, daß die Kinnladen mit Hornschneiden bekleidet, die Vorderglieder in Flügel umgebildet, also nur noch zwei Beine vorhanden und in diesen Fußwurzel und Mittelfuß zu einem Stücke verschmolzen sind, sowie ferner sich vergegenwärtigt, daß das Hinterhaupt mit einfachem Gelenkknopfe, der aus mehreren Stücken bestehende Unterkiefer an dem beweglich mit dem Schädel verbundenen Quadratbeine gelenkt, das Herz doppelte Kammern und Vorkammern besitzt, die Lungen mit Luftsäcken und den meist luftführenden Knochen in Verbindung stehen, das Zwerchfell unvollkommen und das Becken nicht offen ist, wird man auch dem Naturforscher gerecht.
So abweichend gebaut der Vogel zu sein scheint, so große Aehnlichkeit zeigt sein Geripp mit dem der Säugethiere, so viele Uebereinstimmung aber ebenso mit dem der Kriechthiere, weshalb auch letztere von nicht wenigen Naturforschern als Vorläufer der gefiederten Rückgratthiere aufgefaßt werden. Bezeichnend für die Vögel ist ihr Vermögen zu fliegen: mit ihm hängen die scharf ausgeprägten Eigentümlichkeiten der Gestalt und des inneren Baues aufs engste zusammen; aus ihm erklärt sich größtentheils die Umgestaltung, welche die Vögel im Gegensatze zu Säuge- und Kriechtieren erlangen mußten, um das zu werden, was sie sind.
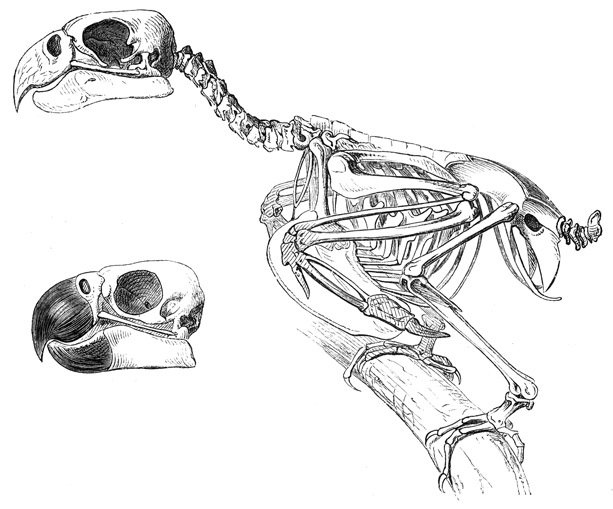
Geripp des Jako und Kopf des Gelbwangenkakadu.
Der Schädel ist stark gewölbt und wird aus verschiedenen Knochen zusammengesetzt, deren verbindende Nähte, in der Jugend deutlich sichtbar, im Alter so miteinander verwachsen, daß von der vormaligen Trennung keine Spur mehr übrig bleibt. Die kleinen, aber sehr verlängerten Knochen, welche das Gesicht bilden, bestehen aus zwei Oberkieferbeinen, dem Pflugschar- und Quadratbeine und den Verbindungsknochen sowie den Unterkiefern. Bemerkenswerth ist die Größe der Augenhöhlen und die Dünne der zwischenliegenden, zuweilen auch wohl durchbrochenen Wand, ebenso der einfache Gelenkknopf am Hinterhauptsloche, welcher größere Beweglichkeit des Schädels ermöglicht, als sie beim Kopfe des Säugethieres stattfinden kann. Die Halswirbel schwanken an Zahl zwischen neun und vierundzwanzig und zeichnen sich aus durch ihre Beweglichkeit, während die sechs bis zehn Rumpfwirbel und die neun bis siebzehn Lenden- oder Kreuzwirbel im Gegentheile sehr unbeweglich sind und oft miteinander verschmelzen. Im Gegensatze zu dem entsprechenden Theile der Säugetiere sind die Schwanzwirbel, deren Anzahl meist acht bis zehn beträgt, durch Verschmelzung jedoch herabgemindert werden kann, stets vollkommener ausgebildet als bei den Säugetieren, was sich namentlich an dem letzten, dem Träger der großen Steuerfedern, bemerklich macht; denn dieser Wirbel stellt sich als eine hohe, drei- oder vierseitige Knochenplatte dar. Die dünnen und breiten Rippen, deren Anzahl mit jener der Rückenwirbel im Einklange steht, gelenken an letzteren und durch besondere Knochenkörper am Brustbeine, tragen auch, mit Ausnahme der ersten und letzten, am hinteren Rande hakenförmige Fortsätze, welche sich auf dem oberen Rande der folgenden Unterrippen anlegen und zur Festigung des Brustkorbes wesentlich beitragen, dementsprechend auch bei den kräftigen Fliegern sehr entwickelt, bei den Läufern hingegen verkümmert sind oder gänzlich fehlen. Das Brustbein läßt sich mit einem großen Schilde vergleichen, auf dessen Mitte der Kamm aufgesetzt ist. Seine Größe und die Höhe des Kammes werden bedingt durch die sich hier ansetzenden gewaltigen Brustmuskeln, verändern sich also je nach der größeren oder geringeren Flugfähigkeit des Vogels. Bei allen Raubvögeln z. B. ist der Kamm sehr hoch und stark gebogen, bei den Kurzflüglern fehlt er gänzlich. Als besondere Eigenthümlichkeit desselben mag noch hervorgehoben werden, daß er bei einzelnen Vögeln inwendig hohl ist und dann einen Theil der Luftröhre aufnimmt. Das Becken unterscheidet sich von dem der Säugethiere hauptsächlich durch seine Verlängerung. Der Schultergürtel besteht aus dem langen, schmalen, jederseits neben der Wirbelsäule den Rippen aufliegenden Schulterblatte, welches sich vorn mit dem sogenannten Rabenbeine zur Bildung des Schultergelenkes verbindet, und den an ihrem vorderen Ende verschmolzenen Schlüsselbeinen, welche gemeinschaftlich das Gabelbein darstellen; der Flügel aus dem Oberarme, einem langen, luftgefüllten Röhrenknochen, der im Gegensatze zu den Säugethieren starken Elle und der verhältnismäßig schwachen Speiche, welche den Unterarmtheil bilden, zwei, höchstens drei Mittelhandknochen und drei Fingern: einem Daumen, welcher bei mehreren Vögeln einen wirklich krallenartigen, aber unter den Federn versteckten Nagel trägt und dann zwei Glieder hat, dem großen, zweigliederigen und dem mit ihm verwachsenen kleinen, eingliederigen Finger. Die Beine werden gebildet aus dem Ober- und dem Unterschenkel, dem Laufe und dem eigentlichen Fuße oder den Zehen. Am Unterschenkel zeigt sich das Wadenbein als ein verkümmerter, mit dem starken Schienbeine verwachsener Knochen; der Lauf besteht aus einem langen Röhrenknochen, an welchem die Zehen gelenken. Von den letzteren sind gewöhnlich drei nach vorn, eine nach hinten gerichtet; bei einzelnen Vögeln kehrt sich die hintere Zehe jedoch nach vorn, bei anderen verkümmert sie, bei anderen wendet sich eine Zehe, die äußere oder die innere, nach hinten, bei einzelnen endlich verkümmert der Fuß bis auf zwei außen sichtbare Zehen. Der Daumen besitzt in der Regel zwei, die erste Vorderzehe drei, die zweite vier, die äußere fünf Glieder.
Das ganze Geripp verknöchert ungemein schnell, und die Knochenmasse ist viel dichter und spröder, auch weißer als bei den Säugethieren. Besonders aber unterscheiden sich die Knochen der Vögel von denen der Säugethiere dadurch, daß sie luftführend sind. Das bei dem jungen Vogel vorhandene, sehr blutreiche Mark wird allmählich aufgesaugt, der Knochen also hohl und damit befähigt, Luft in sich aufzunehmen.
Unter den Muskeln stehen die Brustmuskeln, welche die Flügel bewegen, obenan. Sie erreichen hier einen Umfang wie bei keinem Wirbelthiere weiter. Ihnen gegenüber treten die Muskeln des Rückens auffallend zurück. Am Beine haben in der Regel nur der Ober- und der Unterschenkel kräftige Muskeln; denn bloß bei denjenigen Vögeln, deren Fänge bis zu den Zehen herab befiedert sind, erstrecken sich die Muskeln weiter nach unten bis gegen die Zehen hin, bei den übrigen sind sie am Lauftheile bereits sehnig geworden. Besonders entwickelt zeigen sich die Hals- und ebenso die Hautmuskeln, verkümmert die Gesichtsmuskeln.
Das Nervensystem kommt dem der Säugethiere sehr nah. Das Gehirn überwiegt an Masse noch das Rückenmark, ist jedoch schon einfacher gebildet, theilt sich in das große und kleine Hirn und zeigt beide Halbkugeln des ersteren, nicht aber die Windungen, welche das Hirn der Säugethiere so auszeichnen. Das verlängerte Mark ist beträchtlich groß, das Rückenmark in der Röhre der Halswirbel rundlich und gleich dick, in der Röhre der Brustwirbel breiter und dicker, in den Kreuzwirbeln wieder dünner. Die Nerven verhalten sich in ihrem Verlaufe ungefähr ebenso wie die der Säugethiere.
Alle Sinneswerkzeuge sind vorhanden und wohl entwickelt, einzelne zwar vereinfacht, nicht aber verkümmert. Das Auge steht obenan, ebensowohl wegen seiner verhältnismäßig sehr beträchtlichen Größe wie seiner inneren Bildung. Gestalt und Größe sind sehr verschieden: alle fernsichtigen und alle nächtlichen Vögel z. B. haben sehr große, die übrigen kleinere Augen. Dem Vogelauge eigenthümlich sind: der sogenannte Knochenring, gebildet aus zwölf bis dreißig vierseitigen, dünnen Knochenplatten, welche sich mit ihren Rändern dachziegelartig übereinander schieben, hinsichtlich ihrer Größe, Stärke und Form aber vielfach abweichen, sowie der Fächer oder Kamm, eine dicht gefaltete, gefäßreiche, mit schwarzem Farbstoffe überzogene Haut, welche im Grunde des Glaskörpers auf der Eintrittsstelle des Sehnerven liegt und oft bis zur Linse reicht. Beide, Ring und Fächer, ermöglichen wahrscheinlich, daß der Vogel nach Belieben fern- oder kurzsichtig sein kann, bedingen jedenfalls die außerordentliche innere Beweglichkeit des Auges. Neben den beiden Augenlidern, welche stets vorhanden sind, besitzen die Vögel noch ein drittes, halbdurchsichtiges, die sogenannte Nickhaut, welche im vorderen Augenwinkel liegt, seitwärts vorgezogen werden kann und bei sehr grellem Lichte sich nützlich erweisen mag. Die Regenbogenhaut ändert in ihrer Färbung nach Art, Alter und Geschlecht ab. Bei den meisten Vögeln sieht sie braun aus; von dieser Farbe durchläuft sie alle Schattirungen bis zu Roth und Hellgelb oder Silbergrau und ebenso vom Silbergrau zu Hellgrau und Blau. Einige Vögel haben ein lebhaft grünes, andere ein bläulichschwarzes Auge. Ein äußeres Ohr ist nicht vorhanden. Die großen Ohröffnungen liegen seitwärts am hinteren Theile des Kopfes und sind bei den meisten Vögeln mit strahligen Federn umgeben oder bedeckt, welche die Schallwellen nicht abhalten. Bei den Eulen wird die Muschel durch eine häutige, höchst bewegliche, aufklapp- und verschließbare Falte ersetzt. Das Paukenfell liegt nahe am Eingange; der Gehörgang ist kurz und häutig, die Paukenhöhle geräumig. Anstatt der drei Gehörknöchelchen der Säugethiere ist nur ein einziger, vieleckiger Knochen vorhanden, welcher mit dem Hammer einige Aehnlichkeit hat und gleichzeitig Steigbügel und Amboß ersetzen muß. Die Geruchswerkzeuge stehen denen der Säugethiere entschieden nach. Eine äußere Nase und große Nasenhöhlen fehlen. Die Nasenlöcher, am Oberkiefer gewöhnlich nahe der Wurzel des Schnabels liegend, öffnen sich als rundliche Löcher oder Spalten, ausnahmsweise auch in längeren Hornröhren und sind entweder nackt oder mit Haut oder mit borstenartigen Federn bedeckt. Innen theilt sich die Nase in zwei Höhlen, in denen je drei häutige, knorpelige oder knöcherne Muscheln liegen, und auf deren sie überziehenden Schleimhaut der Riechnerv sich ausbreitet. Einen feinen Geschmackssinn scheinen nur wenige Vögel zu besitzen, da die Zunge bloß bei einzelnen so gebildet ist, daß wir auf ihre Fähigkeit zum Schmecken schließen dürfen. Bei den meisten ist sie im Gegentheile mehr oder weniger verkümmert, entweder verkürzt und verkleinert, oder mit einer hornartigen Haut überzogen, bei wenigen lang und fleischig. Mehr als zum Schmecken mag sie im allgemeinen zum Tasten benutzt werden, und ebenso kann sie zum Anspießen oder Ergreifen der Nahrung dienen. Der Sinn des Gefühles, möge er nun als Empfindungs- oder als Tastvermögen aufgefaßt werden, scheint hoch entwickelt zu sein; denn die äußere Haut ist reich an Nerven, und der so oft tastfähigen Zunge kommt auch der mit weicher Haut überzogene Schnabel noch zu Hülfe.
Sehr vollkommen sind die Organe des Blutumlaufes und der Athmung. Die Vögel besitzen ein Herz mit zwei Kammern und zwei Vorkammern, welches in seiner Bildung dem der Säugethiere sehr ähnelt, verhältnismäßig aber muskelkräftiger ist. Zu beiden Seiten desselben liegen die Lungen und seitlich der Spitze des Herzens die beiden Leberlappen. Die Lungen sind mit den Rippen verwachsen und erstrecken sich weiter nach unten als bei den Säugethieren, wie denn überhaupt eine scharfe Scheidung zwischen Brust und Bauchhöhle nicht stattfindet. Außer den Lungen füllen die Vögel noch mehrere Säcke und Zellen, welche im ganzen Körper liegen, mit der eingeathmeten Luft an, indem diese aus den Lungen in die Brustfellsäcke eindringt und sich dann von hier aus weiter im Körper verbreitet, ja sogar den größten Theil der Knochen, entweder die Röhren, oder die außerdem vorhandenen Zellen, erfüllt. Die Luftröhre besteht aus knöchernen, durch Haut verbundenen Ringen und besitzt einen oberen und unteren Kehlkopf. Ersterer liegt hinter der Zunge, ist fast dreieckig und hat keinen Kehldeckel; seine Stimmritze wird von nervenreichen Wärzchen umgeben und an den Rändern mit einer weichen, muskeligen Haut bekleidet, welche vollkommene Schließung des Kehlkopfes ermöglicht. Der untere Kehlkopf liegt am Ende der Luftröhre vor der Theilung in die Aeste und ist eigentlich nur eine Vergrößerung des letzten Luftröhrenringes. Ein Steg in der Mitte, gebildet durch Verdoppelung der inneren Haut der Luftröhre, theilt ihn in zwei Spalten oder Ritzen, deren Ränder beim Ausströmen der Luft in Schwingungen gesetzt werden, also zur Erzeugung der Stimme dienen. An jeder Seite des unteren Kehlkopfes liegen Muskeln, einer bis fünf an der Zahl, welche jenem, dem eigentlichen Stimmwerkzeuge, vielseitige Beweglichkeit ermöglichen. Bei wenigen Vögeln fehlen diese Muskeln gänzlich, bei anderen, zu denen die meisten Singvögel zählen, sind fünf Paare vorhanden. Zu beiden Seiten der Luftröhre verlaufen außerdem lange Muskeln, welche am unteren Kehlkopfe beginnen, bei einzelnen bis zu den Ohren aufsteigen und durch ihre Thätigkeit Verkürzungen oder Verlängerungen der Luftröhre bewirken können. Höchst eigenthümlich ist der Verlauf der letzteren bei manchen Vögeln; denn nicht immer senkt sie sich vom unteren Ende des Halses unmittelbar in das Innere des Brustkorbes, tritt vielmehr, wie bereits bemerkt, bei einzelnen vorher erst in den Kamm des Brustbeines ein oder bildet auf den äußeren Brustmuskeln eine mehr oder weniger tiefe Schlinge, kehrt nach oben zurück und senkt sich nun erst in das Innere des Brustkorbes.
Die Verdauungswerkzeuge der Vögel unterscheiden sich von denen der Säugethiere schon deshalb wesentlich, weil jene keine Zähne haben und alle Bissen ganz verschlucken. Speicheldrüsen sind vorhanden; eine wirkliche Durchspeichelung in der Mundhöhle aber findet kaum statt, weil der Bissen vor dem Verschlingen nicht gekaut wird. Bei vielen Vögeln gelangt er zunächst in eine Ausbuchtung der Speiseröhre, welche man Kropf nennt, und wird hier vorläufig aufbewahrt und vorverdaut; bei anderen kommt er unmittelbar in den Vormagen, eine Erweiterung der unteren Speiseröhre, welche reich an Drüsen und stets dünner als der eigentliche Magen ist, keinem Vogel fehlt und bei denjenigen Arten am größten ist, welche keinen Kropf besitzen. Der Magen kann sehr verschieden gebildet sein. Bei denen, welche vorzugsweise oder ausschließlich von anderen Thieren leben, ist er gewöhnlich dünnhäutig; bei denen, welche sich von Pflanzenstoffen nähren, sehr starkmuskelig und innen mit einer harten, gefalteten Haut ausgekleidet, welche wirklich die Stelle eines Reibers vertritt und, von den kräftigen Muskeln bewegt, die Speisen, denen Sandkörner und Kieselchen beigemischt werden, zerkleinert und zermalmt. Im Darmschlauche fehlt der Dickdarm, ist wenigstens nur beim Strauß sozusagen angedeutet. Der Mastdarm erweitert sich gegen sein Ende zur sogenannten Kloake, in welche die beiden Harnleiter, die Samengänge und die Eileiter münden. Die Milz ist verhältnismäßig klein, die Bauchspeicheldrüse groß, die hartkörnige, in mehrere Lappen getheilte Leber ansehnlich, ebenso die Gallenblase, die Niere endlich lang, breit und gelappt.
Einige Vögel besitzen eine deutliche Ruthe, alle, wie selbstverständlich, Hoden und Samengänge. Erstere liegen in der Bauchhöhle am oberen Theile der Nieren, schwellen während der Paarungszeit außerordentlich an und schrumpfen nach ihr auf kleine, kaum bemerkbare Kügelchen zusammen; letztere laufen, stark geschlängelt, vor den Nieren neben den Harnleitern herab, erweitern sich und bilden vor ihrer Mündung eine kleine Blase. Der traubenförmige Eierstock liegt am oberen Ende der Niere und besteht aus vielen rundlichen Körperchen, den Dottern, deren Anzahl sich ungefähr zwischen hundert und fünfhundert bewegt. Der Eileiter ist ein langer, darmförmiger Schlauch mit zwei Mündungen, von denen eine in die Bauchhöhle, die andere in die Kloake sich öffnet.
Die Haut der Vögel hat hinsichtlich ihrer Bildung im wesentlichen mit jener der Säugethiere Aehnlichkeit. Auch sie besteht aus drei Lagen: der Oberhaut, dem Schleimnetze und der Lederhaut. Erstere ist dünn und faltenreich, verdickt sich aber an den Fußwurzeln und Zehen zu hornigen Schuppen und wandelt sich auch am Schnabel in ähnlicher Weise um; die Lederhaut ist verschieden dick, bei einzelnen Vögeln sehr dünn, bei anderen stark und hart, stets gefäß- und nervenreich und nach innen zu oft mit einer dichten Fettschicht bedeckt. Die Federn entwickeln sich in Taschen der Haut, welche ursprünglich gefäßreiche, an der Oberhaut liegende Wärzchen waren, jedoch allmählich in Einsenkungen der Lederhaut aufgenommen wurden. Die Wärzchen haben, nach Carus, auf ihrer vorderen Fläche eine tiefe Furche, von welcher rechts und links seichtere Furchen abgehen, welche, wiederum mit kleinen seitlichen Furchen verbunden, um die Tasche herumziehen und auf der hinteren Fläche derselben flach auslaufen. Die Oberhaut, welche die Tasche mit allen ihren Unebenheiten bedeckt, wuchert vom Grunde aus und verhornt; der verhornte Theil wird nach außen geschoben und stellt die Feder dar. Diese entspricht hinsichtlich ihrer Form den Furchen der Tasche: der Schaft oder Kiel der tieferen vorderen, der Bart den beiden seitlichen. Gegen Ende des Wachsthums der Feder schwinden die Furchen; der Schaft schließt sich zu einem dünnwandigen Rohre, und die in dieses hinein verlängerte Warze vertrocknet. Somit stellen sich die Federn als Erzeugnisse der Oberhaut dar. Sie sind ähnliche Gebilde wie Haare, Stacheln oder Schuppen der Säugethiere, bei den verschiedenen Vögeln aber vielfachen Veränderungen unterworfen und auch an den verschiedenen Theilen des Vogels selbst abweichend gebildet. Man unterscheidet den Stamm, die Fahne oder den Bart, am Stamme die Spule und den Schaft. Ersterer ist der untere, in der Haut steckende Theil der Feder, ein rundes, hohles, durchsichtiges Gebilde, welches nach oben hin vierkantig wird und mit zeitigem Marke sich füllt, während es in der Mitte die oben und unten angewachsene Seele, eine Reihe dütenförmiger, ineinander steckender Zellen enthält, welche die Nahrung zuführen. Der obere Theil des Schaftes ist gewölbt und ebenfalls mit glatter, horniger Masse bedeckt, der untere durch eine Längsrinne getheilt und minder glatt. Am Schafte stehen zweizeilig die den Bart bildenden Strahlen, dünne Hornplättchen, welche schief von innen nach außen am Schafte befestigt sind und an deren oberen Kante sich zweizeilig die Fasern ansetzen; letztere tragen fast in gleicher Weise angereihte und gebildete Häkchen, welche den innigen Zusammenhang der Federn vermitteln. Unter diesen selbst unterscheidet man Außen- und Flaumfedern oder Dunen. Erstere werden in Körper-, Schwung-, Steuer- und Deckfedern, die Schwungfedern in Hand-, Arm- und Schulterschwingen eingetheilt. Am Handtheile des Flügels stehen gewöhnlich zehn Handschwingen oder Schwungfedern erster Ordnung, während die Anzahl der Armschwingen oder Schwungfedern zweiter Ordnung schwankend ist; der Schwanz wird in der Regel aus zwölf, selten aus weniger, öfter aus mehr Steuerfedern gebildet. Von der Wurzel vieler Außenfedern zweigt sich oft eine Nebenfeder, der Afterschaft ab, welcher meist sehr klein bleibt, bei dem Emu aber dieselbe Länge und eine ganz ähnliche Entwickelung wie die Hauptfeder erlangt. Alle Außenfedern stehen nicht überall gleich dicht, sind vielmehr in gewisser Weise nach Fluren geordnet, so daß eigentlich der größte Theil des Leibes nackt und die Befiederung nur auf schmale, reihenartige, bei den verschiedenen Vögeln auch verschieden verlaufende Streifen beschränkt ist. Diejenigen Vögel, welche ein gleichmäßig dichtes Federkleid tragen, sind zum Fliegen unfähig. Die Körperfedern liegen dachziegelartig, die Schwung- und Steuerfedern fächerförmig übereinander; die Deckfedern legen sich von oben nach unten über die Schwung- und Steuerfedern und werden demgemäß als Hand-, Ober- und Unterflügel- oder Schwanzdeckfedern unterschieden. Bei den Dunen ist die Fahne weitstrahliger, lockerer und biegsamer, der Verband der Häkchen mehr oder weniger aufgehoben und das ganze Gefüge dadurch ein anderes geworden. Auch mit den verschiedenen Farben, welche an den Federn haften, steht Verschiedenheit der Bildung im Einklange: eine und dieselbe Feder, welche verschiedene Farben zeigt, kann auch verschieden gebildet sein, da ihre Pracht weit weniger auf den an ihr haftenden Farbstoffen, als vielmehr auf Strahlenbrechung beruht. Ausbleichen der Federn kommt häufig, Nachdunkeln seltener vor; Weißlinge sind daher nicht ungewöhnliche Erscheinungen und werden bei den verschiedenartigsten Vögeln beobachtet.
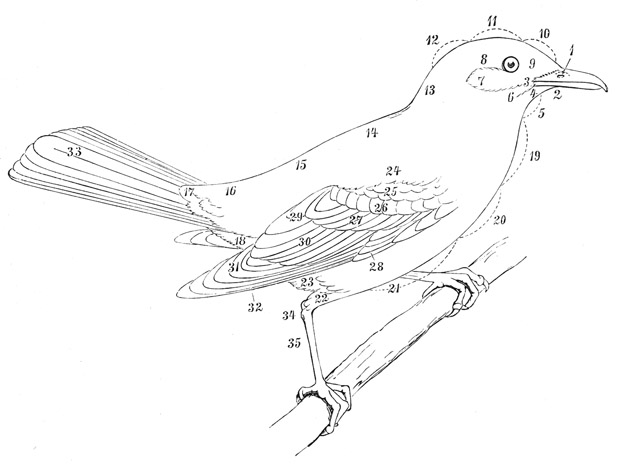
Wissenschaftliche Bezeichnung der hauptsächlichsten Außentheile des Vogelleibes.
1 Nasenlöcher, 2 Kinn, 3 Schnabelspaltwinkel, 4 Backe, 5 Kehle, 6 7 8 9 Unterkiefer-, Ohr-, Schläfen- und Zügelgegend, 10 Stirne, 11 Scheitel, 12 Hinterkopf, 13 Nacken, 14 15 Ober- und Unterrücken, 16 Bürzel, 17 18 Ober- und Unterschwanzdeckfedern, 19 Gurgel, 20 21 Ober- und Unterbrust, 22 Unterschenkel, 23 Bauch, 24 Schulter, 25 26 27 kleine, mittlere und große Oberflügeldeckfedern, 28 Bugfedern, 29 30 31 Achsel-, Arm- und Handschwingen oder Schwungfedern dritter, zweiter und erster Ordnung, 32 After, 33 Steuer- oder Schwanzfedern, 34 Ferse, 35 Lauf.
Für die Bestimmung der Vögel ist es von Wichtigkeit, die übliche Benennung der verschiedenen Federn und aller Theile des Vogelleibes überhaupt genau zu kennen; vorstehende Abbildung mag daher zu allgemeinem Verständnisse dienen.
Keine Klasse hat einen so regen Stoffwechsel, keine andere so warmes Blut wie die der Vögel. Eins geht aus dem anderen hervor: die gesteigerte Athmung ist es, welche den Vögeln ihre erhöhte Thätigkeit und Kraft verleiht. Sie athmen ungleich mehr als andere Thiere; denn die Luft kommt nicht bloß chemisch verbunden, sondern noch unverändert überall in ihrem Leibe zur Geltung und Bedeutung, da, wie bereits bemerkt, nicht allein die Lungen, sondern auch die Luftsäcke, die Knochenhöhlen und Knochenzellen, zuweilen sogar noch besondere Hautzellen mit ihr angefüllt werden. Das Blut wird reichlicher mit Sauerstoff versorgt als bei den übrigen Thieren; der Verbrennungshergang ist beschleunigter und bedeutender, seine reizende Eigenschaft größer, der ganze Kreislauf rascher und schneller: man hat gefunden, daß die Schlag- und Blutadern verhältnismäßig stärker sind, das Blut röther ist und mehr Blutkügelchen als das der übrigen Wirbelthiere enthält. Hiermit steht die unübertroffene Regsamkeit in engster Verbindung, und der durch sie nothwendig bedingte Kräfteverbrauch hat selbstverständlich wiederum lebhaftere Verdauung zur Folge.
Man darf behaupten, daß der Vogel verhältnismäßig mehr verzehrt als jedes andere Geschöpf. Nicht wenige fressen beinahe ebenso lange, als sie wach sind, die Kerfjäger so viel, daß die tägliche Nahrungsmenge an Gewicht ihre eigene Körperschwere zwei- bis dreimal übersteigt. Bei den Fleischfressern gestaltet sich das Verhältnis günstiger; denn sie bedürfen kaum ein Sechstheil ihres Körpergewichts an Nahrung, und alle Pflanzenfresser brauchen wohl nicht mehr als sie; trotzdem würden wir auch sie als Fresser bezeichnen müssen, wenn wir sie mit Säugethieren vergleichen wollten. Die Nahrung wird entweder unmittelbar in den Vormagen oder in den Kropf eingeführt und hier vorverdaut, im Magen aber vollends zersetzt oder förmlich wie zwischen Mahlsteinen zerkleinert. Manche Vögel füllen sich beim Fressen die Speiseröhre bis zum Schlunde mit Nahrung an, andere den Kropf so, daß er kugelig am Halse hervortritt. Raubvögel verdauen noch alte Knochen, größere Körnerfresser verarbeiten sogar verschlungene Eisenstücke derartig, daß ihre frühere Form wesentlich verändert wird. Unverdauliche Stoffe liegen bei einzelnen wochenlang im Magen, bevor sie abgehen, während sie von anderen in zusammengeballten Kugeln, sogenannten Gewöllen, wieder ausgespieen werden. Für alle Vögel, welche zeitweilig Gewölle bilden, ist Aufnahme unverdaulicher Stoffe nothwendige Bedingung zu ihrem Gedeihen: sie verkümmern und gehen nicht selten ein, wenn sie gezwungen werden, auf solche Stoffe gänzlich zu verzichten, leiden auch wohl unter Wucherungen der inneren Magenhaut und werfen diese von Zeit zu Zeit anstatt der Gewölle aus. Trotz des regen Stoffwechsels sammelt sich bei reichlicher Nahrung unter der Haut und zwischen den Eingeweiden sehr viel Fett an; mehrere Hungertage nacheinander verbrennen dasselbe aber auch vollständig wieder. Dennoch ertragen die Vögel Hunger länger als die Säugethiere.
Auch die willkürlichen Bewegungen der Vögel geschehen rascher und sind ausdauernder, ihre Muskeln in der That dichter und fester, reizbarer und ihre Zusammenziehungen kräftiger als bei den übrigen Thieren. Ueber den Flug, die ausgezeichnetste Bewegung, habe ich (Bd. 1, S. 11) schon einige Worte gesagt und möchte an sie erinnern, weil das nachfolgende damit in Verbindung steht. Alle übrigen Thiere, welche fähig sind, sich in der Luft zu bewegen, flattern oder schwirren: die Vögel fliegen. Dies danken sie der Bildung ihrer Fittige. Alle Federn derselben liegen dachziegelartig übereinander und sind gebogen, wodurch der Flügel eine muldenartige Ausbuchtung nach oben erhält. Werden die Schwingen emporgehoben, so lockert sich die Verbindung der einzelnen Schwungfedern, und die Luft kann zwischen den Federn durchstreichen; beim Niederdrücken hingegen schließen sich die Fahnen innig an einander an und setzen der Luft einen bedeutenden Widerstand entgegen: der Vogel muß sich also bei jedem Flügelschlage erheben, und da nun der Flügelschlag von vorn nach hinten und oben nach unten geschieht, findet gleichzeitig Vorwärtsbewegung statt. Der Schwanz dient als Steuer, wird beim Emporsteigen etwas gehoben, beim Herabsteigen niedergebogen, bei Wendungen gedreht. Selbstverständlich ist, daß die Flügelschläge der vollendeten Flieger bald rascher, bald langsamer erfolgen, bald gänzlich unterbrochen werden, daß die Flügel mehr oder weniger gewendet werden, und der vordere Rand demnach bald höher, bald niederer zu stehen kommt, je nachdem der Vogel schneller oder gemächlicher auf- und vorwärts fliegen, schweben oder kreisen will, und ebenso, daß die Fittige eingezogen werden, wenn sich derselbe aus bedeutenden Höhen jäh zum Boden hinabzustürzen beabsichtigt. Die Wölbung der Flügel bedingt auch, daß er zum Fluge Gegenwind bedarf; denn der von vorn kommende Luftzug füllt ihm die Schwingen und hebt ihn, während Rückwind ihm die Federn lockert und die Flügel herabdrückt, die Bewegung überhaupt beeinträchtigt. Die bezügliche Schnelligkeit und die Art und Weise des Fluges selbst steht mit der Gestaltung der Flügel und der Beschaffenheit des Gefieders im innigsten Einklänge. Lange, schmale, scharf zugespitzte, hartfederige Flügel und kurzes Gefieder befähigen zu raschem, kurze, breite, stumpfe Flügel und lockeres Gefieder umgekehrt nur zu langsamem Fluge; ein verhältnismäßig langer und breiter Schwanz macht jähe Wendungen möglich, große, abgerundete und breite Flügel erleichtern längeres Schweben etc. Hinsichtlich der bezüglichen Schnelligkeit des Fluges habe ich bereits gesagt, daß sie die jedes anderen Thieres übertrifft; bezüglich der Ausdauer mag bemerkt sein, daß der Vogel hierin hinter keinem Thiere zurücksteht, daß er für uns unbegreifliches leistet und im Verlaufe weniger Tage viele tausende von Kilometern zurücklegen, binnen wenigen Stunden ein breites Meer überfliegen kann. Zugvögel fliegen tagelang ohne wesentliche Unterbrechung, Schwebevögel spielen stundenlang in der Luft, und nur sehr ungünstige Verhältnisse entkräften einzelne schließlich wirklich. Bewunderungswürdig ist, daß der Vogel in den verschiedensten Höhen, in denen doch die Dichtigkeit der Luft auch verschiedenen Kraftaufwand bedingen muß, anscheinend mit derselben Leichtigkeit fliegt. Als sich Humboldt in der Nähe des Gipfels vom Chimborasso befand, sah er in unermeßbarer Höhe über sich noch einen Kondor schweben, so hoch, daß er nur als kleines Pünktchen erschien; der Vogel flog anscheinend mit derselben Leichtigkeit wie in der Tiefe. Daß dies nicht immer der Fall ist, hat man durch Versuche feststellen können: Tauben, welche Luftfahrer frei ließen, flogen in bedeutenden Höhen weit unsicherer als in tieferen Schichten.
In der Regel sind die guten Flieger zum Gehen mehr oder weniger unfähig; indessen gibt es auch unter ihnen einige, welche sich laufend mit Leichtigkeit bewegen. Der Gang selbst ist vielfach verschieden; es gibt Renner, Traber, Läufer, Springer, Schreiter, Gänger und endlich ungeschickte Watschler oder Rutscher unter den Vögeln. Von dem Gange des Menschen, welcher wie sie auf zwei Füßen einherschreitet, weicht ihr Lauf merklich ab. Mit Ausnahme weniger Schwimmvögel, welche nur rutschend sich bewegen, gehen alle Vögel auf den Zehen, diejenigen, bei denen der Schwerpunkt in die Mitte des Körpers fällt, am besten, wenn auch nicht am raschesten, die hochbeinigen gut, jedoch mit gemessenen Schritten, die kurzbeinigen schlecht, gewöhnlich hüpfend, diejenigen mit mittelhohen Beinen sehr schnell und mehr rennend als laufend. Alle, welche sich steil tragen, bewegen sich schwerfällig und ungeschickt, diejenigen, bei denen die Beine ebenfalls weit hinten am Körper eingelenkt sind, welche aber den Vordertheil desselben herabbiegen, kaum leichter, weil bei ihnen jeder Schritt auch eine merkliche Wendung des Vorderkörpers nothwendig macht. Einige vortreffliche Flieger können gar nicht mehr gehen, einige ausgezeichnete Taucher bloß rutschend und kriechend sich fördern. Bei sehr eiligem Laufe nehmen viele ihre Flügel zu Hülfe.
Nicht wenige Mitglieder der Klasse bewegen sich im Wasser mit Behendigkeit, führen schwimmend die meisten Handlungen aus, fördern sich rudernd auf der Oberfläche weiter und tauchen in dessen Tiefe hinab. Jeder Vogel schwimmt, wenn er auf das Wasser geworfen wird; die Schwimmfähigkeit beschränkt sich auch nicht ausschließlich auf die eigentlichen Schwimmer. Bei diesen, wie bei allen im Wasser lebenden Vögeln überhaupt, stehen die Federn dichter als bei den übrigen, werden auch beständig reichlich eingefettet und sind so vortrefflich geeignet, die Nässe abzuhalten. Der auf der Oberfläche des Wassers fortschwimmende Vogel erhält sich ohne irgend welche Anstrengung in seiner Lage, und jeder Ruderschlag hat bei ihm einzig und allein Fortbewegung des Körpers zur Folge. Zum Schwimmen benutzt er gewöhnlich nur die Füße, welche er zusammengefaltet vorwärts zieht, ausbreitet und dann mit voller Kraft gegen das Wasser drückt, bei ruhigem Schwimmen einen nach dem anderen, bei raschem meist beide zugleich. Um zu steuern, legt er ein Bein mit ausgebreiteten Zehen nach hinten und rudert mit dem zweiten. Mit dem Schwimmen ist oft Tauchfähigkeit verbunden. Einige Vögel schwimmen unter der Oberfläche des Wassers schneller als auf ihr und wetteifern mit den Fischen; andere sind nur dann im Stande zu tauchen, wenn sie sich aus einer gewissen Höhe herab auf das Wasser stürzen. Beide Fähigkeiten sind bedeutsam für die Lebensweise. Diejenigen, welche von der Oberfläche des Wassers aus mit einem mehr oder weniger sichtbaren Sprunge in das Wasser tauchen, werden Schwimm- oder Sprungtaucher, jene, welche sich aus der Luft herab in die Wellen stürzen, Stoßtaucher genannt. Die Schwimmtaucher sind Meister, die Stoßtaucher eigentlich nur Stümper in ihrer Kunst: jene können ohne weiteres in die Tiefe hinab tauchen und längere Zeit in ihr verweilen, diese zwängen sich nur durch die Macht des Stoßes unter die Oberfläche und werden gewiß gegen ihren Willen wieder emporgeschleudert; jene suchen unter Wasser nach Beute, diese sind bestrebt eine bereits erkundete wegzunehmen. Kurze Flügel ermöglichen das Schwimmtauchen, lange sind zum Stoßtauchen unerläßlich, weil hier das Fliegen Hauptsache, das Tauchen Nebensache geworden ist. Nur eine einzige Vogelfamilie, die der Sturmtaucher, vereinigt in gewissem Sinne beide Fertigkeiten. Bei den Schwimmtauchern werden die Füße und der Schwanz gebraucht, bei den Stoßtauchern hauptsächlich die Flügel, bei einzelnen der ersteren, bei den Flossentauchern namentlich, Füße, Schwanz und Flügel. Die Tiefe, bis zu welcher einzelne unter das Wasser tauchen, die Richtung und Schnelligkeit, in welcher sie sich hier bewegen, die Zeit, welche sie unter der Oberfläche zubringen, sind außerordentlich verschieden. Eiderenten sollen, wie schon früher bemerkt wurde, bis sieben Minuten verweilen und, laut Holboell, bis in eine Tiefe von einhundertundzwanzig Meter hinabsteigen können; die Mehrzahl besucht so bedeutende Tiefen sicherlich nicht, erscheint auch schon nach höchstens drei Minuten an der Oberfläche, um Luft zu schöpfen. Einige Vögel, welche nicht zu den Schwimmern zählen, sind nicht bloß fähig, zu schwimmen und zu tauchen, sondern auch auf dem Grunde des Wassers umherzulaufen.
Noch eine Fertigkeit ist den Vögeln eigen: viele von ihnen klettern und zwar ganz vorzüglich. Hierzu benutzen sie vorzugsweise die Füße, nebenbei aber auch den Schnabel und den Schwanz, bedingungsweise sogar die Flügel. Die unvollkommenste Art zu klettern ist die, welche die Papageien ausüben, wenn sie mit dem Schnabel einen höher stehenden Zweig ergreifen, an ihm sich festhalten und den Körper nachziehen, die vollkommenste die, welche wir von den Spechten beobachten können, bei denen nur noch die Füße und der Schwanz in Frage kommen. Einige flattern mehr in die Höhe, als sie klettern, indem sie bei jeder Aufwärtsbewegung die Flügel lüften und wieder anziehen, somit eigentlich emporfliegen und sich dann erst wieder festhängen: in dieser Weise verfährt der Mauerläufer, während die Spechte sich hüpfend vorwärts bewegen, ohne die Flügel merklich zu lüften. Fast alle Kletterer steigen nur von unten nach oben oder auf der oberen Seite der Aeste fort; einzelne aber sind wirklich im Stande, kopfunterst am Stamme herabzulaufen und andere an der unteren Seite der Aeste hinzugehen.
Eine ausgezeichnete Begabung der Vögel bekundet sich in ihrer lauten, vollen und reinen Stimme. Zwar gibt es viele unter ihnen, welche wenig Töne oder bloß unangenehm kreischende und gellende Laute vernehmen lassen; die Mehrzahl aber hat eine ungemein biegsame und klangreiche Stimme: wirklich stumme Vögel kennt man nicht. Die Stimme ermöglicht reichhaltige Sprache und anmuthigen Gesang. Jede eingehendere Beobachtung lehrt, daß die Vögel für verschiedene Empfindungen, Eindrücke und Begriffe besondere Laute ausstoßen, denen man ohne Uebertreibung die Bedeutung von Worten zusprechen darf, da sich die Thiere nicht allein unter sich verständigen, sondern selbst der aufmerksame Beobachter sie verstehen lernt. Sie locken oder rufen, geben ihre Freude und Liebe kund, fordern sich gegenseitig zum Kampfe heraus oder zu Schutz und Trutz auf, warnen vor Feinden und anderweitiger Gefahr und tauschen überhaupt die verschiedensten Mittheilungen aus. Und nicht bloß die Arten unter sich wissen sich zu verständigen, sondern Bevorzugte auch zu minder Begabten zu reden. Auf die Mahnung größerer Sumpfvögel achtet das kleinere Strandgesindel, eine Krähe warnt Staare und anderes Feldgeflügel, auf den Angstruf einer Amsel lauscht der ganze Wald. Besonders vorsichtige Vögel schwingen sich zu Wächtern der Gesammtheit auf, und ihre Aeußerungen werden von anderen wohl beherzigt. Während der Zeit der Liebe unterhalten sich die Vögel, schwatzend und kosend, oft in allerliebster Weise, und ebenso spricht die Mutter zärtlich zu ihren Kindern. Einzelne wirken gemeinschaftlich in regelrechter Weise am Hervorbringen bestimmter Sätze, indem sie sich gegenseitig antworten; andere geben ihren Gefühlen Worte, unbekümmert darum, ob sie Verständnis finden oder nicht. Zu ihnen gehören die Singvögel, die Lieblinge der Schöpfung, wie man sie wohl nennen darf, diejenigen Mitglieder der Klasse, welche dieser unsere volle Liebe erworben haben. So lange es sich um reine Unterhaltung handelt, stehen sich beide Geschlechter in ihrer Sprachfertigkeit ungefähr gleich; der Gesang aber ist eine Bevorzugung des männlichen Geschlechtes, denn höchst selten nur lernt es ein Weibchen, einige Strophen abzusingen. Bei allen eigentlichen Sängern sind die Muskeln am unteren Kehlkopfe im wesentlichen gleichartig entwickelt; ihre Sangesfertigkeit aber ist dennoch höchst verschieden. Jede einzelne Art hat ihre eigenthümlichen Töne und einen gewissen Umfang der Stimme; jede verbindet die Töne in besonderer Weise zu Strophen, welche sich durch größere oder geringere Fülle, Rundung und Stärke der Töne leicht von ähnlichen unterscheiden lassen; das Lied bewegt sich bei einzelnen in wenigen Tönen, während andere Oktaven beherrschen. Werden die Gesangstheile oder Strophen scharf und bestimmt vorgetragen und deutlich abgesetzt, so nennen wir das Lied Schlag, während wir von Gesang reden, wenn die Töne zwar fortwährend wechseln, sich jedoch nicht zu einer Strophe gestalten. Die Nachtigall oder der Edelfink schlagen, die Lerche oder der Stieglitz singen. Jeder Singvogel weiß übrigens Abwechselung in sein Lied zu bringen, und gerade deshalb wirkt es so mächtig auf uns. Auch die Gegend trägt zur Aenderung das ihrige mit bei; denn dieselben Arten singen im Gebirge anders als in der Ebene, wenn sich auch das Wie nur von einem Kenner herausfühlen lassen will. Ein guter Schläger oder Sänger in einer gewissen Gegend kann tüchtige Schüler bilden, ein schlechter aber auch gute verderben: die jüngeren Vögel lernen von den älteren ihrer Art, nehmen aber leider lieber das Mangelhafte als das Vollendetere an. Einzelne begnügen sich nicht mit dem ihnen ursprünglich eigenen Liede, sondern mischen ihm einzelne Töne oder Strophen anderer Vögel oder sogar ihnen auffallende Klänge und Geräusche ein. Sie nennen wir Spottvögel, obwohl wir ihnen mit dieser Bezeichnung Unrecht thun. Singvögel im eigentlichen Sinne des Wortes, also solche, welche nicht bloß die Singmuskeln am unteren Kehlkopfe haben, sondern auch wirklich singen, gibt es in allen Ländern der Erde, jedoch vorzugsweise in denen der gemäßigten Gürtel.
Schon vorhin wurde angedeutet, daß keine Sinnesfähigkeit der Vögel verkümmert ist. Dieser Schluß läßt sich aus der einfachen Betrachtung des Sinneswerkzeuges ziehen, erhält aber doch erst durch Beobachtung seine Bestätigung. Alle Vögel sehen und hören sehr scharf, einzelne besitzen ziemlich feinen Geruch, andere, wenn auch beschränkten Geschmack und alle wiederum feines Gefühl, wenigstens soweit es sich um das Empfindungsvermögen handelt. Die leichte, äußere und innere Beweglichkeit des Auges gestattet dem Vogel, ein sehr weites Gesichtsfeld zu beherrschen und innerhalb desselben einen Gegenstand mit für uns überraschender Schärfe wahrzunehmen. Raubvögel unterscheiden kleine Säugethiere, Kerfjäger fliegende oder sitzende Kerbthiere auf erstaunliche Entfernung. Ihr Auge bewegt sich fortwährend, weil der Brennpunkt für jede Entfernung besonders eingestellt werden muß. Hiervon kann man sich durch einen einfachen Versuch überzeugen. Nähert man die Hand dem Auge eines Raubvogels, beispielsweise dem eines Königsgeiers, dessen lichtfarbige Regenbogenhaut die Beobachtung erleichtert, und merkt man auf die Größe des Sternes, so wird man sehen müssen, daß diese sich beständig in demselben Maße verengert und erweitert, als man die Hand entfernt oder nähert. Nur hierdurch wird es erklärlich, daß diese Vögel, wenn sie hunderte von Metern über dem Erdboden schweben, kleinere Gegenstände wahrnehmen und auch in der Nähe sehr scharf sehen können. Von dem vortrefflichen Gehöre der Vögel gibt schon ihr Gesang uns Kunde, da dieser erst eingelernt werden muß. Wir können uns von seiner Schärfe durch unmittelbare Beobachtung überzeugen. Scheue Vögel werden oft nur durch das Gehör auf eine Gefahr aufmerksam gemacht; gewöhnte Hausvögel achten auf den leisesten Anruf. Daß die großöhrigen Eulen bei ihrer Jagd das Gehör ebensowohl benutzen werden wie das Gesicht, läßt sich mit Bestimmtheit annehmen, wenn schon bis jetzt noch nicht beweisen; doch stehen auch sie den feinhörigen Säugethieren wahrscheinlich noch nach: es liegen wenigstens keine Beobachtungen vor, welche uns glauben machen können, daß irgend ein Vogel ebenso fein hört wie eine Fledermaus, eine Katze oder ein Wiederkäuer. Ueber den Geruchsinn herrschen noch heutigen Tages sehr verschiedene Meinungen, weil man sich in entschiedenen Fabeleien gefallen hat. Daß der Rabe das Pulver im Gewehre rieche, ist heutigen Tages noch bei vielen Jägern eine ausgemachte Sache; daß der Geier auf viele Kilometer hin Aasgeruch wahrnehme, wird selbst noch von manchem Forscher geglaubt: daß ersteres nicht der Fall, braucht nicht erwähnt zu werden, daß letzteres unrichtig, kann ich, auf vielfache Beobachtungen gestützt, mit Entschiedenheit behaupten. Ein gewisses Maß von Geruch ist gewiß nicht zu leugnen: dies beweisen uns alle Vögel, mit denen wir hierauf bezügliche Beobachtungen anstellen; von einer Witterung aber, wie wir sie bei Säugethieren wahrnehmen, kann unter ihnen gewiß nicht die Rede sein. Auch der Geschmack der Vögel steht dem der Säugethiere unzweifelhaft nach. Wir bemerken zwar, daß jene gewisse Nahrungsstoffe anderen vorziehen, und schließen daraus, daß es geschehe, weil die gedachten Stoffe für sie einen höheren Wohlgeschmack haben als andere; wenn wir uns aber erinnern, daß die Bissen gewöhnlich unzerstückelt verschlungen werden, erleidet eine etwaige Schlußfolgerung aus jener Wahrnahme doch eine wesentliche Beeinträchtigung. Die Zunge ist wohl eher Werkzeug der Empfindung als solches des Geschmackes: sie dient mehr zum Tasten als zum Schmecken. Bei nicht wenigen Vögeln hat gerade der Tastsinn in der Zunge seinen bevorzugten Sitz: alle Spechte, alle Kolibris, alle Zähnschnäbler untersuchen mit ihrer Hülfe die Schlupfwinkel ihrer Beute und scheiden diese durch sie von ungenießbaren Stoffen ab. Nächst ihr wird hauptsächlich der Schnabel zum Tasten gebraucht, so z. B. von den Schnepfen und Zahnschnäblern. Der Fuß kommt kaum in Betracht. Der Sinn des Gefühls durch das Empfindungsvermögen scheint allgemein vorhanden und sehr ausgebildet zu sein: alle Vögel bekunden die größte Empfindlichkeit gegen Einwirkungen von außen, gegen Einflüsse der Witterung sowohl als gegen Berührung.
Rücksichtlich der Fähigkeiten des Gehirns, welche wir Verstand nennen, sowie hinsichtlich des Wesens der Vögel gilt meiner Ansicht nach alles, was ich oben bezüglich der Säugethiere sagte; ich wüßte wenigstens keine Geistesfähigkeit, keinen Charakterzug der letzteren anzugeben, welcher bei den Vögeln nicht ebenfalls bemerklich würde. Man hat lange Zeit das Gegentheil einer solchen Anschauung festgehalten und namentlich dem sogenannten Naturtriebe oder »Instinkte« Beeinflussung des Vogels zuschreiben wollen, thut dies wohl auch heutigen Tages noch, gewiß aber nur deshalb, weil man entweder nicht beobachtet oder sich die Beobachtungen anderer nicht klar gemacht hat. »Man darf«, so habe ich bereits im »Leben der Vögel« gesagt, »bei allen derartigen Fragen nicht vergessen, daß unsere Erklärungen von gewissen Vorgängen im Thierleben kaum mehr als Annahmen sind. Wir verstehen das Thier und sein Wesen im günstigsten Falle nur zum Theil. Von seinen Gedanken und Schlußfolgerungen gewinnen wir zuweilen eine Vorstellung: inwieweit dieselbe aber richtig ist, wissen wir nicht.« Manches freilich erscheint uns noch räthselhaft und unerklärlich. Dahin gehören Vorkehrungen, welche Vögel scheinbar in Voraussicht kommender Ereignisse treffen, ihr Aufbruch zur Wanderung, noch ehe der Mangel an Nahrung, welchen der Winter bringt, eingetreten, Abweichungen von der sonst gewöhnlichen Art des Nestbaues oder die Fortpflanzung überhaupt, welche sich später als zweckmäßig beweisen; hierher gehören auch, obschon mit wesentlicher Beschränkung, unsere Wahrnehmung bezüglich des sogenannten Kunsttriebes, und anderes mehr. Viel richtiger als das Bestreben, solche noch unaufgeklärte Thatsachen einseitig erklären zu wollen, würde sein, unsere einstweilige Unkenntnis rückhaltslos einzugestehen. Weitere Forschungen werden uns die Erklärungen dieser scheinbaren Wunder gewähren, Leugnung dieser Wunder wenigstens zu weiterem Forschen anspornen. Es ist bequem, des Menschengeistes aber unwürdig, da, wo das Verständnis aufhört, dem Wunderglauben irgend welches Recht einzuräumen; denn sowie wir von Uebernatürlichkeit zu faseln beginnen, verlieren wir eben die Natur aus den Augen. Wer den Vögeln Verstand und zwar sehr ausgebildeten, umfangreichen Verstand absprechen will, kennt sie nicht oder will sie nicht kennen, weil er dem Menschen die unhaltbare Stellung der Halbgöttlichkeit zu retten hofft. Er vergißt die Bildungsfähigkeit der Vögel, vergißt, daß man sie abrichten, zum Aus- und Einfliegen gewöhnen, sprechen oder meinetwegen Worte nachplaudern lehren, also etwas thun oder lassen kann, welches mit der Annahme einer von außen her wirkenden, unbegreiflichen, also auch undenkbaren Kraft vollständig im Widerspruche steht, weil jeder Mensch, welcher sich mit Erziehung eines Vogels abgibt, dadurch die unbekannte Macht, welche letzteren unbewußt leitet, beeinträchtigen würde.
Die Vögel sind Weltbürger. So weit man die Erde kennt, hat man sie gefunden: auf den Eilanden um beide Pole wie unter dem Gleicher, auf dem Meere wie auf oder über den höchsten Spitzen der Gebirge, im fruchtbaren Lande wie in der Wüste, im Urwalde wie auf den kahlen Felskegeln, welche sich unmittelbar am Meere erheben. Jeder einzelne Gürtel der Erde beherbergt seine besonderen Bewohner. Im allgemeinen gehorchen auch die Vögel den Gesetzen der thierischen Verbreitung, indem sie in den kalten Gürteln zwar in ungeheuerer Anzahl, aber in nur wenigen Arten auftreten und mehr nach dem Gleicher hin stetig an Mannigfaltigkeit und Vielartigkeit zunehmen. Das ausgleichende Wasser übt seinen Einfluß auch auf sie aus: es besitzt und erhält verhältnismäßig wenige und sich im wesentlichen ähnelnde Arten, während das Land seinen vielfachen Wechsel auch in der Vogelwelt wiederspiegelt. Denn nicht bloß in jedem Gürtel, sondern auch in jeder Oertlichkeit treten gewisse Vögel auf, in der nordischen Tundra, der Wüste des Wassers, andere als in der Wüste des Sandes, in der Ebene andere als im Gebirge, im baumlosen Gebiete andere als im Walde. Als Ergebnisse und Erzeugnisse der Bodenbeschaffenheit und des Klimas müssen die Vögel in ebendemselben Grade abändern wie ihre Heimat selbst. Auf dem Wasser ist der Verbreitungskreis der einzelnen Arten größer als auf dem Lande, wo schon ein breiter Strom, ein Meerestheil, ein Gebirge zur Grenze werden kann: aber Grenzen gibt es auch auf dem Meere. Nur äußerst wenige Vögel bewohnen buchstäblich alle Theile der Erde, so viel bis jetzt bekannt, nur ein einziger Landvogel und einige Sumpf- und Wasservögel; Weltbürger ist z. B. die Sumpf- oder Kurzohreule, welche in allen fünf Erdtheilen gefunden wurde, Weltbürger ebenso der Steinwälzer, welcher an den Küsten aller fünf Erdtheile und auf der westlichen wie auf der östlichen Halbkugel vorkommt und vorkommen kann, weil er überall auf der ganzen Erde die gleichen Lebensbedingungen vorfindet. In der Regel erstreckt sich der Verbreitungskreis weiter in der Richtung der Längengrade als in jener der Breitengrade: im Norden der Erde leben viele Vögel, welche in allen drei Erdtheilen mehr oder weniger in gleicher Anzahl gefunden werden, während einige hundert Kilometer vom Norden nach Süden hin schon eine große Veränderung bewirken können. Die Bewegungsfähigkeit des Vogels steht mit der Größe des Verbreitungskreises nicht im Einklange: sehr gute Flieger können auf einen verhältnismäßig geringen Umkreis beschränkt sein, minder gute sich viel weiter verbreiten als jene. Auch die regelmäßigen Reisen, der Zug und die Wanderung der Vögel, tragen, wie wir später sehen werden, zur Ausdehnung gewisser Verbreitungskreise nicht bei.
Sclaters Vorgange folgend, theilt man ziemlich allgemein die Erde in sechs thierkundliche Gebiete ein. In dem ersten derselben, dem nördlich altweltlichen Gebiete, welches Europa, Nordafrika und Nordasien bis zum dreißigsten Breitengrade umfaßt, leben, nach Sclaters Aufstellung, ungefähr sechshundertundfunfzig Vogelarten, unter denen, als für das Gebiet bezeichnend, nur die Nachtigallen, Grasmücken, Rothschwänze, der Flüevogel, die Laufwürger, Alpenraben, Heher, Ammer, Kernbeißer und Rauchfußhühner besonders hervorgehoben zu werden verdienen. In diesem weiten Gebiete finden sich also nur sehr wenige Vogelgruppen, welche in anderen nicht weit vollständiger entwickelt wären. Es ist das ärmste von allen, und weist nur eine einzige Vogelart auf je dreizehnhundert geographischen Geviertmeilen auf.
Das äthiopische Gebiet, welches Afrika südlich von der Sahara nebst der im Südosten des Erdtheils gelegenen Inselwelt, Madagaskar, Mauritius und Bourbon, ebenso auch Südarabien in sich begreift, beherbergt mehrere, ihm eigenthümliche Familien, z. B. die Mäusevögel, Pisangfresser und Madenhacker, und ist reich an bezeichnenden Arten. Hier leben die Grau- und Zwergpapageien, die Honiganzeiger, der Kern der Webefinken, die Sand- und Läuferlerchen, Sporenpieper, fast alle Glanzdrosseln, die Baumhopfe, der Kranichgeier, Gaukler, die Singhabichte, Perlhühner, der Strauß, Schuhschnabel, Schattenvogel, die Königskraniche und andere.
Als in hohem Grade eigenartig stellt sich Madagaskar dar. Obwohl dem äthiopischen Gebiete angehörig und nur ein Theil desselben, besitzt es doch eine so ausschließlich eigenthümliche Thierwelt, dgß man es, wollte man einzig und allein sie berücksichtigen, als besonderes Festland erklären müßte. Merkwürdigerweise steht diese Thierwelt der asiatischen näher als der afrikanischen und verleiht der Annahme, daß in der Vorzeit ein großes Festland zwischen Afrika und Indien über das Meer sich erhoben habe, eine gewisse Berechtigung. Denn, wenn es wirklich jemals ein »Lemurien« gegeben hat und dieses Festland im Meere versunken ist, kann man nur Madagaskar und die zu ihm gehörigen Inselgruppen, namentlich die Maskarenen, Seschellen und Amiranten, als die noch übrig gebliebenen Theile desselben ansehen: »die letzten Zufluchtsstätten einer ringsum erloschenen thierischen Bevölkerung lemurischen Gepräges«, wie Hartlaub sich ausdrückt. Keine einzige aller für Afrika bezeichnenden Vogelsippen wiederholt sich auf Madagaskar, und deshalb erscheint es fast gerechtfertigt, thierkundlich diesem merkwürdigen Eilande den Rang eines eigenen Gebietes zuzusprechen. Nicht weniger als vier Familien der Vögel werden ausschließlich auf Madagaskar und den zugehörigen Eilanden gefunden. Außerdem sind Afrika gegenüber Papageien, Tagraubvögel, Kukuke, Honigvögel, Tauben, Sumpf- und Schwimmvögel besonders zahlreich, Finken, Bienenfresser und Staare ungemein schwach, die Familien der Raben, Würger, Drosseln, Schwalbenwürger, Fliegenfänger und Droßlinge endlich durch eigenthümlich veränderte Mitglieder vertreten. Die Artenzahl aller Vögel des äthiopischen Gebietes schätzt Sclater auf zwölfhundertundfunfzig, so daß also auf je dreihundertundfunfzig geographische Geviertmeilen eine Art zu rechnen ist; die Artenzahl Madagaskars beträgt, nach Hartlaub, zweihundertundzwanzig, und von ihnen sind mindestens einhundertundvier der Insel eigenthümlich.
Als drittes Gebiet betrachten wir mit Sclater das indische, welches ganz Asien südlich vom Himalaya, also Indien, Ceylon, Birma, Malakka, Südchina, die Sundainseln, Philippinen und anliegenden Eilande in sich schließt. Bezeichnende Arten dieser von Vögeln reich bevölkerten Länder sind die Edelsittiche, Nachtspinte, Rachenvögel, Hornschwalme, Salanganen und Baumsegler, Zwergedelfalken und Wassereulen, Hirtenstaare und Atzeln, Prachtkrähen, Schweif-, Lappen- und Stummelheher, Lachdrosseln, Mennigvögel, Rubinnachtigallen, Schneidervögel, Wald- und Schwalbenstelzen, Pfauen, Pracht-, Kamm- und Fasanenhühner, Horn- und Argusfasanen, Buschwachteln und andere mehr. Schlägt man die Anzahl der diesem Gebiete eigenen Vogelarten zu funfzehnhundert an, so ergibt sich, daß hier auf je hundertundvierzig geographische Geviertmeilen eine Vogelart kommt, und es erweist sich somit das indische Gebiet als das verhältnismäßig reichste von allen.
Unter dem oceanischen Gebiete verstehen wir Australien, Neuguinea und die übrigen papuanischen Eilande, Tasmanien, Neuseeland und alle Inseln des Stillen Weltmeeres. Die Vogelwelt dieser Länder ist als verhältnismäßig reiche und sehr eigenartige zu bezeichnen. Dem Festlande Neuholland und Vandiemensland gehören an: die Kakadus, Breitschwanz- und Erdsittiche, Fratzenkukuke, Eulen- und Zwergschwalme, Dickkopf- und Krähenwürger, Pfeifkrähen und Pfeifatzeln, Leierschwänze, Panther-, Kragen- und Atlasvögel, Graulinge, Emu und Kasuare, die Talagalahühner, Trappenwachteln, Hühnergänse und andere mehr; auf den Papuainseln leben die Loris, Zwergkakadus, Paradiesvögel im weitesten Sinne, Krontauben und andere; Neuseeland zeichnet sich aus durch die Nestor- und Nachtpapageien, Lappenstaare, Schnepfenstrauße etc.; die oceanischen Inseln endlich beherbergen eigenartige Papageien, Tauben, Finken und verschiedene Pinselzüngler. Nimmt man die Artenzahl des ganzen Gebietes zu tausend an, so kommt eine Art auf je einhundertundachtzig geographische Geviertmeilen.
Nicht viel reicher als das nördlich altweltliche, ist das nördlich neuweltliche Gebiet oder Nordamerika, von der Landenge von Panama an bis zum Eismeere. Bezeichnende Vögel dieses Gebietes sind: Blausänger, Sichelspötter, Laubwürger, Steppen-, Ammer- und Uferfinken, Baumheher, Truthühner und andere. Die Artenzahl wird auf sechshundertundsechzig geschätzt, so daß also auf je fünfhundertundsechzig geographische Geviertmeilen eine Art gerechnet werden darf.
Das südamerikanische Gebiet endlich steht, was die Anzahl der in ihm lebenden Vogelarten anlangt, unter allen oben an, übertrifft auch an Eigenartigkeit der Formen jedes andere und bleibt nur in dem verhältnismäßigen Reichthume seiner Vogelwelt hinter dem indischen Gebiete um etwas zurück. Sclater schätzt die Artenzahl der in ihm hausenden Vögel auf zweitausendzweihundertundfunfzig, [Brehm schreibt durchgängig "funfzig", "funfzehn", aber "fünf", "fünfhundert" E. für Gutenberg] und es ergibt sich hieraus, daß eine Vogelart auf je einhundertundsiebzig geographische Geviertmeilen kommt. Mindestens acht oder neun, meist sippen- oder artenreiche Familien treten ausschließlich in diesem Gebiete auf; eine ganze Ordnung, die der Schwirrvögel, ist vorzugsweise hier heimisch: denn nur sehr wenige ihrer ungewöhnlich zahlreichen Arten gehören dem Norden der Westhälfte unserer Erde an, und man ist daher berechtigt, besagte Ordnung eine südamerikanische zu nennen. An bezeichnenden Arten ist das Gebiet besonders reich. Im Süden Amerikas herbergen: die Araras, Keilschwanzsittiche, Grünpapageien, Pfefferfresser, Maden-, Fersen-, Lauf- und Bartkukuke, Glanzvögel, Sägeraken, Plattschnäbler, Schwalke, Zahnhabichte, Sperber- und Mordadler, Schwebe-, Bussard- und Falkenweihen, Haken- und Fersenbussarde, Geierfalken, Kamm-, Königs- und Rabengeier, die Tyrannen, Schmuck- und Kropfvögel, Ameisendrosseln, Baumsteiger, Töpfervögel, Weichschwanzspechte, Baum-, Hoko-, Schaku- und Steißhühner, Nandus, Sonnenreiher, Feldstörche, Wehrvögel, verschiedene Schwimmvögel und andere mehr.
Aus vorstehendem ergibt sich, daß auf der Osthälfte der Erde ungefähr viertausendunddreihundert, auf der Westhälfte etwa dreitausend Vögel leben. Diese Zahlen sind jedoch nur annäherungsweise richtig, stimmen auch mit den Schätzungen anderer Vogelkundigen keineswegs überein. Gray führt 1871 nicht weniger als elftausendeinhundertzweiundsechzig, Wallace 1876 zehntausendzweihundert Arten auf, weder der eine, noch der andere aber vermag für die Richtigkeit seiner Angaben einzustehen. Wahrscheinlich schätzen wir noch immer hoch, wenn wir die Anzahl der bis jetzt wirklich bekannten Vogelarten zu neuntausend annehmen.
Der Aufenthalt der Vögel ist höchst verschieden. Sie besiedeln alle Orte, welche ihnen die Möglichkeit zum Leben gewähren. Von dem Meere an steigen die im Wasser hausenden Vögel bis hoch in das Gebirge empor, und mehr als sie noch erheben sich die Stelzvögel, aus dem einfachen Grunde, weil sie weniger als jene an das Wasser gebunden sind. Das trockene Land besitzt ebenso überall seine ständigen Bewohner: selbst inmitten der Wüste, auf Sandflächen, welche unserer Meinung nach kaum ein Geschöpf ernähren können, finden sie noch ihr tägliches Brod. Doch ist die größere Menge, wenn nicht unmittelbar, so doch mittelbar, ebenso an Pflanzen gebunden wie die Säugethiere. Erst im Walde entfaltet unsere Klasse ihren vollen Reichthum und ihre Mannigfaltigkeit. Das Meer ernährt Millionen von Einzelwesen derselben Art, und die Brutzeit versammelt sie auf einzelnen Felswänden, Inseln, Schären; wie zahlreich aber auch die Gesellschaft sein möge: auf dem Lande und selbst im Walde gibt es Schwärme von ähnlicher Stärke, und während, dort die Einförmigkeit vorherrscht, bekundet sich hier nebenbei Verschiedenartigkeit. Je mehr man sich dem Gleicher nähert, um so artenreicher zeigt sich die Klasse der Vögel, weil in den Wendekreisländern das Land selbst wechselvoller ist als irgendwo anders und mit dieser Vielseitigkeit der Erde eine Vermehrung verschiedener Lebensbedingungen im Einklange stehen muß. Dem entspricht, daß es nicht die großen Waldungen sind, welche die größte Mannigfaltigkeit zeigen, sondern vielmehr Gegenden, in denen Wald und Steppe, Berg und Thal, trockenes Land und Sumpf und Wasser miteinander abwechseln. Ein durch Wälder fließender Strom, ein von Bäumen umgebener Sumpf, ein überschwemmter Waldestheil versammelt stets mehr Vogelarten, als man sonst zusammen sieht, weil da, wo die Erzeugnisse des Wassers und des Landes sich vereinigen, nothwendigerweise auch ein größerer Reichthum an Nahrungsmitteln vorhanden sein wird als da, wo das eine oder das andere Gebiet vorherrscht. Die größere oder geringere Leichtigkeit, sich zu ernähren, bindet die Vögel, wie alle übrigen Geschöpfe, an eine gewisse Stelle.
Die Vögel verstehen es meisterhaft, ein bestimmtes Gebiet auszubeuten. Sie durchspähen jeden Schlupfwinkel, jede Ritze, jedes Versteck der Thiere und lesen alles Genießbare auf. Wenn man die Art und Weise der Ernährung in Betracht zieht, kann man auch bei ihnen von Beruf oder Handwerk reden. Einzelne, wie viele Körnerfresser und die Tauben, nehmen offen zu Tage liegende Nahrungsmittel einfach auf; andere Körnerfresser ziehen Sämereien aus Hülsen heraus, die Hühner legen sie, Wurzeln, Knollen und ähnliche Stoffe durch Scharren bloß. Die Fruchtfresser pflücken Beeren oder Früchte mit dem Schnabel ab, einzelne von ihnen, indem sie sich fliegend auf die erspähte Nahrung stürzen. Die Kerbthierfresser lesen ihre Beute in allen Lebenszuständen derselben vom Boden ab, nehmen sie von Zweigen und Blättern weg, ziehen sie aus Blüten, Spalten und Ritzen hervor, legen sie oft erst nach längerer und harter Arbeit bloß oder verfolgen sie mit der Zunge bis in das Innerste ihrer Schlupfwinkel. Die Raben betreiben alle diese Gewerbe gemeinschaftlich, pfuschen aber auch schon den echten Räubern ins Handwerk. Unter diesen beutet jeder einzelne seinen Nahrungszweig selbständig aus. Es gibt unter ihnen Bettler oder Schmarotzer, Gassenkehrer und Abfallsammler, solche, welche nur Aas, andere, welche hauptsächlich Knochen fressen, viele, welche Aas nicht verschmähen, nebenbei jedoch auch schon auf lebende Thiere jagen; es gibt unter ihnen einzelne, welche hauptsächlich größeren Kerfen nachstreben und höchstens ein kleines Wirbelthier anfallen, andere, deren Jagd bloß diesen gilt; es gibt Raubvögel, welche nur auf sitzendes oder laufendes, andere, welche bloß auf fliegendes Wild stoßen, einzelne, welche die verschiedenartigsten Gewerbe betreiben. Unter den Sumpf- und Wasservögeln ist es ähnlich. Viele von ihnen lesen das auf, was sich offen findet, andere durchsuchen Versteckplätze der Thiere; einige fressen pflanzliche und thierische Stoffe, andere letztere ausschließlich; diese seihen sich aus flüssigem Schlamme ihre Nahrung ab, jene holen sie tauchend aus bedeutenden Tiefen empor; die einen suchen ihre Beute unter dem Wasser, die anderen stürzen sich auf bereits erspähte von oben herab. Es gibt keine Gegend, kein einziges Plätzchen auf der ganzen Erde, welches von ihnen nicht ausgebeutet würde. Ein jeder versucht seine Ausrüstung in der besten Weise zu verwerthen, jeder sich schlecht und recht durch das Leben zu schlagen. Die Ausrüstung, also die Gestaltung und Bewaffnung des Vogels ist es, welche das Gewerbe oder den Beruf bestimmt.
Der Vogel lebt eine kurze Kindheit, aber eine lange Jugendzeit, wenn auch nicht gerade im Verhältnisse zu dem Alter, welches er erreicht. Allerdings ist sein Wachsthum rasch beendet und er schon wenige Wochen nach dem Eintritte in die Welt befähigt, deren Treiben und Drängen, Fordern und Anstürmen die Brust zu bieten; aber eine lange Zeit muß vergangen sein, ehe er seinen Eltern gleich da steht. Er entwickelt sich, wie wir alle wissen, aus dem Eie, und zwar durch die Wärme, welche die brütenden Eltern oder die brütende Mutter, gährende Pflanzenstoffe oder die Sonne diesem spenden. Nach der Befruchtung tritt eines der Dotterkörperchen, welche am Eierstocke hängen, aus der Mitte der übrigen heraus, nimmt aus dem Blute alle dem Dotter zukommende Stoffe auf, wird dadurch selbst zum Dotter und wächst bis zu dessen Größe heran, trennt sich sodann und gelangt nun in den Eileiter, welcher während der Legezeit eine erhöhte Thätigkeit bekundet, namentlich das Eiweiß absondert. Beide, Dotter und Eiweiß, werden durch Zusammenziehungen des Eileiters vorwärts bewegt, gelangen in die untere Erweiterung desselben oder in die sogenannte Gebärmutter, nehmen hier die Eigestalt an und erhalten die Eischalenhaut und die Kalkschale. Letztere, welche anfangs weichbreiig und kleberig ist, erhärtet rasch und vollendet den Aufbau des Eies. Durch Zusammenziehung der Muskelfasern der Gebärmutter wird letzteres, mit dem stumpfen Ende voran, gegen die Mündung der Scheide, in diese und die Kloake bewegt, hier wahrscheinlich gefärbt und sodann durch den After ausgestoßen. Größe und Gestalt des Eies, welche wohl durch den Bau der Gebärmutter bedingt werden, sind sehr verschieden. Erstere ist in der Regel dem Umfange des Körpers der Mutter insofern angemessen, als das Ei einen gewissen Gewichtstheil des Körpers beträgt, schwankt aber erheblich; denn es gibt Vögel, welche verhältnismäßig sehr große, andere, welche verhältnismäßig sehr kleine Eier legen. Die Gestalt weicht von der des Hühnereies gewöhnlich nicht auffällig ab, geht jedoch bei einzelnen mehr ins kreisel- oder birnenförmige, bei anderen mehr ins walzige über. Ueber die Färbung der Eier läßt sich im allgemeinen wenig, nur ungefähr so viel sagen, daß diejenigen Eier, welche in Höhlungen gelegt werden, meist weiß oder doch einfarbig, die, welche in offene Nester zu liegen kommen, getüpfelt sind. Die Anzahl der Eier, welche ein Vogel legt, schwankt von eins bis vierundzwanzig; Gelege von vier bis sechs Eiern dürften am häufigsten vorkommen.
Sobald das Weibchen die gehörige Anzahl von Eiern gelegt hat, beginnt das Brüten. Die Mutter bleibt auf dem Neste sitzen, angespornt durch einen gleichsam fieberhaften Zustand, und spendet nun, entweder allein oder abwechselnd mit ihrem Gatten, dem im Eie eingebetteten Keime die Wärme ihrer Brust, macht sich auch wohl zeitweilig die Sonnenstrahlen oder die durch Gährung faulender Pflanzenstoffe sich erzeugende Wärme nutzbar. Je nach der Witterung werden die Eier früher oder später gezeitigt; die Zeitschwankungen sind jedoch bei den einzelnen Arten nicht besonders erheblich. Anders verhält es sich, wie zu erwarten, rücksichtlich der Brutdauer bei den verschiedenen Arten: ein Strauß brütet selbstverständlich länger als ein Kolibri, jener fünfundfunfzig bis sechzig, dieser zehn bis zwölf Tage. Achtzehn bis sechsundzwanzig Tage mögen als eine mittlere Zeit angesehen werden.
Zur Bildung und Entwickelung des Keimes im Eie ist eine Wärme von dreißig bis zweiunddreißig Grad Reaumur Bedingung. Sie braucht nicht von der Brust des mütterlichen Vogels auszustrahlen, sondern kann, mit gewissen Beschränkungen, beliebig ersetzt werden. Plinius erzählt, daß Julia Augusta, des Tiberius Gemahlin, in ihrem Busen Eier ausgebrütet habe, und die alten Egypter wußten bereits vor tausenden von Jahren, daß man die brütende Henne durch künstlich erzeugte, gleichmäßig unterhaltene Wärme ersetzen könne. Dreißig Grad Wärme einundzwanzig Tage lang gleichmäßig unterhalten und in geeigneter Weise zur Einwirkung auf ein befruchtetes Hühnerei gebracht, liefern fast unfehlbar ein Küchlein. Stoffwechsel, insbesondere Zutritt der Luft, ist zur Ausbildung des Keimes unerläßliche Bedingung: ein Ei, welches keinen Sauerstoff aufnehmen kann, geht stets zu Grunde.
Die Einwirkung der Wärme ist schon nach wenigen Stunden ersichtlich. Zwölf Stunden nach Beginn der Bebrütung eines Haushuhneies wird die Narbe oder der Hahnentritt länglicher; die ihn umgebenden weißlichen Ringe vergrößern sich und nehmen an Anzahl zu. Am zweiten Tage macht sich hier nach außen ein kleiner Vorsprung bemerklich; in der dreißigsten Stunde sieht man in der blasenförmigen Höhlung desselben, welche mit einer hellen Flüssigkeit angefüllt ist, einen trüben, wolkigen Körper von länglicher Gestalt, welcher aus zarter Gallerte besteht. Gegen Ende des Zweiten Tages zeigen sich die ersten Spuren von Blut als röthliche Punkte, Streifen und Linien, welche nach und nach zusammenfließen und ein Netz bilden. Dieses, die Anlage der Gefäße, wird am dritten Tage deutlicher, verbindet sich erst zu Aesten und bildet schließlich einen Mittelpunkt, das Herz, in Form einer zusammengeschlängelten Röhre mit drei Erweiterungen. Bald nach seiner Vollendung beginnt es sich auszudehnen und zusammenzuziehen: das Leben ist nicht bloß erwacht, sondern auch sichtbar geworden. Aus drei durchsichtigen Bläschen, unter denen man einen ganz farblosen, aber hervorstehenden Punkt bemerkt, baut sich der Kopf aus; jene Punkte sind die Augen. Von dem einen Bläschen zieht sich ein Streifen abwärts, welcher aus paarweise aneinander liegenden Bläschen besteht: aus ihm wird die Wirbelsäule hervorgehen. Zwei hervorspringende Platten am unteren Ende derselben bezeichnen den Umkreis des Unterleibes; Spuren des Gekröses, des Magens und der Gedärme zeigen sich bereits. Am vierten Tage hat der Dotter sich vergrößert, aber gelichtet und verdünnt, das Eiweiß dagegen abgenommen; der Gefäßraum ist größer geworden, und die Gefäße haben sich gemehrt; die Scheidung derselben in Schlag- und Blutadern bereitet sich vor; der Keim hat sich gekrümmt und berührt mit dem Kopfe das Schwanzende; das Herz hat sich deutlicher gebildet: man sieht Gefäße des Hirns, Spuren der Kiefer, Ansätze zu Flügeln und Füßen und eine grauröthliche, gallertartige Masse, welche sich zur Leber gestalten wird. Am fünften Tage haben sich Herz, Gefäße und Eingeweide weiter ausgebildet; die Brust ist von dem vom Rückgrate ausgehenden Wulste und den Flügeln fast bedeckt; am Ende des Tages werden die Lungenanfänge bemerklich. Das Herz ist mit einem durchsichtigen Beutel umgeben, das Rückenmark deutlich sichtbar geworden. Mit dem sechsten Tage hat sich die Eihaut zu zwei ineinander geschlossenen Blasen ausgebildet, von denen die äußere die Lederhaut, die innere, den Keim umgebende, die Schafhaut genannt wird; am Unterleibe des Keimes bemerkt man einen Sack, welcher sich nun durch Beimischen des Eiweißes vergrößert und Gefäße in den Leib des Küchelchens sendet. Die einzelnen Theile des Leibes entwickeln sich bestimmter und gliedern sich; der Keim selbst zeigt am Ende des Tages zuweilen eine Art von Bewegung. Am siebenten Tage schwimmt er in der Flüssigkeit der Schafhaut, ist fast zwei Centimeter lang geworden, sein Kopf beinahe so groß wie der Leib; im Gehirne, welches als eine schleimige, weichliche Masse erscheint, lassen sich bereits einzelne Theile unterscheiden, am Rückgrate Spuren der beginnenden Verknorpelung bemerken, die Rippenanfänge als weißliche Streifen wahrnehmen, Speiseröhre, Kropf und Magen deutlicher sehen, Gallenblase und Milz wenigstens erkennen. Am achten Tage hat sich der Keim wieder vergrößert, der Ansatz zum Brustbeine gebildet; weißliche Streifen um die Knochenanfänge geben sich kund als die werdenden Muskeln. Der neunte Tag läßt einen kleinen Vorsprung an dem sehr großen Kopfe, den Oberschnabel, durchsichtige Augenlider auf den sehr großen Augen, das im Herzbeutel eingeschlossene, schon ausgebildete, zwölfmal in einer Minute schlagende reizbare Herz, das fester gewordene Hirn und den Beginn der Knorpelverhärtung ersichtlich werden. An den beiden folgenden Tagen, dem zehnten und elften, wächst der Keim bis zu einer Länge von vier Centimeter heran; der Kopf wird verhältnismäßig kleiner, liegt zwischen den Füßen und ist fast mit den Flügeln bedeckt; die Gallenblase hat sich gefüllt; die gefäßreiche Haut zeigt Erhabenheiten, aus welchen Federn hervorbrechen. An den beiden folgenden Tagen bewegt sich der über fünf Centimeter lange Keim schon stark; aus der Haut brechen in der Steißgegend, am Rücken, aus den Flügeln und Schenkeln flaumartige Federn hervor; die Glieder bilden sich aus; Fuß und Zehen bedecken sich mit zarten, weißlichen Schuppen; der Schnabel gestaltet sich und erhärtet. Das Gehirn erlangt fast ganz seine künftige, bleibende Gestalt; die Schädeldecken verknorpeln; die Lungen bilden sich zu verhältnismäßiger Größe aus; an der Luftröhre nimmt man bereits Knorpelringe, an den Nieren die Harngefäße, außerdem den Harnleiter, Eierstock und die Eierleiter wahr; die Muskeln sind noch weiß und weich, die größeren Sehnen werden aber schon deutlicher, in den meisten Knorpeln zeigen sich Verknöcherungspunkte. In den beiden folgenden Tagen wächst der Keim bis zu sechs und sieben Centimeter Länge; der Schnabel und die Zehenglieder erhalten einen hornartigen Ueberzug; an den Flügeln brechen die Federn hervor; gestört, öffnet und schließt das Thierchen den Schnabel. In den drei nächsten Tagen, dem siebzehnten bis neunzehnten also, verbreitet sich die Lederhaut über die ganze innere Fläche des Eies; das Eiweiß verschwindet fast gänzlich; der Dottersack fällt zusammen und tritt durch den Nabelring mehr und mehr in die Bauchhöhle ein; der Keimling erhält seine Befiederung vollends, liegt in einer zusammengeballten Lage in der Schafhaut eingeschlossen, den Kopf meist unter dem rechten Flügel seitwärts an die Brust gelegt, die Beine gegen den Bauch angezogen, bewegt sich auch lebhaft, öffnet und schließt den Schnabel, schnappt nach Luft und läßt nicht selten seine piepende Stimme hören. Der Kopf ist ausgebildet; die Gehirntheile haben ihre bleibende Gestalt erhalten. Noch ist die Wärmeerzeugung gering. In den beiden letzten Tagen wird der Dotter vollends von der Bauchhöhle aufgenommen; der Keimling füllt das ganze Ei aus, athmet, piept und streckt die Zunge hervor, wenn er herausgenommen wird. Mehrere Stunden vor dem Ausschlüpfen, am einundzwanzigsten Tage, bewegt er sich hin und her, reibt mit seinem auf dem Schnabel befindlichen Höcker an der Eischale; es entstehen Risse, Lücken, indem kleine Schalenstücke abspringen; die Eischalenhaut reißt: das Vögelchen streckt seine Füße, zieht den Kopf unter den Flügeln hervor und verläßt nun die zerbrochene Hülle.
Wenige Vögel gelangen im Eie zu ähnlicher Ausbildung wie das Huhn; verhältnismäßig wenige sind im Stande, einige Minuten nach dem Auskriechen unter Führung der Mutter oder sogar ohne jegliche Hülfe abseitens der Eltern ihren Weg durchs Leben zu wandeln. Gerade diejenigen, welche als Erwachsene die größte Beweglichkeit und Stärke besitzen, sind in der Jugend ungemein hülflos. Die Nestflüchter kommen befiedert und mit ausgebildeten Sinnen, die Nesthocker nackt und blind zur Welt; jene machen nach dem Auskriechen einen höchst angenehmen Eindruck, weil sie bis zu einem gewissen Grade vollendet sind, diese fallen auf durch Unansehnlichkeit und Häßlichkeit. Die weitere Entwickelung bis zum Ausfliegen beansprucht verschieden lange Zeit. Kleinere Nesthocker sind drei Wochen nach ihrem Auskriechen flügge, größere bedürfen mehrere Monate, bevor sie fliegen können, einzelne mehrere Jahre, bevor sie ihren Eltern gleich dastehen. Denn die Jugendzeit des Vogels ist nicht mit dem Ausfliegen, sondern erst dann beendet, wenn er das Alterskleid anlegt. Nicht wenige erhalten anfangs ein Federkleid, welches mit dem ihrer Eltern keine Ähnlichkeit zeigt; andere gleichen in der Jugend dem Weibchen, und die Unterschiede, welche hinsichtlich des Geschlechtes bemerklich werden, zeigen sich erst mit Anlegung des Alterskleides. Einzelne Raubvögel müssen eine Reihe von Jahren erlebt haben, bevor sie alt, d. h. wirklich erwachsen genannt werden können.
Alle Veränderungen, welche das Kleid erleidet, werden hervorgebracht durch Abreibung, Verfärbung und Vermauserung oder Neubildung der Federn. Abreibung bedingt nicht immer Verringerung, im Gegentheile oft Erhöhung der Schönheit; denn durch sie werden die unscheinbarer gefärbten Spitzen der Federn entfernt und die lebhafter gefärbten Mittelstellen derselben zum Vorscheine gebracht. Die Verfärbung, eine bisher von vielen Forschern geleugnete, jedoch unzweifelhaft bestehende Thatsache, bewirkt auf anderem, bis jetzt noch nicht erklärtem Wege Veränderungen der Färbung einzelner Theile des Gefieders. Junge Seeadler z. B. tragen in der Jugend ein ziemlich gleichmäßig dunkles Kleid, während im Alter wenigstens der Schwanz, bei anderen Arten auch der Kopf weiß aussieht. Weder die Steuer-, noch die Kopffedern nun werden vermausert, sondern einfach verfärbt. Man bemerkt auf den breiten Steuerfedern, welche sich zu fortgesetzten Beobachtungen sehr günstig erweisen, zuerst lichte Punkte; diese vermehren und vergrößern sich, bleichen gleichzeitig ab, fließen endlich ineinander, und die Feder ist umgefärbt. Wie viele Vögel ihr Jugendkleid durch Verfärbung allein oder durch Verfärbung und gleichzeitig stattfindende, theilweise Vermauserung in das Alterskleid verwandeln, wissen wir zur Zeit noch nicht; daß einzelne in dieser Weise sich umkleiden, darf nicht mehr bestritten werden. Mauserung findet dann statt, wenn die Federn durch längeren Gebrauch, durch Einwirkung von Licht, Staub, Nässe re. mehr oder weniger unbrauchbar geworden sind, in der Regel nach beendigtem Brutgeschäfte, welches die Federn besonders abnutzt, vielleicht infolge des fieberhaften Zustandes, in welchem sich der brütende Vogel befindet. Dieser Federwechsel beginnt an verschiedenen Stellen des Körpers, insofern aber immer gleichmäßig, als er stets die entsprechenden Federn einer Körperhälfte betrifft. Bei vielen Vögeln werden bei einer Mauser nur die kleinen Körperfedern und bei der zweiten erst die Schwung- und Steuerfedern mit jenen erneuert; bei anderen bedarf der Ersatz der letzteren einen Zeitraum von mehreren Jahren, da immer nur zwei gleichzeitig neu gebildet werden, während bei anderen die Mauserung dieses Theiles des Gefieders so rasch stattfindet, daß sie flugunfähig werden. So lange der Vogel gesund ist, verleiht ihm jede neue Mauser neue Schönheit, und diese nimmt mit dem Alter zu, nicht ab wie bei anderen Thieren. Wird die Mauser unterbrochen, so erkrankt der Vogel; denn der Neuersatz seiner Federn ist ihm für sein Leben unbedingt nothwendig.
Das bezügliche Alter, welches ein Vogel erreichen kann, steht mit der Größe, vielleicht auch mit der Jugendzeit, einigermaßen im Einklange. Im allgemeinen läßt sich behaupten, daß der Vogel ein sehr hohes Alter erreicht. Kanarienvögel leben bei guter Pflege ungefähr ebenso lange wie Haushunde, zwölf, fünfzehn, achtzehn Jahre, im Freien, wenn nicht ein gewaltsamer Tod ihr Ende herbeiführt, wohl noch viel länger; Adler haben über hundert Jahre in der Gefangenschaft ausgehalten, Papageien mehrere Menschenalter erlebt. Krankheiten sind selten unter den Vögeln; die meisten wohl enden zwischen den Zähnen und Klauen eines Raubthieres, die wehrhaften an allgemeiner Entkräftung und Schwäche. Doch hat man auch Seuchen beobachtet, welche viele Vögel einer Art rasch nacheinander hinrafften, und ebenso weiß man von Haus- und Stubenvögeln, daß es gewisse Krankheiten unter ihnen gibt, welche in der Regel mit dem Tode endigen. Im Freien findet man selten eine Vogelleiche, im allerseltensten Falle die eines größeren Mitgliedes der Klasse, vorausgesetzt, daß der Tod ein sogenannter natürlicher war. Von vielen wissen wir nicht, wo und wie sie sterben. Das Meer wirft zuweilen die Leichen seiner Kinder an den Strand; unter den Schlafplätzen anderer sieht man auch wohl einen todten Vogel liegen: die Leichen der übrigen verschwinden, als ob sie die Natur selbst begrabe.
»Kein anderes Geschöpf«, so habe ich in meinem »Leben der Vögel« gesagt, »versteht so viel zu leben, wie der Vogel lebt; kein anderes Geschöpf weiß so ausgezeichnet hauszuhalten mit der Zeit wie er. Ihm ist der längste Tag kaum lang, die kürzeste Nacht kaum kurz genug; seine beständige Regsamkeit gestattet ihm nicht, die Hälfte seines Lebens zu verträumen und zu verschlafen: er will wach, munter, fröhlich die Zeit durchmessen, welche ihm gegönnt ist.«
Alle Vögel erwachen früh aus dem kurzen Schlafe der Nacht. Die meisten sind rege, noch ehe das Morgenroth den Himmel säumt. In den Ländern jenseit des Polarkreises machen sie während des Hochsonnenstandes zwischen den Stunden des Tages und denen der Nacht kaum einen Unterschied. Ich habe den Kukuk noch in der zwölften Abendstunde und in der ersten Morgenstunde wieder rufen hören und während des ganzen dazwischen liegenden Tages in Thätigkeit gesehen. Wer bei uns im Hochsommer früh in den Wald geht, vernimmt schon mit dem ersten Grauen der Dämmerung die Stimmen der Vögel und dieselben ebenso noch nach Sonnenuntergang. Eine kurze Zeit in der Nacht, einige Minuten dann und wann übertages scheinen ihnen zum Schlafen zu genügen. Unsere Hühner setzen sich zwar schon vor Sonnenuntergang zur Nachtruhe auf, schlafen jedoch noch nicht und beweisen durch ihren Weckruf am Morgen, daß kaum drei Stunden erforderlich waren, um sie für die lange Tagesarbeit zu stärken. Aehnlich ist es bei den meisten; nur die größeren Raubvögel, insbesondere die Geier, scheinen ihre Schlafplätze spät zu verlassen.
Der Vogel, dem Stimme und Klang geworden, begrüßt den kommenden Morgen mit seinem Gesange, thut dies wenigstens während der Paarungszeit, in welcher die Liebe sein Wesen erregt und vergeistigt. Erst nachdem er gesungen, beginnt er Nahrung zu suchen. Fast alle nehmen zwei Mahlzeiten zu sich, eine am Morgen, eine gegen Abend, und widmen die Mittagsstunden der Ruhe, der Reinigung des Gefieders, der Ordnung ihrer Federn. Ausnahmen von dieser Regel bemerken wir bei allen Vögeln, welche hinsichtlich ihrer Nahrung mehr als andere aus einen günstigen Zufall angewiesen sind. Die Raubvögel fressen gewöhnlich nur einmal täglich, und diejenigen unter ihnen, welche nicht selbst Beute gewinnen, sondern einfach Aas aufnehmen, sind keineswegs immer so glücklich, jeden Tag fressen zu können, sondern müssen oft tagelang hungern. In den meisten Fällen wird nur diejenige Speise verzehrt, welche der Tag erwerben ließ; einzelne aber, beispielsweise Würger, Spechte und Kleiber, tragen sich Speiseschätze zusammen und bewahren diese an gewissen Orten auf, legen sich also förmlich Vorräthe an, auch solche für den Winter. Nach der Mahlzeit wird ein Trunk und dann ein Bad genommen, falls nicht Sand, Staub oder Schnee das Wasser ersetzen müssen. Der Pflege seines Gefieders widmet der Vogel stets geraume Zeit, um so mehr, je ungünstiger die Einflüsse, denen jenes trotzen muß, um so weniger, je besser im Stande die Federn sind. Nach jedem Bade trocknet er zunächst durch Schütteln das Gefieder einigermaßen ab, sträubt es, um dies zu beschleunigen, glättet hierauf jede einzelne Feder, überstreicht sie mit Fett, welches er mittels des Schnabels seiner Bürzeldrüse entnimmt, mit demselben auf alle diesem erreichbaren Stellen aufträgt oder mit den Nägeln vom Schnabel abkratzt, um es den letzterem nicht erreichbaren Stellen einzuverleiben, auch wohl mit dem Hinterkopfe noch verreibt, strählt und ordnet hierauf nochmals jede Feder, hervorragende Schmuckfedern, Schwingen und Steuerfedern mit besonderer Sorgfalt, schüttelt das ganze Gefieder wiederum, bringt alle Federn in die richtige Lage und zeigt sich erst befriedigt, wenn er jede Unordnung gänzlich beseitigt hat. Nach solcher Erquickung pflegt er in behaglicher Ruhe der Verdauung; dann tritt er einen zweiten Jagdzug an. Fiel auch dieser günstig aus, so verfügt er sich gegen Abend nach bestimmten Plätzen, um sich hier der Gesellschaft anderer zu widmen, oder der Singvogel läßt noch einmal seine Lieder mit vollem Feuer ertönen; dann endlich begibt er sich zur Ruhe, entweder gemeinschaftlich mit anderen nach bestimmten Schlafplätzen oder während der Brutzeit in die Nähe seines Nestes zur brütenden Gattin oder zu den unmündigen Kindern, falls er nicht diese mit sich führt. Das Zubettgehen geschieht nicht ohne weiteres, vielmehr erst nach längeren Berathungen, nach vielfachem Schwatzen, Lärmen und Plärren, bis endlich die Müdigkeit ihr Recht verlangt. Ungünstige Witterung stört und ändert die Regelmäßigkeit der Lebensweise, da das Wetter auf den Vogel überhaupt den größten Einfluß übt.
Mit dem Aufleben der Natur erlebt auch der Vogel. Sein Fortpflanzungsgeschäft fällt überall mit dem Frühlinge zusammen, in den Ländern unter den Wendekreisen also mit Beginn der Regenzeit, welche, wie ich schon wiederholt zu bemerken Gelegenheit nahm, nicht dem Winter, sondern unserem Frühlinge entspricht. Abweichend von anderen Thieren leben die meisten Vögel in geschlossener Ehe auf Lebenszeit und nur wenige von ihnen, wie die Säugethiere, in Vielweiberei oder richtiger Vielehigkeit, da eine Vielweiberei einzig und allein bei den Kurzflüglern stattzufinden scheint. Das Pärchen, welches sich einmal vereinigte, hält während des ganzen Lebens treuinnig zusammen, und nur ausnahmsweise geschieht es, daß einer der Gatten, von heftiger Brunst ergriffen, die Gesetze einer geschlossenen Ehe mißachtet. Da es nun auch unter den Vögeln mehr Männchen als Weibchen gibt, wird es erklärlich, daß von jeder Vogelart beständig einzelne Junggesellen oder Wittwer umherstreifen, in der Absicht, eine Gattin sich zu suchen, und läßt es sich entschuldigen, daß diese dann auf die Heiligkeit der Ehe nicht immer gebührende Rücksicht nehmen, vielmehr einem verehelichten Vogel ihrer Art sein Gespons abwendig zu machen suchen. Die nothwendige Folge von solch frevelhaftem Beginnen und Thun ist, daß der Eheherr den frechen Eindringling mit allen Kräften zurückzuweisen sucht, unter Umständen also zu Tätlichkeiten übergehen muß: daher denn die beständigen Kämpfe zwischen den männlichen Vögeln während der Paarungszeit. Wahrscheinlich macht jeder einzelne Ehemann böse Erfahrungen; vielleicht ist auch sein Weib »falscher Art, und die Arge liebt das Neue«: kurz, er hat alle seine Kräfte aufzubieten, um sich ihren Besitz zu erhalten. Eifersucht, wüthende, rücksichtslose Eifersucht ist somit vollkommen entschuldigt. Allerdings gibt es einzelne Vogelweibchen, welche dann, wenn sich ein solcher Eindringling zeigt, mit ihrem Gatten zu Schutz und Trutz zusammenstehen und gemeinschaftlich mit letzterem über den Frevler herfallen; die meisten aber lassen sich ablenken vom Pfade der Tugend und scheinen mehr am Manne als an einem Manne zu hängen. Man hat sonderbare Beobachtungen gemacht. Vögel, deren Männchen getödtet wurde, waren schon eine halbe Stunde später wieder verehelicht; der zweite Gespons wurde ebenfalls ein Opfer seiner Feinde: und dieselben Weibchen nahmen ohne Bedenken flugs einen dritten Gatten an. Die Männchen legen gewöhnlich viel tiefere Trauer um den Verlust ihrer Gattin an den Tag, wahrscheinlich aber nur, weil es ihnen ungleich schwerer wird als den Weibchen, wieder einen Ehegenossen zu erwerben.
Die männlichen Vögel werben unter Aufbietung ihrer vollen Liebenswürdigkeit um die Weibchen, einige durch sehnsüchtiges Rufen oder Singen, andere durch zierliche Tänze, andere durch Flugspiele etc. Oft wird die Werbung sehr stürmisch, und das Männchen jagt stundenlang hinter dem Weibchen drein, dieses scheinbar im Zorne vor sich hertreibend; in der Regel aber erhört das Weibchen seinen Liebhaber bald und widmet sich ihm dann mit aller Hingebung. In ihm ist der Geschlechtstrieb nicht minder mächtig als in dem Männchen und bekundet sich in gleicher Stärke in frühester Jugend wie im spätesten Alter. Hermann Müller beobachtete, daß ein sechs Wochen alter Kanarienhahn seine eigene, zur Begattung lockende Mutter betrat, und daß ein im Juli dem Eie entschlüpftes Bastardweibchen vom Stieglitz und Kanarienvogel bereits im December sich liebestoll zeigte, erhielt aber auch von zwölfjährigen Kanarienhähnen noch kräftige Bruten. Derselbe hingebende und verständnisvolle Beobachter erfuhr von seinen mit Liebe gepflegten, äußerst zahmen Stubenvögeln, daß der Fortpflanzungstrieb auch sich geltend macht, wenn zwei Vögel desselben Geschlechtes zusammenleben, und selbst dann durch Nisten, Legen und Brüten sich äußert, wenn keine Begattung stattgefunden hat. Paarungslustige Vögel erkennen das entgegengesetzte Geschlecht andersartiger Klassengenossen sofort, unterscheiden sogar männliche und weibliche Menschen genau: Vogelmännchen liebeln mit Menschenfrauen, Vogelweibchen mit Männern. Beide Geschlechter gehen auch Mischehen der unglaublichsten Art ein: ich selbst beobachtete, daß Storch und Pelekan sich eheliche Liebkosungen erwiesen. Die Begattung findet zu allen Stunden des Tages, am häufigsten wohl in der Morgen- und Abenddämmerung statt, und wird oft wiederholt, noch öfter erfolglos versucht.
Schon während der Liebesspiele eines Pärchens sucht dieses einen günstigen Platz für das Nest, vorausgesetzt, daß der Vogel nicht zu denjenigen gehört, welche Ansiedelungen bilden und alljährlich zu derselben Stelle zurückkehren. In der Regel steht das Nest ungefähr im Mittelpunkte des Wohnkreises, nach der Art selbstverständlich verschieden. Streng genommen findet jeder passende Platz in der Höhe wie in der Tiefe, auf dem Wasser wie auf dem Lande, im Walde wie auf dem Felde seinen Liebhaber. Die Raubvögel bevorzugen die Höhe zur Anlage ihres Horstes und lassen sich selten herbei, auf dem Boden zu nisten; fast alle Laufvögel hingegen bringen hier das Nest an; die Wald- und Baumvögel stellen es in die Zweige, auf die Aeste, in Vorgefundene oder von ihnen ausgemeiselte Höhlen, in das Moos am Boden etc., die Sumpfvögel zwischen Schilf und Röhricht, Ried und Gras am Ufer, auf kleine Inselchen oder schwimmend auf das Wasser selbst; einzelne Meervögel verbergen es in Klüften, selbst gegrabenen Höhlen und an ähnlichen Orten: kurz, der Stand ist so verschieden, daß man im allgemeinen nur sagen kann, jedes Nest steht entweder verborgen und entzieht sich dadurch den Blicken der Feinde, oder ist, wenn es frei steht, so gebaut, daß es nicht leicht bemerkt werden kann, oder steht endlich an Orten, welche dem in Frage kommenden Feinde unzugänglich sind. Die Familien- oder Ordnungsangehörigkeit eines Vogels berechtigt nicht, anzunehmen, daß er sein Nest in derselben Weise errichtet wie seine Verwandten, denn gerade hinsichtlich des Standortes unterscheiden sich die verschiedenen Glieder einer Familie, ja sogar die einer Sippe erheblich. Der Mensch beeinflußt den Standort eines Nestes oft wesentlich, sei es, daß er neue Wohnsitze schafft oder alte vernichtet. Alle Schwalbenarten, welche in Häusern brüten, haben diese freiwillig mit Felsnischen oder Baumhöhlungen vertauscht und gehen unter Umständen noch heutzutage solchen Tausch ein; Sperling und Hausrothschwanz, Thurm-, Röthel- und Wanderfalk, Schleiereule, Käuzchen, Felsen- und Thurmsegler, Dohle, Hirtenstaar, Wiedehopf und andere mehr sind ohne Einladung des Menschen zu Hausbewohnern geworden; der Staar und einer und der andere Höhlenbrüter haben solche Einladung angenommen. Andererseits zwingt der Mensch durch Ausrodung hohler Bäume und deren Reste oder Abtragung der Steinhalden Meisen und Steinschmätzer in Erdhöhlen Niststätten zu suchen.
Die einfachsten Nester benutzen diejenigen Vögel, welche ihre Eier ohne jegliche Vorbereitung auf den Boden ablegen; an sie reihen sich diejenigen an, welche wenigstens eine kleine Mulde für die Eier scharren; hierauf folgen die, welche diese Mulde mit weicheren Stoffen auskleiden. Dieselbe Steigerung wiederholt sich bei denen, welche anstatt auf dem flachen Boden in Höhlen brüten, und in gewissem Sinne auch bei denjenigen, welche ein schwimmendes Nest errichten, obgleich diese selbstverständlich erst eine Unterlage erbauen müssen. Unter den Baumnestern gibt es fast ebenso viele verschiedenartige Bauten als Baumvögel. Die einen tragen nur wenige Reiser liederlich zusammen, die anderen richten wenigstens eine ordentliche Unterlage her, diese mulden letztere aus, jene belegen die Mulde innen mit Ried und feinem Reisig, andere wiederum mit Reisern, Rüthchen, Würzelchen Haaren und Federn; mehrere überwölben die Mulde, und einzelne verlängern auch noch das Schlupfloch röhrenartig. Den Reisnesterbauern zunächst stehen die Weber, welche nicht bloß Grashalme, sondern auch wollige Pflanzenstoffe verflechten, verweben und verfilzen, dieselben sogar mit vorgefundenen oder selbst bereiteten Fäden förmlich zusammennähen, und damit sich die Meisterschaft erwerben. Aber Meister in ihrer Kunst sind auch die Kleiber, welche die Wandungen ihres Nestes aus Lehm herstellen. Dieser Stoff wird durch Einspeichelung noch besonders durchgearbeitet und verbessert oder sein Zusammenhang vermehrt, so daß das Nest eine sehr bedeutende Haltbarkeit gewinnt. Mehrere Kleiber verschmähen übrigens Lehm gänzlich, tragen dagegen feine Pflanzenstoffe, Moos und Blatttheilchen z. B., zusammen und überziehen diese mit ihrem Speichel, andere endlich verwenden nur den letzteren, welcher, bald erhärtend, selbst zur Wand des Nestes werden muß. In der Regel dient das Nest nur zur Aufnahme der Eier, zur Wiege und Kinderstube der Jungen; einige Vögel aber erbauen sich auch Spiel- und Vergnügungsnester oder Winterherbergen, benutzen die Nester wenigstens als solche. Zu jenen gehören mehrere Weber- und die Atlas- und Kragenvögel, auch ein Sumpfvogel, dessen riesenhaftes Nest einen Brut- und Gesellschaftsraum, ein Wach- und Speisezimmer enthält, zu diesen unter anderen die Spechte, welche immer in Baumhöhlen schlafen, oder unsere Sperlinge, welche während des Winters in dem warm ausgefütterten Neste Nachtruhe halten.
Jede Art verwendet in der Regel dieselben Baustoffe, bequemt sich jedoch leicht veränderten Umständen an, zeigt sich auch zuweilen ohne ersichtlichen Grund wählerisch und eigensinnig. Erzeugnisse des menschlichen Kunstfleißes, welche die Vorfahren heute lebender Vögel offenbar niemals zum Baue ihres Nestes benutzen konnten, werden von letzteren regelmäßig verbraucht, Samenwolle eingeführter Pflanzen und andere passende Theile nicht verschmäht. Gefangene Vögel sehen nicht selten gänzlich von denjenigen Stoffen ab, welche sie in der Freiheit vorzugsweise verarbeiten, und ersetzen sie durch andere, welche sie hier nicht beachten.
Das Weibchen baut, das Männchen trägt zu. Dies ist die Regel; aber auch das Umgekehrte findet statt. Bei den Webervögeln z. B. bauen die Männchen allein, und die Weibchen lassen sich höchstens herbei, im Inneren des Nestes ein wenig nachzuhelfen. Bei den meisten übrigen Vögeln übernimmt das Männchen wenigstens das Amt des Wächters am Neste, und nur diejenigen, welche in Vielehigkeit leben, bekümmern sich gar nicht um dasselbe. Während des Baues selbst macht sich das Männchen vieler Vögel noch in anderer Weise verdient, indem es mit seinen Liedern oder mit seinem Geschwätz die arbeitende Gattin unterhält. Der Bau des Nestes selbst beansprucht vollste Thätigkeit und Hingabe, wird, so viel als thunlich, ununterbrochen weiter und rasch zu Ende geführt, zuweilen allerdings auch wiederholt begonnen und verlassen; die Arbeit macht erfinderisch und bringt Thätigkeiten zur Geltung, welche außerdem gänzlich ruhen. Baustoffe werden mit Schnabel und Füßen abgebrochen, vom Boden oder Wasser aufgenommen, aus der Luft gefangen, zerschleißt, geschmeidigt, gezwirnt, mit dem Schnabel, den Füßen, zwischen dem Rückengefieder zum Neste getragen, hier mit dem Schnabel und den Füßen an die rechte Stelle gelegt, unter Mithülfe des Gatten um Zweige gewunden, mit den Füßen zerzaust und mit der Brust angedrückt. »Sorglose Vögel«, so schreibt mir Hermann Müller, dessen langjährige, treffliche Beobachtungen ich der nachfolgenden Schilderung des Brutgeschäftes kleiner Nesthocker zu Grunde lege und größtentheils wörtlich wiedergebe, »werfen die zum inneren Ausbaue bestimmten Niststoffe vom Nestrande aus in die Mulde und hüpfen nach; sorgsame tragen sie mit dem Schnabel hinein und legen sie behutsam unter ihren Leib. Die einen wie die anderen erfassen sie nunmehr mit den Füßen, zertheilen und verbreiten sie kreiselnd mit wahrhaft wunderbarer Geschicklichkeit und drücken sie fest. Die Form der Mulde wird durch die Brust hervorgebracht, indem sich der Vogel mit fast senkrecht gehaltenem Schwanze im Neste dreht und die Stoffe andrückt; die darüber befindliche steilere Nestwand erhält ihre Gestalt durch abwechselnde Arbeit der Brust, des Flügelbuges und Halses; der Nestrand endlich wird theils durch den Unterschnabel, beziehentlich das Kinn, ungleich mehr aber durch schnelle niederdrückende und wackelnde Bewegungen des Schwanzes geformt, durch Hin- und Herstreifen des Unterschnabels aber geglättet.« Lange, zum Umwickeln von Zweigen bestimmte Halme werden vorher mit dem Schnabel gekaut und geknickt, Lehmklümpchen stets erst längere Zeit geknetet. Außen oder innen vorragende Halme nimmt ein sorgsam bauender Vogel weg; ungenügende Nester erhöht und erweitert er oft noch, nachdem bereits Eier in ihnen liegen.
Einige Vögel errichten gemeinschaftlich Nester, und die verschiedenen Mütter legen in diesen zusammen ihre Eier ab, brüten wohl auch auf letzteren abwechselnd; andere theilen einen gesellschaftlich ausgeführten Hauptbau in verschiedene Kämmerchen, von denen je eines einer Familie zur Wohnung dient; andere wiederum bauen ihr Nest in das anderer Vögel, zumal in den Unterbau desselben, und nisten gleichzeitig mit ihren Wirten.
Ueber das Legen der Eier hat Hermann Müller ebenfalls die genauesten Beobachtungen gesammelt und mir zu Gunsten des »Thierlebens« mitgetheilt. »Die meisten Vögel legen morgens zwischen fünf und neun Uhr und zwar häufig in derselben Stunde. Das Legegeschäft vom Besetzen bis zum Verlassen des Nestes nimmt durchschnittlich eine halbe Stunde in Anspruch; diese Zeit kann sich aber erheblich verlängern und ebenso wesentlich verkürzen. Schon am Tage, zumal am Nachmittage, vorher verräth der Vogel durch ungewöhnlich starke Aufnahme von Futter, Sand und Kalkstoffen, daß er legen wird. Lebhafte Bewegung oder Kreiseln im Neste scheint das Legen zu befördern. Mit Eintritt der Wehen schlüpft der Vogel ins Nest. Die Wehen bekunden sich durch kürzeres Athmen bei ein wenig gesperrtem Schnabel, Emporrichten des Vorderleibes, zitterndes Ausbreiten und darauf folgendes Senken der Flügel. Unmittelbar vor dem Legen öffnet der Vogel den Schnabel sehr weit, preßt ersichtlich so stark er kann, und das Ei schießt heraus. Die Nachwehen sind kürzer, aber sehr empfindlich; denn der Vogel setzt sich nicht unmittelbar nach dem Legen in das Nest, sondern bleibt noch einige Minuten mit gestreckten und gespreizten Beinen emporgerichtet stehen, wahrscheinlich, um den gereizten Leib nicht mit dem Neste in Berührung zu bringen. Erst nach dieser Ruhepause senkt, ja drückt er sich mit ersichtlicher Wollust in den Kessel und beginnt zu jubeln. Dieses Frohlocken gilt offenbar nicht bloß der Ueberstehung der Schmerzen, sondern drückt Freude über die Brut aus; denn es wird auch während des Brütens selbst, zu einer Zeit, wann die Wehen längst vergessen, oft wiederholt, unterbleibt jedoch, wenn der Vogel zwar legt, nicht aber brütet. Kleinheit der Eier, nicht genügend entwickelter z. B., mindert die Wehen nicht.«
Mit Beginn des Eierlegens erhöht sich die Brutwärme des Vogels; der erwähnte fieberhafte Zustand tritt ein und bekundet sich bei vielen auch dadurch, daß auf gewissen Stellen des Körpers Federn ausfallen, wodurch die sogenannten Brutflecken sich bilden. Der Mutter fällt fast ausnahmslos der Haupttheil des Brütens zu: sie sitzt von Nachmittag an bis zum nächsten Vormittag ununterbrochen auf den Eiern, und der Vater löst sie bloß so lange ab, als sie bedarf, um sich zu ernähren. Bei anderen wird die Arbeit gleichmäßiger vertheilt; bei einzelnen, beispielsweise bei den Straußen, brütet nur der Vater. Aushülfe des männlichen Geschlechtes, welche schädliche Abkühlung der Eier verhütet, wird von manchen Weibchen zwar geduldet, nicht aber gern gesehen: so wenigstens läßt das mißtrauische Gebaren der letzteren schließen. Einzelne von ihnen unterbrechen ihre freie Zeit wiederholt, um nach dem Männchen zu sehen, andere drängen vor ihm sich ins Nest und beaufsichtigen es förmlich während des Brütens. Die meisten freilich erweisen sich erkenntlich für die geleistete Hülfe und geben dies in nicht mißzuverstehender Weise zu erkennen. Fast alle brütenden Vögel besehen und verlassen, wie Hermann Müller ferner beobachtete, das Nest mit großer Vorsicht. »Sie nahen sich verstohlen, bleiben einige Augenblicke auf dem Nestrande stehen, besichtigen aufmerksam die Eier und deren Lage, hüpfen mit ausgespreizten Beinen und Zehen in die Mulde, schieben die Eier mit dem Unterschnabel oder Kinne unter ihren Leib, versenken sich hierauf ganz in den Kessel, bewegen sich nach rückwärts, um die Eier unter die Federn zu schieben, rücken nunmehr wieder vor, bauschen, sich schüttelnd, die Federn nach allen Richtungen, senken Flügel und Schwanz auf den Nestrand und stellen so einen möglichst luftdichten Verschluß her.« Schwimmvögel, welche, aus dem Wasser kommend, ihr Nest besetzen, versäumen nie, zuvor ihr Gefieder sorgsam zu trocknen. Bei der geschilderten Bewegung nach rückwärts werden die Eier regelmäßig aus ihrer Lage gerückt, nach Hermann Müllers Beobachtungen dabei jedoch nicht um ihre Axe gedreht, sondern nur verschoben, und zwar geschieht dies anscheinend zufällig, nicht absichtlich. »Das Weibchen bestrebt sich, die Eier möglichst unter die Federn zu bringen, nimmt aber auf deren Lage keine Rücksicht. Beim Verlassen des Nestes dehnen und strecken die brütenden Vögel zunächst ihre Beine behaglich nach hinten, heben den Rücken buckelig empor, drehen Hals und Kopf, lüften die Flügel, richten sich auf und begeben sich nun erst mittels eines leichten Sprunges ins Freie«. Ehe sie sich entfernen, bedecken alle, welche Dunen ausrupfen, das Gelege mit diesen, andere mit Erde oder Sand, während die meisten solche Vorkehrungen nicht treffen. »Für den Inhalt des Nestes und die Beschaffenheit der Eier haben die Vögel kein Verständnis; denn sie brüten mit gleicher Hingabe auf fremden wie auf den eigenen Eiern, auch auf fremdartigen Gegenständen, wie auf Nüssen, Kugeln, Steinen, vor dem Legen eine Zeitlang selbst im leeren Neste. Angebrütete und taube oder faule Eier haben für sie den gleichen Werth. Ans der eigentlichen Mulde gerollte Eier bleiben regelmäßig unberücksichtigt, gerade als wüßten sie, daß ihnen gegenüber der Liebe Mühe fernerhin doch umsonst ist. Dagegen verändern sie, wenn die Eier in der Mulde freiliegen und sie dies merken, ihren Sitz so lange, bis sie alle wieder bedeckt haben. Abnahme der äußeren Wärme empfinden sie meist sehr lebhaft, werden traurig oder verdrießlich, wenn kühle Witterung eintritt und erlangen ihre Heiterkeit erst wieder, wenn ein erwünschter Umschlag sich bemerklich macht. Die höchste Wärme während der ganzen Brutzeit tritt drei bis vier Tage nach dem Ausschlüpfen der ersten Jungen ein, kommt daher Spätlingen oft sehr zu statten.
»Die Entwickelung der Keimlinge eines und desselben Geleges vollzieht sich nicht immer in gleichen Fristen; auch bei durchaus regelmäßiger Bebrütung kommt es im Gegentheile und ziemlich oft vor, daß einzelne Junge einen und selbst mehrere Tage später das Licht der Welt erblicken. In der Regel fällt das Ausschlüpfen in die Früh- und Vormittagsstunden; doch kann ausnahmsweise auch das Entgegengesetzte stattfinden. Beim Auskriechen leisten die Eltern den im Innern des Eies arbeitenden Jungen keine Hülfe. Wie diese es anfangen, um sich aus der sie umschließenden Hülle zu befreien, weiß man noch nicht genau. Ihre Arbeit im Innern des Eies ist eine ziemlich geräuschvolle, wie jedes Haushuhnei belehren kann. Daß die brütenden Vögel dieses Geräusch vernehmen, beweisen sie durch häufiges, aufmerksames Hinabblicken ins Nest, helfen aber können sie nicht. Das Geräusch wird treffend mit Picken bezeichnet und hört sich an, als ob das Küchlein mit dem Schnabel gegen die Eischale stoße. Endlich zerspringt die Schale, wie oben beschrieben, in der Regel an der Stelle, an welcher die im stumpfen Ende ausgespannte innere Haut anliegt; doch geschieht das Durchbrechen nicht immer in stetigem Zusammenhange, manchmal vielmehr auch, indem rundum mehrere Löcher durchgearbeitet werden. Durch strampelnde Bewegungen verläßt das Junge die gesprengte Schale. Unmittelbar darauf wird diese von den Eltern entfernt, und zwar entweder weit vom Neste weggetragen oder mit Lust verspeist. Junge, welche an der Schale kleben, laufen Gefahr, von den Eltern mit der unnützen Hülle aus dem Neste geschleppt zu werden. Sofort nach geschehener Räumung des Nestes kehrt die Mutter zu diesem zurück, läßt sich vorsichtig in die Mulde hinab, klammert sich rechts und links an den Wänden an, um die zarten Jungen nicht zu drücken oder sonstwie zu beschädigen und spendet ihnen vor allem Wärme. In den ersten vier bis sieben Tagen verläßt sie die kleinen, meist nackten Nesthocker so wenig als möglich und immer nur auf kurze Zeit; nach Ablauf dieser Frist bedingt schon das Herbeischaffen größerer Futtermengen wesentliche Aenderungen. Die Bedeckung der Küchlein bei Tage und Nacht währt bei kleineren Arten durchschnittlich so lange, bis ihre Rückenfedern sich erschlossen haben. Mit zunehmendem Wachsthume der Jungen verändert die wärmende Mutter ihre Haltung im Neste, insofern sie ihre Füße auf jener Rücken setzt; dies aber geschieht, wie aus dem Stillsitzen der Jungen hervorgeht, so leicht, daß dadurch keinerlei Belästigung verursacht wird.
»Die jungen Vögel selbst legen, sobald sie das Ei verlassen haben, ihre Köpfe in das Innere der Mulde und benutzen die noch vorhandenen Eier als willkommene Kopfkissen. Wenn keine Eier vorhanden sind, liegt ein Hals und Kopf über dem anderen, und der unterste muß oft stark ziehen und rütteln, um sich zu befreien und aus dem Amboß zum Hammer zu werden. Junge Zeisige sind bereits am vierten Tage ihres Lebens kräftig genug, um sich zu wenden und die Köpfe an die Nestwand zu legen. Wird es ihnen unter der mütterlichen Brust zu schwül, so schieben sie ihre Köpfchen nicht selten mit weit geöffneten Schnäbeln hervor, als ob sie ersticken müßten. Sorgsame Mütter wissen natürlich, was ihren Sprößlingen frommt, und lassen sich durch sie in ihren Obliegenheiten nicht stören. Ja ein von mir beobachtetes Zeisigweibchen duckte die dicken Köpfe der von ihm erbrüteten Dompfaffen beharrlich in den Kessel zurück, weil sie bereits am fünften Tage auf den Rand gelegt wurden und ihm beschwerlich fallen mochten. Eine junge, unerfahrene Zeisigmutter vermuthete in den weit geöffneten Schnäbeln ihrer Erstlinge Zeichen von Hunger und stopfte ununterbrochen Speisebrei hinein, auch wenn die Kröpfe bis zum Platzen gefüllt waren. Geschah dadurch des Guten zu viel, dann zogen die Kleinen es vor, aus der Charybdis in die Scylla zurückzusinken und gelassen weiterzuschwitzen.
»Selbst die jüngsten Vögelchen klammern sich, wenn sie merken, daß sie aufgenommen werden sollen, mit den Nägeln an die Neststoffe. Dasselbe geschieht, wenn sie behufs der Entleerung ihren schweren Leib an der Nestwand emporschieben oder die ersten ängstlichen Flugübungen anstellen. Auf diese Weise mögen sie sich bei zu großer Kühnheit vor dem Hinausstürzen zu schützen suchen. Die ersten Flügelschläge fallen mit der ersten Fütterung zusammen, verstärken sich allmählich und gewinnen schließlich anmuthige Leichtigkeit, wie dies bei jungen Straßensperlingen so leicht zu sehen ist. Die ersten Bewegungen des Mißbehagens stellen sich ein, wenn die Mutter das Nest verläßt und kühlere Luft eintritt: dann zittert mit den Flügeln der ganze Körper der Kleinen, und vielleicht wird durch diese raschen Bewegungen der Blutumlauf beschleunigt und die innere Wärme erhöht. Den ersten ernstlichen Gebrauch der Flügel zur Erhebung über das Nest zeigte ein Kanarienvogel an seinem sechzehnten Lebenstage. Junge Nestvögel sind wie kleine Affen: das Beispiel steckt an. Es gewährt einen erheiternden Anblick, wenn ein Junges mit befiederten oder auch nackten Flügeln zu flattern beginnt und unmittelbar daraus alle Flügelpaare gleichzeitig durcheinander schwirren. Die ersten Gehbewegungen geschehen nicht auf den Zehen, sondern auf den Haken. Haben es die Vögel eilig, so fallen sie nach vorn über und stützen und fördern sich vermittels der Vorderflügel. Wann die Füße ihre Thätigkeit beginnen, konnte ich wegen der inzwischen entfalteten und verhüllenden Federn nicht wahrnehmen. Das geschlossene Auge junger Zeisige öffnet sich mit dem fünften Lebenstage. Doch währt es bis zum zehnten Tage, bevor die Augen völlig erschlossen sind.
»Gleich nach dem Abtrocknen beginnen die Jungen ihre Stimme hören zu lassen. Bei im Zimmer erbrüteten Kanarienvögeln, Stieglitzen, Zeisigen und Dompfaffen piepten am frühesten und lautesten die Kanarienvögel, später und schwächer die Stieglitze und Zeisige, am schwächsten und spätesten die Gimpel, gleich als ob die spätere Gesangsfähigkeit der verschiedenen Arten schon beim ersten Lallen sich bekunden wollte. Diese Laute, zippende Töne, sind keineswegs Zeichen von Hunger, sondern im Gegentheile solche des höchsten Wohlbehagens, denn sie verstummen augenblicklich, wenn die Mutter sich erhebt und kühlere Luft das Nest erfüllt. Mit der Entwickelung des Körpers hält die der Stimme nicht gleichen Schritt. Kanarienvögel piepen am sechsten und siebenten Lebenstage nicht stärker als am ersten. Nach Oeffnung der Augen schreien sie lauter, jedoch auch nur dann, wenn sie sehr hungrig oder auf einander neidisch sind. Nähert sich ihnen etwas verdächtiges, so verstummen sie sofort und tauchen in den Kessel hinab. Bei jungen Dompfaffen tritt der Stimmwechsel am vierzehnten Lebenstage ein. Junge Kanarienhähne verrathen schon als Nestlinge ihr Geschlecht durch Knurren und knurrendes Zirpen, ebenso die Zeisige. Das erste Dichten auf der Sprosse vernahm ich bei Kanarienvögeln am neunzehnten, bei Zeisigen am einundzwanzigsten Lebenstage. Erstere verlassen, nachdem sie einige Tage vorher vom Nestrande aus ihre Flügel wiederholt erprobt haben, am vierzehnten, beziehentlich sechzehnten Lebenstage die Wiege, kehren jedoch bei kühler Witterung auch wohl noch mehrere Tage und Nächte in dieselbe zurück. Einzelne waren am neunzehnten Lebenstage flügge und sind am zweiundzwanzigsten bereits vollständig selbständig. Andere ernähren sich zwar theilweise selbst, lassen sich jedoch noch am dreißigsten Tage ihres Lebens füttern. Junge Zeisige laufen Kanarienvögeln in vielen Beziehungen den Rang ab, verlassen am dreizehnten, vierzehnten oder fünfzehnten Tage das Nest und werden unter Umständen schon am neunzehnten Tage von der Mutter als erwachsen angesehen, nämlich weggebissen, wenn sie sich an dieselbe herandrängen wollen.
»In den ersten Tagen der Kindheit, bevor die winzigen Jungen ihre Köpfe an die Nestwand legen, pflegen ihre Väter bei der Fütterung gewöhnlich nicht unmittelbar sich zu betheiligen. Diese Vernachlässigung gleichen sie dadurch reichlich aus, daß sie später, zumal wenn die Weibchen vor eingetretener Selbständigkeit der Kinder bereits wieder brüten, die Pflege der letzteren fast ganz allein übernehmen, sowie dadurch, daß sie in den ersten Tagen und während der ganzen Brutzeit ihren Gattinnen reichliche Nahrung zutragen, damit sie die Brütung nicht so oft zu unterbrechen brauchen. Den Jungen erwachsen hieraus doppelte Vortheile. Sie genießen ungestörter die Wärme der Mutter und erhalten zwiefach eingespeichelte und deshalb leichter verdauliche Speise. Ehe die Eltern sich oder ihre Kinder atzen, wetzen sie aus Reinlichkeitssinn in sorgfältigster Weise die Schnäbel. Die jungen Vögel kommen mit starkem Hunger auf die Welt. Sie erheben, sobald sie trocken geworden sind, wie in schlaftrunkenem Taumel die unverhältnismäßig großen Köpfe mit so weit aufgerissenem Schnabel, daß derselbe zu zittern pflegt. Jeder sucht dem anderen den Bissen wegzuschnappen, und in der That wird derjenige, welcher den Hals am längsten reckt, regelmäßig zunächst bedacht, und erst wenn sein Kopf in den Kessel zurückgesunken ist, kommen die kleineren Kinder an die Reihe. Hierin liegt eine wirksame Ursache für das Zurückbleiben einzelner Nesthäkchen. Dank ihres überaus schnellen Stoffwechsels brauchen die Jungen in der Regel von ihren Eltern nicht zum Fressen aufgefordert zu werden. So lange sie blind sind, erheben sie bei der geringsten Bewegung der Mutter ihre weit geöffneten Schnäbel. Verzieht dieselbe zu lange, dann drücken sie die Schnabelspitze an die mütterliche Brust. Tritt einmal der seltene Fall ein, daß sie übersättigt in tiefen Schlaf gesunken sind und nicht sperren mögen, so werden verschiedene Ermunterungsversuche angewendet. Zunächst stoßen die Eltern sanft girrende Töne aus. Fruchten diese nicht, so tippen sie in erster Reihe auf die Schnabelwurzel, in zweiter Reihe nach fruchtlosem Bemühen auf die empfindlicheren Augenlider. Bleibt auch dies ohne Erfolg, dann bohren sie ihre Schnabelspitze in den Schnabelspalt der Jungen, um denselben gewaltsam aufzubrechen. Zwei Zeisigmütter waren im Futtereifer überschwenglich und quälten dadurch ihre Kinder unablässig. Waren deren Kröpfe übermäßig angefüllt, und blieben alle Einladungsversuche deshalb erfolglos, dann schoben sie die Köpfe der Kleinen in liebreichster, schmeichelnder Weise wiederholt nach rechts und links, richteten sie empor, legten schließlich ihre Schnabelspitze vier Millimeter breit über den Schnabelspalt der Jungen und preßten den Schnabel leicht ein wenig auseinander, um ein paar Speisebröckchen mit schlängelnder Zunge hineinzuschieben. Der Speisebrei, welcher anfänglich verfüttert wird, ist dick und zähe, wie starker Sirup und dabei doch so wasserhaltig, daß eine besondere Tränkung nicht stattzuhaben braucht. Durch würgende Bewegungen wird immer eine zu drei, seltener fünf oder einer Gabe ausreichende Menge von Speisebrei aus dem Kropfe hervorgestoßen, mit der Zunge sorgfältig untersucht, damit kein harter Theil mitverfüttert werde, und dann am Gaumen der Jungen abgesetzt, so daß er, Dank seiner Glätte und Schwere, ohne anstrengende Schluckbewegungen der letzteren in deren Schlund hinabsinkt. Ameisenpuppen werden von Zeisigen, vielleicht auch von anderen Körnerfressern, ganz verschluckt und ebenso auch wieder ausgestoßen. Gewahren die Eltern beim Sperren der Jungen, daß von der vorigen Fütterung ein Krümchen auf der Zunge, an den Rachenwänden oder am Gaumen hängen geblieben ist, so wird es behutsam aufgenommen, verschluckt und dann erst weiter gefüttert. Ist der in einen der Schnäbel gelegte Bissen zu groß ausgefallen, so wird ein Theil zurückgenommen. Brachte ein Zeisigmännchen seiner Gattin einige durch Zufall zusammengebackene Ameisenpuppen, dann nahm sie dieselben nicht im ganzen an, sondern zupfte sie einzeln ab, um sie nach vorgenommener Prüfung zu verschlucken, vielleicht aus Sorge, daß unter ihnen einige mit mehr oder minder entwickelten Larven sich befinden möchten. Solche wie alle härteren Theile von Kerbthieren überhaupt werden immer ängstlich gemieden, weil die jungen Körnerfresser hornige Bestandtheile ebensowenig zu verdauen vermögen als die Wurmfresser.
»Manche Mütter sind so fütterungssüchtig, daß sie ihre Kinder förmlich martern. Ein Zeisigweibchen pickte in dieser Sucht so häufig an dem Schnabelwinkel seines Kindes, daß dort feine Blutstreifen entstanden. Der Kropf eines Nestzeisigs war einmal so überfüllt, daß der Vogel wegen Belästigung den Schnabel längere Zeit nicht zu schließen vermochte, der eines jungen Kanarienvogels so dick aufgetrieben, daß er den Kopf nicht drehen konnte, um die Federn zu bearbeiten.
»Reinlichkeit ist zumal für junge Vögel das halbe Leben, und verkleisterte Afterfedern sind ein sicheres Zeichen des Todes. Daher sieht man Eltern und Kinder in gleicher Weise bemüht, dieser ersten Bedingung Genüge zu leisten. Ihre Triebe ergänzen sich gegenseitig, wie man dies besonders während der Brütung und der ersten Lebenstage der Jungen im Neste beobachten kann. Der Mastdarm der Alten wie der Jungen ist bedeutender Erweiterung fähig. Während unter gewöhnlichen Umständen die Entleerungen in sehr kurzen Fristen stattfinden, werden sie im Neste, beispielsweise bei Winterbrütungen, oft sehr verzögert, zuweilen um volle sechzehn Stunden. Wegen dieser langen Enthaltung erreichen die Kothballen nicht selten die Größe der von ihrer Trägerin gelegten Eier. Junge Vögel entleeren sich nicht, so lange sie von ihrer Mutter bedeckt werden. Dauert ihnen dies zu lange, dann geben sie ihre Bedürfnisse durch unruhige Bewegungen nach rückwärts zu erkennen. Augenblicklich erhebt sich die Mutter, und nun eilt auch, ungerufen und ungelockt, der Vater, welcher im kleinen Nistbauer jede Bewegung gehört und gesehen hat, schleunigst herbei. Gemeinschaftlich achtet jetzt das Elternpaar mit gespanntester Aufmerksamkeit, mit niedergebeugtem Kopfe und unverwandten, glänzenden Augen auf die rückgängigen Bewegungen ihrer Kinder. Diese schieben, mit den Nägeln in die Nistwand eingreifend, ihren schwer beladenen, massigen Leib empor, halten, an der höchsten erreichbaren Stelle angelangt, einen Augenblick an, bewegen sich, um den Kothballen zu lösen, einige Male rasch seitlich schlängelnd und treiben den angesammelten Koth hervor, dem Anscheine nach mehrere Millimeter weit über die Afteröffnung hinaus. Die Entfernung erscheint stets etwas größer, als sie wirklich ist, weil die Jungen in demselben Augenblicke, in welchem der letzte verdünnte Theil des Kothballens ausscheidet, bereits wieder in die Mulde hinabrutschen, als ob sie ja nicht mit dem Kothe in Berührung kommen wollten. Die kahnförmige Gestalt des dicken Unterleibes macht es den Jungen, auch wenn sie einmal nachlässig sein sollten, ganz unmöglich, die Wand eines naturgemäßen Nestes mit ihrem Hintertheile zu berühren. Zwischen beiden bleibt immer genügender Raum, um den niedergebeugten Eltern die Aufnahme der Auswurfstoffe zu ermöglichen. Bei günstiger Stellung warten die Eltern deren Ausscheiden nicht einmal ab, führen vielmehr die Schnabelspitze in den After ein und ziehen den Koth heraus. Schon in der Kinderschule wurde uns erzählt, daß die alten Vögel letzteren aus den Nestern forttragen; ich war daher nicht wenig erstaunt, als ich bemerken mußte, daß meine Kanarienvögel diesen Glaubenssatz niemals bestätigten. Ja, ich würde noch heute seine Richtigkeit für Stubenvögel geradezu bezweifeln, wäre sie nicht durch letztere auch wiederum mehrfach erhärtet worden, und hätten nicht zwei Sperlingsgäste, der eine in der Stube, der andere auf der äußeren Fensterbank, dasselbe gethan. Beide erregten meine Aufmerksamkeit dadurch, daß sie erbrechende Bewegungen machten und kleine Gegenstände fallen ließen, welche als Kothballen junger Vögel erkennbar waren. Daß mir das Wegtragen der letzteren ein paar Jahrzehnte hindurch unbekannt geblieben, daran waren meine Vögel, nicht aber ungenügende Beobachtungen Schuld. Habe ich doch in denselben Jahren das nachfolgende feinere und deshalb weniger leicht zu beobachtende Verfahren unzählige Male bei meinen sämmtlichen Vögeln kennen gelernt. Meine Stubenvögel verschluckten nämlich die Kothballen ihrer Kinder, ja, die Männchen verfolgten die mit der seltsamen Kost belasteten Weibchen, entrissen sie ihnen, flogen zu der bereits wieder zum Nestrande zurückgekehrten Gattin und verfütterten die Auswurfstoffe von neuem. Da nun die Weibchen ihren Jungen gegenüber ebenso verfahren, macht der absonderliche Bissen einen vollständigen Kreislauf. Für mich liefert diese Thatsache einen sicheren Beweis, daß die Kothballen noch unverdaute, brauchbare Nahrungsstoffe enthalten, was auch bei dem schnellen Verlaufe der Verdauung nicht zu verwundern ist. Alles dies ändert sich, wenn die Jungen am sechsten, siebenten oder neunten Lebenstage ihren Unrath auf oder über den Nestrand zu legen vermögen. Solche Auswurfsstoffe rühren die Eltern durchschnittlich nicht mehr an, und die sorgsameren unter ihnen bedecken lieber den Schmutz leicht mit einigen Faserstoffen. Doch habe ich auch in dieser Beziehung Ausnahmen beobachtet. Flüggwerdende Zeisige hatten Koth vom Rande aus in das Innere des Nestes fallen lassen. Als die Mutter diesen Uebelstand nach einiger Zeit gewahrte, hob sie den bereits verhärteten Unrath auf, um ihn zerbröckelt zu verspeisen. Dasselbe wurde später bei einem Kanarienvogel beobachtet.
»Nestlinge entleeren sich, sobald die Mutter sich erhoben hat, gewöhnlich gemeinschaftlich in einer Minute und machen den Eltern deshalb viel zu schaffen. Haben sie einmal ausnahmsweise in Abwesenheit der letzteren ihr Bedürfnis befriedigt, so ist der Schaden auch nicht groß. Denn die Kothballen junger Nestlinge sind bekanntlich mit einer gallertartigen Haut überzogen, welche einige Zeit vorhält und erst durch die Einwirkung von Luft und Wärme zerstört wird. Die Eltern finden dadurch bei ihrer Rückkehr noch Gelegenheit, für Reinlichkeit des Nestes zu sorgen. Wie die alten haben auch die jungen Vögel viel von Ungeziefer aller Art zu leiden. Verschiedenartige Milben werden allen kleineren Vogelarten zur schlimmsten Plage. Schon ein Dutzend dieser Schmarotzer reicht hin, um ihnen die nächtliche Ruhe zu verkümmern. Hauptsitze der Unholde bilden Kopf und Flügel, wie man am sichersten an dem Zittern und Schütteln dieser Theile beobachtet. Ist die Plage besonders arg, dann knirschen und knistern die gequälten Vögel im Schlafe oder Traume laut mit den Schnäbeln. In einem Brutneste kann die Vermehrung der Milben schreckenerregend werden. Da die Vögel im Bauer nicht so viele und gute Gelegenheit haben, sich durch Baden oder Einsanden von den lästigen Gästen zu befreien, auch wiederholt in einem und demselben Neste brüten, werden sie hier weit mehr belästigt als im Freien. Oft sieht man sie die Brütung unterbrechen, den Schnabel rüttelnd, tief in die Niststoffe einbohren, um auf die abscheulichen Kerbthiere zu jagen. Werden die brütenden Stubenvögel gelegentlich durch künstliche Verdunkelung zu längerem Stillsitzen veranlaßt und die verdunkelnden Vorhänge dann entfernt, so sieht man, wie sie die Eier schnell und heftig auseinander werfen, um den Grund der Mulde, die wärmste und deshalb günstigste Pflanzstätte des Gesindels, zu untersuchen, wie dies bei Nichtverdunkelung der Käfige an jedem Bruttage zu wiederholten Malen zu geschehen pflegt. Sobald die Eltern im Neste sich zurücksetzen oder auf den Nestrand stellen, bücken sie sich tief herab, um den Kessel genau zu besichtigen. Wehe dann der Milbe, welche an der Nestwand lagern oder auf den Eiern umherlaufen sollte. Mehr noch als die Alten werden erklärlicherweise die Jungen und zwar von der ersten Lebensstunde an durch die Schmarotzer geplagt. Da die unmündigen Kleinen sich nicht selbst zu helfen vermögen, bedürfen sie besonderer Obhut ihrer Mütter. Wie oft und gern habe ich, dicht über das Nest gelehnt, den mannigfachen Sorgen und Liebesmühen meiner Vögel zugeschaut und mich durch ihre treuherzigen Enthüllungen belehren lassen. Sobald die Jungen abgetrocknet sind und sich vom beschwerlichen Eintritte in die Welt erholt haben, setzt sich die Mutter zurecht und beginnt zu milben. Sie besichtigt ihre Kinder mit leuchtenden Augen von allen Seiten, bewegt sich mit äußerster Vorsicht, um das verhaßte Wild nicht zu verscheuchen, faßt plötzlich zu, ergreift und verzehrt einen Schmarotzer und lauert von neuem. Die Kleinen scheinen sich während der Ausübung dieser niederen Jagd nicht ganz wohl zu fühlen. Der oft lange währende Anstand entzieht ihnen zu viel Wärme, und deshalb versuchen sie oft mühselig, unter den Leib ihrer Mutter zurückzukriechen. Diese aber rückt dann so lange empor, bis jene nicht mehr zu folgen vermögen und wiederum unter mangelnder Wärme leiden. Gelegentlich mit den Milben werden auch die Haarfedern erfaßt, was man aus den häufigen Zuckungen der Jungen deutlich genug entnehmen kann. Zuweilen dauerte mir die Jagd der Eltern so lange, daß ich, aus Sorge für Erkältung der zarten Jungen, durch Anklopfen an das Gebauer Einhalt gebot. Die sorgsame Mutter begnügt sich nicht bloß mit dem Kopfe ihrer Kleinen, sondern untersucht auch Rücken und Seiten, bückt sich selbst bis auf den Grund des Nestes, um womöglich ebenso den Unterleib zu prüfen. Bei einer solchen Gelegenheit warf einmal eine Zeisigmutter ihr nacktes Kind auf den Rücken und überließ mir die Sorge, dasselbe wieder aufzurichten. Um meinen Vögeln die Jagd zu erleichtern, spritzte ich einige Tropfen Insektentinktur ans äußere Nest. Nach wenigen Augenblicken setzten sich die Plagegeister in Bewegung und mit ihnen das Weibchen. Zunächst fing es das auf dem Rande erscheinende Wild; sodann erhob es sich und lehnte sich weit über den Rand hinaus, um die Jagd an der Außenseite fortzusetzen, und erst plötzliche Verfinsterung durch aufsteigende Gewitterwolken geboten seinem Eifer Einhalt. Das Milbengezücht selbst bleibt wegen seiner Kleinheit dem Beobachter meist unsichtbar; gleichwohl sind die Ergebnisse der Jagd deutlich zu erkennen, weil die Verspeisung des kleinen Wildes ungleich auffälligere Schluckbewegungen erfordert als große Bissen, bei denen das Schlucken nur selten bemerkt wird.
»Die Entwickelung der Federn junger Nestvögel geht in der ersten Woche ihres Lebens unverhältnismäßig langsamer von statten als in den folgenden. Eine mitwirkende Ursache liegt außer anderem darin, daß die Mutter kleiner Nesthocker von der zweiten Woche an das Nest häufiger und länger verläßt, Luft und Licht beliebig eindringen und den Kleinen zur Bearbeitung der Federn Gelegenheit gegeben wird. Einen ergötzlichen Anblick gewährt der Eifer, mit welchem die unbehülflichen Vögelchen die Köpfe drehen, um bald an den eben hervorsprießenden, kaum faßbaren Kielen, bald an den nackten Stellen, welche letztere eben erst bilden sollen, zu knabbern. Einen überzeugenden Beweis für diese Meinung lieferten die im Winter ausgebrüteten Kanarienvögel. Der niedrigen Wärme wegen wurden sie von ihren Eltern eifriger bedeckt, als es im Sommer zu geschehen pflegt, und die Folge war, daß sich die Leiber gut entwickelt, die Federn hingegen am elften, zwölften und dreizehnten Lebenstage noch sehr unvollkommen zeigten; ja ein Junges, welches am sechzehnten Lebenstage das Nest freiwillig verlassen hatte, war so schlecht befiedert, daß es von mir noch mehrere Nächte in den Wattenkasten gebracht werden mußte. Beim Verlassen des Nestes ragen, zumal auf dem Kopfe, noch viele ursprüngliche Haarfedern über die anderen empor. Die meisten mögen sich unter die Deckfedern legen; andere werden höchst wahrscheinlich von den Eltern ausgerupft: wenigstens bemerkt man, daß letztere ihre auf den Sprossen sitzenden Kinder eine Zeit lang unbeweglich betrachten, plötzlich zupicken und die Kleinen durch zuckende Bewegungen verrathen, daß ihnen wehe gethan wurde. Junge Kanarienvögel haben die Gewohnheit, im Herbste einander die Rückenfedern bis zur Nacktheit blutrünstig auszureißen; dies aber hört auf, sobald Nachwuchs derselben eingetreten ist. Die Anlegung des Alters- oder zweiten Jugendkleides beansprucht verschieden lange Zeit, meist aber einige Monate.«
Die vorstehend wiedergegebenen unübertrefflichen Beobachtungen sollen, wie ich ausdrücklich hervorheben will, nur für Zeisige, Kanarienvögel und Gimpel Gültigkeit haben; es läßt sich jedoch wohl annehmen, daß sie bis zu einem gewissen Grade sich verallgemeinern lassen. Wenn nicht genau in der gleichen, so doch in ähnlicher Weise verfahren sicherlich auch die übrigen kleinen Nesthocker. Bei größeren Arten ändern sich die Verhältnisse mehr oder weniger. Die zarten Jungen werden allerdings ebenfalls so lange bedeckt, als dies unbedingt nöthig erscheint; ihre eigene Wärme ist jedoch bedeutend größer als die der kleineren Arten, und viele von ihnen schützt außerdem ein wolliges Dunenkleid, welches sie, beispielsweise die Raubvögel, aus dem Eie mit auf die Welt bringen. Mehrere Höhlenbrüter sind infolge ihrer ungeeigneten Schnäbel nicht im Stande, den Koth ihrer Jungen zu entfernen, und dieser sammelt sich dann derart in der Nisthöhlung an, daß letztere zu einer wahren Pestgrube wird; gleichwohl gedeihen die Jungen nicht minder gut als die sorgsam gepflegten der beschriebenen Arten. Andere, wie die Raubvögel z. B., bedürfen in dieser Beziehung elterlicher Fürsorge nicht, sondern erheben sich einfach über den Rand des Nestes und spritzen ihren flüssigen und kreidigen Koth weit von sich, wodurch freilich der Horstrand und dessen Umgebung in widerwärtiger Weise beschmutzt werden. Dem Unrathe gesellen sich bei Raubvögeln und Fleischfressern, beispielsweise Reihern und Scharben, noch allerlei Ueberreste der herbeigetragenen Beute, welche verfaulend unerträglichen Gestank verursachen, so daß die Niststätte besagter Vögel, insbesondere die der stolzesten unter ihnen, aufs äußerste verunziert wird.
Unverhältnismäßig geringer sind die Elternsorgen der Nestflüchter, welche in Beziehung auf Frühreife mit den Wiederkäuern unter den Säugethieren ungefähr auf gleicher Stufe stehen. Unmittelbar nachdem die durch sorgsame Bebrütung gezeitigten Jungen das Ei verlassen haben, ihr dichtes Dunenkleid durch die Wärme der brütenden Mutter abgetrocknet ist, entfernen sie sich mit den Eltern aus dem Neste und sind von nun an mehr oder weniger befähigt, den Alten zu folgen. Die landlebenden Arten durchstreichen nunmehr unter deren Führung Feld und Flur, die schwimmfähigen ziehen mit ihnen wenigstens großentheils auf das Wasser hinaus. Ohne Hülfe sind jedoch weder die einen noch die anderen im Stande, selbständig ihre Wege durchs Leben zu wandeln; auch sie beanspruchen im Gegentheile noch geraume, oft lange Zeit, bevor sie der mütterlichen Obhut entbehren können. Vater und Mutter, wenigstens die letztere, führt und leitet, vereinigt, wärmt und schützt sie gegen mancherlei Gefahren, welche ihnen drohen. Wie uns jedes Haushuhn vorführt, sorgt die Mutter nicht allein durch Aufscharren passender Nahrung für ihre Bedürfnisse, sondern spendet ihnen auch, wenn es ihr nöthig erscheint, mit rührender Hingabe die Wärme ihrer eigenen Brust. Jede die Sonne verhüllende Wolke verursacht ihr Sorge; ein aufsteigendes Gewitter versetzt sie in wahre Todesangst. Mit ihrem eigenen Leibe deckt sie bei fallendem Hagel ihre Brut, und ob auch die herabstürzenden Eisballen sie vernichten sollten; sorglich wählt sie diejenigen Stellen aus, welche die meiste Nahrung versprechen, und auf weit und breit durchstreift sie mit der hungerigen Kinderschar das Brutgebiet, fortwährend bedacht, drohendem Mangel vorzubeugen. So, wie unser Haushuhn, verfahren alle übrigen Scharrvögel, so die meisten Laufvögel, nicht anders auch die Schwimmvögel, welche zu den Nestflüchtern zählen. Treulich betheiligt sich der Schwan, der Gansert an der Sorge um die Jungen; willig nimmt die Entenmutter diese allein auf sich. Sind die Kleinen ermüdet, so bietet sie ihren, durch Lüftung der Flügel etwas verbreiterten Rücken zum bequemen Ruhesitze. Droht jungen Steißfüßen Gefahr, so nehmen die Eltern sie unter ihre Flügel, tauchen mit ihnen herab in die sichere Tiefe, erheben sich sogar mit den zwischen ihren Federn haftenden Küchlein in die Luft und entziehen sie so wenigstens oft den Nachstellungen der Feinde. Diesen gegenüber bethätigen alle Vögel eine Hingabe, welche sie Bedrohung des eigenen Lebens vollständig vergessen läßt, ihr ganzes Wesen verändert und Muth auch in die Seelen der furchtsamsten unter ihnen legt oder sie erfinderisch erscheinen läßt in Verstellungskünsten aller Art. Mit scheinbar gebrochenem Flügel flattert und hinkt die Mutter, bei vielen auch der Vater, angesichts des Feindes dahin, versucht ihn vor allem von den Kindern abzulenken, führt ihn weiter fort, steigert seine Raubgier durch allerlei Geberden, erhebt sich plötzlich, gleichsam frohlockend, um zu den jetzt geborgenen Jungen zurückzukehren, führt diese eiligst weg und überläßt dem bösen Feinde das Nachsehen. Elternsorgen bethätigen auch die Nestflüchter, und Elternliebe bekunden sie in nicht geringerem Grade als die Nesthocker.
Aber weder die einen noch die andern haben ausgesorgt, wenn die Jungen das Nest verlassen haben oder so weit erstarkt sind, daß sie auch wohl ohne die Mutter durchs Leben sich zu helfen vermöchten, mindestens ihre Nahrung zu finden wissen. Denn die Vögel unterrichten ihre Jungen sehr ausführlich in allen Handlungen, welche für die spätere Selbständigkeit unerläßlich sind. Unter gellendem Rufe sehen wir den Mauersegler, sobald die Jungen flugbar geworden sind, durch die Straßen unserer Städte jagen oder unsere Kirchthürme umschweben, in wilder Hast unter allerlei Schwenkungen dahinstürmen, bald hoch zum Himmel aufsteigen, bald dicht über dem Boden dahinstreifen und damit eine Unterrichtsstunde vor unseren Augen abhalten. Es handelt sich darum, die jungen Segler in der schweren Kunst des Fliegens genügend zu üben, zu selbständigem Fange der Kerbthiere, welche die Eltern bis dahin herbeischleppten, anzuhalten und für die demnächst anzutretende Reise vorzubereiten. Bei allen guten Fliegern erfordert solcher Unterricht längere Zeit, bei denen, welche fliegend ihre Nahrung erwerben müssen, besondere Sorgfalt. So vereinigen sich bei den Edelfalken Männchen und Weibchen, um die Kinder zu belehren, wie sie ihre Jagd betreiben sollen. Eines der Eltern fängt eine Beute, fliegt mit ihr weit in die Luft hinaus, erhebt sich allmählich über die folgende Kinderschar und läßt die Beute fallen. Fängt sie eines der Jungen, so belohnt sie ihn für die aufgewandte Mühe; wird sie von allen verfehlt, so greift sie, noch ehe sie den Boden im Fallen berührte, der unter den Kindern einherfliegende Gatte des Elternpaares und schwingt sich nun seinerseits in die Höhe, um dasselbe Spiel zu wiederholen. So sieht man alle Vögel durch Lehre und Beispiel Unterricht ertheilen, und die unendliche Liebe der Eltern bethätigt sich bei dieser Gelegenheit wie bei jeder anderen. Erst wenn die Jungen selbständig geworden und im Gewerbe vollkommen geübt sind, endet solcher Unterricht, und nunmehr wandelt sich die Zuneigung der Eltern oft in das Gegentheil um. Dieselben Vögel, welche bis dahin unermüdlich waren, um ihre Brut zu ernähren und zu unterrichten, vertreiben sie jetzt rücksichtslos aus ihrem Gebiete und kennen sie fortan nicht mehr. Die Kinder hängen mit fast gleicher Zärtlichkeit an ihren Eltern wie letztere an ihnen, obgleich auch in diesem Falle die Selbstsucht jüngerer Wesen zu einem hervorstechenden Zuge wird. Gehorsam und folgsam sind die meisten von ihnen nur so lange, als dieser Gehorsam durch Darreichen von Nahrung belohnt wird; Eigenwille macht sich auch unter den Vogelkindern schon in frühester Jugend geltend und muß zuweilen selbst durch Strafe gebrochen werden. Erst eigene Erfahrung vollendet den Unterricht, so wenig sich auch verkennen läßt, daß Lehre und Beispiel befruchtend wirken.
Erwähne ich nun noch, daß es einzelne Vögel gibt, welche vom ersten Tage ihres Lebens außerhalb des Eies an jeder elterlichen Fürsorge entbehren und dennoch ihre Art erhalten, so habe ich in großen flüchtigen Zügen ein allgemeines Bild des Jugendlebens entrollt.
Mehrere Vögel treten unmittelbar nach vollendeter Brutzeit eine Reise an, welche je nach Art und Familie oder nach Heimat und Wohnkreis, eine längere oder kürzere, ausgedehntere oder beschränktere ist. Wir unterscheiden diese Reisen als Zug, Wanderschaft und Streichen. Unter Zug verstehen wir diejenige Art der Wanderung, welche alljährlich zu bestimmter Zeit stattfindet und in bestimmter Richtung geschieht; unter Wandern ein Reisen, welches bedingt wird durch die Nothwendigkeit, also weder eine bestimmte Zeit, noch Richtung hat, nicht alljährlich geschieht, und endet, wenn seine Ursache aufgehoben wurde; unter Streichen endlich eine Wanderschaft in engeren Grenzen, hervorgerufen durch den Wunsch, einen früheren Wohnsitz gegen einen anderen umzutauschen, von einer gewissen, gerade jetzt in Fülle sich findenden Nahrung Vortheil zu ziehen.
Der Zug ist es, welcher uns im Herbste unsere Sänger nimmt und sie im Frühjahre wiederbringt, welcher unsere Wasservögel vertreibt, noch bevor das Eis ihr Gebiet ihnen unzugänglich macht, welche viele Räuber zwingt, ihrer abgereisten Beute nachzufliegen. Von den europäischen Vögeln ziehen mehr als die Hälfte, von den nordasiatischen und nordamerikanischen verhältnismäßig ebenso viele. Alle wandern in mehr oder weniger südlicher Richtung, die auf der Osthälfte der Erde lebenden von vielen Ländern aus auch nach Südwesten, die auf der Westhälfte wohnenden mehr nach Südosten, entsprechend der Weltlage ihres Welttheiles und der Beschaffenheit des Gürtels, in welchem die Winterherberge liegt. In der Zugrichtung fließende Ströme oder verlaufende Thäler werden zu Heerstraßen, hohe Gebirgsthäler zu Pässen für die Wanderer; in ihnen sammeln sich nach und nach die Reisenden an. Einige ziehen paarweise, andere in Gesellschaft, die schwachen hauptsächlich des Nachts, die starken auch bei Tage. Sie reisen meist so eilig, als ob ein unüberwindlicher Drang sie treibe; sie werden um die Zeit der Reise unruhig, auch wenn sie im Käfige sich befinden, werden es, wenn sie als Junge dem Neste entnommen und in der Gefangenschaft aufgefüttert wurden. Die einen verlassen uns schon früh im Jahre, die anderen viel später, jeder einzelne aber zu einer bestimmten, nur wenig wechselnden Zeit. Diejenigen, welche am spätesten wegzogen, kehren am ersten zurück, die, welche am frühesten uns verließen, kommen am spätesten wieder: der Mauersegler reist schon in den letzten Tagen des Juli ab und stellt sich erst im Mai wieder ein; die letzten Nachzügler wandern erst im November aus und sind bereits im Februar wieder angelangt. Ihre Winterherbergen sind ungemein ausgedehnt; von manchen kennt man die Stätte nicht, in welcher sie endlich Ruhe finden. Mehrere überwintern schon in Südeuropa, viele in Nordafrika zwischen dem siebenunddreißigsten und vierundzwanzigsten Grade der nördlichen Breite; nicht wenige gehen bis tief in das Innere des heißen Gürtels und finden sich während der Wintermonate von der Küste des Rothen oder Indischen Meeres an bis zu der des Atlantischen. Eine ähnliche Herberge bilden Indien, einschließlich der benachbarten großen Inseln Birma, Siam und Südchina. Die nordamerikanischen Vögel reisen bis in den Süden der Vereinigten Staaten und bis nach Mittelamerika. Auch auf der südlichen Halbkugel findet ein regelmäßiger Zug statt. Die Vögel Südamerikas fliegen in nördlicher Richtung bis nach Süd- und Mittelbrasilien, die Südaustraliens wandern nach dem Norden dieses Erdtheiles, theilweise wohl auch bis nach Neuguinea und auf die benachbarten Eilande.
Vor dem Weggange pflegen die Abreisenden Versammlungen zu bilden, welche einige Tage an einer und derselben Stelle verweilen, die einzeln Vorüberziehenden zu sich herbeilocken und endlich, wenn der Schwarm zu einer gewissen Stärke angewachsen ist, mit diesem plötzlich aufbrechen und davon fliegen. Einzelne halten vorher förmliche Musterung über die Mitglieder der Reisegesellschaft. Diese bleibt unterwegs, meist auch in der Winterherberge, mehr oder weniger vereinigt. Reisend beobachten die Zugvögel entweder eine bestimmte Ordnung, gewöhnlich die eines Keiles oder richtiger die zweier gerader Linien, welche in schiefer Richtung gegen einander laufen und vorn an der Spitze sich vereinigen, einem V vergleichbar; andere fliegen in Reihen, andere in einem gewissen Abstande durch einander, in wirren, nach außen hin jedoch einigermaßen gerundeten Haufen. Die meisten streichen in bedeutender Höhe fort, manche stürzen sich aber aus dieser Höhe plötzlich tief nach unten herab, fliegen eine Zeitlang über dem Boden weg und erheben sich allgemach wieder in ihre frühere Höhe. Schwächere Vögel benutzen unterwegs Wälder und Gebüsche zu ihrer Deckung, fliegen wenigstens übertages so viel als möglich von Baum zu Baum, von Wald zu Walde. Laufvögel, denen das Fliegen schwer wird, legen einen guten Theil des Weges zu Fuße, manche Wasservögel geringere Strecken schwimmend zurück. Gegenwind fördert und beschleunigt, Rückwind stört und verlangsamt den Zug, hält ihn wohl auch tagelang auf. Die lebhafte Unruhe, welche aller Gemüther erfüllt, endet erst am Ziele der Reise; jedoch tritt auch dort das gewohnte Leben nicht früher ein, als die neu erwachende Liebe im Herzen sich regt. Nunmehr trennen sich die Gesellschaften, welche auch in der Fremde noch vereinigt blieben, in kleinere Flüge, Trupps oder Paare; alte Ehen werden neu befestigt, junge geschlossen, und singend und werbend kehren die Männchen, beglückend und gewährend die Weibchen heim zur Stätte vorjährigen Glückes oder der Kindheit.
Die Wanderung kann unter Umständen dem Zuge insofern ähnlich werden, als sie zu einer bestimmten Zeit mit größerer oder geringerer Regelmäßigkeit stattfindet. Wandervögel sind viele der im hohen Norden lebenden Arten, welche innerhalb eines gewissen Gebietes wohl alljährlich streichen, aber nicht in allen Jahren weitere Reisen nach milderen oder nahrungreicheren Gegenden und Ländern unternehmen. Eingetretener oder eintretender, vielleicht nur befürchteter Mangel mag die treibende Ursache solcher Wanderungen sein. Alle Vögel, welche ihre Nahrung auf dem Boden suchen, denen also tiefer Schnee den Tisch zeitweilig verdeckt, wandern regelmäßiger als diejenigen, welche im Gezweige Futter finden. Daher erscheinen letztere, insbesondere die Baumsamen- und Beerenfresser, nicht allwinterlich in unseren Gauen, oft viele Jahre nach einander gar nicht, während sie fast unfehlbar bei uns zu Lande sich einstellen, wenn hier Samen und Beeren gut gerathen sind. Inwiefern sie hiervon Kunde erlangen, ist einstweilen noch räthselhaft und verleiht dem Glauben an »Instinkt« eine scheinbare Stütze. Thatsache ist, daß sie an besonders reich beschickter Tafel regelmäßig sich einfinden. Im Gegensatze zu diesen unstäten Reisenden ziehen sich alle Vögel, welche im oberen Gürtel des hohen Gebirges leben, jedes Jahr unregelmäßig in tiefere Gegenden hinab und wandern mit Beginn des Frühlings, ebenfalls zu einer bestimmten Zeit, wieder nach ihrem Standorte zurück; ihre Reise also ist der wirklicher Zugvögel ähnlich.
Das Streichen geschieht während des ganzen Jahres und auf der ganzen Erde. Alle Hagestolzen oder Wittwer streichen, größere Raubvögel schon ihrer Nahrung wegen; andere schweifen im Lande umher, scheinbar mehr zu ihrem Vergnügen, als der Nothwendigkeit folgend; einzelne bewegen sich in sehr engem Kreise, andere durchwandern dabei mehrere Meilen. Unter den Wendekreisländern kann auch diese Art der Ortsveränderung dem Zuge ähnlich werden.
Wie immer der Vogel reisen möge, ob als ziehender Wanderer oder Landstreicher, und wie weit seine Reise sich ausdehne: seine Heimat haben wir immer nur da zu suchen, wo er liebt und sich fortpflanzt. In diesem Sinne darf das Nest das Haus des Vogels genannt werden.
Die Säuger sind die Nutzthiere, die Vögel die Vergnügungsthiere des Menschen. Jene müssen zollen und geben, wenn sie vom Menschen nicht vertilgt werden wollen, diese genießen eine Bevorzugung vor allen übrigen Thieren: sie besitzen des Menschen Wohlwollen und des Menschen Liebe. Die Anmuth ihrer Gestalt, die Schönheit der Farben, die Schnelligkeit und Behendigkeit ihrer Bewegungen, der Wohllaut ihrer Stimme, die Liebenswürdigkeit ihres Wesens ziehen uns unwiderstehlich an. Schon die ersten Menschen, von deren Gefühle wir Kunde haben, befreundeten sich mit den Vögeln; die Wilden nahmen sie unter ihren Schutz; Priester vergangener Zeiten sahen in ihnen heilige Thiere; Dichter des Alterthums und der Gegenwart lassen sich begeistern von ihnen. Ihr Leben, ihre Stimme, ihr Flug, ihre ersichtliche Zufriedenheit mit dem Dasein erhebt und erbaut uns. Ihnen gewähren wir gern die Gastfreundschaft, welche wir den Säugern und noch mehr den Lurchen entschieden versagen, gewähren sie ihnen, auch wenn sie uns wenig Nutzen bringen; unter ihnen werben wir uns mehr Haus- und Stubengenossen als unter allen übrigen Thieren: selbst wenn wir uns anschicken, ihnen mit Netz und Schlinge nachzugehen, wenn wir uns mit ihrer Jagd beschäftigen, erstirbt nicht die Zuneigung, welche wir gegen sie hegen. Sie sind unsere Schoßkinder und Lieblinge. Ihr Leben ist von hoher Bedeutung für unser Besitzthum und Wohlbefinden. Die Vögel bilden ein unentbehrliches Glied in der Reihe der Wesen; sie sind die Wächter des Gleichgewichtes in der Thierwelt und wehren den verderblichen Uebergriffen der anderen Klassen, insbesondere der Kerbthiere, denen preisgegeben die Natur vielleicht veröden würde. Der Nutzen, welchen sie uns bringen, läßt sich allerdings weder berechnen noch abschätzen, weil hierbei ungelöste Fragen in Betracht kommen; wohl aber dürfen wir mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß dieser Nutzen größer ist als der Schaden, welchen die Vögel uns zufügen. Und darum thun wir wohl, sie zu hegen und zu pflegen. Unsere heutige Land- und Forstwirtschaft schädigt gerade die uns besonders werthen Vögel im höchsten Grade; denn sie raubt oder schmälert ihre Aufenthaltsorte, Brutstätten und Wohnplätze, zwingt sie daher, auszuwandern und anderswo ein wirklicheres Heim zu suchen. Hier und da tritt wohl auch der Mensch unmittelbar ihnen entgegen, indem er ihre Nester plündert und ihnen selbst mit Gewehr, Netz und Schlinge nachstellt; doch fallen die Verluste, welche dem Vogelbestande durch Jagd und Fang zugefügt werden, kaum ins Gewicht gegenüber der Schädigung, welche der Bestand durch unsere gegenwärtige Ausnutzung des Grundes und Bodens erleidet. Hege und Pflege der heimischen Vögel wird also nur dann als ersprießlich sich erweisen, wenn wir auf natürlichem oder künstlichem Wege Aufenthaltsorte, Wohnplätze und Brutstätten schaffen, die noch vorhandenen mindestens erhalten. Alle übrigen Maßregeln, welche Gefühlsüberschwenglichkeit, Unkunde, Unwissenheit und Unverstand vorgeschlagen haben, werden die thatsächlich stattfindende Verminderung einzelner Arten ebenso wenig aufhalten, als sie die nicht minder thatsächliche Vermehrung anderer befördern konnten. Gesicherte Wohn- und Niststätten müssen wir erhalten oder schaffen: die Vögel werden auf ihnen von selbst sich einfinden. Nur in diesem Sinne will ich die ernste Mahnung verstanden wissen, welche ich schon seit Jahren allen verständigen Menschen ans Herz lege:
»Schutz den Vögeln!«