
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Der geneigte Leser wird ermahnt, nicht alles für wahr zu halten, was in dieser Erzählung vorkommt. Doch ist sie in einem schönen Buch beschrieben und zu Vers gebracht.
Der Zundelheiner und der Zundelfrieder trieben von Jugend auf das Handwerk ihres Vaters, der bereits am Auerbacher Galgen mit des Seilers Tochter kopuliert war, nämlich mit dem Strick; und ein Schulkamerad, der rote Dieter, hielt's auch mit und war der jüngste. Doch mordeten sie nicht und griffen keine Menschen an, sondern visitierten nur so bei Nacht in den Hühnerställen, und wenn's Gelegenheit gab, in den Küchen, Kellern und Speichern, allenfalls auch in den Geldtrögen, und auf den Märkten kauften sie immer am wohlfeilsten ein. Wenn's aber nichts zu stehlen gab, so übten sie sich untereinander mit allerlei Aufgaben und Wagstücken, um im Handwerk weiterzukommen. Einmal im Wald sieht der Heiner auf einem hohen Baum einen Vogel auf dem Nest sitzen, denkt, er hat Eier, und fragte die andern: »Wer ist imstand und holt dem Vogel dort oben die Eier aus dem Nest, ohne daß es der Vogel merkt?« Der Frieder, wie eine Katze, klettert hinauf, naht sich leise dem Nest, bohrt langsam ein Löchlein unten drein, läßt ein Eilein nach dem andern in die Hand fallen, flickt das Nest wieder zu mit Moos und bringt die Eier. – »Aber wer dem Vogel die Eier wieder unterlegen kann,« – sagte jetzt der Frieder, »ohne daß es der Vogel merkt!« Da kletterte der Heiner den Baum hinan, aber der Frieder kletterte ihm nach, und während der Heiner dem Vogel langsam die Eier unterschob, ohne daß es der Vogel merkte, zog der Frieder dem Heiner langsam die Hosen ab, ohne daß es der Heiner merkte. Da gab es ein groß Gelächter, und die beiden andern sagten: »Der Frieder ist der Meister.« Der rote Dieter aber sagte: »Ich sehe schon, mit Euch kann ich's nicht zugleich tun, und wenn's einmal zu bösen Häusern geht und der Unrechte kommt über uns, so ist's mir nimmer Angst für Euch, aber für mich.« Also ging er fort, wurde wieder ehrlich, und lebte mit seiner Frau arbeitsam und häuslich. Im Spätjahr, als die zwei andern, noch nicht lang, auf dem Roßmarkt ein Rößlein gestohlen hatten, besuchten sie einmal den Dieter und fragten ihn, wie es ihm gehe; denn sie hatten gehört, daß er ein Schwein geschlachtet, und wollten ein wenig acht geben, wo es liegt. Es hing in der Kammer an der Wand. Als sie fort waren, sagte der Dieter: »Frau, ich will das Säulein in die Küche tragen und die Mulde drauf decken, sonst ist es morgen nimmer unser.« In der Nacht kommen die Diebe, brechen, so leise sie können, die Mauer durch, aber die Beute war nicht mehr da. Der Dieter merkt etwas, steht auf, geht um das Haus und sieht nach. Unterdessen schleicht der Heiner um das andere Eck herum ins Haus bis zum Bett, wo die Frau lag, nimmt ihres Mannes Stimme an und sagt: »Frau, die Sau ist nimmer in der Kammer.« Die Frau sagt: »Schwätz nicht so einfältig! Hast du sie nicht selber in die Küche unter die Mulde getragen?« »Ja so,« sagte der Heiner, »drum bin ich halb im Schlaf,« und ging, holte das Schwein und trug es unbeschrien fort, wußte in der finstern Nacht nicht, wo der Bruder ist, dachte, er wird schon kommen an den bestellten Platz im Wald. Und als der Dieter wieder ins Haus kam und nach dem Säulein greifen will, »Frau,« rief er, »jetzt haben's die Galgenstricke doch geholt.« Allein, so geschwind gab er nicht gewonnen, sondern setzte den Dieben nach, und als er den Heiner einholte (er war schon weit vom Hause weg) und als er merkte, daß er allein sei, nahm er schnell die Stimme des Frieders an und sagte: »Bruder, laß jetzt mich das Säulein tragen, du wirst müde sein.« Der Heiner meint, es sei der Bruder und gibt ihm das Schwein, sagt, er wolle vorausgehen in den Wald, und ein Feuer machen. Der Dieter aber kehrte hinter ihm um, sagte für sich selber: »Hab' ich dich wieder, du liebes Säulein?« und trug es heim. Unterdessen irrte der Frieder in der Nacht herum, bis er im Wald das Feuer sah und kam, und fragte den Bruder: »Hast du die Sau, Heiner?«. Der Heiner sagte: »Hast du sie denn nicht, Frieder?« Da schauten sie einander mit großen Augen an, und hätten kein so prasselndes Feuer von buchenen Spänen gebraucht zum Nachtkochen. Aber desto schöner prasselte jetzt das Feuer daheim in Dieters Küche. Denn das Schwein wurde sogleich nach der Heimkunft verhauen, und Kesselfleisch über das Feuer getan. Denn der Dieter sagte: »Frau, ich bin hungrig, und was wir nicht beizeiten essen, holen die Schelme doch.« Als er sich aber in einen Winkel legte und ein wenig schlummerte, und die Frau kehrte mit der eisernen Gabel das Fleisch herum, und schaute einmal nach der Seite, weil der Mann im Schlaf so seufzte, kam eine zugespitzte Stange langsam durch das Kamin herab, spießte das beste Stück im Kessel an, und zog's herauf: und als der Mann im Schlaf immer ängstlicher winselte, und die Frau immer emsiger nach ihm sah, kam die Stange zum zweitenmal: und als die Frau den Dieter weckte: »Mann, jetzt wollen wir anrichten,« da war der Kessel leer, und wär' ebenfalls kein großes Feuer nötig gewesen zum Nachtkochen. Als sie aber beide schon im Begriff waren, hungrig ins Bett zu gehen, und dachten: will der Henker das Säulein holen, so können wir's ja doch nicht haben, da kamen die Diebe vom Dach herab, durch das Loch der Mauer in die Kammer, und aus der Kammer in die Stube, und brachten wieder, was sie gemaust hatten. Jetzt ging ein fröhliches Leben an. Man aß und trank, man scherzte und lachte, als ob man gemerkt hätte, es sei das letzte Mal, und war guter Dinge, bis der Mond im letzten Viertel über das Häuslein wegging, und zum zweitenmal im Dorf die Hahnen krähten, und von weitem der Hund des Metzgers bellte. Denn die Strickreiter waren auf der Spur, und als die Frau des roten Dieter sagte: »Jetzt ist's einmal Zeit ins Bett,« kamen die Strickreiter, von wegen des gestohlenen Rößleins, und holten den Zundelheiner und den Zundelfrieder in den Turm und in das Zuchthaus.
Als der Zundelheiner und der Zundelfrieder wieder aus dem Turm kamen, sprach der Heiner zum Frieder: »Bruder, wir wollen doch den roten Dieter besuchen, sonst meint er, wir sitzen ewig in dem kalten Hundsstall beim Herrn Vater auf der Herberge.« – »Wir wollen ihm einen Streich spielen,« sagte der Frieder zum Heiner, »ob er's merkt, daß wir's sind.« Also empfing der Dieter ein Brieflein ohne Unterschrift: »Roter Dieter, seid heute nacht auf Eurer Hut, denn es haben zwei Diebsgesellen eine Wette getan: Einer will Eurer Frau das Leintuch unter dem Leibe wegholen, und Ihr sollt es nicht hindern können.« Der Dieter sagte: »Da sind zwei rechte Spitzbuben aneinander. Der eine wettet, er wolle das Leintuch holen, und der andere macht einen Bericht, damit sein Kamerad die Wette nicht gewinnt. Wenn ich nicht gewiß wüßte, daß der Heiner und der Frieder im Zuchthaus sitzen, so wollt ich glauben, sie wären es.« In der Nacht schlichen die Schelme durch das Hanffeld heran. Der Heiner stellte eine Leiter ans Fenster, also daß der rote Dieter es wohl hören konnte, und steigt hinauf, schiebt aber einen ausgestopften Strohmann vor sich her, der aussah, wie ein Mensch. Als inwendig der rote Dieter die Leiter anstellen hörte, stand er leise auf und stellte sich mit einem dicken Bengel neben das Fenster: denn das sind die besten Pistolen, sagte er zu seiner Frau, die sind immer geladen: und als er den Kopf des Strohmanns heraufwackeln sah, und meinte, der sei es, riß er schnell das Fenster auf, und versetzte ihm einen Schlag auf den Kopf, aus aller Kraft, also daß der Heiner den Strohmann fallen ließ und einen lauten Schrei tat. Der Frieder aber stand unterdessen mausstill hinter einem Pfosten vor der Haustüre. Als aber der rote Dieter den Schrei hörte, und es war alles auf einmal still, sagte er: »Frau, es ist mir, die Sache sei nicht gut, ich will doch hinuntergehen und schauen, wie es aussieht.« Indem er zur Haustüre hinausgeht, schleicht der Frieder, der hinter dem Pfosten war, hinein, kommt bis vor das Bett, nimmt wieder, wie in der vorigen Erzählung, als sie das Säulein stahlen, des roten Dieters Stimme an, und es ist wieder eben so wahr. »Frau,« sagte er mit ängstlicher Stimme, »der Kerl ist maustot, und denk' nur, es ist des Schultheißen Sohn, Jetzt gib mir geschwind das Leintuch, so will ich ihn darin forttragen in den Wald und will ihn dort einscharren, sonst geht's zu bösen Häusern.« Die Frau erschrickt, richtet sich auf und gibt ihm das Leintuch. Kaum war er fort, so kommt der rechte Dieter wieder und sagt ganz getröstet: »Frau, es ist nur ein dummer Bubenstreich gewesen, und der Dieb ist von Stroh.« Als aber die Frau ihn fragte, »wo hast du denn das Leintuch,« und lag auf dem bloßen Spreuersack, da gingen dem Dieter erst die Augen auf, und sagte: »O ihr vermaledeiten Spitzbuben! Jetzt ist's doch der Frieder gewesen und der Heiner, und kein anderer.«
Aber auf dem Heimweg sagte der Frieder zum Heiner: »Aber jetzt, Bruder, wollen wir's bleiben lassen. Denn im Zuchthaus ist doch auch alles schlecht, was man bekommt, ausgenommen die Prügel, und zum Fensterlein hinaus, auf der Landstraße, hat man etwas vor den Augen, das auch nicht aussieht, als wenn man gern dran hängen möchte.« Also wurde auch der Frieder wieder ehrlich. Aber der Heiner sagte: »Ich geb's noch nicht auf.«
Eines Tages sah der Heiner ganz betrübt in einem Wirtshaus und dachte daran, wie ihn zuerst der rote Dieter und danach sein eigener Bruder verlassen haben, und wie er jetzt allein ist. »Nein,« dachte er, »es ist bald keinem Menschen mehr zu trauen, und wenn man meint, es sei einer noch so ehrlich, so ist er ein Spitzbube.«
Unterdessen kommen mehrere Gäste in das Wirtshaus und trinken Neuen, und wißt Ihr auch, sagte einer, daß der Zundelheiner im Land ist, und wird morgen im ganzen Amt ein Treibjagen auf ihn angestellt, und der Amtmann und die Schreiber stehen auf dem Anstand? Als das der Heiner hörte, wurde es ihm grün und gelb vor den Augen, denn er dachte, es kenne ihn einer und jetzt sei er verraten. Ein anderer aber sagte: »Es ist wieder einmal ein blinder Lärm. Sitzt nicht der Heiner und sein Bruder zu Wollenstein im Zuchthaus?« Drüber kommt, auf einem wohlgenährten Schimmel, der Brassenheimer Müller mit roten Pausbacken und kleinen freundlichen Augen dahergeritten. Und als er in die Stube kam und tut den Kameraden, die bei dem Neuen sitzen, Bescheid und hört, daß sie von dem Zundelheiner sprechen, sagt er: »Ich hab' schon so viel von dem Zundelheiner erzählen gehört. Ich möcht' ihn doch auch einmal sehen.« Da sagte ein anderer: »Nehmt Euch in acht, daß Ihr ihn nicht zu früh zu sehen bekommt. Es geht die Rede, er sei wieder im Land.« Aber der Müller mit seinen Pausbacken sagte: »Pah! ich komm' noch bei guter Tageszeit durch den Fridstädter Wald, dann bin ich auf der Landstraße, und wenn's fehlen will, geb' ich dem Schimmel die Sporen.« Als das der Heiner hörte, fragte er die Wirtin, was bin ich schuldig, und geht fort in den Fridstädter Wald. Unterwegs begegnet ihm auf der Bettelfuhr ein lahmer Mensch. Gebt mir für ein Käsperlein Eure Krücke, sagt er zu dem lahmen Soldaten. Ich habe das linke Bein übertreten, daß ich laut schreien möchte, wenn ich drauf treten muß. Im nächsten Dorf, wo Ihr abgeladen werdet, macht Euch der Wagner eine neue. Also gab ihm der Bettler die Krücke. Bald darauf gehen zwei betrunkene Soldaten an ihm vorbei und singen das Reiterlied. Wie er in den Fridstädter Wald kommt, hängt er die Krücke an einen hohen Ast, setzt sich ungefähr sechs Schritte davon weg an die Straße und zieht das linke Bein zusammen, als wenn er lahm wäre. Drüber kommt auf stattlichem Schimmel der Müller daher trottiert und macht ein Gesicht, als wenn er sagen wollte: »Bin ich nicht der reiche Müller, und bin ich nicht der schöne Müller, und bin ich nicht der witzige Müller?« Als aber der witzige Müller zu dem Heiner kam, sagt der Heiner mit kläglicher Stimme: »Wolltet Ihr nicht ein Werk der Barmherzigkeit tun an einem armen lahmen Mann. Zwei betrunkene Soldaten, sie werden Euch wohl begegnet sein, haben mir all mein Almosengeld abgenommen und haben mir aus Bosheit, daß es so wenig war, die Krücke auf jenen Baum geschleudert, und sie ist an den Ästen hängen blieben, daß ich nun nimmer weiter kann. Wollt Ihr nicht so gut sein und sie mit Eurer Peitsche herabzwicken?« Der Müller sagte: »Ja, sie sind mir begegnet an der Waldspitze. Sie haben gesungen: So herzig, wie mein Liesel, ist halt nichts auf der Welt!« Weil aber der Müller auf einem schmalen Steg über einen Graben zu dem Baume mußte, so stieg er von dem Roß ab, um die Krücke herabguzwicken. Als er aber an dem Baum war und schaut hinauf, schwingt sich der Heiner schnell, wie ein Adler, auf den stattlichen Schimmel, gibt ihm mit dem Absatz die Sporen und reitet davon. »Laßt Euch das Gehen nicht verdrießen,« rief er dem Müller Zurück, »und wenn Ihr heim kommt, so richtet Eurer Frau einen Gruß aus von dem Zundelheiner!« Als er aber, eine Viertelstunde nach Betzeit, nach Brassenheim und an die Mühle kam, und alle Räder klapperten, daß ihn niemand hörte, stieg er vor der Mühle ab, band dem Müller den Schimmel wieder an der Haustüre an und setzte seinen Weg zu Fuß fort.
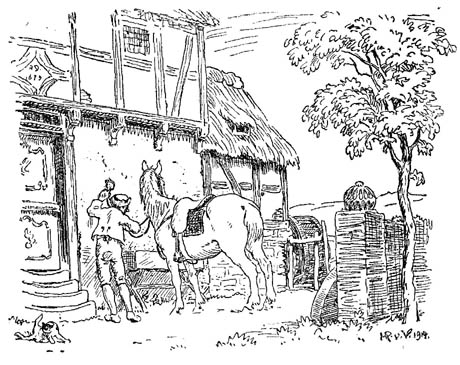
Eines Tages, als der Frieder den Weg aus dem Zuchthause allein gefunden hatte und dachte: »Ich will so früh den Zuchtmeister nicht wecken,« und als schon auf allen Straßen Steckbriefe voranflogen, gelangte er abends, noch unbeschrien, an ein Städtlein, nahe bei der Grenze. Als ihn hier die Schildwache anhalten wollte, wer er sei und wie er hieße, und was er im Schilde führe: »Könnt Ihr polnisch?« fragte herzhaft der Frieder die Schildwache. Die Schildwache sagt: »Ausländisch kann ich ein wenig, ja! aber Polnisch bin ich noch nicht darunter gewahr worden.« – »Wenn das ist,« sagte der Frieder, »so werden wir uns schlecht gegeneinander explizieren können. Ob kein Offizier oder Wachtmeister am Tor sei?« Die Schildwache holt den Torwächter, es sei ein Pollack an dem Schlagbaum, gegen den sie sich schlecht explizieren könne. Der Torwächter kam zwar, entschuldigte sich aber zum Voraus, viel polnisch verstehe er auch nicht. »Es geht hier zu Land nicht stark ab,« sagte er, »und es wird im ganzen Städtel schwerlich jemand sein, der kapabel wäre, es zu dolmetschen.« – »Wenn ich das wüßte,« sagte der Frieder und schaute auf die Uhr, die er unterwegs noch an einem Nagel gefunden hatte, »so wollte ich ja lieber noch ein paar Stunden zustrecken, bis in die nächste Stadt. Um neun Uhr kommt der Mond.« Der Torhüter sagte: »Es wäre unter diesen Umständen fast am besten, wenn Ihr gerade durchpassiertet, ohne Euch aufzuhalten, das Städtel ist ja nicht groß,« und war froh, daß er seiner los ward. Also kam der Frieder glücklich durch das Tor hinein. Im Städtlein hielt er sich nicht länger auf, als nötig war, einer Gans, die sich auf der Gasse verspätet hatte, ein paar gute Lehren zu geben. »In Euch Gänse,« sagte er, »ist keine Zucht zu bringen. Ihr gehört, wenn's Abend ist, ins Haus oder unter gute Aufsicht.« Und so packte er sie mit sicherem Griff am Hals, und mir nichts, dir nichts unter den Mantel, den er ebenfalls unterwegs von einem Unbekannten geliehen hatte. Als er aber an das andere Tor gelangte und auch hier dem Landfrieden nicht traute, drei Schritte von dem Schilderhaus, als sich inwendig der Söldner rührte, schrie der Frieder mit herzhafter Stimme: »Wer da!« Der Söldner antwortete in aller Gutmütigkeit: »Gut Freund!« Also kam der Frieder wieder glücklich zum Städtlein hinaus und über die Grenzen.

Als der Zundelfrieder bald alle listigen Diebesstreiche durchgemacht und fast ein Überleid daran bekommen hatte, denn der Zundelfrieder stiehlt nie aus Not oder aus Gewinnsucht oder aus Liederlichkeit, sondern aus Liebe zur Kunst und zur Schärfung des Verstandes; hat er nicht dem Brassenheimer Müller den Schimmel selber wieder an die Tür gebunden? Eines Abends, als er, wie gesagt, fast alles durchgemacht hatte, dachte er: »Jetzt will ich doch auch einmal probieren, wie weit man mit der Ehrlichkeit kommt. Also stahl er in selbiger Nacht eine Geiß, drei Schritte von der Scharwache, und ließ sich attrappieren. Den anderen Tag im Verhör gestand er alles. Wie er aber bald merkte, daß ihm der Richter fünfundzwanzig oder etwas zum Andenken wollte mitgeben lassen, dachte er: »Ich bin noch nicht ehrlich genug.« Deswegen verschnappte er sich noch ein wenig mit den Redensarten und gestand bei der weiteren Untersuchung nach kurzem Widerstand, wie er von jeher ein halber Kakerlak gewesen sei, das heißt, ein Mensch, der bei Nacht fast besser sieht als am Tag, und als ihn der Richter aufs Eis führen wollte, ob er nicht noch von ein paar andern Diebstählen wisse, die kürzlich begangen worden, sagte er, allerdings wisse er davon, und er sei derjenige. Als ihm den andern Morgen der Spruch bekanntgemacht wurde, er müsse ins Zuchthaus, und der Stadtsoldat, der ihn begleiten sollte, stand schon vor der Tür; denn es war zwanzig Stunden weit, sagte er ganz reumütig: »Recht findet seinen Knecht. Was ich verdient habe, wird mir werden.« Unterwegs erzählte er dem Stadtsoldaten, er sei auch schon Militär gewesen. »Bin ich nicht sechs Jahre bei Klebecks Infanterie in Dienst gewesen? Könnt ich Euch nicht sieben Wunden zeigen aus dem Scheldekrieg, den der Kaiser Joseph mit den Holländern führen wollte.« Der treuherzige Begleiter sagte: »Ich hab's nie weiter bringen können als zum Stadtsoldaten. Eigentlich wär' ich ein Nagelschmied. Aber die Zeiten sind schlimm.« – »Im Gegenteil,« sagte der Frieder, »ein Stadtsoldat ist mir respektabler als ein Feldsoldat. Denn Stadt ist mehr als Feld, deswegen avanciert der Feldsoldat in seinem Alter noch zum Stadtsoldaten. Zudem, der Stadtsoldat wacht für seiner Mitbürger Leben und Eigentum, für eigen Weib und Kind. Der Kriegssoldat zieht ins Feld und kämpft, er weiß nicht für wen und nicht für was. Zudem,« sagte er, »kann ein Stadtsoldat, wenn er nichts Ungeschicktes begangen hat, mit Ehren sterben, wann er will. Unsereiner muß sich schon drum totstechen lassen. Ich versichere Euch,« fuhr er fort, »ich und meine Feinde (er meinte die Strickreiter) wir haben wenig Ehre davon, daß ich noch lebe.« Der Nagelschmied wurde über diese ehrenvolle Vergleichung so gerührt, daß er bei sich selbst dachte, einen so gütigen und herablassenden Arrestanten habe er noch nicht leicht transportiert, und der Frieder ging immer mit großen Schritten voraus, um den Nagelschmied recht müde und trocken zu machen in der Sonnenhitze. »Darin unterscheiden sich die Feldsoldaten von den Stadtsoldaten,« sagte er, »daß sie an einen weiten Schritt gewöhnt sind von dem Marsch.« Abends um vier Uhr, als sie in ein Dörflein kamen und an ein Wirtshaus, »Kamerad,« sagte der Frieder, »wollen wir nicht einen Schoppen trinken?« – »Herr Kamerad,« erwiderte der Nagelschmied, »was ihm recht ist, ist mir auch recht.« Also tranken sie miteinander einen Schoppen, auch eine halbe Maß, auch eine Maß, auch zwei, und Brüderschaft ohnehin, und der Frieder erzählte immerfort von seinen Kriegsaffären, bis der Nagelschmied vor Schwere des Weins und Müdigkeit einschlief. Als er nach einigen Stunden wieder aufwachte und den Frieder nimmer sah, war sein erster Gedanke: »Was gilt's, der Herr Bruder ist alsgemach vorausgegangen.« Nein, er stand nur ein wenig draußen vor der Türe; denn der Frieder geht nicht leicht leer fort. Als er wieder hereinkam, sagte er: »Herr Bruder, der Mond will bald aufgehen.« Der Nagelschmied, schläfrig und träge, sagte: »Wie der Herr Bruder meint.« In der Nacht, als der Nagelschmied fest schlief und alle Töne aus dem Baß in den Diskant und wieder in den Baß durchschnarchte, der Frieder aber nicht schlafen konnte, stand der Frieder auf, visitierte für Zeitvertreib des Herrn Bruders Taschen und fand unter anderm das Schreiben, das wegen seiner dem Stadtsoldaten an den Zuchthausverwalter war mitgegeben worden. Hierauf probierte er für Zeitvertreib des Herrn Bruders Monturstiefel an. Sie waren ihm recht. Hierauf ließ er sich für Zeitvertreib durch das Fenster auf die Gasse herab und ging des geraden Weges fort, so weit ihm der Mond leuchtete. Als der Nagelschmied früh erwachte und den Herrn Bruder nimmer gewahr wurde, dachte er: »Er wird wieder ein wenig draußen sein.« Freilich war er wieder ein wenig draußen, und als er den Tag erlaufen hatte, im ersten Dorf, das ihm am Weg war, weckte er den Schulzen. »Herr Schulz, es ist mir ein Unglück passiert. Ich bin ein Arrestant, und der Stadtsoldat von da und da, der mich transportieren sollte, ist mir abhanden gekommen. Geld habe ich keins. Weg und Steg kenn' ich nicht, also laßt mir auf Gemeindekosten eine Suppe kochen und verschafft mir einen Wegweiser in die Stadt ins Zuchthaus.« Der Schulz gab ihm einen Schein an den Gemeindewirt auf eine Mehlsuppe und einen Schoppen Wein und schickte nach einem armen Mädchen. »Geh' ins Wirtshaus und zeige dem Mann, der dort frühstückt, wenn er fertig ist, den Weg und die Stadt: er will ins Zuchthaus.« Als der Frieder mit dem Mädchen aus dem Wald und über die letzten Hügel gekommen war, sagte er zu dem Mädchen: »Geh' jetzt nur nach Haus, mein Kind, jetzt kann ich nimmer verirren.« In der Stadt, bei den ersten Häusern, fragte er ein Büblein auf der Gasse: »Büblein, wo ist das Zuchthaus,« und als er es gefunden und vor den Zuchthausverwalter gekommen war, übergab er ihm das Schreiben, das er dem Nagelschmied aus der Tasche genommen hatte. Der Verwalter las und las und schaute zuletzt den Frieder mit großen Äugen an. »Guter Freund,« sagte er, »das ist schon recht. Aber wo habt Ihr denn den Arrestanten? Ihr sollt ja einen Arrestanten abliefern.« Der Frieder antwortete gang verwundert: »Ei, der Arrestant bin ich selber.« Der Verwalter sagte: »Guter Freund, es scheint, Ihr wollt Spaß machen. Hier spaßt man nicht. Gesteht's, Ihr habt den Arrestanten entwischen lassen! Ich seh' es aus allem.« Der Frieder sagte: »Wenn Sie es aus allem sehen, so will ich's nicht leugnen. Wenn mir aber Ihro Exzellenz,« sagte er zu dem Verwalter, »einen Berittenen mitgeben wollen, so getrau ich mir, den Vagabunden noch einzusaugen. Denn es ist kaum eine Viertelstunde, daß er mir aus den Augen gekommen ist.« – »Einfältiger Tropf,« sagte der Verwalter, »was nützt dem Berittenen die Geschwindigkeit des Rosses, wenn er mit einem Unberittenen reiten soll. Könnt Ihr reiten?« Der Frieder sagte: »Bin ich nicht sechs Jahre Württemberger Dragoner gewesen?« – »Gut,« erwiderte der Verwalter, »man wird für Euch ebenfalls ein Roß satteln lassen, und zwar für Euer eigen gutes Geld, ein andermal gebt Achtung,« und verschaffte ihm in der Eile ein offenes Ausschreiben an alle Ortsvorgesetzte, auf daß, wenn er Mannschaft nötig habe zum Streif. Also ritten der Strickreiter und der Zundelfrieder miteinander dahin, um den Zundelfrieder aufzusuchen, bis an einen Scheideweg. An dem Scheideweg sagte der Frieder dem Strickreiter, auf welchem Weg der Strickleiter reiten soll und welchem er selber reiten wolle. »Am Rhein an der Fahrt kommen wir wieder zusammen.« Als sie aber einander aus den Augen verloren hatten, wendete sich der Frieder wieder rechts und machte mit seinem Ausschreiben in allen Dörfern Lärm und ließ die Sturmglocken anziehen, der Zundelfrieder sei im Revier, bis er an der Grenze war. An der Grenze aber gab er dem Rößlein einen Fitzer und ritt hinüber.

In einer niederländischen Stadt in einem Wirtshaus waren viele Leute beisammen, die einander einesteils kannten, zum Teil auch nicht, denn es war ein Markttag. Den Zundelfrieder kannte niemand. »Gebt mir auch noch ein Schöpplein,« sagte ein dicker, bürgerlich gekleideter Mann zu dem Wirt und nahm eine Prise Tabak aus einer schweren, silbernen Dose. Doch sah der Zundelfrieder zu, wie ein windiger, gewürfelter Gesell sich zu dem dicken Mann stellte, ein Gespräch mit ihm anfing und ein paarmal, wie von ungefähr, nach der Rocktasche schaute, in welche der Mann die Dose gesteckt hatte. Was gilt's, dachte der Frieder, der führt auch etwas im Schild. Anfänglich stand der Gesell. Hernach lieh er ein Schöpplein kommen, setzte sich auf die Bank und sprach mit dem Dicken allerlei kuriose Sachen, woran dieser Mann viel Spaß fand. Endlich kam ein Dritter. »Exküse,« sagte der Dritte, »kann man auch ein wenig Platz hier haben?« Also rückte der windige Gesell ganz nahe an den dicken Mann hin und diskurrierte immerfort: »Ja,« sagte er, »ich habe mich ein rechtes verwundert, als ich in dieses Land kam und sah, wie die Windmühlen so geschwind vom Winde umgetrieben werden. Bei mir zu Land geht das ganze Jahr kein Lüftlein. Also muß man die Windmühlen anlegen, wo die Wachteln ihren Strich haben. Wenn nun im Frühjahr die Million tausend Wachteln kommen vom Meer aus Afrika und fliegen über die Mühlenräder, so fangen die Mühlen an zu gehen, und wer in dieser Zeit nicht kann mahlen lassen, hat das ganze Jahr kein Mehl im Haus.« Darüber geriet der dicke Mann so ins Lachen, daß ihm fast der Atem verging, und unterdessen hatte der schlaue Gesell die Dose. »Aber jetzt hört auf,« sagte der Dicke. »Es tut mir weh im Kreuz,« und schenkte ihm von seinem Wein auch ein Glas ein. Als der Spitzbube ausgetrunken hatte, sagte er: »Der Wein ist gut, er treibt. Exküse,« sagte er zu dem Dicken, der vorn an ihm saß, »laßt mich einen Augenblick heraus!« Den Hut hatte er schon auf. Als er aber zur Tür hinausging und fortwollte, ging ihm der Zundelfrieder nach, nahm ihn draußen auf die Seite und sagte zu ihm: »Wollt Ihr mir auf der Stelle meines Herrn Schwagers silberne Dose herausgeben? Meint Ihr, ich hab's nicht gemerkt. Oder soll ich Lärm machen? Ich hab' Euch schonen wollen vor den vielen Leuten, die drin in der Stube sitzen.« Als nun der Dieb sah, daß er verraten sei, gab er zitternd dem Frieder die Dose her und bat ihn vor Gott und nach Gott, stille zu sein. »Seht,« sagte der Frieder, »in solche Not kann man kommen, wenn man auf bösen Wegen geht. Euer Lebenlang laßt es Euch zur Warnung dienen. Unrecht Gut gedeihet nicht. Ehrlich währt am längsten.« Den Hut hatte der Frieder auch schon auf. Also gab er dem Gesellen noch eine Prise Tabak aus der Dose und trug sie hernach zu einem Goldschmied.
Bei einem Goldschmied kauften zwei vornehm gekleidete Personen für 3000 Taler kostbare Kleinode für die Krönung in Ungarn. Hernach bezahlten sie ihm tausend Taler bar, legten alles, was sie ausgesucht hatten, in ein Schächtelchen zusammen, siegelten das Schächtelchen zu und gaben es dem Goldschmied in Verwahrung, gleichsam als Pfand, daß sie in einigen Tagen die noch fehlenden 2000 Taler zahlen würden. Wenigstens kam es dem Goldschmied so vor, als ob es das nämliche Kästchen sei. »In vierzehn Tagen«, sagten sie, »bringen wir Euch die fehlende Summe und nehmen alsdann das Schächtelchen in Empfang.« Alles wurde schriftlich gemacht. Allein es vergehen drei Wochen, niemand meldet sich. Der Krönungstag geht vorüber, es gehen noch vier Wochen vorüber. Niemand will mehr nach dem Schächtelchen fragen. Endlich dachte der Goldschmied: »Was soll ich nun Euer Eigentum hüten auf meine Gefahr und mein Kapital tot drin liegen haben?« Also wollte er das Schächtelchen im Beisein einer obrigkeitlichen Person öffnen und die bereits empfangenen tausend Taler für die Käufer hinterlegen. Als es aber geöffnet ward, – »lieber, guter Goldschmied«, sagte der Aktuar, »wie seid Ihr von den beiden Spitzbuben angeschmiert!« Nämlich in dem Schächtelein lagen, statt Edelgestein, Kieselstein und Fensterblei statt Goldes. Die zwei Kaufleute waren spitzbübische Taschenspieler, hatten das wahre Schächtelein unvermerkt auf die Seite gebracht und dem Goldschmied ein anderes zurückgegeben, das ebenso aussah. »Goldschmied,« sagte der Aktuar, »hier ist guter Rat teuer. Ihr seid ein unglücklicher Mann.« Indem trat wohlgekleidet und ehrbar ein Fremder zur Türe herein und wollte dem Goldschmied allerlei Silbergeschirr und goldene Schnallen verkaufen und hörte den Spektakel. »Goldschmied,« sagte er, als der Aktuar fort war, »Euer Lebelang müßt Ihr Euch nicht mit den Schreibern einlassen. Haltet Euch an praktische Männer! Habt Ihr das Herz, eine Wurst gegen eine Speckseite zu setzen, so ist Euch zu helfen. Wenn Euer Schächtelein noch in der Welt ist, so schaff' ich Euch die Spitzbuben wieder ins Haus.« – »Um Vergebung, wer seid Ihr?« fragte der Goldschmied. – »Ich bin der Zundelfrieder,« erwiderte der Fremde mit Vertrauen und einem recht liebenswürdig freundlichen Spitzbubengesicht. Ob nun der Goldschmied dachte, daß man Spitzbuben am besten mit Spitzbuben fangen könne, oder ob er dachte, daß, wer das Roß geholt, der hole auch den Zaum; kurz, er vertraute sich dem Frieder an. »Aber ich bitte Euch,« sagte er, »betrügt mich nicht.« »Verlaßt Euch auf mich,« sagte der Frieder, »und erschreckt nicht allzusehr, wenn Ihr morgen früh wieder um etwas klüger geworden seid!« Vielleicht ist der Frieder auf einer Spur? Nein, er ist noch auf keiner. Aber wer in selbiger Nacht dem Goldschmied auch noch vier Dutzend silberne Löffel, sechs silberne Salzbüchslein, sechs goldene Ringe mit kostbaren Steinen holte, das war der Frieder. Dem Goldschmied war es recht. Nämlich auf dem Tische fand er von dem Zundelfrieder einen eigenhändigen Empfangsschein, daß er obige Artikel richtig empfangen habe, und ein Schreiben, wie sich der Goldschmied nun weiter zu verhalten habe. Er zeigte jetzt, nach des Frieders Anleitung, den Diebstahl beim Amt an und bat um eine Besichtigung. Hernach bat er den Amtmann, die gestohlenen Artikel in allen Zeitungen bekannt zu machen. Dann bat er, auch das versiegelte Kästchen, das ihm die Spitzbuben zurückgelassen hatten, mit einer genauen Beschreibung in das Verzeichnis zu setzen. Der Amtmann bewilligte ihm den Wunsch. »Einem honetten Goldschmied,« dachte er, »kann man etwas zum Gefallen tun.« Also kommt es in alle Zeitungen, dem Goldschmied sei gestohlen worden das und das, unter anderem ein Schächtelein so und so, mit vielen kostbaren Edelsteinen, die alle benannt wurden. Die Nachricht kam bis nach Augsburg. Dort schmunzelte ein Dieb dem andern zu: »Der Goldschmied hat noch nicht erfahren, was in dem Schächtelein war. Weißt du, daß es ihm gestohlen ist?« »Desto besser,« sagte der andere, »so muß er uns auch unsere tausend Taler zurückgeben und hat gar nichts.« Die Betrüger gehen also dem Frieder in die Falle und kommen zum Goldschmied. »Seid so gut und gebt uns jetzt das Schächtelein. Verzeiht, daß wir Euch ein wenig länger haben warten lassen.« – »Liebe Herren,« erwiderte der Goldschmied, »Euch ist unterdessen ein großes Unglück geschehen, das Schächtelein ist gestohlen worden. Habt Ihr's noch in keiner Zeitung gelesen?« Da erwiderte einer der Diebe mit ruhiger Stimme: »Das ist uns leid, aber das Unglück wird wohl auf Eurer Seite sein. Ihr liefert uns das Schächtelein ab, wie wir's Euch in die Hände gegeben haben, oder Ihr gebt uns die schon bezahlten tausend Taler zurück. Die Krönung ist ohnehin vorüber.« Man sprach hin, man sprach her, »und das Unglück wird eben doch auf Eurer Seite sein,« nahm wieder der Goldschmied das Wort. Denn im nämlichen Augenblick traten jetzt mit seiner Frau vier Hatschiere in die Stube, handfeste Männer, wie sie waren, und faßten die Spitzbuben. Das Schächtelein war nicht mehr aufzutreiben, aber das Zuchthaus und so viel Geld und Geldeswert, den Goldschmied zu bezahlen. – Der Frieder brachte dem Goldschmied alles wieder und verlangte nichts für seinen guten Rat. »Wenn ich einmal etwa von Eurer Ware benötigt bin,« sagte er, »so weiß ich ja den Weg in Euren Laden und zu Euren Kästen.«