
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Endlich war Schnee gefallen. Weich und leise glitt er in dicken Flocken hernieder und hüllte das lärmende Berlin in feiertäglichen Hermelinpelz. Die Spatzen am Dachfirst sahen wie Tintenkleckse auf einer weißen Schreibseite aus. Alles war gedämpft. Das Schreiten der Fußgänger, das Rollen der Wagen und Autos, das Gleiten der Schlitten.
Nur die Stimmen der Jugend erschallten in voller Stärke. Buben und Mädel kämpften auf den verschneiten Plätzen und Straßen und lieferten sich tobende Schneeballschlachten. Das schrie, jauchzte, lachte und kreischte unter den weißen Wurfgeschossen, daß selbst ernste, sorgenbeschwerte Menschen stehenblieben und lächelnd dem ausgelassenen Treiben zuschauten. Jugend – so hatte man selbst einst gejauchzt und getobt, so war es, und so würde es sein. Sich immer wieder erneuernde Jugend.
Peter war jetzt zu Hause nicht zu halten. Weder Radio noch Bastelkasten konnten ihn fesseln. Und die Schularbeiten nun schon gar nicht. Gut, daß er in diesem Jahre einigermaßen in der Klasse stand. Sonst wäre es um die Osterversetzung schlimm bestellt gewesen. Bei allen Schneeballkämpfen war er Anführer. Wehe den armen Mädeln, die ahnungslos plaudernd aus der Schule heimkehrten. Peters kühles Geschoß traf sie unbarmherzig.
»Meine Schulfreundinnen wollen mich gar nicht mehr mittags begleiten, weil Peter uns immer mit seinen ollen Schneebällen auflauert. Susi sagt, Peter ist feige und schießt aus dem Hinterhalt«, beklagte sich Gitta.
»Was, ich feige?« empörte sich Peter. »Na, Susi kann sich ja morgen in acht nehmen. Kannst ihr bestellen, daß ich sie zu einem Schneeballduell fordere. Ohne jeden Hinterhalt. Aber kneifen ist nicht. Der wollen wir den Kopf schon waschen.«
»Wie unritterlich, Peter«, tadelte die Mutter. »Gegen kleine Mädchen kämpft man nicht.«
»Wenn sie frech sind, ist es ganz gleich, ob sie Hosen oder Kleider tragen. Dann muß man ihnen die Flötentöne beibringen. Na warte man, Susichen.«
Wer wartete, war aber nicht Susi, sondern Peter. Peter und seine Jungs hatten am nächsten Tag hinter den verschneiten Pappeln des Lietzensees Aufstellung genommen. Dort führte der Schulweg der Mädel vorüber. Erst herankommen lassen und dann offen zum Kampf fordern. Wollen mal sehen, wer von uns dann feige ist und Reißaus nehmen wird.
Die Evastöchter waren schlauer als die Jungen. Es gab ja mehr Straßen in Berlin, durch die man heimgelangen konnte. Peter bekam kalte Füße und kalte Suppe, als er endlich zu Tisch erschien. Und auslachen lassen mußte er sich überdies von der kleinen Kröte, der Gitta.
Mit Schneeschuhen zog die Jugend in den Grunewald, rudelweise. Von sanftgewellten Hängen flog man unter schneeigen Kiefern auf die Nase. Was tat's? Lachend suchte man aus dem Wirrwarr von Beinen die eigenen heraus und versuchte die Kunst von neuem. Bis man es zum vollendeten Telemark und Christiania gebracht hatte. Und wer keine Schneeschuhe besaß, der setzte sich auf den Rodelschlitten. Bobs wurden durch Aneinanderketten von Rodeln gebildet und – pardauz! – das gab ein Juchhei, wenn er kippte und die ganze Mannschaft in den Schnee purzelte.
Renate zog mit ihrem Kodak in die Schneelandschaft hinaus und machte drollige Aufnahmen von durcheinanderwirbelnden Beinen und von Rodelpannen. Vielleicht gab es mal wieder ein Photopreisausschreiben. Dabei war sie eine tadellose Schneeschuhläuferin. Gitta beneidete sie glühend, wie fest verwachsen sie mit ihren Schieern war, während ihre eigenen immer woanders hinwollten als Gitta selber.
Wolfgang trieb in diesem Winter andern Schneesport. Vom Studentenwerk aus war er zum Schneeschippen angefordert worden. Kam er abends nach Hause, war er todmüde und mußte trotzdem noch zum Vorexamen »büffeln«. Die Zeit reichte jetzt kaum noch zum Musizieren mit dem Japaner.
Der einzige, den der Schnee nicht begeisterte, war Doktor Ma-wu. Er fror. Deutschland war sehr schön. Aber den deutschen Winter mochte der Japaner nicht leiden. Er sehnte sich nach dem Land der Blumen.
Frau Felsings Vertretung war nun zu Ende. Und das Geld, das sie verdient hatte, leider auch. Allerlei Neuanschaffungen waren im Januar notwendig geworden. Peter schoß tüchtig in die Höhe. Nichts paßte ihm mehr. Und was ihm noch paßte, war zerlöchert. »Junge, wie kann man nur so ein Reißdeibel sein!« Peter sorgte getreulich dafür, daß Mutti nach dem Abendessen die Hände nicht in den Schoß legte. Auch für den Haushalt waren Neuanschaffungen nötig. Das Bettzeug war seit geraumer Zeit schadhaft. Man konnte den Mietern doch keine geflickte Wäsche geben. So wanderte ein beträchtlicher Teil von Frau Felsings Stenotypistenhonorar in die »Weiße Woche«.
Der Januar ging zu Ende. Der Tag jährte sich, an dem der Vater seine Kündigung erhalten hatte. Ein ganzes Jahr zur Arbeitslosigkeit verdammt! Und immer noch keine Aussicht, irgendwo eingestellt zu werden.
In den ersten Tagen des Februars brachte die Post einen umfangreichen Brief. Es war nicht der »blaue Brief«, den Peter im vorigen Jahre so gefürchtet hatte. Gelb war er und an Herrn Ernst Felsing adressiert. Als Herr Felsing ihn öffnete, hielt er seine Zeugnisse und die Abschriften seiner Militärpapiere in der Hand. Man schickte ihm seine Papiere von der Staatslotterie zurück und bedauerte gewiß, von seinem Anerbieten keinen Gebrauch machen zu können. Herr Felsing öffnete das Begleitschreiben und – ließ den Bogen überrascht sinken.
»Unangenehme Nachricht, Ernst?« fragte seine Frau, die gewöhnt war, in den Mienen ihres Mannes zu lesen.
Er schüttelte den Kopf. »Man ersucht mich um eine persönliche Vorstellung, da ein Posten zum i. April möglicherweise frei wird. Aber es wird ja wieder nichts daraus werden. Da bewerben sich noch unzählige. Warum sollte ich ihn gerade bekommen?« Zu oft war Herr Felsing enttäuscht worden.
»Was für eine Stelle, Ernst? Bei einer Bank? Ich weiß ja gar nicht, daß du dich um etwas beworben hast.« Ganz aufgeregt war seine Frau.
»Ich bewerbe mich ja dauernd und erhalte regelmäßig Absagen. Es wird auch diesmal nicht anders sein, Lotte. Wozu erst wieder hoffen?«
»Du sollst nicht so mutlos sein, Ernst, und Vertrauen haben.«
Sie nahm ihrem Mann das Schreiben aus der Hand. »Von der Staatslotterie? Als Lotterieeinnehmer? Das wäre ja herrlich, wenn du die Stelle erhalten würdest.«
»Ja – wenn! ›Wenn meine Tante Räder hätte, wäre sie ein Autobus‹, sagt Peter. Jedenfalls kann ich mich ja vorstellen. Auf eine Enttäuschung mehr oder weniger soll es nicht ankommen.« –
Tage vergingen. Wochen reihten sich zu Wochen. Der Schnee schmolz. Fritz Kunze rief statt der Mickymäuse jetzt am Wittenbergplatz »ein Jroschen die Schneejlöckchen« aus. Erste Frühlingsboten.
Und während Winter und Vorfrühling miteinander um die Herrschaft rangen, während Herr Felsing sich wunderte, daß noch immer keine Nachricht von der Staatslotterie da war, während Frau Felsing überlegte und rechnete, ob man wohl ein kleines Familienfest zu Renates im März stattfindender Konfirmation geben könnte, hielt der Vorfrühling in Deutschlands Staatsregierung seinen Einzug.
Plötzlich war sie da, die allgemeine nationale Erhebung Deutschlands. Die aufbauwilligen Deutschen schlossen sich unter Führung des Reichskanzlers Hitler zusammen. Mithelfen wollten sie alle, Deutschland wieder groß und stark zu machen, es aus seiner wirtschaftlichen Not zu befreien. Das ganze deutsche Volk einte sich, um dem Elend der Nachkriegsjahre ein Ende zu bereiten.
Berlin war ein Flaggenmeer. Alles hoffte wieder auf bessere Zeiten. Allen voraus die Jugend, die Hoffnung des deutschen Volkes.
Große Veränderungen brachte der Frühling mit sich. Nicht nur in Stadt und Land, in allen Betrieben der großen Staatsmaschine. Auch im kleinen Kreise, im Felsingschen Haus hatte sich so manches geändert. Vater hatte wieder Arbeit. Was er nicht zu hoffen gewagt hatte, war Tatsache geworden. Er hatte den Posten bei der Lotteriekollekte erhalten.
Alles atmete auf. Der Druck, der durch Vaters Arbeitslosigkeit ein ganzes Jahr lang auf allen Familienmitgliedern gelastet hatte, löste sich. Die Mutter fand wieder ihre heitere Zuversicht. Ihr Gottvertrauen hatte nicht getrogen. Der alte Gott lebte noch. Zum April sollte der Vater seine neue Beschäftigung beginnen. Listen wurden aufgestellt von allen Bekannten, denen man Zirkulare mit Einladungen zur Staatslotterie senden konnte. Sicher bot jeder gern mal dem Glücke die Hand. Muttis Schreibmaschine klapperte. Sie schrieb persönliche Begleitschreiben zu den gedruckten Formularen, auf denen angekündigte Riesengewinne mit soundso vielen Nullen zur Beteiligung anreizten. Die Kinder schrieben Adressen aus. Bis zum 15. März mußten alle Adressen versandt sein.
»Vater, kann man auch ein hundertachtundzwanzigstel Los spielen?« erkundigte sich Peter.
»Nein, Junge. Ein Achtel ist der kleinste Anteil. Höchstens kann man das noch mit einem andern teilen, daß jeder ein Sechzehntel übernimmt«, erklärte ihm der Vater. Als erster Kunde kaufte er für seine vier Kinder ein Achtellos. Es trug die verheißungsvolle Nummer 891+011.
»Quersumme 20 – das bringt bestimmt Glück!« posaunte Peter.
»Wenn man soviel davon vorher spricht, dann geht es nicht in Erfüllung. Glück kommt unerwartet, überraschend«, belehrte ihn Mutti.
»Hahaha – Mutti ist abergläubisch«, lachte der Bengel.
»Und du bist frechdachsig!« Das ließ sich nicht bestreiten.
Wolfgang hatte sein Vorexamen bestanden. Er hieß jetzt cand. ing. Zum April hatte er sich aufs Land für den Freiwilligen Arbeitsdienst gemeldet. Das Haus leerte sich. Denn auch Doktor Ma-wu hatte unter vielen Verbeugungen und immer wieder erneutem Bedauern zum April gekündigt. Seine deutschen Studien waren beendigt. Er kehrte zurück nach Japan.
»Werden ick nix mehr gehen in Kurfurstendamm von Berlin, werden ick gehen in Ginsa, schönstes Straße in Tokio. Werden ick bringen deutsches Technik zu Japan.« Und zu Wolfgang gewendet, meinte Doktor Ma-wu: »Kommen Sie mit in Tokio. Oh, Tokio schön, serr schön. Nix kaltes Schnee. Immer Blumen. Können Sie werden großes Musikus in Japan.«
Ein verlockender Gedanke. Fernes Land mit fremdartigen Sitten kennenzulernen und dort seiner Musik leben zu können. Trotzdem schüttelte Wolfgang den Kopf.
»Unser deutsches Vaterland braucht jetzt seine Jugend. Jeder von uns hat die Pflicht, am Aufbau mitzuhelfen. Keiner darf eigenen Wünschen nachgehen und fahnenflüchtig werden.«
Ende März fand Renates Einsegnung statt.
Mit ihren Kameradinnen zusammen empfing Renate ernst bewegt den Segen der Kirche. Das Geleitwort, das Pastor Richter ihr ins Leben hinein mitgab, lautete: »Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.« Ja, sie wollte getreu sein, ihrem Glauben, ihrem Volke, ihrer Pflicht. Und den Eltern, die sie liebevoll bis hierher geführt hatten, wollte sie stets dieselbe Treue halten.
Zum Festessen im kleinen Kreise, nur Renates Pate, Onkel Hartwig, war dazu aus München gekommen, hatten Renates Freunde vom Markt alle ihr Scherflein beigesteuert. Obenan Mutter Buttermilch, die sogar eine goldgedruckte Glückwunschkarte mit einem schönen Vers gesandt hatte. Doktor Ma-wu und Fräulein Lerche waren ebenfalls geladen. Der Japaner verehrte seiner jungen Freundin einen neuen, ganz besonders guten photographischen Apparat. Selbst Peter war von dem Zeiß-Ikon einwandfrei begeistert. Sogar einen Trinkspruch auf die junge Konfirmandin brachte Doktor Ma-wu aus. »Oh, Fräulein Renate ist bestes Tockter zu Elters, bestes Swester, ist mehrst schönstes Blume in Deutschland, ist wert, zu sein Japanese.«
»Ich will aber gar keine Japanerin sein. Ich bin stolz darauf, daß ich Deutsche bin«, meinte Renate, mehr patriotisch als höflich.
Auch Onkel Hartwig, der sein nettes Mündel recht gern mit nach München genommen hätte, bekam einen Korb. »Wenn ich erst aus der Schule bin, besuche ich euch«, vertröstete Renate ihn. »Wolfgang geht jetzt von Hause fort und Doktor Ma-wu auch, da müssen wir andern wenigstens daheim bleiben. Sonst wird das Nest zu leer.«
Als Renate am Abend den Eltern gute Nacht sagte und nochmals für alle Liebe dankte, meinte Mutti: »Wenn ich dich nicht in diesem Jahr gehabt hätte, mein Mädel. Ihr Kinder habt uns immer wieder neuen Mut gegeben.«
Der April kam mit Regen und Sonnenschein.
Doktor Ma-wu nahm mit unzähligen Dankesworten Abschied von dem gastlichen Hause, in dem er sich gefühlt hatte wie »Sohn bei Elters«. Er würde die liebe Familie Felsing nie vergessen und Deutschland stets in dankbarer Erinnerung behalten. Und wenn einer von ihnen nach Japan käme, wäre er der glücklichste Mensch, die Gastfreundschaft erwidern zu können.
»Ich besuche Sie bestimmt mal, wenn ich groß bin, Herr Doktor«, versprach Peter. »Jetzt habe ich noch keine Zeit. Ich muß helfen, unser deutsches Volk wieder stark zu machen.«
»Und Fräulein Renate und kleines Dame Gitta kommen mit Herrn Peter in Japan.« Die ganze Familie lud der Japaner ein.
Und dann war er fort. Vater bezog wieder das Balkonzimmer, das zum Lotteriebüro eingerichtet wurde. Die Kinder sprachen noch oft von dem netten Japaner, der sie so verwöhnt hatte. Jedesmal, wenn Renate ihren Zeiß-Ikon benutzte, dachte sie: Wie mag es Doktor Ma-wu jetzt gehen? Ob er schon im bunten Kimono die Ginsa entlang spaziert?
Wolfgang war mit seinem kleinen Koffer aufs Land in ein freiwilliges Arbeitslager gegangen.
In enger Volksverbundenheit schafften die jungen Akademiker Schulter an Schulter mit Arbeitern, Handwerkern, Angestellten und Bauernsöhnen. Das kameradschaftliche Zusammenarbeiten aller Volksschichten stärkte das soziale Empfinden der jungen Leute.
Ein jeder lernte dort, sich als verantwortliches Glied des Volksganzen zu fühlen.
Auch Peter wurde es klar, daß er alle Kräfte anspannen mußte, nicht nur körperlich zu ertüchtigen, sondern auch als pflichttreuer Schüler Tüchtiges zu leisten. Er war zu Ostern in die Untersekunda versetzt worden. Sein Ehrgeiz hatte nie weiter gereicht, als zum Durchschnitt zu gehören. Aber jetzt wollte er mal zeigen, daß er konnte, wenn er wollte. Auch er mußte am Wiederaufbau Deutschlands Mitarbeiten.
Renate und Lump entbehrten Wolfgang besonders. Oft faßte Renate die Vorderpfoten des Terriers und blickte ihm in die feuchten Hundeaugen:
»Wir dürfen nicht jaulen, Lump, wir müssen auf Wolfgang verzichten. Er sagt, das Vaterland braucht ihn.«
Renate war jetzt Unterprimanerin. Sie tat wie stets ihre Pflicht. Auch im Hause spielte sie in Gemeinschaft mit Gitta oft Heinzelmännchen.
Mutti hatte ziemlich viel Schreibmaschinenarbeit für den Vater. Die neue Lotteriekollekte ließ sich ganz nett an. Man konnte wieder hoffen, daß es bergauf ging.
Kam Mutti dann von ihrer Büroarbeit in die Küche, so war das Geschirr gewaschen, die Kartoffeln geschält und das Gemüse für den nächsten Tag geputzt.
Nun konnten sie alle in den Frühling hinaus, um sich an dem Werden in der Natur zu freuen und neues Hoffen daraus zu schöpfen.
Es war, als ob der Frühling in diesem Jahr ganz besonders üppig und verschwenderisch seine Gaben ausschüttete. Ordentlich jung leuchteten wieder Vaters Augen. Fest und energisch schritt er neben Mutti durch die Blütenwege am Lietzensee.
Mit leuchtendem Sonnenschein vergoldet der 1. Mai das Fest der nationalen Arbeit. Frühlingsgrüne Girlanden schmücken die Häuser, Kirchen und Plätze, schlingen sich quer über die Straßen Berlins. Fahnen flattern farbenfreudig im Frühlingswind.
Draußen auf dem Tempelhofer Feld herrscht fieberhafte Tätigkeit. Schon in der Frühdämmerung beginnt das Treiben. Blumenschmuck wird geliefert, Fahnen und Transparente mit Inschriften angebracht. Händler schlagen ihre Stände auf. Lieferwagen rattern, um die Lebensmittel für die Riesenmengen herbeizuschaffen, die das Fest der nationalen Arbeit hier begehen wollen.
Um fünf Uhr war Peter bereits auf den Beinen. Das ganze Haus trampelte er aus dem Schlaf. Bald nach sechs marschierte er inmitten der mit Musik und Fahnen aufziehenden Jugend- und Schülerverbände durch das mit Maigrün und Flaggen geschmückte Brandenburger Tor. Am Eingang der Linden ein großes Transparent mit der Inschrift: Dem deutschen Menschen kann nur ein starkes Deutschland Arbeit geben. Die frühlingsgrünen Linden hinab, die schon so manche große historische Stunde geschaut, bis zum Lustgarten hinunter ein wogendes Meer von Schulkindern. Die Jugend marschiert.
Und während zum Tempelhofer Feld all die Formationen, Verbände, Vereine, Gilden, Innungen und Betriebe, das ganze arbeitende Berlin, hinausziehen, während von außerhalb Tausende und aber Tausende zum nationalen Fest der Arbeit in umkränzten Sonderzügen, blumengeschmückten Autos und Flugzeugen in die Hauptstadt befördert werden, sammelt sich die Jugend zur nationalen Kundgebung im Lustgarten.
Unübersehbar stehen die Jungen und Mädels, blond und braun, Kopf an Kopf, von der Wilhelmstraße hinunter bis zum Alten Schloß. Schulklassen, Jugendorganisationen mit Fahnen, Wimpeln und Standarten.
Jungdeutschland erwartet den greisen Reichspräsidenten und den Reichskanzler.
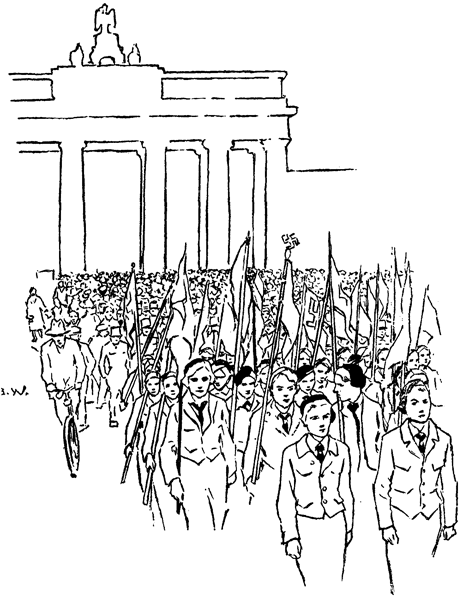
Renate und Gitta haben mit ihren Schulkameradinnen in der Wilhelmstraße unweit der Reichskanzlei Aufstellung genommen, während Peter unter Tausenden von Kindern im Lustgarten aufmarschiert ist. Renate hält ihren Zeiß-Ikon gezückt, um den Moment, wenn der Reichspräsident und der Reichskanzler erscheinen, festzuhalten.
Kommen sie denn noch immer nicht? Die Zeit wird der wartenden Jugend lang. Flugzeuggeschwader durchziehen die Lüfte.
Das fröhliche Stimmengewirr der Kinder verstummt plötzlich. Von der Schloßrampe herab erklingt vom Berliner Sängerbund feierlich das Lied: »Deutschland, du mein Vaterland.« Riesenlautsprecher übertragen die erhebende Kundgebung.
Laute Hoch- und Heilrufe erbrausen von den Linden her, schwellen lauter und immer lauter an.
Nur mit Mühe kann der Wagen, der den Reichspräsidenten und den Reichskanzler, das alte und das junge Deutschland verkörpernd, an der lebendigen Mauer der ihnen zujubelnden Jugend vorbeiführt, bis zum Lustgarten gelangen.
Ach, wie beneidet Peter den Jungen, der dem greisen Reichspräsidenten den Blumenstrauß im Namen der Jugend überreichen darf. Ein neuer Jubelsturm, als der Reichspräsident die Rednertribüne betritt. Von hunderttausend hellen Kinderstimmen klingt es ihm entgegen:
»Ich hab' mich ergeben mit Herz und mit Hand
Dir, Land voll Lieb' und Leben, mein deutsches Vaterland!«
Stille trotz der Menschenflut. Der alte Generalfeldmarschall spricht zur Jugend. Er begrüßt die Jugend, die sich hier aus allen Volksschichten versammelt, um sich zum gemeinsamen Vaterlande, zur pflichttreuen Hingabe an die Nation, zur Achtung vor der schaffenden Arbeit zu bekennen.
»Ihr seid unsere Zukunft! Ihr müßt einst das Erbe der Väter auf eure Schultern nehmen, um es zu erhalten, zu festigen und auszubauen. Nur wer gehorchen lernt, kann später auch befehlen. Nur wer Ehrfurcht vor der Vergangenheit unseres Volkes hat, kann dessen Zukunft meistern.«
Mit dreifachem Hurra auf Deutschland schließt der greise Reichspräsident. Das Deutschlandlied erbraust.
Das ganze deutsche Volk – alle wollen sie geeint an der nationalen Arbeit mithelfen.
Jugend voraus!