
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Erzählt nach eigenen Erlebnissen



n Westminster, dem vornehmsten Viertel Londons, erhebt sich ein Gebäude, dessen prächtiges Aeußere noch von der inneren, luxuriösen Einrichtung übertroffen wird. Spiegelsaal reiht sich an Spiegelsaal, und man glaubt sich beim Durchwandern dieser herrlichen Räume, beim Anblick der zahlreichen Dienerschaft in das Schloß eines Fürsten versetzt, der hier seine Residenz aufgeschlagen hat.
Es gehört dem Yachtklub ›Neptun‹, dessen Mitglieder zu der höchsten Aristokratie des Landes zählen.
Heute abend waren die Herren besonders zahlreich vertreten. Einer Einladung ihres Präsidenten zufolge waren sie aus allen Ortschaften Englands zusammengekommen, denn gewiß hatte ihnen der Vorsitzende des Klubs, Lord James Harrlington, etwas Wichtiges mitzuteilen.
Lord James Harrlington besaß die besten und am schnellsten segelnden Yachten und war im Führen derselben Meister, sodaß er allein deswegen zum Vorsitzenden des Klubs gewählt worden wäre; außerdem aber stach er schon durch sein Aeußeres und seine persönlichen Eigenschaften vor den anderen Mitgliedern hervor, welche sich ihm willig unterordneten, weil sie seine Überlegenheit kannten.
Schon vor einiger Zeit hatte dieser Lord seine Freunde eingeladen, mit ihm eine Reise um die Erde anzutreten, wozu er auf einer Werft der Insel Wight den Bau eines Schiffes selbst leitete, aber damals waren nur wenige damit einverstanden gewesen. Doch die fieberhafte Hast, mit welcher Lord Harrlington den Schiffsbau betrieb, das Geheimnis, mit dem er seine bevorstehende Reise umgab, hatten die Herren doch sehr neugierig gemacht. Ungesäumt waren sie der Aufforderung, im Klubhaus einzutreffen, nachgekommen.
Es herrschte eine gespannte Stimmung unter den Mitgliedern. Trotzdem die Abendmahlzeit schon vorüber war und die Herren im Rauchsalon Platz genommen hatten, ließ der Vorsitzende selbst immer noch auf sich warten.
»Ich wette,« rief Charles Williams, ein von seinem Vermögen lebender Gentleman, genannt ›der lustige Charles‹, weil er stets voll des unverwüstlichsten Humors und der tollsten Einfälle war, »ich wette, daß Lord Harrlington für uns irgend eine große Ueberraschung bereit hält oder uns einen Narrenspossen spielen will.«
»Er ist jedenfalls noch auf der Insel Wight bei seinem neuen Schiffe,« entgegnete Edgar Hendricks, des ersteren spezieller Freund, ein blutjunges, mädchenhaft aussehendes Kerlchen. »Ich möchte nur wissen, was Harrlington im Schilde führt. Sein ganzes Treiben in letzter Zeit war wirklich geheimnisvoll.«
»Vielleicht will er sich als Seeräuber etablieren,« lachte sein Freund, »ich habe letzthin das neue Fahrzeug angeschaut. Fast sieht es aus, als ob auf demselben Geschütze aufgestellt werden könnten.«
»Well!« rief Lord Hastings, ein herkulisch gebauter, junger Mann, der den ganzen Abend gähnend und in Zeitungen lesend in einem Lehnstuhl gesessen hatte. »Das wäre wenigstens einmal eine vernünftige Idee, die in dieses langweilige Dasein Abwechslung brächte. Ich wäre mit bei der Partie.«
»Dann schlage ich vor,« sagte ein anderer Herr, »wir segeln in die indischen Gewässer, wählen Harrlington zum Hauptmann, Lord Hastings und Williams zu Offizieren, plündern chinesische Fahrzeuge und hängen die langzöpfigen Burschen an den Raaen auf.«
»Lord Harrlington,« meldete in diesem Augenblick ein Diener, indem er die Thür öffnete und den Vorsitzenden eintreten ließ.
Lord James Harrlington war eine schlanke, elegante Erscheinung mit einem stolz getragenen Kopf. Das hübsche, frische Gesicht wurde durch einen kecken, blonden Schnurrbart geziert, und ebenso keck und lustig, aber zugleich auch kühn blickten die blauen Augen. Wer den Lord so in dem modernen Anzug sah, hätte nicht geglaubt, daß in dieser nicht übermäßig kräftigen Gestalt eine ungeheure Elastizität und Gewandtheit, verbunden mit außergewöhnlicher Kraft, wohnten.
Der Lord hatte schon beim Eintritte ein Zeitungsblatt aus der Tasche gezogen und faltete dasselbe nun auseinander. Er winkte den ihn umdrängenden Herren, wieder Platz zu nehmen, da sie, außer Lord Hastings, alle aufgesprungen waren.
»Meine Herren,« begann er mit volltönender Stimme, »entschuldigen Sie zunächst mein spätes Kommen. Diese Zeitung hier ist schuld daran, wie Sie gleich erfahren werden.
»Ich hatte,« fuhr er fort, »alle Mitglieder des Klubs ›Neptun‹ vor etwa einem Jahre eingeladen, mit mir eine Reise um die Erde zu unternehmen, da aber den Herren etwas Derartiges nichts Neues ist, erhielt ich keine Zusagen. Hätte ich freilich damals schon gesagt, warum ich diese Weltreise antreten will, so hätte ich sicher von keinem eine abschlägige Antwort erhalten.
»Was heute diese Zeitung, die neueste Nummer der ›Times‹, verkündet, war mir schon vor einem halben Jahre bekannt und veranlaßte mich, den Bau meines Schiffes mit solcher Eile zu betreiben.«
»So spannen Sie die Herren doch nicht länger auf die Folter,« rief Lord Hastings. »Sie sehen, Williams vergeht bald vor Neugier.«
»So hören Sie denn, meine Herren,« fuhr Harrlington fort, »was der ›Times‹ berichtet wird. Hier steht:
»New-York, den 12. April. Heute können wir endlich unseren Lesern mitteilen, wem das auf der Werft von Dicksen erbaute Vollschiff gehört, dessen kühne Konstruktion die Bewunderung aller Sachverständigen hervorgerufen hat. Die amerikanischen Damen haben wieder einmal durch ihre Erfindungsgabe im Gebiete des Seesports alle ihre Schwestern in anderen Ländern übertroffen.«
»Alle Wetter!« unterbrach der lustige Charles den Vorlesenden. »Ich habe eine großartige Ahnung!«
Harrlington las weiter:
»Vor einem Jahre teilten wir mit, daß der Damenruderklub ›Ellen‹ sich plötzlich aufgelöst habe und alle seine Mitglieder spurlos verschwunden seien. Jetzt erst erfahren wir, daß sich die Damen auf eine einsame Insel an der Ostküste Nordamerikas zurückgezogen hatten, wo sie unter Leitung von bewährten Seeleuten Unterricht im Arbeiten in der Takelage eines Segelschiffes nahmen, als Matrosen in Sonnenschein und Sturm auf dem Ozean kreuzten und nebenbei nautische Wissenschaften trieben. Vorgestern kehrten die Damen nach New-York zurück, und allein elf von den vierundzwanzig Mitgliedern haben vor der Prüfungskommission das Steuermannsexamen für große Fahrt mit Auszeichnung bestanden, darunter die Vorsitzende des Klubs, Miß Ellen Petersen, von deren Siegen im Einzelboot wir schon früher öfters zu berichten hatten, und die das beste Examen ablegte. Weiter erfuhren wir, daß die Damen auf jenem neuen Segelschiffe eine Reise um die Erde zu unternehmen gedenken, und zwar als Matrosen, ohne Dienerinnen mitzunehmen oder männliche Hülfe sich zu sichern. Erst gestern wurde das Schiff mit großer Feierlichkeit von Miß Petersen auf den Namen ›Vesta‹ getauft. Die Ladies selbst nennen sich ›Vestalinnen‹. Leider wird jedem Mann ohne Ausnahme der Zutritt zum Schiff verweigert, sodaß wir über die innere Einrichtung desselben keine Auskunft geben können; doch soll sie, so weit man unter solchen Umständen darüber urteilen kann, großartig sein. Wann das Schiff mit seiner weiblichen Besatzung in See stechen soll, ist vorläufig noch völlig unbekannt.«
Lord Harrlington blickte auf.
»Einzig,« rief Hendricks und schlug mit der Faust auf den Tisch, »da möchte ich mit dabei sein.«
»Du würdest auch gut dazwischen passen,« lachte Williams.
»Still,« beschwichtigte Harrlington, »hier ist noch ein Zusatz:
»New-York, den 13. April abends. Heute morgen verließ die ›Vesta‹ unter flatternden Wimpeln den Hafen. Die Damen, in kleidsamer Matrosentracht, waren zum Teil in die Wanten (Strickleitern) und in die Raaen aufgeentert und winkten von dort den Hunderten von begleitenden Booten und Dampfern ein Lebewohl zu. Im freien Fahrwasser wurde das Schiff vom Schleppdampfer gelöst, und Miß Ellen Petersen, auf der Brücke stehend, übernahm das Kommando. Es war eine Freude, zu sehen, mit welcher Schnelligkeit und Gewandtheit die Vestalinnen die Segelmanöver ausführten, wie sich im Nu ein Segel nach dem anderen entrollte, wie sich das Schiff unter der schneeweißen Last auf die Seite legte und, von einer Südbrise gefaßt, der Ferne zustrebte. Durch ein gutes Fernglas konnte man noch lange die schönen Matrosen in ihrer gefährlichen Arbeit auf den Raaen beobachten. Niemand außer ihnen selbst weiß, welchen Hafen sie zunächst anlaufen werden. Jedenfalls wünschen wir der ›Vesta‹ und ihrer schönen Besatzung eine glückliche Reise und guten Wind; mögen sie das Sternenbanner der Vereinigten Staaten über allen Ländern und Meeren stolz flattern lassen.«
»Die amerikanischen Ladies haben die englischen wieder einmal überflügelt,« schloß Lord Harrlington seinen Vortrag und steckte die Zeitung ein, »aber bald genug werden sie Nachahmer finden.«
Atemlos hatten die Herren gelauscht. Selbst der phlegmatische Hastings hatte seinen Schaukelstuhl verlassen und war an den Tisch getreten.
»Es ist doch schändlich,« rief er jetzt mit donnernder Stimme, »ich sitze hier und vergehe fast vor Langeweile, während andere immer neue Einfälle haben. Wenn das nicht bald anders wird, so ziehe ich Weiberkleider an und schmuggle mich an Bord der ›Vesta‹ ein.«
Er strich sich durch den kurzen Vollbart und warf einen prüfenden Blick an seiner riesigen Figur hinunter.
Auch die anderen Mitglieder brachen in Ausrufe der Verwunderung und des Beifalls über diese Absicht der amerikanischen Damen aus.
»Die Vesta,« begann Lord Harlington abermals, nachdem die Ruhe wieder hergestellt war, »war bekanntlich die römische Göttin der Erde und hatte bei ihrem Bruder Zeus geschworen, den Werbungen des Gottes des Meeres, des Neptun, nachdem unser Klub benannt ist, kein Gehör zu schenken, sondern Jungfrau zu bleiben. Ihre Priesterinnen, die Vestalinnen, mußten das Gelübde der Keuschheit ablegen und wurden bei Übertretung desselben mit dem Tode bestraft.«
Er schwieg lächelnd.
»Da paßte unser Klub ›Neptun‹ eigentlich vortrefflich zum Reisebegleiter,« meinte Williams.

Lord Harrlington nickte belustigt.
»Deshalb fordere ich hiermit die Mitglieder des ›Neptun‹ nochmals auf, mich auf meiner Reise um die Erde zu begleiten. Mein neues Schiff, eine mit einer Hilfsmaschine ausgestattete Segelbrigg, ist auf den Namen ›Amor‹ getauft und soll der keuschen ›Vesta‹ während ihrer Fahrt als Beschützer, wenn auch als ungewünschter, zur Seite bleiben.«
»Hip, hip, Hurrah,« schrie der lustige Charles Williams und machte einen Bocksprung über seinen Stuhl, »das ist ein Gedanke.«
»Bravo,« riefen auch die anderen, »wir fahren ihnen nach.«
Am meisten erregt war Lord Hastings; er schlug wiederholt auf den Tisch, daß die Gläser umfielen, und erklärte diesen Tag für den gesegnetsten seines Lebens.
Ein allgemeiner Tumult entstand. Jeder wollte sprechen, jeder einen neuen Plan zum besten geben. Die beiden unzertrennlichen Freunde, Charles Williams und Edgar Hendricks schwuren hoch und heilig, als Weiber an Bord der ›Vesta‹ zu kommen, ein anderer schlug vor, den ›Amor‹ in den Grund zu bohren und sich von den Vestalinnen als Schiffbrüchige aufnehmen zu lassen; Lord Hastings fragte Harrlington, ob er Kanonen an Bord mitnehme, wegen der Seeräuber, und wenn keine kommen sollten, würde er eigens eine malayische Prau auf die ›Vesta‹ hetzen, um dann rettend eingreifen zu können.
»Aber,« unterbrach einer den Lärm, »wir wissen ja nicht, wo wir die ›Vesta‹ treffen sollen!«
»Dafür ist gesorgt,« sagte Lord Harrlington geheimnisvoll. »Mir wird stets ihr nächster Hafen bekannt sein, woher, darf ich nicht verraten; ein Versprechen bindet meine Zunge. Doch lassen Sie uns jetzt festsetzen, wer von den Herren mit meinem Vorschlage einverstanden ist, ferner, wann wir abfahren wollen und was für Vorbereitungen notwendig sind!«
Nur ein einziges Mitglied schloß sich aus, alle übrigen siebenundzwanzig Herren waren bereit, sich acht Tage später von der Insel Wight aus auf dem ›Amor‹ einzuschiffen.
Derselbe war eine Brigg, d. h. er hatte zwei Masten mit vollen Raaen, aber außerdem, wie erwähnt, noch eine kleine Hilfsmaschine, um mit deren Kraft auch bei Windstille, sowie selbst gegen den Wind fahren zu können.

»Heute morgen verließ die »Vesta« unter flatternden Wimpeln den Hafen,« las Harrlington.
Die ›Vesta‹ dagegen war ein Vollschiff, d. h. sie hatte drei Masten mit allen Raaen, war aber ohne Maschine.
Es wurde ausgemacht, daß die Takelage des ›Amor‹ ebenso, wie die der ›Vesta‹, von den Mitgliedern des Sportklubs bedient werden sollte. Nur sollten noch sechs Leute mitgenommen werden, welche die Maschine zu versorgen hatten und, wenn diese außer Dienst war, die niederen Arbeiten für die Herren verrichten sollten. Außerdem ließ sich Lord Harrlington, welcher selbstverständlich die Stelle des Kapitäns erhielt, durch seinen treuen Diener, einen Neger, begleiten.
Als erster Steuermann wurde von den übrigen Mitgliedern einstimmig Lord Hastings gewählt, als zweiter John Davids, ein sehr beliebter, thatkräftiger, junger Mann.
Erst spät in der Nacht trennten sich die Herren, um die letzten Tage in England zur Regelung ihrer Verhältnisse und zur Ausrüstung für die Reise zu benutzen.
»Sie wohnen in meinem Hotel?« fragte Harrlington Lord Hastings. »Dann können Sie meinen Wagen benutzen.«
Als die Equipage durch die Straßen fuhr, begann plötzlich der sonst sehr schweigsame Hastings:
»Apropos, Harrlington. Errang nicht, als wir beide vor zwei Jahren in New-York zur Regatta waren, jene Miß Ellen Petersen den Sieg über Sie?«
Lord Harrlington nickte stumm.
»Alle wunderten sich damals, daß Ihre Kräfte im letzten Augenblicke nachließen, sodaß das Boot der Lady kurz vor dem Ziele an dem Ihren vorbeischoß. Offen gestanden, es war eine starke Blamage für unseren Klub, von einem Weibe besiegt zu werden.«
Harrlington seufzte.
»Ihnen will ich es bekennen,« fügte er endlich, »daß ich mit Absicht meine Fahrt mäßigte.«
»Ah!« rief Hastings überrascht.
»Als ich sah, wie die schöne Ellen vor Eifer glühte, als die erste das Ziel zu passieren, wie sie sich mit Macht in die Riemen legte, wie sich ihr in engen Trikot gekleideter Körper graziös hin- und herbewegte, da hatte ich alles andere vergessen, und als ich ihr Frohlocken über mein Zurückbleiben in ihren lieblichen Zügen sah, gab ich es auch auf, sie wieder einzuholen. Ich hätte ihr die Freude um alles in der Welt nicht verderben mögen.«
Lord Hastings schwieg eine Weile.
»Man sagte damals,« begann er dann wieder, »Sie hätten um die Hand der Siegerin angehalten und eine abschlägige Antwort bekommen?«
Eine Weile blieb Lord Harrlington die Entgegnung schuldig.
Dann streckte er plötzlich dem anderen die Hand entgegen und rief im warmen Tone:
»Lord Hastings, Sie sind mein Freund!«
Der Ueberraschte schüttelte ihm herzhaft die dargebotene Rechte.
»Das weiß doch niemand besser, als Sie selbst, wenn ich auch meine Freundschaftsgefühle nicht so äußern kann, wie dies sonst in der Gesellschaft Mode ist.«
»Ich weiß dies. Hören Sie denn: Ja, ich habe Miß Ellen meine Liebe gestanden und liebe sie noch jetzt, ohne Gegenneigung zu finden. Aber bei allen Himmeln, jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich sie mir erringen werde! Mag sie noch so stolz, so kalt, so geringschätzend von den Männern denken, während dieser Reise wird sie sehen, was es heißt, einen Beschützer, treu bis zum Tode, zur Seite zu haben. Und führe sie bis ans Ende der Welt, ich werde ihr folgen.«
Und ruhiger fuhr er fort:
»Miß Ellen droht eine große Gefahr, von der sie selbst keine Ahnung hat; ihr Leben hängt an einem Haar. Lord Hastings, wollen Sie mir beistehen, dieses junge Menschenleben, dem meine Liebe gehört, zu beschützen?«
Wieder streckte er dem Freunde die Hand entgegen.
»Ich will,« sagte dieser einfach. »Doch wer sollte diesem unschuldigen Weibe verderblich gesinnt sein?«
»Noch kann ich es nicht sagen; es fehlen mir die Beweise, um eine Person mit Namen zu nennen. Aber jedenfalls ist beschlossen worden, sie während dieser Reise aus der Welt zu schaffen. Nicht ein abenteuerliches Unternehmen hatte ich vor, als ich die Mitglieder des Klubs zur Begleitung aufforderte. Eine Schar starker, mutiger und thatkräftiger junger Leute wollte ich um mich haben, wenn ich der ›Vesta‹ folgte. Mir ahnt, daß Sie nicht vergebens auf allerlei Abenteuer warten werden; denn jene Schurken, welche der einzigen Erbin von unzähligen Reichtümern nach dem Leben trachten, werden keine Mittel scheuen, ihren Zweck zu erreichen. Oft genug werden wir Kämpfe gegen unbekannte Feinde zu bestehen haben.«
»Desto besser,« schmunzelte Lord Hastings und rieb sich die Fäuste, mit denen er Kieselsteine hätte zermalmen können.
Der Wagen hielt.
»Gute Nacht,« sagte auf dem Korridor des Hotels Lord Harrlington. »Wir sehen uns morgen früh nicht wieder, denn ich reise mit dem ersten Zuge nach der Insel Wight. In acht Tagen treffen wir uns alle dort.«
In den Anlagen, welche einen Teil des Hafenufers von New-York zieren, wandelte ein Mann auf und ab, der sich durch den wiegenden Gang als Seemann kennzeichnete.
Er schien nicht geneigt, jedem sein Antlitz zu zeigen, denn obgleich die anbrechende Nacht schon an sich alles nur undeutlich erkennen ließ, hatte er doch noch den Rockkragen möglichst hochgeschlagen und die Schiffermütze tief in die Stirn gezogen, sodaß nur Nase und Augen zu sehen waren. Er war einäugig, aber das unverletzte Auge schien die Fähigkeit zu besitzen, die schwärzeste Finsternis zu durchdringen. Das unter der Mütze hervorsehende, kurzgeschorene Haar war eisgrau, doch zeigten die Bewegungen des Mannes eine noch jugendliche Frische.
Der Einsame zog seine Uhr.
»Es ist bereits neun,« murmelte er durch die Zähne, »jetzt könnte er kommen. Es muß ein vornehmer Herr oder eine sehr geheimnisvolle Sache sein, daß sie der Meister nicht selbst in die Hand nimmt. Aha, da naht einer, das könnte er sein.«

Er trat an den Betreffenden heran und fragte ihn nach der Zeit, indem er dabei sonderbar hüstelte.
»Zehn Minuten nach neun,« antwortete dieser kurz und ging weiter.
Der Seemann murmelte einen Fluch in den weißen Schnurrbart und wanderte wieder auf und ab.
Abermals kam ein Herr die Straße entlang, in einen langen, schwarzen Mantel gehüllt, den Filzhut tief in die Augen gedrückt.
Der Wartende hüstelte wieder.
»Bitte, wie ist die Zeit?« fragte er den Herrn.
»Es ist Zeit, daß Ihr gehängt werdet!« entgegnete jener mit tiefer, ruhiger Stimme.
»Teufel,« lachte der Seemann heiser, »Ihr seid noch gröber, als Bill, der Schiffskoch. Doch scheint Ihr der rechte Mann zu sein. Gebt die Losung!«
»Seewolf.«
Der Seemann zuckte zusammen.
»Pst,« flüsterte er und blickte sich scheu nach allen Seiten um, »nicht so laut! Dieser Name hat einen schlechten Klang. Folgt mir jetzt in einiger Entfernung! Es ist nicht weit.«
Er schritt schnell voraus, der andere folgte ihm.
Nachdem sie den Weg durch einige dunkle Straßen und Gäßchen möglichst im Schatten zurückgelegt hatten, bog der Seemann in eine Sackgasse ein und hielt vor einem kleinen, unansehnlichen Gebäude, welches nicht bewohnt zu sein schien. Ein eigentümlicher Griff an dem Schloß, und die Thür war offen.
»Schnell herein,« flüsterte der Führer und schloß dann die Hausthür wieder sorgfältig.
Er zog aus der Tasche eine Blendlaterne, machte Licht und leuchtete dem Fremden die Treppe hinauf, dabei aber durch die vorgehaltene Hand das an sich schon schwache Licht der Laterne dämpfend.
In der zweiten Etage des Hauses traten sie in ein kleines Gemach, welches nichts weiter enthielt als einen Tisch. An der einen Wand befand sich ein offener Kamin, wie sie in Amerika sehr gebräuchlich sind.
Der Einäugige setzte die Laterne so auf den Tisch, daß der Lichtschein nicht zum Fenster hinausfiel, und wendete sich dann zu dem Herrn im Mantel. Dieser hatte zwar jetzt den Kragen desselben heruntergeschlagen, dafür aber bereits auf der Treppe das Gesicht mit einer schwarzen Larve bedeckt, durch welche dieses vollständig verhüllt wurde. Nur die Augen funkelten wie die eines Raubtieres hervor.
»Nun sprecht,« begann der Einäugige. »Was ist Euer Wunsch?«
Der Schwarzmantel zog wortlos einen versiegelten Brief hervor und gab ihn dem anderen.
»Kennt Ihr das Siegel?« fragte er dabei.
Der Angeredete nahm den Brief und brachte ihn in den Lichtkreis der Laterne. Er bebte scheu zusammen, als er den Abdruck des Petschaftes erkannte. Derselbe zeigte einen Galgen mit der Umschrift: ›Tod dem Verräter.‹
»Lest den Brief, er ist für Euch!«
Der Seemann las. Er zündete dann das Schreiben an, und erst, als das Siegel zerschmolzen war, ließ er das brennende Papier zu Boden fallen und dort zu Asche werden. »Entschuldigen Sie mein voriges Betragen,« begann er dann in demütigem Tone, »ich konnte nicht ahnen, daß Sie in so naher Beziehung zum Meister stehen. Fragen Sie! Ich werde Ihnen antworten.«
»Kennt Ihr den Meister?«
»Nein, niemand kennt ihn. Aber ich weiß, daß sein Arm überall ist, auf dem Meere, wie in den fernsten Ländern. Ich könnte seltsame Geschichten davon erzählen. So zum Beispiel hatte einmal ein Neuling, ein junges Bürschchen, unser Leben an Bord satt, es bekam Gewissensbisse. In Kapstadt lief es eines Nachts von Bord, um dem englischen Konsulat Enthüllungen zu machen; doch habe ich dies erst später erfahren. Thatsache aber ist, daß der Bursche nicht weit kam. Als ich des Morgens an Deck stieg, hing er aufgeknüpft an der höchsten Raae, auf der Stirn das Zeichen des Meisters eingebrannt, die Glieder des Toten aber waren schon so steif, daß er sicher bereits stundenlang da oben gehangen hatte. Solcher Geschichten könnte ich noch manche erzählen.«
»Wie kamt Ihr in den Dienst des Meisters?«
Der Einäugige zögerte eine Weile mit der Antwort.
»Vor etwa zehn Jahren,« begann er dann unsicher, »wurde ich wegen Sklavenhandels von Engländern in Sansibar festgenommen. Ich sah von einem Fenster aus, wie alle Leute meines Schiffes, einer nach dem anderen aufgehängt wurden, ich, der Kapitän, sollte als letzter darankommen. Aber in der Nacht vor meinem Todestag wurde ich in einer mir noch heute rätselhaften Weise aus dem Kerker befreit und für den Dienst des Meisters geworben. Derselbe nimmt nnr die tüchtigsten Leute an, und der Name des Seewolfs war damals weit und breit berüchtigt.«
In dem Kamin knisterte es. Der Schwarzmantel lauschte aufmerksam und machte dem Seemanne ein Zeichen, mit der behandschuhten Rechten nach dem Ofen deutend.
Der Einäugige schüttelte gleichgiltig den Kopf.
»Fledermäuse!« sagte er. »Dieses Haus ist unbewohnt, verlassen, und wir sind absolut sicher.«
»Ihr triebt neben dem Sklavenhandel Seeräuberei?« fragte der Maskierte, welchersich wieder beruhigt hatte, weiter.
»Ja, bei Gelegenheit.«
»Und was habt Ihr jetzt im Dienste des Meisters zu thun?«
»Ich führe als spanischer Kapitän unter dem Namen Fonfera mein Schiff von Hafen zu Hafen, bin im Besitze aller nötigen Papiere und empfange an jedem Landungsplatze Weisungen vom Meister, wohin ich zu fahren habe. Ist es möglich, so nehmen wir eine Ladung mit, sonst befrachten wir einfach das Schiff mit Kisten voll Sand, welche in dem nächsten Hafen von ebenfalls Eingeweihten des Meisters vorschriftsmäßig abgeholt werden. Niemals kommen wir daher mit der Polizei in Berührung. In dem neuen Hafen bekomme ich wieder Befehle vom Meister. Entweder muß ich einen Verfolgten, der im Dienste des Bundes etwas Strafwürdiges begangen hat, in Sicherheit bringen oder muß manchmal ganze Banden nach anderen Ländern schaffen oder sonst etwas Aehnliches. Ab und zu gilt es auch,« schloß der Pirat mit unsicherer Stimme, »ein ganzes Schiff auf offener See verschwinden zu lassen.«
»Ich weiß, Ihr erzählt mir nichts Neues. So kennt Ihr das Meer?«
»O,« rief der Einäugige fast laut, die magere, aber sehnige und starkknochige Gestalt stolz emporreckend, »das Meer ist meine Heimat, es gehört mir. Auf ihm bin ich geboren, fünfundfünfzig Jahre habe ich auf ihm zugebracht, jedes Land, jede Bucht, jede hervorspringende Ecke der verschiedenen Küsten kenne ich wie mich selbst. Und das Meer kennt den Seewolf. Vierzehnmal schon verschlang es mein Schiff und meine Kameraden, aber mich spie es stets wieder aus. Ich bin sein Kind.«
»Habt Ihr zuverlässige Leute an Bord?« fragte der Fremde weiter.
»Herr, der ›Friedensengel‹ hat die bravsten und fixesten Matrosen, die jemals das Meer durchkreuzt haben, auf seinen Planken. Die Kerls fürchten Gott und den Teufel nicht. ›Friedensengel!‹ Hahaha! Ein vortrefflicher Name für das Schiff des Seewolfs.«
Der Schwarzmantel schwieg eine geraume Zeit und blickte nachdenkend vor sich nieder. Dann heftete er den finsteren Blick fest auf den Seemann und sagte:
»Ihr tretet von jetzt ab in meine Dienste!«
Der Seewolf machte eine linkische Verbeugung.
»Hat Euch der Meister bis jetzt in Silber bezahlt, so bezahle ich Euch in Gold.«
Der Einäugige schmunzelte und verbeugte sich wieder.
»Herr, befehlt! Was soll ich thun? Soll ich die Erde in die Luft sprengen oder jedes mir begegnende Schiff in den Grund rennen?«
»Kennt Ihr das weißgestrichene Vollschiff, das im nördlichsten Hafendock liegt?«
Der Pirat lächelte geringschätzig.
»Man erzählt sich Seltsames. Die Welt wird bald vollständig verrückt werden. Es ist die ›Vesta‹, sie ist heute getauft worden und geht morgen früh mit vierundzwanzig Unterröcken in See. Hahaha,« lachte er mit erstickter Stimme, »ich will nicht der Seewolf heißen, wenn ich mir nicht einmal das Schiff da draußen genauer betrachte und den Weibern einen Streich spiele.«
»Kennt Ihr die Kapitänin?«
»Dem Namen nach; sie soll Ellen Petersen heißen und die Verrückteste von allen sein.«
Der Schwarzmantel zog eine Photographie hervor und hielt sie dem Piraten vor das Auge.
»Blitz und Donner!« rief der Seemann überrascht. »Beim heiligen Klüverbaum, das ist ein Prachtmädel. Diese Augen sehen einem bis ins Herz.«
Der Schwarzmantel bohrte seine Blicke fest in das Auge des Piraten und sagte leise, jedes Wort betonend, mit zischender Stimme:
»An demselben Tage noch, an dem ich die Nachricht erhalte, daß Miß Ellen Petersen nicht mehr unter den Lebenden weilt, erhaltet Ihr eine Million Dollars bar ausgezahlt und seid von dem Dienste des Meisters entbunden, seid ein freier Mann. Hier habt Ihr die Beglaubigung vom Meister.«
»Ah,« rief der Pirat freudig, nachdem er das ebenfalls versiegelt gewesene Schreiben gelesen und dann sorgfältig vernichtet hatte. »Das ist einmal ein Geschäft. Endlich eine Hoffnung, von diesem verfluchten Sklavendienste befreit zu werden und wieder auf eigene Faust arbeiten zu können. Doch was soll ich thun?«
»Ihr werdet wie bisher in jedem Hafen Instruktionen vom Meister erhalten und jede notwendige Geldsumme empfangen. Doch die ›Vesta‹ ist ein schnellsegelndes Schiff, werdet Ihr ihm bei Gelegenheit folgen können?«
Der Seemann lachte höhnisch auf.
»Wohl ist es ein scharf gebautes Fahrzeug und wäre in meiner Hand das schnellste der Welt, doch auch der ›Friedensengel‹ ist nicht zu verachten, und schließlich sind diese Weiber doch gleich Kindern gegen mich und verstehen nichts von der Sache, wenn sie auch noch so viele nautische Kenntnisse besitzen. Was wissen diese Neulinge von den Geheimmitteln, um den Lauf eines Schiffes zu beschleunigen! Wie man das Vorderteil beschwert, wie man die Masten schwippend macht, und wie man den ungünstigsten Wind abfängt. In diesen Kniffen ist der Seewolf Meister. Nein, nein, das ist Spielerei für mich. Doch, wie ist es, wenn das eine oder das andere Mädchen mit darauf geht?«
»Und wenn das ganze Schiff auf den Meeresgrund sinkt oder in die Luft fliegt,« antwortete der Gefragte finster, »es schadet nichts. Erfahre ich den Tod der Ellen Petersen aus sicherer Quelle, so bekommt Ihr die Million Dollars und seid frei. Auf dem Wasser oder auf dem Lande, durch Kugel, Dolch oder Gift, sie muß sterben.«
»Und sie wird durch meine eigene Hand fallen,« rief der Einäugige mit wilder Fröhlichkeit aus, »diese Gelegenheit, mich freizumachen, soll mir nicht entgehen! Wohin geht die ›Vesta‹ zuerst?«
»Ich kann mit Bestimmtheit nur sagen, daß das erste Reiseziel das mittelländische Meer ist. Dort könnt Ihr sie leicht treffen.«
«All right,« entgegnete der Pirat und ergriff die Laterne, denn der Schwarzmantel schritt schon nach der Thür. »Mein Schiff ist reisefertig, noch heute steche ich in See und lauere der ›Vesta‹ in der Straße von Gibraltar auf, um ihr zu folgen und eine Gelegenheit für meinen Zweck zu erspähen. Sie sollen mit dem Seewolf zufrieden sein.«
Vorsichtig, wie sie gekommen waren, entfernten sich die beiden würdigen Männer aus dem Hause und gingen unten in verschiedenen Richtungen davon. – – – –
Auf dem Dache des Hauses, in welchem eben diese nächtliche Unterredung stattgefunden hatte, saß ein Katzenpärchen und miaute verliebt. Plötzlich sprangen die Tiere scheu davon. Aus einem Schornsteine blickte ein Menschenkopf hervor, dem im nächsten Moment die ganze Gestalt folgte. Der Mann setzte sich auf den Rand der Esse und rieb sich schmunzelnd die Hände.

»Es ist doch ausgezeichnet,« sagte er vergnügt zu sich selber, »wenn ein Detektiv als Schornsteinfeger gelernt hat. Also der Seewolf ist wieder aufgetaucht und treibt nach wie vor sein sauberes Handwerk! Vor dreißig Jahren schreckte mich meine Mutter mit seinem Namen, wenn ich nicht folgen wollte. ›Wenn du nicht artig bist,‹ rief sie immer, ›so sage ich es dem Seewolf, der nimmt dich dann mit.‹ Diesmal aber werde ich ihn mitnehmen. Der Bursche ist natürlich viel zu schlau, um ihn schon jetzt fassen zu können, denn wie er sagt, fährt er als ein schlichter Kapitän; außerdem bindet mich mein Versprechen, denn wird er jetzt dingfest gemacht, so sucht sich dieser saubere Gentleman einen anderen, der seine teuflischen Pläne ausführt.« Er überlegte eine Weile und fuhr dann in seinem Selbstgespräch fort:
»Also hatte Lord Harrlington doch recht, als er diesen Herrn meiner Aufmerksamkeit empfahl. Wer hätte das geglaubt! Ein Glück war es, daß ich durch eine Unbedachtsamkeit des vermeintlichen Kapitäns Fonsera von dieser Unterredung hier im Hause erfuhr und, nichts Gutes ahnend, mich hier einfand. Mit Gold ist die Entdeckung gar nicht zu bezahlen. Nun gilt's bloß noch, den nächsten Hafenplatz der ›Vesta‹ auszukundschaften, und dann – auf Wiedersehen, Seewolf, mich wirst du nicht wieder von deiner bluttriefenden Spur los, bis ich dich, Raubtier des Meeres, eingefangen habe.«
Der Schornsteinfeger sprang von der Esse herab und lief trotz der pechschwarzen Nacht so sicher wie eine Katze auf dem schmalen Firste des Daches entlang, bis er durch ein Fensterchen verschwand.
Während die heimliche Unterredung zwischen dem Piraten und dem maskierten Mann in jenem Häuschen stattfand, spielte sich in dem Prachtgebäude, welches dem ehemaligen Damenruderklub ›Ellen‹ als Versammlungsort diente, eine andere Scene ab.
Alle vierundzwanzig Mitglieder, welche sich noch diese Nacht an Bord der ›Vesta‹ begeben wollten, um früh ihre Reise um die Erde anzutreten, waren anwesend. Die Kapitänin, Miß Ellen Petersen, hatte sich eben erhoben, um eine Ansprache zu halten.
Miß Petersen war eine Waise. Nach dem Tode ihres Vaters, eines enorm reichen Pflanzers in Louisiana, hatte die Mutter noch einmal geheiratet, dann aber selbst bald das Zeitliche gesegnet. Mit ihrem Stiefvater, einem ehemaligen Abenteurer, der durch seine schöne Gestalt und seine bestechenden Manieren das Herz ihrer geliebten Mutter gefangen hatte, konnte sich Ellen nie befreunden. Ein unnennbares Gefühl stieß sie von dem ihr stets sehr liebenswürdig begegnenden Mann mit den stechenden, grauen Augen zurück und ließ sie schon in ihrem siebzehnten Jahre nach New-York ziehen.
Das Mädchen hatte in seiner Kindheit eine zügellose Freiheit genossen, wie sie nur der Aufenthalt auf einer Plantage gewähren kann. Wurde sie nicht durch Unterricht an das Haus gefesselt, so konnte man sie während der Tagesstunden zwischen den Cow-boys finden, jenen unübertrefflichen Rinder- und Pferdehirten der Prärie. Von diesen lernte sie, wie man das wildeste Roß zum Gehorsam zwingt, und wie man, während das Pferd über eine Hecke setzt, eine in die Luft geworfene Orange mit der Revolverkugel zerschmettert.
Als der verhaßte Stiefvater dem schon erwachsenen Mädchen einst Vorwürfe über dieses unweibliche Betragen gemacht hatte, war sie kurz entschlossen nach New-York gezogen, um ganz ihren Neigungen leben zu können.
Hier war ihr nicht so oft die Gelegenheit geboten, Rosse zu tummeln und andere körperliche Uebungen vorzunehmen, dafür aber fand sie bald Geschmack am Wassersport und gab sich diesem mit vollem Eifer hin. Schon nach einem Jahre hatte sie viele gleichgesinnte, junge Mädchen, die reich und unabhängig gleich ihr waren, um sich versammelt und gründete mit diesen den ersten Damenruderklub der Welt, von dessen Siegen oft in den Zeitungen zu lesen war.
Ihre neueste Idee war nun, mit diesen Freundinnen als Matrosen eine Reise um die Erde zu machen, um der staunenden Männerwelt zu zeigen, daß die Frauen, wenn sie wollen, jener in nichts nachstehen.
Miß Ellen stand jetzt im zweiundzwanzigsten Jahre. Ihr prächtiger, schlanker und doch voller Wuchs bezauberte jeden Mann, auch wenn er nicht in das schöne Gesicht sah, welches einer Venus zu gehören schien. Reiches, blondes Haar umrahmte die weiße Stirn und flutete über den Nacken. Aber das Herrlichste an Ellen waren ihre tiefblauen Augen, deren Strahlen bis in das Herz zu dringen schienen. Zwar waren diese Strahlen noch kalt, aber es schien nur die Gelegenheit zu fehlen, um sie in sengende, leidenschaftliche Gluten zu verwandeln.
»Meine Freundinnen,« begann sie mit einer wundervollen Altstimme, »es handelt sich also um die Aufnahme einer neuen Vestalin. Wir sind vierundzwanzig Mitglieder, und, wie wir berechnet haben, sind zur Bedienung der ›Vesta‹ unbedingt fünfzig Hände erforderlich. Eine geeignete Person haben wir bis jetzt noch nicht finden können. Nun stellte sich mir heute früh eine junge Dame mit dem dringenden Wunsche vor, uns auf der Reise begleiten zu dürfen. Empfohlen wurde sie mir von unserer Freundin Jessy Murray. Die Novize wartet im Nebenzimmer, und ehe wir zur Abstimmung schreiten, sollen Sie sie dem Aeußeren nach beurteilen. Ich bemerke gleich, daß Johanna Lind zwar in Amerika geboren ist, über von deutschen Eltern abstammt.«
Während Miß Ellen die Hand nach der Klingel ausstreckte, um die Wartende zu rufen, entstand unter den Damen ein mißmutiges Gemurmel, weil eine Deutsche an Bord der ›Vesta‹ kommen sollte. Doch ehe die Vorsitzende ihr Vorhaben noch ausführen konnte, sprang Jessy Murray auf.
»Halt!« rief das junge Mädchen mit blitzenden Augen. »Wenn Miß Petersen gegen Miß Lind ein Vorurteil erweckt hat, so will ich dies abschwächen. Johanna Lind ist in ganz Amerika nicht unter diesem, sondern unter ihrem englischen Namen, Jane Lind, bekannt.«
Triumphierend wartete die Sprecherin den Eindruck ihrer Worte ab.
»Ah,« riefen alle Damen fast gleichzeitig aus. »Jane Lind, die Heldin vom Oberonsee?«
»Ja, sie ist es. Johanna Lind wagte im Winter letzten Jahres siebenmal ihr Leben, um ebensoviele Personen aus den hochgehenden Wogen des Oberonsees zu retten.«
»Dann ist eine Abstimmung gar nicht nötig,« rief eine Dame.
»Nein, sie ist aufgenommen!« stimmten alle anderen bei.
Die Gerufene trat ein. Wenn ihre Aufnahme noch nicht beschlossen gewesen wäre, so hätte doch schon ihre Erscheinung diese bewirkt.
Unter all den schönen Mitgliedern des Klubs konnte sie Anspruch erheben auf den Titel der schönsten; dabei blickte das kluge, braune Auge so liebevoll und freundlich, daß es im Nu die Herzen aller Damen bezauberte. Niemand hatte dieser zarten, schmiegsamen Gestalt zugetraut, daß sie sich siebenmal den eisigen Fluten preisgegeben hatte, ohne nachteilige Folgen zu verspüren.

Mit herzlichem Willkommen wurde sie als neue Vestalin begrüßt. Jessy Murray hatte bereits erzählt, daß dieselbe in jeder Weise würdig sei, an Bord der ›Vesta‹ zu leben, da sie auch auf den großen Seen oder vielmehr Binnenmeeren Nordamerikas, genügend Gelegenheit gehabt hätte, sich mit dem Wassersport vertraut zu machen.
»Bevor wir jedoch,« nahm die Kapitänin wieder das Wort, »Sie definitiv als Vestalin aufnehmen können, ist es nötig, daß Sie unsere Gesetze kennen lernen. Glauben Sie diese nicht halten zu können, so steht Ihrem Rücktritt nichts im Wege. Die Regeln sind einfach, aber sehr streng, doch nicht streng für uns, die wir uns freiwillig Vestalinnen nennen. Sie kennen die Sage von der Vesta und deren Priesterinnen?«
Johanna bejahte lächelnd.
»Nun wohl! So wissen Sie auch, daß eine Vestalin, welche das Gelübde der Keuschheit brach, eingemauert wurde; ließ sie das heilige Feuer ausgehen, so wurde sie gegeißelt, desgleichen, wenn sie Ungehorsam zeigte. Dies gilt allerdings nicht für uns. Wer aber mir, der Kapitänin der ›Vesta‹, ungehorsam ist, wird an der Stelle, wo wir uns gerade befinden, sei es an der Küste, an einer Insel oder mitten auf dem Ocean, unwiderruflich vom Schiff ausgesetzt. Wer während dieser Reise das Gelübde der Keuschheit bricht, wird an den Mast gebunden, gegeißelt und im nächsten Hafen an das Land gesetzt. Dasselbe gilt für diejenige, welche etwas über unser Leben verrät, ein Reiseziel nennt oder überhaupt Mitteilungen über etwas macht, was unter uns besprochen wurde. Sind Sie damit einverstanden, Miß Jane Lind, so unterschreiben Sie dieses Formular, sodaß Sie sich später nicht über uns beschweren können.«
Die Vestalin ergriff die Feder, überlegte einige Sekunden und unterschrieb dann mit fester Hand den Vertrag.

Bis jetzt hatte die Vorsitzende mit ernster Stimme gesprochen, nun aber fuhr sie in ihrer gewöhnlichen, heiteren Weise fort:
»Der Zweck dieser Reise ist, der Welt den Beweis zu geben, daß wir Frauen den Männern in nichts nachstehen, daß wir ebensogut wie sie ein Schiff durch den Sturm leiten und jeder Gefahr Trotz bieten können, ohne mit den Wimpern zu zucken. Wer, wie ich, schon vielfach Seereisen gemacht hat, weiß, daß unbedingter Gehorsam auf einem Schiffe notwendig ist. Alle diese Bestimmungen sind nicht willkürlich von mir getroffen, sondern von allen beschlossen worden. In den einzelnen Hafenplätzen hört dieses Vorgesetztenverhältnis zu mir natürlich auf. Wir besehen uns die betreffende Stadt, unternehmen Ausflüge ins Innere des Landes, Jagdpartien u. s. w., für welche an Bord alle Vorbereitungen getroffen sind. Und nun seien Sie als Vestalin herzlich begrüßt.«
Sie schüttelte, ebenso wie die anderen, Johanna Lind, der neu angemusterten Vestalin, herzlich die Hand.
»Wie wird die Arbeit an Bord verteilt?« fragte diese.
»Ich bin für immer zur Kapitänin gewählt worden,« erklärte Miß Ellen. »Zeigt sich aber eine der Damen mehr für diese Stellung geeignet, so werde ich sie ihr freiwillig abtreten. Bei Segelmanövern arbeiten alle nach verteilten Rollen in der Takelage. Die Funktionen der beiden Steuerleute gehen die Reihe um, ebenso die der Köchin, bis sich im Laufe der Zeit zeigt, wozu jede der einzelnen Damen besondere Neigung besitzt. Die Mannschaft ist, wie auf jedem Schiffe in zwei Gruppen geteilt, in die Backbord- und in die Steuerbordwache, welche sich aller vier Stunden ablösen. Die Verteilung der Wachen machen die Damen unter sich aus, damit Freundinnen möglichst zusammenkommen. Das Schiff ist neu, sodaß außer den nötigen Segelmanövern und der täglichen Reinigung sehr wenig Arbeit zu thun sein wird. Für Unterhaltung, Musik, Bücher u. s. w. ist auf der ›Vesta‹, wie Sie finden werden, aufs beste gesorgt, desgleichen für Bequemlichkeit. Die einzelnen Arbeiten, wie zum Beispiel Zeugwaschen, muß sich natürlich jede selbst besorgen, wie auf anderen Schiffen die Matrosen.«
»Die ›Vesta‹ geht bereits morgen in See?«
»Ja, morgen früh. Wir begeben uns noch diese Nacht an Bord. Lassen Sie Ihre Sachen gleich nach dem Schiffe bringen! Ordnen Sie noch alles Nötige an, und kommen Sie selbst an Bord.«
»Kann ich schon jetzt erfahren, welchen Hafen die ›Vesta‹ zunächst anlaufen wird?«
»Gewiß. Wir haben keine Heimlichkeiten unter uns. Wir kreuzen durch den atlantischen Ocean, möglichst langsam, um uns im Segelmanövrieren zu vervollkommnen, fahren ins mittelländische Meer und laufen zuerst Konstantinopel an. Von dort begeben wir uns nach Alexandrien, machen einen Abstecher nach Kairo, besuchen die Pyramiden u. s. w. und segeln dann wieder der Straße von Gibraltar zu, unterwegs noch einige sehenswerte Plätze mitnehmend. Welchen Weg wir dann einschlagen, wird später beschlossen.«
Die jungen Mädchen plauderten und scherzten noch lange miteinander und malten sich die sie erwartenden Erlebnisse und Abenteuer mit den heitersten Farben aus. Hätten sie ahnen können, daß jetzt gerade der berüchtigtste Seeräuber und seine Matrosen, Hyänen in Menschengestalt, die Anker lichteten, um draußen auf dem Meere der ›Vesta‹ aufzulauern und sie samt ihrer Besatzung für immer verschwinden zu lassen!
Noch ehe sich die Damen an Bord ihres Schiffes begaben, entfernte sich Miß Jane Lind, weil sie ihre Koffer noch besorgen wollte, mit dem Versprechen, bald nachzukommen.
Als sie auf der Straße stand, seufzte sie tief auf und schlug die Augen zum Himmel empor.
»Gott, Du Allmächtiger,« stammelte sie, »gieb mir die Kraft, mein Vorhaben zu vollbringen! Schweres habe ich mir vorgenommen. Behüte Du mich, wie Du mich immer bis jetzt wunderbar beschirmt hast! Mut, Johanna, es muß sein, und es wird dir gelingen!«
Eilends entfernte sie sich, bestieg eine Droschke und fuhr in ein anderes Stadtviertel. Vor einem Postgebäude hielt der Wagen.
Johanna stieg aus, trat in den Schalterraum und spähte umher. Niemand außer ihr befand sich im Zimmer. Flüchtig warf sie ein paar Zeilen auf ein ausliegendes Depeschenformular und reichte dieses dem dienstthuendcn Beamten.
Der Telegraphenapparat klapperte, und im nächsten Momente durchliefen das Kabel des atlantischen Oceans die Worte:
»Lord Harrlington, London. Abreise morgen früh. Konstantinopel.«
Die neue Vestalin hatte den ersten Verrat verübt; die Geißel wartete ihrer.
Der Teil des atlantischen Oceans, welcher an Spanien und Portugal grenzt, wird die spanische See genannt. Sie wird von den Schiffen gefürchtet, denn wilde Stürme brausen über sie hin und schleudern die Fahrzeuge wie Nußschalen hin und her, ihnen mit dem Untergang an der nahen Küste drohend; aber selbst bei ganz ruhigem Wetter haben die aus dem unendlichen Ocean kommenden und sich am Strande brechenden Wogen noch eine so ungeheure Gewalt, daß sie fort und fort über das Deck eines Schiffes spülend, alles mit fortschwemmen können. Nur, wenn schon seit Tagen sich kein Lüftchen mehr geregt hat, dann gleicht auch diese See einem Spiegel. Und setzt wieder ein frischer Wind ein, so erzeugt er wohl Wellen, aber nicht jenen gewaltigen Wogengang.
Ein solcher ruhiger Tag war angebrochen. Neugierig blickte die warme Maisonne von ihrer Höhe herab auf eine Brigg, welche bei günstigem Westwinde mit vollen Segeln die spanische See nach Süden zu befuhr. Sie hatte doch schon so manche Schiffsbesatzung bei der Arbeit in der Takelage und bei ihrem Treiben in der Freizeit beobachtet, aber eine solch merkwürdige war ihr noch nicht vorgekommen!
Matrosen waren es unbedingt, welche sich an Deck der schlanken, schöngebauten Segelbrigg herumtrieben, denn sie beschäftigten sich zum Teil mit seemännischen Arbeiten. Aber ach – wie sahen sie aus!
Obgleich sie die Hemdsärmel aufgekrempelt hatten, wodurch meist recht sehnige, muskulöse Arme zum Vorschein kamen, und obgleich fast alle barfuß gingen, erzeugten sie doch sämtlich den Eindruck, als kämen sie eben erst von einem Ballsaal, auf dem sie sich als Vagabunden maskiert gehabt. Die schon arg mitgenommenen Anzüge zeigten noch den Schnitt der neuesten Mode, und ein Mann, der eben die Taue sorgfältig zu Ringen aufschichtete, trug gar einen schwarzen Frack. Am Heck, in der Nähe des Steuerruders, saß ein riesiger Mann mit einem Cylinder auf dem Kopfe. Er ließ die nackten Beine über Bord hängen und angelte. Aber die originellste Figur war der am Steuerruder Stehende; die Hosen so weit wie möglich aufgekrempelt, den Oberkörper in einen roten Reitfrack geklemmt und am Halse einen fast acht Centimeter hohen Stehkragen, so hielt er das Rad mit beiden Händen und suchte seinem Gesicht einen möglichst sorgenvollen Ausdruck zu geben. Vor ihm stand nämlich ein Photographenapparat, durch welchen er eben von einem anderen Manne fixiert wurde.
So sah es aus an Bord des ›Amor‹, welcher der Straße von Gibraltar zusteuerte. Die bestellten, gleichmäßigen Matrosenanzüge waren bis zur Abfahrt von der Insel Wight nicht fertig geworden, zum Aerger Lord Harrlingtons und zum Ergötzen der übrigen jungen Leute, welchen diese Maskerade ungemein gefiel. Doch sollten die Sachen nach dem von Harrlington angegebenen nächsten Hafen mit Eilpost nachgeschickt werden.

»Halten Sie doch den Kopf nicht so hoch, Hendricks,« rief der lustige Charles Williams, welcher seinen Freund photographieren wollte, ich kann von Ihrem Gesicht nur die Nasenlöcher sehen.«
»Thut mir leid! Mein Stehkragen läßt keine andere Stellung zu.«
»Geben Sie Ihren Augen einen kühneren Ausdruck! Spähen Sie recht scharf in die Ferne!« sagte wieder Charles unter seinem Tuche hervor.
Edgar Hendricks riß die Augen möglichst weit auf und versuchte so zu blicken, wie er es auf Bildern von Seeleuten gesehen hatte.
»So ist es gut!«
Charles kam unter dem Tuche hervor. »Jetzt recht ruhig gestanden!
»Passen Sie auf! Eins – zwei –«
»Süd – Südwest – dreiviertel West,« rief in diesem Augenblick Lord Harrlington, der auf dem Vorderdeck mit dem zweiten Steuermann den Stand der Sonne genommen hatte, dem Steuernden zu und gab somit die neue Richtung an.
Hendricks, wohl wissend, daß die Ausführung derartiger Kommandos keinen Aufschub erleiden darf, drehte erneut das Rad, gerade als Charles drei sagte.
»Potz Ankertaue und Stahltrossen!« schrie letzterer, als er die Platte durchs Licht besah. »Ihr Kopf ist mindestens zehnmal so breit, wie er hoch ist! Vom Gesicht ist nur der Stehkragen zu sehen, und fünfundfünfzig Hände haben Sie auch! Noch einmal!«
Er warf die Platte ins Wasser, gerade wo Lord Hastings fischte.
»Wenn Sie mir die Fische mit Absicht vertreiben, fordere ich Sie auf krumme Säbel,« rief dieser.
»Die giebt's hier an Bord gar nicht, bloß Enterbeile.«
»Dann auf krumme Enterbeile.«
»Wieviel Fische haben Sie eigentlich während der letzten sechs Stunden gefangen, Lord Hastings?«
»Zwei Stück,« erwiderte der Angeredete stolz und wies auf die neben ihm liegenden Fischchen.
»Hagel und Haubitzen!« rief der lustige Charles, der wieder seinen Apparat zurechtrückte, um eine neue Aufnahme von seinem Freunde zu machen, »das wird aber eine teure Abendmahlzeit.«
»Sagen Sie einmal,« fragte der am Steuer stehende Hendricks, »woher haben Sie nur diese famosen Matrosensprüche? Ich grüble und grüble, mir fällt aber kein so recht kerniger Ausdruck ein, und Sie werfen nur immer so damit herum.«
»Das kommt eben davon, daß man seine Zeit richtig anwendet,« antwortete der Photograph stolz. »Während Sie unnütze Abschiedsbesuche machten, bin ich die letzten acht Tage in allen Matrosenschenken Londons herumgelaufen, und jedesmal, wenn ein Matrose fluchte, habe ich mir die Worte aufgeschrieben. Doch nun, Potz Ketten und Katzenschwänze! Machen Sie endlich einmal den Mund zu und stehen Sie still! So – die Stellung ist gut. Eins – zwei – drei! Sie können sich wieder rühren!«
Er besah die neue Platte.
»Ausgezeichnet getroffen! Das Bild wird noch etwas koloriert, damit der rote Frack recht zur Geltung kommt, und dann schicke ich es nach London. Das wird aber Aufsehen erregen, wenn Sir Edgar Hendricks im Schaufenster hangt, barfuß im Frack und Stehkragen, am Steuerrad stehend.«
»Oberbramraasegel fest!« kommandierte in diesem Augenblick der Kapitän. Das war Charles' Arbeit, denn die Oberbramraa ist die höchste Raa einer Brigg und erfordert zur Bedienung solch leichte, schmächtige Gestalten, wie die Charles Williams'.
Gewandt erstieg er die Wanten und machte das Segel an der Raa fest. Von seinem erhöhten Standpunkte aus konnte er das Meer weit überblicken.
»Ein Schiff Backbord achtern,« rief er und deutete links nach hinten.
Lord Harrlington nahm ein Fernrohr zur Hand und richtete es auf den am Horizont erscheinenden dunklen Punkt.
»Ein segelndes Vollschiff,« fagte er nach einer Weile, »das könnte die ›Vesta‹ sein.«
Wie der Blitz schoß Charles an einem Tau von oben herab, sprang durch eine Luke ins Innere und kam bald mit einem Fernglas wieder herauf, welchem Beispiele die anderen Herren folgten. Selbst die Heizer, jetzt bei dem guten Winde unbeschäftigt, stellten sich neugierig an Deck.
»Doch nein,« sagte wieder Lord Harrlington, »die ›Vesta‹ hat an jedem Maste sechs Raaen, und dieses nur fünf. Außerdem ist die ›Vesta‹ schneeweiß angestrichen und würde die Sonnenstrahlen viel mehr reflektieren. Das erwartete Schiff ist es also nicht.«
»Merken Sie nicht etwas Seltsames, Kapitän?« sagte John Davids, der zweite Steuermann.
»Nein,« sagte dieser und nahm das Fernrohr von den Augen. »Doch ja,« rief er jetzt, »merkwürdig, mit welch wunderbarer Schnelligkeit dieses Segelschiff sich uns nähert!«
Auch die übrigen Herren hatten dies bemerkt und staunten darüber.
Näher und näher kam das Schiff. Mit unheimlicher Eile durchschnitt es die Wellen, welche schäumend au seinem Bug emporspritzten.
Dicht aneinander gedrängt standen die Engländer an der Bordwand und starrten erstaunt, einige auch entsetzt zu dem Schiff hinüber, das sie jetzt fast erreicht hatte.
Es war ein großes, stark gebautes Fahrzeug, das alle Segel beigesetzt hatte, aber doch viel zu schwer war, um mit solcher Windeseile daherfliegen zu können.
Das Deck war völlig leer, nichts war darauf zu sehen; aber es war eigentlich gar kein Deck zu nennen, denn es wölbte sich fast wie die Hälfte einer Halbkugel, sodaß Menschen kaum darauf hätten stehen können. Alles an dem Schiff war mit einer schmutziggrauen Farbe bemalt, von der Mastspitze bis zur Wasserlinie herunter, kein Tau, kein Segel zeigte eine andere Farbe.
Einer der Heizer fiel stöhnend auf die Kniee und bedeckte sein Gesicht.

»Wir sind verloren!« wimmerte er. »Der fliegende Holländer!«
»Unsinn,« rief barsch Lord Hastings, faßte den Burschen beim Kragen und stellte ihn mit einem Ruck wieder auf die Beine. »Mache dem ›Amor‹ keine Schande. Die Söhne Altenglands fürchten sich auch vor zehn fliegenden Holländern nicht.«
Jetzt war das wunderbare Schiff dicht an der Seite des ›Amor‹, und nun geschah etwas, was selbst den Unerschrockensten der Gesellschaft ein Grausen einflößte.
Wie mit einem Zauberschlag flogen plötzlich zu gleicher Zeit alle Segel des Schiffes hoch und rollten sich kunstgerecht an den Raaen auf, als hätten die geübtesten Matrosen sie dort festgebunden. Und doch war kein Mensch, weder an Bord, noch in der Takelage zu sehen.
»Das ist Hexerei,« rief Lord Harrlington.
»Ob ich hier hinüberspringen kann?« fragte Lord Hastings und maß die etwa zehn Meter betragende Entfernung zwischen beiden Schiffen. Das Fahrzeug fuhr jetzt ebenso schnell wie der ›Amor‹, immer dicht an dessen Seite.
»Samiel hilf!« rief Hendricks mit bebenden Lippen. »Wissen Sie, was das ist, Williams?«
»Das kann ich Ihnen ganz genau sagen,« erwiderte Charles Williams, der selbst in seiner Todesstunde einen Spaß nicht hätte unterdrücken können, »ich weiß es nämlich auch nicht.«
Etwa fünf Minuten mochte das rätselhafte Schiff so neben dem ›Amor‹ hergefahren sein, als plötzlich wieder durch unsichtbare Hände die Segel gelöst und auseinandergefaltet wurden. Aber nicht nur das, auch die Raaen wurden alle zu gleicher Zeit etwas nach dem Steuerbord gerichtet, und mit verdoppelter Eile schoß es wieder dem Süden zu. In einer Viertelstunde war das Meerwunder den Augen der Herren entschwunden.
Allerlei Meinungen über dasselbe wurden jetzt an Bord des ›Amor‹ laut. Die Männer waren zu aufgeklärt, um an Uebernatürliches zu glauben, aber zu deuten wußte sich diese Erscheinung niemand.
Lord Harrlington war mit seinen Aeußerungen über das Gesehene am zurückhaltendsten, obgleich gerade er seines bekannten Scharfsinns wegen am meisten gefragt wurde.
»Die einzige Erklärung ist die,« sagte er endlich, »daß unter der Halbkugel, welche wir gesehen haben, sich die Maschinerien befinden, um alle Segel, Raaen u. s. w. regieren zu können. Woher das Schiff, welches weder Schornstein, noch etwas Derartiges besaß, die ungeheure Schnelligkeit nimmt, wird mir immer ein Rätsel bleiben, bis ich die innere Einrichtung selbst sehe.«
»Und wenn ich noch einmal so nahe an dieses Schiff komme, wie jetzt,« meinte sein Freund, »dann will ich nicht Hastings heißen, wenn ich es mir nicht genauer besehe. Das ist ebenso interessant, wie ein Besuch auf der ›Vesta‹. »Geschmacksache,« entgegnete Hendricks.
Die Besatzung unterhielt sich noch lange über das geisterhafte Schiff oder diese neue Erfindung, als sie durch ein Kommando des Kapitäns wieder in die Raaen geschickt wurde.
Schon seit einiger Zeit hatte Lord Harrlington nach dem hinter ihnen liegenden Horizont gespäht, als er sein Fernrohr mit einem Male zusammenschob und den Befehl gab, die Segel einzuziehen.
Verwundert führten die Herren dieses jetzt ganz unnötige Manöver aus, denn der Wind war ihrer Meinung nach sehr günstig.
Kaum standen sie alle wieder an Deck, so streckte der Kapitän die Hand aus, zeigte nach einem dunklen Punkte am Horizont und sagte fröhlich lächelnd:
»Meine Herren, die ›Vesta‹! In einer halben Stunde können wir uns den Damen vorstellen.«
Ein allgemeines Hurrah entfuhr der Besatzung des ›Amor‹. Wieder richteten sich achtundzwanzig Ferngläser nach dem schnell größer werdenden Schiffe mit den schönen, vornehmen Damen an Bord.
»Charles,« fragte Edgar Hendricks den Freund, »sitzt mein Stehkragen auch ordentlich?«
»Ja, der sitzt gut,« erwiderte der lustige Charles, den Barfüßigen von oben bis unten musternd, »aber die Stiefeln können Sie sich erst noch wichsen lassen. Und Sie,« wandte er sich an den wieder angelnden Hastings, der nach wie vor die Beine über Bord hängen ließ, »edler Lord, ich bitte Sie, nehmen Sie doch Ihre nackten Beine weg, oder ziehen Sie wenigstens Strümpfe an, Sie blamieren ja ganz England.«
»Unsinn!« knurrte der phlegmatische Lord. »Ich bin jetzt Seemann und nicht im Salon. Wenn es die Damen geniert, so mögen sie nicht hersehen. Wahrhaftig,« er hob die Nase und schnoberte in die Luft, »es riecht schon nach Frisierstube.«
In der That war es die ›Vesta‹, die sich der jetzt still liegenden Brigg schnell näherte. Sie kam vom Westen, von der amerikanischen Küste, sodaß sie mehr von der Seite her an den ›Amor‹ heransegelte.
Wie jedes Schiff auf dem Meere die Aufmerksamkeit der Besatzung eines anderen erregt, so standen natürlich auch die Vestalinnen alle an Deck und musterten durch Ferngläser die in Sicht kommende, kleine Brigg, umsomehr, da diese mit einem Male ohne jeden Grund sämtliche Segel barg.
Das ganze Schiff machte einen überaus günstigen, erfreulichen Eindruck, selbst das Auge des ältesten Seebären hätte mit Entzücken darauf verweilt.
Alles war schneeweiß angestrichen und zeugte von einer peinlichen Sauberkeit. Statt der gewöhnlichen hölzernen Bordwand umgab das blankgescheuerte Deck ein Kupfergeländer, in welchem sich die Sonne wiederspiegelte. In der Mitte erhob sich, wie auf jedem größeren Fahrzeug, eine Kommandobrücke, auf welcher Miß Ellen Petersen, die Kapitänin, und die beiden Damen standen, an denen die Reihe war, das Steuer zu bedienen.
Die Mädchen waren in schneeweiße Anzüge gekleidet, natürlich nach Art der Männer, wie sie auch in allem anderen das Aussehen von Matrosen hatten. So zum Beispiel saßen auf ihren Köpfen langbebänderte Mützen mit der Goldaufschrift ›Vesta‹.
Miß Petersen hatte recht gehabt, wenn sie schon vor dem Antritt der Reise behauptet hatte, eine solche nur vierwöchentliche Seefahrt sei besser, als eine halbjährliche Badekur, denn wirklich strotzten die Gesichter der Mädchen von Gesundheit und Fröhlichkeit. Noch nie hatten ihre Augen so lebhaft geblitzt, wie jetzt nach diesen paar Wochen. Zwar war die Haut schon tüchtig verbrannt, an dem ausgeschnittenen Brustteil von Sonne und Wind gerötet, auch die Hände zeigten an einigen Stellen eine harte Haut, aber was schadete das! Die Freiheit und Ungeniertheit an Bord wog dies alles auf. Uebrigens wußten sie wohl, daß ein verbrannter, aber gesunder Teint selbst ein unscheinbares Gesicht hübscher macht, als ein blasser, kränklicher.
Und der Dienst auf einem Segelschiffe ist, wenn man vom Ein- und Ausladen, wie diese Damen, verschont bleibt, wirklich durchaus kein anstrengender.
Die ›Vesta‹ hatte sich der Brigg soweit genähert, daß die Personen auf derselben durch das Fernrohr zu unterscheiden waren.
Plötzlich lachte Miß Jessy Murray, welche neben der Kapitänin auf der Brücke stand, laut auf.
»Was sind das nur für sonderbare Matrosen da?« fragte sie und spähte aufmerksam hinüber. »Ich glaube, der eine hat einen roten Frack an, und einer trägt gar einen Cylinder auf dem Kopfe!«
Immer schneller kam das Vollschiff der Brigg näher, schon brauchten die Damen das Glas nicht mehr, um die Gesichter der Leute erkennen zu können.
»Ich will nicht Jessy Murray heißen,« begann jene wieder, »wenn der Mann dort auf dem Vorderteile nicht Lord Harrlington ist, den Sie in der Regatta bei New-York im Einzelboot geschlagen haben.«
Die Sprecherin warf einen Blick nach Miß Petersen und sah, wie diese über und über errötete.
»In der That, er ist es,« antwortete die Kapitänin. »Uebrigens habe ich damals offen bekannt, daß ich ihn jedenfalls nur durch einen Zufall oder infolge seiner Großmut besiegt habe.«
Auch andere Damen an Deck stießen jetzt Rufe der Verwunderung aus.
»Sehen Sie nur den Mann da, der so ungeniert die nackten Beine über Bord hängen läßt, Shocking!« rief eine. (Shocking ist ein englisches Wort und bedeutet so viel wie anstößig, beleidigend, ohne gemein zu sein.)
»Bei Gott,« sagte darauf eine andere im Tone des höchsten Erstaunens, »es ist Lord Hastings, der beste Boxer Englands.«
»Hahaha,« lachte wieder eine andere, »sehen Sie nur den Mann dort am Steuerrad mit dem roten Reitfrack und hohen Stehkragen. Es ist der schöne Sir Hendricks, welcher auf dem Regattaballe alle Frauenherzen in Feuer zu setzen glaubte. Man erzählt sich von ihm, daß er selbst beim Schlafen die Sporen nicht ablegen soll und statt eines Kopfkissens einen Sattel benutzt. Nun glaube ich es!«
»Und der Herr neben ihm ist Sir Williams, sein unzertrennlicher Freund, genannt der lustige oder tolle Charles, der Ihnen auf dem Balle so den Hof machte. Shocking, auch er geht ohne Schuhe und Strümpfe einher. Die Herren machen es sich sehr bequem.«
»Ich hab's,« rief Jessy Murray, »die Besatzung dieser Brigg besteht aus dem Jachtklub ›Neptun‹. Lord Harrlington, Lord Hastings, Sir Williams, Sir Edgar Hendricks, Lord Stevenson, der Sohn des berühmten Herzogs von Chaushilm – sie alle sind vertreten, die ganze Aristokratie Englands. Was soll das nur? Machen sie auch gleich uns eine Weltreise?«
»Flagge und Vesta hoch,« kommandierte Miß Petersen. »Wir wollen doch wenigstens den Namen dieser Brigg erfahren!«
Die Seeleute können sich vermittels fünfundzwanzig verschiedener Flaggen, entsprechend den 25 Buchstaben des Alphabets, welche sie in verschiedener Reihenfolge wehen lassen, vollständig unterhalten. Das sogenannte internationale Signalbuch lehrt, wie man die einzelnen Fragen und Antworten durch diese Flaggen auszudrücken hat.
So entfaltete sich jetzt an der Flaggenstange des Vollschiffes das Sternenbanner der Vereinigten Staaten, am Mittelmast ging eine weiße Flagge hoch, in deren Mitte eine Vestalin zu sehen war, wie sie das Feuer ihrer Göttin unterhielt und von der Raa des hintersten Mastes flatterten fünf Tücher, den Namen ›Vesta‹ ausdrückend.
Begierig warteten die Damen auf die Antwort der Brigg.
Da erschien am Heck, dem hintersten Teile des Schiffes, die Farbe Englands, der Name ›Amor‹ war zu lesen, und am Mast flatterte eine weiße Flagge, den Gott der Liebe in brennendem Rot darstellend, wie er mit dem gefährlichen Bogen lächelnd nach der ›Vesta‹ zielte.
»Das ist Ironie!« rief heftig Miß Petersen aus, stampfte mit dem kleinen in einem weißen Segeltuchschuh steckenden Füßchen auf die Planken und errötete dabei über das ganze Gesicht. Die anderen Damen dagegen brachen in ein schallendes Gelächter aus.
»Wir wollen die Besatzung fragen, ob diese Begegnung eine zufällige oder absichtliche ist.«
Da in diesem Augenblicke die Mannschaft des ›Amor‹ wieder Segel beisetzte, um neben der ›Vesta‹ fahren zu können, so gab die Kapitänin Befehl, einige Segel zu bergen und dirigierte das Schiff dicht neben die Brigg. Nur etwa zehn Meter waren die Fahrzeuge voneinander getrennt.
Zu gleicher Zeit erklangen auf beiden Schiffen die Metallglocken achtmal, ein Zeichen, daß es Mittag war. Die am Steuerruder Stehenden wurden abgelöst.
Lord Harrlington stand stumm mit gekreuzten Armen an dem Mast gelehnt und betrachtete unverwandt mit flammenden Augen die schöne Führerin des Vollschiffes.
»Wenn ich nicht irre,« begann Miß Petersen, »sind an Bord dieser Brigg die Mitglieder des englischen Yachtklubs ›Neptun‹?«
Ehe jemand anders antworten konnte, trat der lustige Charles vor, zog mit einer eleganten Verbeugung den Hut und sagte:

»Erraten, geehrtes Fräulein! Sie sehen hier die berühmtesten Männer Englands, ebenso wie Sie, auf einer Reise um die Welt begriffen.«
Miß Petersen sann einen Moment nach, wie sie etwas Näheres über die Absicht dieser Herren erfahren könne, aber Charles hatte schon unter den lachenden Damen jene bemerkt, um deren Gunst er sich beim Regattaball in New-York bemüht hatte, und abermals den Hut ziehend und mit dem nackten Fuß auskratzend, fuhr er fort:
»Ah, Miß Thomson, freut mich ungemein, Sie wiederzusehen. Darf ich mich nach Ihrer Gesundheit erkundigen?«
»Danke,« lachte das Mädchen zurück, »aber sagen Sie, wie in aller Welt kommen Sie in diesem seltsamen Aufzuge hierher?«
»Wir gaben einen Maskenball und warteten nur auf Ihr Eintreffen. Ihre Verkleidung ist wirklich reizend. Bei welchem Schneider lassen Sie eigentlich arbeiten? Der Matrosenanzug sitzt Ihnen wie angegossen.«
»Und wollen Sie mir nicht die Adresse Ihres Schusters mitteilen?« gab das schlagfertige Mädchen unter dem Kichern ihrer Gefährtinnen zurück. »Mir gefällt die Form Ihrer Lackschuhe außerordentlich.«
Charles warf einen bedauernden Blick auf seine nackten Füße.
»Ah, das darf Sie nicht genieren. Dieselben sind gerade in Reparatur, und mein einziges Paar Strümpfe hängt dort zum Trocknen. Ich wollte mir erst welche von Lord Hastings borgen, aber der hat überhaupt keine mitgenommen.«
»Lord Hastings,« fragte eine andere den unbekümmert weiter Angelnden, »haben Sie sich hier als neapolitanischer Fischerknabe etabliert?«
»Wenn Sie nicht mit Ihrem Schiff aus dem Wege fahren, kann ich natürlich nichts fangen,« brummte der Gefragte mürrisch, der seiner trockenen Gutmütigkeit wegen bei den Damen beliebt war.
»Sie müssen nicht angeln, sondern in Ihren Cylinder Löcher machen und damit schöpfen.«
»Habe ich schon versucht, aber es geht nicht.«
»Miß Nikkerson,« mischte sich jetzt Edgar Hendricks ein, »darf ich Sie zur nächsten Tour auffordern?«
»Ich bin leider schon vergeben! Sagen Sie, Sir Hendricks! Wo haben Sie denn Ihre sonst unvermeidlichen Reitsporen? Sie sollen ja die meiste Zeit des Tages zu Pferde sitzen und selbst in Ihrem Zimmer reiten?«
»Es that mir zu weh, als ich die Sporen in die nackten Fersen stechen wollte. Das Schuhetragen ist hier nämlich nur ausnahmsweise gestattet, nur an Sonn-, Fest- und Geburtstagen.«
»Sein Pferd hat er mit,« versicherte Williams mit der Hand auf dem Herzen, »es liegt aber im Zwischendeck und ist seekrank, sonst könnten Sie den edlen Sir an Bord herumreiten sehen.«
Solche scherzhafte Reden wechselten noch lange zwischen den Herren und Damen; nur Miß Petersen und Lord Harrlington verhielten sich schweigend.
Endlich trat letzterer an die Bordwand und fragte hinüber:
»Miß Petersen, erlauben Sie, daß der ›Amor‹ die ›Vesta‹ während ihrer Fahrt um die Erde begleitet? Bedenken Sie wohl, wie oft Sie eine männliche Hilfe herbeisehnen werden, und eine bessere, treuere und thatkräftigere als die meiner Brigg können Sie nirgends finden. Zu See und zu Land, in jeder Gefahr können Sie auf uns zählen.«
Das Mädchen lachte spöttisch auf.
»Wir Vestalinnen brauchen keine Hilfe; dies zu zeigen ist eben unsere Absicht. Und übrigens, Lord Harrlington, Sie scheinen kein guter Seemann zu sein, wenn Sie nicht zu erkennen vermögen, daß die ›Vesta‹ Ihrer Brigg im Segeln weit überlegen ist. Nur eine halbe Stunde Fahrt, und wir sind Ihnen außer Sicht.«
Des Kapitäns Augen blitzten.
»Miß Petersen, Sie sind mir noch Revanche schuldig. für Ihren Sieg über mich im Einzelboot. Was gilt die Wette, daß der ›Amor‹ der ›Vesta‹ folgen kann?«
»Gut. Um was wetten wir?« war die Antwort.
»Ich schlage vor,« rief der lustige Charles, »um einen Kuß. Verlieren wir, so geben wir jeder Dame einen Kuß, verliert die ›Vesta‹, so bekommt jeder Herr von einer Dame einen.«
»Shocking!« riefen die Damen lachend; Ellen Petersen aber sagte:
»Scherz beiseite! Kann Ihr Schiff dem unsrigen folgen, so sei Ihnen die unwiderrufliche Erlaubnis gegeben, uns für immer zu begleiten. Im anderen Falle werden Sie sich nie wieder darum bemühen, die ›Vesta‹ aufzusuchen, sondern sie im Gegenteil stets vermeiden.«
»Einverstanden!« erwiderte Lord Harrlington fröhlich, und sogleich begann an Bord der beiden Schiffe ein reges Leben. Kommandos erschollen. Die Damen, wie die Herren flogen in die Takelage, um alle Leinewand zu entfalten, doch wenn die Kapitänin nicht zu sehr mit ihrer Besatzung beschäftigt gewesen wäre, so hätte sie bemerken können, wie Harrlington angelegentlich durch ein Sprechrohr mit jemandem im Zwischendeck verhandelte.
Schon nach wenigen Minuten, als sich der Wind in die Segel legte, war zu sehen, daß die ›Vesta‹ der Brigg an Schnelligkeit weit überlegen war. Beide Schiffe loggten, das heißt, mittels einer dazu bestimmten Vorrichtung wurde die Geschwindigkeit der Fahrt aufgenommen, und es fand sich, daß das Vollschiff zwölf Knoten, die Brigg aber nur acht lief. Als die ›Vesta‹ an dem Amor vorüberflog, schwangen die Mädchen jubelnd die Mützen in die Luft und wunderten sich nur über das spöttische Lächeln des Kapitäns und der übrigen Herren, welche keine Spur von Mißvergnügen zeigten. Lord Hastings zog sogar seinen Zylinder und rief dem vorbeieilenden Schiff ein ›Auf Wiedersehen‹ zu.
Nach einer halben Stunde konnten die Damen nur noch die Mastspitzen des ›Amor‹ sichten.
»Sonderbar ist es doch, daß die englischen Herren auf eine Wettfahrt eingingen,« meinte Miß Murray, »ich fürchte, sie verbergen darunter irgend eine andere Absicht.«
»Was ist denn das?« rief plötzlich aufgeregt die Kapitänin und beobachtete die Brigg durch das Fernrohr. »Es ist gar kein Zweifel, sie kommen uns wunderbar schnell nach.«
»Ha!« fuhr sie nach einigen Minuten fort. »Ueber dem ›Amor‹ schwebt eine Rauchwolke. Ich habe allerdings nicht ahnen können, daß er eine Hilfsmaschine an Bord führt.«
Auch die anderen Damen hatten das Näherkommen des ›Amor‹ bemerkt, aber es war nicht zu verkennen, daß sie sich nicht, wie Miß Petersen, darüber ärgerten, sondern vielmehr freuten.
Wiederum nach einer halben Stunde lag die Brigg unter Segeln und Dampf an der Seite der ›Vesta‹.
»Wir haben gewonnen,« rief Lord Harrlington freudig nach der Kommandobrücke hinüber, »Sie werden mit der Begleitung des ›Amor‹ als Retter in der Not zufrieden sein.«
»Die Wette gilt nicht,« entgegnete aber die männerfeindliche Kapitänin, »ich habe nicht gewußt, daß das Schiff eine Maschine besaß.«
»Die Wette gilt nicht? Bitte, meine Herren und Damen, wer kann leugnen, daß der ›Amor‹ der ›Vesta‹ gefolgt ist?«
»Der ›Amor‹ hat gewonnen, die Wette ist giltig,« riefen wie aus einem Munde alle Herren, und zum geheimen Aerger der Kapitänin stimmten die Damen ihnen bei.
»So sei es denn!« sagte sie endlich. »Ellen Petersen hält ihr versprochenes Wort. Der ›Amor‹ darf die ›Vesta‹ begleiten, doch nur unter folgender Bedingung: Verliert er nur ein einziges Mal unsere Spur, so hat er ein für allemal das Recht verscherzt, uns ferner zu folgen.«
»Ganz schlau,« sagte Charles zu seinem Freunde, »aber wartet, ich will einen Zankapfel in ihre Mitte werfen.«
Und mit lauter Stimme fuhr er fort:
»Miß Petersen, wollen Sie darüber nicht auch die anderen Damen fragen? Ich glaube nämlich, dieselben sind anderer Ansicht.«
»In der That,« sagte jetzt Johanna Lind, die neuaufgenommene Vestalin, und trat auf die Kommandobrücke. »Ohne die versprochene Pflicht des Gehorsams verletzen zu wollen, bitte ich Sie doch, Miß Petersen, zu bedenken, wie leicht wir in die Lage kommen können, Hilfe in Anspruch zu nehmen, und besser ist es dann, von solchen Leuten, den Söhnen der edelsten Familien Englands, Unterstützung zu finden, als in die Hände der rohen Matrosen des ersten besten Schiffes zu fallen.«
Die an Deck stehenden Mädchen stimmten der kühnen Sprecherin bei. Miß Petersen überlegte. Johanna hatte recht; hier durfte sie nicht nach eigenem Ermessen handeln, und außerdem hatte sie in der kurzen Zeit schon öfters bewundert, mit welcher Klugheit die neue Vestalin in jeder Angelegenheit den Ausschlag gab, auch sie hatte zu Johanna bereits eine innige Neigung gefaßt. Alles an diesem klugen, mutigen und immer liebenswürdigen Mädchen zog sie an. So gab sie auch diesmal nach.
»Wir werden eine Beratung abhalten,« rief sie dem auf Antwort harrenden Harrlington zu. »In zehn Minuten werden Sie die Zu- oder Absage auf Ihren Wunsch zu hören bekommen.«
Die Damen versammelten sich am Steuerrad und sprachen emsig miteinander. Es ging dabei, wie Hendricks zu seinem Freunde sagte, wie in einer Mädchenschule zu.
Nach zehn Minuten trat die Kapitänin wieder an die Bordwand.
»Wir haben Ihre Bitte, uns begleiten zu dürfen, ohne daß wir uns durch dieselbe beleidigt fühlen, einstimmig angenommen.«

»Hurrah!« schrieen die Herren, und Mützen, Hüte und Cylinder flogen in die Luft.
»Aber,« fuhr Miß Ellen lächelnd fort, »nur unter gewissen Bedingungen. Wir erlauben Ihnen sogar, uns auf Landpartien zu begleiten, doch ...«
»Hip, hip, hip, hurrah!« unterbrach sie jubelnd Charles.
»Doch nur, wenn Sie folgendes annehmen: Der ›Amor‹ folgt der ›Vesta‹ tagsüber in solcher Entfernung, daß selbst mit dem besten Fernrohr das Treiben der Damen nicht beobachtet werden kann; in der Nacht dagegen kann er sich ihr beliebig nähern.«
»Angenommen!« sagte Lord Harrlington erfreut.
»Verlieren Sie uns aus den Augen,« sprach Ellen weiter, »und finden uns innerhalb dreißig Tagen nicht wieder, zu Wasser oder zu Lande, so erlischt diese Erlaubnis, und der Nachtklub ›Neptun‹ macht in allen europäischen und amerikanischen Sportzeitungen bekannt, daß seine Mitglieder sich von dem Damenklub ›Vesta‹ auf dem Gebiete des Wassersports für überwunden erklären. Alle Herren unterzeichnen mit dem vollen Namen. Sind Sie damit einverstanden?«
»Wir sind's,« rief die Besatzung des ›Amor‹ einstimmig.
»Sie werden uns nicht entschlüpfen,« fügte der Kapitän hinzu.
»Und wir werden es doch. Die ›Vesta‹ fährt einfach in der Nacht ohne Lichter, wie wollen Sie uns dann folgen?«
»Das dürfen Sie nicht, das Seegesetz verbietet es Ihnen.«
»Was dürfte eine Ellen Petersen nicht?« spottete das übermütige Mädchen, »Ich werde doch kein einziges Licht anzünden lassen.«
»Und ich gebe Ihnen mein Wort, daß ich trotzdem auf Ihrer Spur bleiben werde, und segelten Sie bis ans Ende der Welt,« rief erregt Lord Harrlington.
»Wie lange werden Sie dies aushalten, wenn ich fragen darf?«
»Bis Miß Ellen Petersen meine Braut ist!«
Die letzten Worte hatte der Lord mit fieberhaft erregter Stimme gerufen. Jetzt wandte er sich kurz um.
»Feuer aus! Hol' ein das Klüversegel! Hol' ein die Marssegel!« erklang es aus seinem Munde, und die bald erglühende, bald erbleichende Ellen sah, wie die also bediente Brigg plötzlich ihren Lauf mäßigte und zurückblieb, bis sie am Horizont nur noch einem dunklen Punkte glich.
Aber als der Abend kam, war die Brigg dem Vollschiff wieder ganz nahe, und da der Mond hell schien, so verschob Miß Ellen Petersen ihren Plan, ohne Lichter zu fahren, auf eine dunklere Nacht, um die Begleitung des ›Amor‹ loszuwerden.
Der Vollmond zeichnete in scharfen Umrissen den Schatten der ›Vesta‹ auf dem Wasser ab; die Sterne funkelten am Firmament und blickten neugierig auf das Damenschiff herab, auf dessen Kommandobrücke eine schlanke Gestalt ruhelos hin- und herwanderte, von Zeit zu Zeit mit einem Nachtfernrohr den Horizont absuchend.
Was bewog diese Person, anstatt nach dem anstrengenden Tagesdienst ihre Koje aufzusuchen, die Wache am Steuer zu übernehmen?
In Ellen Petersens Herzen, denn diese war die ruhelos Wandernde, wogten stürmische Gedanken, gleich den Wellen, welche der brausende Orkan auf der See erzeugt.
Zum zweiten Male trat ihr dieser Mann entgegen und warb wiederum um ihre Hand, aber nicht heimlich, wie damals, als er ihr in einem Nebenzimmer seine Liebe gestand, nein, öffentlich, daß es alle seine Begleiter und die Vestalinnen gehört hatten.
Warum hatte sie ihm damals mit kurzen Worten gesagt, daß sie nie einen Mann lieben könne, nie heiraten werde? Hatte sie damit die Wahrheit gesagt? Ach, nein, leider nein! Der Stolz hatte ihr diese Worte diktiert, der Stolz, als eine Männerfeindin zu gelten, der Wille, frei, selbstbewußt wie ein Mann aufzutreten.
»Und segelten Sie bis an das Ende der Welt, ich bliebe doch auf Ihrer Spur!«
Diese Worte klangen wieder in ihrer Seele, und sie sah noch die flammenden Blicke, mit denen sie begleitet waren.
»Wohlan denn,« rief Ellen und schlug die Augen empor zu den Sternen. »So hört meinen Schwur, ihr ewigen Gestirne! Hält er sein Versprechen, zeigt er sich als ein treuer Freund in allen Nöten und Gefahren, bis wir sicher in den Heimatshafen gelangt sind, dann soll sich der Trotz von Ellen Petersen in die dienende Liebe des Weibes umwandeln, und diese Reise wird die Entscheidung bringen.
›Das goldene Horn‹, ein Meeresarm, trennt Konstantinopel von den beiden Vorstädten Pera und Galata.
Während ersteres mit seinen schmutzigen Gäßchen und Winkeln, gebildet von fensterlosen Häusern, noch einen vollkommen orientalischen Eindruck macht, besitzen die beiden Vorstädte der türkischen Residenz ein mehr europäisches Aussehen.
Schon, daß in Galata der Hafen für die fremden Schiffe liegt, macht die ganze Stadt zum Versammlungsorte der Engländer, Franzosen, Italiener, Griechen, und so weiter. Auch für Unterhaltung der Mannschaft der hier ankernden Fahrzeuge ist reichlich gesorgt.
In einer Weinstube saßen zwei Männer spät abends zusammen, wenn der Raum eine solche Bezeichnung verdient, denn die Lokale Peras und Galatas, in denen griechische und spanische Seeleute verkehren, zeichnen sich durch eine ganz besondere Unreinlichkeit aus.
Beim ersten Blick waren die beiden als Seeleute zu erkennen, auch wenn sie nicht ihr leises, eifriges Gespräch fortwährend mit Flüchen, wie sie auf Schiffen gebräuchlich sind, gewürzt hätten; der Schnitt der Kleidung verriet es dem Beobachter.
Der eine von ihnen war eine magere, knochige Gestalt mit scharfer Adlernase, eisgrauem Haupthaar und gleichfarbigem Schnurrbart. Das linke Auge fehlte ganz und läßt ihn als einen alten Bekannten wiedererkennen, den Seewolf, der hier in Konstantinopel sein Schiff, den ›Friedensengel‹, mit Weizen befrachtete.
Der andere war offenbar ein Grieche. Das dunkle und zugleich scharf blickende Auge, der kurzgehaltene, schwarze Vollbart, wie auch die kleine Gestalt stempelten ihn dazu. Sie unterhielten sich in spanischer Sprache.

»Noch einen Krug Roten!« rief jetzt barsch der Grauhaarige, und sofort erhob sich aus einer Ecke der elenden Spelunke, welche das Licht der matt brennenden Oellampe nicht erhellte, ein altes Weib, um den verlangten Wein zu bringen.
Nachdem die Gläser frisch gefüllt waren, begann der Grieche wieder in flüsterndem Tone, seinen Mund fast bis an das Ohr des Einäugigen neigend:
»So seid Ihr also auch auf zehn Uhr hierher bestellt worden, um neue Befehle vom Meister zu empfangen? Bin gespannt, was er diesmal hat.«
Der andere nickte stumm.
»Geniert Euch nicht,« sagte er dann mit lauter Stimme und deutete dabei nach jener Ecke, wo die Frau wieder verschwunden war. »Die Alte gehört zu unserer Bande und hat vielleicht mehr auf dem Gewissen, als wir beide zusammen. Aber sagt, wo habt Ihr gesteckt, seit Ihr den ›Friedensengel‹ verließt und Euch der Meister ›etablierte‹?«
»Ich erhielt in Algier ein Schiff, die ›Nixe‹, das Ihr gesehen habt, und schaffte von der afrikanischen Küste Mädchen nach Spanien und Frankreich. Feine Ware, kann ich Euch sagen. Doch diese Engländer, die Gott verfluchen möge, sahen mir zuletzt scharf auf die Finger; der Meister erfuhr's, und so erhielt ich vor vierzehn Tagen in Algier den Befehl, nach Konstantinopel zu segeln um in dieser Schenke neue Aufträge zu erwarten. Unterwegs änderten wir die Takelage des Schiffes, strichen es anders an und tauften es ›Undine‹. Die Papiere waren bereits in Ordnung, und nun bin ich als ehrlicher Weinhändler hier, um aber jedenfalls wieder nebenbei Mädchen nach anderen Ländern zu paschen.«
Der Einäugige seinerseits hatte ihm bereits erzählt, welchen Auftrag er auszuführen habe.
»Möchte nur wissen, was das für eine Brigg ist, die sich immer neben der ›Vesta‹ hält,« knurrte er jetzt. »Diese Spitzbuben vereiteln mir alle meine Pläne. Selbst hier in Konstantinopel kann man keines der Mädchen sehen, ohne daß ihr nicht ein Schatten folgt. Es muß auch irgend so eine vornehme Gesellschaft sein. Erst sahen sie wie Vagabunden aus, alle mit Lappen und Lumpen bekleidet, als wollten sie zur Maskerade gehen; jetzt aber stecken sie in einer Uniform und führen auf der Mütze die Buchstaben ›Amor‹, den Namen ihrer Brigg. Man braucht sich der Kapitänin nur auf zehn Meter zu nähern, gleich tauchen hinter ihr drei der Burschen auf.«
»Was ist das für ein prächtiges Vollschiff, das unten an der fünften Brücke liegt? Es ist glänzend schwarz bemalt und trägt in grauen Buchstaben den Namen ›Blitz‹. Nationalität zeigt es nicht. Selten habe ich einen so schönen, stolzen Bau gesehen, und wunderbar ist es auch, was für eine Menge Mannschaft sich an Deck herumtreibt.«
Der Seewolf schwieg nachdenkend.
»Auch mir ist es aufgefallen,« sagte er dann. »Die Takelage, der ganze Bau erinnert mich an eine seltsame Begegnung, die ich vor etwa zwei Monaten an der Küste von Nordamerika erlebte. Doch jenes Schiff war grau und hatte ein rundes, glattes Deck, und dieses zeigt außer seiner schönen Konstruktion keine Abweichung von einem anderen Fahrzeuge.«
Er teilte dem griechischen Kapitän Signor Demetri mit, wie er damals einem rätselhaften Schiffe begegnet sei, das mit ungeheurer Schnelligkeit gegen den Wind an ihm vorbeigeflogen sei.
Signor Demetri lachte.
»Unsinn, Ihr alle habt geträumt; so etwas existiert nicht. Was wird's weiter gewesen sein, als ein Dampfer, der den Schornstein irgendwo verborgen hatte, vielleicht in den Masten.«
Der Seewolf, oder, wie er sich lieber nennen hörte, Signor Fonsera, zuckte schweigend die Achseln.
»Was macht denn mein alter Freund Bill?« fragte mit heiserem Lachen nach einer kleinen Pause der Grieche wieder. »Treibt er noch immer seine Kochkunst?«
Der Seewolf warf einen scheuen Blick nach der Ecke.
»Pst,« flüsterte er, »Vor dessen Handwerk graut selbst mir altem Sünder. Noch ist es kein Vierteljahr her, daß wir die blau angelaufenen Leichen einer ganzen Schiffsbesatzung ins Meer versenkten. Einen teuflischeren Einfall hat der Meister wohl noch nie gehabt, als damals, da er diesen Plan ausdachte.«
»Es ist entsetzlich in der That,« sagte auch der andere, sich schüttelnd.
»Bezeichnet mir die Person, die meinen Dolch kosten soll,« fuhr der Seewolf fort, »nennt mir das Schiff, das meine Leute entern sollen, und Ihr werdet keinen willigeren Ausführer der That finden als mich. Aber so kaltblütig mit anzusehen, wie einer der Leute nach dem anderen mit zuckenden Gliedern umsinkt, nein, das wäre selbst für den Seewolf zu viel.«
»Geschäftssache!« erwiderte der Grieche und blickte nach der Taschenuhr. »Fünf Minuten vor zehn Uhr. Gleich müssen wir Nachricht erhalten, denn der Meister ist pünktlich mit seinen Aufträgen, wie im Bezahlen.«
»Und wie im Hängen,« ergänzte der Einäugige grinsend.
»Malt den Teufel nicht an die Wand,« sagte der Grieche erbleichend. »Wer weiß, wie bald in dieser Hinsicht die Reihe an uns ist!«
Jetzt hob die Wanduhr zum Schlage aus, und in diesem Augenblick kam das alte Weib aus dem Winkel, näherte sich dem Tisch und händigte jedem der beiden Gäste ein Schreiben aus.
Jene wechselten einen Blick.
»Sagte ich es nicht,« meinte der Einäugige, »daß die Wirtin wahrscheinlich besser eingeweiht ist, als wir? Sie spielt eine Hauptrolle. Wir, die wir uns auf Meeren und in Ländern herumplagen müssen, geben nur Nebenfiguren ab.«
Beide erbrachen ihr Schreiben und lasen. Dann sahen sie sich an.
»Gut oder schlecht?« fragte der Grieche.
Der Seewolf zuckte die Achseln und antwortete halb unwillig:
»Beides! Ich liebe es eben nicht, wenn ein einmal gegebener Befehl aufgehoben oder doch geändert wird. Jetzt wird mir wieder aufgetragen, bei Wahrung meines Lebens der Petersen kein Haar zu krümmen, sie aber doch aus der Welt zu schaffen. Ich soll sie mit Gewalt oder List nach einer mir bezeichneten Stelle bringen, von wo aus sie abgeholt wird, und dann meinem ersten Auftraggeber bei meiner Seligkeit schwören, ich hätte sie getötet. Zeugen ständen mir zur Verfügung. Verlockend ist allerdings die doppelt so hohe Summe, die mir dafür geboten wird.«
»Wie hoch ist diese?«
»Hm, mein lieber Demetri! In solchen Geschäftsgeheimnissen hört denn doch unsere Freundschaft auf.«
»Und die Sache riecht mir nach Mädchenhandel,« sagte der Grieche, ohne im geringsten durch die Antwort des Gefährten beleidigt zu sein. »Stimmt! Die Gefangennahme der Kapitänin ist jedenfalls die Privatsache irgend eines Wüstlings, aber daß ich für jedes andere Mädchen, welches ich ausliefere, eine Prämie bekomme, geht ohne Zweifel auf Rechnung des Meisters.«
Der Grieche nickte.
»Seit der Sklavenhandel nicht mehr gehen will, scheint sich der Meister nur mit dem Mädchenhandel zu befassen. Mir schreibt er: ›Heute über sieben Tage abends die ›Undine‹ segelbereit halten. Achtzehn Weiber werden nach Smyrna geschifft, wo man sie abholt.‹ – Die Dinger werden an asiatische Fürsten verkauft, kenne das von früher, als wir dieses Geschäft so nebenbei im kleinen betrieben. Prosit, Kamerad, auf glückliches Gelingen!«
Der Seewolf that Bescheid.
»Wie gedenkt Ihr Euren Plan einzurichten?« fragte der Grieche wieder.
Der Einäugige kraute sich in den Haaren.
»Es ist eine verdammte Geschichte! Das ganze Weibsvolk tot abzuliefern, wäre mir eine Kleinigkeit, aber eine zerbrechliche Ware ohne jeden Schaden irgendwo zu überwältigen, das ist nichts für den Seewolf. Ich bin kein Kindermädchen, das mit zarten Gestalten umzugehen weiß.«
»Ist nicht Konstantinopel ein günstiger Platz für eine Ueberrumpelung? Die engen und dunklen Gäßchen der Stadt eigneten sich doch vortrefflich hierzu, und die Polizei ist auch flau.«
»Pah, die Polzei!« meinte der Einäugige verächtlich. »Kommt dem Seewolf nicht mit solchen Kleinigkeiten! Hier kann ich wohl einige der Weiber wegfangen, doch nicht alle. Und, bei meiner Seligkeit, alle muß ich haben, oder ich will nicht der Seewolf heißen!«
»Wenn Euch die Reisebegleiter der Mädchen nicht einen derben Strich durch die Rechnung machen!«
»Diesen Bürschchen werde ich gehörig die Zähne weisen; so oder so, einmal müssen sie doch daran glauben.«
»Schickt ihnen Bill als Koch an Bord,« schlug der Grieche vor.
»Haha, der würde ihnen eine schmackhafte Henkersmahlzeit vorsetzen. So übel ist der Vorschlag nicht. Aber es machte mir doch mehr Vergnügen, wenn ich diesen feinen Herrchen ordentlich auf die Finger klopfen könnte, sodaß sie sich nie wieder mit einer Spielerei abgeben, die sie nicht verstehen.«
»Woher erfahrt Ihr immer, wohin sich die ›Vesta‹ wendet? Denn ausplaudern wird dies die Besatzung doch sicher nicht?« fragte Demetri.
»Durch den Meister,« war die Antwort. »In der Straße von Gibraltar gab mir ein Fischer, der neben uns anlegte, den Auftrag, nach Konstantinopel zu segeln. Jetzt schreibt er: Nächstes Reiseziel Alexandrien.«
»Merkwürdig! Doch sagt, was habt Ihr für einen Plan, die Mädchen zu bekommen?«
Der Seewolf schwieg eine Zeit lang nachdenklich, dann sagte er offen:
»Mir fällt augenblicklich nichts weiter ein, als auf offener See die ›Vesta‹ anzugreifen, zu entern und zu nehmen. Oder vielleicht auch, daß wir als Schiffbrüchige auf das Schiff kommen und dann die Mädchen überwältigen. Aber ohne Skandal geht so etwas natürlich nicht ab. Einige Dolchstiche wären mir tausendmal lieber.«
Der griechische Mädchenhändler spielte träumerisch mit seinem Glase.
»Seewolf,« begann er endlich wieder, »Ihr mögt ein ganz brauchbarer, in Eurem Handwerk geschickter Geselle sein, wie es auf dem Meere wenige mehr giebt, aber Eure Schlauheit läßt viel zu wünschen übrig.«
»Wieso?« brauste der andere beleidigt auf.
»Ihr mögt auch gerieben sein,« besänftigte der Grieche den Aufgebrachten, »aber es fehlt Euch an Einfällen. Was gebt Ihr mir, wenn ich Euch einen Plan verrate, der Euch schnell ans Ziel führt?«
Der Grieche blinzelte listig mit den zugekniffenen Augen.
»Gebt Ihr mir die Hälfte Eures Verdienstes ab?«
»Seid Ihr verrückt? Seht, ich will ehrlich gegen Euch sein. Für jedes Mädchen, welches ich außer der Kapitänin lebendig ausliefere, erhalte ich 306 Dollars, 24 Mädchen sind es, und ich verspreche Euch, ist Euer Vorschlag gut, den vierten Teil von diesem Lohne, also im besten Falle 1800 Dollars. Einverstanden?«
»Nun, Ihr wißt, ich bin Euch noch einen Gegendienst schuldig, sonst würde ich Euch den Plan nicht so billig verkaufen, denn ein solcher ist bei jedem Unternehmen doch die Hauptsache. Also abgemacht, den vierten Teil!«
»Und was meint Ihr?« fragte der Pirat gespannt.
»Sehr einfach! Ihr fangt hier in Konstantinopel oder sonst irgendwo eines der Mädchen weg, am besten gleich die Kapitänin, denn dann ist Euch ein hoher Gewinn sicher, und lockt mit dieser die ganze Besatzung nach einem Eurer Schlupfwinkel, wo sie Euch nicht mehr entgehen kann.«
»Wahrhaftig!« rief erfreut der Seewolf und schlug donnernd mit der Faust auf den wurmstichigen Tisch. »Daß mir auch so etwas Einfaches nicht einfallen mußte.«
»Natürlich, die alte Geschichte,« lachte Demetri, »jetzt ist es etwas Einfaches.«
»Aber die Brigg,« wendete der andere wieder zweifelnd ein, »wird mir verdammt viel zu schaffen machen!«
»Da sieht man, daß Ihr ein Narr seid. Mit der macht Ihr es ebenso. Fangt einen der Burschen weg oder tötet ihn und laßt ihn verschwinden! Schreibt falsche Briefe oder benachrichtigt seine Kameraden sonstwie von seinem Aufenthaltsort, und Ihr sollt sehen, wie schnell diese dummen Kerle in die Schlinge gehen. Habt Ihr sie erst, dann ist es Euch auch ein leichtes, sich über ihre Vermögensverhältnisse zu erkundigen. Sind es wirklich vornehme Leute, dann könnt Ihr Euch ein gutes Lösegeld versprechen.«
»Topp! Das wird gemacht! Ihr könnt dafür auf einen Gegendienst rechnen. Bei der ersten Gelegenheit werde ich mich einiger der Mädchen bemächtigen, vielleicht schon morgen.«
»Nein, nur eines einzigen, vergeßt das nicht!« ermahnte der Grieche. »Die Sache ist so sicherer und geht geräuschloser vor sich, als wenn Ihr zu viel wagt.«
Die beiden beratschlagten noch einige Zeit, dann trennten sie sich.
Bereits seit sechs Tagen ankerte die »Vesta« vor Konstantinopel. Die Damen hatten teils zusammen, teils in kleineren Gesellchaften, die türkische Hauptstadt nach allen Richtungen durchstreift, alle Sehenswürdigkeiten, wie Moscheen, Cisternen, das Hippodrom u. s. w. besucht, doch nicht eine einzige war unter ihnen, welche mit dem Aufenthalt in diesem ersten Hafen zufrieden gewesen wäre. Diese Amerikanerinnen hatten die Heimat nicht verlassen, um sich die Welt zu besehen, das hätten sie bequemer als Passagiere erster Klasse auf einem Dampfer haben können; nein, sie hofften auf Gelegenheiten, bei denen sie einmal zeigen konnten, daß auch Frauen den Mut und die Thatkraft besitzen, welche sonst nur den Männern zugesprochen werden.
Wohl legte allein die lange Seereise als Matrose Zeugnis davon ab, aber es genügte den Damen nicht, daß sie nur für ihr eigenes Leben arbeiteten, sie wollten selbst gleich Männern in fremde Schicksale eingreifen, das Recht und die Unschuld beschützen, das Unrecht bestrafen, und zwar offen, mit der Waffe in der Hand. Und dazu bot sich ihnen bisher keine Gelegenheit.
Gleichzeitig mit der »Vesta« war der »Amor« eingetroffen, und die Damen merkten wohl, daß ihnen stets dunkle Gestalten folgten, wohin sie auch gehen mochten. Da dieselben aber in einer respektvollen Ferne blieben und sich durchaus nicht aufdringlich zeigten, so ließ man es ruhig geschehen. Wer wußte, ob man nicht doch einmal männliche Hilfe nötig hatte?
Am Abend des sechsten Tages kamen die drei Freundinnen, Ellen Petersen, Jessy Murray und Johanna Lind von einem Besuche der Cisterne Basilica, einer jener sehenswerten, von unzähligen Säulen getragenen Röhrenanlagen, aus denen Konstantinopel mit Wasser versorgt wird. Die Damen trugen bei derartigen Ausflügen natürlich nicht ihre Matrosenuniform, sondern geschmackvolle, moderne Toiletten.
Durch die lange Wanderung zwischen den Marmorsäulen erschöpft, beschlossen sie, sich für kurze Zeit in einem Café zu erholen. Sie begaben sich in das nächste, anständige Lokal und besprachen bei einer Tasse Mokka das eben Gesehene.
Plötzlich trat ein Herr in den Saal und setzte sich, ohne die übrigen wenigen Gäste zu beachten, nicht weit von den Damen an einen Tisch.
Es war ein großer, schlank und doch athletisch gebauter Mann, dessen schönes Gesicht von einem blonden Vollbart eingerahmt wurde.
Bei seinem Anblicke war Johanna wie vor freudigem Erschrecken zusammengezuckt, aber so unmerklich, daß selbst die dicht an ihrer Seite sitzende Ellen keine Spur davon gemerkt hatte, und keine Röte, keine Erregung in den Zügen des jungen Mädchens verriet, daß sie diesen Mann kannte.
Kaum hatte sich derselbe gesetzt und seine Bestellung aufgegeben, als seine Blicke die drei Damen streiften. Wie vorhin Johanna, so war jetzt er überrascht, nur daß er seine Freude nicht zu verbergen bemüht war. Eine jähe Röte schoß über sein Antlitz, er sprang auf und näherte sich schnell jenem Tische, fast noch im Gehen die Hand ausstreckend und in herzlichem Tone auf deutsch rufend:
»Fräulein Johanna – Lind!« fügte er dann, abermals errötend, hinzu. »Also hier in Konstantinopel sehen wir uns endlich wieder! Wie mich das freut!«
Es war sonderlich, daß Johanna diesen warmen Ton nicht erwiderte. Sie stand auf, und ohne die Hand zu ergreifen, stellte sie in förmlichem Tone vor:

»Miß Petersen, Miß Murray – Herr Ingenieur Hoffmann. Wir hatten am Oberonsee Gelegenheit, uns kennen zu lernen.«
Sie sah den jungen Mann mit einem so eigentümlich festen Blick ihrer schönen Augen an, daß dieser sichtlich eine Bemerkung unterdrückte, die ihm auf der Zunge geschwebt hatte.
»Ah, Miß Petersen?« rief er dann rasch gesammelt. »So habe ich die Ehre, mit der Kapitänin der ›Vesta‹ zu sprechen?«
Die Damen bejahten.
»Schon oft habe ich mir gewünscht, mit diesen kühnen Vestalinnen zusammenzutreffen, wohl niemand hat sich für Ihre Idee so lebhaft interessiert, wie ich. Aber Fräulein Lind,« fuhr er dann mit einem Anflug von Erstaunen fort, »gehören auch Sie zu der Besatzung der ›Vesta‹, die doch –«
Ein einziger Blick traf den Sprecher aus den Augen Johannas, daß er plötzlich eine Pause machte und dann weitersprach:
»– die doch nur aus New-Yorker Damen bestehen soll?«
»Ausnahmen bestätigen nur die Regel,« nahm Miß Petersen das Wort. »Doch dürfen wir uns erkundigen, was Sie hierher nach Konstantinopel führte?«
»Miß Lind hat Sie vorhin doch nicht ganz richtig belehrt,« sagte der Herr, der inzwischen am Tische Platz genommen hatte, »indem sie mich als Ingenieur vorstellte. Allerdings habe ich Ingenieurwissenschaften studiert, aber meine Neigungen galten dem Schiffsbau, und nachdem ich einige Reisen gemacht, widmete ich mich vollständig dem Seeleben. Ich führe jetzt ein eigenes Schiff, den ›Blitz‹, den Sie vielleicht schon in Galata haben liegen sehen.«
»Ah,« riefen die Damen wie aus einem Munde, und Johanna lauschte von jetzt ab aufmerksamer als zuvor, »so ist das schwarze Schiff das Ihrige!«
»Ja, es wird immer mehr Mode, daß man seine Reisen als Kapitän auf einem eigenen Schiffe macht,« sagte lächelnd Hoffmann. »Selbst Damen finden ja Geschmack daran. Gleich Ihnen befahre ich seit einem Vierteljahre alle Meere, besehe mir die Hafenplätze und mache ab und zu einen Abstecher ins Land.«
»Nun,« spottete Jessy Murray gutmütig, »in drei Monaten können Sie wohl noch nicht ›alle‹ Meere befahren haben.«
Der Herr wurde etwas verlegen.
»Wie gefällt Ihnen mein Fahrzeug?« fragte er ausweichend.
»Es scheint ein ausgezeichneter Segler zu sein. Aber wie sonderbar, daß Sie schwarz zur Farbe gewählt haben! Wir ließen uns den Schiffsrumpf so gefallen, aber selbst alles Tauwerk und die Segel schwarz zu streichen, das ist doch übertrieben. Ferner müssen Sie eine starke Besatzung an Bord haben, mindestens sechzig Mann. Das Deck wimmelt ja förmlich von Leuten.«
»Ich brauche sie,« antwortete Hoffmann, dessen Aufmerksamkeit nur Johanna zu gelten schien, abermals verlegen.
»Sie scheinen nicht viel auf der Kommandobrücke zu stehen, oder vielmehr, da der ›Blitz‹ sonderbarerweise keine besitzt, sich an Deck selten aufzuhalten,« bemerkte Jessy. »Sehen Sie uns an, wie wir von der Sonne erbraunt sind.«
»Wirklich, sehr, aber es steht Ihnen gut,« sagte der Mann kopfschüttelnd und bog sich vor, als wolle er Johannas Antlitz in Bezug auf Echtheit der Farbe prüfen.
Die beiden anderen Damen konnten sich das rätselhafte Betragen des Ingenieurs nicht erklären, höchstens Johanna mochte etwas ahnen.
»Wir haben für übermorgen vormittag mit der Besatzung der englischen Brigg ›Amor‹ und der eines französischen Lustdampfers ein Wettrudern in achtriemigen Booten vor,« begann wieder Miß Ellen die Unterhaltung. »Würden Sie sich vielleicht an der Regatta beteiligen?«
»Ich? Nein, danke, die Boote des Blitz gewinnen doch. Na ja,« fuhr er plötzlich fort, als er die erstaunten Mienen der Damen bemerkte, und wurde wieder verlegen, »wir können ja auch einmal verlieren. Gut, ja, ich nehme die Einladung an.«
Er erfuhr noch, wo und wann das Zusammentreffen der Boote stattfinden sollte.
»Wir müssen fort,« sagte Miß Ellen. »Die Dunkelheit bricht an, und wir brauchen wenigstens eine halbe Stunde, ehe wir einen Pferdebahnwagen oder ein anderes Fuhrwerk treffen.«
»Um Gottes willen, gehen Sie nicht allein bei Nacht durch die Straßen Konstantinopels!« rief Hoffmann, sich direkt an Johanna wendend. »Ich weiß, wie gefährlich sie sind.«
»Aber nicht für eine Vestalin,« entgegnete lächelnd Johanna.
»Bravo!« stimmten die beiden anderen Damen ihr bei.
»Meine Begleitung werden Sie doch nicht ausschlagen?«
»Auch das müssen wir,« sagte Miß Petersen. »Wir würden den Namen unseres Schiffes beschimpfen, wenn wir in Herrenbegleitung an Bord kämen. Leben Sie wohl! Also auf Wiedersehen übermorgen vormittag.«
»Dieser Herr Hoffmann hat ein seltsames Betragen,« meinte Ellen auf der Straße. »Kennen Sie ihn näher, liebe Jane?«
»Er ist ein einfacher, bescheidener Charakter, der sich nicht verstellen kann und nicht in Gesellschaft paßt. Ich kenne ihn nicht genauer als Sie.«
»Wir? Wieso?«
»Er hat einen wahren Abscheu davor, sich bekannt oder berühmt zu machen, obgleich er es leicht könnte, denn er soll eminente Talente besitzen. Bei jenem schrecklichen Dammbruche am Oberonsee, als auch ich Gelegenheit hatte, meine schwachen Kräfte im Dienste der Nächstenpflicht anzuwenden, that sich bekanntlich ein Herr hervor, dessen Namen später vergeblich von den Zeitungen zu erforschen gesucht wurde. Ich bin wohl die einzige, die ihn kannte. Zum Vergnügen am Oberonsee weilend, eilte er beim ersten Signal nach der Unglücksstelle, vollbrachte Wunder von Rettungsthaten, gegen welche die meinigen nur Spielereien waren, und als der die Dammarbeiten leitende Pionieroffizier von den Fluten verschlungen worden war, ergriff Hoffmann das Kommando. Sein genialer Blick übersah sofort die Situation, und nur ihm ist es zu danken gewesen, daß dem durchbrechenden Wasser Einhalt geboten wurde. Doch als die Gefahr vorüber, war auch er spurlos verschwunden. Erinnern Sie sich noch dessen?«
»Wir entsinnen uns,« versicherten die Damen; »der Klub ›Ellen‹ scheute keine Bemühungen und Kosten, um den Namen des Helden zu erfahren.«
»Er will nicht, daß jemand die Sache berührt. Wenn Sie ihm Schmeicheleien gesagt hätten, wäre er aus der Verlegenheit gar nicht herausgekommen. Ich wiederhole, er ist ein Mann der That und nicht der Gesellschaft.«
Die drei Damen waren im Eifer der Unterhaltung stehen geblieben. Plötzlich fiel mitten zwischen sie ein weißes Zettelchen. Miß Ellen hob es auf, blickte nach oben, von wo es gekommen war, konnte aber in der von den Sternen beleuchteten Nacht an der nackten Hauswand nur ein kleines, vergittertes Fenster wahrnehmen.

»Merken Sie sich den Namen der Straße und die Lage des Hauses,« sagte Ellen, nachdem sie das Papier aufmerksam betrachtet hatte, im Weitergehen. »Ich kann wohl Schriftzüge erkennen, sie aber bei der schwachen Beleuchtung nicht lesen. Da in diesem Viertel keine Laterne zu existieren scheint, so müssen wir warten, bis wir in belebtere Straßen kommen.«
Nach einer kleinen Weile bogen sie in eine breite, aber auch noch dunkle Straße ein, welche nach dem Hafen führte. Kaum waren sie in diese eingetreten, als Johanna sagte:
»So, jetzt können Sie es lesen, ich habe Streichhölzer bei mir.«
»Warum sagen Sie das erst jetzt?«
»Ich nehme an,« sagte Johanna lächelnd, »daß dieses Papier irgend etwas enthält, was andere nicht wissen sollen, sonst wäre es uns nicht so geheimnisvoll zugestellt worden.«
»Wirklich,« sagten beiden Damen überrascht, »Sie haben recht.«
Bei dem Scheine eines brennenden Streichholzes überflog Miß Petersen die Schrift. Erstaunen, vermischt mit Freude, prägte sich dabei in ihren Zügen aus, dann sagte sie:
»Es ist in gutem Französisch geschrieben. Hören Sie nur, das ist etwas für uns:
»Ich werfe dieses Billet der ersten Person zu, welche ich englisch sprechen höre, weil ich weiß, daß die Engländer die Sklaverei nicht dulden. Ich bin die Tochter des Scheichs Mustapha-ibn-Hamed vom Stamme der Beni-Suef, deren Zelte zwischen Fayum und den Natronseen stehen. Man hat mich geraubt und nach Konstantinopel verkauft. Zufällig habe ich erlauscht, daß ich und siebzehn andere Mädchen morgen Abend an Bord der ›Undine‹, ankernd in Galata, zweite Brücke, gebracht und nach Smyrna geschafft werden sollen. Wer du auch seiest, kannst du nichts für mich thun, so teile wenigstens meinem Vater mit, welches Schicksal seine Tochter getroffen hat.
Sulima.«
»Und darunter,« fuhr die Leserin fort, »steht noch flüchtig gekritzelt:
»Allah sei Dank, mein Billet fällt in die Hände edler Damen. Sie werden mir helfen! Das letztere gilt natürlich uns,« schloß Miß Ellen.
»Ein himmlisches Mädchen,« rief Miß Jessy enthusiastisch, »diese Sulima! Endlich mal eine Gelegenheit zu einem kleinen Abenteuer!«
»Wie fangen wir es an, die Sulima und womöglich alle ihre Genossinnen zu befreien?« sagte Ellen nachdenklich.
»Sehr einfach,« entgegnete die hitzige Jessy, »wir gehen an Bord, alarmieren unsere Freundinnen, dringen in das Haus, zünden es meinetwegen an und bringen im Triumphe die Befreiten in ihre Heimat. Dann hat unsere Reise wenigstens einen Zweck gehabt.«
»Und in der nächsten Stunde sitzen wir wegen Einbruchs, Brandstiftung, gewaltsamer Entführung u.s.w. fest,« ergänzte lächelnd Johanna. »Nein, das ist nichts. Ich kenne die türkischen Gesetze, sie sind dem Mädchenhandel viel zu günstig gestimmt, weil dabei etwas für den Staat abfällt. Nein, ich habe bereits einen anderen Plan.«
»Der ist?« fragte Ellen begierig.
»Wir orientieren uns, ob in Galata wirklich ein Schiff Namens ›Undine‹ liegt –«
»Es liegt dort, ich habe es selbst gesehen, eine kleine Bark. Sie ladet Wein,« sagte Jessy.
»Desto besser! Also spionieren wir morgen abend, ob die Mädchen wirklich an Bord gebracht werden, und nehmen der ›Undine‹ auf offener See ihren Raub ab. Das macht der ›Vesta‹ Ehre.«
»Bravo!« rief Ellen. Miß Lind hat wieder den besten Einfall.«
Auch Jessy stimmte freudig bei.
»Aber,« wendete sie doch ein, »der griechische Kapitän wird seine Passagiere nicht gutwillig herausgeben.«
»Miß Murray,« rief Ellen ganz erstaunt, »ich verstehe Sie nicht! Wozu haben wir denn Geschütze an Bord? Denen streifen wir eben einmal die Leinwandbezüge ab, jagen der ›Undine‹ ein paar Kugeln in den Leib und zwingen die Besatzung mit dem Revolver in der Hand, die Mädchen uns zu überlassen. Wir wollen uns doch nicht umsonst ein Jahr lang am Geschütz ausgebildet haben.«
»Jetzt schnell an Bord,« rief Jessy und lief schon mit stürmischen Schritten voraus. »Heute nacht wird vor Freude keine Vestalin schlafen.«
Lachend folgten die beiden anderen der Aufgeregten.
Die Straße verengte sich an einer Stelle so, daß der Sternenhimmel weiterhin kaum zwischen den Dächern der Häuser durchblickte. Fast vollständige Dunkelheit umgab die drei Mädchen.
Da sah Miß Ellen mit einem Male, welche einige Schritte hinter den beiden anderen zurückgeblieben war, wie eine Menge dunkler Gestalten von allen Seiten herzusprangen und jenen große Decken über den Kopf warfen.
»Hilfe!« gellte es aus Ellens Munde durch die Nacht, und gewandt wich das Mädchen einem Angreifer aus. Ehe er seinen Versuch erneuern konnte, erhielt er von der kräftigen Ellen einen solchen Schlag ins Gesicht, daß er hintenüber zur Erde fiel.
Sie griff in die Tasche, um den Revolver zu ziehen, aber ehe sie ihn noch in der Hand hatte, fühlte sie ihre Arme gefaßt und zusammengepreßt. Vergebens versuchte sich die Jungfrau von dem eisernen Griffe zu befreien, noch einmal stieß sie einen Hilferuf aus, dann fiel eine Decke über sie und erstickte ihr Geschrei.
So fest war die Hülle um sie gewickelt worden, daß sie weder Füße, noch Arme regen konnte.
Ellen wurde emporgehoben und kam auf den muskulösen Arm eines Mannes zu sitzen, aber kaum war dieser einige Schritte gelaufen, als so laute Stimmen an ihr Ohr schlugen, daß sie deutlich selbst durch die dicke Decke drangen und das Herz des Mädchens mit Entzücken erfüllten.
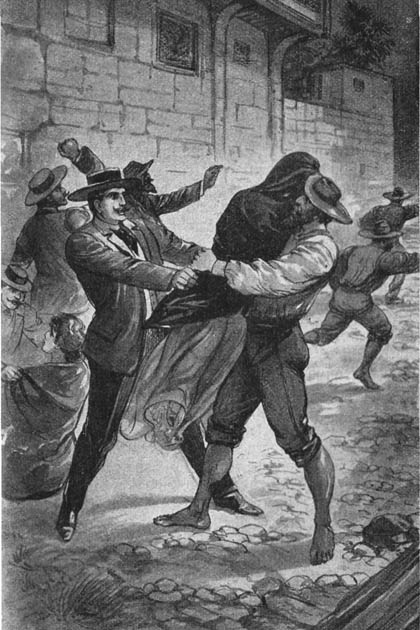
Sie kannte diese tiefe, donnernde Stimme, die fröhliche helle, wie auch alle die anderen.
»Banditen, Räuber,« schrie der Baß, »da, eins, zwei, drei ...«
Jede Zahl war von einem Schlag begleitet, wie wenn ein Ochse gefällt wird.
»Halt! Reißt nicht so schnell aus! Ich bin nicht so gut zu Fuß,« rief dann die lustige Stimme. »Entschuldigen Sie, es that doch nicht weh?«
Der Frage war ein Weheruf vorausgegangen.
Dies alles hatte nur einen Augenblick in Anspruch genommen, im nächsten fühlte sich Ellen heftig zu Boden gesetzt; die Decke wurde ihr abgerissen.
Vor ihr stand Lord Harrlington, der sie mit besorgten und zugleich zärtlichen Blicken betrachtete.
Ehe Ellen noch ein Wort sagte, wandte sie sich um, und zu ihrer unaussprechlichen Freude bemerkte sie, daß auch die beiden Freundinnen eben von den Hüllen befreit wurden.
Der lustige Charles half dabei Miß Jessy, und wie gewöhnlich, konnte er auch jetzt nicht eine lustige Bemerkung unterdrücken.
»Sie erlauben doch, daß ich Ihnen ablegen helfe,« sagte er im höflichsten Tone. »Wenn Sie aber frieren sollten, so behalten Sie meinetwegen nur die Pferdedecke um.«
Acht Herren vom ›Amor‹ waren es, welche die Damen gerettet hatten, aber der Mann, welcher jetzt Miß Lind aus der Decke schälte, war jener Herr aus dem Café, der deutsche Ingenieur.
Ellen erzählte in Kürze, wie alles gekommen war; sie hatte nicht viel zu sagen, weil der Ueberfall so überraschend ausgeführt worden war.
»Wir hatten Sie in der Cisterna Basilika beobachtet,« berichtete Lord Harrlington, »waren Ihnen nach dem Café gefolgt und hatten Sie dort hineingehen sehen. Nun müssen Sie aber das Lokal durch eine Hinterthür verlassen haben, denn als fast eine Stunde verstrichen, überzeugten wir uns, daß Sie nicht mehr drinnen waren. Seltsam, zum ersten Male verloren wir Ihre Spur, und gerade da mußte eine Gefahr für Sie auftauchen.«
»Glücklicherweise holten wir gleich darauf einen Herrn ein, welcher unsere Absicht, Ihnen nahezubleiben, kennen mußte, denn er fragte uns, ob wir Sie verloren hätten. Wir bejahten, und er sagte, er sei Ihnen auf der Fährte. Unterwegs stellte er sich uns vor und behauptete, bereits in jenem Café Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben.
»Als wir dort oben um die Ecke bogen, ertönte Ihr erster Hilferuf, gleich darauf der zweite, und ehe wir nur noch daran dachten, unseren Gang zu beschleunigen, schoß schon Herr Hoffmann wie ein Pfeil uns voraus und schlug den Träger von Miß Lind zu Boden. Dann machten auch wir uns an die Arbeit.«
»Wo ist denn unser Retter, Mister Hoffmann?« fragte Ellen und sah sich nach allen Seiten um.
»Ja, wo ist er?« sagte Charles. »Er schälte Miß Lind so behutsam aus, als hätte er ein weiches Ei vor sich, und dann, hui, weg war er.«
»Ein seltsamer Mensch.«
»Schade, daß wir keinen der Straßenräuber festgehalten haben,« meinte ein anderer Herr. »Wir waren alle so in Sorge um die Damen, daß keiner daran dachte, sich weiter um die am Boden Liegenden zu kümmern. Natürlich haben sie sich eilends ans dem Staub gemacht.«
»Laßt die armen Kerle laufen,« erwiderte Charles Williams sorglos, »denen schmeckt heute doch das Abendbrot nicht mehr. Ich habe dem einen Burschen mit einem Male alle Zähne ausgezogen! Das mache mir einmal ein Zahnarzt nach. Ein Glück ist es nur, daß ich Lord Hastings zuvor das heilige Gelübde abgenommen habe, bloß ganz vorsichtig zuzuschlagen, sonst könnten wir die ganze Nacht mit der Karre die Leichen fortbringen. Hagel und Haubitzen – Pardon, meine Damen –« unterbrach er sich mit einem Male und hob etwas von der Straße auf, »hier hat wohl gar ein Bandit noch seine Photographie hinterlassen?«
Er zündete ein Streichholz an.
»Ah, Pardon, Miß Petersen, es ist die Ihrige, die Sie wahrscheinlich Ihrem Entführer zum Andenken mitgeben wollten.«
»Meine Photographie?« rief Ellen im Tone des höchsten Erstaunens.
Sie beleuchtete das Bild.
»Wirklich! Wer von den Herren war im Besitze meiner Photographie?«
»Niemand,« versicherten alle, auch die Damen verneinten.
Gedankenvoll wandte Ellen langsam den Kopf, bis ihre Blicke denen Harrlingtons begegneten. Die übrigen lachten eben über die Spaße des lustigen Charles.
»Wissen Sie, wer sie verloren haben kann?« fragte Lord Harrlington leise. – »Nein!« – »Besaß keiner der Räuber, der gedungenen Mörder Ihr Bild?«
Entsetzt starrte sie den jungen Mann an. Unwillkürlich strichen ihre schlanken Finger an der Kante der Photographie hin und her, und plötzlich verließ alle Farbe ihr Gesicht, die Lippen fingen an zu beben, und wieder und wieder fuhren die Finger an der Seite des Bildes herunter, bis sie allemal wieder auf einer Stelle haften blieben.
»Lord!« stöhnte sie endlich. »Ich kenne das Bild, ich weiß, wem es gehört, eine entsetzliche Ahnung dämmert in mir auf.«
»Was Sie nur ahnen, ist bei mir Gewißheit,« sagte finster Harrlington. »Und sehen Sie,« fuhr er mit herzlichem Tone fort und trat auf das zitternde Mädchen zu, »weil ich es wußte, darum bin ich Ihnen gefolgt und werde nicht von Ihrer Seite weichen.«
»Verzeihen Sie mir,« erwiderte stammelnd und mit erstickter Stimme Ellen, »ich bin ein thörichtes, eigensinniges Mädchen gewesen. Geben Sie mir die Hand! So! Ich nehme von jetzt ab Ihre Begleitung an. Nun gerade aber will ich zeigen, daß die ›Vesta‹ doch um die Erde kommt, wenn auch gefolgt vom ›Amor‹!«
»An Bord, meine Damen,« rief sie, sich zur Fröhlichkeit zwingend.
»Die Herren werden uns hoffentlich sicher hinbringen.«
»Hundert oder fünfzig Meter Distanz?« fragte Charles.
»Einen Meter,« war die Antwort. – – – –
Zwei Stunden später, es war fast Mitternacht, legte ein Boot zur Seite des ›Blitzes‹ an.
»Der Kapitän an Bord?« fragte der Bootsführer.
»Ja, was giebt's?« klang es von oben herab.
»Einen Brief persönlich an den Kapitän abzugeben.«
»So kommt an Deck!«
Der Ruderer befestigte sein Boot mit einem kunstvollen Knoten am Fallreep, einer auf Schiffen gebräuchlichen, aufziehbaren Treppe, und stieg diese hinauf.
Eine halbe Minute später öffnete der deutsche Ingenieur, jetzt Kapitän des ›Blitzes‹, das zierliche Briefchen. Helle Ueberraschung spiegelte sich in den edlen Zügen wieder, die sich aber sofort in Freude verwandelte, als er die Unterschrift ›Johanna Lind‹ las. –
Die neue Vestalin hatte zum zweiten Male die Gesetze der ›Vesta‹ übertreten.
Ein schwacher Wind blähte die Segel der Bark, welche sich an einem sonnigen Sommermorgen ihren Weg zwischen den Inselchen des griechischen Archipels suchte.
›Bark‹ ist die seemännische Bezeichnung für ein Segelschiff mit drei Masten, von denen jedoch nur die beiden vorderen Raaen führen; der hintere Mast hat keine, sondern trägt nur ein einziges, großes Segel, das sogenannte Besansegel, welches von der Mastspitze bis an Deck reicht.
Der Mann am Bug, der mit blinzelnden Augen nach dem verschwindenden Horizont späht, ist niemand anderes als Signor Demetri, und die Bark ist sein Schiff, die ›Undine‹.
»Wann kommen wir endlich aus diesen verwünschten Inseln heraus?« fragte auf französisch ein neben ihm an der Bordwand lehnender Herr, sehr elegant gekleidet, aber im Schnitte seiner Gesichtszüge den Türken verratend.
»In etwa einer Stunde, Herr,« entgegnete der Kapitän. »Weiß der Teufel, man fühlt sich nicht davor sicher, daß nicht jeden Augenblick ein englischer Kreuzer hinter einem Vorsprung auftauchen und die Bark zwecks Visitation anhalten kann.«
»Was für Vorsichtsmaßregeln haben Sie für diesen Fall getroffen?«
Der Grieche lächelte verschmitzt.
»Mein Schiff hat Wein geladen. Außerdem aber haben wir noch ebenso viele leere Fässer an Bord, wie Mädchen vorhanden sind. Dieselben werden dann einstweilen in jene gesteckt, bis der Besuch wieder abgedampft ist.«
»Wenn die Spürnasen aber nun an die leeren Fässer klopfen oder am Gewicht merken, daß kein Wein darin ist?«
»Hahaha,« lachte der Kapitän schlau. »Darauf sind wir vorbereitet. Mögen die englischen Pfiffköpfe heben, klopfen, anbohren so viel sie wollen, sie finden auch in den leeren Fässern Wein.«
»Wie soll ich das verstehen?« fragte erstaunt der Türke.
»Ganz einfach, die Fässer haben einen doppelten oberen Boden, der mit Wein gefüllt ist und wo auch der Spund sitzt. Der Eingang zum inneren, leeren Raume liegt am Boden.«
»Das ist wirklich großartig!« rief der Frager. »Doch das Gewicht? Es wird doch etwas geringer sein, als wenn das Faß mit Wein angefüllt wäre.«
»Durchaus nicht! Die Fässer sind mit Blei ausgelegt, sodaß nur ein Centner Gewicht im Vergleich zu den wirklichen Weinfässern fehlt. Diesen ergänzt dann ein Mädchen.«
Der Türke wollte eben noch eine Frage stellen, als der Kapitän ihn unterbrach und nach einer kleinen Insel in der Ferne deutete.
»Da! Endlich! Es ist das letzte Eiland im griechischen Archipel. In zehn Minuten werden wir es hinter uns haben und im freien Fahrwasser sein. Doch sagen Sie, Effendi, wie werden Sie die Mädchen in Smyrna von Bord schaffen? Damit habe ich mich nämlich nicht zu befassen.«
»Dann ist dies auch ganz meine Sache,« antwortete herrisch der Türke und wandte sich kurz ab.
»Oho,« murrte Demetri mit giftigem Blick nach dem Fortgehenden. »Warte, du türkischer Hund, wir sprechen uns noch einmal!«

»Schiff voraus an Steuerbord,« rief in diesem Augenblick ein Matrose von der Raa herab, wo einige der Leute postiert waren, um scharfen Ausguck zu halten, weil das schmale Fahrwasser des griechischen Archipels durch viele Schiffe belebt wird und ein Zusammenstoß also leicht eintreten kann.
»Was ist das?« fragte der Türke den Kapitän, der bereits mit dem Fernrohr den dunklen Punkt am Horizont betrachtete.
Ein unmerkliches Lächeln huschte über das gelbe Gesicht des Griechen.
»Ein englischer Kreuzer,« entgegnete er gleichgültig »der auf uns zu warten scheint.«
»Was?« rief der Türke erbleichend. »Nicht möglich!«
»Sie werden das auf uns wartende Schiff gleich ohne Fernrohr erkennen können.«
Der Kapitän der ›Undine‹ hatte dem stolzen Türken natürlich nur einen Schreck einjagen wollen, sonst wäre er selbst nicht so ruhig geblieben. Aber auch er wußte sich das Betragen jenes Schiffes nicht zu erklären.
Offenbar war es ein Segelschiff, ein Dreimaster. Es hatte die Segel an den Raaen aufgerollt, jedoch, wie man beim Näherkommen erkennen konnte, nur ganz unbeholfen und nachlässig, als wäre die Arbeit in höchster Eile ausgeführt worden.
Jetzt sah man auch, wie das Schiff trotz des schwachen Windes und ruhigen Seeganges heftig von einer Seite nach der anderen schwankte, und wie die Mannschaft an Deck ängstlich hin und her lief.
»Was ist denn dort los?« fragte der Türke, der die Gestalten an Bord nun mit dem bloßen Auge erkennen konnte.
Es war schade, daß er nicht in das Gesicht des neben ihm stehenden Kapitäns blickte, sondern seine Aufmerksamkeit nur auf das nahe, fremde Schiff richtete, sonst hätte er sehen können, wie sich ein freudiges Erstaunen in den Mienen des Griechen widerspiegelte.
»Ich weiß es noch nicht, doch wir werden es gleich erfahren,« antwortete der Gefragte möglichst gleichgiltig und sich beherrschend.
Er log. Er war ein erfahrener Seemann, aber zugleich auch ein schlauer, berechnender Mensch, und blitzähnlich hatte er einen Plan entworfen, über den er vor Freude fast aufgejauchzt hätte. Doch Vorsicht! Der Türke mußte getäuscht werden.
Er hatte nämlich erkannt, daß jenes Vollschiff die ›Vesta‹ war, welche er von Galata aus kannte. Das Steuerruder desselben mußte durch irgend einen Zufall gebrochen sein.
Sofort kalkulierte der schlaue Grieche: An Bord der ›Vesta‹ sind nur Damen, welche zum Vergnügen als Matrosen fahren. Pah! Frauenzimmer, die bei jedem kleinen Unfall aufschreien. Jetzt begegnete ihnen das erste Unglück. Das Steuerruder ist gebrochen. Für jeden erfahrenen Matrosen eine Stunde Reparatur, weiter nichts, aber für diese Weiber, Neulinge in der Seemannskunst, ein schreckliches Unglück. Sie können es selbst nicht ausbessern, werden das erste vorbeisegelnde Schiff anrufen, daß kundige Leute hinübergeschickt werden, und dieses erste Schiff – ist die ›Undine‹.«
Mit einem teuflischen Lächeln blickte sich der Kapitän um. Weit und breit war kein Schiff in Sicht, kaum in der Ferne die letzte kleine Insel des Archipels zu sehen, eine Viertelstunde nur, ja, nicht einmal so lange und – der Kapitän der ›Undine‹ war ein reicher Mann.
Ein häßliches Lächeln umspielte die Lippen des Griechen, während er durch die Zähne murmelte:
»Haha, Seewolf! Diesmal werde ich dir einen fetten Bissen wegschnappen. Wieviel war es für ein Mädchen? 300 Dollar, und das sind 25 Stück, 300 mal 25 macht 7500 Dollar, und die Kapitänin wird auch eine schöne Summe einbringen. Thut mir leid, alter Bursche! Aber wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Du machst es auch nicht anders. Aber ein paar Prozent will ich dir doch abgeben. Der Meister wird mit mir zufrieden sein, wenn ich auf eigene Faust handle. Schnelligkeit in der Ausführung seiner Befehle ist ihm die Hauptsache. Wer es besorgt, ist ihm egal. Aber der Türke braucht nichts zu merken.«
Als er seine Augen wieder nach dem Schiffe wendete, flatterten, wie er erwartet hatte, von dessen hinterem Maste eine Reihe Wimpel herab, und schon brachte ihm ein Matrose das internationale Signalbuch.
Aber Demetri bedurfte desselben nicht, er wußte, was die Zeichen bedeuteten.
»Ruder gebrochen. Können nicht reparieren. Hilfe!«
»Was sollen die bunten Läppchen dort?« fragte der Türke.
Der Grieche gab ihm keine Antwort. Fast hatte die ›Undine‹ das Schiff erreicht.
»Bergt die Segel! Ruder hart Backbord!« kommandierte er.
Die Segel wurden aufgezogen, und das Schiff drehte aus dem Wind, sodaß es stille lag.
»Was machen Sie denn?« schrie der Türke. »Fahren Sie weiter, ich befehle es Ihnen! Kümmern Sie sich nicht um ein fremdes Schiff!«
»Merken Sie denn nicht, daß dieses Schiff sinkt?« log der Grieche. »Ich muß die Mannschaft natürlich aufnehmen.«
»Ich kann nichts von einer Gefahr merken.«
»Weil Sie eben eine ›Landratte‹ sind. In einer Viertelstunde ist es mit Mann und Maus verschwunden.«
»Das geht Sie nichts an. Seit wann sind Sie denn so menschenfreundlich geworden?«
»Ich lasse meine Befehle ausführen. Zwei Boote aussetzen!« kommandierte der Grieche weiter, denn er sah, daß die steuerlose ›Vesta‹ zu stark schwankte, um die Bark dicht an sie bringen zu können.
»Was wollen Sie thun?« fragte wieder der Türke.
»Mich mit einigen Mann dort an Bord begeben und das Ruder ausbessern,« war die Antwort.
»Sie werden es nicht thun! Wozu denn nur?«
»Bedenken Sie doch, wie schön das klingt, wenn in allen Zeitungen zu lesen ist: die ›Undine‹ fand auf offener See ein Schiff mit zerbrochenem Ruder, und der brave Kapitän begab sich mit Lebensgefahr auf das Fahrzeug, um weiteres Unglück zu verhüten!« höhnte der Grieche.
»Sie thun es nicht! Sie bleiben hier an Bord, ich befehle es Ihnen!« schrie der Türke, blau vor Wut.
»Hören Sie,« antwortete der Grieche drohend und griff nach der im Gürtel steckenden Pistole, »ich bin hier Kapitän und lasse mir nicht befehlen. Wer mir an Bord ungehorsam ist, den schieße ich wie einen tollen Hund über den Haufen.«
Der Türke schwieg eingeschüchtert.
»Zwei Boote über Bord,« meldete ein Matrose.
Die ›Undine‹ lag jetzt etwa 20 Meter von der ›Vesta‹ entfernt, beide Schiffe die Breitseiten einander zugekehrt. Außer dem Kapitän wußte noch niemand, daß jene Matrosen dort verkleidete Frauen waren, als aber jetzt die beiden Boote mit je sechs Ruderern, welche sich auf Geheiß des Kapitäns bewaffnet hatten, von der Brigg abstießen, teilte er es den Leuten während der kurzen Fahrt nach dem Vollschiff mit.
»Ihr klettert möglichst gleichzeitig an Bord,« instruierte Demetri, »und bin ich als letzter oben, so zieht ihr, ebenso wie ich, die Pistolen und schlagt auf die Mädchen an. Aber kein Schuß darf fallen! Wehe dem, der einem der Mädchen ein Haar krümmt, alles andere besorge ich. Laßt die Frauenzimmer so viel schreien, wie sie wollen, es hört sie doch kein Mensch außer uns.«
Die Matrosen standen im Dienste des Mädchenhändlers, sie wurden von ihm bezahlt und wußten, daß bei jedem solchen Geschäft ein hübscher Anteil für sie abfiel. Auch nicht ein einziger war unter diesem gefühllosen Gesindel, der nicht jetzt heimlich aufgejauchzt hätte.
Jetzt erst konnten sie sich erklären, warum ihr Kapitän so bereit dazu war, jenem Schiff mit zerbrochenem Ruder Hilfe zu bringen, denn sonst war dies seine Art nicht. Ein ganzes Passagierschiff mit tausend Personen hätte er teilnahmlos untergehen sehen können, ohne auch nur einen Finger zur Rettung derselben zu rühren, wenn er davon keinen Vorteil in Aussicht hatte.
Eben deswegen hatte er ja den Streit mit dem Türken gehabt. Dieser stand jedenfalls auch im Dienste des Meisters, von dem die Matrosen nur hier und da ein dunkles Gerücht vernahmen. Demetri war zum ersten Mal mit jenem zusammengetroffen, hatte sich über dessen stolzes, befehlendes Wesen geärgert und wollte nicht, daß ein Anteil des in Aussicht stehenden Gewinnes auf ihn fiele.
Außer dem Türken waren auf der Bark nur der am Steuerruder stehende und ein anderer Matrose zurückgeblieben.
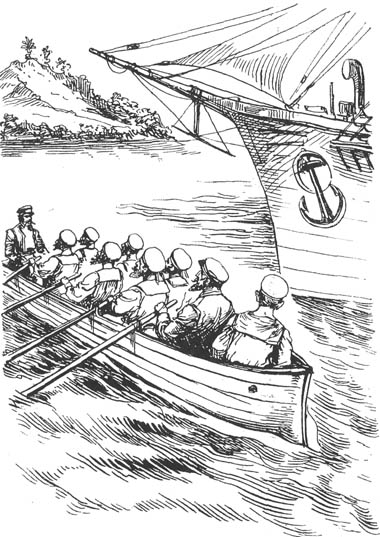
Mit einigen Ruderschlägen war das hilfsbedürftige Schiff erreicht, auf dem die Besatzung dicht nebeneinander gedrängt an dem Kupfergeländer stand. Eben legten sich dic Ruderer zum letzten Male in die Riemen, als ihnen plötzlich die Altstimme eines Mädchens einen lauten Befehl zurief. Sie sahen, wie der am Steuer sitzende Kapitän mit einem Male alle Gesichtsfarbe verlor, und als sie, teils infolge des drohenden Geheißes, teils aus Ueberraschung, die Riemen aus dem Wasser hoben und sich umwandten, verloren auch sie ihre Fassung und warteten entsetzt einen weiteren Befehl ab. So etwas war ihnen in ihrem bewegten Leben doch noch niemals begegnet.
Johanna hatte ausspioniert, daß wirklich auf die ›Undine‹ achtzehn vermummte Weiber gebracht wurden, welche unter Leitung eines nach europäischer Art gekleideten Türken in Sänften dicht an den Ankerplatz der Brigg getragen worden waren. Es war alles so glatt und ohne Aufsehen vor sich gegangen, daß niemand dabei etwas Unrechtes vermutet hatte.
Noch in derselben Nacht hatte die ›Vesta‹ die Anker gelichtet und war nach dem südlichen Eingang der Fahrstraße durch den Archipel gesegelt, um der Undine hier aufzulauern, und wieder war es Johanna gewesen, welche den Damen den Rat gegeben hatte, einige der Mädchenhändler auf das Schiff zu locken und sie zur Auslieferung der Geraubten zu zwingen.
Wurde dennoch Widerstand versucht, so war immer noch Zeit, weitere Gewaltmittel anzuwenden.
Ellen hatte den englischen Herren nicht mitgeteilt, was sie vorhatte, denn diese Gelegenheit war eine zu günstige, um einmal zu zeigen, welche Thatkraft amerikanische Damen entwickeln könnten, und außerdem war Ellen seit jenem Ueberfall in Konstantinopel wohl bereit, die Begleitung der Herren anzunehmen, aber nicht gewillt, sie von den Unternehmungen der ›Vesta‹ in Kenntnis zu setzen, außerdem verboten dies auch die Vorschriften der Vestalinnen.
Noch immer hatte Ellen den Vorsatz, dem ›Amor‹ einmal zu entschlüpfen und dann dreißig Tage lang sich nicht wieder von ihm blicken zu lassen, um den Triumph, in allen Sportzeitungen Englands und Amerikas die Niederlage der englischen Sportsleute gegenüber amerikanischen Damen zu lesen, genießen zu können. War dies erst erreicht, dann sollte der ›Amor‹ ihnen immer folgen dürfen. Es war bereits beschlossen worden, daß man bei Landpartien auch jetzt schon die Herren zur Teilnahme aufforderte. Das Abenteuer in Konstantinopel hatte gezeigt, wie gefährlich es für junge Mädchen ist, ohne männlichen Schutz in einer fremden Stadt zu sein. Wie sollte dies erst in unbekannten Wildnissen werden? An Bord der ›Vesta‹ dagegen fühlten sie sich vollkommen sicher und keiner Hilfe bedürftig.
Die Damen standen also an dem Geländer des Schiffes und sahen augenscheinlich freudig erregt der Ankunft der Boote entgegen. Nur zwei Mädchen lehnten an mit Leinwand bezogenen, etwa meterhohen Gegenständen, welche beide mitten auf dem Deck standen, der eine vorn, der andere hinten auf dem Schiff.
»Warum kommen nur so viele und gleich in zwei Booten?« flüsterte Ellen, welche vor Freude darüber erglühte, daß der Mädchenhändler in die Falle ging.
Neben ihr stand Johanna. Diese sah bei dieser Aeußerung überlegend vor sich hin, dann huschte ein Lächeln über ihre Züge.
»Auch ich habe mich anfangs darüber gewundert,« flüsterte sie zurück, »jetzt aber ist mir ihre Absicht klar. Ahnen Sie nichts, Miß Petersen?« – »Nein.«
»Der Mädchenhändler hat die ›Vesta‹ in Galata liegen sehen. Er weiß, daß sich hier Mädchen an Bord befinden, und will –«
»Ah, in der That,« unterbrach Ellen die scharfsinnige Johanna, »das ist die einzige Lösung. So wird sich also nun das Blättchen wenden. Doch aufgepaßt, meine Damen, denken Sie an die Anordnung!«
Jetzt legten sich die Matrosen unten in den Booten zum letzten Male in die Riemen, gleich mußten sie das Schiff erreicht haben.
»Hoch die Riemen, ihr Mädchenhändler! Wer noch einen Ruderschlag thut, hat eine Kugel im Arm,« rief da eine Stimme von der ›Vesta‹ herab, und als sich die Matrosen überrascht umblickten, sahen sie zwanzig Revolverläufe auf sich gerichtet.
Nie hatten die Männer ein Kommando schneller befolgt. Im Nu flogen die Riemen aus dem Wasser. Alle waren sprachlos über das Beginnen der Mädchen, denn solche konnten sie jetzt wirklich dort in jenen Matrosen erkennen.
»Niemand an Bord der ›Undine‹ rühre sich!« folgte unmittelbar darauf ein anderer Befehl. Miß Murray hatte ihn gerufen, welche hochaufgerichtet am Geländer stand und mit dem Revolver unbestimmt auf die drei Leute der Brigg zielte.
Zu gleicher Zeit sprang ein Mädchen an das Ruder und hielt mit fester Hand das Rad. Das Schiff hörte plötzlich auf zu schwanken, und ebenso schnell flogen die Hüllen von den beiden Gegenständen, ein Rollen ward hörbar, und über Bord blickten die Läufe zweier auf Rädern ruhender Revolverkanonen, gerade nach dem Deck der Undine zielend.
Revolverkanonen sind jene schnellfeuernden Geschütze, wie sie an Bord von Kriegsschiffen angewendet werden. Sie ruhen entweder auf feststehenden Lafetten oder, wie hier, auf Rädern. Die Engländer führen sie aber in Aegypten und Indien auf Kamelen mit sich. Die Revolverkanone ist nach allen Seiten hin beweglich und gestattet in der Minute die Abgabe von achtzig Schüssen mit Kugeln oder Granaten, welche aus einem Kasten beständig in den Lauf geführt werden. Das Feuern geschieht durch Drehen eines Rades.
Zwei solcher Geschütze bedrohten jetzt die ›Undine‹, während 20 Revolverläufe auf die erstarrte Bemannung der beiden Boote gerichtet waren.
»Träume ich denn oder wache ich?« sagte Demetri, nachdem er den ersten Schrecken überwunden hatte, und griff sich an die Stirn. »Himmel und Hölle!« schrie er dann. »Zum Teufel mit euch! Heraus mit den Waffen!«
Er riß die Pistole aus dem Gürtel, aber in demselben Moment fuhr ein Feuerstrahl aus dem Revolver Ellens. Eine Kugel zerschmetterte die feindliche Waffe, sodaß nur der Kolben in der Faust des Kapitäns zurückblieb.

»Die nächste sitzt in dem Arm!« rief dabei das Mädchen den entsetzten Männern zu, die nach diesem sicheren Schuß mit keiner Muskel mehr zu zucken wagten.
»Miß Nikkerson,« ertönte gleich darauf die Sopranstimme Jessys, »der Mann am Steuerruder sucht dieses unbemerkt zu drehen. Weg mit dem Rad!«
Ein krachender Donner erschütterte die Luft, ein Feuerstrom entquoll dem Laufe eines der Revolvergeschütze, und dem Matrosen auf der ›Undine‹ flogen die Trümmer des hölzernen Rades um den Kopf.
»Wo habt Ihr die achtzehn Mädchen an Bord versteckt?« fragte Ellen den mit finsteren Blicken dasitzenden Kapitän.
Er beantwortete die Frage nicht, sondern stierte das kühne Weib ingrimmig an.
»Antwort!«
Noch immer schwieg der Kapitän beharrlich, er sann hastig über einen Plan nach, aus dieser Lage herauszukommen, aber selbst ihm wollte diesmal nichts einfallen.
»Achtet auf Euer linkes Ohrläppchen!« klang es von oben; ein Schuß krachte, und aufheulend fuhr der Grieche mit der Hand nach dem linken Ohr, von dem das Blut herabrann!
»Wo sind die Mädchen, die Sklavinnen? Antwort, oder ich schieße Euch das eine Ohr völlig ab.«
»Im Zwischendeck!« knirschte der Kapitän mit vor Wut und Schmerz heiserer Stimme. »Holt sie euch und fahrt zum Teufel!«
Sofort wurde ein Boot über Bord gelassen, und sechs Damen nebst Ellen nahmen darin Platz, aber noch immer bedrohten vierzehn Revolverläufe die unten liegenden Matrosen.
Einige Ruderschläge brachten das Boot der Vestalinnen an die ›Undine‹ und zwar legten sie so an, daß sie an Bord klettern konnten, ohne in die Schußlinie zu kommen.
Unbehindert stiegen Ellen und vier der Mädchen an Bord; die zwei Matrosen und der Türke standen wie festgebannt an ihren Stellen, denn sie hatten gemerkt, daß diese kühnen Mädchen keinen Spaß verstanden und in der Handhabung der Schußwaffen Meister waren.
»Wo sind die Sklavinnen?« fragte Ellen den vor Schrecken zitternden Türken und spielte mit dem Revolver.
Stumm deutete er nach der Luke, welche zur Kapitänskajüte führte.
»Zwei Damen kommen mit mir, die beiden anderen beobachten diese Leute!« ordnete Ellen an. Sie schritt der Luke zu und stieg die schmale Treppe hinab, gefolgt von den beiden Gefährtinnen.

Kaum hatte sie unten den Boden erreicht und blickte sich in dem herrschenden Zwielicht um, so sah sie von einer in einer dunklen Ecke kauernden Gruppe von Weibern ein in türkische Gewänder gehülltes Mädchen sich absondern und sich zu ihren Füßen stürzen.
»Ich wußte es, als ich die Schüsse hörte,« rief es auf französisch unter Thränen und küßte wieder und wieder Ellens Hand. »Ihr seid Engländer und wollt uns befreien!«
»Wir sind gar keine Engländer,« entgegnete Ellen gütig lächelnd und hob die Weinende auf, »aber frei sollt ihr doch sein und noch mehr, wir bringen euch, wohin ihr wollt. Bist du Sulima?«
Erstaunt blickte das Mädchen auf.
»Woher kennen Sie meinen Namen?«
Jetzt sah sie zum ersten Male voll in das Gesicht der vor ihr Stehenden.
»Allah!« rief sie. »Sie sind kein Mann und,« sie betrachtete die beiden anderen Vestalinnen, »auch diese da nicht!«
»Nein, wir sind jene Damen, welchen du in Konstantinopel das Billet zugeworfen hast. Doch komm jetzt!« fuhr sie fort und wehrte dem Mädchen, welches von neuem mit Ausrufen des Entzückens zu Boden sank und die Kniee ihrer Retterin umschlang. »Wie viele seid ihr?«
»Achtzehn, noch alles junge Mädchen, fast Kinder, die verkauft werden sollen,« war die Antwort.
»Habt ihr Sachen mit?«
»Nichts, als was wir auf dem Körper tragen; erst kurz vor dem Markte sollten wir geschmückt werden.«
»So folge du mir zuerst mit fünf anderen Mädchen. In drei Fahrten schaffen wir euch alle auf unser Schiff, wo ihr in Sicherheit seid.«
Auf ihren Wink kamen noch fünf andere Sklavinnen mit an Deck und stiegen ins Boot.
Der Türke knirschte vor Wut mit den Zähnen, als die befreiten Mädchen an ihm vorbeigeführt wurden, und der griechische Kapitän fuhr, als das Boot der ›Vesta‹ zum ersten Male an dem seinen vorbeikam, mit der Hand nach der im Gürtel steckenden Pistole; doch während der Bewegung hörte er das mahnende Zischen eines Matrosen, und schnell griff er, anstatt nach der Pistole, nach seinem Ohr, von welchem noch immer das Blut sickerte.
»Der ›Amor‹ ist in Sicht,« wurde Ellen an Bord gemeldet, und wirklich tauchten eben hinter dem letzten Inselchen des griechischen Archipels die Masten der Brigg auf. Eine Rauchwolke schwebte über dem Schiffe, also kam es angedampft und mußte bald den Schauplatz erreicht haben.
»Desto besser,« meinte Ellen, »so können die englischen Herren doch sehen, wie gut wir die frühe Morgenstunde ausgenutzt haben, und unsere That bewundern. Doch jetzt schnell wieder auf die ›Undine‹ zurück, die übrigen Mädchen zu befreien.«
Als das Boot zum dritten Male mit den letzten der Sklavinnen die ›Vesta‹ erreichte, war die Brigg dicht in der Nähe, fast zwischen der ›Vesta‹ und der Bark.
»Guten Morgen, meine Damen,« lachte der lustige Charles zuerst hinüber. »Sie nehmen wohl Passagiere an Bord? Oder rauben Sie ein Schiff aus?«
»Das erstere ist wohl das richtige,« gab Miß Jessy zurück, »wir passen den Sklavenhändlern scharf auf die Finger und nehmen ihnen unerbittlich ihre Ware weg. Mit solchen Geschäften lassen Sie sich also nicht ein, wir würden auch Sie nicht schonen.«
Mit Genugthuung und Stolz nahmen die Vestalinnen die Lobpreisungen und Schmeicheleien der Herren dankbar lächelnd an.
»Alle Wetter!« flüsterte Edgar Hendricks seinem Freunde ins Ohr. »Sehen Sie nur diese Prachtmädels da, die Sklavinnen. Schade, daß wir sie dem Händler nicht abnehmen konnten.«
»Wahrhaftig,« entgegnete Williams, »es ist jammerschade! Alle Schattierungen sind vertreten, vom Schneeweiß bis zum tiefsten Schwarz. Sehen Sie da die große Negerin, ihre Augen funkeln, wie die eines Raubtieres. Die möchte ich nicht anfassen; ich glaube, die beißt in die Finger.«
Und laut rief er nach der ›Vesta‹ hinüber, auf welcher die Damen die Sklavinnen auszufragen schienen:
»Wenn Sie nicht genügend Platz drüben haben, so geben Sie uns nur einige ab. Ich schwöre Ihnen hoch und heilig, Miß Petersen, daß es die Mädchen hier gut haben sollen.«
»Unsinn,« brummte Lord Hastings, der sich bisher mit der Besatzung der beiden Boote beschäftigt hatte, welche noch immer dicht zur Seite der ›Vesta‹ lagen.
»Unsinn, weiter fehlte nichts. Wir wollen hier keinen Damensalon einrichten.«
»Seien Sie nicht ängstlich,« sagte Ellen, deren scharfe Ohren das Gebrumm verstanden hatten, »die ›Vesta‹ giebt keinen ihrer Schützlinge heraus.«
Dann wandte sie sich an den griechischen Kapitän, dem Williams eben die Vorzüge des englischen Heftpflasters anpries, weil es besonders zerschossene Ohrläppchen riesig schnell heile.
»Fahren Sie an Bord zurück,« sagte sie, »und versuchen Sie nicht, irgend etwas zur Wiedererlangung der Mädchen zu unternehmen. Sie haben jetzt gesehen, daß wir Ihnen überlegen sind und nicht mit uns spaßen lassen.«
Unverzüglich begab sich die Besatzung auf die ›Undine‹ zurück, wo die Matrosen eine Vorrichtung zimmerten, welche das zerschossene Steuerrad ersetzen mußte, während der Kapitän finster brütend in der Kajüte saß und stillschweigend die Schmähreden des Türken über sich ergehen ließ.
Sein einziger Gedanke war Rache, furchtbare Rache an diesen Weibern, welche ihn, den schlauen Seemann, so überlistet, gedemütigt und gezüchtigt hatten.
Unterdessen fand draußen eine Unterredung zwischen Lord Harrlington und Miß Petersen statt.
»Warum haben Sie uns nicht von Ihrem gefährlichen Unternehmen benachrichtigt?« fragte Harrlington in vorwurfsvollem Tone die Kapitänin. »Wie leicht hätte es unglücklich für Sie ablaufen können; Sie hätten uns wenigstens auffordern sollen, in Ihrer Nähe zu bleiben.«
Der Lord mußte aber doch etwas von der Absicht der Vestalinnen gehört haben, denn in der Nacht bereits war auf seinen Befehl der ›Amor‹ segelfertig gemacht worden und der ›Vesta‹ gefolgt und lag seit dem frühesten Morgen immer unter Dampf hinter jener Insel versteckt. Von der äußersten Spitze des Eilandes hatte Harrlington mit seinem ausgezeichneten Fernrohr die beiden Schiffe beobachtet, aber alle Fragen der Herren ausweichend beantwortet und sie auf später vertröstet.
»Lord Harrlington,« entgegnete Ellen, »an Bord der ›Vesta‹ droht uns keine Gefahr. Wir fühlen uns auf ihr so sicher, als wären wir in einem Ballsaal in New-York und nicht auf dem Meere.«
»Aber erinnern Sie sich doch Ihres Versprechens! Sie wollten nach der Befreiung aus den Händen der Straßenräuber unsere Begleitung annehmen.«
»Wohl haben wir nichts dagegen, wenn uns der ›Amor‹ folgt,« entgegnete das Mädchen, »aber dazu auffordern werden wir ihn niemals. Dagegen bleibt die Verabredung betreffs der Landausflüge bestehen.«
»Hurrah,« schrie Charles, »Miß Nikkerson, ich stelle Ihnen meinen Regenschirm zur Verfügung.«
»Sie werden bald Gelegenheit finden, uns Ritterdienste zu leisten,« fuhr Ellen fort, »denn wir haben die Absicht, jedes einzelne der Mädchen persönlich in seine Heimat zu begleiten, und sie stammen aus aller Herren Länder. Wir vernehmen die befreiten Sklavinnen jetzt, und deshalb, Lord, muß ich das Gespräch abbrechen.«
»Wollen Sie mir nicht den Namen des nächsten Hafens mitteilen?« bat Harrlington.
»Nein, dies würde gegen unsere Gesetze verstoßen. Suchen Sie uns nicht zu verlieren, das ist alles, was ich Ihnen raten kann. Ueberdies wissen wir selbst noch nicht, welches unser nächstes Ziel sein wird.«
Sie ging wieder zu der Gruppe der Mädchen und sah nicht, wie Lord Harrlington ihr lächelnd nachblickte.
Vorläufig lagen die beiden befreundeten Schiffe noch Seite an Seite still, während die Matrosen der ›Undine‹ eigenmächtig Segel setzten, denn weder der Kapitän, noch der Türke ließen sich an Deck sehen.
Die Engländer aber traten zusammen und tauschten Bemerkungen über die Sklavinnen ans. Leider konnten sie, so sehr sie sich auch anstrengten, von der Unterhaltung zwischen diesen und den Vestalinnen nichts vernehmen.
»Zwei von ihnen sind offenbar Negerinnen,« erklärte Lord Stevenson, der ebenso wie Harrlington schon viel gereist war, »zwei andere wahrscheinlich Araberinnen, die dort mit dem roten Jäckchen ist eine Indierin. Einige der Mädchen haben Gesichtszüge, wie man sie unter der Bevölkerung an der Westküste Asiens trifft. Aber diese da mit den gelben Gesichtern und runden Augen kann ich nicht klassifizieren. Harrlington, Sie Weltumsegler, wissen Sie nicht, wo deren Wiege gestanden haben mag?«
»In einer kultivierten Gegend jedenfalls nicht,« warf Edgar Hendricks dazwischen.
»Warum nicht,« antwortete aber Harrlington lächelnd. »Allem Anscheine nach sind es südamerikanische Kreolinnen oder Abkömmlinge von Indianern und Weißen.«
»Chaushilm,« sagte Charles zu dem jungen Herzog, der als großer Frauenverehrer bekannt war, »Sie lieben ja Damen mit üppigem, schwarzen Haar, daher empfehle ich Ihnen, sich um die Gunst jenes Mädchens dort zu bewerben. Haare hat sie wenigstens für drei auf dem Kopfe, und ihre Lippen sind wie zum Küssen geschaffen.«
Er deutete dabei auf eine Gestalt mit aufgebauschtem Haarwulst und aufgeworfenen Lippen.
»Wahrscheinlich eine Südseeinsulanerin,« meinte Harrlington. »Doch still! Miß Petersen will etwas fragen!«
Die Vestalinnen hatten sich inzwischen nach den Schicksalen ihrer Schützlinge erkundigt. Es war ihnen dies nicht so schwer geworden, als man bei der Verschiedenheit der Nationalitäten hätte vermuten sollen; die in Asien geborenen verstanden fast alle arabisch, und bei diesen diente die französisch sprechende Sulima als Dolmetscherin, die übrigen aber hatten während ihrer Gefangenschaft so viel Türkisch gelernt, um sich verständigen zu können, und so ging die Aufklärung ohne Schwierigkeit vor sich.
Nur Sulima selbst hatte ihr Schicksal noch nicht erzählt, ebenso nicht jene Negerin, deren wildes Aussehen dem lustigen Charles Gelegenheit zu dem Witze gegeben.
Sie war eine hohe, schlanke Gestalt, mit einem mehr knabenhaften Gesicht, das nicht hübsch zu nennen war, aber neben Kühnheit und Stolz eine nicht zu bändigende Wildheit verriet. Die pechschwarzen Augen, welche unstät von einem der Mädchen zum anderen wanderten, schienen wirklich den Blick eines Panthers annehmen zu können, ein solcher Blitz schoß ab und zu aus ihnen, obgleich das Mädchen sich möglichst bemühte, den Vestalinnen, welche sich auch nicht durch Sulima mit ihr verständigen konnten, freundlich entgegenzukommen.
Das lose Gewand hatte die Negerin so um ihren Körper geschlungen, daß die Arme freiblieben, und seltsam war es, was für Muskeln diese zeigten. Jeder Nerv, jede Ader trat an ihnen wie aus Marmor gemeißelt hervor, und dennoch zeugten die schlanken, wohlgepflegten Hände von keiner schweren Arbeit. Desgleichen verriet jede Bewegung des Körpers, was für eine katzenartige Gewandtheit ihm innewohnte.
Die Damen versuchten vergeblich in allerlei Sprachen, mit dieser Negerin eine Unterredung zu ermöglichen.

»Es ist nicht möglich,« sagte Sulima. »Während der sechs Monate, welche wir zusammen in Konstantinopel gefangen waren, hat sie sich nie mit uns unterhalten und gab überhaupt nie einen Laut von sich.«
»Wie war ihr Benehmen im übrigen?« fragte Ellen.
»Sie verhielt sich finster, zurückhaltend und stolz, besonders den Wärtern gegenüber, welche uns das Essen brachten und uns sonst bedienten. Näherte sich ihr einer der Leute, so schaute sie ihn mit so unbeschreiblich wilden Blicken an, daß er scheu zurückwich. Ich sah einmal zufällig, wie sie aus ihren dichten Haarflechten einen kleinen Dolch hervorzog und ihn aufmerksam betrachtete. Als sie bemerkte, daß ich ihr Geheimnis erkundet hatte, rief sie mir in ihrer fremden, sonderbaren Sprache einige drohende Worte zu; aber sie wußte, daß sie von mir am allerwenigsten Verrat zu fürchten brauchte; ich ging ja selbst mit verwegenen Fluchtplänen um, besprach mich darüber mit meinen Leidensgenossinnen und machte auch ihr meine Absichten begreiflich.«
Wieder war es Johanna Lind, welche in dieser schwierigen Lage einen Ausweg wußte.
»Ich habe gehört,« sagte sie, »Lord Harrlington soll einen alten Diener bei sich haben, einen Neger, der, wie so viele Schwarze, ausgedehnte Sprachkenntnisse besitzt, und den er darum mit auf diese Reise genommen hat. Es ist leicht möglich, daß derselbe dieses Mädchen versteht.«
»Ich werde den Lord fragen,« entgegnete Ellen und näherte sich der Bordwand des ›Amor‹, welcher vom Wind dicht an das Vollschiff getrieben wurden war.
»Lord Harrlington, Sie haben einen Neger als Diener mit, welcher sehr viele Dialekte spricht, auch afrikanische?« »Ja, Miß, meinen Hannibal.«
»Wir können eines der Mädchen nicht verstehen, vielleicht kann Hannibal uns als Dolmetscher dienen.«
»Sofort werde ich ihn rufen,« erklärte Harrlington bereitwilligst, »das heißt,« fuhr er lächelnd fort, »er wird wohl keine Zeit haben.«
Er ging nach der Luke, in die er mehrmals den Namen des Dieners hinabrief.
»Was soll das heißen, daß ein Neger keine Zeit hat?« fragte Ellen erstaunt die anderen Herren.
»Hannibal hat nie Zeit,« beteuerte Charles ernsthaft, »der arme Bursche ist immer mit Arbeit überhäuft. Doch Sie werden gleich selbst hören.«
»Hannibal, Hannibal, komm' herauf!« rief Harrlington hinab.
»Ich habe keine Zeit!« klang es nach einer Weile in ärgerlichem Tone zurück.
»Komm einmal herauf, Damen möchten dich sprechen.«
»Zum Kuckuck mit den Damen, Hannibal hat keine Zeit, Hannibal ordnet die Bibliothek!« klang es wieder von unten zurück.
»Wie? Der Neger ordnet die Bibliothek?« riefen die Damen zweifelnd.
»Es ist so,« versicherte Charles, »sein Herr hat ihm aufgetragen, die verkehrt stehenden Bücher umzukehren. Nun kann Hannibal zwar weder lesen, noch schreiben, aber er weiß doch, ob die Buchstaben auf dem Kopfe stehen oder nicht.«
»Aber Hannibal, du wirst notwendig gebraucht,« lockte Harrlington wieder und betonte dabei das Wort ›notwendig‹. Im Nu erschien ein mächtiger, pfeffergrauer, wolliger Kopf über der Luke, dem gleich darauf die Gestalt eines alten Negers mit verwitterten und runzeligen Gesichtszügen folgte.
Hannibal hatte ein bewegtes, abenteuerliches Leben hinter sich, über dessen erstem Teil ein geheimnisvolles Dunkel lag. Man sprach davon, daß er in seiner Jugend an der Westküste Afrikas einen Schmuggelhandel mit Spirituosen betrieben habe, bis er einmal erwischt und sehr hart bestraft wurde, wahrscheinlich mit Peitschenhieben, denn noch jetzt wies sein Rücken tiefe Narben auf; doch war dies nur eine Vermutung. Dann hatte Hannibal, welchen Namen er aber erst vom jetzigen Herrn bekommen, sich in der ganzen Welt herumgetrieben und zwar meist in Gesellschaft von Artisten, bei denen er als Clown fungierte. Später produzierte er sich in größeren Hafenstädten als Bauchredner, und als solcher traf ihn Harrlington einst in einem Hafen Südamerikas.
Der Lord brauchte damals gerade einen Diener, und er fand an dem etwa fünfzigjährigen Neger, dessen ungeheueres Sprachentalent er bald entdeckte, ein solches Wohlgefallen, daß er ihn aufforderte, ihn zu begleiten. Der Schwarze war gerade in einer schlechten Lage, das Bauchreden wollte ihn nicht recht ernähren, und so nahm er ohne Besinnen das neue Engagement an. Das war vor fünf Jahren gewesen.
Herr und Diener hatten sich seitdem so aneinander gewöhnt, daß sie, wenigstens für längere Zeit, unzertrennbar schienen, obgleich sie eigentlich in einem sehr sonderbaren Verhältnisse standen.
Viele Neger besitzen ein beispielloses Talent zum Erlernen von Sprachen, sodaß sie sich bald vollkommen in derselben unterhalten können. Jeder Satz, den sie hören, haftet in ihrem Gedächtnis, und ein einmal gesprochenes Wort vergessen sie nie wieder, sie wissen mit nur wenigen Vokabeln so geschickt umzugehen, daß sie alles ausdrücken können.
Dieses Talent besaß auch Hannibal. Außerdem konnte er jede einmal gehörte Tierstimme, jeden Menschenlaut oder jedes vernommene Geräusch auf das täuschendste nachahmen, wie er ja auch Bauchredner war.
Lord Harrlington beschäftigte sich viel mit dem Studium fremder Völker, und hierbei leistete Hannibal ihm unschätzbare Dienste. Er brauchte nur einen Fuß, einen Finger, eine Fährte zu sehen, so konnte er sofort sagen, zu welcher Rasse der Eigentümer gehörte, wie alt er oder ob er Mann oder Weib sei.
Hannibal hatte bald bemerkt, wie viel der Lord und dessen Freunde auf seine Eigenschaften hielten, und er gefiel sich nach und nach darin, den Gelehrten zu spielen. Obgleich er nicht lesen und schreiben konnte, saß er oft stundenlang vor einem offenen Buche, eine Brille auf der Nase, und that, als ob er lese.
Da sein Herr ihm alles nachsah, ihn überhaupt eigentlich nur zur Unterhaltung und zum Zeitvertreib hielt, so glaubte sich Hannibal dazu berechtigt, sich jede Störung in seinem Studium, wie er sagte, zu verbitten. Wurde er gerufen, so antwortete er einfach, er habe keine Zeit, und ließ sich durchaus nicht stören, selbst nicht von Lord Harrlington, welcher daran seinen Spaß fand. Im übrigen wäre Hannibal für seinen Herrn durchs Feuer gegangen. Nur der Aufforderung, daß er ›notwendig‹ gebraucht werde, leistete er Folge, denn er versäumte nie eine Gelegenheit, bei der er seine Kenntnisse zeigen konnte, auf die er sehr stolz war.
So kam er denn auch jetzt die steile Treppe eiligst heraufgestiegen und freute sich ungemein, als er erfuhr, daß alle Damen und Herren sich vergeblich abmühten, eine Negerin verstehen zu können.
Ellen winkte der Schwarzen, an die Bordwand des Schiffes zu kommen, doch kaum standen jene und Hannibal sich gegenüber, so geschah etwas Seltsames.
Hannibals Züge nahmen mit einem Male einen erst erschrockenen, dann freudigen Ausdruck an. Mit weit ausgebreiteten Armen stürzte er nach der Bordwand, welche ihn von der Schwarzen trennte, fiel auf die Kniee und stammelte unzusammenhängende Worte, die niemand der Zuhörer verstand. Sie wurden in ebensolchen Gurgellauten gesprochen, wie man sie vorhin von dem Mädchen gehört hatte.
Dieses selbst blickte den Knieenden erst mit unverkennbaren Zeichen des Erstaunens an, ward aber dann aufmerksamer, wies bei dem Namen ›Yamyhla‹ mit dem Finger stolz auf die Brust, darauf antwortete sie, was Hannibal mit Entzücken zu erfüllen schien.
Kaum aber war ihm das Wort ›Kebabo‹ entschlüpft, das er mit sichtlichem Zögern aussprach, so entstellte plötzlich ein Ausdruck grimmer Wut die Züge der Negerin; sie duckte sich zusammen, und ehe jemand ahnte, was sie vorhatte, schnellte sie mit einem Satze über die Bordwand und stand vor dem Knieenden. Ein Griff in ihr dichtes Haar, und sie hielt einen kleinen Dolch hoch in der Hand, um ihn Hannibal in das Herz zu stoßen.

Lord Harrlington war der einzige, der so viel Fassung bewahrte, hinzuzuspringen, um einen Mord an seinem Diener zu verhindern. Aber wunderbarerweise stieß ihn dieser selbst zurück, riß sein Hemd auf und erwartete, ohne mit den Wimpern zu zucken, den tödlichen Stoß. Nur einige kurze Worte sagte er.
Da ließ die Negerin die erhobene Waffe sinken, und wieder entspann sich zwischen beiden ein aufregendes Gespräch, in dem fortwährend die Namen Yamyhla, Kebabo, Bahadung, Gheso, Abeokuta und andere mehr vorkamen.
»Was war das?« fragte Ellen erstaunt. »Wie ist mir denn, habe ich den Namen Yamyhla nicht schon irgend einmal gelesen oder gehört?«
»Allerdings,« entgegnete Miß Nikkerson, »an einem Abend wurde in unserem Klub die Geschichte vorgelesen, wie vor Jahren die 5000 Amazonen von Dahomeh im Kampfe fast völlig vernichtet wurden. Die Anführerin derselben hieß Yamyhla.«
»Ja, und wir jubelten damals noch über die Bravour, mit welcher sich die Mädchen gegen den zehnfach stärkeren Feind geschlagen hatten,« sagte eine andere.
»Nun weiß ich auch, was alle diese Namen bedeuten,« meinte eine dritte.
»Bahadung war der König von Dahomeh, welcher sich immer eine Leibgarde von 5000 in den Waffen geübten Mädchen hielt. Gheso war sein Vater, und bei der Stadt Abeokuta haben die Amazonen gekämpft.«
»Sollte jene Yamyhla deren Führerin gewesen sein?« fragte Ellen.
»Das ist nicht möglich, höchstens ist sie die Tochter oder Enkelin derselben,« antwortete eine Vestalin, »jetzt aber kann ich mir wenigstens erklären, woher dieses Mädchen eine solche Kraft und Gewandtheit besitzt. Ohne Zweifel ist sie eine jener Kriegerinnen, welche sich unausgesetzt in Kampfspielen üben.«
»Dann wäre sie würdig für die ›Vesta‹« riefen fast alle Mädchen. »O, wenn wir sie für uns gewinnen könnten, diese Amazone!«
»Wir wollen sehen, was sich thun läßt,« entgegnete Ellen, »Hannibal scheint sie genauer zu kennen. Jetzt kommt sie auf unser Schiff zurück; wir werden gleich alles von dem Dolmetscher erfahren.«
Die beiden hatten sich unterdes lebhaft unterhalten, das Weib zeigte wiederholt nach der Sonne, erzählte dem Neger etwas unter Gestikulationen und legte zum Schluß bedeutungsvoll den Finger auf den Mund. Hannibal, auf dessen Gesicht sich während dieser Rede bald Freude, bald Entsetzen abgespiegelt hatte, rutschte jetzt auf den Knieen zu der Negerin, küßte den Saum ihres Gewandes und that, als ob er vor Entzücken außer sich wäre.
Darauf schritt das Mädchen wieder an die Bordwand und schwang sich mit einer Leichtigkeit und Grazie über dieselbe, um die sie jeder Cirkuskünstler beneidet hätte. Stumm schritt sie an den Damen vorüber und gesellte sich zu der Gruppe der Mädchen.
»Nun, sage uns, was sie dir erzählt hat,« verlangte Ellen von Hannibal. Doch dieser schüttelte mit dem Kopfe.
»Ich darf nichts verraten,« entgegnete er; sein früheres Selbstbewußtsein hatte er mit einem Male ganz verloren. »Meine Zunge ist mit tausend Eiden gebunden.«
»Wie? So sollen wir nicht erfahren, wen wir befreit haben?«
»Doch, das dürfen Sie, Miß. Es ist die Enkelin jener Yamyhla, welche im heldenmütigen Kampfe gegen die Neger von Weidah fiel.«
»Sagte ich es nicht?« rief Miß Nikkerson. »Sie ist eine Amazone von Dahomeh.«
»Wie kommt sie in die Sklaverei? Hat sie dir dies gesagt?« fragte Ellen weiter.
»Das ist es eben, was ich nicht verraten darf. Dagegen hat Yamyhla eine Bitte an Sie, die Kapitänin des Damenschiffes. Sie darf erst nach 21 Monaten in ihre Heimat zurückkehren, um dort ihr Recht zu suchen, und fragt, ob sie während dieser Zeit auf der ›Vesta‹ verweilen kann. Ich habe ihr erklärt, daß sie dann arbeiten müsse, und Yamyhla hat sich bereit erklärt, gern die niedrigsten Dienste zu verrichten, wenn sie nur bei ihresgleichen sein kann. Yamyhla stammt aus einem der vornehmsten Geschlechter Dahomehs.«
Ellen blickte sich im Kreise ihrer Gefährtinnen um; überall begegnete sie freudigen Gesichtern.
»Natürlich,« stimmten die Vestalinnen bei, »Yamyhla ist eine der Unsrigen!«
»Du hörst es, Hannibal,« redete Ellen diesen wieder an. »Teile es Yamyhla mit und sage ihr auch, daß wir sie nach Ablauf der gesetzten Frist selbst in ihre Heimat bringen werden, und, hat sie wirklich Ansprüche zu machen, so werden wir sie dabei mit aller unserer Kraft unterstützen. Auch die Herren des ›Amor‹ werden sich nicht davon ausschließen. Nicht wahr, Lord Harrlington?«
»Wohin Sie gehen, dahin folgen wir Ihnen,« versicherte dieser abermals.
»Ach, hat es so eine Negerin gut,« seufzte Charles in komischer Verzweiflung. »Warum bin ich keine Dahomeh geworden!«
Ellen winkte dem Mädchen und ließ ihm den Entschluß durch Hannibal übersetzen. Yamyhla zeigte außerordentliche Freude darüber und drückte durch allerhand Gebärden ihre grenzenlose Dankbarkeit aus. Von den übrigen Vestalinnen wurde sie mit Herzlichkeit als Genossin begrüßt.
Da über ihrem Schicksal ein Geheimnis zu ruhen schien, so wurde ausgemacht, sie nicht über dasselbe zu befragen, bis sie es selbst mitteilte. Yamyhla sollte dieselbe Arbeit verrichten und dieselben Rechte besitzen, wie jede andere Vestalin; doch sollte man sich möglichst viel mit ihr abgeben, um ihr bald einige Begriffe der englischen Sprache beizubringen.
Es ward von den Damen beschlossen, jeden ihrer Schützlinge persönlich in seine Heimat oder an einen gewünschten Ort zu bringen, und man konnte dabei auf Schwierigkeiten und Gefahren rechnen, denn nicht alle die Mädchen waren einfach durch Raub in die Sklaverei geraten, einige vielmehr durch allerlei Ränke und Ungerechtigkeiten, und diese zunichte zu machen und zu bestrafen, hatten sich die kühnen Amerikanerinnen zur Aufgabe gestellt.
Nur noch Sulima war zu vernehmen, welche bisher unermüdlich dabei gewesen war, die Verständigung zwischen Rettern und Befreiten zu erleichtern. Jetzt versammelten sich die Damen, wieder außer Hörweite der Engländer, und Sulima begann:
»Wie ich schon vor zwei Tagen in Konstantinopel auf dem Billet mitteilte, welches glücklicherweise in die Hände solch edler Damen fiel – Allah sei Dank dafür – bin ich die Tochter von Mustapha-ibn-Hammed, des Scheichs eines Stammes der Beni-Suef. Unsere Herden weiden friedlich in den Oasen, welche zwischen Fajum und dem Thale der Natronseen liegen; die Männer jagen die flüchtige Antilope der Wüste, und die Frauen pflegen sie, wenn sie, erschöpft vom scharfen Ritte, auf schaumbedeckten Pferden heimkehren, vor sich im Sattel die erlegte Beute, neben sich die kläffenden Hunde. Kein anderer Stamm wagt es so leicht, den Beni-Suef feindlich entgegenzutreten, denn die Lanzen meiner Stammesbrüder fehlen ihre Gegner nie, und ihre Schwerter gleichen zuckenden Blitzen, wenn sie durch die Luft sausen.
»Doch, was vermögen alle Tapferkeit und Kriegskunst gegen heimtückische List? Vor einem Jahre sollte ich mit Salim vermählt werden. Der Tag der Hochzeit kam heran –«
»Wer ist Salim?« unterbrach Ellen die Erzählerin.
»O, Salim!« rief diese enthusiastisch aus und richtete sich stolz auf, »er ist der Löwe der Wüste, der Adler der Gebirge. Kein Feind kann seinen Blick vertragen, und sein Freund erwärmt sich an dem Sonnenstrahl, der aus seinen Augen leuchtet.«
»War er schon lange dein Verlobter?«
»Ja. Doch muß ich Ihnen erst sein Schicksal mitteilen. Salim ist kein Araber von Geburt, sondern ein Mischling, ist aber ein Beduine geworden und übertrifft den besten unter diesen an Tapferkeit und Tugenden, wie an Schönheit.«
»Sein Vater zählte zu dem Stamme der Aduan, welcher nur aus hundert Familien besteht, und deren schlechtestes Mitglied noch ein Held genannt werden muß.«
»Ist der Stamm Aduan nicht jener,« fragte Thomson, welche des Türkischen mächtig und in der orientalischen Geschichte bewandert war, »bei dem die regierenden Scheichs von Mekka ihre Söhne erziehen lassen?«
»Es ist dieser Stamm, der tugendhafteste in Arabien; zu diesem gehörte Ali-ben-Taleb, der Vater Salims. Die Aduan plünderten einst eine fränkische Karawane –«
»Wie?« unterbrach sie abermals eine Vestalin, »die Tugendhelden plünderten eine Karawane?«

»Nein,« erwiderte Sulima stolz, »wenigstens nicht so, wie Sie es verstehen mögen. Kein Beduine überfällt eine Karawane und beraubt sie, aber jeder Beduinen-Scheich fordert von den durch sein Gebiet ziehenden Kaufleuten eine kleine Summe, wofür er sie sicher bis an die Grenzen seines Reiches bringt und sie mit seinem Leben gegen jede Mißbill schützt, sowie er jede Ungerechtigkeit seiner eigenen Leute empfindlich bestraft. Giebt man ihm den verlangten Tribut nicht freiwillig, so verweigert er der Karawane den Durchzug, und spottet man seines Verbots, so nimmt er sich den Tribut eigenmächtig. Stößt er aber dabei auf Widerstand, dann erst plündert er die fremden Eindringlinge und bestraft sie wegen ihres Ungehorsams, das heißt, er nimmt ihnen die Waren und Weiber weg. Ist dies recht oder nicht?«
»Dieser Brauch mag eine alte Sitte sein,« entgegnete Ellen auf die Frage der Araberin, »und ich kann ihn nicht ungerecht nennen. Doch unterbrecht jetzt unsere Erzählerin nicht mehr.«
»Ali-ben-Taleb,« fuhr Sulima fort, »erbeutete einst ein junges Mädchen, eine Fränkin, und als das Lösegeld für die Gefangene gezahlt werden sollte, ereignete sich etwas Sonderbares, was wohl selten unter den Beduinen vorkommt. Karo-hissar, diesen arabischen Namen hatte sich das Mädchen selbst gegeben, was etwa so viel heißt wie die ›schwarze Burg‹, verweigerte selbst, ausgeliefert zu werden, und bat, sie in den Stamm der Aduan aufzunehmen.
»Den übrigen blieb die Ursache dazu nicht lange ein Geheimnis, denn bald darauf nahm Ali-ben-Taleb die Fränkin zum Weibe, trotz aller Mißbilligungen seiner Genossen und des Scheichs. Er ging nach Mekka, und hier gelang es ihm, dem tapfersten Aduan, doch, seine Absicht durchzusetzen, aber mit der Bedingung, daß seine Kinder nicht zu dem Stamme selbst gezählt würden, und daß sein Weib, die Fränkin, nach seinem Tode den Stamm nebst ihren Kindern verlassen müsse. Die Aduan wollten ihr edles Blut unvermischt erhalten.
»Karo-Hissar ward vollkommen Araberin, nahm alle unsere Gewohnheiten an, sie wechselte sogar um ihres Mannes willen, den sie glühend liebte, die Religion, das heißt, sie ward Muhamedanerin.
»Allah segnete diesen Entschluß; nach einein Jahre schenkte sie ihrem Gemahl einen Knaben, der den Namen Salim empfing, das schönste Kind, welches je die Sonne küßte.
»Aber nicht lange sollte ihr Glück dauern; bereits nach fünfjähriger Ehe starb Ali-ben-Taleb an einer ansteckenden Krankheit, und Karo-Hissar mußte das Lager der Aduan, das ihr so lange eine sichere Heimat gewesen, mit blutendem Herzen verlassen; das Kind nahm Sie natürlich mit.
»Ich weiß nicht, und niemand hat es je erfahren, warum sie sich nicht dem fränkischen Lande zuwandte, aus welchem sie stammte. Nie sprach sie von ihren Eltern, von ihren Geschwistern, und wurde sie darüber gefragt, so füllten sich ihre Augen mit Thränen, aber nie sprach sie von ihnen. Sie hatte gewiß einen Grund, darüber zu schweigen.
»Ach, sie war die schönste Frau, welche ich je gesehen. Ihre Wangen glichen denen der Gazelle, ihr Haar wetteiferte an Schwärze und Glanz mit dem Ebenholze. Lachte sie, so waren wir alle fröhlich, und weinte sie, so herrschte Traurigkeit in unseren Zelten.
»Karo-Hissar ging nach Mekka und flehte den Scheich um die Gnade an, bei den Aduan bleiben zu dürfen, wo sie Freunde besaß, aber der Herrscher der Beduinen schlug es ihr mit den Worten ab: Einmal habe er im Stamme der edelsten Araber fremdes Blut geduldet, die Zeit sei abgelaufen, nie wieder würde er etwas Derartiges erlauben.
»Man sagte, ein Großer seines Hofes habe seine Augen auf die schöne Karo-Hissar geworfen und sie zu besitzen begehrt, und als sie seine Anträge abgeschlagen, habe er sich des Knaben bemächtigen wollen, um somit auch die Mutter zum Bleiben zu zwingen. Doch sind dies nur Gerüchte.
»Sicher aber ist, daß die junge Frau, deren einziger Reichtum in Salim bestand, Mekka heimlich verlassen hat und mit einer Karawane nach Egypten kam, wo sie sich einige Zeit lang in Masr aufhielt.«
»Was ist das – Masr?« fragte Ellen.
»Masr ist das arabische Wort für Kairo,« belehrte sie Miß Thomson, »die Eingeborenen Egyptens bezeichnen ihre Hauptstadt nur mit diesem Namen.«
»So ist es,« bestätigte Sulima. »Hier machte Karo-hissar die Bekanntschaft einiger Beni-Suefs, welche die von uns Mädchen gewebten Teppiche verkaufen wollten.
»Sie zog mit Salim in die Wüste, bat meinen Vater um die Erlaubnis, bei seinem Stamme verweilen zu dürfen, und mein edler Vater, gerührt durch das Schicksal der Ausgestoßenen, gewährte ihr die Bitte.
»Sie wurde seitdem von uns als Stammesangehörige betrachtet.
»Salim, damals fünf Jahre alt und zwei Jahre älter als ich, wurde mein Gespiele und machte sich selbst zum Beschützer für mich. So lange ich zurückdenken kann, schwebt mir immer seine Gegenwart vor. Ich würde ihn für meinen Bruder halten, wenn ich nicht darüber von anderen belehrt worden wäre, daß er in unserem Lager eigentlich ein Fremdling war, wenn er auch als Beni-Suef galt.
»Wenn wir beide uns nicht an Spielen ergötzten, oder draußen bei den Herden waren, so verbrachten wir unsere Zeit im Zelte Karo-Hissars, und diesem Umstande ist es zu verdanken, daß wir beide, Salim und ich, geläufig französisch sprechen lernten, obgleich ich fest glaube, daß sie keine Französin war.«
»Woraus schließt du das?« unterbrach sie Johanna Lind.
»Weil sie, wenn sie mit ihrem Gott verkehren wollte, in einem Buche las, dessen Inhalt nicht französisch war, auch ganz andere Buchstaben hatte.«
»Ich denke, Karo-hissar war Muhamedanerin geworden?«
»Das war sie, aber, wenn sie allein war oder nur mit uns Kindern, dann las sie immer in dem Buche, fiel auf die Kniee, weinte oft und schien zu beten. Deshalb glaube ich jetzt, daß sie sich mit ihrem früherem Gott beschäftigte.
»Ich war zehn Jahre alt, als Karo-hissar starb. Sie litt an einem geheimen Gram, und dieser löste schnell ihr Leben auf.
»Ich will hier nicht ausführlich erzählen, welcher Schmerz uns durchwühlte, als die Mutter, denn eine solche war sie auch mir gewesen, uns genommen wurde. Es war für mich die Zeit gekommen, da die Zelte der Frauen mein Aufenthaltsort wurden, und da ich mich an den Arbeiten beteiligte, das heißt, Teppiche zu weben und zur bestimmten Zeit zu den Herden hinauszugehen und in Gemeinschaft der anderen Mädchen die Muttertiere zu melken, während Salim nach Vollendung des zwölften Jahres feierlichst als ein Mitglied in den Stamm der Beni-Suef aufgenommen wurde.
»Hatten sich unsere Herzen schon als spielende Kinder in Freundschaft gefunden, so dauerte es nicht lange, und in unsere Herzen zogen andere Empfindungen ein. Doch ich will hier nicht schildern, wie Salim mir einst seine Liebe gestand, genug, er bewarb sich bei dem Scheich um meine Hand, und ihm, der den übrigen Stammesmitgliedern als Muster eines Mannes galt, ward sie nicht abgeschlagen.
»Salim war damals neunzehn Jahre alt, und selten hat ein Auge einen schöneren Jüngling gesehen. Das im Gegensatz zu dem Araber schwarz gelockte Haar, der kleine Schnurrbart gaben ihm ein fremdes, aber zugleich bezauberndes Aussehen, dagegen prägten ihn die kühnblickenden Augen, die hohe Stirn, die edle gebogene Nase zum Araber.
»Seine Geschicklichkeit in der Führung der Waffen erregte selbst die Bewunderung der alten Männer, ebenso seine Reitkunst, welche die der anderen weit in den Schatten stellte. Oft beklagte sich Salim mir gegenüber, daß ihm so gar keine Gelegenheit geboten würde, seine Fähigkeiten zu zeigen, daß er nur im Spiele Schwert und Lanze schwingen könnte und nur hinter der Antilope sein Roß zu immer schnellerem Laufe antreiben dürfe, denn der Scheich, mein Vater, war ein friedliebender Mann und wollte jenes unnütze Blutvergießen vermeiden, wie es sonst unter den Arabern der Wüste gebräuchlich ist, welche mit Freuden jede Gelegenheit ergreifen, ihre Waffenkunst im Kampf gegen einen Nachbarstamm zu zeigen.
»Eines Vorfalles muß ich noch erwähnen, damit das Folgende verständlich wird.
»In unserem Stamme lebte ein Mann, welcher wegen seiner List und Verschlagenheit bekannt war. Hassan, so war sein Name, hatte von der Natur ein mißgestaltetes Aeußere bekommen; er war klein, bucklig und krummbeinig, auch schielte er sehr. Dafür aber hatte er einen um so regeren Geist, den er aber, wie mir und noch vielen anderen meines Stammes dünkte, zu unrechten Dingen anwendete.
»Hassan eignete sich nicht zum Weiden der Herden und zur Jagd, trotzdem war er ein sehr nützliches Mitglied, er besorgte den Verkauf von Decken und Teppichen, leitete den Tausch von Pferden und Ziegen gegen nützliche Sachen und war darin unerreichbar. Ueberhaupt zeigte er mehr Anlagen zum Kaufmann, hatte aber eine schlechte Eigenschaft ererbt, die solche Leute oft besitzen, nämlich einen ungeheuren Geiz und eine unersättliche Gewinnsucht.
»Daß er sich die meiste Zeit in Städten und bei fremden, verdorbenen Stämmen in Geschäften aufhielt, mag diese schlimmen Eigenschaften genährt haben. Mein Vater wußte zum Beispiel bestimmt, daß Hassan den Stamm bei den Einkäufen betrog, daß er Geld unterschlug, aber einmal war er viel zu schlau, als daß er sich dabei ertappen ließ, und dann auch führte er die ihm gegebenen Aufträge so gut aus, daß dennoch jeder mit dem ausgelieferten Betrage zufrieden war.
»Einst kamen zu uns Abgesandte der Baniti, eines südlich wohnenden, mächtigen Stammes, und unter ihnen war auch Dahab, der Sohn ihres Scheichs. Sie wollten von uns, deren Pferde weit und breit berühmt sind, Zuchthengste eintauschen.
»Dieser junge Scheich mißfiel mir außerordentlich, einmal wegen seines ganzen, abstoßenden Aeußeren, und dann auch, weil er seine tückischen Augen immer so begehrlich auf mich richtete.
»Sein Aufenthalt in unserem Lager währte einige Tage, und ich merkte wohl, wie er stets bemüht war, in meine Nähe zu kommen. Ich wich ihm jedoch aus.
»Eines Morgens befand ich mich ganz allein bei einer Ziegenherde, nirgends war ein Mensch zu sehen, als plötzlich ein Reiter herangesprengt kam und vor mir hielt.
»Es war kein anderer als Dahab, welcher mich hier aufgesucht und gefunden hatte.
»Nach einigen allgemeinen Fragen stieg er vom Pferde, band es an einen Zweig und begann mit verfänglichen Reden, bis er mich schließlich ganz offen fragte, ob ich sein Weib werden wollte.
»Ich sagte ihm, er habe ja schon zwei Weiber, darauf lachte er und entgegnete, ich sollte sein Lieblingsweib werden.
»Nun erklärte ich ihm, daß ich bereits mit Salim verlobt sei, und forderte ihn auf, mich zu verlassen. Daraufhin brach er in ein höhnisches Lachen aus, welches eine Angewohnheit von ihm war und ihn mir besonders verhaßt machte. Er spottete über Salim als einen armen Schelm, mit dem er, der Scheich der Baniti, doch nicht zu vergleichen sei, und wurde in seinen Bewerbungen noch zudringlicher.
»Allerdings war Salim arm, wenigstens im Vergleich zu Dahab, aber seine Tugenden wogen die Reichtümer jenes hundertfach auf. So wandte ich ihm den Rücken und ging meiner Beschäftigung nach.
»Da aber geschah etwas für einen Beduinen Unerhörtes.
»Plötzlich fühlte ich mich von hinten um den Leib gefaßt, der Schleier wurde mir vom Gesicht gerissen, und dicht an mein Ohr, sodaß ich den heißen Atem spürte, schlugen die mit wilder Leidenschaft gesprochenen Worte:
»›Ein Baniti-Scheich nimmt sich das mit Gewalt, was ihm verweigert wird!‹
»Noch ehe mir der schreckliche Sinn dieser Worte Bewußtsein kam, geschah etwas Unerwartetes.
»Plötzlich fühlte ich, wie sein Griff locker wurde, er stieß einen Schrei aus, und im nächsten Augenblicke flog mein Bedränger von unsichtbarer Gewalt geschleudert zur Seite, mitten unter die Ziegenherde.

»Hinter mir stand Salim, sein Pferd neben sich. Er hatte schon längst einen Argwohn gegen den fremden Gast gefaßt, war ihm gefolgt und kam nun zur rechten Zeit, um mich vor einer Gewaltthat zu schützen.
»Wütend richtete sich Dahab auf, riß die Pistole aus dem Gürtel und schlug auf Salim an, aber ehe er noch feuern konnte, war dieser schon bei ihm und schlug ihn abermals zu Boden.
»Darauf hat ihn Salim auch noch, trotz meines Abratens, gezüchtigt und ihm das Schwert zerbrochen.
»Wir ließen Dahab am Boden liegen, der sein Antlitz im Sand versteckt hatte, wahrscheinlich um uns seine ohnmächtige Wut nicht zu zeigen, und kehrten nach dem Lager zurück.
»Dahab ließ sich nicht wieder sehen, die abgesandten Baniti hatten den Handel bereits abgeschlossen und zogen davon, ohne von uns über ihren verschwundenen Scheich Nachricht zu erhalten, denn ich hatte Salim gebeten, niemandem von dem Betragen desselben zu erzählen, um üble Folgen zu vermeiden.
»Trotzdem besaß der gezüchtigte Dahab die Frechheit, mich heimlich durch Hassan, welcher im Lager der Baniti zu thun gehabt hatte, noch einmal zum Weib zu begehren, und der kleine, bucklige Unterhändler, wahrscheinlich von dem Scheich bestochen, that selbst sein Möglichstes, mich zu der Annahme dieses Vorschlages zu bewegen.
»Natürlich wies ich ihn mit Verachtung ab. Hassan entfernte sich; ich bemerkte noch, wie er im Fortgehen ein höhnisches Grinsen nicht verbergen konnte, dachte mir damals aber nichts dabei. Jetzt weiß ich, welches Geschäft dieser berechnende, hündische Mann mit mir vor hatte.
»Es war am Tage unserer Hochzeit. Der Morgen schon brach mit Gesang, Tanz und Spielen an, und die Frohesten unter den Frohen waren wir beide, Salim und ich, sollten wir doch noch an demselben Tage für immer vereint werden.
»Gegen Abend näherte sich eine Reiterschar unseren Zelten, und ein Abgesandter derselben bat uns um Gastfreundschaft für die Nacht. Nie hat ein Beni-Suef diese einem Fremden abgeschlagen, und am Tage der Festlichkeit war um so weniger Grund dazu vorhanden.
»Es waren sechs Männer auf stattlichen Pferden, welche an unserem Fest teilnahmen. Sie gaben vor, einem weit, weit südlich wohnenden Stamme anzugehören und nach Kairo zu reisen, um am Hofe des Vizekönigs eine Audienz zu erhalten, von ihren Nachbarn wäre ihnen Unrecht geschehen.
»Das ganze Lager, Männer, Frauen und Kinder weilten innerhalb der Zelte, und die Herden waren unter Aufsicht einiger Kinder, welche sich gegenseitig ablösten, dachte doch niemand an etwas Arges. Auch die Pferde, die Kleinode der Beduinen, standen ohne Aufsicht an den Zelten angepflockt.
»Plötzlich erscholl der Ruf:
»›Die Pferde sind los!‹
»Es hatten sich wirklich einige derselben frei gemacht, und zwar gerade die jüngsten Hengste. Damals glaubten wir an einen Zufall, und sofort sprangen die Männer auf ihre Tiere und setzten den Flüchtlingen nach, sodaß kein einziges Pferd im Lager zurückblieb mit Ausnahme der Tiere unserer Gäste, welche sonderbarerweise selbst schnell die Sättel bestiegen, aber der Reiterschar, welche sich unseren Blicken entzog, ruhig nachblickten. Salim war der ersten gewesen, welcher sich aufs Pferd geworfen, und zwischen den Zelten befanden sich außer unseren Gästen und den Weibern nur noch Kinder und Greise, welche bedauerten, an der lustigen Jagd nicht teilnehmen zu können.
»Auch Hassan hatte sich jenen nicht angeschlossen, er besaß nicht einmal ein Pferd, weil er überhaupt seines schwächlichen Körpers wegen nur selten ritt.
»Jetzt sollte es sich zeigen, welches verbrecherische Vorhaben die sechs Fremdlinge im Sinne hatten.
»Kaum war die letzte Reitergestalt in westlicher Ferne verschwunden, als plötzlich einer der sechs einen scharfen Pfiff ausstieß: zu gleicher Zeit fühlte ich mich um die Hüften gefaßt, emporgehoben, und ehe ich noch an Gegenwehr denken konnte, saß ich schon vorn im Sattel eines Reiters, und fort ging es, daß mir der Atem versagte, nach Osten zu in die Wüste.

»Wildes Geschrei erhob sich hinter uns. Ich sah, wie Hassan fluchend die Pistole aus dem Gürtel riß und meinem Entführer und den sich diesem zur Seite haltenden anderen Genossen nachfeuerte und sich wie unsinnig geberdete. Der Heuchler! Er hatte vorher die Kugeln aus dem Lauf genommen!
»Dann bemerkte ich mit einem Male, daß ich nicht die einzige war, daß ich noch eine Leidensgefährtin hatte. Gleich mir hing über den Sattel eines anderen Reiters Seddah, die Tochter eines unserer angesehensten Stammesgenossen, welche auch geraubt worden war.
»Erlaßt mir die Schilderung meiner Gefühle, als ich die Zelte meiner Heimat verschwinden sah, als wir nach einigen Stunden wilden Reitens über den Nil setzten und immer weiter und weiter dem Osten zu geschleppt wurden.
»Nach zwei Tagen erreichten wir die Küste des Meeres; unsere Entführer warteten, bis die Nacht anbrach, und ritten dann in ein Hafenstädtchen, in welchem meine Freundin und ich in ein Häuschen gebracht und verborgen gehalten wurden.
»Hier blieben wir sieben Tage, ohne jemanden zu sehen als eine alte Frau, welche uns das kärgliche Essen brachte. Eines Nachts hörte ich vor unserem vergitterten Fenster einen leisen Stimmenwechsel, und, so vorsichtig er auch geführt wurde, erkannte ich doch in einem der Sprecher Hassan wieder.
»Derselbe hatte die Angewohnheit, bei jedem Satz, den er sprach, bekräftigend an seine Seite zu schlagen, und dieses eigentümliche Klatschen vernahm ich hier.
»Doch ich mußte mir Gewißheit verschaffen. Ich weckte Seddah, und mit ihrer Hilfe gelang es mir, an das hochgelegene Fenster zu klimmen und durch das Gitter auf die Straße zu spähen.
»Meine Vermutung war richtig gewesen. Unten stand Hassan, und ich sah eben in dem hellen Mondenschein, wie er von einem reichgekleideten Türken oder Araber eine Menge Goldstücke ausgezahlt bekam.
»Aber auch diesen Fremden hatte ich schon einmal gesehen. Er war am Tage zuvor der Wärterin in unser Zimmer gefolgt und hatte uns lange aufmerksam betrachtet, mich mit sichtbarem Wohlbehagen, die etwas pockennarbige Seddah aber mit geringschätzigem Lächeln, und hatte dann in freundlichem Tone geäußert, dabei scheu umherspähend, als fürchte er einen Lauscher, wir sollten nur den guten Mut nicht verlieren, wir würden bald zu den Unsrigen zurückkehren können.
»Die Ahnung, welche mir bei Entdeckung dieses Handels auftauchte, war furchtbar, aber ich verschwieg Seddah, daß ich Hassan erkannt hatte, um das so wie so schon furchtsame Mädchen nicht noch ängstlicher zu stimmen.
»In derselben Nacht noch ging meine Ahnung in Erfüllung. Plötzlich wurde die Thür aufgerissen; jener Türke drang mit einigen Dienern ins Zimmer und ließ mich hinausführen. Als ich entsetzt den Mund öffnen wollte, um Gnade zu erflehen, legte sich eine Hand darauf. So wurde ich von Seddah gerissen, ohne ihr ein Lebewohl zurufen zu können. Was aus ihr geworden ist, weiß ich nicht!
»Ich wurde in ein kleines Fahrzeug gebracht, welches in selber Nacht noch abfuhr, und nach einigen Tagen erreichten wir Suez, von wo ich unter Begleitung vieler Männer auf einem Kamel nach Port-Said geschleppt wurde. Hier mußte ich wieder ein Schiff besteigen und kam nach Konstantinopel, ohne daß ich während der ganzen Reise auch nur ein einziges Mal Gelegenheit gehabt hätte, an Flucht denken, oder auch nur jemandem mein Schicksal mitteilen zu können.
»In jenem Hause zu Konstantinopel, aus dessen Fenster Sie, meine Retterin, das Billet empfingen, verweilte ich über sechs Monate, immer unter strenger Bewachung. Ich war anfangs das einzige gefangene Mädchen, aber nach und nach kamen immer mehr dazu, bis wir achtzehn waren, wahrscheinlich die bestellte Lieferung an den Hof irgend eines asiatischen Fürsten, denn unser Transport war, wie ich Ihnen schon mitteilte, nach Smyrna bestimmt.
»Das ist in kurzen Worten mein Schicksal, in welches Sie mit kräftiger Hand eingriffen, um dem Vorhaben jener elenden Händler zu begegnen. Allah segne Sie dafür!«
»Hast du nichts mehr von Hassan gehört?« fragte Ellen.
»Nein. Als ich ihn unten am Fenster gesehen, war es das letzte Mal.«
»Du sagtest,« nahm Miß Thomson das Wort, »Karo-hissar hieße die schwarze Burg? Das ist aber nicht arabisch, es ist türkisch.«
»Karo-hissar sprach besser türkisch, als arabisch. Als sie zu den Adnan kam, verstand sie letzteres noch gar nicht, sie lernte es erst im Laufe der Zeit. Damals gab sie sich aber diesen türkischen Namen.«
»Das hieße auf deutsch Schwarzburg,« murmelte Johanna Lind vor sich hin.
»Was meinen Sie zu diesen Erlebnissen?« fragte Ellen ihre Freundin Johanna. »Wie kommt es, daß Hassan dieses Mädchen nicht dem Dahab ausgeliefert hat, denn dieser wollte sich doch jedenfalls Sulimas bemächtigen?«
Johanna lächelte.
»Ich verstehe das Verhalten Hassans sehr wohl, er spielte eine doppelte Rolle, und es sollte mich gar nicht wundern, wenn er später als Befreier des –«
Ausrufe an Bord des ›Amor‹ unterbrachen die Auseinandersetzungen des Mädchens. Die Herren wiesen nach dem Horizont, und Lord Hastings rief:
»Da ist es wieder, das Geisterschiff!«
Zum ersten Male sahen die Damen selbst das Wunder, von dem ihnen die Herren schon so viel erzählt hatten. Aber sie hatten deren Schilderungen für Uebertreibungen einer erhitzten Phantasie gehalten oder für Albernheiten, und sie verlacht. Jetzt sahen sie das beschriebene Rätsel selbst, und nicht eine war unter den Vestalinnen, der das sonst so mutige Herz nicht schneller schlug. Große Aufregung bemächtigte sich aller.
Wieder kam das graue Ungetüm mit furchtbarer Schnelligkeit dahergebraust, seinen Kurs direkt auf die beiden Schiffe zunehmend. Kein Steuerrad, kein Kompaßhäuschen, keine Winde – nichts war auf dem hohen, halbrunden Verdeck zu sehen.
Fast hatte es die beiden aneinanderliegenden Schiffe erreicht, fast schien es, als wenn es sie rammen wollte, als es plötzlich fast unmerklich einen kleinen Winkel beschrieb und nun dicht an der staunenden Mannschaft vorbeischoß.
»Flagge und Vesta hoch!« rief Ellen, sich aufraffend, und sprang selbst an den Kasten, der die Signalwimpel barg. »Wir wollen doch sehen, ob Geister auch unter einer Flagge segeln!«
Diese Ermunterung brachte Leben in die erstarrten Körper. Im Nu flatterten am Hinterteil des Schiffes die amerikanische Flagge und die Wimpel der ›Vesta‹, und im nächsten Augenblick zeigte auch die Brigg die englischen Farben.
Aber der Versuch hatte keinen Erfolg. Stumm, ohne ein Zeichen von sich zu geben, flog das gespenstische Schiff vorbei, teilte die Wogen mit ungeheurer Gewalt und ließ das gebrochene, hochaufschäumende Wasser über sein Vorderteil fluten. Eine Flagge ging nicht hoch.
Johanna stand noch immer wie gebannt da und starrte dem sich schnell entfernenden Schiffe nach.
»Eins, zwei, drei, vier, fünf,« zählte sie leise, »der ›Blitz‹ ist es nicht, der hat sechs Raaen an jedem Mast.«
»Der ›Blitz‹?« fragte Ellen erstaunt. »Wie kommen Sie darauf?«
»Ich meinte nur so,« entgegnete Johanna und wandte sich nachdenkend ab.
»Was es auch immer sein mag,« rief Ellen mit fröhlicher Stimme, »uns, die Vestalinnen, sollen alle Geister der Welt nicht beunruhigen. Auf, meine Damen, die Unterhaltung ist aus!«
Kommandos erschollen an Bord beider Schiffe, die englischen, wie die amerikanischen Matrosen kletterten wie Eichhörnchen die Wanten hinauf, eilten gleich Seiltänzern die Raaen entlang und knüpften die Segel los; andere schlugen unten am Deck die Taue über Winden und zogen die Leinewand straff, während inzwischen die Steuerleute aus dem Stand der Sonne und nach dem Chronometer den Ort berechneten, an dem man sich befand.

In die Segel der ›Vesta‹ legte sich der Wind.
»Ruder hart Steuerbord!« erklang die Altstimme Ellens von der Kommandobrücke, und:
»Klüversegel hol' aus!« gleich darauf; das Vollschiff kam von der Brigg frei, welche sofort ins Kielwasser der ›Vesta‹ einbog.
»Auf Wiedersehen!« rief Ellen und winkte mit dem Tuche nach dem ›Amor‹ zurück, »und halten Sie sich hübsch in der gehörigen Entfernung, meine Herren, wie ausgemacht ist!«
»Auf Wiedersehen!« schrie Charles, der auf der zweiten Raa stand, aus vollem Halse und schwenkte seine Mütze. »Wo soll das Wiedersehen stattfinden, Miß Petersen?«
»Ich weiß nicht,« entgegnete Ellen achselzuckend.
»Gut, dann treffen wir uns dort wieder.«
»Brüllen Sie nicht so und tanzen Sie nicht so auf der Raa herum,« murrte Lord Hastings unten am Deck, »sonst fallen Sie noch herunter.«
»Kann ich machen, wie ich will,« war die Antwort, »mein Genick gehört mir, und wenn Sie nicht still sind, so falle ich direkt auf Sie da unten. Passen Sie auf!«
Wie ein Jongleur sprang Sir Williams an ein am Maste herunterhängendes Tau und schoß wie ein Blitz daran herab, dicht vor die Füße des Lords.
Bald war der verlangte Abstand zwischen den beiden Schiffen hergestellt, und der ›Amor‹ machte Dampf auf, um die ›Vesta‹ nicht zu verlieren.
»Wohin fahren wir, Kapitän?« fragten einige der Herren Lord Harrlington.
»Nach Alexandrien,« antwortete dieser.
»Was, Georg, du kommst schon zurück?« fragte der breitschultrige Bootsmann des ›Blitz‹ einen jungen Burschen, der eben, eine Ledertasche um die Schultern gehängt, das Fallreep emporstieg.
»Warum nicht?« entgegnete der Angeredete und wischte sich den Schweiß von dem sonnverbrannten, frischen Gesicht, nahm dann die bebänderte Mütze ab, sodaß scharf die Grenzlinie zu sehen war, bis wohin die sengende Sonne und stürmische Winde ihre Wirkung auf die Haut geäußert hatten, und trocknete mit dem Tuche das Futter der Mütze.
»Warum nicht?« entgegnete er auf die verwunderte Frage des Bootsmannes.
»Vom Hafen von Alexandrien bis zum Postgebäude ist es nicht so weit, und außerdem bin ich mit der Pferdebahn gefahren.«
»Das sieht dir gar nicht ähnlich. Sonst schnüffelst du doch in jeder neuen Stadt alle Winkel aus und kannst dann erzählen, wo der beste Wein und das schönste Mädchen zu haben sind.«
»Ja,« lachte Georg, »das kommt eben davon, wenn man sich einen Nachtwächter zum Vater ausgesucht hat. Das Spionieren vererbt sich. Aber heute war es mir doch etwas zu heiß dazu. Doch sag', Bootsmann, ist der Kapitän im Salon?«
»Er wird in seinem Arbeitszimmer sein,« brummte der Bootsmann mürrisch, weil der sonst immer Neuigkeiten vom Lande mitbringende Georg heute so karg mit denselben war.
Der junge Matrose drehte nachdenklich den kleinen, schwarzen Schnurrbart, warf einen prüfenden Blick über das Deck, auf welchem die Mannschaft mit dem Putzen der Messing- und Eisenteile beschäftigt war, obgleich diese schon in der Sonne blitzten, und schritt dem inmitten des Schiffes stehenden Häuschen zu, in welchem sich die nach der Kajüte führende Treppe befand.
Auf dem ›Blitz‹ schien militärische Ordnung zu herrschen, denn unten an der Treppe stand, wie am Fallreep, ein Posten.
»Melde mich dem Kapitän, Hans!« sagte Georg zu diesem, ebenso wie vorhin zum Bootsmann deutsch sprechend, und der Mann verschwand in einer Thür.
Es war wunderlich, mit welcher Aufmerksamkeit der junge Matrose mit der Brieftasche sich jetzt, als er für eine halbe Minute allein war, umsah. Blitzschnell ließ er seinen Blick durch den halbdunklen Gang schweifen, kein Gegenstand, keine Thür, nicht einmal die Schlösser schienen seinem durchdringenden Auge zu entgehen. Es war fast, als ob Georg, der doch auf dem ›Blitz‹ seine Heimat hatte, seit der stolze Bau zum ersten Male die Fluten des Oceans durchschnitten, hier ein Fremdling wäre.
Die Thür öffnete sich wieder, und der Posten winkte Georg, hereinzukommen, während er selbst seinen alten Platz an der Treppe einnahm.
Ein Fremder hätte gestaunt über die prächtige Einrichtung dieses kleinen Gemaches. Obgleich kein Prunk, keine weichen Diwans und unnütze Luxusmöbel zu sehen waren, zeigte doch jeder kleinste Gegenstand die gediegenste Arbeit. Stühle und Tische waren von poliertem Nußbaumholz gefertigt, desgleichen die Bücherschränke und Sekretäre. Ueber dem großen Tisch in der Mitte, welcher mit offenen Atlanten und Büchern bedeckt war, hing ein überaus kostbarer Kronleuchter, dessen Lampen durch Elektrizität zum Leuchten gebracht werden konnten.
Diese Kraft schien hier überhaupt eine große Rolle zu spielen. In allen Winkeln, vor jedem Schrank war eine Edison'sche Glühlampe angebracht, während auf dem Schreibtisch ein kunstvoll gearbeiteter Telegraphenapparat und noch viele andere Instrumente von sonderbarer Konstruktion standen, die sämtlich, wie die von ihnen ablaufenden, grünen Drähte verrieten, durch Elektrizität bedient wurden.
Vor dem Schreibtisch saß, eben einen Brief lesend, der Kapitän des ›Blitz‹, jener deutsche Ingenieur, dessen Bekanntschaft der freundliche Leser schon in Konstantinopel gemacht hat. Als er jetzt beim Eintritt der Briefordonnanz aufstand und seine Gestalt dehnte, um die vom Sitzen steifgewordenen Glieder wieder beweglich zu machen, kam in dem kleinen Raum seine mächtige, aber dennoch harmonisch schön gebaute Gestalt zur vollen Geltung. Man glaubte sich beim Anblick dieses Mannes mit dem gekräuselten Vollbart, dem vollen Haar, welches die durch das kleine, runde Fensterchen fallende Sonne goldig erstrahlen ließ, einem jener Helden gegenüber, wie sie uns die germanische Götterlehre zu schildern weiß. Dieses strahlende, blaue Auge schien geschaffen, das tiefste Geheimnis zu ergründen, aber es schien auch, obgleich jetzt gutmütig und sanft, befähigt, den verwegensten Feind durch bloßes Anschauen zu entwaffnen.
»Nun, Georg,« sagte er freundlich, »hast du die Post nach meiner Beschreibung gleich gefunden?«
»Natürlich,« antwortete der Gefragte selbstbewußt. »Wie können der Herr Kapitän daran zweifeln?«
»Das ist es nicht,« meinte der Kapitän Felix Hoffmann, »ich machte mir wirklich Vorwürfe, dich so allein mit Briefen nach der Post geschickt zu haben.«
»Wieso, Herr Kapitän?«
»Es ist nicht mehr recht geheuer in den Hafenstädten, eine Spitzbubenbande scheint wieder ihr Wesen zu treiben, der die Polizei nicht gewachsen ist.«
Die Briefordonnanz nickte unmerklich mit dem Kopfe.
»Hast du Briefe mitgebracht?«
»Einige,« entgegnete Georg und schüttete den Inhalt der Tasche auf den Tisch. »Aus Deutschland, Amerika, ich glaube, aus Mexiko, und ein paar von hier, doch wahrscheinlich Bitten, den ›Blitz‹ besichtigen zu dürfen.«
Jede Briefordonnanz ist gewissermaßen eingeweiht in die Korrespondenz ihres Herrn, und Georg war es auf dem ›Blitz‹ mehr als irgend ein anderer.
»Sonst etwas Neues?« fragte der Kapitän, während er gleichgiltig die Briefe durchflog und sortierte.
»Ja, sehr viel,« sagte mit pfiffigem Lächeln Georg. »Ich machte vorhin die Bekanntschaft eines jungen Mannes, welcher durchaus an Bord des ›Blitz‹ kommen möchte.«
»So, das möchten wohl noch mehrere. Aber das geht nicht, die Besatzung ist voll.«
»Können Sie wirklich gar keinen mehr gebrauchen?«
Herr Hoffmann warf einen prüfenden Blick auf den Frager.
»Was soll dies, Georg? Hast du einen Bekannten getroffen, den du gern an Bord haben möchtest?«
Georg blieb lange Zeit eine Antwort schuldig, während sich der Kapitän wieder in die Briefe vertiefte.
»Es geht wirklich nicht, Georg, ich nehme keinen Fremden an Bord,« sagte letzterer dann nach einer Weile.
»Auch nicht, wenn ihn Fräulein Johanna Lind empfohlen hat?« klang es etwas spöttisch zurück.
Der Kapitän horchte auf; langsam drehte er das verwunderte Gesicht der Ordonnanz zu, sprang aber dann plötzlich mit allen Zeichen eines namenlosen Erstaunens auf. Was war denn das? Träumte oder wachte er? Das war doch nicht mehr sein Georg, die Ordonnanz? Weg war der Schnurrbart, die braune Gesichtsfarbe; die Stirn war höher geworden, selbst der Mund schien sich verändert zu haben; derselbe Mund war kleiner und die Lippen schmäler.
Der vor ihm Stehende weidete sich mit sichtlichem Ergötzen an dem erstaunten Gesicht des Ingenieurs. Doch nur einige Sekunden hatte diesen die Ueberraschung übermannt, im nächsten Augenblick zog er die weiße Stirn in drohende Falten und sagte in ernstem Tone:
»Was soll das? Sie sind nicht meine Ordonnanz! Wozu diese Maskerade, und wie kommen Sie als Fremder in den Anzug meines Burschen? Antwort, oder –«

Der Ingenieur streckte langsam die Hand nach einem auf dem Tisch stehenden Apparat aus, die Augen fest auf den jetzt bartlosen, jungen Menschen gerichtet, der sich durchaus nicht aus der Fassung bringen ließ, sondern lächelnd entgegnete:
»Hat Sie nicht Fräulein Lind davon benachrichtigt, daß sich Ihnen ein Herr vorstellen wird? Sie glaubte bestimmt, daß Sie ihr die Bitte nicht abschlagen würden, welche sie Ihnen vortrug.«
»Ah,« sagte der Kapitän und zog die Hand zurück, »so sind Sie dieser Abgesandte? Dann ist es allerdings etwas anderes. Sie sind mir willkommen. Aber, erklären Sie mir, auf welche sonderbare Weise stellen Sie sich mir vor, und hier in Alexandrien, da ich Sie doch schon in Konstantinopel erwartet hatte?«
»Diese Karte wird Sie etwas darüber aufklären,« antwortete der Fremde, immer lächelnd, zog eine Brieftasche hervor und reichte dem Ingenieur eine Visitenkarte.
»Nikolas Scharp,« las dieser, sann eine Sekunde lang nach und richtete dann seine Blicke mit unverkennbarer Überraschung auf den jungen Mann.
»Wie,« fuhr er fort, »Sie sind Nick Scharp, der Detektiv, von dem man schon soviel gehört hat, den die Gaunerwelt das Chamäleon nennt, weil er in jeder Stunde ein anderes Aussehen annimmt?«
»Ich habe die Ehre, mich Ihnen als Nick Scharp vorzustellen,« sagte der junge Mann einfach.
»Das konnte ich allerdings nicht ahnen, es erklärt mir aber Ihre seltsame Einführung. Seien Sie mir herzlich willkommen! Bitte, setzen Sie sich.«
Der Ingenieur bot dem Fremden höflich einen Stuhl an, auf welchem dieser gemächlich mit übergeschlagenen Beinen Platz nahm.
»Fräulein Lind schrieb Ihnen oder bat Sie vielmehr,« begann er, »da auch Sie nur auf einer Vergnügungsfahrt begriffen wären, die ›Vesta‹ zu begleiten. Die Gründe hat sie Ihnen jedenfalls auch mitgeteilt?«
»Allerdings! Sie sagte, Miß Ellen Petersen – doch ich weiß nicht, ob ich davon sprechen darf,« unterbrach sich der Ingenieur.
»Ich bin in den ganzen Plan eingeweiht und spielte von Anfang an die Hauptrolle,« entgegnete der Detektiv. »Doch nun kommt es darauf an, ob Sie gewillt sind, auf Fräulein Linds und auf meinen Vorschlag einzugehen, das heißt, der ›Vesta‹ zu folgen und mich an Bord Ihres Schiffes zu behalten, mir aber die völlige Freiheit über meine Handlungen zu gestatten, auch daß ich an Bord und von Bord gehen kann, wann ich will, kurz so, wie Ihnen Miß Lind schrieb.«
»Gewiß bin ich damit einverstanden,« rief der Ingenieur, »es freut mich sogar ungemein, solch' einen ausgezeichneten Mann an Bord meines Schiffes zu haben. Außerdem ersuchte mich Johanna – Miß Lind, wollte ich sagen – den Ratschlägen des von ihr abgesandten Vertrauensmannes Gehör zu schenken. Tauchten mir hinsichtlich dieser Bitte anfangs Zweifel auf, so sind diese jetzt, seit ich weiß, daß dieser Herr Nick Scharp, der amerikanische Detektiv ist, völlig geschwunden. Ich erkenne Ihre Ueberlegenheit in verschiedenen Angelegenheiten an.«
Der Detektiv verbeugte sich leicht.
»Aber,« fuhr der Ingenieur fort, »wie kommt es, daß Sie mich nicht bereits in Konstantinopel aufsuchten, wie es ausgemacht war?«
»Ich habe es doch gethan,« bemerkte lächelnd der Detektiv.
»Aber nicht so, daß ich dessen bewußt wurde.«
»Nein, allerdings nicht. Ich war jener Bootsführer, der Ihnen den Brief von Fräulein Lind brachte. Außerdem benutzte ich die Zeit in Konstantinopel, mich nach und nach mit dem gesamten Personal Ihres Schiffes bekannt zu machen und mir den brauchbarsten unter allen diesen tüchtigen Jungen herauszusuchen, den ich ab und zu verwenden werde, natürlich mit Ihrer Erlaubnis.«
»Auf wen ist Ihre Wahl gefallen?«
»Auf Georg, die Briefordonnanz.«
»In der That, er ist ein intelligenter, treuer und zugleich pfiffiger Geselle, manchmal etwas zu neugierig. Doch à propos, wo steckt er denn jetzt?«
»Er sitzt in meinem Hotelzimmer und raucht als Master Pollok meine Cigarren. Hoffentlich wird es ihm nicht unangenehm sein.«
»Das wird ihm passen; so etwas Abenteuerliches ist nach seinem Geschmack. Und wie soll er wieder herkommen?«
»Ganz auf dieselbe Weise. Ich gehe zu ihm als Ordonnanz, und er kommt als solche an Bord zurück, während ich als Master Pollok an Land bleibe.«
»Wozu diese Vorsicht? Konnten Sie mich nicht in Ihrer eigentlichen Gestalt aufsuchen?«
»Nein. Es war mir, als ob ich beobachtet würde, und wenn ich als Detektiv erkannt und gesehen worden wäre, daß ich auf den ›Blitz‹ gegangen bin, so hätte ich viele Mühe gehabt, meine Beobachter wieder auf eine falsche Spur zu bringen. Außerdem wollte ich Sie erst noch fragen, ob man sich auf Ihre Matrosen betreffs Verschwiegenheit verlassen kann, daß sie mir nicht einmal durch Schwatzen einen Streich spielen.«
Der Ingenieur schüttelte energisch den Kopf.
»Lernen Sie erst meine Besatzung kennen; jeder Mann ist treu wie Gold und verschwiegen wie das Grab.«
»Sie haben sich ja eine wahre Musterkarte von Farben angelegt, ich kalkuliere, alle Nationen der Erde sind auf Ihrem Schiffe vertreten!«
»Ja, es hat mir viele Mühe gekostet, ehe ich sie nach und nach zusammengebracht habe, aber ein jeder von ihnen ist auch ein Original, eine Spezialität in seinem Fache. Doch, bitte, sagen Sie mir, woher kennen Sie Fräulein Lind? Dieses Mädchen ist mir ein Rätsel. Die Besatzung der ›Vesta‹ soll aus den vornehmsten Damen Nordamerikas bestehen, und doch traf ich Fräulein Lind am Oberonsee, als –«
»Herr Hoffmann,« unterbrach ihn der Detektiv rasch, »Ihnen hat Miß Lind also nicht selbst erzählt, wie dies kommt?« – »Nein.« – »Dann halte auch ich mich keinesfalls für berechtigt, über ihre Verhältnisse zu sprechen. Fühlen Sie sich durch diese meine Offenheit beleidigt?«
Der Ingenieur schwieg eine Weile. Dann faßte er die Hand des ihm gegenüber Sitzenden und schüttelte sie herzlich.
»Ein anderer würde es vielleicht thun,« sagte er in warmem Ton, »aber ich schätze einen solchen Charakter wie den Ihrigen, und freue mich, Sie auf meinem Schiffe zu wissen.«
Der Amerikaner verbeugte sich dankend.
»Nun zu Ihren anderen Fragen; ich wollte eher nach Alexandrien kommen, als Sie, um mich über diese Stadt und einiges andere vorher orientieren zu können, und schiffte mich deshalb auf einem Schnelldampfer ein. Zu meiner Verwunderung fand ich aber Ihr Schiff bereits hier liegen. Wie in aller Welt kommt das?«
»Wenn Sie Ihre Geheimnisse haben,« meinte der Ingenieur lächelnd, »so lassen Sie mir auch die meinen. Sie werden noch schnell genug dahinterkommen.«
»Hm, hm,« brummte der Detektiv nachdenklich. Er ließ seine Blicke über den Apparat auf dem Tisch und dann über den Fußboden schweifen, bückte sich und befühlte diesen.
»Isoliert dieser Gummibezug gut gegen elektrische Schläge?« fragte er dann mit schlauem Lächeln.
»Die Masse ist kein Gummi, sondern eine eigene Erfindung von mir,« antwortete der Ingenieur ausweichend. – »Hm, hm!«
Der Detektiv drehte sich um, besah die Bordwand und klopfte mit dem gebogenen Finger daran.
»Voll,« sagte er, »ist sie vielleicht manchmal hohl?«
»Dort nicht,« war wieder die unbestimmte Antwort. – »Haben Sie schon von jenem Wunder gehört?« fragte der Detektiv, »welches seit einiger Zeit durch die Meere kreuzen soll? Man erzählt sich die unglaublichsten Dinge von ihm.« – »Mir ist nichts davon bewußt.« – »Kennen Sie Sir Charles Williams?« – »Nein.« – »Es ist einer der Herren an Bord des ›Amor‹. – »Ah so. Ich kenne einige der Herren dem Ansehen nach, aber fast keinen ihrer Namen.«
»Es ist ein junger Mann von meiner Statur, kleiner blonder Schnurrbart, trägt einen Siegelring mit springendem Löwen, am vierten Vorderzahn auf Backbordseite fehlt rechts ein Stückchen.«
»So genau habe ich mir wirklich noch keinen der Engländer angesehen,« lachte der Ingenieur. »Doch was ist mit diesem?«
»Dieser Williams hatte gestern in einer italienischen Trattoria einige seiner Landsleute, alles Landratten, zusammengetrommelt, die er mit Wein traktierte, und welche dafür seine Abenteuer zur See mit anhören mußten. Als der ›Amor‹ durch den griechischen Archipel fuhr, erzählte er, hätten sie plötzlich ein Schiff gesehen, das mit furchtbarer Eile dahergekommen sei. Als eine Insel seinen Lauf gehemmt, hätte es plötzlich mit den Segeln wie mit Flügeln geschlagen und sei durch die Luft über das Eiland hinweggeflogen. Dann sei es direkt auf den ›Amor‹ zugefahren, kurz vor ihm ins Wasser getaucht und auf der anderen Seite wieder hochgekommen. Der Erzähler habe schnell eine Kanone nach ihm abgefeuert, aber die Kugel wäre wie durch Zauberei, kurz vor dem Ziel ins Wasser gefallen, und wenn diese Geschichte nicht wahr sei, dann wolle er, der Erzähler, nicht Sir Charles Williams heißen und kein Baronet von England sein.«
Der Ingenieur lachte laut auf.
»Dieser Engländer muß ja ein furchtbarer Aufschneider sein.«
»Das ist er, aber sonst ein braver, tüchtiger Mensch.«
»Nun sagen Sie mir, wie kommt es eigentlich, daß Sie nicht mehr im Dienste der amerikanischen Polizei stehen, sondern sich einem Privatmann zur Verfügung gestellt haben?« fragte der Ingenieur nach einer Pause.
»Das kam folgendermaßen: Sie haben doch gewiß in den Zeitungen gelesen, wie ich einen unschuldig Verurteilten dadurch rettete, daß ich die Beweisführnng eines meiner Vorgesetzten glänzend widerlegte?«
»Ich entsinne mich,« lachte der Ingenieur, »es war jene köstliche Geschichte, wo Sie, Nikolas Scharp, sich in San Franzisko unter Beisein einer großen Menschenmenge zur Bekräftigung Ihrer Behauptung, daß ein Gehängter sich selbst befreien könne, öffentlich aufhängen ließen.« – »Ja – ein Kniff, den ich einem Indianerstamme Südamerikas abgelauscht habe. Well, seit jener Zeit wurde ich fortgesetzt von meinen Vorgesetzten schikaniert, welche sich darüber ärgerten, daß ein Detektiv einen hohen Gerichtsbeamten so blamiert hatte. Ich war schon lange unwillig darüber, daß mir in allen meinen Unternehmungen die Hände gebunden wurden, daß ich Vorschriften bekam, deren Verkehrtheit klar zu Tage lag. Und endlich kündigte ich dem Staate meine Dienste. Trotz aller Versuche, mich zu halten, reiste ich nach New-York, um meine Talente auf eigene Faust zu verwerten. Hier traf ich Lord Harrlington, den Kapitän des ›Amor‹, welcher mich für seine Absichten zu gewinnen wußte. Es galt, Miß Ellen Petersen, die Kapitänin der ›Vesta‹, während ihrer Fahrt um die Erde zu begleiten, um sie zu bewachen, das heißt, inkognito, ohne daß sie es wissen durfte.

»Well,« fuhr der Detektiv in seiner Erzählung fort, »das hätte gar nicht besser in meine Pläne passen können. Der Lord stellte mir Mittel zur Verfügung, von denen mir die reichste Regierung nicht den zehnten Teil bewilligt hätte. Ich habe infolgedessen ein System zu Gebote stehen, mittels dessen es mir ein Leichtes ist, jederzeit zu erfahren, wo sich Miß Petersen befindet, was sie unternimmt, ja auch, wenn sie sich einmal, mit Respekt zu sagen, zu außergewöhnlicher Zeit die Nase putzt. So lange sich also meine Schutzbefohlene in Städten aufhält, ist sie wie in Engelshänden aufgehoben, und auf See oder in Wildnissen, wo meine Macht zum Teil aufhört, wird eben auf Ihren Beistand gerechnet, Herr Hoffmann.«
Der Ingenieur nickte beistimmend.
»Well, doch diese Beobachtung betreibe ich nur als Nebensache, hauptsächlich habe ich ein anderes Ziel im Auge. Wie Sie vorhin schon andeuteten, muß eine Bande von Verbrechern existieren, welche sich über alle Hafenstädte verbreitet, vielleicht sogar über die ganze Erde, und die sich gegenseitig in die Hände arbeitet.
»Solche Schandthaten, wie das Verschwinden von einzelnen Personen, wie von ganzen Schiffsbesatzungen mehren sich in schrecklicher Weise, und die Polizei zeigt sich ihnen gegenüber ohnmächtig. Und warum? Weil sie die Sache nicht richtig anfaßt. Bei jedem neuen Verbrechen wird ein anderer Detektiv auf die Fährte gehetzt, und kommt dieser einmal zufällig auf eine richtige Spur, so darf er dieselbe nicht etwa weiter verfolgen, sonst gerät er ins Gehege eines Nebenbuhlers, der ihn vor Neid kaltmachen möchte. Das ist eben der Fehler, an dem alles scheitert. Ich aber werde der Sache auf den Grund kommen, ganz allein, auf eigene Faust.«
»Wie wollen Sie dies anfangen?« fragte der aufmerksam zuhörende Ingenieur.
»Well. Alle Fäden dieses verbrecherischen Gewebes müssen in irgend einer Hauptstadt zusammenlaufen, ich vermute in London oder in New-York. Dort selbst kann ich nichts machen. Der Kerl, der alles dirigiert, ist ebenso, vielleicht noch schlauer als Nick Scharp, der doch auch nicht auf den Kopf gefallen ist. Nein, ich fange von den äußersten Enden der Fäden an und taste mich vorsichtig nach dem Centrum hin, alle mir unterwegs begegnenden Verbrechen übersehe ich, suche sie höchstens zu vereiteln, aber nicht etwa, wie alle meine Kollegen thun, die Uebelthäter festzunehmen und gegen eine Prämie auszuliefern; dadurch werden die Burschen nur kopfscheu gemacht, und ihre Aufmerksamkeit wird auf meine Person gelenkt. Vielmehr bemühe ich mich, selbst in die Bande einzutreten, und habe ich erst die in der Mitte des Netzes sitzende Spinne erreicht, dann zertrete ich ihr den Kopf, und dann ist es mir ein Leichtes, die ganze Sippschaft mit einem Male zu fangen.«
»Wird es aber möglich sein, daß Sie, während Sie Miß Petersen bewachen sollen, sich selbst als Räuber zeigen lassen?«
»Warum nicht? Sehen Sie einmal, wie schön das ist« fuhr der Detektiv mit scherzhaftem Ernst fort, »wenn ich mich dazu anwerben lasse, den Nick Scharp zu ermorden, und wenn ich mich dann selbst töte. Das ist nicht etwa eine Unmöglichkeit. Aehnliches habe ich schon anders gemacht. Durch mein Auftreten in der Maske verschiedener Personen bin ich dazu in stand gesetzt.«
»Wie haben Sie sich eigentlich diese Talente zum Detektiv erworben?« fragte der Ingenieur lächelnd.
»Angeboren,« war die lakonische Antwort. »Mein Vater hat in seiner Jugend lange in der Welt umhergeabenteuert, meist als Taschenspieler, heiratete dann eine Schauspielerin, und diese, in meinem Vater Talente vermutend, lockte ihn auf die Bühne. In der That wurde er eine gefeierte Größe doch trat er unter dem Namen seiner Frau auf, aber ich schweife ab. Wir Kinder –« – »So haben Sie Geschwister?«
»Ja,« antwortete der Detektiv kurz, »wir Kinder lernten von unserem Vater so nebenbei die Taschenspielerkniffe und hatten außerdem von unseren Eltern das Schauspielertalent ererbt. Mein Vater besaß eine wunderbare Kombinationsgabe, und da er bald merkte, daß auch ich eine solche Anlage besaß, gab er sich während aller seiner Freistunden mit mir ab, lehrte mich, wie man nach Systemen richtige Schlüsse ziehen und wie man mit möglichen Erfolgen rechnen muß. Ich hatte darin bald meinen Vater übertroffen.«
»Wie kamen Sie aber darauf, Detektiv zu werden?«
»Well. Ich war ein unbändiger Junge, wollte gern zur See, aber meine Eltern ließen es nicht zu, weil sie aus mir einst etwas Großes zu machen hofften. So lief ich eines Tages davon, fiel aber einem Schornsteinfegermeister in die Hände, der mich zu sich in die Lehre nahm. Doch bald behagte mir das Klettern in den Schornsteinen nicht mehr, und ich lief bei der ersten Gelegenheit wieder davon, kam aber diesmal glücklicherweise auf ein Schiff. Einige Jahre fuhr ich als Matrose, bis ich in einem kleinen Hafen an der Westküste Südamerikas heimlich von Bord floh, um einmal mein Glück an Land zu versuchen. Ich abenteuerte umher, arbeitete bald dieses, bald jenes, aber das, wozu ich mich eignete, fand ich nicht. Da zerbrachen sich einmal die Herren Polizeidirektoren den Kopf über einen rätselhaften Mord, ich erfuhr von der Sache, erkundigte mich über die Einzelheiten, und das, was den Herren unklar blieb, erschien mir so hell wie Sonnenlicht. Ich ersuchte den Polizeipräfekten um eine Audienz, erhielt sie und – mein Glück war gemacht. Der Beamte gab damals zwar meine Weisheit für die seinige aus, aber ich wurde doch als Detektiv engagiert. Später wandte ich mich nach den Vereinigten Staaten, und hier wurde mein Name bald berühmt oder doch bekannt.
»Alles das,« fuhr der Detektiv fort, »was ich einst von meinem Vater erlernt, die Taschenspielerkniffe, die Verstellungskunst und hauptsächlich ein System, nach welchem er mich Schlüsse zu ziehen gelehrt hatte, machten mich zum Detektiven wie geschaffen.
»In kurzer Zeit hatte ich es so weit gebracht, daß ich schon wußte, was meine Kollegen erst ahnten, und daß ich die genauen Umstände kannte, ehe sie nur eine leise Vermutung besaßen. Das fortwährende Spekulieren und Kalkulieren ging mir in Fleisch und Blut über. Es ist merkwürdig, aber ich versichere Sie, ich kann schon auf einige Schritt riechen, ob ein Mensch ein Spitzbube ist oder nicht und zu welcher Klasse von Gaunern er zählt. So hat sich meine Spürnase im Laufe der Zeit ausgebildet. Und was meine Verstellungskunst anbetrifft,« schloß Nick Scharp lächelnd, »so weiß ich fast selbst nicht mehr, wie ich eigentlich aussehe. Der Spiegel zeigt mir immer ein neues Gesicht.«
Er stand auf und hing sich die Brieftasche um.
»Wohin wollen Sie jetzt?«
»Mister Pollok, oder vielmehr Ihre Ordonnanz ablösen, der Bursche raucht sonst alle meine Cigarren auf.«
»Und was haben Sie dann vor?«
Der Detektiv war vor einen Spiegel getreten, zog ein Fläschchen aus der Tasche, befeuchtete sein Taschentuch und rieb sich damit im Gesicht herum.
»Vorläufig muß ich heute abend noch ein Gespräch belauschen. Die Vestalinnen wollen übermorgen einen Ausflug nach Kairo unternehmen, um sich erst die Stadt zu besehen und dann weiter nach Süden gehen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, so soll in Kairo gegen sie der zweite Streich geführt werden. Den Plan dazu muß ich erfahren, um Vorbereitungen zu seiner Vereitelung treffen zu können, wenn ihn die englischen Herren oder Sie nicht zu Schanden machen können; à propos, wissen Sie auch, daß Sie damals, als Sie die Herren in Konstantinopel zur Befreiung der drei Damen veranlaßten, mir einen Strich durch meine Rechnung machten?«
»Ich? Nein! Wie soll ich?«
»Ja, ich hatte etwas anderes vor, hoffte einen Schlupfwinkel der Schufte dadurch ausspionieren zu können. Doch davon heute abend noch! Geben Sie mir ein Stichwort, daß ich zu jeder Zeit der Nacht und unter jeder Verkleidung an Bord kommen kann.«
Der Ingenieur überlegte. Dann sagte er:
»Fragen Sie nach Kapitän Hoffherr, ich werde den Posten am Fallreep darüber instruieren.«
»All right,« erwiderte der Detektiv am Spiegel mit plötzlich veränderter Stimme.
Er wandte sich um, und der Ingenieur hätte schwören können, seine Ordonnanz Georg vor sich zu sehen, so täuschend wußte der Detektiv Aussehen, Stimme, Haltung und die kleinste Bewegung dieses Matrosen nachzuahmen.
»In einer halben Stunde haben Sie Georg wieder,« sagte Nick Scharp, als er dem Ingenieur zum Abschied die Hand schüttelte. »Also bis heute abend.«
Er schritt zur Thür hinaus.
Eine der Hauptstraßen Kairos, der Hauptstadt Egyptens und der Residenz des vom Sultan abhängigen Vizekönigs, ist die Muski.
Sind im Westen der Stadt hauptsächlich die Europäer vertreten, sodaß auch das ganze Viertel ein Aussehen bekommen hat, welches sich von dem einer reichen, deutschen Stadt mit Villen, Wohn- und Geschäftshäusern nicht unterscheidet, so macht das arabische Stadtviertel mit den engen Sackgäßchen, den niedrigen, glatten Lehmhäusern, deren Fenster nach dem innengelegenen Hofe hinausführen, einen noch vollkommen orientalischen Eindruck, die Muski bildet dagegen eine Art Mittelding, um deren Besitz sich Europäer und Eingeborene zu streiten scheinen.
Man kann in ihr die glänzendsten Verkaufsläden finden, Firmen, welche ebenso in Berlin, London und Paris zu lesen sind, besonders große Konfektionsgeschäfte, und dicht neben dem riesigen Glaspalast erhebt sich ein elendes Lehmhüttchen, in dem ein schmieriger Araber gebratene Lebern feilbietet. So wechselt die ganze Straße entlang das Aussehen der Häuserfront.
Ebenso bietet das Leben auf dieser Straße ein bunt zusammengewürfeltes Bild. Elegante Herren, nach modernstem Pariser Schnitt gekleidet, verlassen ihre Comptoirs und eilen in ein in der Nähe befindliches englisches Frühstückslokal, um mit Hast einige geröstete und belegte Brotschnitte hinunterzuschlingen, denn ›Zeit ist Geld‹, und am meisten für englische Geschäftsleute. Mögen sie einen Warentransport nach dem Nordpol zu leiten oder unter dem Aequator ein Geschäft abzuschließen haben, weder Kälte, noch Hitze hindern sie, mit ihren langen Beinen die Wege halb im Laufschritt zurückzulegen, um die Zeit, welche sie sich für Frühstück und Mittagsessen bestimmt haben, mit der Uhr in der Hand, auszunutzen.
Unterwegs werden dle Europäer häufig von schrecklich zerlumpten Arabern angebettelt, wenn die ihren skelettartigen Körper bedeckenden Sachen überhaupt noch als Lumpen bezeichnet werden dürfen. Kaum genügen sie, ihn zu verhüllen. Beine, Schenkel, Arme und Oberkörper sind nackt oder stecken nur in Sachen, welche sich aus Löchern zusammenzusetzen scheinen.
Hier in der Muski ist das Arbeitsfeld des Bettlers.
Er kennt seine Kunden, welche ihm eine kleine Kupfermünze geben, wofür sie den Segen Allahs mit auf den Weg bekommen; er weiß, wann sie eine bestimmte Ecke der Straße passieren, und lauert ihnen dort auf.
Mit wimmernder Stimme streckt er dem Vorbeieilenden die fleischlose Hand mit einer Muschelschale entgegen, murmelt einen langen Segensspruch, das heißt, nur, wenn ein holder Klang an sein Ohr gedrungen ist, und läßt dann die Kupfermünze in irgend einem Versteck seiner Lumpen verschwinden. Bemerkt er einen Fremden, deren es in dem an Merkwürdigkeiten reichen Kairo zahllose giebt – die vielen Hotels geben Zeugnis davon – so eilt er ihm eine Strecke weit nach, ihn mit zudringlichen Bitten und Gebärden belästigend.

Den Kunden, der ihm täglich den Tribut eines Geldstückes entrichtet, begrüßt er mit freundlichem Grinsen; er behandelt ihn mit einer Art Vertraulichkeit und erweist ihm Dienste, von denen der Betreffende oft keine Ahnung hat. Er sorgt dafür, daß der freigebige Herr nicht von anderen Bettlern belästigt wird; er hält durch seinen Befehl die zudringlichen Eseljungen, den Schrecken des Orients, von ihm ab, er wacht über ihn, wie es der beste Kriminalpolizist nicht vermöchte.
Sieht dies nicht fast aus, als wäre der zerlumpte Mann mehr als nur ein Bettler, als besäße er irgend eine geheime Macht? Es ist auch wirklich so, wie er denn auch meistens nicht arm ist.
Die orientalischen Bettler halten in jeder Stadt fest zusammen; sie bilden eine Gilde für sich und dulden keinen Fremdling innerhalb ihres Gebietes. Es bestehen Gesetze unter ihnen, die sich vom Vater auf den Sohn vererben und die für unumstößlich gelten. Eins davon ist, daß der Franke, der einem vom Bettlerhandwerk zinsmäßig einen gewissen Beitrag steuert, von den anderen Vertretern desselben nicht belästigt werden darf, und ferner, daß die Eseljungen unter ihrem Befehl stehen.
Der weitgereiste Leser, welcher vielleicht einmal den Orient besucht hat, kann davon erzählen, was für eine Plage diese letzteren für den Fremden werden können. Hundertmal kann er ihnen erklären, daß er nicht reiten will, selbst im fließendsten Arabisch; wie die Schmeißfliegen umschwärmen ihn die Unholde und geben nicht eher nach, als bis er die Beine über den Rücken eines ihrer Tiere gespreizt hat. Er wundert sich vielleicht, daß dagegen andere Herren vollkommen von den Anerbietungen der Treiber verschont bleiben. Tritt er aus dem Haus, so versammeln sich wohl auch um jene sofort ein Dutzend Jungen, aber er braucht nur mit dem Kopfe zu schütteln, und sofort führen sie die Esel wieder auf ihre Station zurück.
Alles dies bewirken die elenden Bettler, welche die Straßenpassanten beobachten, sie auf die Mildthätigkeit ihres Herzens prüfen und eine Macht ausüben, von der nur sehr wenige Fremde eine Ahnung besitzen.
Eine Geschichte möge das Gesagte bezeugen, welche auf diese Art von Leuten ein eigentümliches, aber gutes Licht wirft.
Ein junger Deutscher war in Aden, einer Hafenstadt Arabiens, in einem österreichischen Geschäftshaus engagiert. Jeden Abend, wenn er seinem Hause zuging, sprach ihn ein Krüppel, der an seine Beinstümpfe Holzschalen geschnallt hatte und sich so fortbewegte, um eine Gabe an, und der gutherzige Deutsche schenkte ihm stets einen halben Piaster, das sind zehn Pfennige. Die Firma des jungen Mannes machte Bankerott, wodurch er nicht nur beschäftigungslos wurde, sondern auch sein ganzes, in dem Geschäft stehendes Geld verlor, sodaß er in große Not geriet. Sein erstes war, daß er seine bisherige Wohnung aufgab und sich ein einfaches Zimmer mietete, sodaß ihn nun sein Weg nicht mehr an dem alten Bettler vorbeiführte. Alle Versuche, ein neues Engagement zu bekommen, schlugen fehl; der junge Deutsche geriet in die bitterste Armut, und sein einziger Wunsch war nur noch, in die Heimat zurückkehren zu können, aber niemand fand sich, der ihm das nötige Geld leihen wollte.
Eines Abends wandelte er niedergeschlagen durch die Straßen Bagdads und kam zufällig an jener Ecke vorbei, an welcher der alte Bettler stand. Dieser sprach ihn sofort an und fragte ihn, warum er nicht mehr hier vorüberginge und warum er so betrübt aussehe. Der Deutsche fühlte sich glücklich, daß wenigstens eine menschliche Seele Mitleid mit seiner Lage hatte, und teilte dem Bettler sein Unglück mit, auch, daß ihm niemand das Geld zur Heimreise leihen wollte. Der Krüppel fragte ihn, ob er ihn diese Nacht besuchen wolle, er wüßte vielleicht Rat, und der junge Mann willigte, obgleich innerlich über den Bettler lächelnd, weil dieser wahrscheinlich bei seiner Bedürfnislosigkeit nur an einige Piaster dachte, ein. Er ging bei Nachtzeit nach der beschriebenen, armseligen Wohnung des alten Mannes, aber wie war er erstaunt, als dieser nach einigen Begrüßungsreden in einer Ecke der Hütte einen Stein am Boden lüftete, einen schweren Beutel hervorhob und ihn mit den Worten auf den Tisch setzte:
»Wieviel hundert Piaster brauchst du zur Reise?«
Er mußte den Sprachlosen dazu nötigen, ihm die Summe zu nennen.
»In den zwei Jahren habe ich von dir nach und nach dreihundertsiebzehn Piaster erhalten. Ich hielt dich für einen reichen Mann, nun aber gebe ich sie dir zurück, und außerdem borge ich dir noch das übrige, daß du in dein Land kommen kannst.«
Der Deutsche brauchte zweihundert Mark, also zweitausend Piaster, und, ohne Dank annehmen zu wollen, zählte sie ihm der Bettler auf.
Das erste, was der deutsche Kaufmann that, als er wieder in bessere Verhältnisse kam, war, daß er seinem Retter die Summe mit Zinsen wieder zukommen ließ.
Von einem großen, mit Rasen und Baumanpflanzungen geschmückten Platz, der mit stattlichen Gebäuden eingerahmt ist, führt die Muski ab. Gehen wir diese entlang und lassen vorläufig das bunte Gewühl von Italienern, Griechen, Spaniern in ihren Trachten, Deutschen, Engländern und Franzosen in moderner Kleidung, Türken und Arabern in orientalischen Gewändern, unbeachtet, lassen wir die Eseljungen ihre Tiere mit dicken Beamten, verhüllten Frauen, die rittlings im Sattel sitzen, an uns vorbeieilen, und biegen wir in das dritte Gäßchen ein, welches sich zur rechten Hand von der Muski abzweigt.
Es macht einen unangenehmen Eindruck auf den Passanten, dieses Gäßchen. Anfangs fällt es sehr steil von der Muski ab. Der Boden ist furchtbar holprig, und die hohen, schmutzigen Häuserwände rücken so nahe aneinander, daß kaum eine Equipage zwischen ihnen durch kann.
Es ist eine Sackgasse; ein Haus versperrt schließlich dem Wanderer den Weg.
Durch einen breiten Thorweg gelangt man in einen Garten, doch nein, in ein Paradies, welches hierhergezaubert worden zu sein scheint. Lange Promenaden, von Palmen beschattet, schattige Gänge, durch Bäume und Büsche gebildet, die sonst nur in Gewächshäusern zu sehen sind, dunkle Lauben, von Mandel-, Apfelsinen- und Feigenbäumen überschattet, bieten sich deinem entzückten Auge dar.
Dazu paßt auch der palastartige Bau, der sich seitwärts erhebt. Ein einziger Blick in den Treppenflur lehrt schon, wie prächtig die inneren Zimmer ausgestattet sein mögen. Die Stufen sind mit kostbaren Teppichen belegt; zu den Seiten stehen Marmorfigurcn, Göttergestalten darstellend, und überall, selbst auf diesem Flur, sind Kronleuchter und geschmackvolle Ampeln angebracht.
Ein Herr im Salonauzug erscheint, das heißt, in Frack und weißem Schlips, und spricht den Besucher mit einer höflichen Verbeugung an.
Der versteht ihn nicht und schüttelt also den Kopf.
Sofort wechselt jener die Sprache, er fragt englisch, französisch, italienisch, spanisch und so weiter, endlich deutsch:
»Was wünschen Sie zu bestellen, mein Herr?«
Was, das ist ein Kellner? Gut! Man fordert eine halbe Flasche griechischen Rotweins, das ist das billigste, was man hier erhalten kann.
Bald erscheint der befrackte Geist wieder und bringt auf silberner Platte die Flasche in ebenfalls silbernem Eisbehälter, und ein feingeschliffenes Glas, die Rechnung wird auf ebenfalls silbernem Teller in Gestalt einer kleinen, kopierten Karte überreicht. Ein tiefer Griff in den Geldbeutel ist zur Begleichung derselben notig. Das ist das Hotel du Nil, das feinste Absteigequartier für Reisende in Kairo.
Freilich kann ein Kaiser, ein König, ein Herzog oder ein Fürst kurz zuvor auf demselben Platze gesessen haben. Es ist nicht unmöglich, daß an eben dieser Stelle Kronprinz Rudolf an seine Mutter, die Kaiserin von Oesterreich geschrieben hat, oder unser Moltke an seine Braut.
Ein einfach gekleideter Mann, ohne Kragen, das wollene Hemd auf der Brust nicht einmal zugeknöpft, geht sinnend im Garten auf und ab und schlägt dabei mit einem Stöckchen den hochaufgeschossenen Grashalmen die Köpfe ab. Vielleicht bedarf es, wie er jetzt die Pflänzchen köpft, nur seines Wortes, und zwei mächtige Völker erheben sich gegeneinander, zum Kampfe gerüstet, und Schmerzgeheul und Trauerklagen erfüllen die Welt.
In der Tat, wohl kein Fremdenbuch der Welt kann eine solche Fülle von berühmten und hochklingenden Namen aufweisen, wie das Hotel du Nil in Kairo, jener Stadt, die von ihren Bewunderern das orientalische Paris genannt wird.
Vor dem Eingangstor drängen sich eine ungewöhnlich große Anzahl Eseljungen, ihre Tiere am Zügel haltend, die teils Herren-, teils Damensättel tragen. Fast scheint es, als ob alle Gäste sich Esel bestellt hätten, in solcher Menge sind diese vertreten.
Zwischen ihnen durch drängen sich Herren, die sich entweder mit den Treibern in einem sonderbaren Kauderwelsch unterhalten oder sich durch scherzhafte Bemerkungen über die Esel die Zeit bis zum Abreiten vertreiben.
»Ist der Esel auch gut?« fragt einer der Herren einen Jungen, denn diese Treiber, fortwährend mit Reisenden verkehrend, verstehen meist etwas von den modernen Sprachen.

»Sehr gut, Effendi,« entgegnete der Bursche, »nickt mit die Kopf.«
Das soll heißen, er trägt den Kopf hoch und bewegt ihn wie ein edles Roß.
»Nickt er auch mit die Schwanz?« fragte der erste Sprecher lachend weiter.
»Nickt mit die Schwanz,« beteuerte der Junge. – »Beißt nicht?« – »Nie nicht beißen.« – »Schlägt nicht aus?« – »Nie nicht ausschlagen thut.« – »Geht nicht durch?« forschte der beharrliche Frager weiter.
Der Treiber versteht diesen Ausdruck nicht, aber er macht eine abwehrende Bewegung.
»Mein Esel, bester Esel, wie ein Lamm,« sagt er.
»Dann nehme ich ihn auch nicht,« meint der Herr und dreht sich phlegmatisch um, nach einem recht störrisch aussehenden Tiere suchend.
»Halloh, Hastings,« rief dieser Fremde plötzlich, als er einen Herrn sah, der sich eben mit der ganzen Wucht seines riesigen Körpers auf einen sehr starken Esel legte, als wolle er probieren, ob derselbe ihn tragen könnte. »Halloh! Brechen Sie dem Tiere nicht das Kreuz! Nehmen Sie doch lieber zwei Esel.«
»Kinderspielzeug!« antwortete der Gefoppte, der, wie auch die anderen Herren zur Besatzung des ›Amor‹ gehörte, mit mürrischer Miene.
Die Vestalinnen wohnten bereits seit zwei Tagen im Hotel du Nil und hatten die Zeit fleißig dazu benutzt, sich alle Merkwürdigkeiten der ägyptischen Hauptstadt anzusehen, und zwar diesmal in Begleitung der englischen Herren, welche in demselben Hotel logierten.
Es waren zuerst Schwierigkeiten entstanden wegen der befreiten Mädchen, welche nicht stets mit herumgeschleppt werden sollten, bis Johanna vorgeschlagen hatte, man sollte den Kapitän des ›Blitz‹ fragen, ob er vielleicht mit seiner zahlreichen Mannschaft über die Sicherheit der Mädchen wachen wolle.
Gedacht, gethan, Miß Ellen hatte dem Ingenieur geschrieben und sofort eine zusagende Antwort erhalten. Noch an demselben Tage verließ sein Schiff den alten Ankerplatz im Hafen und legte dicht neben der ›Vesta‹ an.
»Bleiben Sie so lange aus, wie Sie wollen,« hatte Felix Hoffmann zu der Kapitänin gesagt, »und Sie werden bei Ihrer Rückkehr kein Haar auf den Häuptern Ihrer Schützlinge durch irgend eine menschliche Macht gekrümmt finden. Trauen Sie meinem Wort als dem eines Ehrenmannes.«
Völlig beruhigt verließ Ellen in Begleitung ihrer Gefährtinnen Alexandrien, die Mädchen unter dem Schutze des deutschen Ingenieurs und seiner Matrosen zurücklassend, nur Sulima und Yamyhla nahm sie mit, erstere, um sie in ihre Heimat zu bringen und durch ihre Aussage den Anstifter des räuberischen Ueberfalles zu entlarven, letztere, weil alle Vestalinnen ein ganz besonderes Wohlgefallen an der Amazone fanden, welche bei jeder Schiffsarbeit mit einem Eifer und einer Geschicklichkeit ans Werk ging, welche die Damen immer wieder in Erstaunen setzten. Ueberhaupt betrachteten sie das Mädchen mehr als Genossin, denn als eine der Aufsicht bedürfende Sklavin.
Der ›Amor‹ hatte zur anderen Seite des ›Blitz‹ beigelegt, und Lord Harrlington hatte dem Ingenieur die Brigg ebenfalls zur Aufsicht übergeben.
Die alten Moscheen der einstigen Herrscher Ägyptens, die Wasserkünste, die berühmten Mameluckengräber, die Andenken, welche sich an den Aufenthalt der Juden in Ägypten knüpfen, alles war schon besehen, es galt nur noch, den Pyramiden einen Besuch abzustatten, dann sollte dem heißen Wunsche Sulimas, sie nach der Heimat zu bringen, willfahren werden.
Man sah es dem armen Mädchen an, daß es bald vor Sehnsucht verging, aber zu rücksichtsvoll war, um durch Bitten ihre Retterinnen zur Beschleunigung des geplanten Vorhabens anzutreiben.
Jetzt harrten unten die bestellten Esel, um die Herren und Damen nach Giseh, wo die Pyramiden und die kolossale Sphinx sich erheben, zu bringen. ...
In einem Zimmer des Hotels fand kurz vor dem Abritt noch eine Unterhaltung zwischen Ellen, Johanna und Miß Murray statt, während Sulima und Yamyhla, ebenso wie die übrigen Damen, in helle, bequeme, aber dennoch geschmackvolle Toiletten gekleidet, am Fenster standen und sich über das Treiben der Herren zwischen den Eseln freuten.
Soeben hatte Miß Petersen den beiden Damen einen laugen Artikel aus einer englischen Zeitung vorgelesen, deren es in Kairo mehrere giebt.
»Sieht es nicht gerade aus,« setzte Ellen am Schluß hinzu, und ihr schönes Gesicht strahlte von innigem Entzücken, »als hätte der Schreiber dieses uns ganz in der Nähe beobachtet?«
»Fast scheint es so,« entgegnete Miß Murray, auch sie war ungemein erfreut. »Alles, was wir gethan haben, wie Sie dem Mädchenhändler erst die Pistole aus der Hand schossen, dann sein Ohr trafen, wie ich das Kommando gab, das Steuerrad der ›Undine‹ zu zerschmettern – alles ist so geschildert, wie es geschehen ist.«
»Merkwürdig ist es auch,« fuhr Ellen fort, »wie genau der Name jeder Vestalin genannt ist, die am Geschütz stand, die im Boot war oder die die Bootsbesatzung mit Revolvern bedrohte. Das Verhalten des Türken, des Kapitäns, unser eigenes, alles und alles so, als hätte sich irgendwo ein Reporter versteckt gehalten und unser Thun in seinem Buche notiert. Wer mag dies nur gethan haben? Eine unserer Gefährtinnen?«
»Das kann ich nicht glauben,« sagte Jessy Murray bestimmt.
»Dann weiß ich es wirklich nicht. Was meinen Sie dazu, liebe Jane?«
»Ohne allen Zweifel hat den Artikel einer der Engländer in die Zeitung gesetzt,« entgegnete Johanna.
»Nicht möglich,« riefen beide Damen zugleich aus.
»Der ›Amor‹ war nicht in Sicht, und derjenige, der dieses aufgesetzt hat, muß unbedingt Augenzeuge des Vorfalles gewesen sein.«
»Und doch ist es nicht so unmöglich,« meinte eben Johanna lächelnd, »daß uns dabei die Herren beobachtet haben. Sie entsinnen sich, daß der ›Amor‹ eben in Sicht kam. als wir die Sklavinnen an Bord nahmen. Den näheren Anblick dieser Mädchen wollten sich die jungen Herren natürlich nicht entgehen lassen. Mir fiel übrigens gleich auf, daß sie uns zwar beglückwünschten und sehr viele Schmeicheleien sagten, aber ihr Erstaunen über unsere That war doch nicht das rechte. Zeigten es einige doch, so machte es einen erkünstelten Eindruck.
»Aber ich bitte Sie,« unterbrach Jessy die Sprecherin, »wie sollen sie uns beobachtet haben, wenn wir den ›Amor‹ gar nicht sehen konnten!«
»Ah, doch! Wissen Sie noch, daß nicht so sehr weit von uns das letzte Inselchen des griechischen Archipels lag!« – »Ah, in der That!«
»Nun, und eben, als das Werk vollendet war, kam der ›Amor‹ hinter diesem Inselchen vorgedampft, und die Herren beglückwünschten uns,« schloß Johanna.
»Das wäre allerdings die einzige Lösung des Rätsels. Doch sei es, wie es wolle,« meinte Ellen und stand auf, um vor dem Spiegel ihr Kleid zu ordnen. »Böse bin ich dem Betreffenden jedenfalls nicht, daß er so indiskret gewesen ist, das Geschehene in den Zeitungen zu veröffentlichen. Im Gegenteil, ich bin sehr zufrieden damit.«
»Das kommt doch auch noch in andere Zeitungen?« fragte Jessy.
»Natürlich! Alle Redaktionen der Welt werden sich um die Ehre reihen, ihren Leserkreis zuerst mit dieser Neuigkeit und unseren Namen bekannt zu machen.«
»Bravo, bravo!« rief Jessy entzückt und klatschte in die Hände. »Es ist schade, daß Sir Williams nicht nahe genug war, sonst hätte er uns mit seinem unvermeidlichen Photographenapparat aufgenommen.«
»Ich weiß nicht,« meinte Johanna, »mir gefällt es nicht besonders, daß die Befreiung der achtzehn Mädchen durch uns so freimütig ausgerufen wird.«
»Warum nicht?« fragten die beiden Damen erstannt. »Wir haben doch kein Unrecht begangen, sondern vielmehr eine sehr lobenswerte Handlnng ausgeführt!«
»Gewiß, das haben wir! Aber immerhin, der Schreiber hätte wenigstens warten können, bis wir Sulima sicher den Ihren ausgeliefert haben, wir selbst wieder an Bord der ›Vesta‹ sind und Alexandrien hinter uns haben.«
»Haben Sie etwa Angst, daß wir für unsere Kühnheit von jenem elenden Mädchenhändler bestraft werden könnten?« fragte Jessy in etwas spöttischem Tone.
Johanna richtete sich hoch auf und schaute die Fragerin mit einem festen Blicke an:
»Sie sollten doch wissen, Miß Murray, daß Johanna Lind keine Furcht kennt.«
»Verzeihen Sie mir,« bat sofort Jessy und reichte ihr die Hand, »so war dies nicht gemeint. Aber warum sollte diese schnelle Veröffentlichung eine Gefahr für uns bedeuten?«
Johanna zuckte die Achseln.
»Eine Ahnung sagt es mir. Wir sind in einem Lande, das unter der Oberhoheit des Sultans steht. Die Türkei darf den Sklavenhandel zwar nicht dulden, dafür haben die europäischen Mächte gesorgt, aber sie leistet ihm, und ganz besonders dem Mädchenhandel, heimlich Vorschub.«
»Nun, laßt sie kommen!« meinte Ellen. »Wir werden schon mit ihnen fertig werden. Aber auf nun, meine Damen, wir wollen hinunter! Kommt, Sulima und Yamyhla!«
»Ja, auf, denn schon wiehern vor der Thür die Rosse,« lachte Jessy, als eben ein Esel ein langgezogenes Y–y–ah ausstieß, welches seine Brüder beantworteten. Freudig wurden die Damen unten begrüßt. Schon lange hatte man auf ihre Ankunft gewartet, um den Ritt nach den Pyramiden beginnen zu können.
Jede hatte sich einen Esel ausgesucht, einige weitere Tiere wurden mit Lebensmitteln bepackt, um nach Befriedigung der Augen auch dem Verlangen des Magens genügen zu können. Die mit diesen Schätzen beladenen Tiere und deren Treiber kamen unter die besondere Aufsicht des ebenfalls mitreitenden Hannibal, denn dieser weitgereiste Mann gab sich den Anschein, als ob das Merkwürdigste der Welt nicht mehr sein Interesse erregen könne, nur eine gute Mahlzeit und ein gutes Glas Wein lockten ihm, dem verwöhnten Feinschmecker, ein wohlgefälliges Lächeln ab. So ritt er jetzt hinter den den Beschluß bildenden Eseln mit den Vorräten her und verwandte kein Auge von ihnen. Erst als Yamyhla ihr Tier neben das seinige lenkte, wurde seine Aufmerksamkeit durch die Unterhaltung in Anspruch genommen, die beide in jenen tiefen Gaumenlauten ihres Volkes führten.
Bald hatten sich Gruppen unter den Beteiligten gebildet, wie Freundschaft, Neigung oder Gelegenheit es mit sich brachten. Entweder ritt eine Dame neben einem Herrn oder zwei Herren nebeneinander, denn es waren ja mehr Herren als Damen vertreten.
Williams, der ein entsetzlich mageres, struppiges und steifbeiniges Tier ritt, das wahre Zerrbild eines Esels, hatte dieses sofort an die Seite von Miß Thomson gelenkt, denn bei keiner Gelegenheit unterließ er es, dieser Dame Beweise seiner Verehrung für sie zu geben, allerdings immer in der ihm eigentümlichen, drastischen Art.
»Sir Williams,« begann sie, »warum haben Sie sich gerade das häßlichste Tier ausgesucht? Sie als englischer Baronet sollten doch mehr Geschmack entwickeln. Ich schäme mich schon, wenn dieses Ungeheuer sich an meiner Seite befindet.«
»Urteilen Sie nicht vorschnell,« erklärte Charles mit einer ernsthaften Miene, die ihm gar nicht stehen wollte, »die unscheinbarste Schale enthält oft den süßesten Kern. Sehen Sie zum Beispiel einmal mich an. Auch ich bin nur ein kleiner, bescheidener, unansehnlicher Mensch, wenn Sie aber in mein Inneres sehen könnten, ich sage Ihnen, Sie würden staunen, was da für Schätze verborgen liegen. Nicht wahr, mein Tierchen?« fragte er seinen Esel.
»Y–y–ah,« antwortete dieser.
»Sehen Sie wohl, er bejaht es.«
Miß Thomson lachte hell auf.
»Was würde ich denn da zu sehen bekommen?«
»Vor allen Dingen, in einem großen, goldenen Rahmen, Ihr Bild, und dann – –«
»Und was dann?« – »Und dann noch einmal Ihr Bild.«

»Ja, fragen Sie meinen Esel. Nichtwahr?« – »Y–y–ah,« brüllte dieser wieder.
»Was ist denn das nur mit Ihrem Esel, der antwortet wohl auf Kommando?«
»Er ist ein sehr verständiger Esel, fast ebenso klug wie ich und versteht jedes Wort. Ist das wahr oder nicht?« – »Y–y–ah.«
»Sehen Sie wohl, wie unrecht Sie ihm vorhin gethan haben?«
Auf diese Weise schwatzte er unaufhaltsam fort und ließ seinen Esel nach jeder kühnen Behauptung bejahend brüllen. Er hatte das Tier nur genommen, weil ihm sein Treiber verraten hatte, daß es, wenn man ihm stark die Schenkel gab, schrie. Miß Thomson kam aus dem Lachen nicht heraus.
Unterdessen fand an der Spitze des Zuges ein anderes Gespräch zwischen Lord Harrlington und Ellen statt, hinter denen Johanna und Sulima in Begleitung einiger Herren, darunter Lord Hastings, ritten.
»Sie gestehen also,« fragte Ellen, »daß Sie es waren, der die Ueberlistung des Mädchenhändlers durch uns hier in der englischen Zeitung geschildert hat?«
»Ich war es. Wir beobachteten Ihre Heldenthat von dem Inselchen aus, von dem die ›Vesta‹ nicht weit entfernt lag. Zürnen Sie mir, weil ich nicht verschwiegen gewesen bin? Ich glaubte, Ihnen und allen Vestalinnen damit eine Freude zu bereiten.«
»Das haben Sie auch, und wir sind Ihnen sogar dankbar dafür.«
»Dann ist mir eine Zentnerlast vom Herzen genommen,« rief Harrlington freudig aus. »Ich machte mir zuletzt doch Vorwürfe darüber, ohne Ihre Einwilligung gehandelt zu haben.«
»Wir sehnen uns förmlich darnach, jeden Tag ein ähnliches Abenteuer zu bestehen,« begann Ellen nach einer kleinen Pause wieder. »Man fühlt sich als ein anderer Mensch, kann man so seine Kraft gegen die eines anderen sehen, durch seinen Geist einen verderblichen Plan zu nichte machen, und dabei einen guten Zweck im Auge haben. Es ist dies doch etwas anderes, als wenn man bei Wetten nur aus Ehrgeiz seine Geschicklichkeit zeigt sein Leben aufs Spiel setzt.«
»Gewiß,« bestätigte Harrlington, »und besonders bei uns, denen der wagehalsige Sport zur Liebhaberei geworden ist, wird viel gegen die menschliche Natur gefrevelt. Doch was geht dort vor? Eine Menschenmenge hat sich angesammelt und versperrt uns den Weg.«
An einer Kreuzung von vier Straßen staute sich ein dichter Knäuel von Menschen, hauptsächlich Mohamedanern, die querlaufende Straße war frei gelassen worden, als ob auf ihr etwas erwartet würde; aber der Weg, auf dem die Gesellschaft kam, war vollständig für den Verkehr gesperrt, sodaß bereits eine Unmenge von Passanten, Reitern und Wagen harrte, bis der Durchgang wieder frei würde.
»Was ist hier los? Wird jemand erwartet?« fragte Ellen ihren Eseltreiber.
Dieser, ein verschmitzt aussehender Bursche, erkundigte sich bei den Umstehenden und sagte dann:
»Ja, Miß, der General Raham-el-Haschir, der ruhmvolle Sieger über den Mahdi, wird gleich hier vorbeikommen.«
»Raham-el-Haschir, der immer so ruhmvoll vor dem Mahdi ausgerissen ist! Was kümmert uns der?«
»Es war Allahs Wille.«
»Können wir denn nicht durchkommen? Ich habe keine Lust, hier einige Stunden zu warten; lieber wollen wir umkehren,« sagte Ellen unwillig.
Aber auch dazu war keine Möglichkeit vorhanden, denn hinter der Gesellschaft hatten sich bereits wieder andere Reiter und Equipagen angesammelt, und als jetzt die zuerst Stehenden von einigen ägyptischen Soldaten mit Stockhieben zurückgedrängt wurden, wurde jeder einzelne der Gesellschaft derart eingepreßt, daß er weder vor- noch rückwärts konnte.
»Ich werde schon sehen, ob ich Ihnen die Passage nicht verschaffen kann,« sagte Ellens Bursche mit pfiffigem Lächeln. »Den Schlauen liebt Allah.«
Er ergriff sein Tier am Zügel und versuchte, es ein wenig vorwärts zu drängen.
Fast schien es, als ob die vor ihm stehenden Araber seine Absicht unterstützen wollten, denn willig drückten sie sich zur Seite, sodaß eine kleine Lücke entstand, in die der Bursche schnell den Esel hineinschob.
Lord Harrlington, der durch einen fremden Reiter von Ellen getrennt worden war, versuchte das gleiche Manöver, aber wie eine Mauer standen vor ihm die Muhamedaner – sie wankten und wichen nicht, sondern murrten vielmehr, daß ein Franke, ein verfluchter Ungläubiger, sie zur Seite stoßen wollte.
»Führe meinen Esel auch durch,« herrschte er den Treiber seines Tieres an. Eine unnennbare Angst erfaßte ihn, als er sah, wie sich Miß Petersen weiter und weiter von ihm entfernte, immer der diesseitigen Grenze der Menschenmenge, also der offenen Straße zu.
»Es geht nicht, Effendi,« entgegnete der Eseljunge, der sich wirklich bemüht hatte, die Leute zum Platzgeben zu bewegen.
Schon hatte Ellen die offene Straße erreicht und ritt hinüber, um abermals ins Gewühl einzudringen.
»Um Gottes willen, Miß Petersen,« schrie Harrlington, »bleiben Sie, daß wir Sie wenigstens nicht aus den Augen verlieren.«
Aber sein Ruf ward schon nicht mehr gehört.
Die Menge brach plötzlich in lauten Jubel aus. Vorreiter kamen gesprengt und fegten die Straßen leer, ein unabsehbarer Haufe von Kindern drängte sich plötzlich heran, und Janitscharenmusik ward in der Ferne hörbar.

Jetzt war es zu spät, der Reiterin zu folgen. Sie war auf der anderen Seite eingelassen worden und hatte sich den Augen des Lords entzogen.
Eine innere Angst, die er sich selbst nicht zu deuten wußte, wühlte in ihm. Ratlos sah er um sich und bemerkte, daß auch Johanna Lind über das Verschwinden Ellens sich benuruhigt fühlte. Aber dieses Mädchen trat weit energischer auf, als er.
Ein Blick überzeugte sie, daß jetzt kein Durchkommen mehr möglich sei.
»Kannst du mich auf einem anderen, freien Weg nach der Seite drüben bringen?« fragte sie hastig den Burschen.
»Wohl, Miß, in fünf Minuten.«
»Dann thue es, aber schnell. Für jede Minute weniger bekommst du ein Geldstück mehr.«
»Es geht nicht, Miß, und wenn ich alle Schätze des Sultans dafür erhielte.«
In der That, die Esel standen ganz eingezwängt, sie konnten keinen Schritt machen.
Ohne ein Wort weiter zu sagen, sprang Johanna aus dem Sattel, ergriff das Tier mit der einen Hand beim Zügel, drückte ihm mit der anderen die Nüstern zu und drängte es mit unwiderstehlicher Gewalt zurück.
Ein unwilliges Rufen erhob sich zu Seiten des Mädchens, aber dieses ließ sich nicht in seinem Vorhaben stören; weiter und weiter schob Johanna den Esel zurück, alles rücksichtslos zur Seite stoßend.
Jetzt kam Leben in die Menge, hier und da entstand etwas Raum. Johanna kam an Sulimas Tier vorüber, faßte dessen Zügel und drängte es gleichermaßen rückwärts.
»Mir nach,« rief sie mit heller Stimme, die selbst noch das Jubeln der Menge und die Musik der anrückenden Soldaten übertönte.
Nur sehr wenige der übrigen Herren und Damen hatten das Verschwinden Ellens auf der anderen Seite überhaupt wahrgenommen; aber als jetzt Harrlington, Williams, Miß Murray und andere dem Beispiele Johannas folgten, schlossen sich ihnen alle anderen Glieder der Gesellschaft an.
Kaum hatte Johanna den offenen Platz erreicht, so setzte sie ihren Esel in Galopp und sprengte dem voranrennenden Jungen nach, der sie durch einige Gäßchen führte, ihnen folgten die anderen, welche inzwischen den Grund zu dieser Eile erfuhren und mehr oder minder über den Zwischenfall bestürzt waren.
In weniger als fünf Minuten stand die Gesellschaft auf der anderen Seite der Straße, aber wie man auch umherspäte, von Ellen war nichts zu sehen. Sir Hendricks stellte sich sogar aufrecht in den Sattel – auch er schüttelte verneinend den Kopf. Miß Petersen war nicht unter den Reitern oder Reiterinnen zu erblicken, welche noch immer wie eingekeilt das Passieren des Regiments abwarten mußten.
Die Zuschauer wurden gefragt, ob sie nicht eine Dame zu Esel gesehen hatten, welche von der gegenüberliegenden Seite nach dieser geritten sei. Ellens Aussehen wurde ganz genau beschrieben, aber die Gefragten antworteten entweder gar nicht, denn sie schauten dem kriegerischen Schauspiel zu, oder sie stellten neugierige Gegenfragen.
Nur einer der Araber bejahte und sagte, er habe gesehen, daß eine solche Dame vor einigen Minuten diese Straße dort hinaufgeritten ist.
Er wies dabei auf eine nach Westen führende Chaussee.
»Dann schnell ihr nach,« rief Lord Harrlington. »Was mag sie nur veranlaßt haben, nicht wenigstens auf uns zu warten?«
Er wandte den Esel der angegebenen Richtung zu, und seine Gefährten folgten ihm.
»Halt,« ließ sich da Johannas durchdringende Stimme vernehmen, »es ist nicht wahr. Nie glaube ich, daß Miß Petersen ohne weiteres allein fortgeritten ist, ohne uns wenigstens Nachricht zu geben.«
In diesem Augenblicke, trat ein Herr, allem Anschein nach ein Engländer, an Harrlington heran und fragte ihn:
»Sie suchen eine Dame, die einen Esel ritt?« – »Ja,« entgegnete der Lord hastig.«
»Trug Sie ein hellgraues Kleid mit roter Schärpe?« – »Sie war es, wo haben Sie die Dame gesehen?«
»Als sie diese Seite erreichte, trat ihr sofort ein egyptischer Offizier entgegen, der sie erst sehr höflich begrüßte, dann ihr Tier beim Zügel faßte und es durch die Menschenmenge führte, wobei ihm arabische Soldaten Platz verschafften.«
»Und was dann?« fragte Harrlington atemlos. »Ließ die Dame das ruhig geschehen?«
»Anfangs, ja. Aber ich bemerkte dann, wie die Dame, als der freie Platz erreicht worden war, dem auf sie einredenden Offizier, der sehr gebieterisch aufzutreten schien, heftig entgegnete, sich mehrmals umwandte und nach der anderen Seite hinüberwinkte.«
»Was geschah weiter?«
»Schließlich ritten alle davon, und es fiel mir auf, daß die Soldaten die Dame zwischen sich nahmen.«
»Haben Sie nicht gehört, was gesprochen wurde?«
»Der Offizier sprach sehr leise, die Dame dagegen laut, aber französisch, was ich leider nicht verstehe.«
»Können Sie sich nicht erklären, was alles das zu bedeuten haben mag?«
»Offen gestanden, es glich fast einer Verhaftung.«
»Verhaftet!« riefen alle wie aus einem Munde.
»Meine Ahnung!« flüsterte Johanna und sann einen Augenblick nach. Dann rief sie laut:
»So folgen Sie mir! Ich kenne den Weg nach der Polizeipräfektur. Oder nein, ich bitte Sie alle, sich sofort nach dem Hotel du Nil zu begeben und dort auf Bescheid zu warten. Miß Murray, Lord Harrlington und Sie, Sir Williams, begleiten mich, wir sind genug, um als Zeugen auftreten zu können, Lord Hastings, ich mache Sie für die Sicherheit Sulimas verantwortlich.«
Das Mädchen traf diese Anordnungen so energisch, daß sich alle sofort und ohne Widerrede ihm fügten.
Die Straße war jetzt wieder frei, sodaß die Gesellschaft, von trüben Gedanken gepeinigt, den kurzen Weg nach dem Hotel zurückritt, während Johanna in Begleitung der von ihr genannten Personen so schnell als möglich dem Polizeigebäude zustrebte.
»Die Sache ist mir unerklärlich,« sagte Harrlington unterwegs zu Johanna, »Miß Petersen verhaftet!«
»Es wird nicht so schlimm sein, wenn überhaupt etwas Wahres daran ist, was ich noch selber bezweifle. Im schlimmsten Falle bedeutet es eine Vernehmung wegen jener Befreiung der Sklavinnen, die Sie, Mylord, so voreilig veröffentlicht haben.«
»So tadeln Sie dieses von mir?«
»Durchaus; doch da sind wir vor dem Polizeigebäude, wir werden gleich alles Nähere erfahren.«
Die vier stiegen ab, gaben die Zügel den Jungen zu halten und betraten den Vorhof des Gebäudes, auf dem egyptische Soldaten herumlungerten.
In Egypten giebt es keine Schutzleute, sondern das Militär sorgt für die öffentliche Sicherheit. Die Kriminalpolizei dagegen liegt in den Händen der Engländer, welche Detektive unterhalten.
An den Pfosten des Thores lehnte ein Soldat im Drillichanzug und rauchte phlegmatisch eine Cigarette. Es war der erste, an welchem Lord Harrlington, der vorausschritt, vorbeikam.
»Wo ist der Polizeidirektor von Kairo zu sprechen?« fragte er den jungen Burschen auf gut Glück in englisch, denn dieser sah wie ein Europäer, etwa wie ein Südösterreicher aus, wie überhaupt in der egyptischen Armee Leute aus aller Herren Ländern, meist Abenteurer, dienen.
»In seinem Zimmer,« entgegnete der junge Mensch, ebenfalls auf englisch, aber mit stark italienischem Accent, »was wollen Sie von ihm, Signor?«
»Ihn sprechen. Wie meldet man sich bei ihm an? Aber sofort! Wir haben durchaus keine Zeit zu verlieren.«
»Was wollen Sie von ihm?« fragte der neugierige Bursche weiter, ohne seine bequeme Stellung zu verändern. »Halte uns nicht weiter auf, das rate ich dir,« entgegnete Williams in drohendem Tone, »sonst giebt es etwas.«
Dabei drückte er dem Soldaten ein großes Geldstück in die Hand, denn er wußte schon, daß man den Zutritt zu einem hohen, türkischen Beamten nur erhält, wenn man eine offene Tasche besitzt – je mehr es klingt, desto schneller kommt man zum Ziele.

Jetzt nahm der Soldat die Cigarette aus dem Munde und sagte lächelnd:
»Danke vielmals, aber Zweck hat es nicht gehabt, der Polizeidirektor hat keine Ahnung von dem, was Sie von ihm wissen wollen.«
»Was weißt du davon?« sagte Jessy in geringschätzendem Tone.
»Vielleicht ebensoviel und noch mehr als Sie, Signora,« entgegnete der Soldat und betrachtete schmunzelnd das Silberstück. »Gehen Sie ruhig nach dem Hotel und warten Sie alles ab.«
Lord Harrlington wurde stutzig.
»Weißt du etwa, welche Angelegenheit uns hierhergeführt hat, was uns passiert ist?« fragte er.
»Nein, aber ich sage nochmals, der Polizeidirektor hat keine Ahnung davon, daß irgend eine Dame verhaftet worden ist. Folgen Sie meinem Rate, gehen Sie ins Hotel zurück, trinken Sie eine gute Flasche Wein und warten Sie getrost die kommenden Dinge ab – ich mache es ebenso – adieu, meine Herrschaften!«
Der Soldat drehte sich um und schritt langsam über den Hof.
Lord Harrlington blickte verblüfft Charles an, der eben wieder eine andere Silbermünze bereit hielt, und Jessy wandte sich ebenfalls verwundert nach Johanna um, die sonderbarerweise sich gar nicht an dem Gespräche beteiligt, sondern nur immer aufmerksam den Soldaten beobachtet hatte.
Jetzt schickte sie ihm noch einen prüfenden Blick und sagte:
»Wenn der Polizeidirektor nichts davon weiß, dann brauchen wir ihn allerdings nicht erst zu fragen. Kommen Sie, meine Herren!«
Sie drehte sich um und ging zu ihrem Esel.
Aber Lord Harrlington eilte ihr nach und hielt sie zurück.
»Aber, Miß Lind, Sie werden doch nicht dem ersten Besten Glauben schenken, der etwas von Ellens Verhaftung erfahren hat und uns nun belügt, um keine Arbeit mit uns zu haben?«
»Bitte helfen Sie mir in den Sattel,« sagte da Johanna ruhig und hob das Füßchen.
Während der vollständig frappierte Harrlington ihr willfahrte, flüsterte sie ihm unmerklich etwas zu, wobei der Lord hoch aufhorchte.
»So kommen Sie denn!« winkte er den beiden zu und stieg selbst auf seinen Esel.
»Wirklich, es ist das beste, im Hotel die Erklärung des Vorfalls abzuwarten.«
»Miß Lind hat uns schon zu oft einen guten Rat gegeben, als daß ich ihn diesmal ausschlüge, obgleich ich nicht weiß, was das alles heißen soll,« meinte Jessy.
Auch sie stieg auf, desgleichen Charles.
»Daraus werde ein anderer klug,« meinte letzterer kopfschüttelnd und gab seinem elenden, steifbeinigen Tiere die Schenkel zu fühlen, »in mein kleines Gehirn geht es nicht hinein.«
»Y–y–ah!« bestätigte der verständige Esel.
Kaum waren sie im Hotel du Nil angekommen und hatten die sie mit Fragen bestürmenden Herren und Damen einigermaßen beruhigt, als ein atemloser arabischer Junge gerannt kam, nach Lord Harrlington fragte und diesem ein versiegeltes Couvert gab.
Er riß es auf und las:
»Seien Sie ohne Sorge, ich habe Miß P. nicht aus dem Auge verloren. Noch lasse ich sie in den Händen ihrer Entführer, um einige neue Gesichter und Pläne zu entdecken. Heute abend wird sie spätestens im Hotel sein.
N. S.«
Aus dem Ritte nach den Pyramiden wurde unter diesen Umständen natürlich nichts. – – – –
Es hatte sich wirklich alles so zugetragen, wie jener Herr es dem Lord Harrlington geschildert hatte.
Als Ellen die jenseits der Straße stehende Zuschauerlinie erreichte, wurde sie sofort von einem egyptischen Offizier angeredet, der sie fragte, ob er ihr behilflich sein dürfte. Ellen glaubte, er meinte, ob er sie durch das Gewühl bringen solle, und fest überzeugt, daß ihr die anderen unmittelbar folgten, ließ sie es ruhig geschehen, daß der Offizier die Zügel ergriff und das Tier weiterführte.
Da plötzlich gewahrte sie, daß ihre Begleiter zurückgeblieben waren, und sofort versuchte sie, ihr Tier umzulenken; vergebens, der Offizier hielt die Zügel fest in der Hand und ließ sie nicht los.
»Geben Sie den Esel frei,« rief Ellen, »ich will nicht weiter, sondern hier auf meine Begleiter warten.«
Doch der Offizier schien bei dem Anerbieten, Ellen zu helfen, etwas anderes im Sinne gehabt zu haben.
»Habe ich das Vergnügen, Miß Ellen Petersen vor mir zu sehen?« fragte er in sehr höflichem Tone.
»Ich bin es,« entgegnete Ellen, »aber jetzt lassen Sie mein Tier los! Ich sage Ihnen, daß ich hierbleiben will.«
»Sie sind die Kapitänin der ›Vesta‹?«
»Ja. Warum müssen Sie dies alles so genau wissen? Zum letzten Mal, mein Herr, lassen Sie die Zügel los!«
Jetzt blieb der Offizier stehen und gab das Tier frei, aber es drängten sich – Ellen konnte dies nicht verstehen, denn es war doch kein Grund zu einem Auflauf vorhanden – eine große Anzahl von Arabern um sie, sodaß sie gar nicht daran denken konnte, ihren Esel umzulenken.
»Dann bedaure ich, Ihnen Unannehmlichkeiten bereiten zu müssen,« fuhr der Offizier immer noch in höflichem Tone fort. »Ich bin von der Regierung beauftragt, Sie zu verhaften.«

Ellen fing an zu lachen.
»Ich bediente mich allerdings eines unpassenden Ausdrucks,« sagte der Offizier schnell, »Sie sollen nur verhört werden.«
»Aber, ich bitte Sie, worüber denn?«
»Auf Ihren Befehl ist ein Schiff, welches gefangene Mädchen an Bord hatte, angehalten worden, und Sie haben dieselben mit Hilfe jener Damen Ihrer Begleitung befreit. Ist das nicht so?«
»Gewiß verhält sich das so. Im übrigen bin ich im Hotel du Nil zu sprechen und nicht auf der Straße. Platz da!« rief sie jetzt mit ärgerlicher Stimme und versuchte, sich durch das Gewühl zu drängen.
Einen Moment verlor der Offizier die Fassung. Er hatte wahrscheinlich geglaubt, das Mädchen würde äußerst erschrocken oder doch erstaunt über den Haftbefehl sein und ihm niedergeschlagen folgen; dagegen lachte Ellen ihn aber aus und trat auf, als hätte sie hier zu befehlen.
Dann aber, als es ihr fast gelungen war, sich Raum zu schaffen, griff er wieder in die Zügel und sagte in herrischem Tone:
»Versuchen Sie keinen Widerstand, Miß Petersen. Ich habe den Befehl erhalten, Sie sofort, wenn ich Sie zu sehen bekomme, nach der Präfektur zu führen, und dies ist für mich als Offizier unwiderruflich.
»Glauben Sie mir,« fuhr er in treuherzigem Tone fort, »es fällt mir dieser unangenehme Auftrag furchtbar schwer, ich würde lieber sonst etwas thun, aber ich bin gezwungen, falls Sie mir nicht gutwillig folgen wollen, Gewalt anzuwenden. Ich wäre natürlich außer mir, wenn ich jene Soldaten dort zu Hilfe rufen müßte, um Sie nach dem Polizeigebäude zu bringen.«
Ellen blickte sich um. Sie sah, daß nicht alle der Zuschauer Araber mit Turbanen waren, sondern, daß die ihr zunächst Stehenden die Uniform der egyptischcn Soldaten trugen. Sie schaute zurück, sie glaubte, auf der anderen Seite Lord Hastings' hohe Gestalt wahrzunehmen und winkte mit der Hand, aber in diesem Augenblicke kamen die ersten Sektionen des Regiments mit fliegenden Fahnen vorbeimarschiert, die Musik setzte ein, und jede Verständigung war unmöglich gemacht.
»So warten Sie wenigstens, bis ich meine Kameradinnen noch einmal gesprochen habe.«
»Das geht nicht, Miß Petersen. Ich bitte Sie, zwingen Sie mich nicht zum Aeußersten. Außerdem dauert es ja nur zehn Minuten, Sie brauchen nur ein Protokoll zu unterschreiben, daß auf Ihr Anstiften jene rühmliche That geschah, und ich werde Sie sicher hierher oder auch gleich auf die andere Seite bringen; es dauert doch noch einige Zeit, ehe dns Regiment vorbeimarschiert ist, und einen anderen Weg, um hinüberzukommen, giebt es nicht.«
»Meinen Sie?«
»Wahrhaftig, auf mein Ehrenwort!«
»So führen Sie mich, aber möglichst schnell!«
Ellen war sehr ärgerlich, sie wußte nicht, ob über sich, weil sie trotz des Mahnrufes Harrlingtons über die Straße geritten war, oder über ihre Gefährten, weil diese ihr nicht gefolgt waren. Doch sah sie jetzt keine Möglichkeit, der Aufforderung des Offiziers auszuweichen, denn nirgends konnte sie einen Europäer sehen; alle waren Araber oder Türken, welche natürlich den egyptischen Offizier unterstützen würden.
Dieser selbst, ein französisch sprechender Araber, machte keinen ungünstigen Eindruck auf sie, und so beschloß sie denn, dem Willen desselben Folge zu leisten. Das Verhör sollte ja nur einige Minuten währen.
Sofort bestieg, der Mann einen bereitgehaltenen Esel, die Menge teilte sich, und beide ritten davon. Ellen merkte wohl, daß etwa acht Soldaten ihnen folgten, aber sie that, als sähe sie das nicht. Dieselben gehörten zu dem Offizier und mußten natürlich mit diesem zugleich auf der Polizei eintreffen, um sich zu melden.
Nach einigen Minuten deutete ihr Begleiter auf den Thorweg eines großen, stattlichen Gebäudes und sagte:
»Wir reiten durch diesen Durchgang, und gleich sind wir da.«
In der Mitte des Hofes hielt er, stieg ab und zeigte auf eine emporführende Treppe.
»Wir sind am Ziele! Bitte, steigen Sie ab!«
»Das ist das Polizeigebäude?« fragte Ellen überrascht und zweifelnd. »Wohin bringen Sie mich?«
»Hier befindet sich das Bureau des Beamten, bei welchem Sie das Protokoll unterschreiben müssen,« beschwichtigte sie der Offizier. »Nur eine halbe Minute; dann ist alles geschehen, und ich bringe Sie wieder zurück. Ihr Esel bleibt einstweilen unter der Obhut eines Soldaten.«
Ellen war vollkommen beruhigt; sie folgte dem Offizier in die erste Etage.
Das Haus war nach europäischem Stile gebaut; auf jedem Flur befanden sich zwei Thüren, und an einer derselben klingelte der Offizier.
Ein Mädchen, vielleicht eine Italienerin oder Griechin, öffnete und ließ beide eintreten.
»Bitte, bemühen Sie sich einstweilen hier hinein,« sagte der Offizier, »sofort wird der Polizeibeamte kommen.«
Ellen trat ein, sprang aber in demselben Moment hastig wieder zurück und griff nach der Klinke, der schnell hinter ihr sich schließenden Thür – sie hatte vernommen, wie leise von außen ein Riegel vorgeschoben wurde. Aber, so plötzlich sie auch gehandelt hatte, es war zu spät, die Thür war geschlossen, alles Rütteln half nichts.
Das Mädchen griff sich an die Stirn.
»In die Falle gegangen!« murmelte es. »O, du schlaue Ellen!«
Ihre nächste Bewegung war, in die Tasche zu greifen, doch plötzlich überzog sich ihr Gesicht mit fahler Blässe. Wie sie auch suchte und suchte, erst in der rechten, dann in der linken, alles war darin, die Börse, ein Ledertäschchen, Schlüssel, ein Messerchen; aber der geladene Revolver war verschwunden. Er mußte ihr, während sie von den Arabern umdrängt wurde, entwendet worden sein, natürlich mit dem Einverständnisse des Offiziers, der sie hierhergelockt hatte.
Ja, es blieb ihr kein Zweifel mehr, alles war ein wohlüberlegter Plan; sie sollte von den übrigen Vestalinnen getrennt und hierhergeführt werden. Sie wußte wohl, von wem sie bedroht wurde. Jene von dem Banditen in Konstantinopel verlorene Photographie, deren Besitzer sie kannte, hatte es ihr verraten.
Aber, was hatte man mit ihr vor, was sollte ihr ferneres Schicksal sein? Tod oder ewige Gefangenschaft?
Doch Ellen war nicht das Weib, welches beim ersten Schicksalsschlage gebrochen niedersank, sie hatte schon oft dem Tode ins Auge gesehen, ohne mit den Wimpern zu zucken. Aber hier hatte sie gegen schurkische Heimtücke zu kämpfen, und dieser, das fühlte sie deutlich, war sie nicht gewachsen.
Einen Trost besaß sie. Die Vestalinnen, ihre Freundinnen, Johanna, Lord Hastings, alle diese verwegenen, englischen Herren würden nicht eher ruhen, als bis sie die Vermißte wiedergefunden hatten, sei es tot oder lebendig. Spurlos verschwinden konnte sie nicht. Sie fühlte den scharf geschliffenen Dolch noch auf dem Busen und steckte ihn in die Tasche. Diese Waffe sollte ihr nicht gestohlen werden.
Ellen sah sich im Zimmer um.
Es war elegant mit Tisch, Diwan und gepolsterten Stühlen möbliert; auffallend war nur, daß das Fenster dicht unter der Decke lag und vergittert war.
Sie setzte einen Stuhl auf den Tisch, schwang sich hinauf und spähte hinaus.

Richtig, ein vollständiges Gefängnis! Innen war das Fenster vergittert, und außen zeigte es ein Drahtgeflecht, durch welches man nicht einmal ein Zettelchen hätte werfen können. Dies wäre übrigens ganz unnütz gewesen, denn unten lag ein völlig öder Hof, auf dem kein Mensch zu sehen war.
Was nun beginnen? Sollte sie dem ersten, der in böser Absicht das Zimmer betrat, den Dolch ins Herz stoßen? Auch das hätte nichts genutzt.
Durch Schlauheit war sie überlistet worden, durch Schlauheit mußte sie sich wieder befreien. Gewalt half hier nichts, ebensowenig Schreien und Pochen.
Sie untersuchte aufmerksam den Raum. Sie lüftete den Teppich, aber die Diele darunter war völlig glatt. Sie verschob die Bilder an der Wand, es war keine verborgene Thür oder etwas Aehnliches zu entdecken.
Aber da, als sie den Diwan leise, vorsichtig, um ja kein Geräusch zu machen und so ihre Thätigkeit zu verraten, beiseite rückte, entdeckte sie unten in der Wand ein Loch, eben groß genug, daß sie ihre schmale Hand hineinstecken konnte. Offenbar war es ein Rohr; wahrscheinlich diente es zur Ventilation. Ellen kümmerte sich nicht weiter darum.
Sie setzte sich etwas niedergeschlagen auf den Diwan und überlegte.
Was mochte man nur mit ihr vorhaben? Verschwinden wollte ihr Feind sie lassen, aber auf welche Weise? Sollte es verhungern? Nein, die Thür war kein so großes Hindernis für sie, einem derben Anlauf konnte es doch nicht widerstehen.
Plötzlich sprang Ellen auf und sog aufmerksam die Luft ein.
Was war denn das? Roch es nicht auf einmal merkwürdig süßlich im Zimmer?
Wieder untersuchte sie.
Heiliger Gott, sie kannte dieses Aroma; es war Chloroform.
Die Röhre! Schnell den Diwan wieder von der Wand gerückt, das Taschentuch zusammengeballt und hineingestopft, tief, so weit, wie es die Dicke des Armes zuläßt! Dann noch für den Fall, daß das Tuch nicht völlig schließt, einen breiten Saum vom weißen Unterkleid abgerissen und nachgestopft, immer so weit nach hinten wie möglich.
Aufgeregt schritt Ellen im Zimmer auf und ab.
Also das war es! Sie sollte durch Chloroform betäubt und dann wahrscheinlich forttransportiert werden. Hätte sie getötet werden sollen, so würde man ein anderes, giftiges Mittel angewendet haben! Also der Tod war ihr noch nicht beschieden! Aber wie lange würde es dauern, und ihre Entführer merkten die Vereitelung ihres Planes. Sicher wußten sie noch ein anderes Mittel, um ihr Opfer stillschweigend zu beseitigen. Sie hatte nur einen Aufschub erzielt.
Plötzlich blieb sie stehen und sah nachdenklich vor sich hin. Ja, das war das einzige Mittel, eine Flucht möglich zu machen.
Zum dritten Male rückte Ellen das Polstergestell von der Wand ab, noch vorsichtiger als zuerst, drehte einen Stuhl um und drückte mit dessen Bein die Tücher noch tiefer und fester in das Rohr hinein als zuvor. Sie überzeugte sich, daß nichts von ihnen zu sehen war, und daß auch kein Chloroform mehr eindrang, dann rückte sie alles wieder an Ort und Stelle.
Darauf legte sie sich nachlässig auf den Diwan, nachdem sie zuvor den Dolch wieder im Busen hatte verschwinden lassen, gähnte recht laut und schloß die Augen.
»Aber um Gottes willen nicht einschlafen,« sagte sie sich immer und immer wieder, »sonst bin ich verloren.«
Es war noch nicht genug Chloroform ins Zimmer gedrungen, um die starken Nerven des Mädchens zu erschüttern. Zwar mußte sie mehrmals ihre ganze Energie anwenden, der Müdigkeit nicht zu unterliegen, aber der Gedanke, welche furchtbaren Folgen dies für sie haben könnte, vermochte doch immer wieder, sie wachzuhalten. So harrte sie der kommenden Dinge.
Ellen wußte nicht, wie viele Stunden sie bereits in dieser Lage zugebracht hatte, als auf dem Korridor ein leises Knacken, nur ein einziges Mal und fast unhörbar, ertönte. Gleich darauf war es Ellen, als ob an der Thür ein Geräusch entstände, etwa so, wie wenn ein hölzernes Brettchen zurückgeschoben würde.
Die Gefangene blinzelte mit keinem Auge.
Nach einigen Minuten erscholl draußen ein schwerer Männerschritt, der vor der Thür innehielt, es wurde an der Klinke gerüttelt, und eine tiefe Stimme rief:
»Ich glaube gar, das Fräulein ist eingeschlossen worden! Miß Petersen, sind Sie noch darin?«
Keine Autwort.
Jetzt hörte man vor der Thür lauten Spektakel, Entschuldigungen erklangen, dazwischen Flüche und Verwünschungen, bis endlich ein Riegel zurückgeschoben wurde, und mehrere Personen ins Zimmer drangen.
»Entschuldigen Sie, Miß Petersen, daß Ihnen dies passieren mußte – eine Vergeßlichkeit,« rief die tiefe Stimme fast überlaut wieder.
»Ach, Sie schlafen?« fuhr sie in fragendem Tone fort, aber so, als gälte es, ein Regiment Soldaten zu kommandieren.

Ellen wurde am Arm gefaßt und gerüttelt, aber sie verstellte sich weiter.
»Sie ist betäubt, es ist gelungen!« flüsterte eine andere Stimme.
»Habt Ihr auch nicht zu viel Chloroform einströmen lassen, daß sie nicht etwa stirbt?« sagte die tiefe Stimme, aber jetzt ganz leise.
»Wie soll ich wohl bei meiner langjährigen Praxis, hihihi,« lachte ein anderer. »Seht doch nur, wie ruhig sich ihre Brust hebt und senkt. Und außerdem ertrüge die wohl noch eine ganze Portion mehr als andere. Sie ist ein kräftiges Mädel.«
»Das ist es eben, darum schnell, daß wir sie fortbringen, ehe sie erwacht und Lärm schlägt.«
»Ihr kleidet sie aber doch erst um?«
»Nein, nichts! So wie sie ist, wird sie fortgeschafft. Sie möchte zimperlich in derartigen delikaten Angelegenheiten sein. Auch könnte sie dabei aufwachen, und die angebrochene Dunkelheit ist unserem Vorhaben günstig.«
»Wie bringt Ihr sie fort?«
»Ein famoser Plan, die neueste Idee vom Meister. Wir arbeiten fast nur noch in Uniform, und belästigt uns jemand in unserem Geschäft, so arretieren wir ihn auch noch und lassen ihn nur gegen ein gehöriges Trinkgeld laufen. Hahaha!«
»Also die Soldaten sollen sie tragen, Seewolf?«
»Ja, auf einer Bahre, als trügen sie einen Verunglückten. Deswegen nehmen wir auch den Weg nach dem Krankenhaus, biegen aber kurz vor diesem rechts ab in die Wüste. Kamele stehen bereit, uns nach Port Said zu bringen, wo der ›Friedensengel‹ liegt. Alles ist schon vorbereitet, diesmal glückt's mir.«
»Das gebe der Teufel und seine Großmutter, ich gönn's Euch. Der Offizier hat seine Rolle wirklich ausgezeichnet gespielt.«
»Nicht wahr? Er ist überhaupt ein brauchbarer Mensch und weiß alle Kniffe. Er ist so eine Art verkommener Student.«
Wieder ertönten Schritte auf dem Korridor, mehrere Personen kamen ins Zimmer, und Ellen hörte, wie ein Gegenstand auf den Boden gesetzt wurde, vermutlich die Bahre.
Ein Grausen erfaßte das junge Mädchen, als es jetzt von harten Fäusten angefaßt, emporgehoben und auf die Trage gelegt wurde, aber mit keinem Muskel verriet es, daß es bei vollem Bewußtsein war; den aufgehobenen Arm ließ es kraftlos wie eine Schlafende oder Tote wieder fallen.
Ellen hörte noch, wie ein Vorhang am Kopfende der Trage zugezogen wurde, dann hoben die Männer dieselbe auf und schritten die Treppe hinunter auf die Straße.
»Nur schnell, meine Burschen, daß sie nicht eher aufwacht, als bis wir die Stadt hinter uns haben. In der Wüste mag sie schreien, wenn sie Lust hat, dort will ich schon mit ihr fertig werden,« sagte der Führer der Leute, ein Mann mit eisgrauem Haar und scharfer Habichtsnase, der bekannte Seewolf.
Er gab die einzuschlagende Richtung an und schritt, manchmal argwöhnisch um sich spähend, eilig voran.
»So, jetzt hier rechts ab! Bald sind wir draußen in der Wüste. Ein Glück, daß die Nacht nicht fern ist.«
Sie bogen in eine breite Straße ein, welche in die dicht an Kairo grenzende Wüste führt.
»Kapitän, ich muß absetzen und wechseln, die Hand, an der ich die Wunde habe, schmerzt mich zu sehr.«
Der Seewolf stieß einen Fluch aus.
»Halt aus! Noch fünf Minuten bloß.«
»Ich kann nicht mehr, ich lasse die Trage fallen.«
»Zum Teufel, so setzt hin und wechselt!« rief der Seewolf unwillig. »Ihr seid doch nur Schwächlinge!«
Die Träger bückten sich und stellten die Bahre nieder.
Da schnellte von dieser plötzlich eine Gestalt hoch, in der erhobenen Hand einen blitzenden Dolch, bereit, den ersten, der ihr nahte, aus dem Wege zu räumen.
Mit einem furchtbaren Fluche stürzte der Seewolf hinzu, um die Fliehende zu halten, fuhr aber mit einem Schmerzensschrei zurück; nur der Dunkelheit hatte er es zu verdanken, daß statt des Herzens nur seine Schulter von Ellens Dolch getroffen worden war.
Die vier Träger wichen scheu vor der zum tödlichen Stoße erhobenen Waffe zurück, und das Mädchen jagte zwischen ihnen durch, die Straße zurück. Aber nach wenigen Schritten ereilte sie ein neues Unglück, sie verwickelte sich in ihr langes Kleid und stürzte. Ehe sie sich wieder aufraffen konnte, hatte sich schon ein Mann über sie geworfen.
»Mord!« gellte es noch aus Ellens Munde, dann preßte eine Faust ihr den Hals zusammen.

»Was geht hier vor?« fragte da eine Baßstimme, und plötzlich stand eine hohe Gestalt mitten unter den Leuten.
»Eine Wahnsinnige, die wir nach dem Hospital bringen wollen und die uns entsprungen ist,« rief der Seewolf, der, den Messerstich nicht weiter beachtend, sich über das Mädchen geworfen hatte.
»Kümmern Sie sich nicht um Angelegenheiten der Polizei,« fügte er in grobem Tone hinzu.
»Ich kenne dich, du maskierter Seeräuber!« donnerte jedoch der Fremde, faßte ihn, riß ihn hoch und schleuderte ihn einige Meter weit weg. Dann beugte er sich zu Ellen, um ihr aufzuhelfen, ward aber dabei von zweien der verkleideten Soldaten von hinten um den Leib gefaßt. Doch blitzschnell wandte er sich um, und zwar mit solcher Kraft, daß die beiden ihn nicht halten konnten, packte mit jeder Hand einen bei der Brust und warf sie auf den noch vom Sturze halbbetäubten Räuber.
Ellen konnte sich unterdessen erheben.
Noch eine andere Gestalt hatte sich gleich einem Schatten von der Häuserwand abgelöst, eine schlanke, schmächtige Figur, und war auf die beiden letzten Träger zugesprungen. Der eine erhielt einen Fußtritt in den Leib, daß er ächzend zu Boden sank, den anderen, der ihm schon einen Revolver entgegenhielt, warf er mit einem Faustschlage zu Boden. Im nächsten Moment kniete die schlanke Gestalt auf dem Besiegten und bog sich über diesen.
»Dich brauche ich nicht,« rief er und sprang wieder auf. »Wo ist der See– der Seehund?«
»Dort laufen sie eben um die Ecke,« sagte der Große mit dem Bart.
»Na meinetwegen, Kapitän, ich führe die Mannschaft zurück. Gute Nacht, Miß Petersen! Schöner Abend heute, nicht?«
Nach diesen Worten verschwand er in der Dunkelheit.

Noch immer hielt der Herr die vor Aufregung zitternde Ellen umfaßt. Die letzte Szene war selbst für das kräftige Mädchen zu viel gewesen.
»Ich danke Ihnen, Herr Hoffmann, die Schwäche wird gleich vorübergehen,« sagte sie jetzt und machte sich sanft aus den Armen des deutschen Ingenieurs, denn dieser war es, frei.
Er wartete, bis sie sich so weit erholt hatte, daß sie neben ihm herschreiten konnte; aber den ihr angebotenen Arm schlug sie aus.
»Wo sind die Damen, die Vestalinnen? Wo Lord Harrlington und seine Freunde?« begann sie nach einer kleinen Weile mit leiser Stimme.
»Sie sind im Hotel du Nord und warten auf Ihre Rückkunft.«
»Wie?« rief Ellen halb erstaunt, halb unwillig. »Sie warten sorglos auf mich und machen keine Anstrengungen, mich wiederzufinden? Das kränkt mich sehr.«
»So hätten Sie lieber gesehen, wenn ein anderer, als ich, Sie aus den Händen dieser Elenden befreit hätte?«
»Verzeihen Sie mir, Herr Hoffmann, wenn ich die Wahrheit bekenne. Ja, ich hoffte und hoffte immer, daß einer meiner Freunde meine Spur wiederfinden würde, und als ich Sie vorhin zuerst erblickte, glaubte ich, Lord Harrlington zu sehen.«
»Mein liebes Fräulein,« sagte der Ingenieur in väterlichem Tone zu Ellen, welche sehr niedergeschlagen schien, »wenn Sie glauben, daß Ihre Freundinnen und die englischen Herren über Ihr Schicksal nicht sehr besorgt gewesen sind, so thun Sie ihnen sehr, sehr unrecht. Nicht ich bin es, dem Sie Ihre Befreiung zu verdanken haben, sondern Lord Harrlington. Ich bin nur sein Werkzeug gewesen.«
»Das verstehe ich nicht. Wenn er wußte, auf welchem Wege ich fortgetragen wurde, warum sprang er nicht selbst dazwischen, mich zu retten, sondern schickte einen anderen?«
Ueber die männlich schönen Züge des Ingenieurs flog ein leichtes Lächeln, welches Ellen in der herrschenden Finsternis nicht bemerkte; dann sagte er, wieder ernst:
»Er durfte nicht. Jeder seiner Schritte, jede Handlung der Damen und Herren wurden von Helfershelfern der Räuber beobachtet; um also Argwohn zu vermeiden, mußten jene sich den Anschein geben, als ob sie im Hotel Ihre Rückkunft abwarteten, denn vor dem Polizeigebäude war ihnen mitgeteilt worden, daß Sie wegen Vernehmung in Sachen jener Mädchenbefreiung vom Polizeidirektor für einige Stunden in Anspruch genommen würden.«
Dies war allerdings nicht wahr. Der an der Thür stehende Soldat hatte bekanntlich den nach dem Polizeidirektor Fragenden eine ganz andere Antwort gegeben.
»Dennoch wußte Sie Lord Harrlington in Gefahr,« fuhr der Erzähler fort, »und wie ich schon sagte, haben Sie es nur ihm zu danken, daß die Absicht Ihrer Entführer, Sie nach Port Said zu schleppen, vereitelt wurde. Sie sehen, der Lord ist ziemlich gut in die Pläne Ihrer Feinde eingeweiht; deshalb bitte ich Sie innig, liebe Miß Petersen, richten Sie sich mehr nach seinen Ratschlägen. Wären Sie hübsch an seiner Seite geblieben und nicht eigensinnig weitergeritten, so hätten Sie sich viele Angst und großen Kummer ersparen können.«
Ellen hatte bei diesen freundlichen, aber ernsten Worten ihren ganzen Stolz verloren. Beschämt senkte sie das Köpfchen; es war ihr, als ob ein liebevoller Vater sie strafe und tadle.
»Uebrigens schätzen Sie meine That ja nicht zu hoch; hinter dem Hause dort stand die Hälfte meiner Mannschaft, bis an die Zähne bewaffnet. Ein Pfiff von mir hätte genügt, und die Leute wären zur Hilfe herbeigeeilt. Jener Matrose, welcher allein vortrat, hat sie bereits wieder in ihr Quartier geführt.«
Dieser deutsche Ingenieur schien auch jetzt wieder nur darauf bedacht zu sein, seine Handlungsweise in den Augen anderer möglichst unbedeutend erscheinen zu lassen.
»Was machen meine Mädchen in Alexandrien? Sind sie auch sicher, wenn Sie nicht an Bord Ihres Schiffes sind, Herr Hoffmann?« fragte Ellen.
»Beruhigen Sie sich über dieselben! Gedenken Sie meines Versprechens, daß ihnen kein Haar gekrümmt werden soll. Meine Leute sind so zuverlässig, daß ich ihnen unbedenklich das Liebste, was ich auf der Welt besitze, anvertrauen würde. Doch biegen wir hier in die Muski ein; gleich werden wir im Hotel sein.«
Das war ein Jubel, als Ellen wieder in der Mitte ihrer Freundinnen erschien. Aber die an sie gerichteten Fragen beantwortete sie nicht, sie zog sich, nachdem sie erklärt hatte, morgen das Hotel nicht verlassen, dafür aber übermorgen sofort mit Sulima nach Fayum aufbrechen zu wollen, in ihr Zimmer zurück, um nach diesem aufregenden Tage der Ruhe zu pflegen.
Unterdes hatte Hoffmann mit Harrlington eine lange Unterredung, und obgleich der letztere anfangs etwas ungehalten über eine Forderung des ersteren schien, gelang es doch dem Ingenieur, ihn von der Richtigkeit des Planes, nach dem die Errettung Ellens vor sich gegangen war, zu überzeugen. Auch der Lord gab zu, daß eine kleine Strafe dem eigensinnigen Mädchen nichts schaden könnte, doch, meinte er, diese sei zu hart gewesen.
An dem östlichen Ufer des Nils, südlich der Stadt, hielt ein Beduine auf edlem Roß.
Ein langer Weg und unsägliche Strapazen mußten hinter beiden liegen; denn das Aussehen des Reiters, wie seines Tieres verriet die größte Erschöpfung. Der weiße Burnus des Mannes war stark abgenutzt, ja an verschiedenen Stellen zerfetzt, als hätte er nie daran denken können, sein Gewand zu wechseln, als hätte er seit Wochen Tag und Nacht im Sattel gesessen. Aber, obgleich das Pferd den Kopf etwas gebeugt trug, wieherte es doch hell auf, als sein Herr ihm den edelgeformten Hals klopfte, und schritt ungesäumt dem Wasser zu, um dem jenseitigen Ufer des Nils zuzuschwimmen, während der Reiter die einläufige, lange Flinte, sowie zwei Pistolen, hoch emporhielt, um das Pulver nicht naß werden zu lassen.
Drückte auch das schöne, stolze Gesicht des jungen Beduinen eine tiefe Niedergeschlagenheit, eine geheime Sorge aus, so vermochte diese doch nicht das glänzende Auge zu trüben, mit dem er scharf nach dem anderen Rande des Stromes spähte. Die Züge des Reiters zeigten zwar ein orientalisches Gepräge, man hätte ihn aber ebensogut für einen Südeuropäer halten können, besonders die langen, schwarzen Locken stempelten ihn zu einem solchen, ebenso wie der gekräuselte Schnurrbart.
Das Roß hatte das Ufer gewonnen.
Wieder streichelte der Reiter den Hals des Tieres.
»Noch einige Stunden greife gut aus, Morgenröte,« sagte er zärtlich, »und wir sind im Lager. Deine wackeren Dienste sollen dann belohnt werden. Eile, eile, daß meine Rache den Schuldigen treffe!«
Er stieß dem Pferde die spornlosen Hacken in die Weichen, sodaß dieses in flüchtigen Sätzen durch das hier nur einen Kilometer breite Nilthal flog, an welches die Wüste grenzt.
Weiter sprengte der Reiter in Karriere dem Westen zu, die sengenden Strahlen der Sonne nicht achtend, welche auf sein mit einem Turban bedecktes Haupt herniederglühten, dicht auf den Hals seines Tieres gebeugt, um durch den Widerstand der Luft die Schnelligkeit des Rosses nicht zu vermindern.
Plötzlich weiteten sich seine Augen; scharf spähte er nach dem Horizonte, an dem er dunkle Gestalten wahrnahm.
»Es können nur Beni-Suef sein,« murmelte er, »ich treffe hier auf keinen anderen Stamm. Aber warum halten sie sich nicht zusammen, sondern in Entfernung, als wollten sie eine Linie bilden?«
Er lenkte das Pferd etwas weiter nach rechts, um den Begegnenden ausweichen zu können. Rasch näherte er sich den Gestalten. Wie er jetzt erkennen konnte, waren es Reiter, und zwar mochten es ein Dutzend sein.
Als die neuen Reisenden den einsamen Menschen erblickten und sahen, daß er eine andere Richtung einschlug, änderten auch sie sofort die ihrige, wie wenn sie eine direkte Begegnung mit ihm wünschten.
»Haben sie Böses gegen mich im Sinne, oder wollen sie nur den Weg nach dem Nilthal erfragen? Nun, mögen sie kommen, sie werden Salim friedfertig oder kampfbereit finden, je nachdem,« murmelte der Reiter wieder, zog, ohne den Lauf seines Rosses zu mäßigen, die Pistolen aus dem Gürtel und prüfte sie, ebenso wie die Flinte. Auch überzeugte er sich, daß der zweischneidige Dolch handbereit steckte.

Der kühne Reiter war kein anderer als jener Salim, dem vor einem halben Jahre seine Braut Sulima am Tage der Hochzeit durch fremde Räuber entführt wurde. Noch an demselben Tage war er, von der Jagd nach den losgekoppelten Pferden kaum ins Lager zurückgekehrt, aufgebrochen, um der Spur des geraubten Mädchens zu folgen. Der alte Scheich, Sulimas Vater, hatte ihn reichlich mit Geldmitteln ausgestattet und ihm geheißen,
keine Kosten zu scheuen, um die Entführte wieder zu erlangen.
Sonderbarerweise wollte sich ihm Hassan durchaus als Begleiter anschließen, aber Salim, der dem Burschen niemals recht getraut hatte, schlug ihm die Bitte rundweg ab; er nahm überhaupt niemanden mit, einmal, weil er seinen eigenen Scharfsinn und seine Geschicklichkeit im Verfolgen einer Spur für vollkommen genügend hielt, und dann auch, weil er nicht durch andere Personen in der Schnelligkeit seiner Bewegungen gehemmt sein wollte.
Aber im Nilthal schon verlor er die Fährte der Räuber, denn diese hatten den bebauten und bewohnten Teil ihres Weges dazu benutzt, etwaige Verfolger irrezuleiten, und es gelang Salim trotz aller Mühe nicht, sie wiederzufinden.
Nach einigen Tagen vergeblichen Suchens setzte er kurz entschlossen seinen Weg nach der Küste des Meeres fort, denn eine Ahnung sagte ihm, daß die beiden geraubten Mädchen an Sklavenhändler verkauft werden sollten. Wenn er auch zu spät kam, um dies zu verhindern, so konnte er sich doch wenigstens Gewißheit darüber verschaffen und eventuell die Entführer zur Bestrafung ziehen, das heißt, sie nach den Gesetzen der Wüste töten.
Aber vergebens ritt er die ganze Küste ab und fragte in dem kleinsten arabischen Fischerdorfe wie in der großen Hafenstadt jeden, ob zwei Mädchen mit dem von ihm beschriebenen Aeußeren gesehen worden wären – niemand wollte etwas von ihnen wissen.
Da hatte er eine wundersame Begegnung.
Eines Tages traf er auf dem Wege nach einer anderen Stadt zwei Reisende, einen zu Kamel, den anderen zu Pferde, und wie groß war sein Erstaunen, als er in ihnen Hassan und Seddah erkannte, welche sich auf der Reise nach der Heimat befanden.
Hassan brüstete sich ungemein mit seinem angeblichen Erfolge, daß er die Spur der Mädchen gefunden und Seddah gerettet habe. Auch das Mädchen floß über von Bewunderung für den buckligen Hassan und pries ihn als ihren Befreier.
»Und Sulima?« fragte Salim kurz.
Seddah erzählte das, was der Leser bereits weiß, und fügte noch hinzu, daß sie nach Wegführung der Sulima selbst wieder in ein anderes Städtchen geschleppt wurde, bis eines Nachts der tapfere Hassan ihren Aufenthaltsort erkundet, die Räuber mit Hilfe einiger bezahlter Männer überrumpelt und sie befreit habe.
Salim bezweifelte diese Erzählung von vornherein, besonders als Hassan erklärte, den Namen jenes Städtchens, in dem er Seddah gefunden, vergessen zu haben. Ohne Abschied ritt er davon, um seine Nachforschungen fortzusetzen, aber sie blieben erfolglos.
Fast gingen ihm die Geldmittel und damit die Möglichkeit aus, weiterzureisen, da bekam er sichere Mitteilungen, daß Sulima als Sklavin an einen türkischen Sklavenhändler verkauft und sofort auf ein Schiff geschleppt worden sei. Jetzt gab der Jüngling mit blutendem Herzen die weitere Verfolgung auf, denn niemand wußte, wohin sich das Schiff gewandt habe; aber er hatte doch wenigstens den Namen des Verkäufers erfahren, und um diesen zur Verantwortung zu ziehen, befand er sich jetzt auf dem Ritt nach den Zelten der Beni-Suef.
Es war kein Zweifel, die Reiter suchten mit Salim zusammenzutreffen, und ihr Aussehen war durchaus kein friedfertiges.
Sie ritten vorzügliche Pferde; die Spitzen der Lanzen funkelten im Glanze der Sonne, auf den Rücken hingen die langen Beduinenflinten, und so nahe war Salim schon herangekommen, daß er die Gesichtszüge der Fremden erkennen konnte. Er sah, daß sich in ihnen eine höhnische Freude widerspiegelte, die sie beim Anblick des einsamen Reiters nicht einmal verhehlten.
»Beni-Suef sind es nicht, auch keine Bauiti; die Art, wie sie den Turban geschlungen haben, ist mir völlig fremd. Sie scheinen nichts Gutes gegen mich im Schilde zu führen, und mein Leben ist zu kostbar, um es nutzlos aufs Spiel zu setzen; also werde ich ihnen aus Wege gehen, wenn dies auch einer Flucht ähnlich sieht,« so dachte Salim und lenkte sein Roß scharf rechts ab, so schnell, daß er im Nu an der Seite der Fremden vorübersauste. Da er seinen Ritt nicht im geringsten gemäßigt hatte, so sah es aus, als ob er keine Zeit zu verlieren habe, sondern so schnell als möglich einem Ziele zustrebe.
Er hatte richtig vermutet, denn kaum hatte er die vierzehn Mann hinter sich, denen anfangs sein Manöver überraschend kam, so knallten schon Flintenschüsse, und die Kugeln pfiffen um seinen Kopf.
Doch Roß und Reiter blieben unverletzt.
Salims Blut wallte bei diesem frechen Angriff auf einen harmlosen Wanderer; er riß die Pistole ans dem Leibgurt, wandte sich im Sattel und zielte nach dem ersten der Männer, welche sofort seine Verfolgung aufgenommen hatten.
Der Schuß krachte, und der Reiter stürzte vom Pferde.
Nochmals flogen Kugeln um Salims Ohren, doch abermals fiel ein Verfolger von dessen sicherer Kngel.
»Hussah, Morgenröte,« rief er in wilder Freude und gab der Stute die Fersen, »es ist das erste Mal, daß du vor einem Feinde fliehst, aber ich will deren Zahl nach und nach vermindern.«
Es konnte freilich nicht mehr lange währen, so mußten die Verfolger, wenn anch keine ihrer Kugeln traf, ihn doch erreichen, denn ihre Pferde waren ausgeruht, das seinige dagegen vollständig abgemattet. Mehr und mehr verringerte sich die Entfernung zwischen ihnen, die er durch das plötzliche Ablenken gewonnen hatte; immer näher erklangen hinter ihm die Flüche.
Salim hatte seine Pistolen wieder geladen, eben wandte er sich um, um abermals den nächsten aus dem Sattel zu werfen, als ein Schuß krachte; sein Pferd bäumte sich und stürzte zu Boden.
Doch Salim ward nicht abgeschleudert. Ehe das Roß noch fiel, stand er schon auf den Füßen, riß die Flinte von der Schulter und lag im nächsten Augenblicke hinter dem Pferde, dieses als Schutzwehr gegen die feindlichen Kugeln gebrauchend.
»Arme Morgenröte,« flüsterte er, »kann ich Sulima nicht mehr rächen, so will ich wenigstens Deinen Mörder bestrafen.«
Jetzt war sein Schicksal entschieden. Noch dreißig Meter trennten ihn von seinen Feinden, bald wurde er gewiß von deren Lanzen durchbohrt.
Aber was galt ihm das Leben, seit er Sulima verloren! Es hatte nur noch den Zweck für ihn gehabt, den Verrat an seiner Geliebten zu rächen. Drei der Verfolger müßten noch fallen, dann war er zum Sterben bereit. Er wollte schon dafür sorgen, daß er ihnen nicht lebendig in die Hände fiel.
Doch da zügelten die Beduinen plötzlich ihre Rosse, besprachen sich hastig und jagten in Carriere zurück, als wollten sie auf ihr Opfer verzichten.
Salim war ein in Kampfspielen viel zu erfahrener Mann, als daß er sich durch diese Handlungsweise in Sicherheit hätte wiegen lassen; sein Tod wurde nur etwas verzögert. Er wußte, daß sie jetzt außer Schußweite ritten, ihn umzingelten, von den Rossen stiegen und dann langsam, auf dem Bauche kriechend und jede Erhebung des Sandes benutzend, auf ihn zukamen und eine Gelegenheit für einen günstigen Schuß erspähten.
Wären sie direkt auf ihn zugeritten, so hätten wenigstens noch drei daran glaubeu müssen, denn Salims Kugeln trafen. So dagegen, war mehr Aussicht vorhanden, ihren Zweck zu erreichen, ohne dabei ihr Leben besonders aufs Spiel zu setzen.
Es geschah so, wie er vermutete.
Außer Schußweite gekommen, schwenkten sie nach rechts und links ab und ritten um Salim herum, doch immer einen weiten Abstand von dessen sicherer Flinte bewahrend. Dann, als sie eine bestimmte Entfernung untereinander eingenommen, sprangen sie aus den Sätteln, legten sich in den Sand und krochen langsam näher, während die darauf dressierten Pferde ruhig an ihren Plätzen stehen blieben.
Der Beni-Suef sah, daß jene, obgleich schlechte Schützen auf rennendem Pferde, doch im Einzelkampf geübte Krieger waren, sie verstanden es wenigstens ausgezeichnet, sich hinter der geringsten Erhebung des Bodens zu verstecken; kein Glied kam zum Vorschein, höchstens tauchte hier und da der oberste Rand des Weißen Turbans oder ein Stückchen Gewand auf. So krochen sie langsam näher, ohne ihm eine Gelegenheit zum Gebrauche seiner Büchse zu geben.
Salims Lage war eine schwierige, weil er nicht gleichzeitig alle die Feinde beobachten konnte, auch sich nicht immer wenden wollte, um sich ja nicht einmal eine Blöße zu geben. Die eine Seite war durch den Körper des toten Pferdes geschützt, auf der anderen erhob sich eine Unebenheit des Sandes, sodaß er ziemlich gedeckt lag und dabei zugleich selbst einen günstigen Platz zum Zielen hatte.
Plötzlich hörten die Feinde auf, ihre kriechenden Bewegungen fortzusetzen; er vernahm, daß sie sich etwas zuriefen, einen Satz, der sich von Mund zu Mund fortpflanzte und so den ganzen Kreis durchlief. Leider war die Entfernung noch zu weit, als daß er hätte die Worte verstehen können, aber es war ihm, als sei das Wort ›Franken‹ dazwischen gewesen. Er grübelte nicht weiter darüber nach, sondern betrachtete fortgesetzt einen Mann, der sich ihm am meisten genähert hatte, weil er sehr schnell, dabei auch am unvorsichtigsten gekrochen war.
Da sprang dieser mit einem Male auf, als wolle er auf Salim zulaufen; doch schon krachte dessen Büchse und jener stürzte zusammen.
Doch was war das? Die ganze Reihe hatte sich aufgerichtet und stürzte in wilder Hast nach den Pferden, sprangen auf und jagten davon, ohne sich weiter um ihr Opfer zu kümmern.
Verwundert blickte Salim sich um und sah nun den Grund zu dem schleunigen Rückzug.
Nicht weit von ihm sprengte eine stattliche Reiterschar im Galopp heran, etwa zehn nach europäischer Art, aber in Jagdanzüge gekleidete Männer, alle wohlbewaffnet.
»Es ist doch merkwürdig,« sagte eben der eine, »wohin wir kommen, da reißt alles aus. Wie geht das nur zu, Williams?«
»Das ist ganz natürlich, Hendricks,« spottete der Angeredete, »seit Sie sich einen Backenbart angeschafft haben, sehen Sie wie ein reisender Räuberhauptmann aus.«
»Allah sei gepriesen, ich bin gerettet!« rief Salim, stand aus und erwartete die Ankömmlinge.
»Wer bist Du? Wurdest Du allein von so vielen Feinden bedroht?« fragte ihn der Anführer der Schar – es war Harrlington – erst auf Englisch, und dann, als der Beduine mit dem Kopf schüttelte, auf Französisch. Zur Verwunderung der Herren antwortete derselbe sofort fließend in dieser Sprache.
»Ich bin ein Beni-Suef. Wüstenrauber haben mich überfallen, ich weiß nicht warum, jedenfalls weil sie Schätze bei mir vermuteten, und ohne Ihre Dazwischenkunft wäre ich verloren gewesen.«
»Du bist ein Beni-Suef, dessen Stamm nicht weit von hier seine Zelte aufgeschlagen hat?« rief ein Reiter. »Das ist ein seltsames Spiel des Schicksals, auch wir. ..«
»Ruhig, meine Herren,« unterbrach ihn Lord Harrligton, »vielleicht fügt es sich noch wundersamer!«
»Wie willst du nun deine Reise durch die Wüste fortsetzen, da dein Pferd getötet ist?« wandte er sich wieder an den Beduinen.
»Es ist nur eine halbe Tagesreise für mich; so lange kann ich mit Leichtigkeit ohne Wasser laufen,« entgegnete dieser mit bedauerndem Blicke auf sein totes Roß.
»Siehst Du dort die Karawane?«
Der Beduine folgte der angedeuteten Richtung und erblickte eine Menge Gestalten zu Pferde, welche sich inzwischen dem Schauplatze des Kampfes genähert hatten. Auch einige Kamele konnte er erkennen.
»Ich sehe sie.«
»So komme mit uns, du kannst dort ein Kamel als Reittier erhalten, und wir selbst werden dich nach dem Lager bringen.«
»Die Beni-Suef werden Eure Güte durch Gastfreundschaft zu vergelten wissen,« entgegnete Salim dankbar.
Die Herren ritten langsam, neben sich den Beduinen, der Karawane entgegen.
»Ein Glück war es,« sagte unterwegs Harrlington zu Lord Hastings, »daß Sie diesen Wettritt anregten. Einmal haben wir dadurch einen Menschen vor dem sicheren Tode gerettet, und dann vermute ich fast, haben wir einen Fang gemacht, über den sich Miß Petersen außerordentlich freuen wird, und wahrscheinlich noch viel mehr jemand anders.«
»Wieso?« fragte Hasting. »Nun ja, vielleicht Sulima, weil auch diese eine Beni-Suef ist.«
»Nicht allein darum. Geben Sie jetzt Achtung!«
Die beiden Reitergruppen waren zusammengetroffen. Ellen, in einem kurzen Reitkleid, ritt auf einem prächtigen Grauschimmel neben dem die Karawane führenden Beduinen und unterhielt sich mit Sulima, welche ihr zur anderen Seite ritt. Hinter ihnen verteilten sich die Vestalinnen und die übrigen Herren in Gruppen; den Schluß bildeten einige Kamele, unter Aufsicht Hannibals, welche die mitgenommenen Bedürfnisse trugen.
Alle waren zu Pferde.
Die Vestalinnen trugen, ebenso wie ihre Kapitänin helle, kurze Reitkleider, je nach Geschmack mit Schärpen oder Gürteln verziert, während Ellen um ihre Hüften nur eine Art Ledergewebe kunstvoll geschnürt hatte, über dessen Bedeutung sich verschiedene den Kopf zerbrachen. Die Herren hatten zu dieser Expedition lederne
Jagdkleider angelegt, mit Ausnahme Harrlingtons, der vergebens geraten hatte, in der heißen Wüste lieber leichtes, weißes Zeug zu tragen, wie die Damen und er selbst. Deshalb kam es, daß den Unvorsichtigen bereits mehrere Seufzer über die furchtbare Hitze entfahren waren, aber dennoch war bei einigen sofort, als Lord Harrlington den Vorschlag machte, die Schnelligkeit ihrer Pferde zu prüfen, die Sportlust erwacht, es wurde gewettet, und fort brausten die zehn Herren, die Hitze ganz vergessend.
Die zwischen Salim und seinen Verfolgern gewechselten Schüsse hatten das Rennen unterbrochen. Die Herren waren nach dem Kampfplatz geeilt und eben noch zurecht gekommen, den Beduinen vor dem sicheren Tode zu bewahren.
Neugierig erwarteten die Zurückgebliebenen, welche die Schüsse aus weiter Ferne gehört hatten, die Ankommenden, konnten aber den zwischen diesen gehenden Beduinen nicht sehen.

Da sprang plötzlich zwischen den zurückkehrenden Reitern eine weißgekleidete Gestalt hervor, direkt auf die erste Gruppe zu und rief in jauchzendem Tone:
»Sulima!«
»Salim!« rief ebenso entzückt das Mädchen und sprang ans dem Sattel.
Die beiden Liebenden lagen sich in den Armen.
»Salim! Ist es möglich?« staunte Ellen. »Wo haben Sie ihn getroffen, Lord?«
»Haben Sie die Braut gerettet, so haben wir dem Bräutigam den gleichen Dienst gethan,« entgegnete Harrlington und erzählte nun mit kurzen Worten, aus welch' kritischer Lage sie den Beduinen befreit hätten, während Salim und Sulima das Glück des Wiedersehens auskosteten.
Endlich ermahnte das Mädchen selbst ihren Geliebten, ihrer Schützern Rede zu stehen, denn diese, das hatte sie ihm bereits erzählt, wäre es, der alles zu danken sei. Ohne sie wäre sie jetzt Sklavin an irgend einem Fleck der Erde, und nie wäre dieses Wiedersehen möglich gewesen.
Nun teilte Salim in gedrängten Worten seine Bemühungen mit, etwas über das Schicksal seiner geraubten Braut zu erforschen, und schilderte dann die Verfolgung durch die Wüstenräuber bis zur Dazwischenkunft der englischen Herren.
»Kanntest Du den Stamm, zu dem Deine Verfolger gehörten?« fragte ihn Johanna.
»Nein, es waren Räuber, wie sie sich zum Schrecken der Karawanen überall in der Wüste umhertreiben.«
»Was mag sie veranlaßt haben, dir nachzustellen?«
»Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich vermuteten sie Wertsachen bei mir, oder vielleicht reizten schon meine Waffen ihre Habgier.«
Johanna schüttelte nachdenklich den Kopf.
»Ich glaube eher, Du solltest für immer stumm gemacht werden.«
»Ich?« fragte Salim verwundert.
»Hast du nicht schon daran gedacht, daß Dahab oder Hassan die Räuber gedungen haben kann?«
»Wirklich, das könnte sein. Ich weiß jetzt ziemlich bestimmt, wer den Plan zu Sulimas Entführung ausgesonnen hat; sie selbst bestätigt es, und dieses mich hassende Paar wußte, daß ich eines Tages Rechenschaft fordern würde; es hat jene Wüstenräuber bestochen, mich auf diese oder jene Weise aus der Welt zu schaffen.«
Auch Ellen bestätigte diese Annahme.
»Wie weit ist es noch bis zum Sitze der Beni-Suef?« fragte sie.
Salim warf einen prüfenden Blick über die Karawane.
»Ein flüchtiges Pferd hat zwei Stunden zu laufen, ehe es unser Gebiet erreicht; doch Ihr habt beladene Kamele mit, also werden wir in sechs Stunden dort sein. Wo die Zelte stehen, kann ich noch nicht sagen, denn wir sind ein wandernder Stamm; aber wir können sichere Auskunft von dem ersten Beduinen erhalten, den wir treffen.«
Salim nahm einen Platz auf dem am leichtesten bepackten Kamel ein.
Johanna lenkte ihr Pferd an Ellens Seite.
»Miß Petersen, unsere Vermutung, daß Hassan bei dem Raube Sulimas beteiligt war, hat sich also bestätigt,« sagte sie, »aber aller Wahrscheinlichkeit nach ging dieser Plan von Dahab, dem Scheich der Bauitis, aus. Hassan wird in dem Lager der Suef zu finden sein, aber nicht Dahab. Haben Sie die Absicht, als Richter aufzutreten?«
»Nein,« entgegnete Ellen, »ich will nur, daß Hassan des Verrats gegen seinen Stamm überführt wird, und ich glaube, unser Zeugnis, schon unsere Autorität als Europäer wird dies leicht ermöglichen. Salim selbst kann Dahab nichts beweisen, ebensowenig Sulima, und ich weiß nicht, wie wir diesen Burschen zu einem Geständnis zwingen können.«
»Durch Hassan.«
»Dessen Verschwiegenheit wird Dahab wohl erkauft haben.«
»Aber Stockhiebe werden seine Zunge lösen.«
»Wenn auf Antrag Salims dieses Mittel angewendet werden soll, dann bin ich natürlich damit einverstanden; ich aber werde es nicht vorschlagen,« erklärte Ellen entschieden.
»Es giebt noch etwas anderes, was Hassan vielleicht zum Sprechen zwingen kann,« sagte Johanna nachdenkend.
»Und das wäre?«
»Die Ueberraschung. Wir müssen Sulima nicht sofort als Befreite zurückbringen, sondern erst Salim als Ankläger auftreten lassen, und, wenn Hassan leugnet, muß Sulima auftreten und ihn direkt als Schuldigen bezeichnen. Auch ist es notwendig, daß sie dann ihre Begegnung mit Dahab erzählt.«
»Dies wird das beste sein,« erklärte Ellen befriedigt, »die Trage auf dem Kamel bietet ein gutes Versteck.«
Die sechs Stunden waren noch nicht verflogen, die Sonne stand noch hoch über dem Horizont, als die Karawane in der Ferne die weiße Leinwand von Zelten schimmern sah. Salim erklärte sofort, es wären solche der Beni-Suef, ob gerade die des Scheichs Mustapha-ben-Hammed, könne er noch nicht behaupten. Bald waren sie erreicht, und Salim erfuhr, daß sein Stamm etwa eine Stunde weiter südlich lagere, und daß gerade der alte Scheich der Bauitis und sein Sohn bei ihnen weilten.
Nachdem die Karawane die Zelte hinter sich hatte, hielten sie eine Beratung ab, und es ward mit Salims und Sulimas Einwilligung beschlossen, daß kurz vor Einritt in das Lager beide sich in der Trage verbergen sollten, um vorläufig unentdeckt zu bleiben, denn für diesen Abend war es doch zu spät, mit der Beschuldigung gegen Hassan und Dahab hervorzutreten; erst morgen früh sollte der Gerichtstag abgehalten werden.
»Der Zufall ist uns günstig,« sagte Salim, »daß Dahab sich in unserem Lager befindet, aber wir können ihn nicht bestrafen.«
»Warum nicht?«
»Die Gastfreundschaft ist den Beni-Suef heilig. Doch es genügt, wenn er für schuldig erklärt wird.«
»Was würdest du dann machen?«
»Ich würde ihn in seinem Lager oder außerhalb unserer Zelte aufsuchen und töten,« antwortete Salim mit Nachdruck.
»Es kommen Reiter auf uns zugesprengt,« rief jetzt Johanna, »schnell Salim und Sulima, in die Trage!«
Wirklich kamen der Karawane mehrere berittene Beduinen entgegen; an ihrer Spitze ein würdiger alter Mann, der Scheich Mustapha-ben-Hammed.
Hannibal wurde gerufen, um als Dolmetscher zu dienen.
»Allah sei mit Euch,« rief schon von weitem der Greis und legte wiederholt seine Hand auf Herz und Stirn. »Sucht Ihr Gastfreundschaft bei den Beni-Suef? Unsere Zelte stehen den Reisenden offen.«

Zeremonielle Redensarten wechselten, dann wurde die Gesellschaft ins Lager geführt, wo ihnen Zelte und alle Bequemlichkeit, wie sie die einfachen Beduinen bieten können, angewiesen wurden.
Ellen sah, während sie das Abladen der schweren Trage beaufsichtigte und diese in das Zelt schaffen ließ, welches sie mit Johanna und noch einigen anderen Damen gemeinschaftlich bewohnen sollte, wie ein junger Mann, anders und reicher als die Beni-Suefs gekleidet, sich mit einem kleinen, buckligen Menschen eifrig unterhielt und dabei den Herren finstere Blicke zuwarf.
Ehe die Feuer im Lager erloschen, wurde der Scheich gebeten, in das Zelt der Kapitänin zu kommen, und zwischen den beiden fand eine lange Unterredung statt.
Vor dem Zelte Mustaphas drängten sich die Beduinen und harrten gespannt der kommenden Enthüllungen.
Schon gestern abend hatten einige von ihnen den Auftrag bekommen, Hassan, der jetzt noch arglos schlief, scharf zu beobachten und seine etwaige Entfernung aus dem Lager zu verhüten. Desgleichen waren andere damit beschäftigt, über das Treiben Dahabs zu wachen.
Hassan lag noch träumend auf seinem weichen Teppich, als plötzlich der Vorhang des Zeltes zurückgeschlagen wurde und ihm jemand den herrischen Befehl gab, sofort aufzustehen und zum Scheich zu kommen.
»Was soll's?« rief Hassan, sich die Augen reibend. »Können diese reisenden Franken ihren Weg nicht allein finden? Soll Hassan ihnen wieder einmal als Wegweiser dienen?«
»Gehorche und komme!« sagte drohend der Beduine.
Jetzt ward Hassan stutzig. Er sah, daß vor dem Eingange seines Zeltes mehrere Mäuner standen, bereit, ihn in Empfang zu nehmen. Sein böses Gewissen machte das Herz schneller schlagen.
Eiligst stand er auf, schlug den Burnus um die Schultern und trat aus dem Zelt. Sofort nahmen ihn zwei Männer in die Mitte, führten ihn nach dem Zelt des Scheichs, und Hassans Gesicht entfärbte sich, als er sah, daß ein Gericht abgehalten werden sollte, und daß er der zu Verhörende sei.
Mustapha saß mit gekreuzten Beinen auf einem Teppich; neben ihm stand eine der Damen, welche gestern gekommen waren, und sprach in einer fremden Zunge zu dem sie begleitenden Neger. Rings um diese Gruppe scharten sich die Stammesgehörigen, aber nur die Männer, die Weiber durften an derartigen Versammlungen nicht teilnehmen. Auf der einen Seite standen die männlichen Gäste, auf der anderen die Damen.
Diese verfluchten Franken! Was führte sie hierher, ein Gericht zu veranlassen? Hatte er sie betrogen? Hatte er ihnen schlechte Pferde verkauft? Nein, er kannte sie gar nicht! Sein Auge schweifte unwillkürlich über die Versammlung hinweg. Wie gewöhnlich, so standen die Pferde der Gastfreunde auch hier um das große Zelt des Scheichs, die Zügel nur leicht über eingerammte Pflöcke geworfen.
Zwischen ihnen erkannte Hassan auch das dem Dahab gehörige. Sofort suchte er diesen unter den Zuschauern, und bald hatte er ihn herausgefunden. Auch Dahabs Gewissen schien nicht ganz rein, denn es gelang ihm nur schwer, seine Aufregung zu verbergen. Die Arme übereinandergeschlagen, die schmalen Lippen fest zusammengepreßt, starrte er finster vor sich hin und würdigte seine Umgebung keines Blickes. Da begegneten seine Augen denen Hassans, und dieser bemerkte, wie jener leicht zusammenzuckte. Neben ihm stand sein Vater, der Scheich eines Stammes der Bauiti, ein ehrwürdiger, guter und allgemein beliebter Mann.
Jetzt trat Hassan vor Mustapha. Er hatte seine Fassung wiedergewonnen; beweisen konnte man ihm nichts, er hatte die Fremdlinge noch nie gesehen, Salim war noch nicht zurück – es war zweifelhaft, ob er überhaupt je wiederkam – und so mußte die Versammlung sicher verschoben werden. Aber er wollte nicht warten, sondern sobald wie möglich für immer verschwinden; der Boden fing an, ihm unter den Füßen zu brennen. Frech blickte er dem alten Scheich ins Gesicht.
Die Einleitung zu der Verhandlung mußte schon vor seiner Vorführung begonnen haben, denn Mustapha erhob sofort die Anklage gegen ihn.
»Vor sechs Monaten,« begann er mit vor Erregung zitternder Stimme, »wurden mein einziges Kind, Sulima, und ein anderes Mädchen, Seddah, mit Gewalt von fremden Räubern entführt, welche sich als Reisende ausgaben und meine Gastfreundschaft beanspruchten. Durch List gelang es ihnen, unsere jungen Männer aus dem Lager zu entfernen, dann führten sie ihren verruchten Plan aus. Ist dir dies bewußt?«
»Ja,« entgegnete Hassan, »und ich ...«
Der Scheich winkte ihm zu schweigen.
»Diese edle Dame hier,« er wies dabei auf die neben ihm stehende Ellen, »kommt weit aus dem Abendlande her, um dich, Hassan-ben-Tomar, zu beschuldigen, du habest jene Räuber angeworben.«
Hatte man erwartet, diese offene Anklage würde Hassan niederschmettern, so war man jetzt enttäuscht, daß sie nicht den geringsten Eindruck auf den abgefeimten Spitzbuben machte.
»Mich?« rief er erstaunt aus. »Wo ist Seddah, daß sie bezeuge, wie gerade ich es gewesen bin, der alle seine Kräfte aufgeboten hat, um die Mädchen wiederzubekommen, und daß es mir auch gelungen ist, sie zu befreien, oder doch wenigstens die eine.«
Er warf einen Blick um sich, als suche er Seddah, sah aber dabei Dahab an, der ihn mit drohenden Augen anstierte. Hassan hatte geahnt, daß diese Anklage gegen ihn erhoben würde, jedenfalls waren diese Fremdlinge der verkauften Sulima irgendwo begegnet, und diese, welche ihm nie günstig gestimmt gewesen war, hatte die Vermutung ausgesprochen, daß er bei ihrer Entführung die Hand im Spiele gehabt habe. Aber die Sache war nicht so schlimm; denn Beweise konnten nicht gebracht werden, selbst wenn Sulima plötzlich wieder erschienen wäre.
Ebenso dachte Dahab, er fühlte sich vollkommen sicher.
»Wo ist Seddah?« fragte er wieder.
»Wir kennen ihre Geschichte genügend, als daß wir sie noch einmal anhören müßten,« entgegnete der Scheich, »aber wir kennen auch deine Schlauheit, mit der du uns schon oft hintergangen.«
»Beweise,« rief Hassan trotzig.
»Sie sollen dir werden.«
Der Scheich winkte, und Salim trat hinter dem Zeltvorhang hervor.
Ein Gemurmel ging durch die Reihen der Beduinen, Hassan zuckte unmerklich zusammen, wechselte einen Blick mit Dahab und sah, wie dieser die Farbe verlor.
»Dieser ist es,« rief Salim und deutete auf Hassan, »der die Räuber gedungen, er hat Sulima verkauft, und weil er für die pockennarbige Seddah keinen Käufer fand sich dann den Anschein gegeben, als hätte er dieselbe befreit.«
Doch Hassan blieb ungerührt, er lächelte höhnisch.
»Mein Sohn,« redete der Scheich Salim an, »bedenke, was du sprichst! Du urteilst über Leben und Tod eines unserer Stammesgenossen.
»Es ist so,« rief aber Salim. »Ich kam in ein Hafenstädtchen und erfuhr dort, daß ein Mann, dessen Beschreibung auf Hassan paßte, vor kurzem mit einem Türken Verhandlungen angeknüpft habe. Dieser aber war in jener Stadt unter den Arabern allgemein als Sklavenhändler bekannt, der sich hauptsächlich mit Mädchenkäufen abgab. In derselben Nacht noch, als Hassan mit diesem gesehen worden ist, wurde aus einem Hause ein Mädchen geholt und an Bord des Sklavenschiffes gebracht, während einige Tage später aus demselben Hause eine andere – es war Seddah – nach einer Stadt, welche etwa zwei Tagereisen weiter südlich liegt, geschleppt wurde. Hier erschien bald darauf Hassan abermals und will, wie er erzählt, Seddah mit Hilfe von geworbenen Helfern durch Gewalt ihren Entführern entrissen haben.«
»Ist dies nicht wahr?« rief Hassan triumphierend. »Ruft Seddah, daß sie es bestätigt!«
»Was aber sagst du zu dem ersten Teil der Beschuldigung?« fragte der Scheich streng.
»Er ist erlogen,« entgegnete der Heuchler entrüstet. »Es giebt noch andere Leute, welche so aussehen, wie ich. Eine Ungerechtigkeit ist es, daß auf die leere Aussage fremder Personen ein Unschuldiger auch nur des Verbrechens verdächtigt wird.«
»Ist dir auch dies eine fremde Person?« fragte der Scheich und wies dabei auf den Eingang des Zeltes, in welchem in diesem Augenblick Sulima erschien. Ein allgemeiner Freudenschrei der Beduinen bewillkommnete die Wiedergefundene.
Mustapha, wie auch Ellen, beobachteten den Delinquenten scharf, aber dieser hatte seine Züge so in der Gewalt, daß in ihnen eher ein freudiges Erstaunen, als Schrecken zu lesen war.
»Sulima!« rief er in herzlichem Tone. »Wie mich das freut, daß du gerettet worden bist!«
Ellen wurde unruhig; sie hatte erwartet, daß diese Begegnung mit Sulima einen anderen Eindruck bei Hassan hervorrufen würde.
Sulima deutete mit ausgestreckter Hand auf Hassan.
»Diesen Mann dort habe ich vom Fenster des Zimmers, in dem ich gefangen gehalten wurde, dabei beobachtet, wie er von einem Türken Goldstücke ausgezahlt bekommen hat.«
»Wie willst du mich erkannt haben, wenn es Nacht gewesen ist?« unterbrach sie Hassan, verlor aber doch für eine Sekunde seine Fassung, als er sich der Unklugheit bewußt wurde, die er eben begangen. Aber es war zu spät, den Sinn des Satzes zu ändern.
Mustapha war aufgestanden und maß den Menschen der eine solche Entrüstung heucheln konnte, mit drohenden Augen.
»Wenn es Nacht gewesen ist?« wiederholte er langsam, Wort für Wort eigentümlich betonend. »Woher weißt du denn, Hassan, daß der Handel zwischen dem Türken und dem Betreffenden, der dir so ähnlich sah, des Nachts abgeschlossen wurde?«
Hassan hatte schnell seine Frechheit wieder gefunden.
»Nun, hat dir's Sulima nicht vorhin selbst gesagt?« fragte er die anderen Zuhörer.
Er warf dabei einen Blick auf Dahab, als hoffe er, daß dieser die Behauptung bejahen würde, aber derselbe preßte die Lippen fest zusammen und beobachtete mit glühenden Augen den Angeschuldigten. Von ihm hatte er also keine Unterstützung zu erwarten.
Ein drohendes Murmeln ging durch die Reihen der Beduinen.
»Du siehst, daß du dich selbst gefangen hast. Gestehe die Wahrheit, gieb deine Mitschuldigen an, und deine Bestrafung soll eine mildere sein!«
Wieder streiften Hassans scheue Augen Dahab. Fast war es, als ob dieser sprechen wollte, aber er schwieg.
»Du beharrst beim Leugnen? Gut so –«
»Wo sind Beweise?« unterbrach ihn aber Hassan trotzig. »Ich bin ein Beni Suef, zwei Zeugen verlange ich, die mich gesehen haben wollen und wider mich auftreten.«
»Bursche,« entgegnete der Scheich drohend, »wir kennen deinen tückischen, dir vom Teufel eingegebenen Geist. Seit Jahren hast du uns betrogen und unseren Gewinn geschmälert. Dein Geiz, deine Habsucht sind zu bekannt, um dir nicht auch einen Raub an unseren eigenen Jungfrauen zuzutrauen.«
»Beweise,« beharrte Hassan, dessen einzige Hoffnung noch darauf beruhte, daß solche nicht gebracht werden konnten; denn Sulimas Aussage genügte umsoweniger, als sie ein Weib war, welches bei den Muhamedanern eine untergeordnete Stellung einnimmt.
»Wir werden deine Zunge gelenk zu machen wissen,« rief der Scheich jetzt erregt, »du weißt, es steht mir die Macht zu, dich zum Geständnis zu zwingen.«
»Nicht einen unseres Stammes,« stammelte Hassan erschrocken. »Du bist wohl zum Scheich erwählt, aber deine Herrschaft hat Grenzen.«
»Elender Wicht,« donnerte der Scheich, »auch deiner Frechheit ist ein Ziel gesetzt. Wisse aber, nicht ich richte dich, sondern die Männer der Beni-Suef, und sie sind damit einverstanden, daß du die Bastonnade erhältst, bis du gestehst.«
Sofort fühlte sich Hassan von hinten umfaßt und zu Boden geworfen. Das war zuviel für den dreisten, aber feigen Beduinen. Schon wurden ihm die Sandalen von den Füßen gerissen, er wollte noch einen hilfesuchenden Blick auf den jungen Scheich der Bauitis richten, aber dessen Platz war leer. Da gellte es entsetzt von seinen Lippen:
»Gnade! Nicht ich bin der Urheber des Streiches, Dahab hat mich dafür bezahlt.«
»Dahab!« schallte es wie ein Echo ringsum.
»Dahab! Ich dachte es mir,« flüsterte dessen Vater, mit der Hand nach dem Herzen fahrend.
»Haltet Dahab, er will fliehen,« heulte wieder Hassans vor Angst heisere Stimme; er fühlte schon in Gedanken die Schläge des Rohres, das bei jedem Hieb die Fußsohlen blutig reißt.
Da vernahm man plötzlich auf dem weißen Sande, fast unhörbar, die Galoppsprünge eines Pferdes, das durch die Zeltgasse jagte, aber an der Menge erst vorüber mußte.

Im nächsten Moment sauste ein braunes Roß vorbei, und auf seinem Rücken saß Dahab, der das Tier in Carriere rücksichtslos durch die überraschten Beduinen trieb.
»Haltet ihn! Er ist der Schuldige!« brüllte Hassan, der ihn sah.
»Haltet ihn!« schrieen jetzt auch die übrigen Männer, aber es war fast zu spät, der Schurke hatte den Ausgang der Zeltgasse erreicht.
Schon war er im Freien, als zwei Araber von beiden Seiten hinzusprangen, um dem Pferde in die Zügel zu fallen. Doch da blitzte es links und rechts zu gleicher Zeit auf, ein Krachen erscholl, und lautlos sanken die beiden Beduinen in den Sand.
Dahab ließ zwei Leichen hinter sich.
Noch standen alle vor Schrecken über dieses neue Verbrechen im Lager wie erstarrt, als wieder der Hufschlag eines flüchtigen Pferdes gehört wurde.
Ein Grauschimmel schoß an ihnen vorbei, aber kein Mann saß im Sattel, sondern ein Weib.
»Ellen!« schrie Harrlington aus. »Ist dieses Mädchen wahnsinnig? Ihr nach!«
Alle Männer stürzten jetzt nach den Pferden, schwangen sich auf und setzten den beiden nach, aber Lord Harrlington, allen anderen voran, sah sofort, daß Ellen kein Beistand zu leisten war, denn ebenso wie der edle Vollbluthengst Dahabs, so übertraf auch ihr prächtiger Grauschimmel alle übrigen Pferde bedeutend an Schnelligkeit. Schon hatten sie einen großen Vorsprung, eine Kugel hätte den Flüchtigen nicht mehr erreicht, während Ellen von Dahab nur etwa dreißig Meter entfernt war und sich ihm immer mehr und mehr näherte.
Dennoch stürmte Harrlington beiden nach, ihm zur Seite Salim, der vor Wut mit den Zähnen knirschte.
Plötzlich stieß der Lord einen Schreckensruf aus. Deutlich konnte er wahrnehmen, wie Dahab die Zügel seines jagenden Rosses fahren ließ und sich mit dem Laden seiner Pistole beschäftigte, aber zugleich zeigte auch Ellen ein sonderbares Benehmen. Auch sie ließ dem Grauschimmel freien Lauf und schien, vornübergebeugt, mit irgendetwas beschäftigt.
Harrlington stöhnte auf und drückte dem Tiere verzweifelt die Sporen in die Weichen. Immer weiter hatten sich die beiden entfernt, aber doch konnte er noch deutlich wahrnehmen, wie sich jetzt Dahab im Sattel wendete und auf Ellen anschlug.
Doch was war das? Warum erhob sie ihre Hand und schien dem Flüchtling zu winken? Sie hätte ihn doch vom Pferde schießen können? Der Lord wußte, daß Ellen stets einen Revolver bei sich führte.
Eben hob Dahab den Arm zum sicheren Schuß, da riß plötzlich Ellen ihr Pferd zurück, und gleichzeitig wurde der Beduine wie durch Zauberkraft aus dem Sattel geschleudert. Ellen lenkte um, hinter sich den Körper Dahabs nachschleppend.
Jetzt verstand Harrlington die Handlung des Mädchens.
Ellen hatte einen Lasso bei sich gehabt, jenen geflochtenen Ledergurt, und er erinnerte sich auch, daß sie bei den Cow-boys aufgewachsen war und von diesen wahrscheinlich den Gebrauch der Wurfschlinge gelernt hatte. Aber ein solches Geschick und solche Kaltblütigkeit, im letzten Augenblick den Flüchtling zu Boden zu werfen, hätte er ihr nicht zugetraut.
»Sie sind diesmal mit mir zufrieden, Lord?« fragte sie lachend, als er sie erreicht hatte.
»Sie stürzen sich in unnütze Gefahren, Miß Petersen,« antwortete dieser. »Was kümmerte es sie, ob Dahab entkam oder nicht?«
»Wer so wie ich viele Jahre unter Cow-boys gelebt und mit ihnen stets verkehrt hat, dem geht diese Lust am wilden Jagen ins Blut. Außerdem war für mich durchaus keine Gefahr vorhanden, ich konnte den Flüchtling jederzeit vom Pferde holen; meine Lehrmeister würden mich allerdings, wenn sie Zuschauer gewesen wären, getadelt haben, daß ich nicht gleichzeitig das Tier mit gefangen habe. Sie sehen, ich passe besser in die Wüste oder in die Prärie als in große Städte; hier würde es nicht so schwer sein, mich zu überwältigen. Doch was macht mein Gefangener? Ihm wird während meines Trabes übel mitgespielt worden sein.«
Das war allerdings der Fall. Der Lasso hatte die Arme Dahabs fest an dessen Seiten geschnürt, sodaß er sich nicht hatte aufrichten können, sondern wehrlos nachgeschleift worden war. Hätte der Boden nicht aus weichem Sand bestanden, so würde er wohl noch anders zugerichtet gewesen sein, aber auch so zeigte sein Gesicht blutende Streifen.
Die Beduinen umringten den Gefangenen und nahmen ihm die Lederschleife ab; an Flucht war jetzt nicht mehr zu denken. Die Augen stier zu Boden geheftet, so schritt er stumm und den Kopf gesenkt, nach dem Lager zurück. Als er an dem Scheich der Bauitis vorbeigeführt wurde, hob er den Kopf, doch sein Vater wandte sich um und spuckte verächtlich vor dem Mädchenräuber aus. Also auch sein Vater verurteilte ihn. So hatte er keine Hoffnung mehr.
Unter den Beduinen Arabiens und Nordafrikas herrscht ein äußerst ritterlicher Sinn. Wohl berauben und plündern sie Karawanen, welche den Durchgangszoll durch das Gebiet der einzelnen Stämme verweigern, und geben die gefangenen Männer und Frauen nur gegen ein Lösegeld heraus, wohl führen sie einer Kleinigkeit willen blutige Kriege gegen einen Nachbarstaat und, wenn dieser besiegt ist und einen an Vieh und Geld geforderten Betrag nicht geben will, vernichten sie ihn, die erbeuteten Frauen und Mädchen als Eigentum in Beschlag nehmend, aber dies alles nennen sie keinen Raub, sondern ihr Recht. Die That hingegen, die Dahab ausgeführt hatte, ein Mädchen von einem befreundeten Stamme, mit dem die Bauitis in Frieden und Tauschhandel leben, durch List, Gewalt oder gar durch bezahlte Wüstenräuber entführen zu lassen, das war eine für einen Beduinen über alle Begriffe schmachvolle Handlung. Hätte Dahab sein Leben aufs Spiel gesetzt, um sich in den Besitz des Mädchens zu bringen, welches er liebte, so wäre er weniger hart beurteilt worden.
Unterdes hatte Sulima noch erzählt, wie sie einst nur durch Salims Dazwischenkunft vor Dahabs Frechheit bewahrt geblieben sei, was vollends den Ausschlag gab. Desgleichen schilderte nun Hassan, wie Dahab ihm zehn Goldstücke gegeben und ihm die doppelte Summe versprochen habe, wenn er Sulima in seine Gewalt bringe, alle Unkosten würde er extra zurückerstatten.
Er, Hassan, habe nun Wüstenräuber, wie sie immer in der Nähe von Städten käuflich sind, gedungen, Sulima zu entführen, und, um gleich mehr Profit von dem Geschäfte zu erlangen, auch noch eine andere rauben lassen. In jenem Hafen aber, den die Räuber zuerst erreichten, und wohin er bald nachfolgte, hatte ihm ein türkischer Mädchenhändler für Sulima eine sehr hohe Summe geboten, sodaß er beschloß, Dahab um die Beute zu prellen. Er verkaufte sie, spiegelte Dahab vor, Sulima sei ihm von anderen mit Gewalt abgenommen worden, und ließ Seddah nach einer abgelegenen Stadt bringen, wo er sie dann, dem Anscheine nach, befreite, um so einen etwaigen Verdacht von sich abzulenken. Dahab hatte ihm zwar nie recht geglaubt, aber er fühlte sich als Mitschuldiger, vielmehr als Veranlasser zu dem Mädchendiebstahl und hätte ihn in Ruhe gelassen, hoffend, daß alles in Dunkel gehüllt bliebe. Hassan habe immer vermieden, mit Dahab unter vier Augen zusammenzutreffen; denn er kannte dessen tückischen Charakter und wußte, daß derselbe nur auf eine Gelegenheit lauerte, den Mitwisser seiner Schuld für immer stumm zu machen.
Als die Verfolger zurückgekommen waren, teilte Salim auch noch den Ueberfall unterwegs durch die fremden Araber mit, und Hassan gestand, daß er von Dahab beauftragt worden wäre, Salim aus der Welt zu schaffen, da er doch etwas von Dahabs Plänen erfahren haben könnte, und außerdem, weil dieser den Jüngling wegen jener Züchtigung glühend haßte.
Die ganze Schlechtigkeit Dahabs schien heute mit einem Male an den Tag zu kommen; die Entrüstung der Beduinen war aufs höchste gestiegen.
Der alte Scheich der Bauitis verließ mit seinen Begleitern das Lager, er wollte dem Gericht über Dahab nicht beiwohnen – er hatte keinen Sohn mehr.
»So führt Dahab vor,« rief jetzt Mustapha, »er ist uns zur Verurteilung überlassen.«
Der Scheich hatte denselben einstweilen binden lassen und in Obhut einiger seiner Leute gegeben.
Sofort sah man, wie zwei Männer in einem Zelt verschwanden und bald darauf den Körper Dahabs heraustrugen, ihn stumm zu den Füßen des Scheichs hinlegend.

Kaum hatte dieser ihn erblickt, als er von seinem Teppich aufsprang und im Tone des Unwillens ausrief:
»Wer hat das gethan? Wer hat den Befehl dazu gegeben?«
»Wir haben es gethan,« sagte einer der Beduinen, welche Dahab getragen hatten, finster, »wir sind die Brüder der beiden Ermordeten; unser ist das Recht, ihn zu töten.«
Schaudernd wandten sich die Damen ab, es graute ihnen vor dem Anblick, der sich ihnen bot; das Gewand des am Boden liegenden war über und über mit Blut bedeckt, seine Brust zeigte unzählige Dolchstiche. Der Tod, der Dahab beschieden, war schneller an ihn herangetreten, als der Scheich gewollt hatte.
Aber durch die Reihen der umstehenden Beduinen ging ein beifälliges Gemurmel– die vier Männer hatten recht gehandelt. Dahab hatte ihre Brüder ermordet, und das Gesetz der Wüste, die Blutrache fordert, daß sie sich keine Gelegenheit entgehen ließen, die Seele des Mörders denen der Getöteten nachzuschicken. Ihre Handlungsweise mußte selbst der Richter billigen.
Ellen ging durch die Zeltstraße, um Johanna zu suchen, welche schon seit einiger Zeit den Richtplatz verlassen hatte. Sie traf das Mädchen, als es eben mit Sulima aus einem Zelte trat, ein Buch in der Hand.
»Tod und Mord,« fagte sie, »wohin man sieht, es ist selbst für meine Nerven zuviel. Ich bereue bitter, Dahab wieder eingefangen zu haben.«
»Thun Sie dies nicht,« bat Sulima, »er wäre weder den Bluträchern, noch Salim entgangen. Aber mir ist es unsäglich leid, daß Sie meinetwegen Zeugin dieser Szene geworden sind. Wie soll ich Ihnen danken?«
Ellen wehrte Sulima freundlich ab.
»Was haben Sie einstweilen ausgeforscht, liebe Jane?« fragte sie Johanna, »Sie sind gewiß abermals auf einer neuen Spur.«
»Allerdings,« lächelte Johanna, »Sulima zeigte mir die Andenken an Salims Mutter, und da habe ich verschiedenes Wichtige gefunden. So zum Beispiel verrät die Bibel, daß Karo-hissar eine Deutsche war, denn das Buch ist in deutschen Lettern gedruckt. Ferner steht eine Widmung darin, welche auf ihren Vornamen schließen läßt. Auch eine Photographie, aber nicht ihre, und einige Briefe mit Daten, Nennung von Städten und Unterschriften habe ich gefunden, alles sehr wichtig, um auf die Spur von Karo-hissars Abstammung zu kommen. Ich werde die Nachforschungen vielleicht später selbst betreiben,« fügte sie nachdenklich hinzu.
»Sie haben eine richtige Spürnase, Miß Lind,« lachte Ellen. »Wissen Sie, wenn Sie ein Mann wären, so müßten Sie Detektiv werden.«
Johanna wandte sich etwas verlegen ab.
»Nun, ich scherze ja nur,« fuhr Ellen schnell fort. »Es ist ein elendes Handwerk, als Spion bezahlt zu werden.«
»Von Salim selbst habe ich nicht das mindeste über seine Mutter erfahren können, nur ihr Aussehen konnte er mir sehr genau beschreiben. Man interessiert sich doch auch für die Eltern derer, denen man Teilnahme gezeigt hat.«
»Gewiß,« bestätigte Ellen.
»Wann gedenken Sie das Lager wieder zu verlassen?«
»So bald wie möglich. Am liebsten möchte ich noch heute aufbrechen, doch die Sonne beginnt schon sich zu neigen. Aber morgen mit Tagesanbruch sollen unsere Pferde gesattelt sein – bis dahin wird uns wohl der Scheich noch Gastfreundschaft gewähren.«
»So lange Sie wollen,« rief Sulima, »ein jeder Tag, den Sie und Ihre Freunde in unserem Zelte weilen, soll uns ein Tag der Freude sein. Wie können Sie nur so fragen!«
Jetzt erschollen Jammertöne von dem Richtplatz aus.
»Was wird das Schicksal Hassans sein?« fragte Ellen das Beduinenmädchen.
»Ich weiß es noch nicht, aber getötet muß er werden. Mädchenraub wird mit dem Tode bestraft, man ist dies schon mir und Salim schuldig. Er wird unter vielen Qualen sterben müssen.«
»Wann wirst du mit Salim vereinigt werden?«
»Wann es mein Vater will,« entgegnete das Mädchen mit einem glücklichen Lächeln. »Diesmal wird Allah nicht wieder unsere Freude stören.«
»Wir wollen es hoffen.«
Die anderen Damen näherten sich der Gruppe.
»Es ist entsetzlich,« sagte eine, »jetzt wird Hassan draußen in der Wüste eingegraben, so daß nur der Kopf aus dem Sande hervorragt. Ueber Nacht kommen die Schakale und Hyänen, fressen erst ...«
»Malen Sie diese Schrecknisse nicht aus,« unterbrach sie Ellen, sich schüttelnd.
»Es giebt noch härtere Strafen für solche Verbrechen,« meinte Sulima.
Im Jahre 1869 wurde der Schiffahrt eine Verkehrsstraße übergeben, deren Anlegung einst der weitsichtige Napoleon I. für das größte Ereignis in der Weltgeschichte erklärt hatte. Denkt die Gegenwart, denen sie bereits etwas Bekanntes ist, auch anders darüber, so hat sie doch im Seehandel einen vollkommenen Umschwung bewirkt.
Ein geistreicher Franzose, der Ingenieur Lesseps, war es, der zuerst energisch mit dem Plane umging, die enge Verbindung zwischen Afrika und Asien zu durchstechen, er bewies durch Rechnungen, daß der verschieden hohe Wasserstand des roten und des mittelländischen Meeres, welche die Landenge zu beiden Seiten bespülen, keine Schwierigkeiten bereiten würde, hatte ja doch wahrscheinlich schon einmal eine Wasserstraße hier existiert, wie die zahlreichen Salzseen auf dem Isthmus bezeugten, und schritt nach Aufbringen des nötigen Geldes an's Werk.
Was für eine Ersparnis die Dampfer, welche von europäischen Häfen nach Asien, nach der Ostküste von Afrika und nach Australien fahren, durch den Kanal haben, möge nur eine einzige kleine Rechnung zeigen.
Um die Kosten für die fortwährende Ausbaggerung des Kanals – weil derselbe an Wüsten grenzt, droht er wieder zu versanden, wenn der lose Sand nicht ununterbrochen ausgeschöpft wird – zu decken, ebenso den Gehalt der angestellten Beamten und so weiter zu bestreiten, muß natürlich von jedem Schiff ein Durchgangszoll erhoben werden.
Er wird nach der Tragkraft der Schiffe berechnet, und zwar kostet die Tonne – 20 Centner – etwas mehr als 10 Mark. Selbst kleine Dampfer haben aber eine Tragkraft von 2000 Tonnen, sodaß sie also für eine einzige Durchfahrt etwa 20,000 Mark bezahlen müssen, für jeden Passagier noch 5 Mark extra.
Würde ein Dampfer diese Summe nicht ausgeben wollen, sondern lieber um das Kap der guten Hoffnung, die Südspitze Afrikas, seinem Ziele zufahren, so braucht er einige Wochen länger, hat also viel mehr für Kohlen, Gehalt und Beköstigung der Mannschaft und so weiter auszugeben, was die oben angegebene Summe bedeutend übersteigt. Daher fährt kein Dampfer, der von Europa nach dem indischen Ozean bestimmt ist, die alte Wasserstraße, sondern nur durch den Suezkanal.
Die Segelschiffe, deren einzigste Triebkraft der Wind ist, nehmen natürlich nicht diesen kostspieligen Weg, sondern segeln nach wie vor um das Kap der guten Hoffnung. Nur sehr selten sieht man einmal ein solch stattliches Fahrzeug mit hoher Takelage durch den Kanal schleppen, sie haben dann gewöhnlich eine Ladung, welche man lieber einem Segler als einem Dampfer anvertraut, so zum Beispiel feuergefährliche Sachen, auf deren Fracht die zum Durchfahren des Suezkanals nötige Summe natürlich geschlagen werden muß.
Von einem kleinen Dampfer wurden zwei durch Stahltaue aneinander gebundene Segler geschleppt, deren schlanker, zierlicher Bau nicht auf Frachtfahrzeuge schließen ließ. Und dennoch befanden sich an Bord des ersteren, größeren Schiffes feuergefährliche Dinge, nämlich die Augen der Matrosen, welche an dem kupfernen Geländer lehnten, teils das Panorama der Wüste betrachtend, teils sich mit der Mannschaft der hinter ihnen fahrenden Brigg unterhaltend.
Es waren die ›Vesta‹ und der ›Amor‹, deren Besatzungen das Bezahlen des Durchfahrtsgeldes keine Kopfschmerzen machte.
Streng nach Vorschrift dampfte der kleine Schlepper, den Kanallotsen an Bord, vier Knoten in der Stunde, das heißt eine deutsche Meile, also sehr langsam, um einem ihm begegnenden Schiffe rechtzeitig ausweichen zu können.
Der Kanal ist nicht so breit, um zwei Schiffe aneinander vorbeizulassen, von einem großen Passagierdampfer könnte man sogar zu beiden Seiten an's Ufer springen, aber aller zwei Meilen sind sogenannte Stationen angebracht, Ausbuchtungen, in welchen das Schiff, welches eine solche zuerst erreicht hat, dem ihm begegnenden ausweichen muß. An jeder Station befindet sich ein Turm, von dem aus ein Beamter die Hälfte des Weges bis zur nächsten Station beobachtet und dem Schiff, welches in die Bucht einfahren soll, das Flaggensignal dazu giebt.

Außerdem dürfen die Dampfer, welche keinen elektrischen Scheinwerfer an Bord haben, nicht des Nachts fahren, sondern müssen während der Dunkelheit in einer Bucht liegen bleiben.
Das gleiche Schicksal hatten also der ›Amor‹ und die ›Vesta‹ zu erwarten.
Eben unterhielten sich einige Damen, darunter die Kapitänin, welche bereits einmal den Suezkanal passiert hatte, über diese Thatsache.
»Wo werden wir die Nacht zubringen? Im großen Bittersee?« fragte eines der Mädchen.
»Ich glaube kaum, daß wir so weit kommen werden,« erwiderte Ellen. »Meiner Berechnung nach müssen wir zwischen dem Bittersee und Kautare, einer Poststation, wo auch die von Afrika nach Arabien einwandernden Karawanen übergesetzt werden, anlegen.«
»Wann erreichen wir wieder die offene See?«
»Morgen Nachmittag bestimmt. Es ist eine traurige Gegend, Sand, nichts als Sand, höchstens hier und da etwas elendes Buschwerk – und dennoch wohnen Tiere, sogar Menschen hier.«
»Und haben ihre Heimat auch lieb,« ergänzte Johanna.
»Sie halten sie für den schönsten Ort der Erde,« sagte eine andere.
»Was mögen nur die Herren da drüben haben? Sie wollen sich ja halb tot lachen,« unterbrach jemand eine kurze Pause in der Unterhaltung.
Die Damen wandten ihre Aufmerksamkeit der Brigg zu, auf der eine Gruppe Herren um Williams standen, der allerlei seltsame Grimassen schnitt, Bocksprünge machte und unartikulierte Töne ausstieß.
»Natürlich ist es Sir Williams, kein anderer; in dessen Kopf möchte ich einmal hineinsehen können. Aber er ist der beste Mensch und zuverlässigste Freund, den es auf der Welt giebt,« sagte Miß Thomson.
»Sie scheinen ja außerordentlich viel auf ihn zu halten,« lächelte Ellen.
»Ich sage nur die Wahrheit,« entgegnete Miß Thomson, errötete aber über und über.
»Was mag eigentlich der Grund gewesen sein, daß vier der Herren in Port Said den ›Amor‹ verließen und mit der Bahn wegfuhren? Rätselhaft ist es auch, daß die anderen Herren durchaus nicht mit der Wahrheit herauswollen.« – »Haben Sie jemanden darüber gefragt?« – »Ja, Lord Hastings.«
»Da sind Sie gerade an den Richtigen gekommen, der angelt bereits geschlagene sieben Stunden, läßt sich das Essen hinbringen und fährt jeden grob an, der ihn sonst stört,« lachte ein Mädchen.
»Einer Dame gegenüber wird er wohl etwas höflicher gewesen sein!«
»Unhöflich war er zwar nicht, aber immer noch grob genug, und als sich ein Fisch seinem Köder näherte, hörte er mich gar nicht mehr an.«
»Wenn Sie ein Geheimnis der Herren erfahren wollen, so brauchen Sie mir dies nur zu wissen zu geben, ich besitze den Schlüssel dazu. Passen Sie auf, in fünf Minuten will ich es gelöst haben,« sagte Miß Thomson und schritt dem Hinterteil des Schiffes zu.
»Sir Williams,« rief sie, »bitte, kann ich Sie für eine Minute sprechen?«
Der Angerufene hörte sofort mit seiner Vorstellung auf, legte das Gesicht in möglichst ernste Falten und leistete eiligst der Aufforderung Folge.
»Was wünschen Sie, Miß Thomson?«
»Sie führen dort wohl einen Indianertanz auf?«
»Aber Miß, haben Sie denn nicht gehört, daß ich eine Rede gehalten habe?«
»Nein, wirklich nicht. Ich glaubte eher, Sie versuchten, einen Orang-Utang nachzuahmen!«
»O! Sie kennen doch den englischen Kanzelredner Mister Flamming?«
»Ich habe schon von ihm gehört, er soll ein wunderlicher Kauz sein.«
»Nun, in dessen Stil habe ich gepredigt. Etwas Gliederverrenkung ist dabei unbedingt nötig.«
»Was ich noch fragen wollte, Williams – Sir Williams –«
»Bitte, nennen Sie mich einfach Williams, von allen berühmten Männern spricht man nur mit ihrem einfachen Namen. Wenn es Ihnen beliebt, dürfen Sie auch Charles sagen, das klingt viel hübscher.«
»So hören Sie doch endlich auf!« lachte das Mädchen. »Sagen Sie, wo sind die Herren geblieben, die in Port Said den ›Amor‹ verließen?«
»Sie sind gar nicht geblieben; sie sind abgereist.«
»Wohin aber, das will ich eben wissen!«
Williams zog ein schlaues Gesicht.
»Was geben Sie mir, wenn ich es Ihnen sage?«
»Das ist unhöflich.«
»Ist mir ganz egal! Ich darf es eigentlich nicht sagen; eine furchtbare Strafe droht dem, der das Geheimnis verrät. Aber schön soll es werden, Miß Thomson, reizend! Passen Sie auf, Sie fallen aus einem Entzücken in das andere!«
Jetzt hatte das Mädchen Williams so weit, wie es ihn haben wollte; er fing von selbst an zu plaudern.
»Warum denn über die herrliche Nacht?«
»Ja, auch das; es wird eine reizende Nacht, alles erleuchtet – halt, bald hätte ich es verraten, aber ich sage es Ihnen nicht, Sie erzählen es doch gleich den anderen Damen wieder. Wer das Geheimnis preisgiebt, darf heute abend nicht t ...«
»Was darf er nicht t ...«
»Taue mit Theer einschmieren.«
»Auch mir wollen Sie es nicht sagen? Mir, Ihrer Freundin? Für so schlecht hätte ich Sie nicht gehalten.«
»Ach, verehrteste Miß Thomson,« begann Charles mit kläglicher Stimme, »Sie machen nur das Herz furchtbar schwer.«
»Schreiben Sie es mir auf dann sagen Sie es nicht!«
»Auch das darf ich nicht, ich kann überhaupt gar nicht schreiben. Aber halt! Rätsel aufgeben ist nicht verboten. Hören Sie, was ist das? Es fliegt durch die Luft, es schwimmt auf dem Wasser und ist rund.«
»Völlig rund?«
»Rund, nur rund.«
»Dann weiß ich's nicht.«
»Ja, es ist ein bißchen schwer, ich will es Ihnen leichter machen, der erste Buchstabe ist b, der letzte l und der mittelste a.«
»Bal – Ball?«
»Mein Gott, Fräulein, ich bewundere Ihren Scharfsinn!«
»Wie? Heute abend soll ein Ball stattfinden?« rief das Mädchen erstaunt. »Sie scherzen wohl?«
»Pst, nicht so laut! Wenn es gemerkt wird, daß ich Ihnen das Geheimnis verraten habe, darf ich heute abend nicht mit Ihnen tanzen, und dann wäre Ihnen doch das ganze Vergnügen gestört.«
»Aber wo soll der Ball denn abgehalten werden? Wohl an Bord Ihrer Brigg?«
»Ach, der alte Backtrog,« sagte Charles verächtlich. »Nein, die vier Herren sind vorausgereist, um an einer Stelle über den Kanal Bretter zu legen, auf denen getanzt werden soll.«
»Auf Wiedersehen denn,« sagte Miß Thomson, die das alles nicht glaubte, lächelnd, »jetzt gehe ich zu den Damen und gebe ihnen Rätsel auf.«
»Miß Thomson,« flehte Charles, »machen Sie mich und sich nicht unglücklich.«
»Nun, was haben Sie denn herausgebracht?« fragten die Damen neugierig, als sich ihnen das Mädchen wieder zugesellte.
»Williams setzte mir heute doch einmal einen ganz energischen Widerstand entgegen,« antwortete die Gefragte, »nur soviel habe ich erfahren können, daß die Herren irgend eine Überraschung bereithalten, wahrscheinlich eine Illumination oder so etwas Aehnliches.«
Miß Thomson glaubte nicht daran, daß die Herren wirklich einen Ball arrangieren wollten, Charles hatte ihr dies nur weismachen wollen. Aber auch, wenn sie ihm getraut hätte, war sie doch zu diskret, um ein ihr anvertrautes Geheimnis zu verraten. Sie wußte recht wohl, welchen Einfluß ihre Bitten auf den gutherzigen Charles ausüben konnten.
»Dort taucht Kantare auf,« rief Ellen, »die Karawanen- und Poststation.«
Kantare macht Anspruch auf den Namen einer Ortschaft, besteht aber nur aus wenigen erbärmlichen Lehmhütten. Ein einziges Haus macht davon eine Ausnahme; es ist nach europäischem Stil erbaut und dient gleichzeitig als Postgebäude und als Hotel, um den mit den Karawanen reisenden Händlern nach dem beschwerlichen Wüstenmarsch einmal ein gutes Quartier bieten zu können.
»Das macht einen sonderbaren Eindruck,« sagte ein Mädchen und deutete auf das Firmenschild des Hauses. »Hier mitten in der Wüste wird die Benutzung eines guten franzosischen Billards empfohlen.«
In der That waren auf das Brett zwei gekreuzte Billardstäbe gemalt, und darunter standen die Worte: ›Gutes französisches Billard, die Stunde fünf Piaster.‹
»Sehen dort nicht zum Fenster die fehlenden vier Herren heraus und winken uns mit den Tüchern?«
»Sie wollten nur schnell einmal eine Partie Karambolage spielen,« rief Charles vom ›Amor‹ herüber.
In diesem Augenblick trat ein Postbeamter aus dem Hause und warf ein kleines Säckchen an Bord des Vollschiffes.
»Briefe für die ›Vesta‹!« rief er dabei.
Ellen hatte den Beutel geöffnet und sortierte die Briefe.
»Miß Petersen, Miß Murray, Thomson, Nikkerson, Lind – wahrhaftig, für jede ein Brief, und alle von der gleichen Hand geschrieben.«
Sie wurden aufgebrocheu und von den Mädchen gelesen, welche bald in ein fröhliches Gelächter ausbrachen.
Die in den Umschlägen befindlichen, zierlichen Billets enthielten je eine gedruckte Einladung zu einem heute abend im Hotel zu Kantare stattfindenden Ball von den englischen Herren. Die Damen waren überzeugt, daß der Verfasser der Einladung Charles Williams war; denn der Inhalt strotzte von Humor.
»Nehmen wir an?« fragte Ellen. »Ich allein habe nicht darüber zu entscheiden.«
»Natürlich nehmen wir an!« riefen die Damen einstimmig. »Ein Ball in der Wüste wird uns nie wieder geboten, den müssen wir auf alle Fälle mitmachen.«
»Der Lotse ist von Lord Harrlington bestochen, er legt schon hier an, obgleich wir noch einige Stunden fahren können.«
»Das macht nichts, uns treibt keine Pflicht. Tanzen wir in unseren Matrosenkostümen?« fragte eine.
»Nein, in Balltoilette, schlage ich vor,« meinte Ellen.
»Ein Glück ist es, daß es mehr Herren als Damen sind,« rief eine andere, »dann bleibt wenigstens keine von uns sitzen.«
»Unsere Schützlinge müssen natürlich auch mitkommen.«
»Gewiß.«
»Also fort, meine Damen! In die Kabinen! Wir haben nur noch zwei Stunden Ankleidezeit. Es ist sehr unrecht, daß uns die Herren so spät benachrichtigt haben.«
Noch lange unterhielten sich die Damen über das zu erwartende Fest, wahrend die Herren bereits alle an Land gesprungen waren und in den Zimmern des Hotels eifrig hantierten. Uebrigens enthielt dieses Haus im oberen Stock nur einige kleine Zimmer; unten die Gaststube bestand aus einem großen, schmutzigen Raum, der durch die vorausgereisten Herren einigermaßen in einen Saal verwandelt worden war, welcher sich zur Abhaltung eines Tanzvergnügens eignete. – –
Vor den Fenstern des Hotels zu Kantare standen die wenigen Bewohner des Dörfchens und lugten erstaunt durch die geöffneten Flügel in das Innere.

So etwas war ihnen doch in ihrem ganzen Leben nicht vorgekommen.
Da drinnen drehten sich nach den Klängen eines verstimmten Klaviers, einer Violine und einer Posaune schwarzbefrackte Herren und in Weiß gekleidete Damen in Paaren. Auf den primitiven Bänken, welche längs des Saales hinliefen, saßen andere, plauderten und ließen sich die von Arabern umhergereichten Erfrischungen schmecken.
Die Gesellschaft bestand aus den Besatzungen der ›Vesta‹ und des ›Amor‹.
Die Herren trugen vorschriftsmäßig Frack und weißen Schlips; die Damen aber waren nicht, wie sie erst ausgemacht hatten, in Balltoilette erschienen, sondern in einfachen, weißen Kleidern. Es war ihnen zuletzt doch unpassend erschienen, hier, mitten in der Wüste, in einer fast unbewohnten Gegend, mit den Herren in ausgeschnittener Taille sich Arm in Arm zu bewegen. Dennoch hätten sie sich in ihren einfachen Satinkleidern in jeder europäischen Gesellschaft sehen lassen können.
Um den Saal wenigstens etwas festlich zu schmücken, hatten die Herren noch vor der Ankunft der Damen ihn an der Decke und den Seiten mit bunten Lampions geziert; aber so primitiv auch alles war, die Fröhlichkeit wurde dadurch nicht beeinträchtigt. Gerade die eigentümlichen Verhältnisse trugen dazu bei, gute Laune und harmlose Scherze zu erzeugen, in denen besonders Williams Großes leistete.
»Miß Lind ist seit einiger Zeit recht trübe gestimmt?« fragte Lord Harrlington Ellen. Beide hatten neben dem Klavier Platz genommen, welches von einem der Herren unermüdlich bearbeitet wurde.
»Auch ich habe es schon gefunden,« antwortete Ellen. »Dieser Wechsel bei dem sonst immer heiteren Mädchen ist erst eingetreten, seit wir die Beni-Suef verließen. Ich kann mir den Grund hierzu nicht erklären.«
In diesem Augenblick ertönte draußen der schrille Pfiff einer Dampfpfeife.
»Ein durchfahrender Dampfer?«
»Nein,« entgegnete Harrlington, »es ist elf Uhr, und um diese Zeit legt das letzte Postboot in Kantare an.«
Eben wurde Johanna von einem Tänzer nach ihrem Platze geführt; sie dankte, setzte sich aber nicht, sondern schritt langsam, sich mit einem Fächer Kühlung zuwehend, durch den Saal der Thüre zu.
»Miß Lind ist mir das rätselhafteste Wesen, welches ich je getroffen,« sagte Ellen nachdenkend. »Sie ist so still und bescheiden und manchmal wieder in ihren Meinungen hartnäckig bis zum Eigensinn. Wird in einer Beratung der Vestalinnen ihrem Vorschlag wiedersprochen, so giebt sie nicht eher nach, als bis er angenommen ist, und wird er einstimmig abgewiesen, so geberdet sie sich wie außer sich. Allerdings kommt letzteres sehr selten, jetzt überhaupt nicht mehr vor; denn wir haben allen Grund, ihren Ratschlägen Folge zu leisten; sie ist auf jeden Fall die scharfsinnigste von uns allen.«
Der Lord lächelte.
»Wissen Sie etwas von ihrer Vergangenheit?« fragte er.
»Nichts weiter, als daß sie aus einer guter Familie in der Nähe der großen Seen Nordamerikas stammt. Miß Murray führte sie als jene Dame bei uns ein, welche damals bei dem Dammdurchbruch des Oberonsees eine großartige Bravour entwickelt hat, und das genügte, um sie sofort als Vestalin geeignet erscheinen zu lassen.«
Lord Harrlington drehte nachdenklich an seinem Schnurrbart, antwortete aber nichts.
Unterdeß hatte die Person, von der sich die beiden unterhielten, den Saal verlassen, um sich draußen etwas in der kühlen Nachtluft zu erfrischen.
Johanna merkte nicht, daß von dem Ufer des Kanals ein hochgewachsener Mann auf das Haus zuging, dann aber, als er die einsame Wandlerin bemerkte, seinen Schritt plötzlich hemmte.
Das Mädchen hatte sich wirklich, wie Harrlington zu Ellen sagte, seit einiger Zeit merklich geändert. Es schloß sich von seinen Freundinnen möglichst ab, verbrachte oft Stunden allein in seiner Kabine und gab nur einsilbige Antworten, ohne daß sich irgend eine der Vestalinnen, welche das geistreiche und energische Mädchen gern hatten, den Grund hierzu erklären konnte.
Träumend setzte es seinen Weg längs des Kanals fort, sich immer mehr von dem Hotel entfernend, ohne daß es dies beachtete. Es mußten traurige Gedanken sein, mit denen sich Johanna beschäftigte, denn der laue Wind vermochte nicht mehr die hervorquellenden Thränen zu trocknen. Sie drückte das Taschentuch an die Augen und schluchzte leise.
Da berührte eine Hand von hinten ihren Arm.
»Was fehlt Ihnen, Fräulein Lind?« fragte eine Männerstimme in teilnehmendem Tone.
»Können Sie nicht einen Teil Ihrer Sorgen auf meine breiten Schultern legen?«
»Herr Hoffmann,« rief Johanna erstaunt, noch ehe sie das Gesicht des Ankömmlings erblickte; sie kannte seine tiefe Stimme nur zu gut, eben jetzt hatte sie an ihn gedacht.
»Herr Hoffmann, Sie hier? Wir denken, der ›Blitz‹ liegt noch in Port-Said.«
»Er ist auch noch dort, ich fahre erst morgen durch den Kanal; wahrscheinlich nehme ich eine Dynamomaschine an Bord und lege die Durchfahrt nach dem roten Meere während der Nacht zurück.«
»Und was führt Sie jetzt hierher?«
»Sie, mein liebes Fräulein,« sagte der Ingenieur in herzlichem Tone. »Schon lange sehnte ich eine Stunde herbei, in welcher ich Sie einmal ungestört sprechen könnte; aber Miß Petersens Anordnungen machten dies fast ganz unmöglich. Nie trifft man einen ihrer Matrosen allein. Da erfuhr ich, daß die englischen Herren hier in Kantare eine Festlichkeit veranstalten wollten, und sofort beschloß ich, auch daran teilzunehmen, weil ich hoffte, dabei Gelegenheit zu finden, mit Ihnen einige Worte unter vier Augen zu wechseln.«
Johanna wurde sichtlich verlegen.
»Was ist es denn,« fuhr er zärtlich fort, »das Ihr junges Herz so traurig stimmt? Können Sie es nicht einem Freunde anvertrauen, der innigen Anteil, ja, mehr als dies, an Ihnen nimmt? Geteiltes Leid ist halbes Leid.«
Johanna schwieg und trocknete die Thränen.
»Halten Sie mich nicht für Ihren Freund, Johanna?«
Sie nickte, blieb aber eine Antwort schuldig.
Beide wandelten stillschweigend nebeneinander her, immer weiter von dem Hause fort, aus dem nur noch leise die Klänge der Tanzmelodien erschollen.
Es war eine wundervolle Nacht, wie man sie nur in südlichen Gegenden genießen kann. Der Vollmond beschien hell den gelben Sand der Wüste, ließ die Kiesel in seinen bleichen Strahlen blitzen und spiegelte sich in der silbernen Wasserfläche wieder. Ab und zu schnellte ein Fisch hoch empor, und zitternde Wasserringe zogen sich dann weiter und weiter, bis sie endlich den Uferrand erreichten und sich verloren. Wäre nicht noch der Schall der Posaune in die Ohren der Einsamen gedrungen, so hätte kein Laut die Stille unterbrochen, höchstens das Zirpen einer Zikade, aber gerade die entfernte Musik paßte vortrefflich zu der Landschaft, sie übte einen wunderbaren Zauber auf die Gemüter der beiden jungen Leute ans.
Nach einer langen Pause begann der Ingenieur, langsam und träumend jedes Wort betonend wieder:
»Es war am Oberonsee; der kalte Wintermorgen fing an zu dämmern. Wir hatten beide eine furchtbare Nacht hinter uns, Sie eine noch viel schwerere, als ich, denn mein gegen Wind und Wetter abgehärteter Körper empfand das lange Stehen im Eiswasser bei weitem weniger, als Ihr zarter Leib. Aber nie werde ich den Augenblick vergessen, als wir uns nach Vollbringung des Rettungswerkes am anderen Morgen wiedersahen; Sie hatten sich bereits umgezogen, denn für Sie war nichts mehr zu thun, ich hatte eben erst den letzten Balken einrammen lassen. Wir gaben uns die Hand, und Sie bemerkten, daß die meine stark blutete – ein Holzsplitter hatte sie zerrissen. Mit Ihren steif gefrorenen Fingerchen rissen Sie das Taschentuch entzwei und legten mir den ersten Verband an. Ich sehe es noch so deutlich, als wäre es erst gestern gewesen, wie Sie sich immer in die verklommenen Hände hauchten, weil sich der Faden nicht knoten lassen wollte. Wissen Sie es noch, Johanna?«
Das Mädchen lächelte unter Thränen.
»Dann nahmen wir Abschied und sahen uns erst in Konstantinopel in jenem Café wieder. Ich kann Ihnen nicht sagen, welcher Art meine Gedanken seit jener Zeit gewesen sind, wie ich mich nach Ihnen sehnte, und wie ich mich bei unseren Wiedersehen freute. Sie schrieben mir den Brief und baten mich, da auch ich mich nur auf Vergnügsreisen befinde, der ›Vesta‹ zu folgen, weil der Kapitänin derselben nach dem Leben getrachtet würde; ferner baten Sie mich, einen von Ihnen abgesandten Mann an Bord zu nehmen, welcher noch besser, als Sie, in diesen verwickelten Verhältnissen Bescheid wüßte, und ich erwartete ihn in Konstantinopel, allerdings vergeblich. Sie selbst gaben sich für eine Freundin der Miß Petersen aus –«
Der Ingenieur blieb plötzlich stehen und erfaßte Johannas Hand, welche heftig in der seinigen zitterte.

»Sieh, Johanna!« fuhr Hoffmann leise, eindringlich fort. »Du kennst mich nicht näher; unser Zusammentreffen war immer nur ein kurzes. Ich will Dir sagen, was Du von meinem Charakter zu halten hast; ich bin ein guter Mensch, soweit man das Wort gut auf diese Welt beziehen kann; ich halte das Gebot, daß man seinen Nächsten nicht verurteilen soll, aber einen Fehler verdamme ich unnachsichtlich; ich verachte, verabscheue den, der ihn besitzt und sich nicht die Mühe giebt, ihn abzustreifen; es ist Betrug, Heuchelei,«
Hoffmann hatte zuletzt erregt gesprochen. Jetzt fuhr er wieder in zärtlichem Tone fort:
»Sage mir nun, Johanna! Wie kommt es, daß du dich am Oberonsee für die Kammerzofe einer reisenden Gräfin ausgabst und ein halbes Jahr später als reiche, vornehme Dame in einen Klub eintratest, der sich nur aus den Töchtern der Geldaristokratie zusammensetzte?
Johannas Körper durchlief ein Zittern; mit gesenktem Kopfe blickte sie stumm vor sich nieder.
»Willst du es mir nicht sagen?«
Sie schüttelte ihr Haupt.
»Warum nicht? Hast du kein Zutrauen zu mir, oder bindet ein Geheimnis deine Zunge?«
Johanna brach in einen neuen Thränenstrom aus.
»Ich schäme mich vor Ihnen, ich bin –«
Sie stockte, als brächte sie das Wort nicht von den Lippen,
»Johanna, ich kenne dich besser, als du glaubst! Ich weiß, daß du nicht heucheln kannst, darum würde ich dir alles verzeihen –«
Da riß das Mädchen heftig die Hand aus der seinen.
»Nein, Herr Hoffmann,« rief Jane furchtbar erregt, als der Ingenieur ihre Hand wieder ergreifen wollte. »Sie täuschen sich in mir, ich bin so ein Mensch, den Sie verdammen; ich bin die größte Heuchlerin und Lügnerin, die unter Gottes Sonne lebt. Lassen Sie mich! Leben Sie wohl!«
Sie drehte sich um und rannte förmlich dem Hause zu. Doch im nächsten Augenblick war der Ingenieur wieder neben ihr und hielt sie bei der Hand fest.
»Johanna,« begann er im vorwurfsvollem, aber freundlichem Tone. »Warum schenkst Du mir kein Vertrauen? Weißt du nicht, daß ich dich liebe? Hast du es noch nicht gemerkt?«
Die Gefragte schluchzte krampfhaft auf.
»Herr Hoffmann!« stöhnte sie. »Lassen Sie mich! Quälen Sie mich nicht länger! Sie schenken Ihre Liebe einer Unwürdigen!«
»Vielleicht darum, weil du Detektivin bist?«
»Felix,« schrie sie auf, halb erschrocken, halb freudig.
»Vielleicht darum,« fuhr Hoffmann unbeirrt fort, »weil du zu diesem Geschäfte förmlich erzogen worden bist und deine Talente dazu anwendest, deine Eltern zu ernähren?«
»Felix,« jauchzte Johanna auf, »so verachtest du mich nicht, daß ich für das Spionieren bezahlt werde, wie Ellen sagt?«
»Nein,« erwiderte der Ingenieur und zog den Kopf des zitternden Mädchens an seine breite Brust. »Ich weiß jetzt, Johanna, Deine Lebensgeschichte; ich weiß, wie du während der Abwesenheit deines Bruders, welcher unter dem Namen Nikolas Sharp bekannt ist, die Armut deiner leichtsinnigen Eltern dadurch verbessert hast, daß du eine Stelle als Detektivin annahmst, wozu du die Fähigkeiten besitzest, und daß du noch jetzt eine Hauptkraft in jener Maschine bist, durch deren Lenkung dein begabter, scharfsinniger, aber zugleich auch rücksichtsloser Bruder die Welt in Staunen setzt. Ich verachte die Beschäftigung einer Detektivin durchaus nicht; das thuen nur thörichte, vorurteilsvolle Menschen; im Gegenteil, ich bewundere diese Leute, welche täglich ihr Leben aufs Spiel setzen, um durch Aufdecken und Verhindern von Verbrechen die Sicherheit der Gesellschaft zu bewirken.«
Immer mehr hatten sich Johannas Züge bei diesen Worten aufgeklärt.
»Ist dies deine wirkliche Meinung?« fragte sie noch zweifelnd. »So wäre meine Beschäftigung kein Grund, mich von dir zu trennen?«
»Nicht der mindeste!« Hoffmann zog die Geliebte fester an sich und küßte ihr die Thränen von den Augen. »Erfülle noch den Auftrag, den du von deinem Bruder erhalten hast! Begleite Miß Petersen auf ihrer Reise um die Erde, und dann werde ich ihn bestimmen, daß er sich nach einer anderen Gehilfin bei seinen gefährlichen Unternehmungen umsieht.«
»Ach, das Glück!« rief Johanna. »Manch' schlaflose Nacht habe ich verbracht, seit Miß Petersen mir so recht deutlich ihre Verachtung gegen die Polizeispione zu verstehen gab, obgleich ich eigentlich nie begreifen konnte, warum das Handwerk dieser Leute verächtlich genannt werden soll. Seit jenem Tage kam es mir erst recht zum Bewußtsein, wie elend ich war; denn, ach, Felix, ich habe dich geliebt von der Nacht an, da ich neben dir am Ufer des Sees stand, und jede Verhandlung, die ich mit meinem Bruder hatte, jeden Brief, den ich auf sein Geheiß hin heimlich erbrechen mußte, ließ mich immer deutlicher erkennen, wie unwürdig ich deiner war. Wenn schon die sehr freidenkende Ellen so übel von einem Detektiven denkt, was würdest erst du, ein ernster, wahrheitsliebender Mann von einem bezahlten Spion halten?«
»Denken wir nicht mehr daran!« unterbrach sie Hoffmann. »Es giebt Unterschiede, die scharf getrennt werden müssen. Die Absicht giebt den Ausschlag. Aber ich kann mir deine Gefühle denken, wenn du von der, über welche du wie eine Schwester wachst, geschmäht wirst, wenn auch unwissentlich. Doch jetzt laß uns die kurzen Minuten unseres Beisammenseins noch genießen! Wer weiß, wann sich während dieser Reise noch einmal Gelegenheit dazu bietet. Ich kann vielleicht dafür sorgen,« fuhr er plötzlich nachdenkend fort, »daß sie uns öfter beschert wird.«
Arm in Arm wanderten die beiden Liebenden langsam am Rande des Kanals entlang wieder dem Hotel zu, aus dessen geöffneten Fenstern noch immer die Klänge der Instrumente ertönten. Sie achteten nicht des herrlichen Abends; in ihren Herzen sah es noch schöner aus. Endlich war die Stunde gekommen, nach der sie sich schon längst gesehnt hatten.
»Kommst du mit in den Saal?« fragte Johanna.
Dann zuckte sie zusammen, sie entzog sich dem Arme des Ingenieurs.
»Die Gesetze der Vestalinnen,« hauchte sie, »verbieten mir, so lange wir uns auf dieser Reise befinden, mit einem Manne einen anderen als gesellschaftlichen Umgang zu pflegen.«
»Nun, nun,« lächelte Hoffmann, »diese unnatürlichen Vorschriften sind von den Damen sehr leichtsinnig gegeben worden; noch manch' eine von ihnen wird bitter bereuen, mit dafür gestimmt zu haben. Es ist jetzt nicht mehr nötig, mich in der Gesellschaft blicken zu lassen; ein Dampfboot wird mich nach Port Said zurückbringen, wo meine Anwesenheit erforderlich ist.«
Sie standen etwa noch zwanzig Meter von dem Hotel entfernt, sodaß sie von den Fenstern aus nicht gesehen werden konnten und nahmen Abschied voneinander.
»Wohin gedenkt Miß Petersen die ›Vesta‹ zu steuern?« fragte der Ingenieur.
»Noch ist es nicht bekannt. Wahrscheinlich nach Vorderindien. Vielleicht wird unterwegs Madagaskar ein Besuch abgestattet. Ich lasse es dich noch wissen.«
»Madagaskar? Zu dieser Jahreszeit? Johanna, das mußt du verhindern. Die Insel ist ja vollständig verseucht von jenem Gallenfieber, das Europäer unrettbar dahinrafft.«
»Ich werde es ihr auszureden versuchen.«
»Thue das und benachrichtige mich davon!«
Der Ingenieur zog aus seiner Brusttasche ein flaches, fein gearbeitetes Kästchen hervor.
»Unsere Korrespondenz miteinander war bisher noch sehr mangelhaft, aber nimm hier dieses Kästchen. Es enthält einen Signalapparat, wie er schon an Bord von Kriegsschiffen eingeführt, aber nicht immer verwendbar ist. Ich habe daran Verbesserungen vorgenommen, welche alle Mängel beseitigen. So lebe wohl, mein liebes Mädchen! Wache über Miß Petersen, wie ich über dich wachen werde.«
Ihre Lippen fanden sich noch einmal zum Kusse; dann schritt er dem Ufer, Johanna dem Hause zu.
Die ›Vesta‹ kreuzte bereits seit vier Wochen im indischen Ozean, ohne eine Spur von der Brigg der englischen Herren oder dem ›Blitz‹ entdecken zu können.
Der stolzen Ellen war dies durchaus nicht unangenehm, schien doch nun die Möglichkeit vorhanden, dem ›Amor‹ einmal für dreißig Tage unsichtbar zu bleiben und somit die Wette zu gewinnen. Stets schwebte ein triumphierendes Lächeln um ihre roten Lippen, wenn sie sich in Gedanken ausmalte, wie sie nach Ablauf dieser Frist den Engländern wieder begegnen und sich an den gedemütigten Gesichtern derselben weiden würde.
Sie hatte Lord Harrlington gesagt, daß die ›Vesta‹ nach Indien fahren würde, unterwegs vielleicht auch noch andere Häfen anliefe. Jedenfalls könne er bestimmt darauf rechnen, sie an irgend einem Platze Vorderindiens wieder zu treffen, an welchem, das könne er ja dann in jedem Hafen der Halbinsel erfahren.
Es war Abend. Ellen saß in ihrem Arbeitszimmer und beugte sich über Seekarten, maß, rechnete und verglich, um eine neue Richtung angeben zu können, denn soeben hatte eine Vestalin nach dem Stand der untergehenden Sonne die Lage des Ortes, wo sie sich gerade befanden, aufgenommen, und Ellen fand, daß der ungünstige nördliche Wind das Schiff viel zu weit dem Süden zugetrieben hatte.
Johannas Vorschlag, Madagaskar wegen des dort herrschenden Fiebers nicht anzulaufen, war angenommen worden; die ›Vesta‹ sollte nach Bombay fahren.
Als die Kapitänin an Deck kam, gab sie zuerst die nötigen Ruder- und Segelkommandos; dann musterte sie aufmerksam den Himmel, an dessen Horizont schwere, schwarze Wolken auftauchten.
»Es wird eine böse Nacht werden,« redete Miß Murray sie an. »So bedrohliche Anzeichen eines Sturmes haben wir noch nicht gesehen.«
Ellen zuckte die Achseln.
»Es wird Zeit, daß wir einmal einen Orkan durchmachen,« meinte sie, »alles Bisherige war doch nur Spielerei.«
»Beschwören Sie ihn nicht herauf, in diesen Breiten soll der Sturm oft schrecklich hausen, die Schiffsnachrichten zeugen davon. Da – der erste Windstoß.«
Die Segel schlugen plötzlich klatschend an die Masten und hingen dann schlaff von den Raaen herab, während das Schiff stark hin- und herzuschwanken begann – der Wind hatte mit einem Male eine andere Richtung angenommen.
»Zum ersten Male eine Eule gefangen, wie der Seemann sagt,« lachte Ellen, stampfte aber dabei ärgerlich mit dem Fuß aufs Deck. »Mein ganzes Messen und Rechnen ist umsonst gewesen.«
»Ruder Nordost zu Ost! Hol' an die Steuerbordbrassen!«
Das aus dem Wind gekommene Schiff wurde nach den gegebenen Befehlen bedient, und sofort füllten sich die Segel wieder, aber gleich so stark, daß die an den Tauen ziehenden Mädchen die Raaen kaum wenden konnten.
»Es ist gleich, wohin wir steuern, wir haben ja genügenden Platz zum Segeln,« meinte Ellen.
»Lassen Sie das Bramsegel festmachen,« riet Johanna, welche gerade als erster Steuermann fungierte, »es zieht ein Sturm herauf, sehen Sie dort den grellen Schein über dem Wasser?«
Ellen blickte prüfend nach den obersten Segeln und dann nach der angedeuteten Richtung. Am Horizont stand eine finstere Wolke, die wie von Schwefeldämpfen umflort war.
»Das Barometer zeigt keinen Sturm an, ich kenne auch diese gelben, schnelljagenden Wolken. Sie bringen Böen, aber keinen Sturm. Doch Sie haben recht, vorsichtshalber will ich die oberen Segel festmachen lassen.«
Wieder erschollen Kommandos; diesmal mußten die Mädchen aber in die Takelage, um die erst nur lose aufgezogenen Segel so fest an die Raaen zu binden, daß sie von einem etwa auftretenden Sturm nicht losgerissen werden konnten.
Noch war die Luft ziemlich ruhig; nur ab und zu setzte ein Windstoß ein, und zwar immer aus anderer Richtung kommend. Der Himmel überzog sich ganz mit Wolken, sodaß fast vollständige Finsternis herrschte; nur ab und zu durchbrach ein Strahl der untergehenden Sonne das Gewölk und erhellte für kurze Zeit die Dunkelheit.
Wie auf jedem Schiff sich beim Herannahen eines plötzlichen Sturmes der Mannschaft ein unheimliches Gefühl bemächtigt, so herrschte auch unter den jungen Mädchen eine gedrückte Stimmung. Stumm, aber eilig kamen sie den Befehlen der Kapitänin nach, alle beweglichen Gegenstände im Inneren des Schiffes, wie auch an Deck zur Vorsicht noch einmal mit doppelten Stricken anzulaschen, das heißt, festzubinden.
Jetzt standen nur noch die sogenannten Sturmsegel, also die Mars – und die untersten größten Segel an jedem Mast.
Da brauste mit einem Male ein gewaltiger Windstoß durch die Takelage. In den Tauen entstand ein heulendes Pfeifen, und das Schiff legte sich so auf die Seite, als ob es den Kiel nach oben kehren wollte. Wer nicht schnell irgend einen Gegenstand fassen konnte, schoß auf dem glatten Deck der tiefliegenden Seite zu an das Geländer. Gleichzeitig schüttete die über ihnen schwebende Wolke einen furchtbaren Wasserguß herab.
»Haltet Euch fest!« schrie Ellen, die selbst an die Bordwand geworfen worden war, ohne dabei das Gleichgewicht zu verlieren, wie die meisten der Rutschenden, welche gleich Kugeln über das Deck rollten. Es war die erste Bö, und die ist immer die stärkste. Schlimmer kann es nicht werden.«
Unter Bö versteht man jene Stoßwinde, welche plötzlich einsetzen, höchstens eine halbe Minute währen und dann wieder einer vollkommenen Stille weichen. Sie sind immer von plötzlichen Regenschauern begleitet, im Gegensatze zum Sturm, der ohne solche auftritt, die eben bewirken, daß der Seegang selten ein hoher wird. Ueberhaupt beruhigt ein starker Regenguß selbst die aufgeregteste See.
So war es auch jetzt; obgleich das Vollschiff heftig schwankte, rollte doch nur selten einmal eine Woge über Deck.
Ellen klammerte sich an die neben dem mittelsten Mast befindliche Pumpe und musterte aufmerksam die noch stehenden Segel, deren Taue so stramm angespannt waren, daß sie zu reißen drohten.
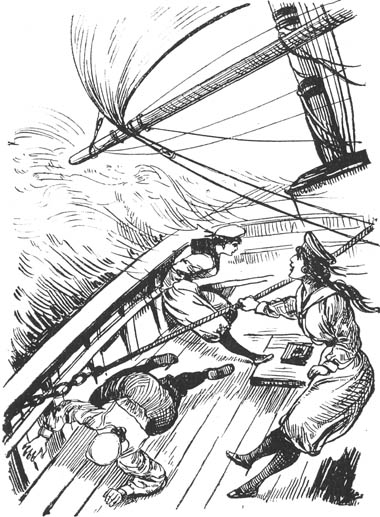
»Auch die Marssegel müssen festgemacht werden, sie fliegen uns sonst davon,« rief sie Jessy und Johanna zu, die sich beide am Geländer hielten.
»Die Taue reißen nicht, auch nicht die Segel,« antwortete Jessy bestimmt, »sie sind noch ganz neu.«
»Um so schlimmer, dann müssen sie erst recht eingeholt werden.«
Ellen hatte recht, es ist besser, daß die Segel bei einem heftigen Winde fortgerissen werden, als daß durch ihre Widerstandsfähigkeit der Mast bricht.
»Ich lasse die Marssegel festmachen,« wiederholte Ellen.
»Thun Sie es nicht,« riefen die beiden Mädchen gleichzeitig, »die Leinwand schlägt zu sehr. Kein Mensch kann sie halten.«
»Marssegel fest,« ertönte jedoch schon Ellens Stimme; die Zeit war günstig; eben war wieder eine Bö vorübergebraust, und es war Ruhe eingetreten. Aber jeden Augenblick konnte eine neue einsetzen und das Schiff von der Mastspitze bis zum Kiel erschüttern.
Die Kapitänin sah, welchen Eindruck dieser Befehl auf die Vestalinnen hervorbrachte, und um ihnen zu zeigen, daß sie nichts Unmögliches von ihnen verlange, enterte sie selbst als erste in den Wanten empor nach der Raa.
Ein Matrose weiß, was es heißt, ein Segel im Sturm festzumachen, wenn dies vorher unterlassen worden ist. Ist es ihm endlich gelungen, das steif aufgeblähte Tuch zu fassen, so zieht er vergebens mit aller Kraft daran, ja, er nimmt sogar die Zähne mit zur Hilfe, aber es spottet allen seinen Anstrengungen – jeder neue Windstoß entreißt die rauhe Leinwand wieder seinen Händen, blutige Streifen darauf zurücklassend. Ein Mittel giebt es allerdings, um auch das wildeste Segel zu bändigen, aber nur die verwegensten Matrosen bedienen sich dessen. Oben an der Raa läuft eine eiserne Stange entlang, an diese klammern sie sich, werfen den Körper auf das Segel und drücken es durch die eigene Schwere nieder; dann haken sie den äußeren Saum der Leinwand an die Füße und ziehen es so langsam an die Raa heran. Dies ist aber ein tollkühnes Unternehmen. Reißt während desselben das Segel, so ist der Waghalsige rettungslos verloren. Beliebter, aber vom Kapitän nicht erlaubt, ist es, die das Segel haltenden Stricke durchzuschneiden und dasselbe einfach davonfliegen zu lassen.
So versuchten auch die Mädchen vergebens, an dem sich wie hartes Holz anfühlenden Segel irgendwo Halt zu finden.
Unglücklicherweise setzte gerade jetzt eine Bö ein, welche alle vorigen an Stärke übertraf; das Schiff bog sich so weit dem Wasser zu, daß einige ängstlich aufschrieen, denn fast wurden sie von den hoch emporspritzenden Wellen erreicht – schlägt doch selbst das Herz des kaltblütigen Matrosen schneller, wenn er hoch in der Luft wie eine Feder hin- und hergeworfen wird.
Die Bö nahm immer mehr an Heftigkeit zu, die Taue klirrten wie Saiten, immer mußte der Bruch eines derselben erwartet werden, oder aber der Mast konnte stürzen.
Ellen nahm Zuflucht zum letzten Mittel.
»Die Hände vom Segel und abschneiden!« hallte ihre Stimme durch die Nacht.
Sie selbst riß das Scheidenmesser heraus und zerschnitt die ihr am nächsten befindlichen Stricke, ebenso thaten auch die übrigen auf der Raa stehenden Vestalinnen, und im Augenblick flog das Segel mit einem Knall davon.
Da gellte ein entsetzlicher Schrei an Ellens Ohr – der Platz neben ihr war plötzlich leer geworden, das Segel hatte ein Mädchen mit fortgerissen.
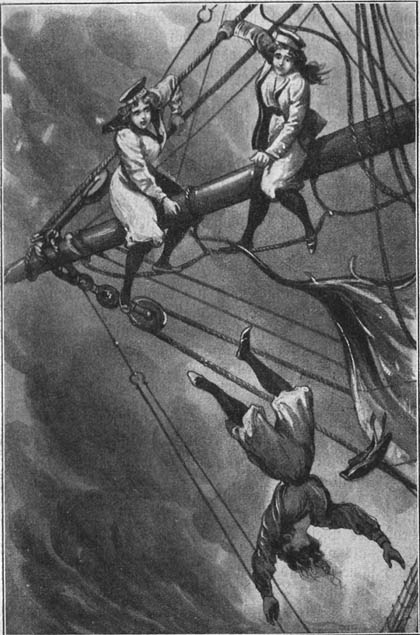
Ellen stieß nicht das gewöhnliche Alarmsignal ›Mann über Bord‹ aus, sie wußte, daß es in dem Geheul des Sturmes unten an Deck nicht gehört wurde. Mit einem Sprunge hing sie im nächsten Tau, ohne erst zu überlegen, ob es fest sei oder lose, und stand sofort unten am Rettungsboot.
»Ein Mädchen über Bord!« schrie sie, die Haltetaue einfach abschneidend.
»Wer ist es?« riefen die Vestalinnen, vor Entsetzen anfangs gelähmt.
»Ich weiß es nicht! Nur schnell! Jede Sekunde ist kostbar!«
Die Damen waren im Aussetzen der Boote außerordentlich geübt; im Nu hingen dieselben außerbords, die Taue wurden nachgelassen, und sie lagen im Wasser.
Ellen saß bereits am Steuer; die dazu bestimmten Gefährtinnen erfaßten die Riemen, da schwang sich auch Johanna über die Brüstung, um ins Boot zu springen.
»Sie bleiben!« rief Ellen.
»Ich komme mit,« entgegnete Johanna, zum Sprunge bereit.
»Sie bleiben an Bord! Ich befehle es Ihnen als Kapitänin,« herrschte aber Ellen das Mädchen an. »Sie sind erster Steuermann und übernehmen das Kommando. Sorgen Sie für Raketen!«
Es war zu spät für Johanna. Schon stieß das Boot ab. Sie sah noch, wie sicher das breitgebaute Fahrzeug unter den kräftigen Ruderschlägen der Mädchen über die nur mäßig bewegte Flut schoß und in der finsteren Nacht verschwand.
Johanna starrte ihm nach; sie legte die Hand auf die Stirn, als wolle sie sich auf etwas besinnen, dann aber drehte sie sich um und nahm energisch das Kommando in die Hand. Das erste war, daß sie das Schiff die Richtung nehmen ließ, wohin sich das Boot gewandt hatte, das zweite, daß sie Raketen an Deck schaffen ließ, um von Zeit zu Zeit ein feuriges Signal in die Luft zu senden.
Die Böen hatten jetzt nachgelassen, aber es war unterdes völlig Nacht geworden.
Aengstlich harrten die Mädchen der Rückkehr des Bootes.
Brachte es die Verunglückte mit oder nicht? Lebendig oder als Leiche?
Aller Herzen waren mit diesen Fragen beschäftigt.
»Wer war es denn?« fragte jemand leise.
»Miß Staunton!« sagte Jessy.
»Hope Staunton!« erklang es im Kreise der Vestalinnen.
Aller Augen füllten sich mit Thränen bei Nennung dieses Namens. Es war das jüngste der Mädchen, kaum sechzehn Jahre alt, ein übermütiger, drolliger Wildfang und der Liebling aller Damen.
Aber Stunde auf Stunde verrann, eine Rakete nach der anderen zischte in die Höhe, das Boot kam nicht wieder. Obgleich jetzt der Vollmond eine weite Strecke des beruhigten Meeres hell erleuchtete, war das ersehnte Boot nicht mehr zu erblicken.
Johanna befand sich in einer verzweifelten Lage, keines der Mädchen wollte ihr das Kommando des Schiffes abnehmen, um sich nicht mit der Verantwortlichkeit zu belasten, nach den Entschwundenen suchen zu müssen, vielleicht gerade eine falsche Richtung einzuschlagen und sich immer weiter zu entfernen.
Jane ließ ihren Gefährtinnen nicht Zeit, sich traurigen Gedanken hinzugeben; beständig ließ sie die ›Vesta‹ wenden, das heißt, die eben gefahrene Strecke noch einmal zurücklegen, stellte die Scharfsichtigsten mit Fernrohren in die Takelage, sandte Raketen und Leuchtkugeln aus – aber alles half nichts, das Boot mit Ellen und den sechs anderen Vestalinnen war verschwunden. Ein Segler ist kein Dampfschiff, er kann nicht beliebig vor und zurück, nach links und rechts fahren und so in kurzer Zeit eine große Strecke absuchen, sondern ist immer vom Winde abhängig. Gegen ihn kann er nicht aufkommen, und anßerdem treibt er auch, wenn er einem Ziele zustrebt, von diesem stets etwas ab.
Johanna war außer sich. Keine Sekunde konnte sie ruhig an einem Platze verharren, fortwährend eilte sie von Posten zu Posten, um dieselben zu kontrollieren.
»Was soll ich Harrlington sagen, wenn er nach Ellen fragt?« das war ihr einziger Gedanke.
Das Rettungsboot konnte nicht umgeschlagen sein. Seine Bordwand war mit Kork gefüttert, der Kiel beschwert, sodaß es sich immer wieder aufrichtete, selbst im schwersten Seegang, und bei diesem kleinen Wogenschlag hätte sich das elendeste Fischerboot gehalten. Aber was war es in dem gewaltigen, unendlichen Meer? Ein Sandkorn in der Wüste! Es geriet in eine Strömung, und nach kurzer Zeit war es meilenweit fortgerissen; das Steuerruder brauchte nur zu brechen, die Riemen verloren zu gehen, und es war ein Spiel der Wellen.
Die ›Vesta‹ hatte planlos im indischen Ocean gekreuzt, Johanna wußte bestimmt, daß hier keine Fahrlinie von Dampfern war, höchstens ein Segelschiff verirrte sich einmal, gleich ihnen, hierher. Aber konnte man mit diesem Zufall rechnen? Seit Wochen war schon kein anderes Schiff in Sicht gekommen. Das Boot enthielt nur ein Fäßchen mit Hartbrot und eins mit Trinkwasser, waren diese Vorräte alle, was dann? Johanna schauderte.
Plötzlich stürzte sie mit einer Hast die Kajütstreppe hinab und in ihre Kabine, als hinge von der Schnelligkeit Leben und Seligkeit ab. Nach einer Minute kam sie wieder an Deck, in der Hand eine Art Schußwaffe, aber platt geformt.
»Warum habe ich nicht eher daran gedacht? Nun wird es zu spät sein, aber versuchen will ich es noch,« murmelte sie.
Sie hob die Pistole und drückte ab.
Aus dem Lauf drang eine Kugel, einen silbernen Strahl hinter sich lassend, weiter und höher, als eine Rakete vermag, schwebte einige Zeit in der Luft, zerplatzte dann und übergoß das ganze Meer mit einem blauen Licht. Der Schein war so intensiv, daß man die Augen schließen mußte. Dann folgte eine zweite, welche beim Zerplatzen ein rotes Licht verbreitete und wieder eine mit grüner Wirkung.
»Ich wußte gar nicht, daß wir solche Raketen an Bord haben,« sagte Jessy neben ihr.
»Sie gehören mir,« antwortete Johanna kurz, ohne die Fragerin zu beachten.
»Schießen Sie noch ein paarmal, diese Kugeln haben ja eine kolossale Leuchtkraft.«
Johanna erwiderte nichts, sondern begab sich selbst in die oberste Raa, als wolle sie nach den Vermißten spähen. Erst nach geraumer Zeit kam sie wieder herunter, vollständig niedergeschlagen.
»Mein Gott, mein Gott, warum konnte ich nicht bei ihr bleiben!« stöhnte sie.
Der Morgen fing an zu dämmern und fand Johanna noch immer ruhelos auf dem Deck hin- und herwandernd, vergebens nach dem Boote spähend, die Mädchen zur Ausdauer ermunternd und tröstend, dabei aber selbst die Verzweiflung im Herzen tragend.
Die Sonne sandte ihre Strahlen schräg über das Deck; die Glocke verkündete den Mittag; wieder brach die Nacht heran, und noch immer schritt Johanna vom Heck nach dem Bug, d. h. vom Hinterteil bis zum Vordereil des Schiffes. Sie hatte das Meer abgesucht, soweit es der Wind ihr erlaubte, sie hatte nach Strömungen geforscht, um aus ihnen die Richtung berechnen zu können, in der das Boot abgetrieben worden sei – sie hatte keine gefunden, alles war umsonst.
Endlich brach sie erschöpft zusammen und mußte in ihre Kabine getragen werden. Nach einigen Stunden fiebernden Schlafes kam sie wieder an Deck; der zweite Morgen war bereits angebrochen, seit das Boot vom Schiff abgesetzt, ihre erste Frage, nein, ihr erster Schrei, war nach ihm. Ein trauriges Kopfschütteln war die Antwort.
Heute war der Tag, welchen Ellen mit solcher Freude erhofft, der dreißigste Tag, seit sie den ›Amor‹ außer Sicht verloren hatten. Schlag zwei Uhr verschwanden die Mastspitzen der Brigg am Horizont, und tauchten sie nach 30 Tagen nicht vor zwei Uhr wieder auf, so hatte sie gewonnen, die englischen Herren mußten sich als besiegt erklären, das Haschenspielen hatte aber ein Ende.
Ach, wie hatte sich Ellen auf den Augenblick gefreut, da die Schiffsglocke den letzten Schlag gab, ohne daß der ›Amor‹ zu sehen war! Wo mochte sie jetzt sein, ruhte sie und ihre Freundinnen schon auf dem Meeresgrunde, von Fischen benagt, oder stierten sie jetzt mit glanzlosen Augen das salzige Wasser an, das den Durst nicht zu löschen vermag?
Entsetzlich! Was wird Lord Harrlington sagen?
Da griff das am Steuerrad stehende Mädchen nach der vor ihr hängenden Glocke. Vier Glasen mußte sie schlagen, das heißt, viermal den hellen Ton ertönen lassen, was an Bord des Schiffes zwei Uhr bedeutet.
»Eins,« zählte Johanna mechanisch mit, »zwei – drei – vier.«
»Ein Segel!« rief eine Vestalin von der Raa herab.
»Noch einmal eine solche Nacht überlebe ich nicht,« sagte am Bord des ›Amor‹ Sir Edgar Hendricks zu seinem Freunde Charles, »immer auf- und abgewandert, auf den Raaen herumgerutscht und dazu durchnäßt bis auf die Haut. Seeschlangen und Salamander! Das halte ein anderer aus, ich kann es nicht.«
»Spannen Sie das nächste Mal den Regenschirm auf,« riet ihm Charles. »Aber wahrhaftig, der Kapitän hat uns wie die Schiffsjungen gedrillt. Für die paar Groschen Heuer mache ich die Arbeit nicht mehr; ich lasse mich in Bombay auszahlen und auf ein anderes Schiff anmustern.«
»Auf welches denn?«
»Auf die Vesta.«
»Hahaha, die wartet nur auf Sie.«
»Nehmen Sie mich nicht gutwillig, dann gebrauche ich eine Kriegslist,« erklärte Charles bestimmt. »Ich schmuggle mich in ein leeres Faß und lasse mich an Bord nehmen.«
»Und wenn die Damen gesalzenes Schweinefleisch essen wollen, nehmen sie Williams aus dem Faß,« unterbrach ihn trocken Lord Hastings, der bereits wieder auf der Bordwand saß und angelte.
»Nehmen Sie diese Beleidigung zurück, Hastings?« fragte ihn Charles.
»Fällt mir gar nicht ein,« brummte dieser mürrisch.
»Dann lassen Sie es bleiben! Hastings ärgert sich nämlich,« erklärte er den lachenden Zuhörern, und Charles hatte immer Zuhörer, »daß ich ihm neulich einen marinierten Hering an seine Angel gehängt habe. Nun sucht er sich bei jeder Gelegenheit durch Redensarten zu rächen. Apropos, Hendricks, erinnern Sie sich noch, wie ich in Kalkutta dem jungen Leutnant den Rotwein aus der Feldflasche trank und dann Heringslake hineingoß?«
Die beiden Baronets hatten zusammen in der indischen Armee als Offiziere gestanden, und nun gab Charles einen seiner unzähligen, dort verübten Streiche zum besten.
»Sie wissen ja in solchen Fällen immer Rat,« sagte nach Schluß der langen Erzählung der Marquis Chaushilm, der Sohn eines Herzogs, zu Charles und zeigte ihm einen seiner Finger. »Ich habe ihn diese Nacht arg gequetscht.«
»Hm, hm,« brummte Charles kopfschüttelnd, »lassen Sie ihn in Bombay abschneiden, sonst –«
»Das Geisterschiff!« schallte in diesem Augenblicke Lord Harrlingtons Stimme.
»Sonst was?« fragte der Marquis ängstlich, der sich mehr für seinen Finger, als für ein Geisterschiff interessierte.
»Sonst können Sie ihn auch daran lassen,« brummte Charles und wandte sich dem Gegenstand der allgemeinen Aufmerksamkeit zu.
Das rätselhafte Schiff, welches den Herren nun zum dritten Male begegnete, kam ihnen diesmal mit noch größerer Schnelligkeit als früher entgegengebraust; es schien förmlich über das Wasser zu springen, so hob es ruckweise einmal den Bug aus den Wellen, dann wieder steckte es ihn tief in die Flut. Der ›Amor‹ fuhr mit dem Wind, das Schiff also gegen ihn an. Es hatte auch alle Segel fest an den Raaen. Wieder war keine Spur von Rauch zu bemerken, der das Vorhandensein einer Dampfmaschine verraten hätte. Es kam nicht wie die beiden ersten Male dicht an der Brigg vorbei.
Als es von dem ›Amor‹ fast querab war, mäßigte es plötzlich seinen Lauf.
»Es heißt Flaggen,« rief Lord Harrlington, »schnell, das Segeltuch her und die Wimpel bereitgehalten!«
Hals über Kopf stürzten einige davon, das Tuch zu holen, während andere sich an dem Flaggenkasten beschäftigten.
Ohne daß man jemanden auf dem runden Deck des merkwürdigen Schiffes sehen konnte, ging am hintersten Mast eine Flagge nach der anderen hoch, bis ein vollständiges Signal im Winde flatterte. Außerdem konnte man sehen, daß es nicht nur still lag, sondern auch langsam rückwärts fuhr, um genügend Zeit zum Ablesen zu geben.
Harrlington schlug die einzelnen Flaggenzeichen im Buche nach. Dann sagte er:
»Volldampf. 62 Grad 17 Minuten östlicher Länge, 6 Grad 2 Minuten nördlicher Breite – gebt das Kontresignal!«
Kaum erschien aus dem ›Amor‹ das Verstandenzeichen, so verschwand das Signal wieder, und das Schiff setzte mit verdoppelter Eile seine Fahrt fort, aber nach links abbiegend.
Während die Herren noch über den Sinn dieses rätselhaften Signals sprachen, gab Lord Harrlington den Befehl, die Kessel zu heizen, und nahm die Sonne auf.
»Was es auch sei,« sagte er dann, »jedenfalls fahren wir so schnell als möglich nach der bezeichneten Stelle, wir brauchen nur eine halbe Stunde zu dampfen. Sir Williams, nehmen Sie das Fernrohr und gehen Sie auf die Raa.«
»Natürlich,« brummte der Angeredete, »Sir Williams hier und Sir Williams da, ohne den geht's nicht mehr. Dem einen thun die Finger, dem anderen die Haare weh, ich aber habe nie ein solches Glück. Na, die Sache wird wenigstens interessant!«
Er hing sich das Futteral um und nahm auf der Raa Platz.
»Noch nichts in Sicht?« fragte nach fünfundzwanzig Minuten Harrlington, der mit einigen Herren fortwährend die Sonne aufnahm, um so immer zu wissen, wo sie sich befanden.
»Hier oben noch nichts,« rief Charles hinunter.
»Einen halben Strich weiter nördlich,« wies der Kapitän dem am Ruder Stehenden an.
»Jetzt etwas zu sehen?«
»Nein – ja, doch, ich sehe etwas!« schrie Charles.
»Was?« riefen alle Herren.
»Einen dunklen Punkt – noch ein paar Sekunden – bei Gott, es ist ein Boot mit Menschen!«
»Ah, Schiffbrüchige!«
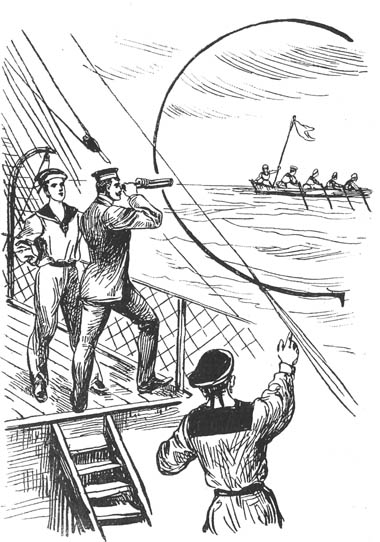
Die Herren beobachteten durchs Fernrohr das Boot, dem sie sich schnell näherten; sie sahen, daß an einem hochgestellten Ruder ein Tuch wehte.
Plötzlich erbleichte Harrlington und ließ das Rohr sinken.
»Ellen,« hauchte er.
»Miß Thomson,« jauchzte im nämlichen Augenblick Charles oben auf der Raa. »Hip, hip, hurrah! Die Vestalinnen kommen auf den ›Amor‹.«
Fünf Minuten später lag das Boot längsseit der Brigg, und die acht Mädchen stiegen an Deck.
»Miß Petersen, wo ist die ›Vesta‹?« fragte Harrlington, der nicht wußte, ob er sich über diese Begegnung auf offener See freuen oder ob er ängstlich sein sollte. Die Damen zeigten durchaus keine besorgten Mienen, eher verschämte.
»Wir wissen es ebensowenig, wie Sie.«
»Wie sollen wir das verstehen?«
In Kürze erzählte nun Ellen ihre Erlebnisse, wie beim Abschneiden des Marssegels Hope Staunton, die neben ihr stand, von der Raa ins Wasser geschleudert worden sei, und wie sie mit sechs Gefährtinnen das Rettungsboot bestiegen.
»Wir hatten das Mädchen bald gefunden, welches sich wacker in der nicht sehr hochgehenden See hielt, nahmen es ins Boot und wollten nach der ›Vesta‹ zurückfahren. Aber von dieser war in der dunklen Nacht keine Spur mehr zu sehen. Beim Rudern merkten wir endlich, daß wir von einem Strom blitzschnell fortgeführt wurden, alles Gegenrudern half nichts. Ab und zu sahen wir noch eine Rakete aufblitzen, die uns die Lage unseres Schiffes verriet, aber dann sahen wir auch diese nicht mehr. Es war zwar eine schlimme Nacht, aber unsere Lage war doch nicht so trostlos; noch hatten wir Mundvorräte und Wasser für einige Tage, und, was für mich die Hauptsache war, in einem Kästchen des Bootes astronomische Instrumente und Karten mit. Heute morgen berechnete ich unsere Lage, fand, daß wir nur etwa zwanzig Seemeilen von einer Inselgruppe entfernt waren. Aus dem Strom waren wir auch heraus, und so legten wir uns ordentlich in die Riemen, um dorthin zu fahren. Auch spähten wir scharf nach einem Segel aus, das wir vor einer halben Stunde wirklich erblickten, nämlich den ›Amor‹. Verzweifelt sind wir also durchaus nicht gewesen, nur um Miß Staunton waren wir in Sorge, weil sie etwas fieberte, ebenso um unsere Freundinnen auf der ›Vesta‹ die sich sehr um uns ängstigen werden.«
»Sie nehmen die Sache sehr kaltblütig,« sagte Harrlington, und auch die übrigen Herren waren erstaunt, wie gleichmütig die Vestalinnen ihr Schicksal ertragen hatten. Mancher Mann wäre wohl in Klagen, allerdings nutzlose, ausgebrochen und hätte hinterher über die ausgestandeneu Strapazen gejammert.
»Vor allen Dingen muß Miß Staunton ins Bett, und ihr diese Möglichkeit zu verschaffen, werden Sie wohl die Güte haben, Lord Harrlington.«
Der Kapitän sorgte dafür, daß den Damen Kabinen hergerichtet wurden.
»Noch eine Frage, Miß Petersen, haben Sie ein Schiff gesehen, außer dem ›Amor‹?«
»Nein, kein einziges.«
»Auch nicht jenes rätselhafte Schiff, welches uns damals im griechischen Archipel begegnete?«
»Nein. Wie kommen Sie ans dieses?«
Harrlington erzählte ihnen, daß das Auffinden des Bootes kein Zufall gewesen, sondern daß ihm das Geisterschiff, wie es allgemein genannt wurde, den Ort angegeben hatte. Die Damen waren natürlich höchst erstaunt.
Hope Staunton war ernstlich erkrankt; ihr zarter Körper wurde vom Fieber geschüttelt; da sich aber an Bord des ›Amor‹ eine vollständige Apotheke befand, so wollte man dasselbe bald meistern.
»Nun haben Sie über den Kurs zu befehlen,« sagte Harrlington, »wohin wünschen Sie gebracht zu werden?«
»Nach Bombay, dort treffe ich die ›Vesta‹ bestimmt wieder.«
»Nach Bombay?« heuchelte Charles erstaunt. »Und wir wollten gerade nach Madagaskar fahren.«
»Wissen Sie auch, meine Herren, daß Sie die ›Vesta‹ seit neunundzwauzig Tagen außer Sicht verloren haben? Morgen um zwei Uhr haben wir die Wette gewonnen.«
Lord Harrlington zog die Uhr.
»Elf Uhr,« sagte er kaltblütig, »wir haben noch siebenundzwanzig Stunden Zeit.«
»Miß Petersen,« begann Charles, »ich hätte eine große Bitte an Sie. Vielleicht erfülle ich auch Ihnen damit einen Wunsch,«
»Und das wäre?«
»Sie sollen ein sehr geschickter Matrose sein, und ich bin nur ein Stümper. Wollen wir nicht während der vierzehn Tage, die wir noch bis Bombay zu segeln haben, die Rollen tauschen. Sie folgen dem Kommando, das mich auf die Takelage schickt, und ich pflege einstweilen Miß Staunton.«
»Aber, Sir Williams,« unterbrach ihn lachend Miß Thomson, »können Sie denn gar nicht einmal ernst sein?«
»Mein Gott, es ist mein heiliger Ernst,« versicherte Charles, »ich habe Anlage zur barmherzigen Schwester. Als mein Jagdhund sich einmal erkältet hatte und ganz heiser bellte, habe ich ihn Tag und Nacht gepflegt, habe ihm Speckumschläge um den Hals gelegt, Medizin eingegeben und ihn in den Schlaf gesungen. Seit dieser Zeit stellt er sich immerwährend krank.«
»Sie sind unverbesserlich, Sir Williams.« –
Harrlington versuchte den ganzen Tag, Ellen einmal allein zu sprechen, aber das Mädchen wußte ihm immer geschickt auszuweichen.
»Morgen um zwei Uhr,« antwortete sie stets, wenn er sie fragte, ob sie nicht eine Minute für ihn habe.
Der andere Tag kam, Ellen schritt aufgeregt hin und her, spähte manchmal aufmerksam nach dem Horizont, sah, fortwährend nach der Uhr und frohlockte, daß kein Segel zu sehen war.
»Halb zwei Uhr,« sagte sie zu den Herren, »in dreißig Minuten können Sie mir gratulieren.«
Die Engländer erklärten sich bereits jetzt für besiegt. Lord Hastings fluchte in allen Tonarten.
»Wer hat zuletzt auf der Oberbramraa an Backbordseite das Segel festgemacht?« fragte Lord Harrlington, die Takelage musternd.
»Ich,« entgegnete Marquis Chaushilm.
»Dann gehen Sie hinauf und machen Sie das flatternde Band fest.«
Chaushilm schickte sich an, die Wanten emporzusteigen, aber der gutmütige Charles sagte:
»Bleiben Sie unten, Herzog, sonst jammern Sie mir nachher über Ihre Schmerzen im Finger die Ohren voll.«
Er kletterte hinauf und verrichtete für seinen Kameraden die Arbeit.
»Noch zwei Minuten, meine Herren, und wir haben gewonnen,« sagte Ellen unten.
Eine Minute verstrich. Da kam Charles an einem Tau heruntergerutscht.

»Welche Zeit ist es genau, Miß Petersen?«
»Genau fünfzehn Sekunden vor zwei Uhr.«
»Dann warten Sie nur noch dreißig Tage, dort steht die ›Vesta‹!«
Charles deutete nach dem Horizont.
Ein Ruf des Unwillens entschlüpfte Ellens Mund; alle Fernrohre flogen an die Augen.
»In der That, ein Segel! Ob es aber gerade die ›Vesta‹ ist?«
»Wenn Williams sagt, es ist die ›Vesta‹, dann ist sie es,« behauptete der Baronet.
»Dampf auf!« kommandierte Harrlington durch das Sprachrohr. »In fünf Minuten wollen wir uns überzeugen.«
Bald hatten sie sich dem Schiffe so weit genähert, daß sie es mit den bloßen Augen deutlich erkennen konnten. Es war wirklich die ›Vesta‹.
Jetzt waren die Herren an der Reihe, in Frohlocken auszubrechen, aber die Damen schienen sich durchaus nicht zu ärgern. Die einzigen, welche eine finstere Miene zeigten, waren Miß Petersen und wunderbarerweise auch Lord Harrlington.
»Miß Petersen,« sagte letzterer zu Ellen, »es ist zwei Uhr, wollen Sie mir jetzt eine Unterredung gewähren?«
»Vielleicht in dreißig Tagen,« antwortete das stolze Mädchen kurz und ließ den betrübten Lord stehen.
In kurzer Zeit war die ›Vesta‹ erreicht, und die Damen begaben sich an Bord ihres Schiffes.
Die Freude, welche unter den Mädchen herrschte, als sie nicht nur die sieben Gefährtinnen der Bootsbesatzung, sondern auch die bereits wiederhergestellte Hope, ihren Liebling, in ihrer Mitte hatten, läßt sich nicht beschreiben.
Johanna begab sich, vollständig erschöpft, in ihre Kabine und ließ sich den ganzen Tag nicht wieder auf dem Verdeck sehen – eine zweite schlaflose Nacht hätte sie nicht mehr aushalten können.
Sir Charles Williams, Baronet von England, hatte von der Mutter Natur eine gute Dosis Humor geschenkt bekommen. Wer seine Bekanntschaft in einer Gesellschaft machte, der hielt den jungen, lebenslustigen, immer zum Scherzen aufgelegten Mann zwar für einen gutmütigen und witzigen, aber zugleich für einen etwas oberflächlichen Menschen, für einen sogenanten, harmlosen Taugenichts.
Wer ihn aber genau kannte – das waren allerdings sehr wenige – an Bord des ›Amor‹ zum Beispiel nur Lord Harrlington – der wußte, daß Charles außerhalb der Gesellschaft, wenn er sich allein befand, ein stiller, nachdenkender und für seine Bildung sehr sorgender Mensch war. Mit der Zeit hatte er sich eine Art ›lachende Philosophie‹ gebildet, nach welcher er lebte; er konnte tagelang sich in ernste Studien vertiefen, überlegen und lesen. Steckte aber nur einer seiner Bekannten den Kopf zur Thür herein, so legte er schnell das Buch zur Seite und empfing den ihm angenehmen Besuch mit einigen Witzen; wollte er aber nicht gestört sein, so behauptete er mit ernsthafter Miene, er müsse zählen, wie oft in einem Buche das Wort ›und‹ vorkäme und schob den Gast ohne weiteres zur Thür hinaus.
Ueberhaupt übte er über alle seine Kameraden eine Herrschaft aus, von der sie sich nichts träumen ließen. Seine Scherze wurden gern gehört, daß er ihnen aber in denselben Wahrheiten sagte, welche sie sich sonst nicht hätten gefallen lassen, merkten sie gewöhnlich nicht, was ihm auch ganz gleichgiltig war – er konnte die Wahrheit nicht verschweigen, hatte sich aber daran gewöhnt, sie in scherzhafte Worte zu kleiden. Selbst die sonst so scharfsinnige Ellen hatte ihn nicht verstanden, als er sich der erkrankten Miß Staunton zur Pflegerin anbot; sie hielt es nur für einen Spaß; er aber wollte ihr andeuten, daß sie, Miß Petersen, als Weib besser in eine Krankenstube passe, als zum Matrosen an Bord eines Schiffes.
Jetzt war Charles Williams zwar auch allein in seiner Kabine, aber sein Benehmen zeigte sich sehr auffallend. Er hatte einen Briefbogen in der Hand, drehte ihn hin und her, hielt ihn gegen das Licht, roch daran und legte ihn kopfschüttelnd auf den Tisch.
»Der Brief ist für mich, das ist ein Faktum,« murmelte er. »Ich heiße Charles Williams, und alle die mir darin gesagten Schmeicheleien passen auf mich. Aber was in aller Welt mag sie nur mit mir vorhaben? Ich muß den Brief noch einmal lesen, dann kann ich ihn auswendig.«
Halblaut las er:
»Geehrter Baronet!
Verzeihen Sie mir, wenn ich Sie mit einer Bitte belästige. Ich brauche zu einem Unternehmen, welches ich vorhabe, eine kühne, thatkräftige und begabte Person, auf deren Verschwiegenheit ich zugleich vollkommen rechnen kann. Die Herren des ›Amor‹ haben mir oft versichert, daß ich auf ihren Beistand in jeder Angelegenheit unbedingt zählen darf, aber zu dem, was ich plane, eignet sich nicht jeder; nur Sie, geehrter Baronet, besitzen die Fähigkeiten, welche dazu nötig sind. Ich bitte Sie dringend, heute abend acht Uhr in den Tempel-Anlagen am Quai zu sein, wo wir uns über alles Nähere besprechen können.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ellen Petersen, Kapitänin der ›Vesta‹.
»Hm, hm,« brummte Charles, »entweder hat Miß Thomson mich ihr vorgeschlagen, oder das Mädchen kennt mich besser, als ich sie. Nun, wir werden sehen, jedenfalls bin ich zur rechten Zeit in den Anlagen. Was ist die Zeit jetzt? Sieben Uhr, also noch eine Stunde.«
Er zündete ein Streichholz an und verbrannte den Brief.
»Herein,« rief er, als es klopfte.
Chaushilms schön frisierter Kopf ward in der Spalte sichtbar.
»Störe ich?« fragte er.
»Jetzt zufälligerweise nicht, kommen Sie nur herein!«
»Was war denn das für ein Eingeborener, der Ihnen vorhin den privaten Brief brachte?« fragte der neugierige Marquis.
»Nicht wahr, der Mensch hatte eine merkwürdige Physiognomie? Das war ein in Indien geborener Indier.«
»Nun ja, das meine ich nicht – von wem war der Brief?«
»Sie wissen doch, mein lieber Herzog,« sagte Charles und knöpfte sich den Kragen um, »daß ich schon früher in Bombay gewesen bin. Da lernte ich nun einen Mann kennen, der eine Pomadenfabrik hat, und dem kaufte ich gestern ein Rezept zu einer ganz vorzüglichen Pomade ab. Da liegt noch die Asche.«
»Warum haben Sie es verbrannt?«
»Ich hatte Angst, daß es Ihnen in die Hände fallen würde, und Sie dann den ganzen Tag Pomade fabrizierten und sich in die Haare schmierten. So – nun bürsten Sie mir einmal den Hut einstweilen ab! Ich danke – und nun den Rock. Fertig? Dann kommen Sie heraus, ich will an Land und muß abschließen.«
Er schob den Herzog zur Thür hinaus und ging an Deck.
Der mächtige Hafen von Bombay hat mit seinen zahllosen, bewimpelten Schiffen ein malerisches Aussehen. Der Handelsgeist des indischen Volkes beschränkt sich nicht nur auf die Hafenstraßen, auch zwischen den Schiffen treiben sich Boote der Eingeborenen umher, welche unausgesetzt den Besatzungen Früchte, Limonade, Eiswasser und Schmuckgegenstände, wie seidene Tücher, Korallenketten u.s.w. anbieten. Zeigt der Kapitän nur einmal die Schwachheit, einen der beturbanten Kaufleute an Bord zu lassen, so wird sein Schiff förmlich von ihnen überschwemmt. Indier, Chinesen, Malayen klettern von allen Seiten empor und lassen die bedrängten Matrosen nicht eher in Ruhe, als bis man ihnen entweder etwas abgekauft oder sie mit einigen drohenden Handbewegungen in ihre Boote zurückgejagt hat. Außerdem liegen auch noch eine Unmenge von Booten zwischen den Schiffen, deren Besitzer sich durch Ueberfahren nach dem Lande Geld verdienen.
Einem solchen winkte Charles.
»Nach der vierten Treppe,« sagte er zu dem Bootsführer in der Sprache der Eingeborenen. Williams war dieser vollkommen mächtig.
Geschickt ruderte der Mann zwischen den Fahrzeugen hindurch nach der bezeichneten Stelle, Charles zahlte eine kleine Silbermünze und stieg aus, er befand sich dicht in der Nähe der sogenannten Tempel-Anlagen, eines Gartens, in dem sich während des Abends hauptsächlich europäische Familien ergehen.

Charles setzte sich auf eine Bank und wartete, bis seine Uhr auf Acht zeigte, dann stand er auf und ging unter den Bäumen des Gartens auf und ab. Da erblickten seine Augen einige Vestalinnen und richtig, unter ihnen auch Miß Petersen. Sie sprach einige Zeit mit Johanna Lind; Charles sah, wie sie sich die Hände gaben und Ellen das in den Garten führende Thor durchschritt, während ihre Freundinnen nach dem Quai gingen.
»Ich wußte, daß Sie bestimmt kommen würden,« lächelte Ellen ihn an.
»Ich hätte mich hertragen lassen,« behauptete Charles.
»Lassen Sie uns in jene offene Laube treten; dort sind wir ungestört und brauchen keinen Lauscher zu fürchten.«
»Sie verlangen doch nichts Unrechtes von mir, gnädiges Fräulein?« fragte Charles ängstlich. »Das kann ich Ihnen vorher sagen, ich schlage niemanden tot, breche nicht ein und zünde keine Häuser an, dazu habe ich eine viel zu gute Erziehung.«
»Brauchen Sie auch nicht, Mut ist allerdings erforderlich.«
»Den habe ich. Verlassen Sie sich darauf! Verlangen Sie, daß ich mich in diesen Springbrunnen stürze, und im nächsten Augenblick liege ich darin. Soll ich?«
»Machen Sie keinen Unsinn, Sir Williams, sondern nehmen Sie sich einmal für zehn Minuten zusammen! Seien Sie ernsthaft!«
»Wie ein Leichengräber,« versicherte Charles und setzte sich neben Ellen auf die Bank.
Ellen begann ihm ihren Plan auseinanderzusetzen, und Charles zog ein immer erstaunteres Gesicht.
»Nun,« schloß Ellen, »wollen Sie oder wollen Sie nicht?«
»Wollen will ich wohl,« entgegnete Charles, »aber es geht nicht.«
»Warum nicht?« rief Ellen eifrig. »Sie sprechen indisch, sind ein gewandter Weltmann außerdem, was die Hauptsache ist, pfiffig und scharfsinnig. Warum geht es also nicht?«
»Danke!« Charles machte eine leichte Verbeugung. »Aber erstens haben Sie neulich zu einer Dame gesagt, ich bedürfe der Aufsicht, und in diesem Falle soll ich doch die Aufsicht führen. Das ist also schon ein Grund.«
Ellen errötete. Sie hatte diese Worte wirklich zu Miß Thomson gesprochen, als die Damen einzelne der englischen Herren kritisierten. Also war ihm ihre Meinung über ihn mitgeteilt.
»Ich nehme es zurück, man kann sich täuschen. Und der zweite Grund?«
»Ist der, daß ich dort, wohin Sie mich schicken wollen, wie ein bunter Hund bekannt bin.«
»Das ist eben recht gut, so wissen Sie schon mit den Verhältnissen Bescheid.«
»Aber die Personen kennen mich auch alle, wie soll ich da –«
»Das ist Ihre Sache,« unterbrach ihn Ellen, »mir ist von Ihrer Schlauheit so viel Rühmenswertes gesagt worden, daß ich Sie einmal auf die Probe stellen will. Also ja oder nein, wollen Sie oder nicht?«
»So gebe ich Ihnen mein Jawort, aber auf Kündigung,« sagte Charles und stand auf. »Wann soll ich die Reise antreten?«
»So bald wie möglich. Wann können Sie den ›Amor‹ verlassen?«
»Ich habe ihn schon verlassen.«
»Wie –?«
»Ich schreibe an Lord Harrlington eine Zeile und bleibe gleich fort. Mein Testament liegt in meinem Schreibtische in Oxford.«
»Diese Bündigkeit gefällt mir an Ihnen. Sie können auf einen Gegendienst rechnen. Adieu, Sir Williams, auf baldiges Wiedersehen!«
»Darf ich Sie nach dem Quai begleiten, Miß Petersen?«
»Ich danke! Miß Lind erwartet mich am Eingange des Gartens.«
Ellen grüßte freundlich und ging.
»Na, dann nicht,« sagte Charles, setzte sich wieder und brannte sich eine Cigarre an. Dann riß er aus einem Notizbuche ein Blatt Papier und fing an zu schreiben, ab und zu vor sich hinsehend.
»Darf ich Sie um Feuer bitten?« fragte da eine Stimme auf Englisch.
Charles blickte auf. Vor ihm stand ein Herr, dem Aussehen nach unverkennbar ein Engländer, das Kinn glatt rasiert, aber mit ein paar großen, sorgfältig gepflegten Koteletten. Er war sehr stutzerhaft gekleidet.
»Bitte,« sagte Charles und hielt ihm die brennende Cigarre hin.
Der Fremde beugte sich vornüber und zündete die seinige an. Dann nahm er ebenfalls auf der Bank Platz.
»Schönes Wetter heute!« begann er nach einer kleinen Weile, während Charles, vom Fremden beobachtet, eifrig weitergeschrieben hatte.
Charles warf einen prüfenden Blick nach dem Himmel, an dem kein Wölkchen zu sehen war.
»Es wird bald regnen,« antwortete er.
»Davon ist jetzt nichts zu merken.«
»Es wird aber doch; denn in zwei Monaten fängt die Regenzeit an.«
Charles wurde durch das Gespräch des Fremden im Schreiben gestört, er wünschte denselben von sich zu entfernen.
»Sagen Sie einmal,« fing dieser plötzlich an, »was wollte eigentlich vorhin Miß Petersen von Ihnen?«
Der Schreibende maß den Frager mit einem erstaunten Blicke, klappte das Buch zu, steckte es ein und drehte sich halb nach seinem Nachbar um.
»Eine offene Frage verdient auch eine offene Antwort: das geht Ihnen gar nichts an.«
Charles wollte aufstehen, da aber legte die Fremde die Hand vertraulich auf sein Knie, als wären sie schon alte Bekannte.
»Bleiben Sie, Sir Williams, Sie thun ja gerade, als kennten Sie mich nicht, und doch weiß ich bestimmt, daß Sie meine Visitenkarte bei sich haben.«
Charles quälte sich vergeblich, in dem ganz gewöhnlichen Gesichte seines Nachbars einen bekannten Zug zu entdecken. Der Mann war ihm völlig fremd.
»Zum Teufel,« schnauzte jetzt Charles denselben an, »ich kenne Sie nicht! Wer sind Sie?«
»Sie haben aber doch meine Visitenkarte bei sich,« versicherte der Fremde lächelnd.
»Was wetten Sie, daß ich Ihre Karte nicht bei mir habe?« fragte Charles.
Er verbrannte grundsätzlich jede ihm gegebene Karte; er führte nur seine eigenen bei sich.
Der Engländer läßt keine Gelegenheit vorbeigehen, um seine Lust am Wetten zu befriedigen.
»Hundert Pfund!«
»Well, ich nehme an! Sehen Sie Ihre Taschen nach!«
Charles griff zuerst in die Brusttasche und zog sein Notizbuch. Er öffnete es, und sofort fiel eine steife Karte heraus. Der Ueberraschte warf dem Fremden einen merkwürdigen Blick zu, dann las er:
»Nikolas Sharp.«
»Was,« schrie er, »Sie sind Nikolas Sharp? Wissen Sie auch, daß ich bereits seit einer halben Stunde immerwährend an Sie denke?«
»Gewiß! Sonst hätte ich Sie nicht aufgesucht und mir Ihre Grobheiten gefallen lassen.«
»Wie, Sie wissen, was für einen Auftrag mir Miß Petersen gegeben hat?« rief Charles erstaunt.
»Ich weiß es, aber ohne meine Unterstützung können Sie ihn nicht ausführen.«
»Bescheidenheit scheint keine Ihrer Tugenden zu sein. Weiß Miß Petersen auch, daß Sie mir Ihre Dienste anbieten?«
»Nein, und ich bitte Sie, sagen Sie Ihr nichts davon, überhaupt nicht, daß Sie mit Nikolas Sharp gesprochen haben. Uebrigens werde ich Ihnen auch nur unter der Voraussetzung eines Gegendienstes behilflich sein. Leisten Sie mir den nicht, so sehen Sie sich nach einem anderen um.«
»Aber, liebster Master Sharp,« sagte Charles, »in diesem Falle sind Sie gar nicht zu ersetzen, Sie sind doch jener Detektiv, der von den Gaunern das Kamel genannt wird?«
»Beinahe so! Nur ist es der Name eines kleineren Tieres, nämlich Chamäleon.«
»Also, Herr Chamäleon, sagen Sie mir, was Sie von mir verlangen, und geht es nicht über meine Kräfte, stehe ich Ihnen zu Diensten. Erst aber erzählen Sie mir, wie Ihre Visitenkarte in mein Notizbuch hineinkommt.«
»Sehr einfach,« lachte der Detektiv, »während ich mir vorhin die Cigarre an der Ihren anbrannte, schob ich sie zwischen die Blätter.«
»Ich habe gar nichts davon bemerkt.«
»Sollten Sie auch nicht! Doch nun passen Sie auf, und unterbrechen Sie mich nicht!«
Hatte sich Charles schon vorhin auf derselben Bank über den Auftrag von Miß Petersen höchlichst gewundert, so sperrte er jetzt bei der Erzählung des Detektivs Mund und Nase auf, wie man sagt, und als Nick Sharp endlich schloß, saß Williams eine Zeit lang sprachlos da.
»Nun, können Sie mir dazu helfen?«
»Mensch, sind Sie denn verrückt, so etwas von mir zu verlangen? Oder glauben Sie vielleicht, ich stehe zur rechten Hand der Königin von England, daß ich so mir nichts, dir nichts befehlen kann?«
»Das nicht, aber ich hielt Sie für den brauchbarsten aller Herren, die sich auf dem ›Amor‹ befinden.«
»Die ganze Welt scheint sich verbunden zu haben, mir heute Schmeicheleien zu sagen,« lachte Charles, »aber Sie fangen mich damit nicht. Eine solche Handlung verträgt sich nicht mit meinem Gewissen.«
»Gewissen hin, Gewissen her! Der Zweck heiligt die Mittel. Alles, was man so von Dienstehre u. s. w. spricht, sind meist nur leere Faseleien. Zieht der Herr Offizier den bunten Rock aus, dann zieht er auch einen anderen Menschen an. Sie wollen nicht?«
»Dann rechnen Sie auch nicht auf mich. Eine Gefälligkeit ist der anderen wert, so ist es bei mir Prinzip.«
»Aber lieber Herr Chamäleon, das ist doch etwas anderes.«
»Es ist ganz genau dasselbe.«
»Außerdem ist es noch sehr fraglich, ob der Betreffende einwilligt.«
»Dies zu bewirken, ist Ihre Sache.«
»Er wird es nicht thun.«
»Er thut es doch! Sie sind sein spezieller Freund, er hat von Ihnen eine ungeheuer hohe Meinung, und außerdem sind noch andere Gründe vorhanden, seine Einwilligung zu geben.«
»So.«
»Sie werden mir recht geben, nachdem Sie mit ihm gesprochen haben. Und nun bedenken Sie einmal, wie nützlich ich Ihnen dabei sein kann,«
»Das ist allerdings wahr. – Gut, ich werde es möglich zu machen suchen.«
»Bravo!« rief der Detektiv. »Wo kann ich den Herrn treffen, nachdem Sie ihn tüchtig vorbereitet haben?«
»Schlagen Sie einen Ort vor.«
In diesem Augenblicke kam ein Fakir, einer jener indischen, religiösen Fanatiker, welche sich meist durch Betteln ernähren, vorüber. Mit demütiger Gebärde streckte er den beiden die zusammengeballten Hände hin, sodaß man sehen konnte, wie die Fingernägel durch das Innere der Hand gewachsen waren. Die Fakire glauben, ein Gott wohlgefälliges Werk zu thun, wenn sie sich selbst quälen, und sind in derartigen Selbstmartern äußerst erfinderisch. Dieser Mann nun hatte, vielleicht schon vor vielen Jahren, gelobt, nie wieder die geballte Faust zu öffnen, um nichts Unreines mehr anzurühren, und so waren ihm schließlich die Fingernagel ins Fleisch gewachsen, bis sie auf der anderen Seite der Hand wieder zum Vorschein kamen.

Die beiden Herren reichten ihm einige kleine Geldstücke, welche er mit den Lippen aus ihren Fingern nahm.
»Hm,« brummte der Detektiv, als er sich entfernt hatte, »es ist schon dunkel, also eigentlich für Fakire nicht Zeit zu betteln. Nun, Sir Williams, wann kann ich Sie wieder sprechen?«
»Bis morgen abend will ich alles arrangiert haben. Doch schlagen Sie einen Ort vor, wo wir ungestört die Sache abmachen können, das heißt, wenn der Betreffende einwilligt.«
»Well, ich werde morgen abend um 8 Uhr im Hotel Alhambra in meinem Zimmer sein, das ist absolut sicher. Fragen Sie nur nach Master Chamberlin; unter diesem Namen bin ich hier eingetragen. Gute Nacht, Sir Williams, auf Wiedersehen!«
Im nächsten Augenblicke war der Detektiv von Charles' Seite verschwunden. Dieser Mann liebte es eben nicht, Zeit zu verlieren. Charles sah noch, wie er dem Fakir nacheilte, kurz hinter demselben den Gang mäßigte und ihn aufmerksam betrachtete.
Charles blieb noch so lange stehen, bis die beiden seinen Augen entschwunden waren; dann stand er auf und schritt dem Ausgange des Gartens zu.
»Charles,« rief plötzlich hinter ihm eine Stimme, und wie er sich umdrehte, sah er einen jungen Mann in der schmucken Uniform der englischen Dragoner vor sich stehen, von denen ein Regiment in Indien stationiert ist.
»Charles, du hier? So gehörst du mit zur Besatzung des ›Amor‹? Wir haben von eurem Unternehmen viel gelesen und uns lebhaft dafür interessiert. Sind auch Hendricks mit und Harrlington und Welton?«
Das alles sprudelte ohne Unterbrechung von den Lippen des erfreuten Offiziers.
»Horatio!« rief Charles, mehr erstaunt, als erfreut über das Wiedertreffen eines alten Freundes. »Plagt mich denn heute der Teufel? Eben wollte ich nach dem Kasino gehen, um dich dort aufzusuchen oder doch wenigstens deine Adresse zu erfahren, und nun läufst du mir von selbst in den Weg.«
Horatio O'Naill war ein alter Freund Williams', dessen Bekanntschaft er während seiner Dienstjahre in Indien gemacht hatte. Es ist allgemeine Sitte in England, daß die Herren der Aristokratie sich einige Jahre dem Vaterlande zur Verfügung stellen, und zwar dienen sie meist, nachdem sie in England selbst eine kurze Zeit als Volontär militärische Ausbildung genossen haben, in den Kolonien als Offiziere. Dann quittieren sie den Dienst und kehren nach England zurück. Ebenso wie Williams, hatten auch Hendricks, Harrlington und noch andere der Herren vom ›Amor‹ in Indien gestanden, andere wieder, wie Hastings und noch einige, in südafrikanischen Kolonien oder Gibraltar, Malta u. s. w. Daher kannte auch Horatio O'Naill, von Geburt ein Irländer, die meisten der Herren, aber er hatte an dem freien Soldatenleben ein solches Behagen empfunden, daß er nicht, wie seine Freunde, nach England zurückgekehrt, sondern im Dienste der englischen Armee geblieben war.
»Wie geht es deiner Braut, Horatio?« fragte Charles weiter. »Ich erfuhr vor einem Jahre von deiner Verlobung. Sie ist die Tochter eines englischen Großkaufmanns hier in Indien, nicht wahr?«
Horatio zog eine etwas betrübte Miene.
»Ich danke, sie befindet sich wohl, und wir sind glücklich. Seit einem Vierteljahr wohnt ihr Vater in Bombay, wo ich stationiert bin, und wo es für uns eine herrliche Zeit gab, da wir uns jeden Tag sehen konnten. Aber gestern kommt mit einem Male der Befehl, daß ich nach dem 4. Dragonerkontingent versetzt werden soll; in drei Tagen muß ich abreisen, und nun ist die schöne Zeit natürlich aus; denn unmöglich kann ich verlangen, daß Clarence, meine Braut, mir folgt. Doch hoffe ich, daß ich höchstens ein halbes Jahr fortzubleiben brauche; dann scheide ich aus der Armee und führe Clarence als mein Weib nach England heim.«
Charles war stehen geblieben.
»Wohin bist du kommandiert?« fragte er erstaunt. »Sage es mir noch einmal, deutlich und langsam.«
»Nach dem 4. Dragonerkontingent, Oberst Walton. Was ist da so besonders Merkwürdiges daran?« fragte Horatio, der das sonderbare Benehmen seines Freundes schon kannte, lächelnd.
»Nun schlage Gott den Teufel tot!« Charles griff sich an die Stirn. »Ich glaube, du Kerl stehst mit dem Satan im Bunde!«
»Was hast du nur, Charles? Du bist ja über meine Versetzung ganz erregt!«
»Komm', laß uns weitergehen! Ich dachte an etwas Anderes.« Charles hatte sich schnell wieder gesammelt. »Erzähle mir, lieber Horatio, wie es der Familie des Obersten Walton geht. Leben die beiden Mädchen noch bei ihm?«
»Gewiß, seine Nichte Rosa sowohl, wie Evelyn, eine entfernte Verwandte von ihm.«
»Hattest du nicht einmal ein Verhältnis mit der schönen Evelyn? Man munkelte etwas davon.«
»Das ist eben, was mir so furchtbar fatal ist,« rief Horatio ärgerlich. »Die glutäugige Evelyn hat sich allerdings einmal um mich bemüht, aber kein Entgegenkommen meinerseits gefunden. Ich liebe diese leidenschaftlichen Naturen nicht, die weder Maß, noch Ziel kennen. Nun ist meine Braut außer sich, daß ich nach dem 4. Dragonerkontingent komme und somit täglich im Hause des Obersten und mit Evelyn verkehren muß. Einem Mädchen kann man dies nicht übel nehmen.«
Charles stieß einen trillernden Pfiff aus, das Zeichen seiner höchsten Freude.
»Ich hab's, ich hab's!« rief er. »Horatio, ich kenne dich, du hast mich früher bei keinem Streich verlassen und wirst mir auch jetzt noch einmal die Hand zu einem bieten.«
»Ich glaube kaum. Als Bräutigam ist die Zeit vorüber, wo man sich mit lustigen Streichen abgiebt. Was hast du vor?«
»Es ist ein Streich, den ich gegen jemanden führen will. Willigst du nicht ein, mir zu helfen, so ist die Ausführung desselben unmöglich gemacht.«
»Wir werden sehen,« lächelte Horatio. »Ich bin, wie du weißt, in meinen Ansichten durchaus nicht so penibel, wie man eigentlich von einem Menschen verlangt, der in dem bunten Rocke steckt.«
»Topp!« rief Charles und schlug seinem Freunde auf die Schulter. »Du bist noch der Alte. Sage mal, Horatio, ist deine Braut eifersüchtig?«
»Ich glaube, ja.«
»Ausgezeichnet! Was meinst du, liebt dich Evelyn noch?«
»Sie schrieb mir bis vor einem halben Jahr immer noch; aber ich habe ihr die Briefe stets ungeöffnet zurückgeschickt, und zwar in Gegenwart meiner Braut – so unterließ sie dann ihre Korrespondenz. Deshalb also, mein lieber Charles, wenn du mich etwa als Köder benutzen und vielleicht so eine kleine Liebesszene arrangieren willst, dann hast du dich getäuscht. Auf so etwas lasse ich mich nicht mehr ein, das bin ich meiner Clarence schuldig.«
»Brauchst du auch gar nicht,« schmunzelte Charles. »Deine Braut wird sogar sehr zufrieden mit der Rolle sein, für die ich dich bestimmt habe. Dn sollst nämlich in der ganzen Geschichte nur eine Nebenfigur spielen.«
»Erkläre dich näher! Verlangst du nichts Unmögliches, so sage ich zu; verträgt es sich nicht mit meinen Anschauungen, so werde ich es dir kurz abschlagen.«
»Laß uns hier in dieses Hotel gehen! Bei einem Glase Wein läßt sich die Sache besser besprechen.«
»Achtung, präsentiert das Gewehr!«
Klirrend flogen die Waffen von der Schulter in die hohle Hand, wurden gleichmäßig nach links geneigt und kehrten wieder auf die Schulter zurück – das Präsentieren der englischen Soldaten. Gleichzeitig erscholl ein Trommelwirbel.
Eben ritt der Colonel, das heißt der Oberst, und zugleich der Kommandeur der indischen Festung Sabbulpore in der Provinz Heiderabad in den Exerzierhof ein.
»Etwas Neues?« fragte er kurz den englischen Offizier, der die aus Sepoys, das heißt Eingeborenen, aber nach englischem Muster uniformierten Soldaten, bestehende Wache kommandierte.
»Nichts, Colonel. Einige Briefe.«
Der Oberst legte dankend die Hand an die Mütze und ritt, während die Wache wegtrat, durch den Hof nach einem kleinen, aber langgestreckten Wohnhaus, vor dem er abstieg und die Zügel einem hinzuspringenden Eingeborenen zuwarf.
»Reibe das Pferd gut ab und führe es auf und ab! Es schwitzt stark,« sagte er auf indisch zu dem Burschen.
Er schritt einige Stufen hinauf und betrat sein Arbeitszimmer. Sofort kam ein anderer Eingeborener, die Ordonnanz des Obersten, und brachte ihm auf einem Teller einige Briefe.

Der Oberst überflog die Adressen derselben und legte sie gleichgültig auf einen Tisch.
»Sekim,« rief er dem hinausgehenden Indier nach.
Dieser kam wieder zurück.
»Wenn die Damen mich sprechen wollen, so brauchst du sie nicht erst wie gestern anzumelden. Sie haben stets Zutritt zu meinem Arbeitszimmer.«
Die Ordonnanz verbeugte sich und ging in den für sie bestimmten Nebenraum, wo sie auf den Ruf ihres Herrn zu warten hatte.
Dieser trat an das geöffnete Fenster und blickte lange nachdenkend in die vor ihm ausgebreitete Gegend.
Goldig lagerte die Sonne auf der herrlichen Landschaft, von Feldern, Wiesen und Hainen gebildet; hier und da schlängelte sich gleich einem Silberfaden ein heller Bach zwischen ihnen durch, und direkt vor dem Fenster erhob sich auf hohem Felsen die Festung Sabbulpore. Die Entfernung war nicht zu groß, um die aus den Schießscharten lugenden Kanonen nicht mehr bemerken zu können, welche ringsum das Land mit ihren Feuerschlünden beherrschten. Jetzt waren ihre Mündungen mit Deckeln verschlossen, aber noch nicht viele Jahre waren verstrichen, seit den stählernen Rohren Feuerstrahlen entquollen, die Tod und Vernichtung in die Reihen der aufrührerischen Indier, geführt von den eigenen, eingeborenen Offizieren, spieen.
Dort um jenen schmalen Weg, der sich um den für uneinnehmbar geltenden Felsen wand, hatte der ungleiche Kampf am heißesten gewütet. Die Geschütze nutzten nichts mehr, die Rebellen waren schon zu nahe, da aber brachen über die Zugbrücke dort die englischen Soldaten, voran der Kommandeur der Festung, Colonel Walton, mit dem Degen in der Faust, gegen den zehnfach stärkeren Feind. Mann gegen Mann, Brust gegen Brust wurde gerungen, kein Schuß ward abgefeuert. Nur krampfhaftes Stöhnen verriet, daß hier Menschen ihre ganze Kraft aufboten, den Gegner von dem steilen Felsen in die furchtbare Tiefe zu schleudern. Es gelang, den Feind zurückzudrängen, und der Donner der Kanonen erschütterte bald wieder die Luft, bis wie eine Wetterwolke ein Kavallerieregiment dahergejagt kam und nicht eher die bluttriefenden Pallasche in die Scheiden steckte, als bis der letzte der Rebellen geflohen war.
Oberst Walton seufzte tief auf und trat vom Fenster zurück, den Schreibtisch aufschließend und sich vor denselben setzend, um nunmehr die Briefe zu lesen.
Der Oberst war ein noch nicht sehr alter Herr, aber sein kurzgehaltenes Haar war schon völlig ergraut, wie auch das mit tiefen Falten durchzogene Gesicht auf ein höheres Alter schließen ließ. Er war nicht in Uniform, sondern, wie alle englischen Offiziere der Kolonieen, wenn sie sich nicht im Dienst befinden, in einen leichten, grauen Anzug nach Civilschnitt gekleidet.
Die Hofmauer, innerhalb deren das Wohnhaus lag, war das sogenannte ›Quartier‹, der Aufenthaltsort derjenigen Soldaten, welche nicht direkt zur Festungsbesatzung gehörten.
Es waren fast nur Sepoys, Eingeborene, welche von der englischen Regierung als Soldaten angeworben, unter Aufsicht von europäischen Offizieren und Unteroffizieren einexerziert werden und ein Kontingent bilden. Außer den englischen Offizieren befinden sich aber bei der britisch-indischen Armee noch eingeborene Offiziere, meist aus den höchsten Kreisen der indischen Bevölkernng stammend, welche der Kaiserin von Indien, also der Königin von England, den Schwur der Treue geleistet haben.
Die englischen Offiziere wohnten nicht in der Festung, sondern in luftigen Gebäuden des Quartiers, da sie hier nicht von den ewigen Trompetensignalen und Kommandorufen belästigt wurden, die indischen Offiziere auf ihren Landgütern. Nur, wenn der Dienst sie in die Festung rief, betraten die Offiziere dieselbe.
Zur Sicherheit lag in der Festung Sabbulpore auch eine Abteilung englischer Soldaten, diese war aber, da an einen Aufstand der von ihren Häuptlingen, Rajahs genannt, gegen die Engländer aufgehetzten Eingeborenen nicht zu denken war, nur sehr schwach an Zahl.
Sinnend stützte Oberst Walton das Haupt auf die rechte Hand und dachte über den Inhalt eines Briefes nach, dessen Siegel das Wappen Englands trug. Es mochten keine freundlichen Gedanken sein, welche ihn beschäftigten, denn die hohe Stirn des Lesers legte sich in immer tiefere Falten.
Da fuhr ihm eine weiche, zarte Hand über dieselbe, als wollte sie die Furchen glätten, und eine helle Mädchenstimme fragte in zärtlichem Tone:
»Warum so finster, Onkelchen? Hast du schlechte Nachrichten erhalten?«
Neben dem Offizier stand Rosa, seine Nichte, welche er vor Jahren, als sie eine Waise wurde, aus England zu sich genommen hatte. Wie sie allein stand, so war auch er, ein Witwer und kinderlos, ohne jeden Anhang bis auf eine entfernte Verwandte, mit der er nicht harmonierte.
So hatte sich sein Herz vollständig an Rosa gehängt, sie war sein Kind, sein Schatz geworden, den er wie seinen Augapfel hütete; er konnte ohne sie nicht leben: früh sein erster Gedanke galt ihr, wie abends der letzte.
Aber das neben ihm stehende Mädchen hätte noch manch anderen mit eben solcher Macht bezaubert.
Sie war eine kleine, wunderbar zierliche Figur; die Händchen und Füßchen schienen einem Kinde zu gehören, die sanfte und doch vollendet schöne Rundung des Busens und der Schultern verriet, daß sie kaum dem Kindesalter entwachsen war.
Das weiche, blonde Haar war in einem Knoten aufgeschürzt, aber es konnte kaum dadurch gebändigt werden; bei jeder Bewegung fiel es immer wieder über den schneeigen Hals und spottete aller Anstrengungen und aller Bemühungen, es glatt zu streichen. Kindlich waren auch die großen, blauen Augen, welche jetzt so zärtlich besorgt in die des Obersten blickten. Von der ganzen Gestalt ging ein duftiger Hauch von Reinheit und Unschuld aus.
Der Oberst schüttelte den Kopf.
»Nein, Rosa, es sind keine schlimmen Nachrichten weiter, aber sie können unangenehme Folgen mit sich bringen. Horatio O'Naill ist als Kapitän nach Sabbulpore kommandiert worden.«
Das Mädchen fuhr erschrocken zusammen.
»Dann muß Evelyn fort,« rief sie.
Der Oberst zuckte die Achseln.
»Ich kann ihr nichts befehlen, sie hat ihren freien Willen und darf bleiben, wo sie will. Ein Unglück ist es, daß durch dieses Mädchens Adern das wilde, französische Blut fließt.«
»O'Naill ist verlobt?« fragte Rosa nach einer Weile.
»Mit einer Engländerin in Bombay; der Abschied wird ihm schwer werden. Seine Braut kann nicht mitkommen, weil ihres Vaters Gegenwart in Bombay geschäftlich notwendig ist.«
»Das giebt ein Unglück,« meinte Rosa betrübt. »Ich kenne Evelyns wilde Leidenschaft nur zu gut. Mich dauert die arme Braut.«
»Nun,« sagte der Oberst und streichelte sanft des Mädchens Hand, »sorge du dafür, daß die beiden nicht wieder zusammenkommen, deiner Klugheit wird es schon gelingen, ich zweifle nicht daran. Aber hier,« er nahm einen Brief vom Tisch, »habe ich eine andere Nachricht, welche dich sehr erfreuen wird. Du hast doch gelesen von jenen Amerikanerinnen, welche als Matrosen eine Reise um die Erde machen, und von jenen Engländern, welche sie dabei begleiten?«
»Gewiß, die englischen Zeitungen berichten ja ihren Lesern ganz genau, wo sich die Weltumsegler befinden, welchen Hafen sie angelaufen haben, und wie es mit ihrer Gesundheit steht. Auch das erste Abenteuer, wie jene Vestalinnen die geraubten Mädchen befreit haben, ist ausführlich beschrieben worden. Ich interessiere mich ganz besonders dafür, kenne ich doch sehr viele der englischen Herren persönlich.«
»Dann würdest du dich wohl auch freuen, wenn du die Besatzungen der beiden Schiffe einmal sehen könntest?« fragte der Oberst lächelnd.
»Ach, das wäre reizend!« rief Rosa.
»Nun, hier habe ich einen Brief von Lord Harrlington, mit dessen Vater ich eng befreundet war; er kündigt mir darin an, daß die Herren des ›Amor‹ sowohl, als auch die amerikanischen Damen eine Reise quer durch Indien machen und dabei in Sabbulpore vorsprechen wollen. Würde dir dies angenehm sein?«
»O,« rief Rosa und klatschte vor Entzücken in die Hände, »dann kommen sie alle, Lord Harrlington, Hendrick, Roberts, Courtney und auch der spaßige Charles, nicht wahr?«
»Wer ist das, der spaßige Charles?« fragte der Oberst erstaunt.
»Sir Charles Williams,« verbesserte sich Rosa, »wir nannten ihn nur immer den lustigen Charles, weil er niemals ernst sein konnte. Das war doch eine schöne Zeit, als du noch in Kalkutta standest. Hier ist es so einsam,« fügte sie traurig hinzu.
»Bin ich dir nicht genug?« sprach der Oberst in zärtlichem Tone.
»Verzeih' mir Onkel, ich wollte dich nicht kränken,« rief Rosa und schlang ihre Arme um des Onkels Hals. »Ich bin ein undankbares Mädchen. Nein, wo du bist, da ist es überall schön, und dann ist ja auch ...«
Rosa wurde unterbrochen, die eingeborene Ordonnanz trat ins Zimmer und meldete:
»Rajah Skindia – Jemedar (Leutnant) Abudahm.«
»Laß sie eintreten!«
»Wer ist noch da, Rosa?« fragte der Oberst, als der Bursche wieder hinaus war.
»Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Wie bist du mit deinem Diener zufrieden, Onkelchen?«
»Er ist ein stiller, aufmerksamer Bursche, ich werde ihn behalten. Doch gehe jetzt ins Empfangszimmer, ich glaube, Leutnant Werden wollte sich heute morgen nach der Gesundheit der Damen erkundigen.«
»Das ist schön, aber nicht so ein böses Gesicht machen, Onkelchen!«
Sie verschwand durch die eine Thür, während durch die andere die beiden Angemeldeten eintraten.
Der Rajah Skindia, der Häuptling der umwohnenden, meist von Ackerbau lebenden Indier und zugleich der höchste Befehlshaber im Fort Sabbulpore, aber noch unter der Aufsicht Waltons stehend, war ein hochgewachsener, imposanter Mann mit langem Vollbart. Seine Kleidung war überaus reich. Das wallende Gewand ward durch einen Gürtel zusammengehalten, an dessen Schloß Diamanten blitzten, und gleich edle Steine zierten die Agraffe des Turbans. Er trug nur einen langen Dolch, während sein Begleiter mit einem krummen Säbel bewaffnet war.
Letzterer unterschied sich überhaupt vollkommen von dem Rajah. Obgleich einen indischen Namen und die Uniform eines indischen Kriegers tragend, zeigten doch seine Züge Spuren europäischer Abstammung. Schön waren sie unbedingt zu nennen; ihr Ausdruck war kühn und edel, aber die schwarzen funkelnden Augen verrieten nicht nur Mut, sondern auch eine nicht zu bändigende Leidenschaft.
Er trug Sandalen, deren Riemen kunstvoll bis über die Kniee gewickelt waren, den Oberkörper bedeckte ein leichtes Gewand, aber ein bei jeder Bewegung klirrendes Geräusch verriet, daß unter diesem ein Kettenhemd, wie sie in Indien von den einheimischen Waffenschmieden angefertigt werden, sich seinem Körper anschmiegte. Ein stählerner Helm mit einer sonderbaren Tierfigur vervollständigte den kriegerischen Eindruck, den er auf den Beobachter machte.
Wären diese beiden Offiziere nicht in dienstlichen Angelegenheiten zum Oberst gerufen worden, so hätte man Abudahm in europäischem Anzug erblicken können, denn er war zwar der Sohn eines Indiers, eines sehr reichen Mannes, aber seine Mutter war eine Französin, und er hatte in Paris seine Bildung erhalten. Dennoch hielt er sich vollständig zu den Eingeborenen, war Muhamedaner und hatte alle Sitten und Gewohnheiten derselben angenommen.
Die beiden Indier verneigten sich bei ihrem Eintritt schweigend mit gekreuzten Armen.
»Ich habe dich rufen lassen, Rajah Skindia,« begann der Oberst, sich des Idioms der Eingeborenen bedienend, »um den Grund zu erfahren, warum der Unterleutnant Majuba in Eisen gelegt worden ist. Habe ich den Befehl gegeben?«

Der Rajah deutete auf Abudahm.
»Dieser wird dir sagen, daß sich Majuba eines Vergehens schuldig gemacht hat, das gerade Ihr Engländer so streng bestraft.«
»So sprich, Abudahm,« forderte der Oberst den Indier auf.
»Der Unterleutnant hat sich geweigert, einen von mir gegebenen Befehl zu vollstrecken. Wir gerieten in Wortwechsel, ich mag etwas zu heftig gewesen sein, plötzlich riß Majuba den Dolch heraus und wollte ihn mir in die Brust stoßen. Nur diesem Panzerhemd habe ich es zu danken, daß ich noch vor dir stehe.«
»Was betraf der Befehl, den er auszuführen verweigerte?«
»Dienstliche Angelegenheiten, es war auf dem Burghof.«
»So habt Ihr kein Recht, ihn gefangen zu halten, er gehört unter meine Aufsicht, denn er hat sich nicht gegen Euch, sondern gegen England vergangen. In spätestens einer Stunde will ich ihn zum Verhör haben; nie glaube ich, daß Majuba sich wegen einer Kleinigkeit an einem Vorgesetzten vergreift.«
Der Oberst machte eine entlassende Handbewegung, doch die beiden standen unbeweglich an der Thür.
»Colonel Walton,« rief der Rajah und trat einen Schritt vor, »bedenke, was du thust! Ein Indier hat auf das Leben eines Offiziers einen Anschlag gemacht; wir haben ihn gefangen genommen, und nun kommt Ihr Engländer und gebt ihn wieder frei. Wo bleibt da unser Ansehen, welches nötig ist, die Eingeborenen in Schranken zu halten?«
Der Oberst wies mit der Hand auf die Felsenfestung und sagte mit erhobenem Tone:
»Als damals die aufrührerischen Indier bei Nacht heimlich den Eingang zur Burg erstiegen, waren sie es vielleicht gewesen, in denen der Plan zum Aufruhr gereift, oder waren es nicht gerade ihre Führer, welche das Feuer der Rebellion geschürt haben?«
Der Rajah fuhr hastig auf.
»Zweifelst du an meiner Treue? Habe ich damals nicht mit meinem Leben Euch Engländer geschützt?«
Der Oberst zuckte die Achseln.
»In einer Stunde will ich Majuba vor mir haben,« wiederholte er.
»Es geht nicht, Colonel, nimm den Befehl zurück!« rief aber Abudahm.
»Er hat mein Leben bedroht, das seinige ist verwirkt; in einer Stunde wirst du die Gewehre knallen hören, die den Mörder ins Jenseits befördern.«
Langsam kam der Oberst auf den indischen Krieger zu und maß ihn von unten bis oben.
»Abudahm,« sagte er, jedes Wort betonend, »nimm dich in acht. Du hast französisches Blut in deinen Adern, du hast eine französische Erziehung genossen und hältst nun auch uns nach den Ansichten der Franzosen für Usurpatoren in einem Reiche, das eigentlich Frankreich gehören soll. Ich rate dir, zähme deine Leidenschaften, Rajah,« fuhr er, zu diesem gewandt, fort, »wie kommt es, daß fortwährend Zwistigkeiten zwischen meinen Leuten und den deinen entstehen? Wie kommt es, daß unseren Befehlen nur widerwillig, oft auch gar nicht gehorcht wird?«
»Ich weiß es nicht,« antwortete der Häuptling, »es mögen Leute unter ihnen aus den Bergen aufrührerische Reden halten. Ich werde ein scharfes Auge auf sie richten.«
»Thue das! Also nochmals, in einer Stunde steht Majuba vor mir!«
»Kapitän O'Naill,« meldete die Ordonnanz.
»Eintreten!« Der Oberst machte den beiden Indiern eine entlassende Handbewegung.
Bei Nennung des Namens war dem jüngeren Offizier ein zischender Laut über die Lippen geschlüpft; unwillkürlich fuhr er mit der Hand nach dem Dolche. Als er sich umdrehte, begegnete sein Blick dem des Kapitäns. Beide Männer maßen sich mit langem Blick. Das Auge des Indiers zeigte einen furchtbar drohenden Ausdruck, das des englischen Offiziers mehr einen unangenehm überraschten. Ohne sich zu begrüßen, gingen sie beide aneinander vorbei.
»Mein lieber O'Naill,« sagte der Oberst herzlich, »eine angenehmere Nachricht konnte ich nicht bekommen, als daß Sie es sind, der die freigewordene Stelle des Kapitäns in Sabbulpore besetzen soll. Ich brauche jetzt gerade tüchtige Leute, denn es ist hier nicht alles so, wie es sein sollte.«
Die beiden Herren schüttelten sich die Hände, und Horatio erkundigte sich nach dem Befinden der Damen.
»Sie befinden sich alle wohl. Meine Nichte freut sich ungemein auf den Besuch jener Herren und Damen, deren Schiffe, der ›Amor‹ und die ›Vesta‹, jetzt in Bombay liegen. Haben Sie dieselben dort gesehen?«
»Ich habe die Herren sogar gesprochen und ihre Absicht erfahren, Sabbulpore einen Besuch abzustatten. Nur einer von ihnen schließt sich aus; Sie kennen ihn auch noch von früherher; es ist Sir Williams, der einen seiner Freunde besuchen will.«
»O, das ist schade! Gerade auf diesen hat sich Rosa so gefreut! Haben Sie Ihre Burschen selbst mitgebracht, Kapitän, oder wollen Sie sich von meinen Leuten welche aussuchen?«
»Ich habe meine zwei Diener bei mir,« antwortete Horatio, »einen Hindu und einen Engländer. Er ist neu zur indischen Armee angeworben worden, etwas dumm, scheint aber treu zu sein. Ich werde ihn behalten.«
»Majuba,« meldete wieder der indische Diener.
»Kommt er allein oder unter Bedeckung?«
»Allein! Er wünscht Sie unverzüglich zu sprechen.«
»Laßt ihn im Vorzimmer warten.«
»Ich weiß nicht, was die beiden indischen Offiziere, der Rajah und Abudahm, den Sie auch kennen, gegen Majuba haben. Fast scheint es mir, als wollten sie ihn aus dem Wege räumen; denn sie haben schon unzählige Versuche gemacht, ihn wenigstens von Sabbulpore zu entfernen. Und gerade er ist derjenige der indischen Offiziere, auf dessen Treue ich mich unbedingt verlasse, während ich den anderen nur so weit traue, wie ich sie sehen kaun.«
»Warum haben Sie ihn zu sich beordert, Colonel?«
»Gestern hat Abudahm die Leute instruiert, und Majuba mußte mit etwas nicht einverstanden sein; beide gerieten in Wortwechsel, entfernten sich außer Hörweite der anderen Indier und stritten heftig miteinander, bis schließlich Majuba seinen Dolch zog und Abudahm zu töten suchte. Er wurde daran gehindert, festgenommen und in Ketten gelegt, ohne daß man mir davon Mitteilung machte. Zufällig erfuhr ich davon, ließ den Rajah und Abudahm zu mir kommen und verlangte, daß Majuba vorgefühlt werde. Sonderbarerweise weigerten sich beide, dies zu thun. Nun, wir werden gleich sehen, was zu der Sache ist.«
Er klingelte und hieß dem Burschen, Majuba eintreten zu lassen. Dieser ging in das Vorzimmer, stürzte aber gleich darauf mit allen Zeichen des Entsetzens zum Oberst zurück, unfähig, ein Wort zu sprechen.
»Was ist geschehen?« riefen die beiden Herren und eilten selbst in den Nebenraum.
Da lag der indische Offizier, das Gesicht zur Erde gekehrt, in einer großen Blutlache. Sein Rücken zeigte eine tiefe Stichwunde, die im Herzen zu enden schien.
Als die beiden indischen Offiziere das Zimmer des Obersten verlassen hatten, bestiegen sie ihre auf dem Hofe harrenden Pferde und verließen das Quartier, um sich nach ihren in der Umgegend liegenden Landhäusern zu begeben.
»Du warst unvorsichtig,« sagte unterwegs der Rajah zu seinem Begleiter, »dem Obersten den Tod des Verräters zu verkünden.«
»Die Wut gab mir die Worte ein,« entgegnete Abudahm, »ich hasse diesen Oberst, der unsere Absichten zu durchschauen scheint; ich hasse ihn wie alle Engländer, überhaupt alle Faringis, welche unser Land betreten. Was haben sie darin zu suchen? Brauchen wir sie etwa, sind es nicht nur Schmarotzer, welche sich an dem, was uns gehört, bereichern?«
»Du hast recht,« sagte der Rajah finster. »Doch bald wird der Tag kommen, da ihrer Herrschaft ein Ende gemacht wird. Ganz Heiderabad wartet nur auf den Moment, daß ich das Zeichen zum Aufstand gebe. Schlägt die Flamme des Aufruhrs in Sabbulpore zum Himmel, so bricht derselbe in ganz Indien los.«
»Doch wann geschieht dies endlich?« unterbrach ihn der behelmte Krieger ungeduldig, »du ziehst diese Stunde von Tag zu Tag hin. Was fehlt uns noch, loszuschlagen? Unsere Offiziere haben ihre Instruktionen; die Eingeborenen hoffen sehnsüchtig den Tag herbei, wo sie das Joch ihrer Unterdrücker, für die sie arbeiten, abschütteln und ihre Dolche mit deren Herzblut färben können, und unsere Sepoys sind vorzügliche Soldaten geworden, dank der Bemühungen englischer Offiziere.« schloß der junge Indier höhnisch lächelnd.
»Es ist noch nicht die Zeit da. Noch muß die Felsenburg Parahimbro vollständig befestigt werden. Wie sollen die Engländer, diese Thoren, staunen, wenn diese halb verfallene Festung plötzlich von Kanonen starrt und dem Feuer von Sabbulpore antwortet. Von dort aus beherrschen wir den Eingang zu diesem Thal; keine feindliche Truppe kann in dasselbe eindringen ohne unsere Erlaubnis.«
Parahimbro war eine kleine ehemalige Festung der Indier, wie ein Adlerhorst hoch am Felsen hängend. Sie gehörte dem Rajah Skindia, und er verweigerte die Herausgabe dieses wichtigen Punktes an die Engländer unter der Vorgabe, er wolle sich später an dieser Stelle ein Sommerschloß bauen. Die alte Burg war schon halb verfallen, jetzt aber arbeiteten viele Handwerker, unter der Leitung des Rajahs daran, welcher, allem Anschein nach, jetzt wirklich mit der Absicht umging, die Mauern wegzureißen und an deren Stelle ein Schloß erbauen zu lassen.
»Was gedenkst du in Betreff Majubas zu thun?« fraqte der junge Indier. »Der Bursche kann uns verderblich werden. Wir haben diesem Verräter am Vaterland glücklicherweise nicht in unsere Pläne eingeweiht, aber er hat natürlich eine Ahnung von unserem Vorhaben und wird dem Obersten Enthüllungen machen. Als er mir gestern vorwarf, daß ich durch Aufwiegeln der Sepoys zum Meineidigen würde, reizte ich ihn durch meinen Hohn zum Zorn, Ich ließ ihn festnehmen, in der Hoffnung, du würdest ihn auf der Stelle erschießen lassen. Wie willst du nun verhindern, daß er plaudert?«
»Wir dürfen dem Befehl des Obersten nicht ungehorsam sein, sonst schöpft er Verdacht. Ich werde ihn hinschicken und zwar als freien Mann.«
»Bist dn wahnsinnig?« rief Abudahm. »Weißt du nicht, welche Anklagen der Bursche gegen dich wegen der Tochter des Obersten –«
»Schweig',« herrschte ihn der Rajah drohend an, »diese Dinge sind begraben. Nein, ich werde ihn hinschicken, aber dafür sorgen, daß er nicht sprechen kann. Hast du neue Nachrichten von Evelyn bekommen?« – »Nein.«
»In nächster Zeit werden neue Kommandierungen erfolgen. Forsche sofort Evelyn darüber ans, damit ich meine Maßregeln treffen kann. Wann werde ich den Inhalt der Briefe erfahren, die der Oberst heute erhielt?«
»Morgen spreche ich mit Evelyn.«
»Das Mädchen ist uns unersetzlich. Es ist für unsere Sache eifriger bemüht, als wir alle zusammen. Wie steht Ihr beide miteinander?«
Der Indier knirschte mit den Zähnen.
»Dieser Sohn einer Hündin, der Kapitän O'Naill, ist hier eingetroffen, und ich habe weniger Aussicht denn je, mir ihre Neigung zu gewinnen. Dieser Bursche ist der erste, der von meiner Hand fallen muß. Mein Weg führt hier ab, Rajah, auf Wiedersehen!«
Er bog in einen Weg zur Rechten ein und sprengte im Galopp davon.
Finster blickte der ältere Mann ihm nach, dann umspielte ein teuflisches Lächeln seine Züge.

»Und der zweite bist du, der ihm nachfolgt, du und Evelyn. Ihr beide waret meine Helfershelfer. Evelyn hat noch die Beweise in den Händen, daß ich es war, welcher Lucilla verschwinden ließ. Haha, es ging dem Oberst ans Herz, aber das genügt mir nicht, meine Rache kennt keine Grenzen. Er war es, der mir das Liebste auf Erden stahl, so habe ich nur recht gehandelt, wenn ich ihm das Teuerste nahm. Erst du, Abudahm, dann Evelyn, und ich habe keine Mitwisser mehr.«
Er wendete sein Pferd und ritt nach dem Quartier zurück, um Majuba auf freien Fuß zu setzen.
Bereits seit vier Tagen befanden sich die englischen Herren und die Vestalinnen in Sabbulpore, und zwischen den Gebäuden, wo sonst nur Trompetensignale und Kommandorufe ertönt waren, vermischt mit den Flüchen der Unteroffiziere, waren jetzt Lachen und Scherzworte hörbar. Den jüngeren Offizieren war es hauptsächlich angenehm, daß der Besuch der Herren und Damen in Sabbulpore stattgefunden hatte, denn der Oberst sorgte dafür, daß es seinen Gästen nicht an Abwechslungen fehlte. Wurden nicht Ausflüge in die Umgegend unternommen, so war sicher darauf zu rechnen, daß der Abend die Gesellschaft zu einer Festlichkeit vereinigte.
Die Dämmerung war angebrochen, der heiße Tag war dem kühleren Abend gewichen, und in den Gärten, welche das Quartier umgaben, wandelten die Paare auf und ab, plauderten, lachten, oder führten ernste Gespräche.
»Ist es nicht jammerschade, daß Sir Williams nicht bei dieser Partie ist?« fragte Miß Thomson ihren Ritter. »Mir fehlt immer etwas, wenn ich mich umsehe und sein ewig fröhliches Gesicht und heiteres Lachen unter den Uebrigen vermisse.«
»Mir geht es ebenso,« versicherte der Angeredete, »aber er hat uns sein Wort gegeben, bald wieder zu uns zu stoßen. Es muß ein sehr intimer Freund sein, den er in Kalkutta aufsuchen will, sonst hätte er uns nicht verlassen und am wenigsten eine gewisse Person.«
»Welche meinen Sie?« fragte das Mädchen unschuldig. – »Diejenige, mit welcher ich mich jetzt unterhalte.« – »O, Sie Bösewicht,« sie schlug ihn mit dem Fächer. »Sehen Sie dort die Tochter des Obersten mit Leutnant Werden, ich glaube, deren eifrige Unterhaltung erstreckt sich auch nicht aufs Wetter.«
»Der Leutnant macht der Nichte seines Vorgesetzten entschieden den Hof, Miß Rosa ist aber auch ein reizendes Mädchen, sie gefällt mir in ihrer Anmut tausendmal besser, als ihre schöne Cousine Evelyn. Was meinen Sie von dieser, Miß Thomson?«
»Ich mag sie nicht leiden, ihr Blick hat etwas Unstetes, Scheues. Schön ist sie allerdings, aber es ist eine zu wilde Schönheit, wie ich sie nicht liebe. Dort geht sie eben. Sehen Sie nur, wie scheu sie sich nach allen Seiten umsieht, gerade, als hätte sie ein böses Gewissen!«
Die Besprochene bog eben in einen Seitengang, der in ein Orangenwäldchen führte. Sie sah sich von Zeit zu Zeit um, glaubte sich aber nicht beobachtet, denn jene beiden, welche sich von ihr unterhielten, wurden durch ein Gebüsch ihren Augen entzogen.
Die hohe Gestalt war von einem enganliegenden, schwarzen Kleid umschlossen, welches ihre vollen Formen deutlich verriet. Die Arme waren ebenso, wie der Busen nur mit einer leichten Gaze verhüllt, so daß die weiße, zarte Haut in der Dunkelheit leuchtete.
Jetzt hatte sie das Wäldchen erreicht. Sie zog eine Uhr hervor.
»Acht Uhr,« murmelte sie. »Kommt er diesmal nicht, so gebe ich die Sache verloren. Ich bemühe mich nicht wieder um ihn.«
Sie lehnte sich an einen Stamm und starrte nach den zum Wäldchen führenden Eingang des Weges.
»Was ist es nur, das mich immer und immer wieder dazu treibt, ihn zu sehen, ihn zu sprechen, ihn zu hören!? Ich muß mich selbst verachten, daß ich mich soweit erniedrigen kann.«
Sie lachte höhnisch auf.
»Ich mich verachten?« rief sie spöttisch. »Dazu wäre eher Zeit gewesen. Spion, Verräter, Mädchenräuber und so weiter, alles zu gleicher Zeit. Doch das gilt alles nur, um diesen verfluchten Engländern zu schaden. Was kann ich dafür, daß mir mein Vater diesen Haß von Jugend an eingeimpft hat? Horch, Schritte,« unterbrach sie ihr Selbstgespräch, »er ist es, Horatio, er kommt wirklich! Nun biete deine ganze Kunst auf, Evelyn!«
In der That war es der Kapitän, welcher sich zu dem ihm von Evelyn gewährten Rendezvous einfand.
Mit schnellen Schritten näherte er sich der Gestalt, die ihn, sich mit einer Hand an den Baum stützend, vor Aufregung zitternd, erwartete.
»Evelyn!« sagte der Mann leise, der jetzt vor ihr stand und sie mit wehmütigen Blicken betrachtete. »Warum quälst du mich fortgesetzt mit Bemühungen, meiner habhaft zu werden. Kennst du nicht meine Verhältnisse, weißt du nicht, daß ich nicht dein sein kann?«
Erstaunt blickte Evelyn empor. So weich hatte sie ihn noch nie sprechen hören. Sonst setzte er ihren Bewerbungen immer ein kaltes Schweigen entgegen, welches Verachtung verriet, er entzog sich ihrer Nähe, wo er nur immer konnte. Und doch, Indien ist das Land der Liebe, die mit Blumenduft geschwängerte Luft kann hier selbst das kälteste Herz zur Liebe entflammen.
In den dunklen Augen des schönen Weibes flammte es heiß auf.
»Horatio,« hauchte sie, »willst du mit mir spielen?«
Traurig schüttelte der junge Mann den Kopf.
»Sieh, Evelyn, mir hat die Natur ein anderes Herz gegeben, als dir. Du bist in Indien geboren, du kennst nichts davon, daß man auch mit der Zukunft rechnen muß, das Genießen des Jetzt ist es, wonach du jagst. Wir kälteren Nordländer ziehen aber die Zukunft in Betracht. So wußte ich vom ersten Augenblick an, als ich deine Liebe zu mir merkte, daß wir beide nie zusammenpassen würden, dein wildes, südliches Blut harmoniert nicht mit dem meinigen, und du würdest bald meine Kälte unerträglich finden.« – »Horatio!«
»Laß' mich sprechen! Ich unterdrückte die keimende Liebe, die ich beim ersten Anblick für dich empfand, schwer ist mir der Kampf geworden, ich habe so manche Nacht mit mir gerungen, aber ich bin stets Sieger geblieben. Es war ein Glück für uns beide, daß wir damals getrennt wurden, ich kam nach Bombay und dort fand ich das Mädchen, welches für mich geeignet war. Es ist nicht so schön, wie du – du bist im Vergleich zu ihr eine Göttin – es ist nicht so bezaubernd, wie du, dir kann ich es bekennen, aber dennoch schlug es mein Herz in Fesseln, und willig duldete ich dieselben, denn ich wußte, daß Clarence das Wesen war, welches mir ewig die Treue bewahren würde.«
»Zweifelst du, daß ich dasselbe gethan hätte?« fragte Evelyn atemlos; fiebernd pochten ihre Pulse.
»Ich zweifle daran,« war die ruhige Antwort. »Ein nüchterner Mensch, wie ich, würde dir bald nicht mehr genügen, du würdest ihn beiseite werfen und dir ein anderes Spielzeug suchen.«
Blitzschnell jagten in dem Gehirn des Weibes die Gedanken. So war er ihr also noch nicht verloren, er hatte Liebe zu ihr empfunden, aber der energische Engländer wußte sie so gut zu verbergen, daß selbst das feinfühlende Weib es nicht hatte erraten können. Wunderbar! Er hatte ja recht, sie paßten nicht zusammen, aber was kümmerte sie die Zukunft? Jetzt, jetzt mußte er ihr gehören! Der Triumph, ihn zu ihren Füßen liegen zu sehen, seiner Braut ihn entrissen zu haben, einer verhaßten Engländerin, lockte sie, und dann außerdem war er nach dem Obersten der Höchste im Fort, er führte Siegel und Schlüssel, welcher Nutzen für ihre Freunde, der Engländer Feinde, wenn dieser stolze Mann ihr gehorchte, wie ein Kind.

Evelyn hatte schon andere Triumphe gefeiert, dieser sollte ihr leicht werden.
»Warum bist du heute meiner Einladung gefolgt und hierhergekommen?« fragte sie.
»Um dich zu bitten, mich nicht länger zu verfolgen. Wenn du dir selbst keinen Frieden erringen kannst, wenn du das Glück meiner Braut vernichten willst, mache mich wenigstens nicht dadurch unglücklich, daß ich deinen Schmerz mitansehen muß, er zerreißt mir das Herz.«
Da flog das schöne Weib an seine Brust und umschlang seinen Hals. Horatio fühlte die weichen Arme, er fühlte den heißen Atem, das Heben und Senken des Busens, und ein Zittern durchflog seinen Körper.
»Horatio,« flüsterte sie mit glühender, leidenschaftlicher Stimme, »stoße mich nicht von dir! Nimm alles von mir, was ich dir geben kann, aber verachte mich nicht länger!«
»Laß mich!« rief Horatio mit vor Aufregung zitternder Stimme, »laß' mich, denke an meine Braut!«
Er versuchte sich von den ihn umstrickenden Armen freizumachen.
»Nein, ich lasse dich nicht, bis du mir versprichst, mich nicht mehr zu verachten! Nur einen freundlichen Blick gönne mir, einen einzigen!«
Ihr Mund näherte sich immer mehr dem seinigen, ihre schwellenden Lippen schmachteten nach Küssen, und heiß blitzten die schwarzen Augen den jungen Mann an.
»Evelyn.«
Er flüsterte den Namen so zärtlich, es war um ihn geschehen.
Sie hielten sich innig umschlungen, Lippe auf Lippe, und tauschten Kosenamen. Vergessen war Clarence! Evelyn hatte gesiegt.
»Welch selige Stunden werden wir noch erleben,« flüsterte endlich Evelyn.
Der Offizier antwortete nicht; noch immer hielt er das Mädchen umschlungen.
»Sag', Horatio, wie lange wirst du in Sabbulpore bleiben?«
Der junge Mann antwortete nicht.
»Wann kehrst du nach Bombay zurück?«
Da zuckte er zusammen, langsam machte er seine Arme von der Gestalt frei. Wie betäubt griff er sich an die Stirn.
»Was habe ich gethan, Clarence, mein Gott!«
»Bereust du, daß du mich lieber hast, als Clarence?«
»Bereuen? Nein, Evelyn, ich gehöre dir von nun bis zum Tod.«
Wieder fanden sich ihre Lippen.
»Du willst für immer bei mir bleiben?« – »Für immer.« – »Du lösest deine Verlobung mit Clarence auf?« – »Ich will, ich muß es jetzt!« – »Thust du es gern?«
»Mir thut sie leid, aber ich kann nicht anders, ich fühle jetzt erst, daß du mir teurer bist, als alles in der Welt!« – »Mein Horatio!«
Endlich raffte sich das Mädchen auf.
»Gehe jetzt,« sagte sie, »und sei morgen abend wieder hier. Ich habe viele Fragen an dich zu stellen.«
»Erst morgen wieder?« fragte der Offizier sehnsüchtig.
»Ja, ich habe einen Besuch zu erwidern. Unsere Gäste waren mir längst zuwider mit ihrer Fröhlichkeit, die mir ins Herz schnitt.«
»Arme Evelyn, was mußt du gelitten haben!« sagte bedauernd O'Naill. »Darf ich dich morgen nicht begleiten? Ich bin dienstfrei.«
»Nein, Horatio, es geht nicht. Doch gute Nacht nun, Geliebter! Gehe nun nach Hause und schlafe wohl! Wir wollen nicht zusammen aus dem Hain kommen, wir könnten gesehen werden.«
Noch eine lange Umarmung, dann trennten sie sich. – – –
Als der junge Offizier den Hain hinter sich hatte und sich außer Gesichtsweite der Geliebten glaubte, nahm er einen schnelleren Gang an. Er durcheilte die Anlagen, gab dem Posten das Losungswort und eilte nach einem Seitenflügel des Hauses, in dem sich seine Wohnung befand.
Er öffnete nicht die Thür, welche in das Wohnzimmer führte, sondern die der Stube, welche von dem Burschen und dem indischen Diener bewohnt wurde. Letzterer stand bei seinem Eintritt auf und verneigte sich mit gekreuzten Armen bis auf die Erde.
Im Quartier war allgemein bekannt, daß dieser Diener kein Wort englisch verstand; einmal hatte es der Offizier selbst gesagt, und dann gab er auch auf alle in englisch gestellten Fragen keine Antwort, sondern hörte nur, wenn auf indisch zu ihm gesprochen wurde.
Sonderbar war es nun, daß dieser Indier seinen Herrn in ganz geläufigem Englisch anredete.
»Wie hat Euer Hochwohlgeboren die Schäferstunde gefallen? Guten Erfolg gehabt, Euer Hochwohlgeboren?«
Der Ton war ganz eigentümlich spöttisch.
»Zum Teufel,« sagte der Offizier und zog den Rock aus, »das hat mich angegriffen. Ist der Kapitän noch wach?«
»Er schläft schon und wiegt sich in süßen Träumen.«
»Der Glückliche. Ich muß drücken und lecken und schlecken, und der richtige liegt im Bett und träumt von seiner Braut.«
»Haben Sie die Abdrücke?« fragte der Inder wieder.
»Natürlich,« antwortete sein Herr, der vor dem Spiegel stand und da hantierte.
»Ein Blinder hätte sie machen können. Das Mädchen ist so verliebt und dumm, daß die Gänse es beißen.«
»Hahaha,« lachte der Hindu, »ich hätte Sie nur sehen mögen, wie Sie das Mädchen bearbeitet haben. Wie in aller Welt haben Sie das nur angefangen, die Abdrücke zu bekommen? Gab sie Ihnen die Schlüssel freiwillig?«
»Sie sind wohl ein bißchen verrückt,« sagte der Mann am Spiegel. »Bei der ersten Umarmung nahm ich ihr den Schlüsselbund aus der Tasche und dann, während wir uns umschluugen hielten, drückte ich hinter ihrem Rücken einen Schlüssel nach dem anderen ins Wachs, zum Abschied nahm ich sie noch einmal an meine Brust, überzeugte mich, daß kein Wachs an den Schlüsseln klebte und steckte sie wieder an ihren alten Platz.«
»Hat's nicht dabei geklirrt?«
»Denken Sie etwa, ein Schlüsselbund klirrt in meiner Hand? Außerdem war das Mädchen so aufgeregt, daß es das Brüllen einer Kuh für das Flöten einer Nachtigall gehalten hätte.«
Der Mann vor dem Spiegel drehte sich um, und vor dem Hindu stand – Nikolas Sharp, der Detektiv.
Jetzt holte er unter dem Bett einen Koffer hervor, öffnete ihn und entnahm demselben einen kleinen Schraubstock, Feilen und einen Bund roher Schlüssel.
»So, jetzt kann es an die Arbeit gehen, ich muß die ganze Nacht schlossern. Werfen Sie mir einmal dort den Lappen her, Williams, ich will den Schraubstock abwischen.«
»Es ist ein Battisttuch vom Kapitän.«
»Das ist meinem Schraubstock ganz egal, wenn es nur das Fett wegnimmt, außerdem benutze ich nur die eine Seite.«
Der Detektiv streifte die Hemdsärmel hoch und begann zu feilen, wobei ihm der Hindu oder vielmehr der verkleidete Williams zusah. Er war außer sich vor Erstaunen, mit welch zauberhafter Schnelligkeit sich ein Schlüssel nach dem anderen unter den kunstfertigen Händen des Detektivs formte, bis er in einen Wachsabdruck paßte.
»Anstatt mir mit offenem Munde zuzuschauen, erzählen Sie mir lieber die Geschichte vom Oberst Walton,« sagte der Detektiv, »aber so knapp wie möglich, damit ich endlich einmal klar darin sehe. Hendricks hat sie mir schon einmal erzählt, als ich mich ihm als ungarischer Fürst vorstellte, aber er kam immer wieder auf des Obersten Pferde zu sprechen. Also ganz kurz, daß sich meine Gedanken dabei nicht verwirren, ohne Umschweife.«
»Nun,« lächelte Williams, »passen Sie auf, es ging folgendermaßen zu: Walton liebte, heiratete sie, Kind, sie starb, Kind weg.«
»Hm,« brummte der Detektiv, »Pferde kommen darin zwar nicht vor, aber etwas ausführlicher können Sie doch erzählen.«
»Walton ist ein Engländer und kam als Leutnant nach Indien,« begann jetzt Williams ernsthaft, »als Kapitän faßte er Neigung zu einer Inderin und –«
»Halt,« unterbrach ihn der Detektiv, »wo war das?« – »Hier in Sabbulpore.« – »Weiter!« – »Und heiratete sie.« – »Legitime Ehe?«
»Ja, aber nicht in England bekannt gemacht; ich glaube nicht einmal, daß seine Nichte Rosa etwas davon weiß, denn er spricht niemals darüber. Kurz, ehe der große Aufstand losbrach, ließ Walton sein einziges Kind, Lucille, unter Bedeckung nach einer Hafenstadt bringen und wollte die damals etwas kränkliche Mutter später nachschicken. Aber weder von Lucille, noch von den englischen Soldaten, welche das Mädchen begleiten sollten, hat man je wieder etwas gehört – sie haben ihr Ziel nicht erreicht, sind verschollen. Als die Mutter dies erfuhr, starb sie.«
»Hm, wie lange ist das her?« – »Fünf Jahre.« – »Wie alt war damals Lucille?« – »Zehn Jahr.« – »Hm, hm.«
Der Detektiv feilte unablässig weiter.
»Was denken Sie davon, Sir Williams?«
»Ich denke überhaupt nie etwas.«
»Ist auch das Gescheiteste, was Sie thun können. Denken greift nur die Gesundheit an. Aber ich meine, ob Sie wissen, wer Anlaß zu dem Raube Lucilles gegeben hat.«
»Ich habe keine Ahnung.«
»Zum Teufel, seien Sie nicht so schwerfällig,« rief der Detektiv, »wozu find Sie denn hier?«
»Um diejenigen zu beobachten, welche hier aus- und eingehen und so nebenbei zu horchen, wie über den Rajah gesprochen wird.«
»Da haben wir's ja, Sie spionieren das aus, was ich schon lange weiß.«
»Das glaube ich denn doch nicht.«
»Nicht? Wissen Sie, wer die Frau des Obersten war?« – »Eine Inderin weiblichen Geschlechts.«
»Diejenige, welche der Rajah liebte.«
»Ah,« rief Williams, dem ein Licht aufging.
»Ja, ach, nun fallen Sie in Verzückungen. Ich weiß noch viel mehr, als das, aber mit solchen Kleinigkeiten gebe ich mich nicht ab.«
»Sie spekulieren auf Evelyn, Ihre Geliebte?«
»Ja, sie giebt den Schlüssel zu diesem und noch vielem anderen, ich werde meiner neuen Braut nächstens den Hals umdrehen.«
»Das arme Mädchen,« seufzte Williams. »In der Haut des Kapitäns möchte ich jetzt auch nicht stecken. Die Evelyn wird nun auch Ansprüche auf ihn machen und seine Braut in Bombay, wenn sie etwas davon erfährt, ihm die Augen auskratzen.«
Der Detektiv zuckte geringschätzig die Achseln.
»Er wird als vorsichtiger Mann sie jedenfalls benachrichtigt haben. Jedenfalls lasse ich mir dieses Rendezvous ordentlich bezahlen, jeder Kuß von mir kostet fünf Dollar, 49 hat sie bekommen, macht zusammen 245 Dollar.«
»Apropos,« fuhr der Detektiv fort, »wie gefällt Ihnen die Ordonnanz des Obersten?«
»Scheint ein anstelliger, braver Bursche zu sein.«
»Am bravsten aber wird er sein, wenn er an einem Stricke hängt,« ergänzte der Detektiv. »Kommt Ihnen das Gesicht nicht bekannt vor?«
»Ich habe noch nicht die Ehre gehabt, mit ihm vordem zu sprechen.«
»Williams, Sie sind doch ein recht blinder Maulwurf. Wollen wir wetten, daß Sie ihn schon in Bombay gesehen haben?«
»Ich schulde Ihnen sowieso noch hundert Pfund. Aber so sprechen Sie doch, wer ist es denn?«
»Kein anderer als jener Fakir, der uns im Tempelgarten von Bombay anbetteln und etwas von unserem Gespräch aufschnappen wollte.«
»Diese Behauptung ist etwas gewagt; denn soviel ich mich noch erinnern kann, waren jenem Fakir die Fingernägel durch die Handballen gewachsen, während dieser Kerl den ganzen Tag Cigaretten dreht. Doch mag sein, ich traue Ihrer Spürnase.«
»Außerdem ist er der, aber nur zu Ihnen gesagt, der vor acht Tagen den Major, oder wie er hieß, getötet hat.«
»Majuba? Mensch, und diese Vermutung, die sehr nahe liegt, wenn es jener Fakir ist, sagen Sie erst jetzt? Tagelang werden schon Untersuchungen gepflogen, jetzt noch ist alles in Aufregung über den Mord.«
Der Detektiv zuckte wieder die Achseln.
»Das ist eben das dumme, daß immer gleich soviel Geschrei gemacht wird. Der Major wird doch nicht wieder lebendig davon. Aber laßt die Ordonnanz einen neuen Mordversuch machen und dabei erwischen, dann hat man ihn fest und braucht keine Zeugen erst aufzubringen. Wenn Sie mich dafür bezahlen, entlarve ich ihn noch heute abend.«
»Wieviel wollen Sie dafür haben?«
»Tausend Dollar nur, weil es ein Schwarzer ist.«
»Nein,« lachte der verkleidete Hindu, »für das Geld lasse ich mir lieber von Ihnen 200 Küsse geben.«
»Die werden bei Schwarzen wieder teurer,« meinte der Detektiv trocken, mit unermüdlichem Fleiße hämmernd, feilend und messend. »So, das ist der zweite! Noch drei, und ich bin fertig. Die Dingerchen sind verflucht kompliziert gearbeitet.«
»Was gedenken Sie mit den Schlüsseln anzufangen?« fragte Charles.
»Ich statte meiner Braut einen Besuch in ihrem Schlafzimmer ab, wo ihr Schreibsekretär steht.«
»Und wieviel nehmen Sie dafür?« Charles amüsierte sich über den Detektiven, der nichts unentgeltlich that.
»Ich mache es billig, weil sie nicht darin ist.«
»Na, dann gute Nacht, Sharp, ich gehe schlafen. Ich glaube, wir beide passen gut zusammen.«
»Gute Nacht, Sir Williams, wollte sagen, Romal, färben Sie nicht das Bett.«
Durch die Dschungeln bewegte sich ein langer Zug von Reitern und Reiterinnen der offenen Grasfläche zu, voraus eine Anzahl Hindus, welche da, wo schnell aufgeschossenes Rohr den Weg sperrte und beschwerlich machte, dieses mit einem krummen, schwertähnlichen Messer abhieben.
Man wußte nicht recht, welche Art von Jagd die Gesellschaft eigentlich betreiben wollte; denn zu einer Tigerjagd fehlten die Elefanten, ohne welche dieses Raubtier höchstens von einzelnen Schützen auf dem Anstand geschossen wird, und zur Treibjagd fehlten jene Unmenge von Eingeborenen mit Spektakelinstrumenten, wie sie dazu verwendet werden.
Wartete man aber bis zum Schlusse des Zuges, so erblickte man zwei vergitterte Karren, in denen je ein katzenähnliches Raubtier mit einer Kappe über den Kopf gefangen gehalten wurde. Es galt also eine Jagd auf Antilopen mit Geparden.
Der Gepard ist ein Mittelding zwischen Hund und Katze, man kann ihn sowohl zu der einen, wie zu der anderen Klasse zählen. Der Kopf und die Zähne sind die des Hundes, die spitzen Ohren wiederum die der Katze, ebenso wie die Tatzen, deren Nägel aber nicht so beweglich sind. In der Gestalt ähnelt er völlig dem Wolf, sie besitzt aber auch die Geschmeidigkeit eines Jaguars. Ferner hat der Gepard noch zwei Eigenschaften, von denen die eine der Katze, die andere dem Hunde gehört: er ist ein leidenschaftliches Jagdtier und läßt sich dennoch zur Jagd im Dienste der Menschen abrichten.
Der in der Tierdressur sehr bewanderte Indier – man denke nur an die Elefanten- und Schlangenbändiger – haben sich diese Eigenschaft zu nutze gemacht und ihn zum Jagdtier abgerichtet, aber nicht wie den Hund, welcher das Wild nur aufstöbert, sondern er muß das flüchtige Wild, welches dem Jäger nur selten zu Schuß kommt, selbst fangen und dann abliefern. Wie seltsam sich der Gepard bei dieser Jagd benimmt, auf welch eigentümliche Art er das Wild fängt, soll nachfolgend geschildert werden.
Auch Ellen hatte viel von diesen Jagden mit Geparden gehört, und gern war sie daher der Einladung des Rajah Skindia gefolgt, einer solchen beizuwohnen. Allerdings ist man hierbei mehr Zuschauer als Jäger. Trotzdem waren natürlich alle, auch die Damen, mit Büchsen bewaffnet, war man doch in keinem Orte Indiens, nicht einmal in den kleineren Städten vor Angriffen von Tigern sicher, obgleich gerade hier selten noch ein solches Raubtier, der König der Dschungeln, gesehen wurde. Die englischen Offiziere von Sabbulpore hatten ihm die Herrschaft zu sehr streitig gemacht.
Die Gesellschaft, unter der Leitung des Rajahs, bestand aus den Herren des ›Amor‹ und den Damen der ›Vesta‹; außerdem hatten sich ihnen noch die meisten Offiziere des Forts, englische, wie eingeborene angeschlossen, ebenso Miß Rosa. Die letztere war recht niedergeschlagen, und wer etwas davon wußte, erklärte es sich damit, daß Leutnant Werden durch Dienst in der Festung gehalten wurde.
Jetzt erreichte der Zug die offene Wiesenfläche. Man darf bei einer solchen nicht an die in Europa denken; in Indien wächst das Gras bis zur Höhe eines Mannes und darüber, je nachdem der Boden dazu geeignet ist. Hier war es nur etwa einen halben Meter hoch, eben recht geeignet, die Jagd mit den Geparden beobachten zu können.
Es dauerte nicht lange, so meldeten die vorausgeschickten, der Jagd kundigen Hindus, daß ein Rudel Antilopen zu sehen wäre. Nach einigen Minuten hielt der Rajah an einem Ort, welcher dazu geeignet war, die Jagd zu beobachten, ohne selbst von den Antilopen bemerkt zu werden. Dieses flüchtige Wild ist überdies nicht so sehr scheu, solange es zwischen sich und dem Jäger eine sichere Entfernung weiß; erblickt es aber einen Menschen in der Nähe, welche einen Schuß erlaubt – es kennt die Schußweite sehr genau – so flieht es mit unglaublicher Schnelle so weit, bis der gehörige Abstand wiederhergestellt ist.
Die mit der Dressur der Geparden beschäftigt gewesenen Wärter zogen die Tiere am Halsband aus den Bambuskästen, richteten ihre Köpfe so, daß sie die Antilopen erblicken mußten und nahmen dann gleichzeitig die Kappen vom Kopf.

»Geben Sie acht, wie diese Tiere sich benehmen,« rief der Oberst.
Kaum war die Kappe gefallen, so schien sich die gedrungene Gestalt der Geparden zu verändern. Ihr Leib streckte sich, der Hals wurde vorgereckt, und die rotunterlaufenen Augen waren nur auf die Antilopen gerichtet – sie bemerkten die Umstehenden gar nicht, welche anfangs scheu vor den großen Raubtieren zurückgewichen waren.
Dann duckten diese sich plötzlich, wie auf Kommando gleichzeitig, bis ihr Bauch den Boden berührte, krochen nach links und nach rechts, und nicht etwa auf das Rudel zu. Im nächsten Augenblick waren sie den Blicken der Gesellschaft entschwunden; nicht ein zitternder Grashalm bezeichnete den Weg, den sie genommen.
»Das sieht aus, als wollten sie sich aus dem Staube machen,« meinte Hendricks, »lieber wäre es mir, wenn ich auf meinem Pferde hinter den Tieren herjagen könnte.«
»Es wäre eine vergebliche Mühe,« erklärte der Oberst, »kein Pferd, überhaupt kein anderes Tier kann sie einholen.«
»Mir gefällt diese Jagdweise nicht,« sagte auch Ellen, »sie kommt mir wie ein Ueberfall von gedungenen Räubern vor. Wie fallen denn nun die Geparden über ihre Opfer her?«
»Sie schleichen sich von beiden Seiten an das Rudel heran und springen entweder gleichzeitig auf zwei Tiere oder treiben sie sich einander zu. Die Dressur ist eine sehr schwierige, und der Besitzer solcher Tiere ist sehr stolz auf sie.«
Jetzt konnte man sehen, wie zwei gelbe Körper durch die Luft sausten und das Rudel auseinanderstob. Die Gesellschaft bestieg die Pferde und ritt nach dem Platze, wo die beiden Geparden ruhig auf den gefällten Antilopen lagen und die Ankunft der Wärter erwarteten.
»Es ist schade,« sagte der Oberst zu Ellen, »daß Sie nicht sehen konnten, wie die Geparden die Tiere eigentlich töten. Sie springen nämlich auf die Beute, werfen sie durch die Wucht ihres schweren Körpers zu Boden und beißen sie nicht, sondern schlagen sie tot. Sie trommeln mit ihren Vorderläufen so lange auf den Kopf des Tieres, bis dieses kein Lebenszeichen mehr von sich giebt, dann erst beißen sie ihm die Schlagader durch.«
»Ist die Jagd schon zu Ende?« fragten einige der Damen mißmutig.
»Diese eben gesehene Szene kann natürlich beliebig oft wiederholt werden, die Geparden verstehen es, sich immer wieder an das Rudel heranzuschleichen.«
»Ich habe an dem einen Mal vollständig genug, ich bin kein Freund vom Zusehen. Wenn uns der Rajah nichts anderes bieten kann, dann danke ich für das Vergnügen,« sägte Ellen entschieden. »Wer von den Damen schließt sich mir an, um allein weiterzujagen?«
Alle waren dazu bereit, ebenso die Herren, und der Rajah befahl den Hindus, welche zum Treiben genügten, das umliegende Buschwerk abzusuchen und das aufgescheuchte Wild der Gesellschaft zuzutreiben. Man stieg von den Pferden und begab sich langsam nach einem mit dichtem Unterholz bewachsenen Platz, wo sich, der Versicherung der Eingeborenen nach, Wildschweine aufhalten sollten.
Ein Wald in Indien ist aber kein europäischer, wo man gemächlich zwischen den Bäumen spazieren gehen kann, sondern umgestürzte Baumstämme, mächtige Wurzeln und ein Gewebe von undurchdringlichen Schlingpflanzen hindern oft den Pfad und nötigen zu weiten Umwegen. Es dauerte nicht lange, so hatte sich die Gesellschaft auseinander gezogen, die Treiber waren schon vorausgeschickt worden, um einen möglichst großen Teil des Waldes zu umgehen, während sich die Herren und Damen mehr an dem Waldsaum hielten, damit sie etwa herausgetriebenes Wild, welches der offenen Wiesenfläche zufloh, zum Schuß bekommen konnten.
Am weitesten voraus waren der Oberst und der Rajah, die sich weniger um die Jagd zu kümmern schienen, als sich vielmehr in ein eifriges Gespräch vertieften. Dann kamen die unzertrennlichen Freundinnen, Ellen, Johanna und Jessy, in der Begleitung von Lord Harrlington und Abudahm, welcher sich der kleinen Gruppe angeschlossen hatte. Auch Hannibal war seinem Herrn gefolgt.
Der junge Indier hatte heute nicht die Kleidung eines reichen Eingeborenen an, sondern war, wie die anderen Herren, in einen Jagdanzug gekleidet. So machte er vollkommen den Eindruck eines Europäers, seine Unterhaltung, seine höflichen Manieren, nichts verriet an ihm, daß er kein Franzose – denn so sah er aus – sondern ein Indier war. Er suchte sich den Damen möglichst angenehm zu machen, erklärte ihnen die Eigentümlichkeiten der Landschaft und hielt sich, zum geheimen Aerger Harrlingtons, stets an der Seite Ellens.
Da teilten sich die Büsche, und das dumme Gesicht jenes englischen Burschen, den O'Naill mitgebracht hatte, ward sichtbar.
»Ist mein Herr hier?« fragte er.
»Wie du siehst, nein!« fuhr ihn der Indier grob an. »Packe dich weg!«
»Bleibe nur hier!« sagte aber Harrlington freundlich zu dem Burschen. »Wer weiß, wo der Kapitän ist, du bist waffenlos, und es ist riskant, ihn hier im Walde aufzusuchen.«
Der Indier warf dem Sprecher einen spöttischen Blick zu und erzählte Ellen eine Geschichte, wie er einst einen Kampf mit einem Jaguar bestanden, dem er nur mit dem Dolch zu Leibe gegangen wäre.
»Mir kommt es vor, als gleiche unsere Jagd mehr einem Spaziergang,« meinte Ellen nach Schluß seiner Erzählung, die Horatios Diener mit einem sonderbaren »Hm, hm,« begleitet hatte. »Ich habe mir eine Jagd in den indischen Wäldern viel interessanter vorgestellt.«
»Sie kann auch manchmal interessant genug werden,« sagte Harrlington, »wenn ich auch noch nicht wie Kapitän Abudahm einen Jaguar mit dem Messer gejagt habe, so habe ich doch schon manches Abenteuer mit Raubtieren bestanden.«
»Dort liegt eins,« rief plötzlich Jeremy, Horatios Diener, und deutete nach einem Buschwerk.
In der That sah man in demselben einen dunklen Körper liegen.
»Er scheint tot zu sein,« meinte Abudahm, »es regt sich nicht. Wir wollen es näher untersuchen.«
Sie näherten sich vorsichtig dem Busch und fanden in demselben ein verendetes Wildschwein liegen, vollständig zerrissen, aber das rauchende Blut quoll noch aus den schrecklichen Wunden hervor.
»Ein Tiger,« sagte Harrlington und wies auf den Abdruck einer Tatze in einem lehmigen Teil des Bodens. »Er muß eben erst seine Beute verlassen haben und kann sich noch nicht weit von hier entfernt haben.«
»Wir können die Verfolgung nicht aufnehmen, wir haben weder Hunde, noch Treiber mit, aber morgen kehren wir zurück und nehmen genügend Lente mit,« meinte Abudahm.
»O, warum nicht heute?« rief Ellen. »Diese Gelegenheit, einen Tiger zu jagen, lasse ich mir nicht entgehen.«
»Wie wollen Sie aber ohne Hunde der Spur folgen?« fragte Jessy.
Harrüngton deutete auf Hannibal. Dieser hatte sich auf die Erde gelegt und betrachtete genau den Abdruck der Tatze, dann stand er auf und untersuchte ebenso sorgfältig die Umgegend.
»Es ist kein Tiger,« sagte er dann.
»Was denn?«
»Eine Tigerin, und zwar eine säugende. Sehen Sie hier die kleinen Punkte im Boden, die haben die Tatzen eingedrückt.«
»Um so schlimmer,« sagte wieder Abudahm, »eine Jagd auf eine Tigerin mit Jungen ist sehr gefährlich, das angegriffene Tier ist furchtbar.«
»Hier ist mein Taschenmesser, wenn Sie keins bei sich haben, Herr Abudahm.«
Damit klappte Jeremy sein Messer auf und bot es dem Indier an, der den dreisten Burschen gar nicht beachtete.
»Ich warte nicht,« entgegnete die eigensinnige Ellen. »Diese Gelegenheit ist zu günstig, als daß ich sie mir entgehen ließe. Kommen Sie mit Jessy, und Jane?«
Die Damen willigten sofort ein, während Harrlington und besonders Abudahm dringend abrieten, ohne Hunde das Tier aufzusuchen, da man nie wissen könne, wo es sich versteckt hielt.
»So gehen wir allein! Wir werden es auch ohne Hunde zu finden wissen und mit ihm fertig werden.«
Da gaben die Herren nach und setzten ihre Büchsen in Bereitschaft. Es war allerdings verlockend, wie die übrigen Herren und Damen staunen würden, daß die kleine Gesellschaft statt eines Wildschweines einen Tiger erlegt habe.
Wie ein Jagdhund nahm Hannibal die Fährte auf, jeder Grashalm, den die Tigerin nur gestreift hatte, verriet ihm, wohin sie sich gewendet habe. Immer weiter drang der Schwarze in den Wald, hinter ihm Harrlington und Ellen, die beiden anderen Damen, Abudahm und Jeremy.
Jetzt fing der Waldboden zu steigen an, bis man an eine Blöße kam, wo er sich wieder jäh senkte, dadurch eine kleine Schlucht bildend.
»Wenn sich der Tiger irgendwo versteckt hält,« flüsterte Abudahm, »so ist er hier. Wir können nicht weiter vordringen; in diesem Loche ist man keinen Augenblick vor einem Ueberfall sicher.«
Hannibal war stehen geblieben und schaute fragend auf Harrlington, dieser wieder auf Ellen.
»Wollen wir etwa hier stehen bleiben?« fragte diese. »Weiter, Hannibal, zeige uns den Weg!«
»Hannibal geht auch nicht weiter, es hat keinen Zweck, denn in dieser Schlucht steckt er sicher. Miß Petersen kennt diese Jagd nicht. Hannibal aber kennt sie und will einen Tiger nicht mit den Händen fangen.«
Er drehte sich um und trat hinter die Jäger zu Jeremy, der sich eben wieder eine frische Pfeife stopfte.
»Wollen Sie die Jagd nicht aufgeben, Miß Petersen?« fragte Harrlington noch einmal.
»Nein, im Gegenteil. So nahe am Ziele lasse ich mir die Beute nicht entschlüpfen. Vorwärts, Jessy, Miß Lind! Jetzt stöbern wir jeden Busch durch und suchen hinter jedem Felsblock. Wer ihn zuerst sieht, benachrichtigt durch einen Ruf die anderen und wartet, bis sie bei ihm sind. Und dann immer einzeln schießen!«
Schweigend ging Lord Harrlington mit gespannter Büchse neben Ellen her, fest entschlossen, nicht von ihrer Seite zu weichen.
Aber wie sie auch jeden Platz und jede Felsenhöhle untersuchten, wo der Tiger ein Versteck hätte finden können, von dem Tiere war keine Spur zu sehen.
»Es wird zu seinen Jungen zurückgekehrt sein,« sagte Ellen.
Abudahm schüttelte den Kopf.
»Ein Tiger zieht sich, wenn er sich verfolgt weiß, nicht direkt nach seinem eigentlichen Lager zurück, weil er dadurch die Jungen in Gefahr bringen würde, sondern er sucht sich irgendwo anders zu verstecken, von wo aus er über den Platz wachen kann.«
Schon näherten sie sich dem jenseitigen Ausgang der Schlucht, als Johanna plötzlich ausrief:
»Dort in dem Busche liegt etwas Gelbes, das ist er!«
Man sah, nur etwa zwanzig Meter entfernt, in einem dichten Gebüsch, ein buntes Fell schimmern. Gefunden war der Tiger.
Kaum war der Ruf Johannas verschollen, so knallte ein Schuß, und in weiten Sprüngen sah man den Tiger dem Ausgange der Flucht zufliehen.
Tadelnd blickte Ellen auf Abudahm, der den voreiligen Schuß abgefeuert hatte.
»Nun können wir noch einmal die Verfolgung aufnehmen, wenn sich uns überhaupt wieder eine so günstige Gelegenheit bietet. Besser als jetzt hätten wir es nicht treffen können.«
Als sie sich dem Busche näherten, bemerkten sie Blutspuren am Boden, die aber bald wieder aufhörten. Am Gebüsch selbst war eine kleine Blutlache, dann wurden die roten Tropfen immer seltener, bis sie endlich ganz verschwanden.
»Ich habe ihn getroffen,« jubelte der Inder.
»Aber nicht tödlich,« entgegnete Harrlington, »sonst würde der Tiger weiter geblutet haben.«
»Weiter,« rief Ellen, »ich will den Burschen noch heute vor meinen Füßen liegen haben!«
Kaum waren sie einige Schritte vorgedrungen, als in einiger Entfernung ein Knacken des Buschwerkes hörbar ward. Man vernahm, wie die Aeste bei Seite gebogen wurden und zurückschnellten, als dränge sich ein Körper hastig durch.
»Wer ist das?« rief Ellen. »Das ist doch nicht der Tiger.«
Da wurde schon über dem niedrigen Gestrüpp der Kopf eines Mannes sichtbar, bedeckt mit der Mütze eines englischen Soldaten. Der Betreffende schien große Eile zu haben, denn er strebte unaufhaltsam vorwärts, hatte aber die kleine Gesellschaft noch nicht gesehen.
»Leutnant Werden,« rief Ellen, die den Ankommenden zuerst erkannte. »Bleiben Sie zurück, um Gottes willen!«
Jetzt erblickte der Leutnant, der in Uniform war, die Jäger.
»Ich hörte einen Schuß fallen und ging der Richtung nach. Ist der Oberst bei Ihnen? Ich muß ihn sofort –«
Er kam nicht weiter.
Plötzlich sauste in großem Bogen ein gelber Gegenstand durch die Luft, ein Schmerzensschrei ertönte, begleitet von dem Schreckensruf der Jäger – und die Gestalt des jungen Leutnants war zwischen den Büschen verschwunden. Der Tiger war auf den Unglücklichen gesprungen und hatte ihn zu Boden geworfen.

Ohne sich zu besinnen, eilte Ellen als erste der Stelle zu, wo der Tiger sein Opfer niedergestreckt haben mußte, gefolgt von Harrlington, dem sich die übrigen anschlossen. Unter dem nächsten Busch konnten sie die Szene überschauen.
Da lag der junge Mann am Boden, und auf ihm stand, die funkelnden Augen grimmig auf die neuen Ankömmlinge gerichtet, den Rachen halb geöffnet, die eine Vordertatze etwas erhoben, der Tiger und stieß ein dumpfes Knurren aus.
Einen solchen Anblick kann man nicht beschreiben, er spottet der Feder; höchstens der Pinsel eines Malers könnte ihn wiedergeben.
Unter dem Banne des Blickes blieben die Personen wie erstarrt stehen, unfähig den Schrecken zu meistern, der sich ihrer bemächtigt hatte.
»Achtung! Der Tiger springt,« schrie Harrlington entsetzt.
Es war alles so schnell vor sich gegangen, daß keiner der Zuschauer dieses blutigen Vorgangs Zeit gefunden, auch nur die Büchse an die Wange zu legen. Kaum hatten sie den Tiger einen Moment in der ersten Stellung erblickt, so lag er schon wieder geduckt am Boden, zum zweiten Sprunge bereit.
Eben wollte er sich emporschnellen, der nächsten Person zu, Miß Ellen, als aus deren Büchse ein Donner hallte. Ein kurzes, abgerissenes Brüllen erschütterte die Luft. Der Tiger streckte sich und rollte über den Körper des Leutnants hinweg – er war tot.
Jetzt eilten die Jäger nach dem bewußtlos am Boden liegenden Offizier, dessen Kleidung über und über mit Blut bedeckt war. Abudahm war der erste, der sich, während die anderen noch ganz erschüttert dastanden, mit dem Verwundeten, oder vielleicht auch Toten beschäftigte. Er kniete nieder, beugte sich über den Regungslosen und knöpfte ihm den engen Waffenrock auf.
Plötzlich nahmen Abudahms Augen einen merkwürdigen Ausdruck an, er warf einen Blick auf die sich ihm eben Nähernden, beugte sich dann weit nach vorn über, als wollte er die Wunde besichtigen und richtete sich wieder auf.
»Tot,« murmelte er verstört, als wisse er nicht, was er eben sagte.
»Unsinn« rief Harrlington und riß das Jagdmesser aus der Scheide. »Ueberzeugen Sie sich doch erst von der Art der Verletzung!«
Ohne weiteres schnitt er dem Leutnant Weste und Hemd auf, wischte mit seinem Taschentuch vorsichtig das Blut ab und betrachtete die Wunden.
»Er lebt,« sagte er freudig, »er atmet noch. Schnell, Abudahm, rufen Sie Ihre Leute zusammen, daß sie den Ohnmächtigen nach dem Fort tragen.«
Der Indier entfernte sich eiligst, als wolle er möglichst schnell diesen Ort verlassen.
»Gott sei Dank!« sagte Ellen. »So ist Aussicht vorhanden, daß er am Leben bleibt! Sind seine Wunden schlimm?«
»Ja,« entgegnete Harrlington, »die Schulter ist furchtbar zerfleischt, weniger die Brust, sonst würde er nicht mehr leben. Geben Sie mir Ihre Taschentücher, meine Damen; Hannibal sucht schon Kräuter, er versteht sich auf solche Sachen. Wir wollen ihm wenigstens einen Notverband anlegen, um die Blutung zu stillen, mehr können wir jetzt nicht für ihn thun.
»Was mag den Unglücklichen nur hergeführt haben?«
Alle beschäftigten sich mit dem noch Bewußtlosen, mit Ausnahme von Johanna und Jeremy, zwischen denen nach dem Weggang des Inders eine stumme Verständigung erfolgt war.
Kaum hatte sich Abudahm aus der knieenden Stellung erhoben, so begegneten sich beider Augen zu gleicher Zeit, und verständnisvoll blickten sie sich einen Moment an. Johanna verwundert, Jeremy pfiffig, und als des Inders Gestalt hinter den Büschen verschwunden war, da kroch auch mit einem Male Horatios Diener mit der Geschmeidigkeit einer Schlange in das Buschwerk und hatte sich sofort den Blicken Johannas entzogen, die sich jetzt ebenfalls dem Verwundeten zuwendete.
Nach kurzer Zeit kam die ganze Jagdgesellschaft an dem Ort zusammen, geführt von Abudahm. Die Eingeborenen flochten schnell aus Aesten und Zweigen eine Trage, um auf dieser den bewegungslosen Körper des jungen Offiziers nach dem Fort tragen zu können.
In der engen Schlucht, welche zu beiden Seiten von jäh emporsteigenden Felsen eingeschlossen wurde, standen die Herren und Damen umher und ließen sich von denen, welche der Szene beigewohnt hatten, diese erzählen. Auch Abudahm und der Rajah unterhielten sich von den übrigen etwas entfernt, während der Oberst, seine Nichte und Kapitän O'Naill von dem jungen Offizier sprachen.
»Was mag nur den jungen Leutnant Werden dazu bewogen haben, sich hierherzubegeben?« fragte der Oberst den Kapitän, »und noch dazu im Dienstanzug? Sein Pferd ist vor dem Eingang der Schlucht gefunden worden.«
Horatio schüttelte bedenklich den Kopf.
»Jedenfalls wollte er Ihnen eine Bestellung machen, Lord Harrlington. Haben Sie nicht ein Schreiben bei dem Verwundeten gefunden?«
»Diese da, welche neben ihm liegen,« entgegnete Harrlington, der das Anfertigen der Tragen beaufsichtigte.
Die beiden Offiziere suchten unter den Papieren, aber es waren nur solche, welche dem Leutnant selbst gehörten.
»Merkwürdig,« murmelten beide, »dann war's ein mündlicher Auftrag.«
»Oberst,« flüsterte da eine Stimme neben Walton, »geben Sie acht auf Abudahm; er hat dem Leutnant etwas aus der Tasche genommen.«
Erstaunt blickte sich der Oberst um und sah hinter sich Johanna stehen.
»Wissen Sie das genau, Fräulein, haben Sie es gesehen?«
»Ich sah nur, daß er sich so über den Verwundeten beugte, als wolle er uns seine Handbewegungen verbergen. Er hat irgend etwas gethan, was er uns nicht wissen lassen wollte.«
»Hölle und Teufel!« knirschte der Oberst. »Wo ist der Schuft, daß ich ihn züchtigen kann.«
Er blickte sich vergebens um; weder der Rajah, noch Abudahm waren in der Schlucht zu sehen, sie mußten dieselbe unbemerkt verlassen haben.
»Was bedeutet das?« schrie der Oberst.
»Das bedeutet,« ließ sich da die tiefe Stimme des Rajah, hoch oben vom Felsen vernehmen, »daß du, Oberst Walton, und deine Gefährten meine Gefangenen sind. Die Festung Sabbulpore ist in meinen Händen.«
Mehr verwundert, als erschrocken über den Sinn dieser Worte richteten sich aller Augen nach oben. Doch wohin sie auch sahen, von allen Seiten starrten ihnen die Mündungen einer doppelten Reihe von Gewehren entgegen.
Die Gesellschaft war schon vor zwei Stunden zur Jagd aufgebrochen.
Im Arbeitszimmer des Obersten war dessen Ordonnanz damit beschäftigt, die Fenster zu putzen, wobei ihm der eingeborene Diener des Kapitäns O'Naill half.
Die beiden schienen sich nicht eben gut zu verstehen; denn es wurde zwischen ihnen während der Beschäftigung kein Wort gewechselt.
Da jagte plötzlich durch das offene Hofthor des Quartiers ein mit Schaum bedecktes Roß, dessen Reiter von dem Posten nicht aufgehalten wurde; denn er trug die weiße Tropenuniform eines englischen Kavallerieregiments. Das Gesicht des Mannes war mit einer Schichte von Staub bedeckt, welcher an dem Schweiß hängen geblieben war. Jedenfalls hatte er einen weiten Weg mit Aufbietung aller Schnelligkeit seines Pferdes zurückgelegt.
»Oberst Walton da?« rief er, ehe er noch das Tier vor dem Eingang des Hauses pariert hatte, dem herzuspringenden Reitknecht zu.
»Nein, ist fort!«
»Nein? Wo ist er?«
Der Reiter schien es sehr eilig zu haben. Seine Augen hingen an den Lippen des Eingeborenen.

»Weiß nicht, ist heute morgen mit noch vielen anderen zur Jagd geritten.«
Da öffnete sich ein Fensterflügel des Hauses, und Evelyns Stimme sagte:
»Kommen Sie ins Arbeitszimmer des Obersten; er muß jeden Augenblick zurückkommen.«
Der Reiter sprang vom Pferde und betrat das Zimmer des Obersten, dessen Thür ihm Evelyn selbst öffnete.
»Was wollen Sie von ihm?« fragte sie.
»Ich habe einen Brief an den Obersten persönlich abzugeben, Fräulein.«
»Geben Sie ihn mir,« sagte Eveline ruhig und streckte die Hand nach dem versiegelten Schreiben aus, welches der Bote aus der Brusttasche gezogen hatte.
»Kann ich nicht, Fräulein, es ist mir aufgetragen worden, ihn persönlich abzugeben.«
»Ich bin vom Obersten ermächtigt, für ihn die Briefe einstweilen anzunehmen. Wissen Sie, was drinnen steht?«
Der Bote lächelte.
»Das weiß ich natürlich nicht, es ist ein geheimer Eilbrief.«
»So geben Sie ihn mir,« sagte Evelyn wieder, die noch immer die Hand ausgestreckt hielt.
»Ich kann ihn nicht eher aus der Hand geben, als bis diese Quittung mit dem britischen Gouvernementssiegel von Sabbulpore gestempelt worden ist,« meinte der Bote zögernd.
»Sie mißtrauen mir wohl?« fragte Evelyn lächelnd.
»Sehen Sie hier den Beweis, daß ich die Vollmacht dazu habe, Briefe in Empfang zu nehmen.«
Sie zog einen Schlüsselbund aus der Tasche, suchte einen Schlüssel und öffnete den Schreibtisch des Obersten.
»Nimm mir das Fenster ab, Ramel,« fuhr die Ordonnanz ihren Gehilfen an, der ganz ins Träumen gesunken zu sein schien.
Willig griff dieser nach dem hingehaltenen Fensterflügel, um ihn abzuwaschen, aber da flog ihm plötzlich der Schwamm aus den Händen und zum Fenster des Hochparterres hinaus.
»Wohin willst du, Ramel?« fragte die Ordonnanz den Burschen, der nach der Thür ging.
»Ich will meinen Schwamm holen, komme gleich wieder,« sagte Horatios Diener, der der verkleidete Williams war.
Evelyn, welche auf die beiden Diener gar nicht achtete, von denen der eine nicht einmal ein Wort englisch verstand, schloß ein Kästchen auf und entnahm ihm den Stempel von Sabbulpore, welcher nur im Besitze des Obersten war.
»Geben Sie mir die Quittung!«
Die Ordonnanz reichte sie ihr.
Sie drückte den Stempel darunter.
»So – hier haben Sie die Quittung, geben Sie mir jetzt den Brief!«
Ohne jedes Zögern reichte ihr der Bote den Brief; er hatte keine Verantwortung mehr.
Evelyn betrachtete den Brief; er war als Geheimsendung an Oberst Walton adressiert und trug das britische Staatssiegel.
»Wann reiten Sie wieder fort? Heute noch?« fragte sie den Boten.
»Es ist nicht möglich; ich habe die 32 englische Meilen von der nächsten Bahnstation in zwei Stunden gemacht, und mein Pferd ist völlig erschöpft. Vor morgen früh kann ich es nicht mehr benutzen.«
»Ordonnanz,« rief sie dem noch im Zimmer befindlichen Diener zu, »führe diesen Mann in die Bedientenstube und sorge für ihn!«
Der Reiter grüßte militärisch und ging in Begleitung des Burschen hinaus.
Sinnend blickte Evelyn ihm nach.
»Sein Verhängnis will es, daß auch er bald nicht mehr unter den Lebenden sein wird,« murmelte sie. »Doch mag er in den Tod gehen; die Engländer haben das Leben meines Vaters auch nicht geschont.«
Sie betrachtete wieder den Brief, und ein häßliches Lächeln entstellte ihre Züge.
»Es ist ganz gleich, ob ihn Walton empfängt oder nicht, und enthielt das Schreiben auch den für uns schlimmsten Befehl, deckte er auch alles auf, die Sache wird dadurch nicht anders. Oberst Walton wird diese Stube nur als Gefangener betreten, und ich werde von jetzt ab für ihn unterschreiben. Allerdings ein gewagtes Spiel, aber es ist nötig, um die anderen Gouvernements in Sicherheit zu wiegen. Hahaha, ich werde günstige Berichte über die hier herrschende Ruhe abgehen lassen.«
Eben wollte sie das Schreiben erbrechen, als die Thür plötzlich aufgerissen wurde und Leutnant Werden, ein blutjunger, knabenhaft aussehender Mann ins Zimmer stürzte.
»Wo ist der Brief, Miß Valois, den eben der Kavallerist brachte?« rief er atemlos, noch halb im Thürrahmen stehend.
»Wie,« fuhr er fort, mitten im Zimmer plötzlich stehen bleibend, »der Schreibtisch des abwesenden Obersten offen! Wie soll ich mir dies erklären, Miß Valois?«
Evelyn hatte für einen Moment die Fassung verloren; aber sofort war sie wieder gesammelt.
»Was haben Sie hier zu suchen, Leutnant Werden?« fuhr sie ihn in herrischem Tone an. »Ist Ihr Dienst nicht auf der Festung. Warum sind Sie hier im Quartier?«
»Den Brief, den Brief,« drängte dieser. »Kümmern Sie sich nicht um Angelegenheiten, die Sie nichts angehen! Zum letzten Male, geben Sie mir den Brief, oder ...«
Die letzten Worte wurden drohend hervorgestoßen. Evelyn hatte diesem jungen Manne, den sie immer nur halb als Kind betrachtete, ein solches Auftreten nicht zugetraut.
»Oder was?« fragte sie mit finster gerunzelter Stirn.
»Oder ich brauche Gewalt!«
»Leutnant Werden, vergessen Sie nicht, vor wem Sie stehen!«
»Den Brief her! Sie haben keine Befugnis, ein Schreiben für den Obersten in Empfang zu nehmen. Ich weiß, daß er schon lange auf einen Eilbrief wartet.«
»Leutnant Werden, Sie benehmen sich manchmal noch sehr kindlich,« sagte Evelyn völlig ruhig. »Allerdings hat mich der Oberst damit betraut, diesen Brief anzunehmen und ihm denselben nachzuschicken. Ich selbst hätte Sie gebeten, zu mir zu kommen und die Weiterbeförderung desselben zu befehlen. Sie hätten diese Szene vermeiden können, wenn Sie nicht so hitzig gewesen wären. Hier haben Sie den Brief!«
Freundlich lächelnd reichte sie ihm das Schreiben hin.
»Entschuldigen Sie meine Heftigkeit, Miß, ein plötzlicher Gedanke beunruhigte mich,« bat der Offizier. »Der Oberst selbst hat mich beauftragt, wenn ein Bote ins Quartier kommen sollte, denselben zu ihm zu führen. Da die Quittung nun aber bereits gestempelt und der Reiter sehr ermüdet ist, so werde ich ihm das längst ersehnte Schreiben selbst bringen. Nochmals, entschuldigen Sie mein Betragen!«
»Fragen Sie den Obersten auch, ob ich wirklich die Befugnis hatte, den Stempel zu benutzen,« rief Evelyn lachend dem Hinauseilenden nach.
Sie sah durch das Fenster, wie der pflichtgetreue Offizier ein Pferd bestieg und in Karriere aus dem Hof sprengte.
»So oder so, murmelte sie höhnisch, »deinem dir bestimmten Schicksal entkommst du nicht, thörichter Knabe! Fällst du nicht in meine Hände, so fällst du in die des Rajah. Doch wer mag ihn so schnell benachrichtigt haben, daß ich dem Boten den Brief abgenommen? Es muß mich jemand verraten haben; seine Aufregung, als er ins Zimmer stürzte, läßt darauf schließen.«
Evelyn sollte nicht lange auf die Beantwortung dieser Frage warten. –
Sir Charles Williams, der als eingeborener Diener Verkleidete, hatte sich höchlichst gewundert, daß Evelyn in der Abwesenheit des Obersten einen für diesen bestimmten Brief dem Boten durchaus abnehmen wollte, und als sie sogar den Schreibtisch öffnete, schoß ihm ein Gedanke durch den Kopf, an den er bis jetzt noch gar nicht gedacht hatte.
Nick Sharp, der Detektiv, hatte abends sein Liebesspiel mit Evelyn regelmäßig fortgesetzt, und ebenso in der Bedientenstube mit ihm in der gewohnten scherzhaften Art geplaudert. Charles wußte wohl, daß der Detektiv ein Geheimnis Evelyns ergründen wollte, aber nicht welches, darüber sprach sich der schlaue und manchmal sehr grob werdende Detektiv nicht aus. Jedenfalls aber mußte es irgend eine private Sache sein, für die er bezahlt wurde, denn umsonst that Sharp nichts.
Da hatte eines Abends der Detektiv so nebenbei gemeint, er glaube fest, Evelyn halte es mehr mit den Indiern, als mit den Engländern, ja, er habe sogar die Vermutung, das Mädchen führe die Engländer an der Nase herum, suche ihre Geheimnisse zu erforschen, denn auch an ihn, den vermeintlichen Kapitän der Festung, stellte sie manchmal so harmlos verfängliche Fragen. Sharp kümmerte sich nicht darum, denn er war Amerikaner, er gab sich prinzipiell nicht mit Sachen ab, die ihn nichts angingen.
Seinetwegen hätten die Indier ganz Sabbulpore in die Luft sprengen können, er würde ruhig zugesehen und seine Pfeife geraucht haben.
Dies zu verhüten, war Angelegenheit der Offiziere, und so lange diese ihn nicht aufforderten, ihnen zu helfen, verbrenne er seine Finger nicht an fremden Geschäften, wie er oft sagte.
Ganz anders dachte Charles.
Er war Engländer, und zwar mit Leib und Seele, er wäre für sein Vaterland durchs Feuer gegangen, und seit der Detektiv ihm seinen Argwohn mitgeteilt hatte, beobachtete er Evelyns Thun und Treiben aufs genaueste, ohne aber etwas Verdächtiges zu bemerken.
Als er jedoch sah, wie Evelyn den Brief mit dem britischen Siegel dem Boten abnahm und selbst den Schreibtisch des Obersten aufschloß, bestätigte sich seine Vermutung, daß das Mädchen ein doppeltes Spiel trieb, denn nie glaubte er, daß der Oberst dem Mädchen die Schlüssel zum Schreibtisch anvertraut habe, welcher alle geheimen Schriftstücke barg. Nein, Evelyn wollte den Brief lesen, ohne wahrscheinlich den Siegelabdruck zu verletzen, und das so erfahrene Geheimnis zu irgend etwas Schlechtem anwenden. Dem mußte er vorbeugen.
Aber wie? Hätte er als Eingeborener ihr den Brief einfach entrissen, so wäre er im nächsten Augenblick von herbeigerufenen Dienern festgenommen worden; gab er sich als Engländer zu erkennen, so war seine Rolle hier ausgespielt, er konnte nicht mehr auf Ellens Wunsch beobachten, wer im Hause des Obersten aus- und einging, was unter den Eingeborenen in der Festung und auf dem Lande für Gerüchte über den Rajah zirkulierten. Beides ging also nicht.
Er warf absichtlich den Schwamm hinaus und lief aus dem Hause, vorgebend, er wollte das Verlorene wiederholen, thatsächlich aber, um irgend einen Engländer, womöglich einen Offizier zu suchen, der Evelyn am Erbrechen des Briefes hinderte.
Glücklicherweise traf er den jungen Werden, der von der Festung aus den Boten ansprengen gesehen hatte. Er war vom Oberst beauftragt worden, ihm eventuell einen Boten nachzusenden und befand sich jetzt zu diesem Zwecke unterwegs.
Da kam der Diener des Kapitäns O'Naill gerannt.
»Leutnant Werden,« rief der Indier, von dem jener wußte, daß er kein Wort englisch verstand, in dieser Sprache, »schnell in das Arbeitszimmer des Obersten! Evelyn will einen Brief mit dem britischen Siegel erbrechen.«
»Was,« rief der Leutnant erstaunt, »du, Ramel ...?«
»Wundern Sie sich nachher, nur schnell ins Zimmer, das Weib hat den Schreibtisch des Obersten geöffnet!« und Charles schob den Zögernden in die Thür.
Jetzt wurde der Leutnant stutzig und eilte in das Zimmer, wo sich die eben geschilderte Szene abspielte.
Was sollte aber nun Charles beginnen? Er sah sich in einer Klemme, aus der er nicht so leicht wieder herauskommen konnte. Doch langes Besinnen war nicht seine Sache. Mit harmloser Miene, ganz unbefangen, trat er wieder in das Haus zurück.
Da fühlte er sich plötzlich von einem Dutzend Armen gepackt. Vergebens suchte sich Charles seiner Gegner zu erwehren, alle seine Gewandtheit half ihm nichts – nach kurzem Ringen lag er gebunden am Boden und, was das Schlimmste war, einer der Inder hielt den kurzen, falschen Vollbart von Charles in der Hand, seine Verkleidung war verraten, denn unter dem aufgerissenen Hemd konnte man die weiße Haut schimmern sehen.
Die Ordonnanz des Obersten, welche selbst bei der Überwältigung mit thätig gewesen, trat in das Zimmer, in dem Evelyn eben einem Indier einen Brief abnahm.
»Miß Valois,« meldete er, »der Mann, der Sie soeben verraten hat, des Kapitäns Diener, ist gar kein Hindu, sondern ein Engländer, denn er flucht in seiner Sprache.«
»Was,« rief Evelyn erstaunt, »er ist kein Hindu?«
Sie sann einen Augenblick nach, dann sagte sie, während sie den Brief öffnete:
»Haltet ihn einstweilen in sicherem Gewahrsam; ich habe jetzt keine Zeit, ihn zu verhören. Du bürgst mir mit Deinem Leben dafür, daß er vor mir steht, wenn ich ihn rufen lasse.«
Evelyn überflog die ihr gesandten Zeilen. Sie lauteten:
»Alle sind gefangen, mit Ausnahme des Burschen des Kapitäns. Er entfloh, ich schoß nach ihm und sah selbst, wie er in eine Schlucht stürzte. Also ist kein Verrat zu fürchten. Leutnant Werden brachte einen Brief für den Obersten, wurde von einem Tiger angefallen und liegt auf den Tod. Ich fing den Brief noch rechtzeitig auf, ehe der Oberst durch ihn gewarnt wurde; denn er enthielt den Rat, auf der Hut zu sein. Sorge dafür, daß heute Nacht das Fort planmäßig genommen wird!
Abudahm.«
»Abudahm,« flüsterte Evelyn, »er bemüht sich um meine Gunst und immer vergebens. Er wäre es wert, daß ich ihm meine Liebe schenkte. Aber Horatio!« Sie seufzte. »Ich kann sein Schicksal nicht wenden. Man sagt, des Weibes Liebe sei das mächtigste aller Gefühle. Bei mir wird es übertroffen durch die Sucht nach Befriedigung meiner Rache. Ich werde seinen Tod weder verhindern können -noch wollen.«
Finster schritt sie ihren Gemächern zu.
Unterdes wurde der gebundene Charles emporgehoben und in ein vollständig zugemauertes Kellerverließ getragen. Nachdem die schwere Thüre verschlossen worden war, blieb er die erste Zeit wie betäubt liegen, dann aber begann er über seine Lage nachzudenken.
Verrat! Das war sein erster Gedanke!
Die Indier in Sabbulpore hatten einen Aufstand vor, um die Herrschaft der verhaßten Engländer abzuschütteln. Evelyn, das teuflische Weib, stak mit den Indiern unter einer Decke und verriet ihnen die Absichten des Obersten. Er hatte manchmal Mitleid mit dem Mädchen gehabt, wenn der unbarmherzige Detektiv, der gar keine Gefühle besaß, mit der liebenden Evelyn spielte, aber jetzt –

Charles knirschte kochend vor Wut laut mit den Zähnen.
Was sollte nur sein Schicksal sein?
Unwiderruflich der Tod; Charles zweifelte nicht im geringsten daran.
Gut, sie sollten einmal sehen, wie ein rechter Mann sterben könne!
Was aber war inzwischen aus der Jagdgesellschaft geworden?
Was war aus seinen Freunden, was war aus den Damen und vor allen Dingen aus Miß Thomson geworden?
Was war deren Schicksal?
Hölle und Teufel! Charles strengte vergeblich alle seine Kräfte an, um die Hanfstricke zu zerreißen, sie schnitten nur ins Fleisch ein, ohne einen Millimeter nachzugeben.
Die Einsamkeit ließ ihm genügend Zeit, sein vergangenes Leben noch einmal durchzuträumen.
Fast nur heitere Bilder tauchten vor seinen Augen auf. Waren doch einmal Sorgen an ihn getreten, so hatte er sie immer wieder fortzuscherzen gewußt.
Dies war das erste Mal, daß er fast den Mut verlor. Was hatte er sich daraus gemacht, wenn er draußen von einem ganzen Hundert Menschen verfolgt worden wäre. Den Tod fürchtete er nicht, er hatte ihm schon unzählige Male in's Auge gesehen, aber gefangen zu sein, während er wußte, daß andere ihn notwendig brauchten und herbeisehnten, das war zu viel für ihn.
Doch es dauerte nicht lange, so fand Charles selbst in diesem finsteren, dumpfen und nassen Kerker seine gute Laune wieder. Er hätte sich ja vor sich selbst schämen müssen, wenn er mit hängendem Kopfe aus diesem Leben geschieden wäre. Noch lebte er ja, noch atmete er, und noch hatte er Aussicht, befreit zu werden; von wem, wußte er allerdings nicht, aber er hoffte, und Hoffnung läßt nicht zu Schanden werden.
»Wenn sie mich belauschen, dann sollen sie wenigstens denken: das ist ein verfluchter Kerl,« dachte Charles und fing an, Walzermelodien zu pfeifen.
Er wußte nicht, wie lange er so gelegen hatte, als plötzlich draußen ein Kanonenschuß ertönte. Gleich darauf erschallte das Knallen von Flinten; er hörte Schwertgeklirr, Geschrei und gellendes Geheul, den Kriegsruf der Indier.
Charles war sich gar nicht im Unklaren darüber, was dieser kurze, nur einige Minuten währende Kampf bedeutete. Die aufrührerischen Indier hatten die Festung überrumpelt; die führerlosen Engländer, nur eine Handvoll, konnten ihnen natürlich keinen Widerstand leisten. Das alles war ein wohlüberlegter Plan, wahrscheinlich ausgeheckt von dieser Teufelin, der Evelyn. Sie war eine Französin und haßte die Engländer.
Ach, hätte doch Charles mit draußen sein können! Wie hätte er diesen verdammten Indiern auf den Köpfen herumpochen wollen. Seufzend wälzte er sich auf die andere Seite und pfiff die englische Nationalhymne.
Plötzlich horchte er auf, ohne aber das Pfeifen einzustellen: es näherten sich der Zelle Schritte. Die Thür wurde aufgerissen, mehrere Männer mit Laternen traten ein und hoben den an Händen und Füßen Gebundenen auf.
»Jetzt geht's an den Kragen,« dachte Charles. »Na meinetwegen, meinen Gefährten geht es auch nicht anders. Ob ich nun ein paar lumpige Jahre mehr oder weniger lebe, darauf kommt es nicht an; die Weltgeschichte steht deshalb noch nicht still.«
Charles ward aus dem Keller herausgetragen, durch den Korridor – er merkte dabei, daß die Nacht bereits angebrochen war – und dann durch das Arbeitszimmer des Obersten direkt nach den Gemächern Evelyns.
Alles sah in dem Hause so friedlich aus, daß Charles fast daran zu zweifeln begann, daß wirklich ein Aufstand hier stattgefunden habe.
In einem Zimmer – es war ihre Schlafstube – stand Evelyn vor ihrem Sekretär und starrte mit glanzlosen Augen in die geöffneten Fächer. Sie bemerkte gar nicht, wie die Indier den gebundenen Engländer an eine Wand lehnten und sich wieder entfernten.
Im Nu hatte Charles begriffen, um was es sich hier handelte. Evelyn hatte etwas in ihrem Sekretär gesucht, sie hatte ihn aufgeschlossen und fand, daß jemand ihre Papiere, wahrscheinlich für sie sehr wertvolle, entwendet hatte, und dieser jemand war Nick Sharp gewesen, der Detektiv, mit dem sie so manche Nacht als vermeintlichem Horatio gekost, und der nach und nach Abdrücke von ihren Schlüsseln genommen hatte.
Charles gab sich für verloren; die Jagdgesellschaft war jedenfalls vernichtet, die englische Besatzung überrumpelt, und auch ihn erwartete wahrscheinlich der Tod, so oder so. Aber an diesem Mädchen wollte er noch einmal seinen ganzen Spott auslassen, er wollte sie so lange reizen, bis sie den dort auf dem Tische liegenden Dolch in sein Herz stieß, und mit einem höhnischen Lachen wollte er von dieser Welt scheiden. Seinem bisherigen Leben sollte auch sein Tod entsprechen.
Jetzt deutete Evelyn mit der ausgestreckten Hand nach dem offenen Sekretär und wandte den Kopf langsam dem Gefangenen zu, bis sich beider Augen begegneten. Charles konnte sehen, wie die ihrigen halb fragend, halb entsetzt blickten.
»Guten Abend,« sagte Charles im ruhigsten Tone, »schönes Wetter heute.«
Evelyn überhörte ihn ganz.
»Was ist das?« fragte sie langsam, jedes Wort betonend.
»Ein Sekretär.«
Sie ließ die Hand sinken und trat mit drohend gefalteter Stirn auf den an der Wand Lehnenden zu.
»Glaubst Du, ich treibe mit Dir Scherz?«
In furchtbar drohendem Tone wurde diese Frage hervorgestoßen, aber sie vermochte nicht, Charles einzuschüchtern.
»Wenn Du keinen Spaß machst, ich mache welchen!«
Er redete sie ebenso mit »Du« an, wie sie ihn.
»Wer bist Du? Sprich!« – »Sir Charles Williams, Baronet von England, zu dienen.«
Erstaunt betrachtete Evelyn den Gefesselten.
»So sind Sie jener Herr, von dem sich die amerikanischen Damen so oft unterhalten?«
»Habe die Ehre! Können Sie mir vielleicht auch sagen, ob eine Miß Thomson öfters von mir gesprochen hat?«
Evelyn schritt nach dem Tische und nahm den Dolch.
»Ich habe keine Lust zu scherzen. Sehen Sie diesen Dolch?«
»Halt, zeigen Sie mir ihn genauer,« unterbrach sie Charles.
»Geben Sie mir keine Antworten auf meine Fragen, so stoße ich Ihnen denselben in's Herz!«
»Danke, nun fragen Sie mal los.«
»Was veranlaßte sie in dieser Verkleidung in unser Haus zu kommen?«
»Ich wollte ein bißchen spionieren, mit wem Sie verkehren.«
»Wer veranlaßte Sie dazu?«
»Stellen Sie eine andere Frage, die beantworte ich nicht!«
Evelyn spielte sinnend mit dem Dolche, sie bemerkte nicht, wie Charles' Augen seltsam aufleuchteten.
»Weiter, weiter,« drängte er, »ich habe nicht lange Zeit, ich will heute abend noch verreisen!«
»Sind Sie verrückt, daß Sie angesichts des Todes noch spaßen können, oder glauben Sie, Sie werden dieses Haus lebendig verlassen? Antwort! Wer hat dort den Sekretär erbrochen und mir Papiere geraubt? Ich halte Sie, den verkleideten Indier, für den Thäter.«
»Da sind Sie allerdings auf einer ganz falschen Spur, mein liebes Fräulein. Nicht ich war es, sondern Ihr Geliebter, mit dem Sie abends immer im Garten schäkerten. Der hat sich die Freiheit genommen, sich etwas für Ihre Korrespondenz zu interessieren.«
»Horatio? Sie lügen!« rief das Weib außer sich.
»Horatio?« spottete Charles. »Wer sagt Ihnen denn, daß es Horatio war? Nein, nicht der Kapitän war es, in dessen Armen Sie gelegen, dessen Lippen Sie geküßt haben, verehrtes Fräulein, sondern es war sein Bursche, der sich als Horatio O'Naill verkleidet hatte. Hahaha!«
Atemlos hatte ihm Evelyn zugehört:
»Nicht möglich,« hauchte sie, »es war Horatio.«
»Trauen Sie meinem Wort! Sein Bursche war der Detektiv Nick Sharp, von dessen Verstellungskunst Sie vielleicht schon gehört haben. Während nun der Kapitän ruhig schlief, verkleidete er sich als solchen und gab Ihnen die Rendezvous. Sie herzten sich und drückten sich und küßten sich, und dabei machte Ihr Geliebter hinter Ihrem Rücken immer Wachsabdrücke von den Schlüsseln.«
Charles weidete sich an dem Entsetzen, welches sich auf dem Antlitz des Weibes abspiegelte.
»Und Sie wußten davon?« sagte sie endlich.
»Gewiß, ich freute mich herzlich darüber, daß eine Verräterin, wie Sie, von einem Schlaueren betrogen wurde.«
»Schurke,« schrie Evelyn und hob den Dolch.
»Schurkin, Verräterin,« entgegnete Charles ebenso schreiend.
Fast war es, als ob Evelyn ihm den Dolch in die Brust stoßen wollte, aber sie hielt noch einmal inne.
»Wußte Horatio davon, daß ein solches Spiel mit mir getrieben wurde?« fragte sie tonlos.
»Er hat den Detektiven dazu engagiert.«
»Unglücklicher, weißt Du auch, daß Horatio tot ist, und alle die, welche heute dieses Haus zur Jagd verließen, und daß auch jener Detektiv mit zerschmetterten Gliedern in einer Schlucht liegt? Nur wenige Augenblicke noch, und Du wirst ihnen nachfolgen!«
»Was wetten wir, daß der Detektiv nicht tot ist?« sagte Charles kaltblütig. »Was wetten wir, daß Sie mich ebensowenig morden werden?«
Evelyn schaute zweifelnd diesen Mann an, der eine Minute vor seinem Tode noch wetten konnte. War er verrückt, oder hatte er irgendwelche Hoffnung, sein Leben erhalten zu sehen?
Langsam hob sie den Dolch.
»Es ist genug!« zischte sie.
»Recht so! Setze deinem Verbrechen die Krone auf! Erst Mädchenraub, dann Verrat an deinen Beschützern und zuletzt Mord an einem Wehrlosen. Pfui, du Scheusal!«
Charles spuckte dem Weibe ins Gesicht.
Ein Wutschrei rang sich von Evelyns Lippen. Blitzend fuhr der Dolch durch die Luft auf das Herz des Gefesselten zu.
Charles lächelte kalt.
Aber das Erwartete geschah nicht.
Im letzten Moment wurde Evelyns Handgelenk von einem eisernen Griff gepackt, ein anderer schnürte ihr die Kehle zu, sodaß sie keinen Laut von sich geben konnte. Ehe sie eigentlich wußte, wie ihr geschah, lag sie auf dem Rücken, und ein Mann, um den Kopf einen Verband, beugte sich über sie, um ihr einen Knebel in den Mund zu stoßen. Im nächsten Augenblick waren ihr die Hände gebunden und Charles' Bande zerschnitten.
»Meine süße Braut,« flüsterte der Mann, der sich über Evelyn beugte, zärtlich, »kennst du mich denn nicht nicht, deinen Horatio? Komm, wir wollen ein Viertelstündchen kosen!«
Wie ein Kind wurde Evelyn emporgehoben. Entsetzt starrte sie den Mann an, der sie auf den Armen hielt. Es war die Stimme Horatios, das Gesicht aber das eines Bedienten, dieses dumme Gesicht, über das sie so oft gespottet hatte. Das war also der Detektiv, von dem Williams vorhin gesprochen.
Ein dumpfes Röcheln entrang sich ihrem Munde.
»Jetzt schnell!« flüsterte Nick Sharp dem Befreiten zu, der durch Beweguugen das stockende Blut wieder in Umlauf brachte. »Sie haben die Unterhaltung zu sehr ausgedehnt. Alles ist zur Flucht bereit. Steigen Sie aus Fenster, ich werfe Ihnen das Mädchen herunter.«
»Sie wollen Evelyn mit sich nehmen?« fragte Charles erstaunt.
»Ich werde doch meine Braut nicht im Stich lassen,« lachte der Detektiv, »der ich Treue bis in den Tod geschworen habe!«

Einige Minuten später war in Evelyns Zimmer niemand mehr zu sehen.
Acht englische Meilen von Sabbulpore breitet sich ein dichter Wald aus. Herden von Affen treiben in den Bäumen ihr Wesen, unternehmen von hier aus am Tage Raubzüge nach den Reisfeldern der Eingeborenen und verträumen die Nacht in sicheren Verstecken.
Aber diese Nacht konnten sie keine Ruhe finden, denn in dem sonst so stillen Walde herrschte ein reges Leben. Ueberall brannten Feuer, hier und da erhob sich ein kleines Leinwandzelt, und Wachtposten patroullierten am Waldessaum auf und ab, gegenseitig, wenn sie sich auf Rufweite genähert hatten, einige Worte wechselnd.
In einem der Zelte saß ein hoher Mann mit langem Vollbarte, ihm gegenüber ein junges Mädchen, dessen Gesichtszüge die einer Indierin waren, obgleich sie nach europäischer Art gekleidet war.
»Wie ich schon sagte,« fuhr das Mädchen in einer begonnenen Erzählung fort, »war meine Mutter eine Indierin aus einem sehr vornehmen Geschlechte, nahe verwandt mit dem des Skindia. Es wurde oftmals gesagt, daß dieser herrschsüchtige Rajah in früheren Jahren sich viel um die Liebe meiner Mutter beworben habe, welche aber bereits die Neigung meines Vaters, damals Kapitän in Sabbulpore, erwiderte. Ich weiß nicht, ob dies wahr ist, jedenfalls aber bemerkte ich öfter, daß der Rajah gegen meinen Vater einen heimlichen Haß trug.
»Es war kurz vor dem großen Aufstande, den die Engländer mit vieler Mühe niederwarfen, als ich zufällig eine Unterredung zwischen Skindia und meinem Vater mit anhörte. Mein Vater, Kapitän Walton, beschuldigte den Rajah, daß er seine eingeborenen Soldaten nicht gehörig in Ordnung halte und allerlei fremde Elemente unter seinen Leuten dulde; der Rajah entgegnete unhöflich, es kam zum Wortwechsel, der schließlich so heftig wurde, daß der Rajah meinen Vater einen Hund nannte, der ihm die Braut verführt habe. Ich stand im Nebenzimmer und hörte deutlich, daß ein klatschender Schlag fiel. Kapitän Walton hatte den Rajah wegen dieser Beleidigung gezüchtigt.
»In unserem Hause lebte eine Verwandte meines Vaters, die Tochter eines Franzosen, ihr Name war Evelyn Valois. Diese, obgleich damals erst achtzehn Jahre alt, also acht Jahre älter als ich, besaß einen ungeheuer herrschsüchtigen Charakter, wie sie überhaupt Neigungen hatte, die man sonst nicht bei jungen Mädchen findet. Obgleich wir natürlich viel zusammen verkehrten, merkte ich doch von Zeit zu Zeit, daß sie gegen mich, die ich einen, wie sie manchmal scherzhaft sagte, sehr losen Mund besaß, Mißtrauen zeigte. Sie gab sich sehr viel mit den indischen Offizieren ab, die entweder dienstlich oder gesellschaftlich in das Haus kamen, und mir fiel oft auf, daß Evelyn sofort zu sprechen aufhörte, sobald ich mich ihr und dem betreffenden Offizier, mit dem sie sich gerade unterhielt, näherte. Im übrigen behandelte sie mich wie ein Kind, überhäufte mich einmal mit Schmeicheleien, das andere Mal schalt sie mich ein neugieriges, eigensinniges Geschöpf.
»Mein Vater wünschte also, daß ich auf Besuch zu Verwandten nach Kalkutta reisen sollte. Damals wußte ich noch nicht, was für drohende Wolken über Indien schwebten. Ich glaubte eben, wie mein Vater sagte, daß er selbst und die Mutter bald nachkommen würden. Ich verbrachte den letzten Abend in meiner Heimat in dem Garten, den ich so liebgewonnen hatte. Jeden Baum kannte ich, jede Blume schien mir ein Lebewohl zuzuwinken, als wollte sie sagen, auf Nimmerwiedersehen! In diesem Garten war ich aufgewachsen, hier hatte ich zwischen den Beeten gespielt, behütet von meiner Mutter.«
Dem Mädchen traten die Thränen in die Augen. Der Herr wartete rücksichtsvoll, bis es sich wieder beruhigt hatte.
»Doch ich schweife ab,« fuhr es endlich fort. »Ich ging durch die Anlagen, entfernte mich, in Gedanken versunken, immer weiter von dem Hause, bis ich ein kleines Orangenwäldchen erreichte. Es war mir streng verboten worden, mich so weit vom Hause zu entfernen, weil die Gegend von Eingeborenen durchstreift wurde. Da sah ich, wie ich so langsam zwischen den Bäumen wandelte, Evelyns Gestalt neben einem Indier stehen, mit dem sie sich eifrig unterhielt. Das wäre ja nichts besonderes gewesen, aber eben jener Mann war früher Diener meines Vaters gewesen, der ihn wegen verschiedener Diebstähle weggejagt hatte.
»Es war nicht meine Absicht, die Lauscherin zu spielen, so hustete ich einige Male, um meine Anwesenheit zu verraten; Evelyn drehte sich um, und ich sah, wie sie bis an die Lippen erbleichte. Sofort verschwand der Mann neben ihr im Gebüsch.
»Heftig fuhr sie mich an, was ich hier zu suchen habe. Aber auf meine trotzige Antwort, ich könne hingehen, wohin ich wolle, ward sie mit einem Male wunderbar freundlich, küßte mich, und sagte, ich sollte dem Vater nicht verraten, daß sie mit jenem Manne, seinem früheren Diener, gesprochen. Es dauere sie so sehr, daß nun der arme Kerl in Armut geraten sei, und sie stecke ihm manchmal etwas zu.
»Das war sonst Evelyns Art nicht, aber ich glaubte ihr. Nur fiel es mir auf, daß sie sich die letzten Stunden, die ich im elterlichen Hause verbrachte, immer an meiner Seite hielt, nie, auch in der Minute des Abschieds, ließ sie mich weder mit dem Vater noch mit der Mutter ein Wort allein wechseln.
»Ach, hatte ich damals ahnen können, daß ich meine Mutter nie wiedersehen würde!«
Wieder brach das Mädchen in Thränen aus.
»Denken Sie an die Freude Ihres Vaters, wenn er seine Tochter wieder in die Arme schließen kann,« sagte der Herr liebevoll zu ihr. »Spielte der Mann, der Diener Ihres Vaters, irgend eine Rolle bei Ihrer Entführung auf dem Wege nach Kalkutta?«
Das Mädchen nickte unter Thränen.
»Er war es, welcher die Indier anführte, die die uns zum Schutze mitgegebenen englischen Soldaten niedermetzelten. Er blieb auch bei mir, bis ich in Madras auf ein Schiff gebracht wurde.«
»Aber Sie konnten sich über die Behandlung nicht beklagen, welche Sie in dem türkischen Hause genossen?«
»Nein, ich wurde als ein Spielzeug, als Zeitvertreib betrachtet. Erst als die alte Dame starb und ihr ganzes Haus sich auflöste, sollte für mich eine schlimme Zeit beginnen. Der geizige Sklavenhändler in Konstantinopel ließ uns hungern und dürsten. Und als ich dann nach Smyrna verkauft werden sollte, ging ich oft mit dem Gedanken um, mich selbst zu töten. Ich hätte es auch gethan, hätten uns nicht die amerikanischen Damen befreit. Wie lange dauert es noch, bis ich meinen Vater wiedersehen kann? Wie lange bleiben die Damen aus? Man sagte mir doch, sie würden uns mit meinem Vater entgegenkommen.«
»Noch einige Tage,« tröstete sie der Mann, »ich selbst weiß nicht, was der Grund zu dieser langen Verzögerung ist, jedenfalls liegen –«
Plötzlich ward der Zeltvorhang zurückgeschlagen, und ein junger Bursche trat ein.
»Kapitän,« meldete er und schien sehr erfreut, denn er lachte vor Vergnügen im ganzen Gesicht. »Georg, Nummer zwei ist eingetroffen und verlangt, Sie sofort zu sprechen.«
»Endlich,« rief der Herr und sprang auf, »kommt er allein? Zu Fuß oder zu Pferd?«
»Er hat zwei andere bei sich, alle zu Pferd, und die Tiere triefen vor Schweiß.«
»Wollen Sie einstweilen in Ihr Zelt gehen, Miß Walton?« bat er das junge Mädchen. »Ich habe eine Unterredung mit einem von mir abgesandten Boten abzuhalten. Hoffentlich kann ich Ihnen dann frohe Botschaft bringen.«
Das Mädchen erhob sich, da aber ward wieder der Zeltvorhang zurückgeschlagen, und zwei Männer traten ins Zelt, der eine ein englischer Soldat im Tropenanzug, der andere ein Indier. Im Eingange des Zeltes wandte sich ersterer um und sagte:
»Kommen Sie nur herein, Sie werden alte Bekannte treffen.«
Halb mit Gewalt schleppte er eine Weibsperson in das Zelt, die Hände auf den Rücken gebunden, die Kleider mit Kot und Schmutz bedeckt.

»Hier, Herr Hoffmann,« fuhr er fort, »ein sehr wertvoller Fang, der uns manches Rätsel lösen wird.«
Beim Anblick des Weibes war Lucille, die von Ellen aus der Sklaverei befreite Tochter des Obersten Walton, mit einem Schrei emporgefahren.
»Evelyn!« rief sie mit namenlosem Erstaunen. »Ist es möglich?«
Die Gerufene rührte sich nicht. Die Lippen fest zusammengepreßt, die Augen starr auf den Boden geheftet, so stand sie da und schien die im Zelt Anwesenden gar nicht zu beachten. Nur ein scharfer Beobachter, wie der Detektiv, konnte bemerken, daß sie das Mädchen, welches sie vor fünf Jahren aus dem Wege räumen wollte, wiedererkannt hatte. Eine plötzliche, über ihr Gesicht ziehende Blässe hatte es verraten.
»Evelyn,« sagte Lucille wieder, als sie sich vom ersten Schrecken erholt hatte. »Kennst du mich nicht mehr?«
Unbeweglich stand die Gebundene. Lucille näherte sich ihr, das Mädchen fühlte doch Mitleid mit jener, die es erst ins Elend gestürzt hatte; aber ihr Aussehen, das Gesicht mit blutigen Schrammen bedeckt, das Kleid mit dem Lehm der Straße besudelt, zeigten ihm, was dieselbe in der letzten Zeit durchgemacht haben mußte. Ein heißes Gefühl des Mitleides stieg plötzlich in dem Herzen des jungen Mädchens auf.
Es wollte Evelyn sanft die Hand auf die Schulter legen, es wollte ihr sagen, daß es ihr verzeihe, für sie bitten wolle, was sie auch gethan haben möge, da aber wandte sich jene mit einer solchen Gebärde des Abscheues ab, daß Lucille bestürzt zurückfuhr.
»Lassen Sie nur, liebes Fräulein!« unterbrach der Detektiv diese Szene. »Diese Person verdient es nicht, daß Sie sich mit ihr abgeben. Herr Hoffmann, bitten Sie Miß Lucille, daß sie sich für einige Minuten aus dem Zelte begiebt, ich habe Ihnen einige Mitteilungen zu machen.«
Schweigend verließ Lucille das Zelt, im Vorbeigehen einen traurigen Blick auf ihre Verwandte werfend. Alle diese Vorgänge waren ihr ein Rätsel.
»Mister Sharp,« begann sofort nach ihrer Entfernung der Ingenieur, »erst einige Fragen: Wer ist dieser Indier?«
»Sir Williams, vom Bord des ›Amor‹,« antwortete Williams für sich selbst; er war merkwürdig ernst geworden, »die weitere Erklärung gebe ich Ihnen nachher. Fragen Sie weiter!«
»Gut! Wie kommt es, daß diese Dame so beschmutzt und arg zugerichtet ist?«
»Sie ist unterwegs einige Male vom Pferde gefallen,« antwortete der Detektiv rauh, »ich hatte keine Stricke bei mir, um sie festzubinden.«
Der Ingenieur warf dem Sprecher einen unfreundlichen Blick zu.
»Ihre Rücksichtslosigkeit scheint keine Grenzen zu kennen,« sagte er finster, »wenn das Weib auch eine Verbrecherin ist, so hätten Sie sie doch als Mensch besser behandeln sollen.«
»Rücksicht hin, Rücksicht her,« murrte Sharp, »es ist genug Zartgefühl von mir, daß ich für sie ein Pferd gestohlen habe. Fragen Sie diesen Herrn, ob vielleicht die Dame ihm gegenüber Rücksicht geübt hat?«
Er deutete auf Charles, der in Kürze erzählte, wie ihn der Detektiv vor Evelyns Dolch beschützt hatte.
»Was ist denn vorgekommen, daß diese Sachen alle passiert sind?« fragte Hoffmann verwundert.
»Sie haben uns mit Ihren Fragen aufgehalten,« entgegnete Sharp. »Der heutige Tag ist ein sehr ereignisvoller: Fort Sabbulpore ist von den Indiern genommen, das heißt, die auf ihm befindlichen Offiziere und englischen Soldaten sind von jenen überrumpelt worden, um Waffen für den Aufstand, der in einigen Tagen hier zuerst losbrechen soll, zu bekommen. Die englischen Herren vom ›Amor‹ und die Vestalinnen sind bei einem Jagdausflug von dem Rajah gefangen genommen worden und der Oberst und einige Offiziere mit ihnen. Wo sie sich jetzt befinden, werde ich nachher erfahren.«
Der Ingenieur mußte sich mit der Hand auf den Tisch stützen, so gelähmt war er durch diese Nachrichten, die der Detektiv im ruhigsten Geschäftstone vorbrachte.
»Was?« fragte er endlich, als er wieder Worte fand. »Und Sie haben es nicht verhindert?«
Der Detektiv brach in ein kurzes Lachen aus.
»Verzeihen Sie, Herr Hoffmann, aber Sie wissen nicht, was Sie sagen! Halten Sie mich vielleicht für einen Gott, daß ich alles wissen soll? Nein,« fuhr er ernst fort, »ich hatte wohl eine Ahnung davon, daß etwas in der Luft lag, eine kleine Empörung oder so etwas Aehnliches, aber ich wäre ausgelacht worden, wenn ich den Offizieren damit gekommen wäre. Gestern abend räumte ich den Schreibsekretär dieser – Dame, wie Sie sagen – aus und hoffte etwas Wichtiges in betreff einer Verschwörung zu finden. Aber die Papiere enthalten nichts davon. Dagegen habe ich jetzt Briefe in den Händen, welche beweisen, daß Evelyn Valois mit die Veranlassung gegeben hat, Lucille entführen zu lassen. Dieser Plan ging hauptsächlich vom Rajah aus, welcher den Oberst glühend haßt, und da Evelyn dem Mädchen auch nicht wohlgesinnt war, überhaupt die Engländer haßt, dagegen mit den Indiern gemeinsame Sache macht, so beauftragte er sie mit der Ausführung des Mädchenraubes.«
»Wer beauftragte Sie, die Briefschaften Evelyns zu visitieren?«
»Niemand. Ich wußte aber, daß Sir Williams hier das Thun und Treiben des Rajahs, Evelyns u. s. w. beobachten sollte, um zu erfahren, wer die Veranlassung zu dem Verbrechen gegeben habe. Aus zweiter Hand erfuhr ich Lucilles Schicksal, und sofort ward mir klar, daß Evelyn dabei eine Hauptrolle spielte. Ich interessierte mich so für das Mädchen, daß ich beschloß, nähere Bekanntschaft mit ihm anzuknüpfen, was mir auch gelang. Allerdings habe ich gehofft, wichtige Sachen für mich in dem Schreibsekretär zu finden, aber es war nichts. Er gab nicht einmal genügend Zeugnis davon, daß sie bei der Verschwörung beteiligt ist, doch jetzt ist dies ja bewiesen.«
»Und die englischen Herren, die Damen, der Oberst? Wo sind sie?«
»Weiß nicht; diese wird uns darüber Auskunft geben. Sehen Sie, wie Sie sich schon darauf freut.«
Evelyn hatte ein höhnisches Lachen hören lassen.
»So erfüllen Sie also Ihr Versprechen?« sagte Hoffmann vorwurfsvoll. »Wollten Sie nicht immer Miß Petersen zur Seite bleiben?«
»Herr Hoffmann, das verstehen Sie nicht,« sagte der Detektiv kurz. »Die Jagdgesellschaft wurde überrascht – Widerstand war nicht möglich, das sah jeder ein, und so ergaben sich alle vorläufig in ihr Schicksal, und das war sehr richtig. Nur mir gelang es, sich durch die Reihen der Angreifer zu schleichen, einer schoß nach mir, die Kugel streifte meine Schläfe, wie Sie hier sehen können, und ich ließ mich sofort wie tot hinfallen. Unglücklicherweise oder vielmehr glücklicherweise strauchelte ich dabei und stürzte in eine ziemlich tiefe Schlucht. Ein anderer hätte dabei sämtliche Glieder gebrochen, aber Nick Sharp brannte sich unten eine Pfeife an und rannte nach dem Fort, um die englischen Offiziere zu benachrichtigen. Jawohl! Da wäre ich aber schön hereingefallen; ehe ich es erreicht hatte, befand es sich in den Händen der Indier. Ich befreite noch Sir Williams, den ich gefangen wußte, nahm meine Geliebte gleich mit und eilte zu Ihnen, um Sie zu benachrichtigen und Ihnen Ratschläge zu erteilen. Sie sehen also,« schloß der Detektiv, »allwissend zu sein ist ganz hübsch, aber so weit hat es Nick Sharp noch nicht gebracht. Wäre ich mitgefangen worden, so könnten Sie noch einige Tage hier warten.«
Der Detektiv hatte sich nach und nach wieder in seinen alten Ton hineingeredet.
»Wo mögen unsere Freunde jetzt sein?« fragte der Ingenieur nach einigem Ueberlegen nochmals.
Der Detektiv deutete auf Evelyn.
»Fragen Sie bei dieser Adresse an.«
Wieder lachte Evelyn höhnisch auf, ein Zeichen, daß aus ihr nichts herausgebracht werden könnte.
Der Ingenieur ging auf sie zu und zerschnitt ihr die Banden.
»Miß Valois,« begann er, »geben Sie der Wahrheit die Ehre und beantworten Sie meine Fragen! Wohin hat der Rajah die gefangenen Mitglieder der Jagdgesellschaft gebracht?«
Es erfolgte keine Antwort. Hoffmann konnte bitten, oder befehlen, soviel er wollte, die festgeschlossenen Lippen öffneten sich nicht. Endlich wandte er sich achselzuckend ab und blickte fragend den Detektiven an.
Dieser hatte lächelnd dem erfolglosen Versuch zugeschaut.
»Herr Hoffmann,« sagte er, »bitte, gehen Sie und Sir Williams auf fünf Minuten aus dem Zelt; wenn Sie zurückkommen, will ich Ihnen alles Wissenswerte erzählen.«
Der Ingenieur zögerte, daun sagte er langsam:
»Gut, ich will gehen, aber bedenken Sie, daß Sie ein Mensch und keine Bestie sind!«
Er ging mit Sir Williams aus dem Zelt.
Charles sah jetzt erst, daß fast die ganze Besatzung des ›Blitz‹ hier versammelt war. Ueberall lagen die Männer, weiße, braune und schwarze um die Feuer herum, rauchten, schwatzten und lachten. Der junge Baronet hatte einst in Frankreich eine Gruppe lagernder Zigeuner gesehen, und denselben Eindruck machte jetzt die Gesellschaft auf ihn.
Beide gingen langsam zwischen den wenigen Zelten umher und hingen ihren Gedanken nach. Dann mußte Charles dem Ingenieur seine Erlebnisse während des letzten Tages erzählen, und Hoffmann wunderte sich nicht wenig bei Schilderung der Szene, die sich in Evelyns Schlafgemach zugetragen hatte. Als Charles das Liebesabenteuer des Detektiven erwähnte, konnte selbst der ernste Deutsche ein Lächeln nicht unterdrücken.
»Dieser Detektiv ist ein seltsamer Mensch,« sagte er. »Sein Leben achtet er gleich nichts, er geht seinem sicheren Tode mit einer Gleichgiltigkeit entgegen, als eile er zu einem Vergnügen, und weiß ihm dann mit einer gewandten Bewegung im letzten Moment noch auszuweichen.«
»Ja, wenn er dafür bezahlt wird,« lachte Charles.
»Ich glaube doch, da irren Sie sich, Sir Williams. Nick Sharp ist ein Deutsch-Amerikaner, sein Vater ist ein Deutscher, wie er überhaupt gar nicht Sharp heißt, aber er giebt sich für einen Amerikaner aus, und als solcher prahlt er mit dem Prinzip, daß er nichts ohne Geld thue. Ich aber halte ihn vielmehr für einen guten Menschen, der das Herz auf dem rechten Flecke hat; wer ihn zum guten Freunde hat, kann in jeder Lage auf ihn zählen. Sein einziger Fehler ist nur, daß er von sich immer auf andere schließt, sein Körper ist wie von Stahl und Eisen zusammengesetzt, Nerven besitzt er gar nicht, und da er somit zu Strapazen und Ertragen von Beschwerden geeignet ist, oder vielmehr, weil er sie überhaupt gar nicht fühlt, so ist er gegen sich selbst im höchsten Grade rücksichtslos. Dasselbe aber, was er seinem Körper zutraut, verlangt er auch von anderen, und daher kommt es, daß er Zeichen von Schmerz, Ermüdung oder Angst bei anderen gar nicht bemerkt oder doch übersieht.«
»Möchte nur wissen,« meinte Charles, »wie er es anfängt, dieses Weib gesprächig zu machen. Soweit ich Evelyn kenne, wird sie ihren Mund nicht aufthun.«
»Glimpflich wird er mit ihr jedenfalls nicht umgehen,« erwiderte der Ingenieur.
Eben schallte ein gellendes Wehgeschrei durch das Lager, aus dem Zelte Hoffmanns kommend. Beide eilten dorthin, aber schon kam ihnen der Detektiv entgegen.
»Die Herren und Damen sind in die Berge geschleppt worden, um dort als Geißeln festgehalten zu werden. Alles, was zum Fort Sabbulpore gehört, der Oberst, seine Nichte, die Offiziere dagegen werden nach Parahimbro geführt, dort will sich der Rajah speziell an seinem Feinde, dem Obersten, rächen.«
»Was haben Sie mit Evelyn gemacht?«
»Sie lebt und ist guter Dinge, ich war sehr höflich mit ihr. Fragen Sie sie selbst!«
Alle drei betraten das Zelt, und der Ingenieur, der zuerst hineinging, fuhr erschrocken zurück.
Auf dem Boden lag Evelyn. Das Gesicht krampfhaft verzerrt, die blau angelaufenen Lippen mit Schaum bedeckt – sie war tot.
Der Ingenieur blickte den Detektiven finster an, doch dieser war selbst über den Anblick, der sich ihm bot, sichtlich betroffen.
»Bei Gott, dem Allmächtigen,« sagte er dann feierlich und hob die rechte Hand zum Schwur empor, »ich bin an dem Tode dieses Weibes unschuldig. Wohl habe ich ihm die Antworten mit Gewalt herausgepreßt, aber an seinem Leben habe ich mich nicht vergriffen.«
»Dies hier wird das Rätsel lösen,« rief Charles, hob etwas vom Boden auf und reichte es dem Ingenieur.
Hoffmann nahm das Fläschchen und roch hinein. »Blausäure,« sagte er dann erschüttert. »Evelyn hat sich selbst gerichtet, um der irdischen Gerechtigkeit zu entgehen. Möge Gott ihr gnädig sein!« Er beorderte einige seiner Leute, die Leiche aus dem Zelte zu tragen.

»Sagen Sie Lucille nichts davon, meine Herren! Das arme Mädchen hat so schon Trübes genug erfahren. Was wollen wir aber nun zuerst beginnen? Mister Sharp, legen Sie uns Ihren Plan vor!«
»Ehe ich dies kann,« sagte der Detektiv und setzte sich, »muß ich erst mitteilen, was der Rajah zu thun beabsichtigt. Evelyn mußte mir alles erzählen. Der Jagdausflug mit den Geparden war natürlich nur darum unternommen worden, um einmal möglichst viele Offiziere, ebenso wie die Gäste, von dem Fort zu entfernen, welches an demselben Tage noch genommen werden sollte, und dann auch, um gleich ohne Blutvergießen in den Besitz von Geißeln zu kommen. Als letztere sollen die Gäste, Damen, wie Herren, dienen, während die Offiziere wahrscheinlich zu Parahimbro getötet werden sollen. Das Fort ist vom Rajah, der vom Rachegefühl gegen den Obersten vollkommen beherrscht wird, viel zu zeitig genommen worden; denn der Aufstand kann nicht losbrechen, solange der Rajah nicht von anderen indischen Häuptlingen davon benachrichtigt worden ist, daß auch sie dazu bereit sind. Trotzdem ist auch hierbei nicht ohne Ueberlegung gehandelt worden, denn Evelyn ist oder war vielmehr mit den Geschäften vollkommen vertraut, die der Oberst zu besorgen hatte. Sie sollte eine etwaige mißtrauische Frage des britischen Gouvernements, ob in Sabbulpore alles ruhig sei, befriedigend beantworten, sodaß man vollkommen in Sicherheit gewiegt wurde, bis an allen Ecken Indiens der Aufstand gleichzeitig losbrach.«
Der Detektiv sah eine kurze Zeit sinnend vor sich nieder, dann fuhr er fort:
»Was nun zu thun ist? Wie viele Leute haben Sie bei sich, Herr Hoffmann?«
»Vierzig Mann.«
»Gut, das genügt, um noch diese Nacht Fort Sabbulpore wiederzunehmen, und zwar still, unter Vermeiden jeden Aufsehens. Es gilt, den Rajah zu täuschen. Er muß von Parahimbro glauben, es sei noch in den Händen seiner Vertrauten, während es aber in den unsrigen ist; wir senden ihm beruhigende Nachrichten. Wenn ich Indisch sprechen könnte, würde ich dies selbst unternehmen, so aber muß ich mich nach jemandem anders umsehen, der als Bote zum Rajah geht.«
»Ich werde das thun,« unterbrach ihn Charles, »Sie putzen mich wieder als indischen Offizier heraus, ich werde dem Rajah schon etwas vorlügen.«
Der Detektiv nickte.
»Das würde gehen, doch wollen wir diesen Punkt erst besprechen, wenn Sabbulpore wieder in unserem Besitz ist. Haben wir dann auch den Rajah gefangen, so wird es uns ein Leichtes sein, den Aufenthalt der Geißeln zu erfahren und sie zu befreien. Für deren Leben bin ich nicht bange. Es ist jetzt elf Uhr, in zwei Stunden können Sie, Kapitän Hoffmann, mit Ihren Leuten vor Sabbulpore liegen, während ich inzwischen mit Sir Williams die Umgebung des Forts sondieren und eine Gelegenheit zum Eindringen ausspähen werde.«
»Aber Oberst Walton?« fragte der Ingenieur. »Wenn der Rajah seine Rache nun nicht verschiebt?«
»Er erreicht Parahimbro erst diese Nacht und wird schwerlich vor morgen früh etwas unternehmen. Bis dahin können wir ihm aber irgendwie eine Nachricht zukommen lassen, die das Leben des Obersten eines Geheimnisses wegen, das im Fort gefunden worden ist, als sehr wertvoll bezeichnet.«
Draußen hörte man die Wachtposten rufen. Stimmen erschallten, Fragen und Antworten wechselten. Das ganze Lager geriet mit einem Male in Aufruhr.
Charles horchte hoch auf; fast schien es ihm, als könne er Frauenstimmen unterscheiden. Mit einem Sprunge war er zum Zelt hinaus, gefolgt von dem Ingenieur und Nick Sharp.
Der Baronet hatte sich nicht getäuscht, als er wohlbekannte Stimmen zu vernehmen glaubte; dort zwischen den Frauen standen seine Freunde und neben ihnen die Vestalinnen.
Aber wie sahen sie aus! Die Kleider zerfetzt, über und über voll Blut; aber nicht nur Dornen schienen Gesicht und Hände zerrissen zu haben, vielmehr zeigte manches Antlitz die Spuren von Säbelhieben. Besonders die Männer wiesen viele Verletzungen auf, aber auch die Damen waren nicht verschont geblieben; Ellen trug den linken Arm sogar in einer Binde und schien vom Blutverlust ganz erschöpft.
»Harrlington!« schrie Charles und stürzte auf den Lord zu, der den Kopf mit einem Taschentuch verbunden hatte. »Mein Gott, sehen Sie mich doch nicht so furchtbar dumm an. Ich bin's ja, Charles.«
Er rannte von einem der Herren zum anderen, von Mädchen zu Mädchen, und versicherte Miß Thomson einmal über das andere, sie hätte ihm noch nie so gut gefallen, als wie mit dem blutigen Gesicht. Er war vor Freude außer sich, als er sah, daß niemand fehlte.
Mit wenigen Worten schilderte Harrlington, wie sie die ihnen mitgegebenen Wächter, die sie nach einem Schlupfwinkel in die Berge führen sollten, überwältigt und sich befreit hätten, und dann erfuhr er von dem Ingenieur den Verbleib der übrigen.
»In Parahimbro sind der Oberst und die Offiziere?« rief er. »Auf, meine Herren! Wer folgt mir? Der Felsen, auf dem diese ehemalige Burg liegt, gilt als unersteiglich, ich aber habe einst auf der Jagd einen Aufstieg gefunden, der nicht allzuviele Schwierigkeiten bietet.
»Noch ehe die Sonne am Horizont sich erhebt, will ich das alte Gerümpel in meiner Gewalt haben und den Rajah zur Verantwortung ziehen. Wer begleitet mich?«
Zehn der Herren, welche am wenigsten verwundet waren, boten sich sofort als Begleiter an; alle glühten vor Begierde, an dem treulosen Rajah Rache zu nehmen. Selbst einige der Damen wollten sich nicht davon ausschließen, darunter Ellen, aber Harrlington sagte:
»Sie haben heute schon genug geleistet; überschätzen Sie Ihre Kräfte nicht. Und Sie, Miß Petersen, können mit Ihrem verwundeten Arm gar nicht klettern. Begnügen Sie sich mit dem Triumph, daß Sie es waren, die den Anlaß zu unserer Befreiung gab.«
»Herr Chamäleon,« sagte Charles zu dem Detektiven, »suchen Sie sich einen anderen Begleiter zu Ihrer Spionage aus, ich bin für die Nacht bereits engagiert.«
»Werde auch ohne Sie fertig,« brummte Sharp, der eben mit wunderbarem Geschick einem der Mädchen einen Verband um die Hand legte. »Sie fangen doch sonst wieder mit einem Male an, Walzermelodien zu pfeifen!«
»Wann brechen Sie auf?« fragte der Ingenieur den Lord Harrlington.
»Sofort! Wir haben bis zum Abend in einem Gebüsch gelegen und sind vollständig ausgeruht,« entgegnete dieser. »Wann wollen Sie mit Ihren Leuten nach Sabbulpore marschieren?«
»Ebenfalls gleich, jede verlorene Minute ist unersetzbar.«
Die Herren, welche Lord Harrlington beim Ersteigen des Felsens begleiten wollten, wurden von Hoffmann mit Gewehren und Revolvern versehen, denn sie hatten nur wertlose Feuersteinflinten und indische Schwerter mitgebracht, dann entfernten sie sich ungesäumt unter des Lords Führung, um, wie er sagte, morgen früh gleich Raubvögeln über Parahimbro zu schweben, während der Ingenieur den Befehl gab, die Feuer zu löschen und die Zelte abzubrechen.
Nach einer Viertelstunde bewegte sich ein langer Zug durch den finsteren Wald der Festung Sabbulpore zu, in der Mitte die Vestalinnen und jene Herren, deren, wenn auch nur leichte, Verletzungen es nicht gestatteten, an dem Rachewerk gegen den Rajah teilzunehmen.
Als der überraschten Jagdgesellschaft von allen Seiten Mündungen von Gewehren entgegenstarrten, sahen die Herren sofort ein, daß Widerstand hier nichts half. Eine einzige, auf Geheiß des Rajahs abgegebene Salve hätte den Boden ringsum mit Toten bedeckt. Willig streckten die Gefangenen die Waffen und ließen es ruhig geschehen, immer von den mit angeschlagenen Gewehren auf den Felsen postierten Indiern, wenigstens hundert Mann, bedroht, daß man ihnen die Hände auf den Rücken band, den Herren sowohl, wie den Damen.
Ein einziges Mal noch blitzte in Lord Harrlington ein Hoffnungsstrahl auf, als am Eingange der Schlucht ein wildes Geschrei erscholl, Schüsse knallten und er den Ruf hörte, daß Jeremy, Horatios Bursche, entflohen sei. Unwillkürlich wollte er die Hände hinter dem Rücken, welche eben erst einmal vom Strick umschlungen waren, wieder auseinanderreißen, aber der vor ihm stehende Indier setzte ihm mit drohender Gebärde die Mündung einer Pistole an die Stirn. Was hätte es ihm und seinen Freunden geholfen, wenn er jetzt starb? Während des Transportes würde sich vielleicht eher als hier eine Gelegenheit zur Flucht bieten.
Außerdem sagte eben der herzukommende Abudahm, dieser elende Verräter, zum Rajah, er habe den Flüchtling mit eigener Hand erschossen. Er habe gesehen, wie derselbe in eine tiefe Schlucht gestürzt sei, zu der es keinen Abstieg gäbe. Also war auch diese Hoffnung, daß Jeremy Hilfe herbeihole, geschwunden.
Harrlington hatte keine Ahnung, daß Jeremy jener Detektiv war, den er mit der Beobachtung und dem Schutze Ellens betraut hatte. Er kannte zwar die seltsamen Gewohnheiten dieses Mannes und wußte, daß derselbe sich immer unter anderer Gestalt demjenigen näherte, für den er sich interessierte, aber unter welcher Maske, das erfuhr selbst Harrlington niemals. Er hielt Jeremy wirklich für den Burschen des Kapitäns, für einen braven und ehrlichen, aber auch sehr beschränkten Menschen. Dennoch ruhte des Lordes einzige Hoffnung jetzt auf dem Detektiven, der Ellen sicher nicht aus den Augen gelassen hatte.
Ebenso wie Harrlington, zweifelten auch die anderen Gefangenen nicht daran, daß der Rajah einen Aufstand im Sinne habe, und um dabei sicher zu gehen, die Offiziere beseitigen und die Gäste derselben als Geißeln behalten wolle.
Bald versammelten sich der Rajah, Abudahm und alle indischen Offiziere, welche an dem Jagdausflug teilgenommen hatten, außer Hörweite der Gefangenen und hielten eine Beratung ab, nach deren Beendigung die bewaffneten Eingeborenen von den Wänden der Schlucht herabgerufen wurden.
Es waren, wie der erfahrene Harrlington sofort sah, nicht nur Eingeborene aus der Umgegend, sondern die Hälfte von ihnen hatte ihre Heimat in den Bergen, welche sich im Norden der Provinz Heiderabad erheben. Ihr Wuchs ist größer und stärker, als der jener Landbebauer, und dann unterscheiden sie sich auch durch die Waffen von letzteren. Während diese moderne Gewehre mit Bajonetten führen, tragen die Bergbewohner alte Feuersteinflinten und die gefährlichen, krummen Säbel, welche mit glatten oder ausgezackten Klingen von eingeborenen Waffenschmieden hergestellt werden.
Der Rajah und Abudahm ordneten den Zug, dessen Endziel natürlich keiner der Gefangenen kannte.
Voraus ritt der Rajah selbst, neben ihm Abudahm und die übrigen indischen Offiziere, sich eifrig unterhaltend. Ihnen schlossen sich die Eingeborenen von Sabbulpore an, welche zu Fuß gekommen waren, nun aber auf den Pferden der Gefangenen saßen und den Obersten, dessen Nichte Rosa und die übrigen englischen Offiziere scharf bewachten. Hinterher schritten die zur Jagd mitgenommenen Treiber, welche abwechselnd die aus Zweigen geflochtene Bahre trugen, auf welcher der noch immer bewußtlose Werden lag, und den Schluß endeten die Herren vom ›Amor‹ und die Vestalinnen, unter der Aufsicht der ebenfalls gleich den Gefangenen zu Fuß gehenden Bergbewohner. Es hatte sich zufällig so gefügt, daß Ellen mit dem neben ihr gehenden Wächter die letzte des langen Zuges war.

Eine Stunde mochte der Marsch schon gedauert haben, der meist immer zwischen Hügeln durchführte, als der voranreitende Rajah sein Pferd zügelte und mit seinen Begleitern eine lange Unterredung hielt. Sie mußten in irgend einem Punkte nicht übereinstimmen, denn namentlich Abudahm begleitete seine Rede mit lebhaften Gestikulationen, aber immer wieder setzte der Rajah dessen vorgebrachten Ratschlägen ein verneinendes Kopfschütteln entgegen.
Dann wurde der Anführer der fremden Indier, ein großer, muskulöser Mann, zu der Gruppe gerufen und mußte eine lange Auseinandersetzung anhören, worauf er zu seinen Leuten zurückkehrte und mit den von ihnen bewachten Gefangenen links in ein Hügelthal einbog, während der Rajah und seine Offiziere mit den gut bewaffneten Indiern und den gebundenen englischen Offizieren nach rechts abschwenkten.
Von Harrlingtons Herzen fiel eine Centnerlast.
Er hatte aus den Bewegungen Abudahms ganz richtig erraten, daß dieser äußerst mißtrauische Mann auf eine Trennung der gefangenen Gäste bestand, aber der Rajah aus irgend einem anderen Grunde nicht darauf eingehen wollte. Er nahm nur die englischen Offiziere mit sich und überließ die übrigen der Wachsamkeit der Bergbewohner.
Ebenso wie Harrlington, atmeten auch dessen Gefährten erleichtert auf, als sie merkten, daß sie nicht voneinander getrennt werden sollten.
Nicht ein einziger war unter den Gefangenen, die jetzt wieder bergauf, bergab, durch Wälder und Wiesenflächen geführt wurden, der sich nicht mit den Gedanken abgequält hätte, wie eine Flucht möglich wäre. Aber nirgends war eine Möglichkeit dazu vorhanden: die Banden waren so fest geschnürt und die Stricke bestanden aus dickem Hanf, sodaß selbst der riesige Hastings sie nicht zu sprengen vermocht hätte. Außerdem waren sie waffenlos, ihre Jagdbüchsen hatten die Indier an sich genommen, und selbst wenn sie frei gewesen wären, war es doch keine so leichte Sache, die fünfzig kräftigen Indier, die alle gut bewaffnet waren, zu überwältigen.
Lord Harrlington war der erste, welcher versuchte, mit seinem Wächter eine Unterhaltung anzuknüpfen, und der braune Bursche, der sich langweilte, ging sofort darauf ein.
»Wohin werden wir geführt?« fragte ihn der Lord.
»Ich weiß nicht, Sahib, jedenfalls in die Berge.«
»Warum sind wir gefangen genommen worden?«
»Unser Rajah, der ein Freund von Skindia ist, hat uns fünfzig Mann hierhergeschickt, mit dem Geheiß, dem Skindia in allen Befehlen nachzukommen. Das haben wir auch gethan.«
»Fürchtet Ihr Euch nicht vor der Strafe, die Euch treffen wird, wenn das englische Gouvernement von unserer Gefangennahme hört?«
Der Indier lachte höhnisch auf.
»Die Engländer werden ihre Rolle hier bald ausgespielt haben,« entgegnete er, »in einigen Tagen erheben sich alle Indier mit einem Male, und sie werden das Häufchen Engländer wie einen Wurm zertreten.«
Also das war es, was diesen Rajah zu der Gefangennahme den Mut gab. Eben wollte Harrlington den Indier weiter ausforschen, als dieser von selbst in triumphierendem Tone fortfuhr:
»Noch heute fällt Sabbulpore, und mit ihm geraten alle darin befindlichen Offiziere und englischen Soldaten in die Hände des Rajah Skindia. Vielleicht weht schon jetzt die britische Flagge nicht mehr auf der Festung.«
Harrlington schrak zusammen.
Wie, also schon so weit war die Empörung gediehen? Er hatte gehofft, daß sich die Besatzung von Sabbulpore über das Ausbleiben der Jagdgesellschaft ängstigen und Nachforschungen anstellen würde, so aber war ihnen die letzte Aussicht genommen, durch andere als durch eigene Hilfe sich zu befreien. Wie aber sollte man dies anfangen?
Ohne Zweifel wurden sie alle in die Berge geschleppt, jede von ihnen hinterlassene Spur verwischt, und sie getrennt in Verstecken als Geißeln festgehalten. Jene Berge waren durchzogen von Höhlen, welche nur den dortigen Bewohnern bekannt waren.
Ebenso wie sie, wurden vielleicht in ganz Indien andere zu Geißeln gemacht, gingen die Engländer auf die ihnen gestellten Bedingungen ein, das heißt, räumten sie Indien, so wurden die Gefangenen freigelassen, nahmen jene aber den Kampf auf und fiel dieser zu ihren Gunsten aus, so mußten die Köpfe der Geißeln unbedingt fallen. Das waren traurige Aussichten.
Finster schritt Harrlington neben seinem Wächter her. –
Auch Ellen hatte vergebens den Kopf angestrengt, ein Mittel zur Befreiung zu finden, es fiel ihr keines ein.
Da merkte sie plötzlich, wie ihr Wächter sie öfters längere Zeit aufmerksam betrachtete. Er mochte für das schöne Mädchen, zu dessen Schütze er auserkoren worden, Teilnahme, oder vielleicht mehr als das empfinden.
Sofort beschloß Ellen, darauf einen Fluchtplan zu gründen, denn wenn nur einer von den Gefangenen entflohen war, so war schon viel gewonnen.
»Sprichst du englisch?« fragte sie den Indier.
Er schüttelte verneinend den Kopf.
Das war schade, sonst hätte ihm Ellen etwas Interessantes erzählt, wodurch sie seine Aufmerksamkeit ablenken konnte.
So aber verging fast noch eine Stunde, ehe sie sich einen Plan zurechtgelegt hatte, nach dem sie ihre Befreiung und vielleicht auch die der anderen bewirken konnte.
Die Sonne stieg immer höher und sandte ihre glühenden Strahlen auf die Gefangenen, welche die Hitze nicht so gewohnt waren, wie die Eingeborenen.
Ellen begann leise zu stöhnen und sah, wie sie ihr Wächter wieder mitleidig betrachtete.
»O,« seufzte sie, »die Stricke schmerzen mich.«
Wieder stöhnte sie mehrere Male auf, um das Mitleid ihres Wächters noch mehr zu erregen. Sie versuchte etwas zurückzubleiben, und als letzte gelang ihr dies auch.
Der Indier wandte sich zu ihr und sprach sie an, aber leider verstand sie ihn nicht. Ellen begnügte sich damit, ein recht schmerzhaftes Gesicht zu ziehen und von Zeit zu Zeit zu jammern.
Da, fast konnte sie einen Freudenruf nicht unterdrücken, legte der Indier bedeutungsvoll den Finger auf den Mund, schaute sie an und zog das Messer aus dem Gürtel. Im nächsten Augenblicke fielen die Bande von Ellens Händen, aber er hielt sie noch zusammen und schaute das Mädchen an, eine Gebärde machend, die zum Schweigen mahnte.
Ellen hatte verstanden, sie sollte die Hände auf dem Rücken so liegen lassen, als wären sie noch gebunden, denn da sie die letzte im Zuge war, so konnte niemand diese ihr gewährte Freiheit bemerken.
Noch wußte sie nicht, wie sie eine Flucht bewerkstelligen konnte, aber schon betrachtete sie mitleidig den gutmütigen Burschen neben ihr; denn zur Erlangung der Freiheit war es jedenfalls nötig, daß er sein Leben lassen mußte. Vorläufig zögerte sie, irgendwelchen Gebrauch von ihren freien Händen zu machen, eine günstige Gelegenheit dazu mußte erst abgewartet werden.
Bei einer Biegung des Weges orientierte sie sich, wie die einzelnen Personen im Zuge verteilt waren. Gleich einer der ersteren war Lord Hastings, von diesem nur durch einen kleinen Zwischenraum getrennt, kam Lord Harrlington, hierauf Johanna, dann Miß Murray, dicht hinter dieser Hendricks, und der nächste vor ihr war John Davids, der zweite Steuermann des ›Amor‹, ein ruhiger, stiller Mann, welcher sich nur bemerkbar machte, wenn seine Dienste gebraucht wurden. Diese genannten Personen waren diejenigen, deren Stellung im Zuge sich Ellen merkte, denn von ihnen hoffte sie am meisten Unterstützung zu finden. Sehr froh war sie, daß gerade der besonnene und schnell entschlossene Davids vor ihr ging.
Da erglänzte in der Ferne der Spiegel eines breiten Flusses.
»Wenn wir diesen passieren,« dachte Ellen, »so ist dies der günstigste Augenblick, den ich zu einer Flucht finden kann. Die Wächter müssen beim Durchschreiten des Wassers in der einen Hand die Flinte, in der anderen die Pistole hochhalten, sodaß sie keine Hand frei haben. Ich bleibe etwas zurück, und in dem Augenblick, da der Wächter Davids beide Arme hochhält, stoße ich meinen Führer nieder, nehme ihm die Waffen ab und laufe dort in jenes Gebüsch. Das Plätschern des Wassers kann vielleicht meine Flucht unbemerkbar machen, wenn nicht, so werde ich mich auch etwaiger Verfolger zu erwehren wissen, und bin ich erst in Sicherheit, so ist schon viel gewonnen.«
Aber es sollte anders kommen, als Ellen gedacht hatte.
Am Ufer des Flußbettes hielt der Führer und besprach sich mit dem hinter ihm gehenden Indier. Dieser deutete auf eine nicht weit entfernte Stelle des Uferrandes, und sofort schritt ersterer darauf zu. Jedenfalls befand sich dort eine Furt, dachte Ellen.
Mit zusammengepreßten Lippen, alle Muskeln anspannend, aber die Hände immer noch auf dem Rücken, sah sie zu, wie einer der Wächter nach dem anderen ins Wasser schritt, das ihm bis zur Brust reichte, Flinte und Pistole hochhielt und neben seinem Gefangenen dem anderen Ufer zustrebte.
Nur noch acht Paare waren außer ihr am Land, Ellen überzeugte sich mit einem Seitenblick, wo das Messer ihres Wächters stak. Betrat Davids das Wasser, so mußte es in ihrer Hand sein, und der Leichnam seines Besitzers rollte den Abhang hinunter.
Doch, was war das?
Die ersten Gruppen hatten das jenseitige Ufer fast erreicht, da entstand in der Mitte des Flusses ein Getümmel, der Zug staute sich, und Ellen sah, wie Lord Hastings seinen Führer unter Wasser drückte und dessen Messer einem anderen herzueilenden Indier in die Brust stieß.
Dem herkulischen Lord war es gelungen, schon unterwegs seine Bande nach und nach zu lockern, und während das bis zur Brust reichende Wasser seine Anstrengungen verbarg, hatte er die Stricke völlig gesprengt.
Die am weitesten vorn befindlichen Wächter drehten sich um, die hinten im Wasser stehenden eilten nach vorn, um den kühnen Mann wieder zu bändigen. Auch Ellens Begleiter wollte ins Wasser springen, da aber riß eine Hand ihm das Messer aus dem Gürtel und stieß es ihm bis ans Heft in den Rücken.
Röchelnd brach er zusammen.
Im nächsten Augenblick fühlte Davids, wie seine Fesseln durchschnitten, wie ihm der Griff eines Schwertes in die Hand gedrückt wurde, und er hörte Ellens Stimme rufen:
»Erst die anderen frei.«
Jeder Schnitt löste die Stricke von zwei Händen. Was schadete es, wenn das scharfe Messer dabei das Fleisch streifte? Nur immer schnell von einem zum anderen geeilt und den Stahl kräftig über die Stricke gleiten lassen.
Um Hastings hatten sich fast alle die Indier geschart, den Wütenden zu bändigen; wer noch nicht zur Stelle war, eilte so schnell wie möglich dorthin, an die anderen Gefangenen dachte in diesem Augenblick niemand – die waren ja noch gefesselt.
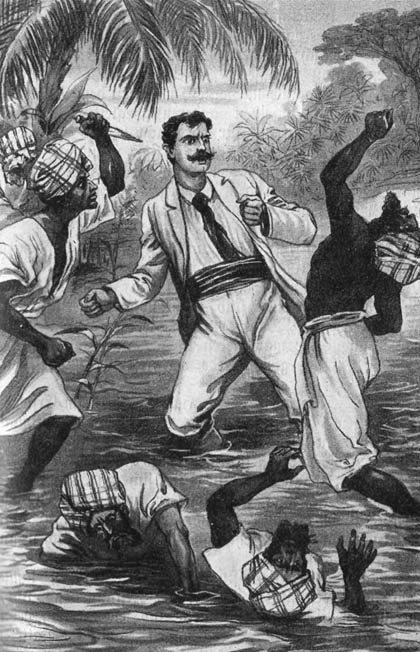
Da wurden die Indier plötzlich von hinten umschlungen, die Messer wurden ihnen aus den Gürteln gerissen und ihnen in die Brust gestoßen; sehnige Finger legten sich mit eisernem Griff um die Kehlen der Ueberraschten, sie wurden unter das Wasser gedrückt, und nur ein Gurgeln verriet, daß soeben eine Seele dem Körper entflohen war.
Die entsetzten Wächter erkannten jetzt, daß alle Gefangenen frei waren; sie griffen nach den Waffen, aber zu spät. Mann gegen Mann standen sie sich schon gegenüber, kein Schuß ward hörbar, die Männer wie die Frauen kannten kein Mitleid. Wer von den Indiern den Dolch gegen einen waffenlosen Engländer zückte, der erhielt von diesem einen Faustschlag, daß er mit zerschmetterter Kinnlade im Wasser verschwand; wer gegen ein Mädchen die Pistole erhob, der sank im nächsten Augenblick mit einem Schmerzensschrei zurück. Nicht ein einziger der Indier erreichte das Ufer; das blutgefärbte Wasser schwemmte ihre Leichen mit fort.
Fünf Minuten hatte dieser Kampf nur gewährt, dann standen die Geretteten wieder am Ufer, zwar mit Wunden bedeckt, aber doch frei. Die Gefühle, die ihre Herzen erregten, als sie sich nun die Hände schüttelten, lassen sich nicht beschreiben.
Der erste, der an die Zukunft dachte, war Harrlington.
»Was nun?« fragte er seine Genossen. »Frei sind wir zwar, aber wir haben wenig Aussicht, uns lange dieser Freiheit zu erfreuen. Wie ich vorhin gehört habe, ist Fort Sabbulpore bereits vom Rajah genommen, so können wir also dort keine Hilfe erwarten.«
»Was brauchen wir Hilfe?« entschied Ellen. »Wir sind fünfundfünfzig Personen, alle bewaffnet wenn auch schlecht. Unsere erste Pflicht ist, dem Rajah die Gefangenen abzujagen. Ich möchte doch diese Indier sehen, wenn wir einige Salven auf sie abgeben, sie würden unserem Angriff nicht lange stand halten.«
»Wir wissen aber nicht, wohin sich der Rajah gewendet hat,« entgegnete Harrlington dem feurigen Mädchen. »Nein, wir wollen erst das Fort Sabbulpore den Indiern wieder nehmen, unmöglich ist dies nicht. Die Feinde glauben uns weit entfernt und sich in Sicherheit, und wenn wir dann wie ein Gewittersturm bei Nacht hervorbrechen, so halten sie uns für englisches Militär, und die Ueberraschten werden nicht lange Widerstand leisten!«
»Aber der Oberst, Rosa und die gefangenen Offiziere?«
»Entweder sind diese bereits im Fort, oder wir erfahren doch wenigstens dort, wo sie gefangen gehalten werden.«
Alle übrigen waren mit diesem Vorschlag einverstanden und traten, nachdem sie sich die beim Kampf empfangenen Wunden notdürftig verbunden hatten, ohne Säumen den Rückweg an. Harrlington kannte die Gegend einigermaßen von früherher und diente als Führer.
Schnell, aber vorsichtig bewegte sich der Zug vorwärts, ebenso, wie vorhin ihre Wächter, um jedes Dorf einen großen Umweg machend, damit die Kunde von ihrer Befreiung und Rückkehr ja nicht vor ihnen nach Sabbulpore käme und somit ihr beabsichtigter Plan vereitelt würde.
Es war Nachmittag, als sie in der Ferne die Bergfestung liegen sahen, und es wurde beschlossen, bis zum Anbruch der Dunkelheit sich in einem mit Unterholz dicht bewachsenen Wäldchen verborgen zu halten und sich auszuruhen, um zu dem in der Nacht vorzunehmenden Wagnis Kräfte zu sammeln.
Harrlington bat zwar, die Damen möchten sich nicht bei der Ueberrumpelung des Forts beteiligen, sie könnten sich auch dadurch sehr nützlich machen, daß sie den Stürmenden den Rücken deckten, aber er wußte schon vorher, daß er dabei auf Widerstand stoßen würde. Nicht nur die Mädchen, sondern auch die meisten seiner Freunde verwarfen diese Bitte, ja, sogar Hastings, der sonst von den Fähigkeiten des weiblichen Geschlechtes etwas geringschätzend dachte, erklärte dem Lord ganz energisch, daß er seit dem Kampf im Fluß die Vestalinnen vollständig als ihm ebenbürtig betrachte und jede Zurücksetzung derselben als eine Beleidigung gegen sich selbst auffasse.
Als die Dunkelheit einbrach, rüsteten sich die Genossen zum Kampf. Noch einmal verbanden sie sich die Wunden, setzten die Waffen in stand und schlichen sich an das Fort heran. Ein richtiger Kriegsplan, wie sie einen heftigen Angriff mit List verbinden wollten, sollte erst kurz vor dem Beginn des Kampfes besprochen werden.
Plötzlich hemmten die Vorausgehenden ihren Schritt und deuteten nach einer bestimmten Stelle. Deutlich konnte man wahrnehmen, daß dort einige Feuer brannten, und beim Näherschleichen bemerkte man, daß man nicht, wie man erst annahm, Wachtfeuer von Eingeborenen vor sich hatte, sondern daß dort Gruppen von Weißen lagerten.
»Wer da?« hallte ein Ruf durch die Nacht.
Vor Harrlington sprang ein Mann auf und hielt das Gewehr gegen ihn.
Die Frage war auf englisch gestellt worden.
»Engländer,« entgegnete Harrlington freudig, »Gott sei Dank, wir treffen auf englische Soldaten.«
Wie waren sie aber erstaunt, als sie in einem der drei ihnen entgegenkommenden Männern Felix Hoffmann, den Kapitän des ›Blitz‹ erkannten, der hier mit vierzig Mann seines Schiffes lag!
Bald hatten sie sich verständigt; diejenigen der Engländer, denen die empfangenen Wunden am wenigsten hinderlich waren, brachen sofort unter Führung des Lord Harrlington nach Parahimbro auf, während sich die übrigen mit den Mädchen der Expedition Hoffmanns gegen die Festung von Sabbulpore anschlossen.
Noch herrschte im Walde Dämmerung; nur ab und zu stahl sich ein Strahl der goldigen Morgensonne durch das dichte Laub und ließ die Tautropfen an den Gräsern wie Diamanten aufblitzen, ein wundervoller Friede lag über der Natur, dessen Stille höchstens einmal durch das Zirpen eines Vogels oder auch den unartikulierten Schrei eines der vierbeinigen Waldbewohner Indiens unterbrochen wurde.
Jene Felsenburg, welche sich, von unten gesehen, wie ein am Abgrund hängendes Adlernest ausnahm, war dagegen schon vollständig den Strahlen der Sonne ausgesetzt, und schien auch deren belebende Kraft zu spüren.
Nicht wie in der Natur, in Wald und Feld, war hier etwas von Ruhe und Frieden zu bemerken; trotz der frühen Morgenstunde wandelten schon kriegerische Gestalten auf dem kleinen Burghof auf und ab; die Sonne ließ stählerne Helme und Brustpanzer erglänzen und spiegelte sich in den Kanonen, deren Mündungen überall durch Löcher in der Burgmauer in das unter ihnen liegende Thal lugten.
Das war das Sommerschlößchen Parahimbro, wie der Rajah Skindia den Engländern gegenüber diese Burg zu bezeichnen beliebte, eine Wohnung hoch in den Lüften, in deren kühlen Mauern er die heißen Sommermonate verträumen wollte, in Wirklichkeit aber eine starke Festung von Kanonen strotzend, und mit Munition, Lebensmitteln und allem Kriegsbedarf wohl versehen, sodaß sie jahrelang eine Belagerung hätte aushalten können.
Ihre Lage war eine vorzügliche. Die Geschütze beherrschten vollkommen den Eingang zum Thal, durch das der Weg nach Sabbulpore führte. Eine größere Abordnung von Soldaten hätte auf keiner anderen Straße nach dieser englischen Festung gelangen können, denn dieselbe lag mitten in den Bergen, deren Pässe durch eine Handvoll Leute gegen ein ganzes Regiment hätte verteidigt werden können.
Natürlich hatten die Engländer erkannt, welch ein wichtiger Punkt dieses kleine Parahimbro für einen Gegner, der sich hier festsetzte, werden konnte, und alle Ueberredungskunst aufgeboten, vergebens bewilligten sie zum Ankauf die größte Summe. Skindia schlug alle Anerbieten kurzweg ab mit der Erklärung, diese Burg habe einst seinen Vätern gehört, und auf dieser Stelle wolle er sich ein neues Schloß bauen.
Wirklich begann er ein solches auszuführen. Aber die Mauern dazu nahmen eine Stärke an, als wären sie für einen Pulverturm bestimmt. Während der Nacht wurden auf dem schmalen Felspfad verhüllte Gegenstände emporgeschleppt, unter deren Gewicht die hölzernen Rollen stöhnten, und nicht alle der im Thale haltenden Wagen waren mit Holz und Steinen beladen, sondern oft trugen die Arbeiter stundenlang auf dem Rücken Kisten und Säcke den Berg hinauf.
War es dem Rajah gelungen, sich unbemerkt in Parahimbro eine kleine Festung zu schaffen, so war er somit in den Besitz eines uneinnehmbaren Platzes gekommen. Ein einziges Geschütz allein fegte mit einem Schuß den schnurgeraden Pfad, an dessen beiden Seiten der bodenlose Abgrund gähnte, rein; kein gegenüberliegender Felsen bot einen Punkt, wo ein feindliches Geschütz aufgefahren werden konnte, und von der Seite, wo dies möglich gewesen wäre, wurde die Festung von einer hoch emporsteigenden Felswand geschützt.
Parahimbro lag also nicht auf der Spitze eines Berges, sondern an der Seite desselben. Vor ihm öffnete sich die Tiefe, hinter ihm erhob sich die Wand, welche den Turm des Schlößchens noch zwanzig Meter überragte und die nicht einmal ein Steinbock, geschweige denn ein Mensch erklimmen konnte.
Skindia und Abudahm befanden sich in einem Turmgemach, durch dessen kleine, runde Fenster man den Weg zur Festung übersehen konnte, der vom Thal bis zum Burgthor führte, wo er durch eine tiefe, künstlich erzeugte Kluft gehemmt wurde, die nur beim Niederlassen einer Zugbrücke den Weitergang erlaubte.
Beide waren sehr aufgeregt. Bald traten sie ans Fenster und blickten angelegentlich in die Ferne, als erwarteten sie sehnsüchtig jemanden, dann maßen sie wieder mit ihren Schritten die Länge des Zimmers.
»Wo bleibt nur Achmed?« fragte endlich der Rajah den jungen Indier in kriegerischem Kostüm.
Es war eine überflüssige Frage, denn Abudahm erwartete ebenso wie der Rajah den Ebengenannten. Es war dies die erst vor einigen Tagen neuangenommene Ordonnanz des Obersten.
»Ist der Bursche auch sicher?« entgegnete Abudahm. »Ich wunderte mich schon, daß du einem Manne, den du nicht weiter kennst, einen solchen Posten anvertrautest. Wer bürgt dir, daß er nicht zu den Engländern hält?«
»Ich glaube doch, daß er damals Majuba zum Schweigen gebracht hat, ist ein genügender Beweis seiner Treue zu uns,« war die Antwort Skindias. »Allerdings kenne ich ihn nicht, aber die Zeugnisse, mit denen er vom Rajah Dadur an mich gewiesen wurde, sprachen zu seinen Gunsten, und ich habe bis jetzt noch nie zu bereuen gehabt, ihm vollständig vertraut zu haben.«
Wieder trat eine lange Pause ein.
»Was hast du mit den Gefangenen vor, Skindia?« fragte der junge Indier endlich.
»Ich behalte sie als Geißeln, bis die Engländer die von uns gestellten Bedingungen bewilligen. Thun sie es, so sind jene frei, selbst mein Haß gegen Walton muß der Sache des Vaterlandes weichen; nehmen sie den Kampf auf, gut, so werde ich meinen Rachedurst befriedigen können.«
»Und warum nahmst du nicht, wie ich dir vorschlug, einige der amerikanischen Damen oder jener englischen Reisenden mit nach Parahimbro? Je mehr Geißeln du hier hast, desto besser für uns.«
»Es ist nicht gut, alle zusammen zu behalten, je getrennter sie untergebracht sind, desto mehr Sicherheit bietet sich uns, sie in Gewahrsam zu halten. Doch sage, Abudahm, was treibt dich dazu, ein solches Augenmerk auf diese Mädchen zu richten? Als wir uns gestern berieten, ob wir sie mit nach Parahimbro nähmen oder nicht, wurdest du bei meiner abschlägigen Antwort so aufgebracht, daß ich fast glaube, du hast einen anderen Grund, als nur den, die Mädchen hier als Geißeln festzuhalten.«
Der Rajah heftete seine Augen fest auf Abudahm, aber dieser lächelte spöttisch.
»Thorheit, Skindia, was anderes sollte mich dazu bewegen, als die Sorge für unsere Sicherheit? Endlich,« rief er dann aus und deutete dabei durch das Fenster auf den Pfad, »Evelyn hat ihn sehr spät geschickt.«
Nach einigen Minuten trat die frühere Ordonnanz des Obersten Walton ins Zimmer, jener Indier, den der Detektiv Williams zur Beobachtung empfohlen hatte.
Schweigend, mit finsterem Blicke blieb er an der Thür stehen.
»So sprich doch!« fuhr Abudahm ihn an. »Ist Sabbulpore in unseren Händen? Wir hörten doch die Schüsse knallen.«
»Wohl war es unser, die englische Flagge war in den Staub getreten, aber sie ist es nicht mehr; seit heute morgen flattert sie wieder vom Turme.«
»Was soll das heißen?« fragte der Rajah erschrocken. »Erkläre dich deutlicher, du sprichst in Rätseln!«
»Das soll heißen,« fuhr der Bursche zähneknirschend fort, »daß Sabbulpore wieder im Besitz der Engländer ist.«
»So haben sie sich wieder befreit?« stießen beide gleichzeitig hervor.
»Nein. Wir hatten die englische Besatzung des Forts überwältigt, es war unser, nur wenig Mühe haben wir dabei gehabt. Kurz zuvor wurde der indische Bursche des Kapitäns O'Naill – er war ein verkleideter Engländer – bei einem Verrate ertappt und gefesselt in einem Kellerraum gehalten. Von dort aus muß er auf eine mir unbegreifliche Weise entsprungen sein und –«
Der Bursche hielt inne.
»Und was?«
»Und Evelyn mit fortgeschleppt haben.«
»Evelyn?« rief Abudahm mit zitternden Lippen.
»Dann hat der Entsprungene Hilfe herbeigeholt und mit List – kein Schuß ist dabei gefallen – uns die Festung wieder abgejagt. Unsere Soldaten liegen gebunden im Burgverließ.«
»So ist ein Teil meines Planes zu nichte geworden!« stöhnte der Rajah.
»Wer waren die, die die Burg gestürmt haben? Doch unmöglich englische Soldaten?«
Achmed lachte höhnisch, er schien sich an dem Schrecken der beiden zu weiden.
»Nicht englische Soldaten waren es, die meisten waren Weiber, jene Mädchen, die Ihr gestern gefangen haben wollt.«

Der Rajah und Abudahm sahen sich entsetzt an. Wollen denn diese schlimmen Nachrichten gar nicht aufhören? So wären also alle Mühen und Vorbereitungen völlig umsonst gewesen?
»Sprich weiter, Unglücksbote! Waren die Weiber allein? Wie entkamst du? Warum kommst du erst jetzt, da die Sonne bereits hoch am Himmel steht?«
»Nur meiner Schlauheit habe ich es zu verdanken, daß nicht auch ich als Gefangener in die Hände der Sieger fiel. Gewiß ist es, daß jener verkleidete Indier die Männer und Weiber getroffen hat, welche sich auf irgend eine Weise befreit haben, nach dem Fort zurückkehrten, und uns nur wenige Stunden darnach wieder daraus verjagten. Die Wachen wurden lautlos überrumpelt, der Burgwall überstiegen, und ehe unsere Brüder nur nach den Waffen greifen konnten, lagen sie schon mit gebundenen Armen am Boden. Ein Zufall war es, daß ich den Eindringenden entgangen bin, obgleich gerade nach mir, wie ich fest glaube, eifrig gesucht wurde.«
»Evelyn ist verschont geblieben?« fragte Abudahm.
»Die ist wohl aufgehoben. Und nun der Grund, warum ich mich so verspätet habe! Ich eilte während der Nacht hierher; da führte mein Weg mich durch einen Wald, und wie ich über eine vom Mond beschienene Blöße rannte, bemerkte ich plötzlich einen frisch aufgeworfenen Erdhügel. Es war nicht nur Neugier, die mich zwang, ihn zu öffnen, eine Ahnung gab es mir ein, und was glaubt Ihr, wessen Leiche ich dort in der Erde eingescharrt gefunden habe?«
»So sprich doch, war es einer deiner Kameraden?«
Der Indier schüttelte den Kopf und sagte, die Augen fest auf Abudahm gerichtet:
»Evelyn.«
Waren die beiden schon vorher wie niedergeschmettert gewesen, so brachen sie jetzt unter der Last der neuen Hiobsbotschaft, daß Evelyn, eine Hauptstütze der angezettelten Verschwörung, getötet worden sei, jedenfalls aber erst, nachdem sie alles verraten, völlig zusammen. Mit glanzlosen Augen sahen sich die zwei Indier an.
Endlich sagte Abudahm mit tonloser Stimme:
»So ist keine Aussicht auf Rettung mehr vorhanden.«
»Nein,« rief plötzlich der Rajah mit wildem Jubel, »zu Ende ist unsere Herrschaft, unser Befehlen hat aufgehört. Nicht lange wird es dauern, so wird man die Söhne der einstigen Herrscher Indiens gefesselt vor das Tribunal führen, weil sie ihr Land befreien wollten. Aber noch eine süße Stunde wartet meiner; ist alles verloren, so will ich wenigstens die Gefangenen zur Hölle schicken.«
Er gab Achmed den Auftrag, dieselben auf den Burghof führen zu lassen, und besprach sich inzwischen noch mit Abudahm.
»Sagte ich es nicht, Rajah,« begann dieser, aus dessen Gesicht jeder Blutstropfen gewichen war, »daß du viel zu voreilig gehandelt hast, als du das Fort Sabbulpore nehmen ließest? Alles wäre gelungen, niemand hätte einen Argwohn gefaßt, wenn du ruhig gewartet hättest, bis wir die Nachricht bekamen, daß auch die übrigen Rajahs zum Aufstand bereit seien. Aber nein, du konntest die Zeit nicht erwarten und hast alles, alles vernichtet.«
»Die Gelegenheit war zu günstig,« entgegnete Skindia, »den größten Teil der Offiziere in die Hände zu bekommen, sowie möglichst viele Geißeln zu machen. Sage selbst, war die Einnahme des Forts und die Uebergebung der Geschäfte des Obersten an Evelyn nicht ein kluger Plan von mir? Nur diese verfluchten Fremdlinge haben ihn zerstört!«
»Was aber nun?«
»Es ist aus,« rief der Rajah verzweifelt und stampfte mit dem Fuße den Boden, »wir haben unsere Rolle ausgespielt. Wir wollen unser Leben so teuer wie möglich verkaufen, und wenn die Rotjacken Parahimbro stürmen, so soll noch mancher von ihnen Indiens Boden mit seinem Blute färben.«
»Welches ist unser Los, wenn wir uns ergeben?«
Der Rajah lachte grimmig auf.
»Schmach und Schande! Aber ehe dies geschieht, fliegt Parahimbro in die Luft; kein Stein soll den Engländern übrig bleiben. Doch wird noch einige Zeit vergehen, ehe ein Angriff möglich sein wird; mindestens sechs Tage müssen verstreichen, ehe Militär hier erscheinen kann, und bis dahin werde ich mein Möglichstes thun, die trägen Häuptlinge zur Eile aufzumuntern. Jetzt laß uns in den Burghof gehen, der Anblick des gefesselten Obersten soll meinen Augen wohlthun. Ha, wie will ich mich weiden an seiner ohnmächtigen Wut!«
Sie gingen.
Auf dem Hofe standen fünf englische Offiziere, die Hände auf dem Rücken gebunden, unter ihnen Oberst Walton und Kapitän O'Naill.
Man hatte sogar den verwundeten Leutnant Werden nicht vergessen, er lag auf der Bahre, die neben der hohen Brüstung stand.
Rosa war frei. Bald eilte sie zu ihrem einstigen Beschützer, Oberst Walton, der ihr der zweite Vater geworden, und sprach ihm Trost zu, dann ging sie wieder zu Werden zurück, der nur ihr es zu verdanken hatte, daß er noch am Leben war.
»Mut, Leutnant,« sagte sie zu ihm, »unsere Lage ist nicht so schlimm wie sie aussieht. Wir werden nur als Geißeln hier behalten, um den indischen Offizieren Sicherheit zu bieten, wenn sie mit den unsrigen unterhandeln. Wenn wir entlassen werden, sind Sie wieder gesund und können den ersten Kampf bestehen, nach dem sie sich so sehnen.«
Schmerzlich lächelnd hatte der junge Offizier den Worten des Mädchens zugehört, das seine eigene Lage vergaß, um ihn zu trösten; er war sich über das Schicksal, das ihrer wartete, nicht unklar.
»Miß Walton,« entgegnete er, »wenn Sie von jemandem Abschied nehmen, und Sie wissen, daß er nicht wiederkommt, machen Sie ihm dann Hoffnung auf ein Wiedersehen, sodaß er dieses stets herbeisehnt und immer umsonst, oder sagen Sie ihm nicht vielmehr für immer Lebewohl?«
Das junge Mädchen hatte ihn verstanden. Sie barg das Gesicht in ihren Händen und begann zu schluchzen.
Der junge Mann legte leise den unverletzten Arm um ihre Taille.
»Ich weiß, Rosa,« fuhr er fort, »daß wir uns beide schon längst geliebt haben, wenn wir auch nie den Mut fanden, es uns zu sagen. Die letzte Stunde meines Lebens will ich noch dazu benutzen, dir dieses zu gestehen. Ja, ich liebe dich, Rosa, und der Tod soll meine Liebe zu dir nicht aufhören machen. Sage mir nur ein Wort, kein Wort des Trostes, ich bedarf seiner nicht, aber ein Wort der Liebe!«
»John,« schluchzte das Mädchen. Es kniete neben der Bahre nieder und küßte wieder und wieder den bleichen Mund. »Sprich nicht so, jetzt soll ja unser Leben erst beginnen, und du sprichst vom Tode. Was ist denn weiter, wenn wir gefangen gehalten werden; einmal müssen sie uns doch freigeben!«

»Ich glaube es nicht; der Rajah ist nicht der Mann, der seine Gefangenen freigiebt, wenn er nicht Vorteil davon hat. Und, Gott sei Dank, unser Vaterland weiß, daß wir uns lieber Mann für Mann hinschlachten lassen, ehe wir einwilligen, daß es unseretwegen auf unverschämte Bedingungen einginge.«
Der junge Offizier hatte die letzten Worte stolz ausgerufen, dann fuhr er wieder wehmütig fort:
»Also darum, mein liebes Mädchen, wollen wir uns keine Hoffnung machen. Ich kenne den Rajah und weiß, daß uns der Tod beschieden ist.«
Das junge Mädchen neigte sich zu dem Ohr des Verwundeten:
»Wenn uns das Leben nicht vereinen kann, dann sterben wir zusammen,« flüsterte sie zärtlich.
Werden drückte ihr mit einem glücklichen Lächeln die Hand.
»Sieh', Rosa!« sagte er dann. »Der Oberst will dich sprechen. Auch er will Abschied von dir nehmen, denn nicht umsonst hat uns der Rajah auf den Burghof führen lassen.«
Seufzend blickte Werden dem Mädchen nach, als es zum Obersten ging.
Diesen eben erlebten Augenblick hatte er sich lange ersehnt, oft ihn sich ausgemalt; nun war er endlich da, aber ach! unter welchen Verhältnissen! Denn kaum hatte er sein Glück gefunden, so mußte er es schon wieder verlieren.
»Rosa,« sagte der Oberst zu seinem Liebling, »die Zeit ist kurz, welche wir für uns übrig behalten. Gieb dich nicht mit thörichten Hoffnungen ab, mein Kind! Versuche nicht, mich zu trösten! Ich kenne den Rajah Skindia, er wird unser Leben nicht schonen, und am wenigsten das meinige, denn er haßt mich und hat schon lange auf eine Gelegenheit gewartet, seinen Rachedurst an mir zu stillen. Wenn jemand verschont bleiben soll, so bist du es; vielleicht erheben einige der indischen Offiziere Einspruch, wenn er auch dich seinem Hasse gegen mich opfern will. Doch sprich, was hattest du vorhin mit Leutnant Werden, Rosa?«
Weinend warf sich das Mädchen an des Obersten Brust.
»Wir lieben uns, Onkel, erst jetzt haben wir es uns gestanden.«
Die Augen des alten Offiziers füllten sich mit Thränen.
»So wird er der glücklichste von uns Männern sein, die aus dem Leben scheiden müssen. Gott will es, daß der Tod das auseinander reißt, was das Leben im letzten Augenblicke zusammenfügte, vertraue ihm, und sei ihm auch dafür dankbar.«
»Ich will und kann nicht glauben,« rief Rosa außer sich, »daß der Rajah etwas Schlimmeres mit uns vor hat, als uns gefangen zu halten. Was haben wir ihm gethan? Hat er nicht in unserem Hause verkehrt, haben wir ihn nicht stets wie einen lieben Freund behandelt, ihn und die anderen seiner Offiziere? O, der unerbittliche Krieg!«
»Der Rajah kommt und Abudahm,« sagte der Oberst bitter, »du wirst gleich hören, welche Freunde wir an ihnen gehabt haben.«
Der Rajah und sein Begleiter traten aus dem Turme.
Langsam, die Arme über die Brust gekreuzt, schritt ersterer auf den Obersten zu. Er hätte ihn schon vorher sprechen können, es aber bis jetzt noch nicht gethan; alles, was dieser Mann seinem Feinde sagen wollte, hatte er für einen Moment aufgehoben, und dieser war jetzt gekommen.
Höhnisch lachend blieb er vor dem Gefaßten stehen.
»Oberst Walton,« begann er, »endlich ist die Stunde gekommen, da ich mit Dir Abrechnung halten kann. Weißt du, was mich dazu trieb, dich bis zum Tod zu hassen, dem du jetzt nicht entgehen wirst?«
Diese Frage hatte der Oberst erwartet.
»Ich weiß,« entgegnete er kalt, »daß ich dich einst ins Gesicht schlug, weil Du mich beleidigtest. Eine andere Handlung, welche ich vor meinem Gott nicht verantworten könnte, habe ich nicht an Dir begangen.«
Wütend fuhr der Rajah auf. Das wollte er nicht hören, denn seine Offiziere standen um ihn herum und erfuhren so, daß er von dem Obersten gezüchtigt worden war.
»Lügner!« donnerte er.
»Du bist ein Lügner,« entgegnete ruhig der Oberst, »deine Behauptung, ich hätte deine Braut verführt, war eine Lüge. Nie hatte dir Lucille angedeutet, daß sie Dein Weib zu werden begehre, ja, sie hat mir oft gesagt, wie sehr sie dich verabscheute. Mit welchem Recht willst du also deine Behauptung verfechten, mit welchem Recht überhaupt Lucille deine Braut nennen?«
»Genug davon,« sagte der Rajah, dem es unangenehm war, in Anwesenheit seiner Leute Wahrheiten hören zu müssen, welche er nicht widerlegen konnte, »hier ist nicht der Platz, über diese Sachen zu sprechen.«
»Weshalb hassest du mich sonst?«
»Ich hasse Dich, wie jeden anderen Engländer, der in unser Land kommt, meine Brüder unterdrückt, aussaugt und sie in Armut zurückläßt, wahrend er selbst als reicher Mann dann in seine Heimat zurückkehrt und dort das Zusammengescharrte verpraßt. Mit welchem Rechte, frage ich dich nun, thut ihr dies?«
Ein beifälliges Gemurmel lief durch die Reihen der zuhörenden, indischen Soldaten; der Rajah wußte, wie man am leichtesten deren Unwillen erregen konnte.
Aber auch der Oberst schwieg verlegen; der Rajah hatte eine Frage gestellt, über deren Lösung so mancher Staatsmann und Gelehrte sich bereits den Kopf zerbrochen, und er war kein Grübler. Der Königin hatte er geschworen, mit Leben und Blut ihr Eigentum zu verteidigen, und sie war Kaiserin von Indien, also war es seine Pflicht, gegen diejenigen zu kämpfen, welche Englands Oberhoheit nicht anerkennen wollten.
»Sieh da,« frohlockte der Rajah, »du selbst findest keine Antwort auf meine Frage, obgleich du seit Jahren nicht nur zugesehen, wie wir Indier geknechtet worden sind, sondern uns selbst als Kerkermeister bewacht hast.« Wieder entstand ein Gemurmel unter den Leuten, diesmal aber war es ein unwilliges. Der Rajah hatte seine Soldaten, auch die Offiziere bald soweit, wie er sie haben wollte, das heißt, bald mußten sie selbst den Tod der Offiziere verlangen.
»Habt ihr, du und deine Offiziere, nicht selbst der Kaiserin von Indien Treue geschworen,« fragte der Oberst, »du und deine Leute? Warum thatet ihr es, wenn ihr sie nicht als eure Gebieterin anerkennen wolltet?«
»Nennt sie nicht unsere Gebieterin,« brauste der Rajah auf, »sprich nicht von einem Schwur! Leisteten wir einen, so war er erzwungen, erpreßt mit einem Entweder oder, es hieß, entweder ihr leistet den Schwur und bleibt in eurer alten Würde und in euren alten Rechten, oder ihr werdet davon enthoben und bekommt ein Gnadengehalt, durch das ihr euch den Schein der mildthätigen Gerechtigkeit geben wolltet.«
Die Entrüstung der Umstehenden wuchs; seit langem hatten sie keine solche Gelegenheit gehabt, ihren Unwillen gegen die Engländer zu zeigen.
Der Oberst hielt es für unter seiner Würde, noch eine Antwort zu geben; seine Aufmerksamkeit wurde von etwas anderem in Anspruch genommen.
Er irrte sich nicht in seiner Wahrnehmung, im Walde blitzte es ab und zu zwischen den Büschen auf. Was mochte das sein? Bald hier, bald da, bald mehrmals an einer Stelle, dann wieder dicht daneben.
Der Oberst stand ebenso, wie die anderen Gefangenen mit dem Rücken der Felswand zugekehrt, die Indier dagegen um sie herum, sodaß sie den Wald nicht beobachten konnten. Der Offizier blickte seine Genossen an, ob auch sie die gleiche Wahrnehmung gemacht hätten, aber dieselben sahen teilnahmlos vor sich hin – doch ja, Horatio richtete plötzlich sein Auge auf den Obersten, und beide sahen sich einen Moment verständnisinnig an, auch er war auf die blitzenden Strahlen aufmerksam geworden.
Die beiden Offiziere wußten, was dieselben bedeuteten, es waren die von blanken Waffen reflektierten Sonnenstrahlen.
Doch ihnen persönlich konnte es nichts mehr nutzen, wenn auch dort ein ganzes Regiment von Soldaten gestanden hätte. Durch Sturm war Parahimbro nicht zu nehmen, selbst wenn die Mauern in Grund und Boden geschossen wurden, und der Indier stirbt lieber, ehe er sich gefangen giebt.
Hoffnungsvoll hefteten bald alle Gefangenen, nicht nur der Oberst, ihre Augen auf den Waldessaum. Ihr Gesichtsausdruck war ein so überraschter, daß sich auch die Indier umdrehten und in Rufe der Verwunderung ausbrachen.
Eben betrat ein Mann den schmalen Felsenpfad, scheinbar zu einem Spaziergang, waffenlos und einfach wie ein Reisender gekleidet. Ohne nur einmal den Schritt zu hemmen, ging er ruhig weiter, bis er etwa fünfzig Meter vor der Zugbrücke stehen blieb und den Arm erhob, zum Zeichen, daß er sprechen wolle. Er selbst konnte die im Fort Befindlichen nicht sehen, dazu war die Mauer zu hoch, aber sie konnten ihn durch die Kanonenpforten beobachten.
»Was will der Mann?« fragte der Rajah erstaunt. »Ein Faringi hier und waffenlos! Will er uns einen Besuch abstatten? Fast scheint es so! Laßt die Zugbrücke nieder, ich werde mit ihm sprechen.«
Rasselnd fiel die Zugbrücke herab, und der Rajah trat vor.
»Bist du der Rajah Skindia?« fragte ihn der Fremde auf englisch.
»Ich bin's, was geht es dich an?«
»Du hast die englischen Offiziere von Sabbulpore in diesen Mauern?«
»Ja, doch nochmals, was kümmert es dich? Bist du ein Engländer?«
»Nein, ich bin kein Engländer; aber jene Offiziere sind meine Freunde. Du hast sie zu einer Jagdpartie eingeladen, und sie sind nicht wieder nach dem Quartier zurückgekehrt. Warum nicht?«
»Weil sie meine Gefangenen sind. Und sie werden auch nicht wieder dahin zurückkehren,« antwortete der Rajah, den diese Unterhaltung, ebenso wie die anderen indischen Offiziere mehr belustigte, als ärgerte.
»Du hast sie hinterlistig gefangen genommen, ohne daß du es verantworten könntest. Ich verlange meine Freunde von dir, nichts weiter! Was du sonst gethan hast, geht mich nichts an.«
Der Rajah lachte laut auf.
»Du scheinst einer jener Reisenden zu sein, welche die Sonne Indiens nicht ertragen können und durch dieselbe auf allerhand seltsame Gedanken gebracht werden.
»Gehe heim, lieber Mann, und kühle deinen Kopf.«
Der andere blieb ungerührt durch diesen Spott.
»So wisse denn, Rajah Skindia,« sagte er und zog seine Uhr hervor, »daß ich dir eine halbe Stunde Bedenkzeit gebe. Ist die Frist verstrichen, und meine Freunde gehen nicht als freie Männer, mit den Waffen, die du ihnen genommen hast, über die Zugbrücke, so nehme ich die Festung im Sturm.«
Er drehte sich um und ging ruhig den Weg zurück, begleitet von dem unaufhörlichen Gelächter der Indier, bis er im Walde wieder verschwand.
»Er ist verrückt,« sagte achselzuckend der Rajah und wandte sich wieder dem Obersten zu. Er war jetzt ärgerlich darüber, daß die Dazwischenkunft des Fremden bei seinen Leuten eine heitere Stimmung hervorgerufen, er hatte das Gegenteil derselben erzielen wollen.
»Nun wieder zu dir,« begann er, »du hast –«
Ein Geschrei unterbrach ihn. Einige Soldaten waren auf die Mauer gesprungen und zeigten mit der Hand nach dem Waldrand, und was man da unten sah, war allerdings geeignet, Bestürzung bei den Indiern, Freude bei den Gefangenen zu erwecken.
Eben kam der Fremde wieder aus dem Walde und hinter ihm, o Wunder, folgten etwa vierzig Männer in Reih und Glied geordnet, das Gewehr vorschriftsmäßig über der Schulter und an der Seite einen Hirschfänger. Gekleidet waren sie in graue Leinwandanzüge und auf den Köpfen trugen sie breitkrempige Strohhüte. Am Fuße des Weges kommandierte der mit einem Degen bewaffnete Führer etwas, und gleichmäßig wurden die Gewehre abgenommen und bei Fuß gesetzt.
Die besten Soldaten hätten nicht besser exerziert.
Die Gefangenen konnten sich diese Erscheinung nicht erklären. Daß Fort Sabbulpore in die Hände des Rajahs gefallen war, hatten sie heute schon unzählige Male hören müssen, aber nicht, daß es ihm bereits wieder abgejagt worden war, ebensowenig, daß sich die anderen Gefangenen befreit hatten. Ueber das eine aber waren sie sich klar, daß die dort – es mochte wohl irgend eine Gesellschaft von Reisenden sein – eine große Thorheit begingen, wenn sie das Fort wirklich stürmen wollten, sie mußten keine Ahnung von der Befestigung Parahimbros haben, denn selbst wenn ihre Zahl zehnmal größer gewesen wäre, hätte doch keiner die Hälfte des Weges lebend zurückgelegt. Den Fremden kannten die Engländer nicht.
Den Indiern entlockte der Anblick dieser Vorbereitung der Leute erst ein Hohngelächter, dann aber entrang sich ihnen ein Wutschrei.
Jedenfalls waren diese Männer verkleidete Soldaten, vielleicht die befreiten Engländer, und im Walde steckten noch einige hundert zu ihrer Unterstützung. Ihre Vermutung, daß die englischen Fremden dabei waren, bestätigte sich, als zwischen den Bäumen einige helle Frauengewänder sichtbar wurden.
»Mögen die Thoren kommen!« rief der Rajah, der jetzt die Leute in der Stimmung glaubte, in der er sie haben wollte. »Vor die Kanonen mit den Gefangenen, wir wollen sie ihren Freunden entgegensenden!«
Ein Jubelschrei begrüßte diesen Befehl, nicht einer war unter den Indiern, der ihn nicht gern gehört hätte.
Die Gefangenen waren Männer, deren Degen schon oft das Blut von Rebellen gefärbt hatte; sie glaubten keine Todesfurcht mehr zu kennen, aber jetzt durchlief doch ein Schauder ihren Körper, aber ihre Mienen blieben unbeweglich.
Im Nu waren sie von den Indiern ergriffen, die Kanonen wurden etwas zurückgezogen, und im nächsten Augenblick waren vor fünf Rohre, deren Mündungen in der Richtung des Weges zeigten, ebensoviele englische Offiziere gebunden.
»Onkel!« schrie in herzzerreißendem Jammer Rosa und wollte an die Brust des alten Mannes stürzen.

Mit roher Faust wurde sie beiseite geschleudert, sodaß sie dicht vor der Bahre des verwundeten Werden zu Boden fiel.
»John,« rief sie weinend und schlang die Arme um den Hals des Leutnants, »giebt es denn noch einen Gott, daß so etwas geschehen kann? Bleibt die Sonne denn noch wirklich am Himmel stehen? John, mein lieber John, sag' mir, daß ich nur träume, oder ich werde wahnsinnig!«
Des jungen Mannes Augen füllten sich mit Thränen, stöhnend richtete er sich halb auf, die Fäuste geballt.
»Mein Gott,« knirschte er, »warum muß ich hier als elender Krüppel hilflos liegen und zusehen, wie meine Kameraden sterben? Warum kann ich nicht mit ihnen den Tod finden?«
Kraftlos brach er wieder zusammen.
»Clarence,« murmelte Horatio unhörbar, »lebe wohl, meine süße Braut, bis wir uns einst wiedersehen werden.«

Unterdes war unten am Wege der Fremde vor den Reihen der etwa vierzig Mann auf- und abgegangen und hatte manchmal nach der Uhr gesehen. Jetzt zog er den Degen und kommandierte, die Flinten wurden auf die Schultern genommen, und die Leute schwenkten ab, um zu zweien den schmalen Weg zu beschreiten, voran der Fremde, den bloßen Degen in der Hand.
Da kam auch noch Unterstützung aus dem Walde – doch nein, es waren nur Frauen, welche sich den Sektionen anschlossen. Alles ging so gemütlich vor sich, als gälte es, einen Spaziergang nach einem Aussichtsthurm zu unternehmen. Die Entfernung war noch viel zu weit für eine Flintenkugel, aber nicht für eine Granate.
»Sie sind es,« rief der Rajah, »die Engländer, welche sich befreit haben und ihre Gefährtinnen. Diesmal werden sie uns nicht entgehen.
»An die Geschütze!«
Die mit der Bedienung der Kanonen betrauten Indier sprangen auf ihre Posten, je einer ergriff eine Abzugsleine, bei deren Ruck der Zünder der Granate aufflammt und diese dem Rohr entfliegt.
Rosa vergrub ihr Gesicht an der Brust des jungen Leutnants, im nächsten Augenblicke mußte der Donner der Geschütze die Festung erbeben machen, die Körper seiner Kameraden wurden in Atome in die Luft geschleudert und jene wagehalsigen Fremden deckten als zerfetzte Leichen den Weg.
Aber die erwartete Katastrophe blieb aus.
Noch ehe der Rajah seinen Mund zum Kommando ›Feuer‹ öffnete, ertönte der peitschenähnliche Knall einiger Büchsen, und wie vom Blitz getroffen sanken die an der Abzugsleine stehenden Soldaten zu Boden.
Entsetzt schauten sich die Indier an. Wer hatte gefeuert, welche von ihnen? Die abergläubischen Indier getrauten sich nicht, sich zu rühren, um wieviel weniger, die Leine wieder in die Hand zu nehmen.
Da deutete einer der Offiziere, der kaltblütigste von ihnen, nach der im Rücken sich über ihnen erhebenden Felswand. Alle wandten die Augen dorthin und sahen etwa ein Dutzend Köpfe über der Wand, den Kolben der Büchse an der Backe.
»Der Felsen ist erstiegen,« rief der Offizier, »herum mit den Kanonen.«
Jetzt löste sich der Bann, der noch auf den Indiern gelegen. Es waren keine Geister, sondern Menschen. Sie stürzten nach den freien Geschützen, mit ihnen der Offizier, aber nur einen Schritt vermochten sie zu thun.
Abermals knatterte eine Salve, und zwölf Leichname lagen am Boden, darunter der des Führers.
Die Ueberlebenden wagten sich nicht mehr zu rühren, sie hatten den zwar nicht gesprochenen, aber deutlich genug gegebenen Befehl verstanden: wer eine Bewegung macht, ist eine Leiche.
»Alles verloren!«
Der Rajah wandte unmerklich den Kopf nach einer Schießscharte und sah, wie die bewaffneten Männer bereits draußen vor der Zugbrücke hielten. Es blieb ihm keine Zeit, darüber nachzudenken, wie sie wohl die Kluft überwinden würden, denn schon krachten zwei Schüsse, die beiden Taue zerrissen, und schmetternd schlug die Brücke nieder, über welche erst der Fremde und seine Leute, dann die Damen schritten.
Noch waren nicht alle der gebundenen Offiziere von den Kanonen geschnitten, als bereits eine weiße Gestalt auf den Obersten zuflog und an seinem Halse hing.
»Mein Vater!«
»Lucille, mein Kind!«
Mehr ward von ihnen nicht gehört. Selbst die erschrockenen Soldaten sahen nicht ohne Teilnahme auf den alten Mann, der da auf den Knieen lag und sein wiedergefundenes Kind umschlungen hielt.
Plötzlich erschollen auf der hölzernen Brücke die Hufe von Pferden, und in den Burghof sprengte ein hoher, englischer Offizier, begleitet von mehreren anderen.
Alle waren so mit der Szene zwischen Vater und Tochter beschäftigt gewesen, daß niemand gesehen hatte, wie im Thal ein Schwadron Kavallerie angerückt war, deren Kommandeur jetzt in den Hof ritt.
Der Offizier sprang vom Pferde und trat auf den Rajah zu, welcher nicht weit von dem Obersten stand und diesen und dessen Kind mit wutverzerrten Zügen betrachtete.
»Rajah Skindia,« rief der Offizier, »im Namen der Kaiserin von Indien, gieb mir Deinen Degen! Du und Deine Leute, Ihr seid verhaftet.«
Ein heiserer Schrei entrang sich der Kehle des Rajah, wie ein Blitz sprang er nach Lucille, war im nächsten Augenblick auf einer Kanone, neben welcher Rosa gelehnt hatte, und dann oben auf der Mauer, in jedem Arm ein Mädchen, mit halbem Oberkörper schon vornübergeneigt. Der Platz, wo eben Rosa gestanden, war leer.
»So schießt doch,« hohnlachte er, den Kopf zurückwendend, nur den gerade unter ihm liegenden Werden konnte er nicht sehen. »So schießt doch, Ihr verfluchten Engländer, hahaha!«
Keiner getraute sich zu rühren, kaum wagte man zu atmen, der Oberst war stöhnend in die Kniee gesunken – die Situation war entsetzlich.
»Oberst Walton,« fuhr Skindia mit gräßlicher Stimme fort, »glaubtest du schon gewonnen zu haben? Deine Freude war eine voreilige. Nahmst du mir das, was ich liebte, so nehme ich dir das deinige. Sieh her, wie sich ein Rajah noch im Tode zu rächen weiß.«
Ein einziger Schrei gellte von allen Lippen, Skindia, die beiden Mädchen an sich gepreßt, neigte sich vorn über, dem Abgrund zu.
Da wurde er von hinten am Gürtel gefaßt und ihm sein eigener Dolch in den Rücken gestoßen – über der Leiche Skindias lag ohnmächtig der junge Werden, den vom Tiger zerfleischten Arm um Rosa geschlungen.
Nick Sharp saß in einer Stube des Quartiers und blätterte in einem Notizbuch. Bald schrieb er etwas nieder, bald strich er etwas aus.
»Stimmt nicht,« murmelte er unwillig. »Seit der Liebelei mit diesem verfluchten Weib bin ich ganz konfus geworden.«
Es klopfte an der Thür.
»Herein!« rief Sharp und dachte nach. »Ist es Sir Williams, so kann er hierbleiben, ist es ein anderer, so schmeiße ich ihn hinaus.«
Marquis Chaushilm trat ins Zimmer. Der Detektiv schaute wieder in sein Buch.
»Guten Morgen, Steuermann, ist Kapitän Hoffmann hier?« fragte der junge Herzog den Detektiv, welcher allgemein als zweiter Steuermann des ›Blitz‹ galt.
»Sehen Sie einmal da unter der Kommode nach,« brummte der Gefragte, der wegen seiner furchtbaren Grobheit berühmt geworden war.
»Ich wollte dem Kapitän nur das Neueste erzählen,« fuhr aber der redselige Marquis unbeirrt fort. »Wissen Sie es schon, daß Abudahm erzählt hat, wenn ihm das Leben versprochen wird, so wolle er ein Geständnis von der größten Wichtigkeit machen?«
»Ist mir ganz egal.«
Der Detektiv fuhr zu rechnen fort.
»Ich möchte aber gern erfahren, was das eigentlich ist. Bedenken Sie einmal, er sagt, er könne durch ein Geständnis Tausenden von Europäern das Leben retten.«
»Dann mal los!«
»Jede Stunde wird das Schreiben vom britischen Gouvernement erwartet, welches ihm das Leben zusichert, wenn seine Aussagen wirklich sehr wichtig sind.«
»So.«
»Wir sind alle gespannt, wie –«
»Wie ein Regenschirm,« unterbrach ihn der Detektiv und klappte das Buch mit einer Heftigkeit zu, daß der Herzog zusammenfuhr.
»Meine Sprechstunde ist aus, Herr Marquis!«
»Aber Herr Steuermann –«
»Kein Wort weiter, meine Sprechzeit ist vorüber!«
Der Detektiv stand auf und öffnete die Thür.
»Bitte,« sagte er mit einer nicht mißzuverstehenden Handbewegung.
Das ging dem jungen Herzog doch über die Schnur.
»Ihre Grobheit ist denn doch etwas zu arg,« brauste er auf. »Ich bin der Marquis von Chaushilm, Sohn des Herzogs von Chaushilm, und wer sind denn Sie, daß Sie so mit mir zu sprechen wagen?«
»Ich bin der Steuermann Claus Uhlenhorst, zweiter Sohn des Kaisers von China,« konnte der Herzog noch hören, dann befand er sich schon auf dem Korridor, und die Thür fiel hinter ihm ins Schloß.
Chaushilm stand noch stumm vor Staunen mit ausgespreizten Fingern da, als sich die Thür wieder öffnete, und der Steuermann in wunderbar freundlichem Tone sagte:
»Lieber Herzog Chaushilm, ich bitte Sie, wenn Sie Sir Williams sehen, so sagen Sie ihm doch, er möchte einmal zu mir kommen. Ich bitte sehr darum!«
»So,« brummte der Detektiv und setzte sich wieder, »den wäre ich los. Weiter fehlte nichts, als daß mich der erste Beste hier mit seinem Schwatzen belästigen könnte. Hm, was mag denn dieser Abel oder Adam oder wie er heißt, eigentlich für ein furchtbares Geheimnis ausplaudern wollen? Na, werde es bald genug erfahren. Weiß Gott, da kommt wirklich Charles, der Herzog hat ihn also doch gerufen. Ja, mit Speck fängt man Mäuse.«
»Wissen Sie schon das Neueste, Uhlenhorst?«
Mit dieser Frage kam Charles in das Zimmer gestürzt.
»Ja,« antwortete der Gefragte und zog eine entsetzlich schmutzige Tabakspfeife aus der Tasche.
»Was heißt das?«
»Ich habe keinen Tabak mehr.«
Lachend reichte ihm der Baronet seinen gefüllten Beutel. Dann fuhr er ernst fort:
»Unser Fakir ist aus seiner Zelle entsprungen.«
»Was kostet von dem das Pfund?« fragte der Detektiv und stopfte die Pfeife.
»Fünfzig Pfund Sterling, wer ihn lebendig einliefert. Er wird von Abudahm als der Mörder Majubas bezeichnet.«
»Fünfzig Pfund Sterling kostet dieser Tabak, das ist ein bißchen viel, Williams,« meinte der Detektiv.
»Zum Teufel mit Ihrem Tabak!« rief Charles. »Ich spreche von dem Fakir und Majuba.«
»Zum Teufel mit allen Fiakern und Majoren, ich spreche aber von Tabak. Sie rauchen eine gute, doch viel zu leichte Sorte.«
»Himmel und Hölle!« Charles sprang erregt auf. »Wollen Sie mich vielleicht foppen, dann ist unsere Freundschaft aus! Hören Sie doch nur, unser Fakir ist entsprungen!«
»Nun fluchen Sie einmal etwas lauter und passen Sie auf, der Flüchtling kommt gleich wieder.« sagte der Detektiv und lehnte sich bequem in einen Stuhl. »Denken Sie denn etwa, ich fahre nun gleich in die Stiefeln, bürste den Hut ab, binde einen Shlips um und renne wie ein Wilder hinterher?«
Charles kratzte sich bedenklich hinter dem einen Ohr. Es war nicht das erste Mal, daß ihm der Detektiv eine Lehre gab. Jetzt war er schon wieder seinem Grundsatz: ›Weinen hilft nichts!‹ untreu geworden.
»Wie schön hätte das geklungen, mein lieber Williams,« fuhr der Detektiv fort, »wenn Sie hübsch langsam zu mir ins Zimmer gekommen wären und gesagt hätten, ›Guten Morgen, Herr Uhlenhorst, der Fakir ist fort, trinken Sie in der Kantine ein Glas Bier mit mir?‹ Na, schadet nichts, Williams, ich werde Sie schon noch zu einem brauchbaren Menschen ausbilden.«
»Es wird aber die höchste Zeit,« seufzte Charles, »ich werde mit jedem Tage älter.«
»Sagen Sie einmal, Williams, wie geht es Miß Thomson?«
»Danke, ausgezeichnet! Ich habe gesehen, wie sie heute morgen zum Frühstück, vier Butterbrote, zwei Scheiben Schinken, drei Scheiben Wurst und drei Eier gegessen hat.«
»Alles aufgegessen?«
»Nun, die Schalen nicht mit. Interessieren Sie sich dafür oder fühlen Sie Brotneid?«
»Hm, Sir Williams, wenn Sie einmal so einen Stellvertreter brauchen, Sie wissen schon, wie ich es meine, dann können Sie mich engagieren. Ich mache es billiger als alle anderen.«
»So etwas verbitte ich mir, Herr Uhlenhorst,« rief Charles, aber durchaus nicht aufgebracht.
»Und wie geht es dem jungen Werden? Das Kerlchen hat mir Respekt eingeflößt. Alle Wetter noch einmal, wie er den Rajah Dingsda so von der Mauer herunter holte, obwohl er kaum selbst auf den Beinen stehen konnte, das lasse ich mir gefallen. Ein sehr nützlicher Mensch! Wie geht's ihm?«
»Es macht sich, er erholt sich sichtlich.«
»Und Miß Rosa?«
»Die erholt sich neben ihm.«
»Und Lucille?«
»Die ist eine Seligkeit und Wonne.«
»Hinkt Ihr Pferd noch?«
»Nicht mehr so sehr.«
»Essen Sie lieber Weinbeeren oder Kokosnüsse?«
Charles sprang vom Stuhle auf.
»Nun ist es aber genug!« rief er. »Denken Sie vielleicht, ich lasse mich von Ihnen zum Narren halten? Ich bin weder ein Adreßbuch, noch ein Fragenautomat.«
»Nun, nun,« beruhigte ihn lächelnd der Detektiv, »sehen Sie, wenn ich über etwas nachdenken will, und es kommt jemand zu mir, der mich mit Redereien quält, so stört mich das ungemein; wenn ich aber Fragen stellen kann, deren Antworten ich nicht anzuhören brauche, so stört mich das durchaus nicht.«
»Ich danke sehr für diese Schmeichelei, aber warum in der Welt haben Sie denn da Chaushilm gebeten, mich zu Ihnen zu rufen?«
»Warum?« fragte der Detektiv erstaunt. »Das war doch gleich meine erste Frage. Ich wollte eine Pfeife Tabak von Ihnen haben.«
Da wurde die Thür aufgerissen, und Chaushilm stürzte ins Zimmer.
»Meine Herren,« rief er atemlos, »Abudahm ist ermordet in seiner Zelle gefunden worden. Ein Offizier hat ihn noch gesprochen, gerade als das Schreiben vom Gouvernement eingetroffen ist, und als er nach fünf Minuten wieder in die Zelle trat, um dem Abudahm diese Mitteilung zu machen, war er tot, er hat einen Dolchstich ins Herz bekommen.«
»Wer?« fragte der Detektiv.
»Abudahm. Das Merkwürdigste aber ist, daß er an der Stirn einen sonderbaren Stempel aufgedrückt bekommen hat.«
Der Detektiv hatte schon den Hut in der Hand.
»Ich muß gehen, sonst tragen sie heute noch ganz Sabbulpore fort und mich dazu. Vorwärts, meine Herren, ich will zuschließen!«
Ohne weiteres schob er die Herren zur Thür hinaus und schloß ab. – –
Eine Viertelstunde später schritt Charles durch den Garten des Quartiers, als er den Detektiv sich entgegenkommen sah, der unter dem Arm einen in Papier gewickelten Gegenstand trug.
»Halloh, Mister Uhlenhorst, was wollen Sie hier?«
»Nach dem Quartier. Kommen Sie mit?«
»Nein, ich warte auf jemanden.«
»So, na dann amüsieren Sie sich gut!« Der Detektiv wollte gehen.
»Was haben Sie denn da eigentlich?« fragte ihn Charles. »Das sieht ja fast wie eine Kegelkugel aus.« »Ist auch eine, ich will heute abend in meiner Stube Kegel schieben.«
»Aber hier kommt ja Blut heraus?« fragte Charles mißtrauisch.
»Ja,« meinte der Detektiv kaltblütig, »sie ist noch nicht ganz ausgetrocknet.«
Damit ließ er die Hülle fallen und hielt dem erschrocken zurückfahrenden Baronet das noch blutende Haupt des ermordeten Abudahm an den Haaren hin.
»Sharp,« stammelte Charles, »wozu denn das?«
»Ich interessiere mich für anatomische Präparate. Im übrigen, mein lieber Williams, wenn in einigen Minuten der Ruf erschallen sollte, daß dem Abudahm der Kopf gestohlen worden ist, so brauchen Sie nicht gleich meinen Namen zu nennen. Sie verstehen mich doch, nicht wahr?«
»Natürlich, ich weiß von nichts. Wenn Ihnen nun aber ein anderer als ich begegnet wäre und hätte Sie nach dem Inhalte des Pakets gefragt? Das herauströpfelnde Blut deutet auf nichts Gutes.«
Der Detektiv lächelte.
»Was Nick Sharp nicht sehen lassen will, das sieht niemand,« sagte er und ging.
In seinem Zimmer angekommen, schloß er sorgfältig die Thür ab und verhängte das Schlüsselloch mit einem Tuch, dann zog er sich die Jacke aus, streifte die Hemdsärmel auf und schälte den abgeschnittenen Kopf mit einer Vorsicht aus der Hülle, als wäre derselbe ein rohes Ei.
Lange betrachtete er das kleine Siegel, das auf dessen Stirn eingebrannt war.
Es stellte einen Galgen vor, um welchen herum die Worte ›Tod dem Verräter‹ standen.
»Nick Sharp,« sagte er endlich zu sich, »du bist einmal ein großer Esel gewesen. Diese Evelyn, die gar nicht so schwer zum Geständnis zu bringen war, hätte dir viel mehr von der Bedeutung dieses Siegels erzählen können. Aber nein, du bist damit zufrieden, daß sie Dir etwas über Lucille und die Gefangenen gesteht. Wer denkt auch gleich an alles, und ich fand überdies unter ihren Briefschaften nichts Verdächtiges. Also Abudahm und der Fakir gehörten auch mit dazu; merkwürdig, hier in Indien! Dieser Fakir war neuengagiert als Bursche von Oberst Walton, in der That aber vom Rajah angestellt, um den Obersten zu beobachten. Doch der Fakir hatte diesen Posten nur nebenbei angenommen, um wieder Abudahm zu beobachten, weil von diesem Verrat gefürchtet wurde. Von wem hatte aber letzterer einen Auftrag bekommen? Denn daß dies so ist, bin ich sicher, sein Streit mit dem Rajah verriet es. War derselbe eingeweiht oder nicht, war es Evelyn? Wer ist der Fakir, der jetzt seine Fesseln zum zweiten Male abstreift und einen Plaudernden zum Schweigen bringt? Ein undurchdringlicher Schleier verhüllt noch das Ganze; vielleicht, daß dieses Siegel mir ein Schlüssel zu manchem Geheimnis wird!«
Er legte den abgeschnittenen Kopf auf den Tisch und zog unter dem Bett einen Koffer hervor, dem er Papier und Instrumente entnahm. Dann fing er an, den eingebrannten Stempel auf das genaueste abzuzeichnen; fortwährend maß er mit dem Zirkel die Stärke, die Entfernung der Buchstaben, bis er den Stempel vor sich auf dem Papier zu seiner vollständigen Zufriedenheit wiedergegeben hatte.

»So,« sagte er endlich, »heute noch werde ich die Zeichnung in Kupfer ätzen.«
Er wickelte den Kopf Abudahms wieder ein und verbarg ihn so geschickt am eigenen Körper, daß an ihm nichts Auffallendes zu sehen war. Nachdem er sich dem Koffer ein Ledertäschchen, wie das Besteck eines Arztes aussehend, entnommen hatte, ging er auf den Hof.
Langsam, die Hände in den Hosentaschen, schlenderte er nach einem kleinen Gebäude, vor dessen Thür ein englischer Soldat mit geschultertem Gewehr auf- und abging. In diesem Häuschen lag die Leiche des ermordeten Abudahm.
»Ein langweiliger Posten, was?« redete der Detektiv den Soldaten an. »So jemanden zu bewachen, der doch nicht ausreißen kann.«
»Es ist der Dienst. Ob ich nun hier verwendet werde oder wo anders, ist mir gleichgiltig,« war die Antwort; »lieber ist mir aber schon, wenn ich in dem freundlichen Quartierhof sein kann, als zwischen den Festungsmauern.«
»Und dann sehen Sie immer fremde Gesichter, denn Abudahm wird wohl von vielen besucht?«
»Es ist nicht so schlimm, die Offiziere, wie die Gäste scheinen andere Dinge im Kopfe zu haben.«
»So? Wie viele sind denn zum Beispiel da gewesen, seit ich mir den Kerl angesehen habe?«
»Wie viele?« sagte der Soldat nachdenkend. »Auch nicht ein einziger.«
»Hm. hm.«
Der Detektiv nahm die Pfeife zwischen die Lippen und griff in die Tasche.
»Da habe ich vorhin meine silberne Streichholzbüchse drin liegen lassen, ich kann doch wohl noch einmal hineingehen?«
»Gewiß,« antwortete der Soldat.
Der Detektiv ging hinein und kam nach fünf Minuten wieder heraus.
»Ich habe sie höllisch lange suchen müssen,« sagte er, »sie war unter einen Schrank gefallen, und ich konnte sie nicht finden.«
In diesem Augenblicke kam Charles um die Ecke des Hauses gegangen.
»Sie hier, Mister Uhlenhorst? Ich wollte mir eben einmal den Abudahm ansehen. Kommen Sie mit?«
»Meinetwegen,« sagte der Detektiv und schickte sich an, abermals in das Haus zu treten.
»Sharp,« flüsterte Charles, als sie durch den kleinen schmucklosen Raum schritten, in welchem die Bahre mit dem Leichnam stand, »bis jetzt ist noch nichts laut geworden.«
»Was denn?« fragte der Detektiv unschuldig.
»Die Geschichte mit dem Kopf.«
»Mit welchem Kopf denn, mein lieber Williams? Sprechen Sie doch deutlicher!«
Sie standen jetzt beide vor dem mit einem Tuche bedeckten Leichnam.
Charles faßte das Tuch an einem Zipfel und schlug es zurück. Sein erster Blick fiel auf das fahle Antlitz des Toten.
»Was!« sagte Charles und prallte förmlich zurück, »der Kerl hat ja einen Kopf!«
»Nun ja,« lächelte der Detektiv kalt, »haben Sie Abudahm vielleicht jemals ohne Kopf herumlaufen sehen?«
Charles faßte die Haare des Schädels und zog daran, er untersuchte den Hals, aber er konnte nichts finden, was daran erinnerte, daß er vor einer halben Stunde den abgeschnittenen Kopf in den Händen des Detektiven gesehen hatte.
Kopfschüttelnd wendete er sich ab.
»Der Teufel mag wissen, wie das zugeht,« sagte er beim Hinausgehen, »ich kann es mir nicht erklären.«
Beide promenierten zusammen in den schattigen Gängen des Haines.
»Haben Sie schon mit Bestimmtheit erfahren, wann die Gäste von hier aufbrechen?« fragte der Detektiv.
»Einige Tage werden wohl noch vergehen. Die Wunden müssen doch erst etwas heilen, ehe die Gäste eine längere Reise zu Pferd machen können!«
»Wohin soll's denn gehen?«
»Habe keine Ahnung! Das machen die Damen unter sich aus.«
»Und die Herren rennen dann hinterher! Schönes Vergnügen das!«
»Wenns Ihnen nicht paßt, so kommen Sie eben nicht mit. Aber sagen Sie mal, um Gottes willen, mein lieber Uhlenhorst, wie haben Sie das eigentlich angefangen, den Kopf Abudahms abzuschneiden und ihn dann wieder so aufzusetzen, daß selbst meine vorzüglichen Augen keine Spur eines Schnittes feststellen konnten?«
»Taschenspielerkunststückchen, weiter nichts,« schmunzelte der Detektiv.
»Es wird mir ordentlich unheimlich in Ihrer Nähe,« meinte Charles. »Nächstens könnten Sie mir schließlich auch einmal in aller Freundschaft den Kopf abschneiden, und ihn dann wieder anleimen.«
»Unsinn,« brummte der Detektiv, »ich muß jetzt gehen, auf Wiedersehen heute abend! Erst geben Sie mir aber noch eine Pfeife Tabak.«
»Sehr gern! Haben Sie keinen mehr bei sich?« Charles reichte ihm den Beutel.
»Er ist mir ausgegangen, und der, den man hier in der Kantine zu kaufen bekommt, schmeckt mir nicht. Nur der Ihrige ist nach meinem Geschmack.«
Der Detektiv stopfte sich sorgsam seine Pfeife.
»So nehmen Sie sich eine Hand voll heraus,« meinte Charles, »ich habe genug mitgenommen.«
»O, ich danke,« entgegnete der Detektiv, schnürte den Beutel wieder zu und gab ihn zurück; »wenn ich keinen Tabak mehr auftreiben kann, komme ich zu Ihnen. Thanks, Sir Williams, auf Wiedersehen!«
Der Detektiv ging.
Charles schlenderte noch etwas in's Gebüsch hinein und warf sich unter einem schattigen Baum in das weiche Gras.
»Sharp hat eigentlich recht,« sagte er nach einer Weile zu sich, die Ellbogen auf den Boden gestützt und den Kopf in die Hände legend, »es ist ein rechter Unsinn, so immer hinter dem Mädchen herzulaufen, mir wird die Sache auch bald über. Ich werde einmal mit Sharp darüber sprechen, ob es nicht geht, daß ich auf eigene Faust die ganze Mädchengesellschaft auseinandersprenge, und mit Gewalt eins davon wegführe, das mir am liebsten ist. Dann mögen sie meinetwegen weiterreisen, ich gehe nach England, wo es jetzt schon hübsch kühl ist, setze mich mit meiner Frau vor das offene Kaminfeuer und lasse mir von ihr Indianergeschichten vorlesen – viel gemütlicher, als wenn man selbst mitmacht.«
Sinnend blickte er vor sich hin.
»Ein komischer Mensch, dieser Detektiv!« fuhr er dann in seinem Selbstgespräche fort. »Einmal ist er grob wie Bohnenstroh, nimmt jemandem, wenn er rauchen will und nichts hat, einfach die Pfeife aus dem Munde und pafft selbst weiter, und dann ist er so bescheiden, daß er nicht einmal eine Handvoll Tabak nehmen will. Als ob es mir auf ein paar Pfund ankäme.«
Er holte die Pfeife und den Tabaksbeutel hervor, um zu rauchen. Langsam griff er in den letzteren, doch plötzlich nahmen seine Züge einen verblüfften Ausdruck an; er sah in den Beutel.
»Jetzt hat mir der Kerl ein Taschentuch hineingestopft.«
Er zog dasselbe heraus.
»Da schlag' aber doch Gott den Teufel tot!« rief er. »Das ist auch noch dazu mein eigenes.«
Er drehte den Beutel um und schüttelte ihn in die leere Hand aus.
»Und mir hat er auch nicht ein Krümelchen Tabak übrig gelassen. Ein verfluchter Kerl, dieser Detektiv!«
Schellenbesetzte Tamburins rasselten; dumpfe Trommeltöne erschollen, und gellende Männerstimmen luden ein, der Vorstellung beizuwohnen.
Die Gäste eines Hotels in Madras, welche im Garten den Abend verbrachten, verließen ihre Stühle und strömten einem freien Rasenplatze zu, auf welchem eine Gesellschaft von indischen Gauklern und Schlangenbeschwörern Anstalten traf, sich mit Erlaubnis des Hotelsbesitzers den Gästen zu produzieren.
In der Mitte des Platzes stand ein kleiner, mit Leinwand überzogener Wagen, aus welchem die Gaukler die zu ihren Vorführungen notwendigen Gerätschaften auspackten.
Die Männer waren fast nackt; nur ein Tuch wand sich um ihre Hüften, sodaß die Zuschauer die muskulös gebauten und doch zugleich geschmeidigen Gestalten bewundern konnten. Einige zogen unter der Plane des Wagens Körbe aus Rohrgeflecht, Kästen und allerhand kleine Gegenstände hervor und bauten sie in einem Halbkreis auf, während andere rings am Boden hockten und mit Tamburins und langen, dünnleibigen Trommeln eine sehr unmelodische Musik erzeugten, um durch dieselbe die Aufmerksamkeit der Gäste zu erregen.
Von einer langen Tafel erhoben sich die Herren und Damen, welche sich bis jetzt unter heiteren Gesprächen die Zeit vertrieben hatten, und näherten sich der Gesellschaft der Gaukler.
»Geben Sie acht, Miß Petersen,« sagte ein junger Herr zu einer Dame, »Sie werden einer Zaubervorstellung beiwohnen, wie sie eine solche für alles Gold der Welt weder in Europa, noch in Amerika von einem Professor der Magie vorgeführt bekommen können. Gaukler treiben sich zwar in ganz Indien umher, aber die aus der Gegend von Madras sind die berühmtesten; sie gleichen selbst den Schlangen, welche sie abrichten.
»Wenn dies eine ebensolche Vorstellung wird, wie ich sie schon einmal mit ansah, so werden Sie wunderbare Dinge zu sehen bekommen.«
»Und Sie, Miß Thomson,« bemerkte ein Herr zu einer anderen Dame, »geben Sie acht, daß der Zauberer nicht etwas in seinen Rockärmel verschwinden läßt und es mir dann aus der Nase holt.«
Die Dame lachte laut auf, denn jene braunen Burschen dort waren nicht einmal im Besitze eines Hemdes, in dem sie etwas verbergen konnten.
Bald hatte sich um die Gaukler ein großer Kreis von Zuschauern gebildet; die Musikanten hörten einen Augenblick in der Bearbeitung ihrer greulichen Instrumente auf und begannen dann wieder mit großer Gewalt, bis sie plötzlich mit einem mißtönenden Akkord kurz abbrachen. In die Mitte des Kreises trat ein Mann, der in jeder Hand eine Holzplatte hielt.
Der kleine, wunderbar zierliche und doch muskulöse Indier, der überhaupt während der ganzen Vorstellung den Erklärer machte, setzte in fließendem Englisch auseinander, daß er mit einer Anziehungskraft ausgestattet sei, der zufolge alle hölzernen Gegenstände an ihm haften blieben, wenn er es wolle; den Beweis werde er an diesen beiden Holzplatten liefern.
»Alte Sachen,« meinte Charles, betrachtete aber ebenso wie die anderen eine der Platten. Sie waren ziemlich groß, die eine Seite rauh, die andere aber spiegelglatt und poliert.
Der Indier ließ seine Fußsohlen besichtigen, um zu zeigen, daß er keinen klebrigen Stoff daran habe. Dann legte er die Platten auf den Boden, trat darauf und begann unter den Klängen der Trommeln und Tamburins einen grotesken Tanz, ohne daß sich die Tafeln dabei gehoben hätten, da aber klatschte er in die Hände, und wie durch Zauber blieben die Holzplatten plötzlich an den nackten Füßen hängen.
Er sprang meterhoch, stampfte auf, überschlug sich, nichts konnte ihre Lage verändern. Ja, er ließ sich sogar von seinen Gefährten festhalten und die Zuschauer an den Tafeln ziehen – sie waren wie an die Füße genagelt.
Er ging nach der Mitte des Platzes zurück, hob ein Bein hoch, klatschte in die Hände, und das Holz fiel wieder vom Fuße ab, dann ebenso das andere. Kurz, er konnte nach Belieben die Platten an die Sohlen heften und wieder fallen lassen.
»Wie geht das zu?« fragte Ellen den Lord Harrlington.
»Es ist dies die Produktion, welche jede Vorstelluug einleitet, ebenso wie der Zauberkünstler bei uns zuerst seine Handschuhe verschwinden läßt. Der Indier dort, kann seine Fußballen hohl machen, dadurch wird, wenn er auf den glatten Hölzern steht, ein luftleerer Raum erzeugt, und die Platten bleiben haften.«
Der Gaukler ging nach den Körben, um sich zu seiner nächsten Produktion vorzubereiten, und zwei andere füllten die Zwischenpause mit ihren Leistungen aus.
Auf die Schulter eines Mannes von riesigen Umrissen stellte sich ein kleinerer von schmächtiger Gestalt, und beide begannen ein Spiel mit vierundzwanzig kupfernen Kugeln, welche sie in der Luft allerlei Figuren beschreiben ließen. Dann stellte sich der Oberste auf, den Kopf seines lebendigen Piedestals, dasselbe beugte sich mehr und mehr, während jener nach unten glitt, bis er selbst auf dem Kopfe stand und der Kleine auf jenes Füßen; das alles geschah, ohne das Kugelspiel dabei zu unterbrechen. Ebenso richtete sich der Große wieder auf, und der Kleine stellte sich mit dem Kopfe auf den des Partners, ohne sich dabei mit den Händen festzuhalten, denn diese mußten unausgesetzt die vierundzwanzig Kugeln treiben.
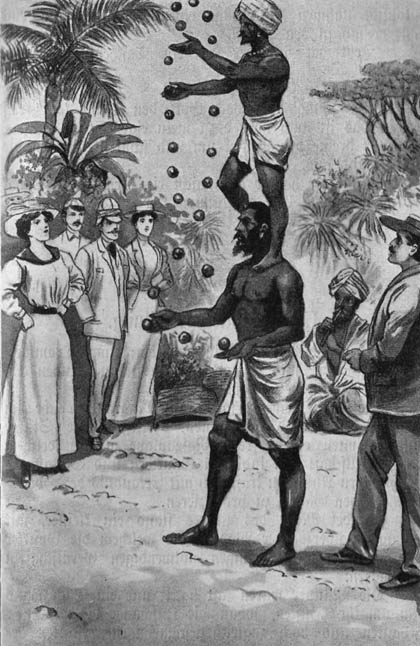
Ein Bravorufen belohnte diese fabelhafte Geschicklichkeit.
Jetzt kam der erste Indier wieder mit einem irdenen Krug, den er von Hand zu Hand wandern ließ, damit sich alle überzeugten, daß es nur ein ganz gewöhnlicher, gebrannter Lehmtopf sei.
Als er ihn zurückbekam, bog er sofort den Kopf zur Seite und goß sich aus demselben Topf, der völlig leer gewesen war, Wasser erst in das eine Ohr, dann in das andere und spie es durch den Mund wieder aus. Er kehrte den Topf um, setzte ihn wieder anf die Erde und murmelte einen Spruch, und siehe da, er konnte abermals einen Wasserschwall ausgießen. Dann schüttete er vor den Augen der Zuschauer aus einem anderen Topf Wasser in den ersteren, nahm diesen auf, stülpte ihn um – aber kein Tropfen floß heraus. Er zerschlug den Topf und ließ die völlig trockenen Scherben herumgehen.
»Können Sie dies erklären?« fragte Ellen.
»Nein,« entgegnete Harrlington, »ich habe es wohl öfters schon gesehen, weiß aber nicht, welcher Handgriffe sich der Gaukler dabei bedient.«
Der Indier ging nach dem Wagen und kam mit einem hohen Korb zurück, hinter sich einen alten, entsetzlich mageren Hund am Stricke ziehend.
Er stülpte den Korb über den Hund, welcher ganz von demselben bedeckt wurde, murmelte einen Spruch, und sofort ertönte das helle Quieken eines Schweines. Als er den Korb emporhob, war an Stelle des Hundes ein Ferkel sichtbar.
Rufe der Verwunderung brachen unter den Zuschauern aus, denen dieses Kunststück neu war. Diejenigen, welche schon längere Zeit in Indien lebten, hatten es wohl bereits gesehen, aber erklären konnte es niemand, denn diese indischen Gaukler verraten ihre Geheimnisse um keinen Preis.
»Passen Sie auf, Miß Thomson,« meinte Charles zu seiner Nachbarin, »das nächste Mal erscheint das Ferkel gebraten.«
Der Indier bedeckte wieder das Ferkel, ein quiekendes Zetergeschrei ward unter dem Korbe hörbar, und als sich derselbe hob, lag das Schweinchen mit durchschnittener Kehle da. Man sah, wie aus dem Halse noch das rauchende Blut floß.
»Ach so,« sagte Charles, »ehe man es bratet, muß es ja erst totgemacht werden.«
»Aber wie kommt das nur?« fragte Miß Thomson ihren Begleiter. »Kann denn dieser Mann wirklich zaubern?«
»Ich weiß es, aber ich sage es Ihnen nicht,« entgegnete Charles, »sonst zaubern Sie mir auch meinen Tabak aus der Tasche.«
Miß Thomson verstand ihn nicht, sie fragte ihn auch nicht weiter, denn schon stülpte der Gaukler abermals den Korb über das tote Ferkel, hob ihn alsbald, und der magere Hund stand wieder lebendig da.
»Meine Herrschaften,« sagte der Inder, »diese bisher gezeigten Kunststücke werden Sie auch von anderen Gauklern gesehen haben, aber nicht das, was ich Ihnen jetzt vorführen werde. Ich, meine Diener, wir alle sind in der glücklichen Lage, keiner Speise mehr zu bedürfen, denn dieser Zauberkorb macht alle Nahrung überflüssig. Wir legen uns einfach darunter, und stehen wir nach einer Minute wieder auf, so ist selbst der hungrigste Magen bis zum Platzen gefüllt mit den leckersten Sachen. Da ich jetzt keinen Hunger habe, werde ich die Zauberkraft des Korbes an diesem Hunde beweisen.«
»Thut ihm auch sehr nötig,« brummte Lord Hastings, der um Haupteslänge unter den Zuschauern hervorragte.
Der Gaukler hob den Korb empor, und ein allgemeines Erstaunen bemächtigte sich der Zusehenden. Der Hund stand noch da, es war unbedingt derselbe, aber er war jetzt rund wie eine Kugel.
»Warum steckt er denn nicht seinen Gaul einmal darunter, dem könnte so eine Kur auch nichts schaden,« meinte Hastings, welcher der einzige war, den dieses Kunststück nicht in Extase versetzte, und wies nach dem klappernden Wagenpferd des Indiers.
»Das geht nicht unter den Korb,« entgegnete Charles, »sonst könnten Sie sich auch 'mal drunter setzen und sich einen Kopf kleiner machen lassen.«
Beim nächsten Ueberdecken schrumpfte der Hund zu seiner ursprünglichen Gestalt zusammen.
Jetzt brachte der vorige starke Hindu einen sargähnlichen Korb und setzte ihn in die Mitte des Kreises. Dann wurde der Mann von seinem Meister an Händen und Füßen gebunden, in ein engmaschiges Netz gewickelt und in den Korb gelegt, der ihn eben aufnehmen konnte. Nachdem der kleine Indier den Deckel geschlossen hatte, erzählte er der Gesellschaft, daß dieser Mann ein großer Verbrecher sei, der unbedingt sterben müsse, nahm einen Säbel und führte einen Hieb nach dem Korbe aus, stach auch noch einige Male tief hinein. Sofort quoll ein roter Strom von Blut hervor.
»Lebet wohl, ich bin unschuldig getötet worden!« rief eine Stimme aus den Lüften.
Unwillkürlich richteten sich aller Augen nach oben. »Seine Seele ist entflohen, nun wollen wir den toten Körper begraben,« sagte der Indier und öffnete den Korbdeckel.
Da aber sprang munter und unversehrt, der Banden ledig, der Mann heraus. Das Netz lag aufgewickelt in einer Ecke des Korbes, ebenso die Stricke.
Wie sich dieser große Mensch, der gerade in den Behälter hineinging, nicht nur freimachen, sondern auch noch dem Säbelhiebe und den Stichen ausweichen konnte, war allen ein Rätsel.
Charles fühlte sich leise am Arme berührt. Er drehte sich um und schaute in das treuherzige Gesicht von Claus Uhlenhorst, der, ebenso wie Kapitän Hoffmann, sich der Gesellschaft angeschlossen hatte.
»Nun kann ich mir erklären, wie sich unser Fakir zweimal befreit hat,« flüsterte der verkleidete Detektiv, »bei diesen Gauklern gehe ich noch einmal in die Lehre.«
»In etwas sind Sie denselben doch über,« entgegnete Charles ebenso leise.
»In was?«
»Im Stehlen.«
»Hoho,« lachte der Detektive, »ich kann auch noch verschiedenes andere, was mir niemand nachmacht.«
»Köpfe abschneiden und wieder anleimen.«
»Seien Sie stille, sonst schneide ich den Ihren ab und setze ihn nicht wieder drauf.«
Er entfernte sich und mischte sich unter die Zuschauer, welche die Gegenstände des Zauberers untersuchten.
»Wann fängt denn nun die Schlangenbeschwörung an?« fragte Ellen. »Die Sonne will schon untergehen.«
»Diese Vorstellung wird stets bis zuletzt aufgehoben,« erklärte Harrlington, »die Schlangen werden erst dazu vorbereitet.«
»Wie das?«
»Diese Gaukler verwenden bei den Schlangentänzen die Brillenschlange, das giftigste Reptil Indiens. Um nun doch einmal sicher zu gehen, reizen sie vor der Vorstellung die Tiere heftig, bis diese vor Wut zu wiederholten Malen in einen vorgehaltenen Lappen beißen, und so erst das Gift ausspritzen.«
»Ich glaubte, man bräche ihnen überhaupt die Giftzähne aus.«
»Nur denen, welche bei Kunststücken angegriffen werden. Aber geschickte Gaukler, wie dieser einer zu sein scheint, unterlassen auch dies und lassen die Schlangen, welche tanzen sollen, nur einmal vorher in ein Tuch beißen. Je wagehalsiger er mit den giftigen Tieren umgeht, desto größer ist der Ruhm des Schlangenbändigers, und darnach strebt er, wie jeder andere Mensch.«
»Ein gefährliches Handwerk,« meinte Ellen.
Der Gaukler gab noch einige seiner Kunststücke zum besten: er ließ aus einer enghalsigen Steinflasche, in der kaum ein Huhn Platz hatte, zwölf Tauben herausfliegen, warf drei Kugeln in die Luft, welche spurlos verschwanden und erst auf Kommando auf einen bestimmten Ort des Platzes niedergesaust kamen, u.s.w. alles Sachen, wie man sie in den Häfen Vorderindiens täglich ausgeführt sehen kann.
Welche wunderbare Geschicklichkeit der indische Jongleur im Balancieren besitzt, mag nur ein Beispiel zeigen. Er setzt eine lange Leiter senkrecht auf den Boden, ohne sie irgendwo zu stützen, klettert hinauf, stellt sich auf die oberste Sprosse und beginnt ein Kugelspiel, wobei er also außer sich selbst noch die Leiter im Gleichgewicht zu erhalten hat.
Ein Kunststück erregte bei den Zuschauern sowohl Bewunderung, wie Grausen. Der größte Hindu nahm eine Bambusstange, an deren vorderem Ende ein sehr schweres, spitzes Stahlstück mit Widerhaken lose aufgesetzt war, und schleuderte diese Lanze mit riesiger Kraft in die Luft. Als sie den höchsten Punkt erreicht hatte, drehte sie sich um, die Stahlspitze löste sich ab und sauste mit ungeheurer Schnelligkeit nach unten, während das Bambusrohr langsam nachgeschwirrt kam.
Der Indier verfolgte den Lauf der Lanze, stellte sich einige Schritte weiter nach rechts und senkte sofort, als die Spitze abfiel, den Kopf zu Boden. Im nächsten Augenblick stürzte das Stahlstück herab und riß ihm ein kleines Stück Zeug aus dem Turban. Nur um einen einzigen Zoll sollte er sich geirrt haben, und der Stahl wäre ihm durch den Kopf geschlagen, aber diese Gaukler berechnen die Flugbahn des Geschosses mit einer solchen Kaltblütigkeit und Sicherheit, daß man nie von einem Unglücksfall hört.
Endlich wurden die Vorbereitungen zum Schlangentanz getroffen.
Einige der Leute trugen einen zugedeckten Korb in die Mitte des Kreises und hielten den Deckel zu, während der kleine Indier in kurzen Worten die Gefährlichkeit der Brillenschlange schilderte, und zwar ohne Uebertreibung.
Ein Biß von ihr, sagte er, tötet den Menschen innerhalb einer, den stärksten Ochsen in zwei Minuten, kleinere Tiere in einigen Sekunden, und zwar ist er absolut tödlich; denn selten einmal gelingt es, den Gebissenen, in dessen Blut das Gift bereits übergegangen ist, zu retten.
Allerdings besitzen die Eingeborenen Indiens Mittel, um den Biß der Brillenschlange, wie sie sagen, unschädlich zu machen, hauptsächlich Kräuter; wirken diese aber nicht, so schieben sie die Schuld nicht dem Mittel, sondern bösen Geistern zu, welche die Rettung dieses Menschen nicht haben wollen. Eines der besten derartigen Mittel ist der Schlangenstein, ein poröser Stein, der an die Bißwunde gelegt wird und das noch nicht tief eingedrungene Gift aussaugt und eine Gegenwirkung auf dieses ausübt. Diese Schlangensteine sind aber äußerst selten. Der Besitzer eines solchen hütet ihn wie einen Schatz, und daher werden von den Schlangenbeschwörern andere Steine als echte verkauft, welche sich zwar auch an der Wunde festsaugen, ohne aber eine Vergiftung abzuwenden. Nur der Schlangenbeschwörer selbst kann den echten Schlangenstein von einer Imitation unterscheiden.
Jetzt setzte sich der Indier mit gekreuzten Beinen auf den Boden nieder und begann auf einer Art Dudelsackpfeife eine eintönige, schwermütige Weise zu spielen.
Nach einigen Minuten fing der Deckel des Korbes an, sich zu bewegen, er klappte mehrmals auf und nieder, bis zuletzt der kleine Kopf einer Brillenschlange mit den funkelnden Augen herauslugte. Immer weiter kroch sie heraus, der schildartige Hals wurde sichtbar, dann folgte der ganze Körper, bis sie endlich völlig aus dem Korbe war, und nun, die Augen unverwandt auf den Spielenden gerichtet, die gespaltene Zunge in fortwährend spielender Bewegung haltend, auf den Mann zukroch.
Ihr folgten nach und nach fünf der einen bis einundeinenhalben Meter langen Tiere.
Als sich alle um den Gaukler geschart hatten, begann dieser plötzlich eine raschere Melodie zu spielen und wiegte sich taktmäßig hin und her. Sofort richteten sich die Schlangen hoch empor, bis sie auf den umgebogenen Schwänzen standen, bliesen den Hals bis zur vollen Weite auf und ahmten, den Blick immer starr auf die Augen des Indiers gerichtet, dessen Bewegungen nach, das heißt, sie wiegten sich ebenso hin und her.

Nach einiger Zeit erklang wieder eine klagende Melodie, die Schlangen sanken zusammen; die Dudelsackpfeife gab sonderbar lockende Töne von sich, und die Tiere näherten sich dem Indier, krochen an seinem Körper empor, schlangen sich um seine Arme, um seinen Hals, schmiegten zärtlich den Kopf an die spielende Hand, an das Gesicht und bezüngelten es.
»Ein grauenerregendes Schauspiel,« sagte Miß Thomson.
»Ich bin froh, daß mein Vater mich nicht als Schlangenbändiger hat lernen lassen,« meinte Charles, »ich wäre wahrhaftig aus der Lehre gelaufen. Viel lieber wäre es mir, wenn ...
»Was ist denn das?« unterbrach er sich plötzlich. »Was krabbelt mir denn zwischen den Beinen herum?«
Er bückte sich, um das Ding näher zu betrachten, da stieß die Dame neben ihm einen schwachen Wehruf aus, und Charles schrie vor Entsetzen laut auf – an ihrer Hand hing ein meterlanges Reptil, eine Brillenschlange.
Ein furchtbares Gedränge entstand, die Zuschauer stoben auseinander, der Ruf: »Eine Schlange ist entschlüpft!« jagte sie, wie von Furien gepeitscht, davon, die Indier sprangen nach der Stelle, woher der Schrei kam, und hemmten so die Fliehenden, während der Schlangenbändiger sich erst von den Schlangen freimachen mußte.
Ellen war die erste, welche den Unglücksplatz erreichte.
Da lag ihre Freundin auf dem Rücken, das Gesicht und die Lippen schon blau und die Augen gläsern. Neben ihr kniete Charles und saugte mit aller Kraft an der Wunde, um das Gift zu entfernen, während er noch mit der Hand den Hals der Schlange gepackt hielt, die sich mit krampfhaften Bewegungen um seinen Arm wand.
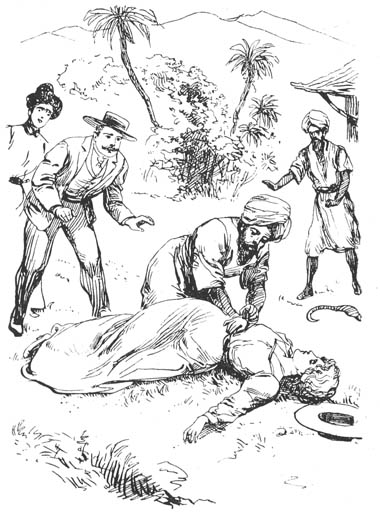
Ratlos blickte Ellen den herbeieilenden Harrlington an, der im Laufen das Messer aufklappte, aber ehe er noch die Stelle erreichte, sprang schon ein junger Indier hinzu, ergriff die Schlange beim Schwanze und riß sie Charles mit einem Rucke aus der Hand. Sausend flog das Reptil durch die Luft und lag mit zerschmettertem Kopf auf der Erde.
»Es ist zu spät!« schrie Harrlington. »Wo ist der Bändiger?«
Der junge Indier, der eben die Schlange getötet, drängte Charles mit Gewalt von dem Mädchen weg.
»Was willst du thun?« rief Charles außer sich, als er wie ein Kind zur Seite geschoben wurde. Er sprang auf und schien Lust zu haben, den Hindu zu Boden zu schlagen, der ruhig in ein am Gürtel hängendes Täschchen griff.
»Laßt ihn,« sagte aber der Gaukler, der seine Schlangen im Korbe untergebracht hatte und jetzt herzukam, »nur er kann helfen; das Mädchen wird gerettet.«
Der fremde Indier, der nicht zu der Gesellschaft des Gauklers gehörte, nahm einen kleinen Stein aus dem Täschchen und legte ihn an die Wunde der Hand, wo er sofort hängen blieb und sich immer mehr anschloß.
Atemlos harrten die Umstehenden des Ergebnisses.
»Zwei Minuten sind vorbei,« sagte Harrlington leise, »und der Tod ist noch nicht eingetreten.«
Der Indier schüttelte lächelnd das Haupt.
»Die Miß wird nicht sterben,« sagte er mit scharfer Betonung.
Noch war keine Minute verstrichen, als die blaue Farbe im Gesicht einer fahlen Blässe Platz machte; der erst fast gar nicht mehr fühlbare Puls fing wieder an zu schlagen, und die Brust hob und senkte sich wieder gleichmäßig.
Mit einem Male fiel der Stein von selbst ab und wurde von seinem Besitzer aufgehoben und wieder eingesteckt.
»Sie kann selbst nach Hause gehen,« sagte der Indier, »aber mein Stein hätte nicht mehr geholfen, wenn nicht dieser gleich das Gift ausgesaugt hätte.«
Er wies dabei auf Charles.
Während die Herren und Damen das völlige Erwachen des Mädchens aus ihrer Betäubung abwarteten, wendete sich der junge Indier an den Gaukler, der mit zerknirschter Miene zugeschaut hatte.
»War die Schlange eine der deinigen?« fragte er ihn.
»Sie war es,« erwiderte der Gaukler ganz bestürzt.
»Ist sie aus deinem Korbe entwischt?«
»Nein, aus einem Korbe mit Schlangen, die nicht gebraucht wurden.«
»Wer sollte diese beobachten?«
»Der Mann ist geflohen?«
»Wer war es?«
Der Gaukler schwieg, sichtlich verlegen.
»Wer war es, kennst du ihn nicht?«
»Nein, es war ein fremder Hindu,« stammelte der Gaukler endlich.
»Wie?« fuhr der junge Inder auf. »Du hast einen Fremden angenommen? Kennst du meine Befehle nicht? Lieferst du ihn mir bis morgen Mitternacht nicht aus, so trifft dich seine Strafe.«
Er wendete sich kurz ab und ging.
Ellen hatte die Unterhaltung, welche auf indisch geführt worden war, nicht verstanden, aber das befehlende Auftreten des jungen Hindu war ihr aufgefallen. Sie blickte der graziösen Gestalt, die mit elastischen Schritten davonging, so lange nach, bis sie dieselbe aus den Augen verlor.
»Wer war das?« fragte sie den Gaukler, welcher dem noch immer liegenden Mädchen etwas Branntwein einflößte.
»Mukthar heißt er.« antwortete er kurz.
»Mukthar, der Schlangenkönig?« rief Ellen erstaunt.
Der Hindu hielt plötzlich in seiner Beschäftigung inne und blickte überrascht auf.
»Woher kennst du ihn?« fragte er.
»So ist er es wirklich? Schade, daß ich ihn nicht gleich gesprochen habe. Doch nein, besser so,« fügte sie nachdenklich hinzu.
»Er ist nicht der König der Gaukler selbst, sondern nur dessen Sohn,« sagte der Hindu und setzte seine Bemühungen um Miß Thomson fort.
Bald kam ein Wagen, nm das fast wiederhergestellte, aber noch schwache Mädchen, das nicht sprechen konnte, nach dem Hotel zu bringen, wohin Ellen es begleiten wollte.
Ehe sie in den Wagen stieg, drehte sie sich um, gab Charles die Hand und sagte:
»Ich danke Ihnen vorläufig im Namen von Miß Thomson für Ihre Hilfe. Wenn Sie nicht die Geistesgegenwart und Thatkraft gehabt hätten, so würden wir jetzt –«
Sie brach schnell ab und stieg ein.
»Geistesgegenwart? Thatkraft?« wiederholte Charles, als der Wagen davonfuhr. »Lord Hastings, schreiben Sie das auf, und lernen Sie das auswendig, damit Sie mich nicht mehr einen unnützen Menschen nennen! Zum Teufel, Uhlenhorst,« fuhr er den neben ihm stehenden Steuermann an, der seiner Pfeife dicke Dampfwolken entlockte, »Sie rauchen ja einen ganz pestilenzialisch stinkenden Tabak.«
Und Charles mußte sich mehrmals mit dem Tuche über die Augen fahren.
»Meine Herren,« nahm Lord Harrlington das Wort, »Miß Petersen ladet uns zu morgen früh ein, mit den Damen einen Ritt zu Pferd in die Gegend von Madras zu machen,«
»Hm, hm,« brummte Hastings, »wieder so ein Jagdausflug mit Geparden? Zum zweiten Male lasse ich mich nicht gefangen nehmen, auch bade ich mich nicht gern in Kleidern.«
»Es soll nicht weit sein, etwa eine Stunde zu Pferd. Miß Petersen scheint ein Geheimnis daraus zu machen.«
»Na ja,« meinte aber der mißtrauische Hastings, »gerade wie damals. Erst sahen wir zu, wie gejagt wurde, dann jagten wir, und schließlich wurden wir selbst gejagt?«
»Esel!« bemerkte Charles. »Wir schließen uns an und nehmen zur Vorsicht Badehosen mit. Was mag indessen Miß Ellen vorhaben?« wandte er sich fragend an Uhlenhorst.
»Sie schleppt doch immer ein Mädchen mit sich 'rum, das damals Herr Hoffmann zugleich mit Lucille nachbrachte, nicht wahr?« antwortete der Gefragte.
»Ja,« sagte Charles,»und was ist mit diesem?«
»Das soll gewiß abgeladen werden.«
»Ach so, das könnte allerdings sein. Aber ich finde, lieber Uhlenhorst, Sie haben eine wunderbar zarte Ausdrucksweise: rumschleppen und abladen – wirklich sehr schön!«
»Und ich finde, Sir Williams,« entgegnete der Detektiv, »Sie lecken immerwährend mit der Zunge die Lippen ab. Schmeckt das Schlangengift so gut?«
Charles konnte ein leichtes Erröten nicht unterdrücken.
»Na, na, Sie brauchen nicht gleich rot zu werden,« sagte der Detektiv trocken, »ich bin früher auch einmal jung gewesen.«
»Sie,« rief Charles entrüstet. »Wie alt sind Sie denn eigentlich? Fünfundzwanzig Jahre, he?«
»Das auszurechnen ist ein schwieriges Kunststück. Neulich war ich vierzig Jahre alt, dann wieder dreißig, ungefähr fünfunddreißig, das macht allein schon hundertundfünf Jahre.«
»Nun hören Sie aber auf,« unterbrach Charles den Detektiven, der heute gerade recht gut aufgelegt war. »Uebrigens schulden Sie mir noch für den Tabak, den sie mir gestohlen haben,«
»Dafür war doch ein Taschentuch im Beutel.«
»Das war ja mein eigenes.«
»Na, glauben Sie etwa, ich werde Ihnen meines hineinstopfen? Sie können den Tabak von den hundert Pfund abziehen, die Sie mir für die Wette schulden.«
»An« rief Charles und kratzte sich hinter den Ohren, »an die habe ich gar nicht mehr gedacht.«
»Oder bezahlen Sie hier einmal ein Glas Bier, das ist mir ebenso lieb,« meinte der Detektiv und schleppte Charles in eine Restauration.
»Finden Sie nicht auch,« sagte der Detektiv, als beide am Tisch saßen, »daß dieser Gaukler ein recht dummer Kerl war?«
»Wieso?«
»Wenn ich so einen Topf hätte, der immer voll bleibt, wenn ich nur einmal etwas hineingieße, dann hätte ich ihn doch nicht mit Wasser, sondern mit Bier gefüllt.«
Nicht weit von Madras erhebt sich ein Gebirge, dessen wildphantastische Felspartien einen gar wunderlichen Eindruck machen. Fühlt sich der einsame Wanderer schon an hellen Tage unheimlich in diesem Felsenlabyrint, so steigert sich dieses Gefühl der Furcht bis zum Entsetzen, wenn sein Fuß während der Nacht hindurchpilgern muß.
Er glaubt Riesen zu erblicken, die eng umschlungen miteinander ringen; er sieht Ungeheuer von märchenhafter Gestalt, die Rachen geöffnet, den schuppigen Schweif geringelt, zum Sprunge gebückt, bereit, sich auf den Wanderer zu stürzen; er sieht schöne Frauengestalten, die hilfesuchend die Arme nach ihm ausstrecken, als erwarteten sie von ihm Befreiung, Und dies alles ist nicht tot, die Gestalten bewegen sich im unsicheren Schein des Mondes; das Heulen des Windes, das Säuseln der Baumzweige und das unter den Füßen raschelnde Laub giebt ihnen die Sprache, bald schrecklich drohend, bald flehend oder klagend.
Dem Fremden graust es. Mit flüchtigem Schritt eilt er durch die Schluchten, durch die Thäler, mit Steinbildern besetzt, geht mit zaghaftem Schritt auf schwankenden Bambusbrücken, die über stürzende Gießbäche führen, bis er endlich zwischen zwei nahe aneinander herantretenden Felswände hindurch muß und – siehe da – er tritt ans einer Wildnis in ein Paradies.
Vor seinen Blicken öffnet sich das flache Land, der Mond flutet über die Reis- und Baumwollenfelder, er übergießt die jetzt ruhig dahinfließenden und friedlich murmelnden Bäche mit seinem silbernen Licht, und besitzt der Wanderer ein scharfes Auge, so kann er noch sehen, wie seine Strahlen die Kuppeln von Madras erglänzen lassen.
›Des Teufels Sitz‹ ist dieses jäh emporsteigende Gebirge vom Munde des Volkes genannt worden, und wahrlich, eine bessere Bezeichnung hätte nicht gefunden werden können. Es ist, als ob der Teufel, dieser anmaßende Geist, auch in der schönsten Gegend sein Recht, daß die Erde sein Eigentum ist, bezeugen wolle und nun hier inmitten eines Paradieses seinen Sitz aufgeschlagen habe, von wo aus er dem unruhigen Treiben der Erdenkinder grinsend zuschauen kann. »Wo ist der Zugang zu dem Gebirge?« fragte Ellen, die neben Harrlington dem Zuge der Herren und Damen vorausritt, den eingeborenen Führer.
Dieser deutete auf eine jäh aufsteigende Wand in der Ferne.
»In einer Viertelstunde werdet Ihr das Höllenthor betreten,« antwortete er, »habt Ihr dasselbe passiert, so werdet Ihr bald auf Leute von Shikaris Stamm stoßen.«
»Du glaubst also, daß uns Shikari freundlich aufnehmen wird?«
»Shikari ist alt geworden, er lebt nur noch der Einsamkeit und seinen Tieren und läßt seinen Sohn die Aufsicht über seine Leute führen. Sein Sohn ist den Engländern freundlich gesinnt und hat auch Shikari so weit gebracht, daß er die Fremdlinge nicht mehr haßt. Kommt Ihr nicht nur aus leerer Neugierde, sondern führt Euch ein Grund zu ihm, so werdet Ihr den Zugang zu seinem Gebiet offen finden.«
Das Gebirge war erreicht, und der Führer erhielt seinen Lohn.
Während die Gesellschaft durch eine einsame Schlucht ritt, die den Eingang zu dem Felsengebiete bildete, fragte Lord Harrlington Miß Petersen:
»Haben Sie schon über Shikari Erkundigungen eingezogen?«
»Ja, und ich habe verschiedene Urteile über ihn zu hören bekommen, welche zum Teil von Unglaublichkeiten strotzten. Die Engländer scheinen ihn für einen Sonderling und die Eingeborenen für einen Halbgott zu halten. Was halten Sie von ihm?«
»Was über ihn Seltsames gesprochen wird, ist nicht Uebertreibung, er wird jetzt von den Indiern der Schlangenkönig oder der König der Gaukler genannt, und von den Gebildeten der Bevölkerung wird sein Name mit Respekt, von den Niedrigen mit Ehrfurcht ausgesprochen. Sein Vater konnte mir noch erzählen, wie er ihn als Gaukler bei der Produzierung seiner Kunststücke gesehen hat. Er war unbedingt der geschickteste aller indischen Gaukler und Schlangenbeschwörer; war eine Gegend von Schlangen verseucht, so wurde Shikari gerufen, und der Klang seiner Pfeife lockte dieselben wie durch Zauberei überall hervor, sie folgten ihm, wohin er wollte. Er versteht eben die Kunst, auf jedes Tier einen geheimen Einfluß auszuüben, und verwendet diesen, auch wilde Tiere abzurichten. Fertigt er uns nicht vor der Thür seines Reiches ab, so können wir Erstaunliches zu sehen bekommen.«
»Wissen Sie schon, wer jener Indier war, der gestern das Leben der Miß Thomson gerettet hat?«
»Nein,« entgegnete Harrlington.
»Es war Shikaris Sohn.«
»Wie,« rief Harrlingtou, »also Mukthar? Nun kann ich es mir auch erkläre», wie die Gebissene so schnell hergestellt worden ist, daß sie heute schon wieder zu Pferd sitzt. Shikari besitzt ein geheimes Mittel, mit dem er die Schlangensteine tränkt, sodaß sie das Gift nicht nur begieriger aufsaugen, sondern es zugleich auch unschädlich machen. Dann haben wir auch umsomehr Hoffnung, vorgelassen zu werden.«
»Haben Sie auch die Schluchten zur rechten Seite richtig gezählt, daß wir uns nicht verirren?« fragte Ellen.
»Jetzt passieren wir die zweite, die vierte ist die richtige, sie bildet den Eingang. Sie wird uns durch ihre Enge auffallen.«
Nach einigen Minuten sagte Ellen wieder zu Harrlington:
»Warum wird Shikari der König der Gaukler genannt?«
»Weil er der geschickteste unter ihnen war und sein Sohn es jetzt ist, und Schlangenkönig, weil kein anderer als diese beiden, es so versteht, die Schlangen zu fangen, zu zähmen und tanzen zu lassen.«
Harrlington begann plötzlich zu lachen.
»Was haben Sie denn?« fragte ihn Ellen,

»Mir fällt ein hübsches Geschichtchen ein, in welchem Shikari eine Rolle spielt; mein Vater erzählte es mir. Nach einem sehr trockenen Sommer war eine Gegend in Indien wieder einmal so von Schlangen verseucht, daß auf den Kopf jeder getöteten Giftschlange eine Rupie (etwa zwei Mark) von dem englischen Gouvernement ausgesetzt wurde, während der Preis sonst nur eine halbe Rupie ist. Es wurden Schlangenköpfe eingeliefert, Hunderte und aber Hunderte, und das ging Monat für Monat fort, ohne daß eine Abnahme der Schlangen zu bemerken gewesen wäre. Schließlich wurden die englischen Beamten aber mißtrauisch und gingen dieser großen Lieferung auf die Spur. Und was meinen Sie wohl, was sie dabei gefunden haben?«
»Nun?« fragte Ellen neugierig.
»Shikari hatte schon vor Jahren eine förmliche Schlangenzucht angelegt – unter günstigen Bedingungen vermehren sich diese Tiere ungeheuer – und wartete nun auf die Zeit, wo die Prämie für Schlangenköpfe eine sehr hohe war. Als sie bis zu einer Rupie gestiegen, tötete er seine Pfleglinge und verhandelte sie an die Eingeborenen jener Gegend eine Kleinigkeit billiger, sodaß diese beim Wiederverkauf an die englische Regierung einen kleinen Nutzen erzielten.«
Ellen mußte über diese Schlauheit lachen.
»Und was sagten die Beamten dazu?«
»Die waren natürlich, als das Geheimnis offenbar wurde, sehr aufgebracht, und wollten dem Shikari wegen Betrugs etwas am Zeuge flicken. Aber der Indier war schlauer als sie. Er versicherte ihnen mit der treuherzigsten Miene von der Welt, er habe geglaubt, die Engländer wollten aus den Schlangenköpfen etwas fabrizieren, vielleicht den Zähnen das Gift entziehen.«
»Was thaten nun die Engländer?«
»Sie forderten eine große Summe Geld zurück, die sie unnütz ausgegeben hatten, denn Shikari rechnete ihnen ganz genau vor, wieviel Schlaugenköpfe er verkauft habe.«
»Und Shikari?« lachte Ellen.
»Der wollte seine Schlangenköpfe wiederhaben oder wenigstens ebensoviele lebendige Schlangen, wie er getötet hatte, und so blieb die Geschichte ruhen.«
»Ein gutes Licht wirft dies nicht gerade auf den Indier,« meinte Ellen,
»Shikari that dies nur, weil er die Engländer als fremde Eindringlinge betrachtete und sich daher für berechtigt hielt, ihnen den vermeintlichen Raub anf jede nur mögliche Art zu schmälern. Im übrigen ist Shikari ein guter und mildthätiger Mann, welcher der erste ist, der bei Wassersnöten, Feuersbrünsten u. s. w. den davon betroffenen Eingeborenen seinen Geldbeutel öffnet. Er ist reich, denn er ist kein gewöhnlicher Gaukler, der sich auf der Straße produziert, sondern wird an Fürstenhöfe bestellt, besonders, wenn ausländische Größen sich in Indien zum Besuche aufhalten. Jetzt lebt er nur noch seinem Vergnügen und der Dressur vou Tieren. Sein Sohn Mukthar hat das Geschäft des Vaters übernommen.«
Ellen schwieg eine Weile, dann fragte sie wieder:
»Soll die Bezeichnung ,König der Gaukler' nicht auch darauf deuten, daß er über alle diese fahrenden Leute herrscht?«
Harrlington lächelte.
»Es wird allerdings davon gemunkelt, daß alle Gaukler unter ihm stehen, ja, daß er sogar über Leben und Tod derselben entscheiden kann, aber ich halte dies für leere Redereien. Die Gaukler Indiens sind freie Leute, sie ziehen bald hierhin, bald dorthin, sammeln ihre Kupfermünzen ein und kümmern sich um keinen Herrn oder König.«
»Haben Sie aber nicht gemerkt, wie herrisch Mukthar gestern unserem Gaukler gegenüber auftrat, und wie demütig sich der Mann dabei benahm? Leider konnte ich die auf Indisch geführte Unterhaltung nicht verstehen.«
»Ich habe nicht darauf geachtet,« sagte Harrlington, »meine Aufmerksamkeit war ganz Miß Thomson gewidmet. Es ist ja aber leicht möglich, daß Shikari Leute ausschickt, die in seinem Brot stehen und das gesammelte Geld abgeben müssen, er liefert ihnen dafür Apparate und dressierte Schlangen. Ein solcher Höriger war vielleicht auch dieser Gaukler.«
»Ich aber kann Ihnen erzählen,« sagte Ellen mit Betonung, »daß Shikari doch mit Recht der König der Gaukler genannt wird, denn alle diese stehen unter seinem direkten Befehl; er schickt sie hin, wohin er sie haben will, er bestraft sie, und wenn sie ihm wiederholt ungehorsam sind oder sich grober Vergehen gegen die Zunft der Gaukler schuldig machen, kann er sie töten, und zwar mit Einwilligung der übrigen.«
»Woher wissen Sie das?« fragte der Lord erstaunt.
»Ich weiß es aus ganz sicherer Quelle, ebenso sicher, als hätte er selbst es mir erzählt. Früher, als Shikari selbst noch die Aufsicht führte, waren die Gaukler und Schlangenbändiger hauptsächlich diejenigen, welche einen Aufstand vorbereiteten, geheime Sendungen besorgten und überhaupt den Engländern Schwierigkeiten bereiteten –ihre Taschenspielerkunst machte dies sehr leicht. Seit aber der gegen die Engländer freundlich gesinnte Mukthar seinen Vater abgelöst hat, werden die Gaukler nicht mehr zu derartigen Geschäften verwendet, sondern ziehen nur harmlos im Lande herum. Trotzdem stehen sie aber alle noch unter dem Befehl des Schlangenkönigs.«
»Dann sind Sie besser darüber orientiert als ich, und ich will Ihnen nicht widersprechen. Doch dort ist die vierte Spalte, in die wir einbiegen müssen.«
Harrlington deutete dabei auf eine Oeffnung in der Felswand, die so glatt und gerade hindurchlief, als wäre sie von Menschenhänden in den Stein gehauen worden. Die Wände traten so nahe aneinander heran, daß kaum zwei Reiter sich nebeneinander halten konnten.
Nach einigen Minuten hatte man diesen Durchgang hinter sich, und die Spalte begann Windungen zu machen, bald erweiterte sie sich, bald ward sie so eng, daß die Kleider des Reiters die Felswände streiften. Ueber den Häuptern hingen riesige Felsblöcke, welche dem Sonnenlicht den Zutritt verwehrten, einmal mußte die Gesellschaft sogar minutenlang durch einen Tunnel reiten, in dem vollständige Finsternis herrschte.
Harrlington zündete, ebenso wie die anderen Herren, Streichhölzer an; denn wer wußte, ob sich vor ihnen nicht plötzlich ein Abgrund öffnete oder sonst Gefahren im Wege lagen. Durch das Licht aufgescheucht, huschten Fledermäuse über die Köpfe der Reisenden hin und schlugen klatschend gegen die Wand.
»Schauerlich,« sagte Ellen und schüttelte sich, »die Namen »Sitz des Teufels« und »Schlangenkönig« passen hier zusammen.«
»Es ist eine Burg, wie sie keine Menschenhand besser hätte bauen können,« meinte Harrlington, »eine Hand voll Leute hält hier ein ganzes Regiment Soldaten im Vordringen auf. Nur ein einziger Felsblock braucht oben gelöst zu werden, und der Durchgang ist schon für Tage unmöglich gemacht.«
Als sie den Tunnel hinter sich hatten, machte der Weg eine scharfe Biegung. Die Wände standen wieder so weit auseinander, daß der Lord neben Ellen reiten konnte.
Eben bogen sie um die Ecke, als beide plötzlich nach den Revolvern fuhren. Vor ihnen, nur zehn Schritte entfernt, stand schweifwedelnd ein mächtiger Königstiger und stieß ein wildes Knurren aus.

Der Zug stockte. Ellen hielt den Atem an und hob den Revolver, aber ihr Arm wurde von Harrlington niedergedrückt.
»Um Gottes willen, nicht schießen,« flüsterte der Lord, »er gehört dem Shikari.«
Es pflanzte sich schnell nach hinten von Mund zu Mund fort, was die Ursache des Haltens sei. Die beiden Vordersten standen und gingen nicht vorwärts und der Tiger nicht rückwärts; die glühenden Augen auf Ellen gerichtet, wedelte er mit dem Schweif und ließ sein Knurren hören.
»Die Situation wird lächerlich,« sagte Ellen; »wer sagt uns, daß die Bestie zahm ist?«
»Es giebt hier keine wilden mehr,« entgegnete Harrlington, »aber was sollen wir machen? Er scheint als Wächter angestellt zu sein.«
»Geben Sie ihm ein Stückchen Zucker,« ließ sich von hinten Charles Stimme vernehmen.
Unwillig setzte Ellen ihr Pferd in Bewegung, aber sofort kauerte sich der Tiger nieder und brüllte laut.
»Kali,« rief hinter dem Felsen eine Stimme, »wer ist da?«
Der Name Kali hat in Indien einen schrecklichen Klang, ihn führt die Göttin der Vernichtung, der noch vor wenigen Jahren, manchmal auch noch jetzt, Menschenopfer gebracht wurden.
Da bog um den Vorsprung ein Indier und blieb beim Anblick der Gesellschaft stehen.
»Dürfen wir Shikari einen Besuch abstatten? Wir kommen als Freunde,« rief sofort Harrlington.
»Folgt mir!« entgegnete der Mann, lockte die Tigerin, die liebkosend an ihm emporsprang, und schritt voran. Zweimal mußte man noch um Felsen biegen, dann erweiterte sich die Spalte und führte in eine Schlucht, groß genug, die ganze Gesellschaft bequem aufzunehmen.
Am Eingange saßen einige Leute um ein Schachbrett, und neben ihnen lag Kali, die Wächterin dieses Thores. Sonst war nichts weiter in der Schlucht zu sehen.
Sie war rings von Felswänden eingeschlossen, als wäre kein anderer Ausweg als der, woher sie eben kamen, aber die Wände waren zerklüftet und zerrissen, überall sah man Löcher, Höhlen und Spalten in ihnen.
Der Indier, welchen Harrlington zuerst angeredet, ging nach einer derselben und verschwand in ihr.
Nach einer Minute kam er zurück,
»Der Schlangenkönig will Euch nicht sehen,« sagte er kurz.
»Sage ihm, die Dame, deren Leben gestern sein Sohn gerettet habe, wolle diesem danken und brächte Geschenke mit.«
Der Indier warf einen Blick auf die zahlreiche Gesellschaft, welche aus fünfzig Personen bestand, und ging wieder nach der Spalte.
»Ihr sollt Eure Geschenke behalten, Mukthar braucht keine Geschenke,« sagte er, als er zurückkam.
»Das nennt man abgeblitzt,« lachte Charles, »wenn wir jetzt nicht gutwillig gehen, hetzt uns der Kerl mit seinen Tigern und Schlangen zum Hause hinaus.«
»Gehe nochmals hin und sage, ich hätte –«
Ellen wurde unterbrochen.
»Shikari nimmt keinen Besuch an, den nur die Neugierde herführt,« sagte der Inder, »und niemals so viele. Komme allein wieder!«
»Ich hätte ihm Grüße von Dchatalja zu bestellen,« fuhr Ellen ruhig fort.
Die Wirkung, die dieser Name hervorbrachte, war eine wunderbare.
Der Indier richtete verwundert den Kopf empor und seine Gefährten, die ruhig weitergespielt hatten, sprangen gleichzeitig auf; selbst der Tiger hatte sich, wie seine Herren erhoben.
Diesmal kam der Indier zurückgerannt.
»Wer rennt,« erklärte Charles der Miß Thomson, »hat gewöhnlich große Eile; also werden wir jetzt entweder mit Eilpost hinausbefördert oder ins Innere des Heiligtums geschleppt.«
»Ihr seid dem Schlangenkönig willkommen,« sagte der Indier, »er will Euch gleich empfangen. Steigt einstweilen von den Pferden!«
Er löste eine kleine Pfeife vom Gürtel und stieß einen schrillen Pfiff aus.
Sofort kamen aus allen Höhlen und Löchern Hindus hervor, nahmen den Herren und Damen die Zügel ab und führten die Pferde durch Spalten in unsichtbare Ställe.
In dem erst so öden Felsenkessel wimmelte es wie in einem Ameisenhaufen.
Die Ankömmlinge wurden durch einen Riß in eine andere Schlucht geführt, welche sich nach oben verengte, während sie unten sehr geräumig war.
Wenn der Ausdruck Schlucht gebraucht worden ist, so war dabei nur an die natürliche Entstehung des Saales gedacht, in welchen die Gesellschaft geführt wurde, denn nichts fehlte hier, was man in dem Empfangssalon eines Fürsten zu sehen gewöhnt ist.
Den steinernen Boden bedeckten weiche Teppiche, längs der Wände zogen sich schwellende Diwans hin, Stühle und Tische standen umher, kurz, der ganze Raum war mit dem größten Luxus ausgestattet. Erhellt wurde er von dem Tageslicht, welches von oben hereinfiel, aber die Wände näherten sich so, daß bei Regen der ganze Saal mit Brettern oder ähnlichen Schutzvorrichtungen überdeckt werden konnte.
Man konnte sich nicht genug wundern, hier in diesem unwirtlichen Gebirge eine solche Pracht zu finden. Es war ein in den Felsen gehauener Palast.
Doch weder Shikari, noch Mukthar ließen sich sehen, um die Gäste zu begrüßen, und so mußten diese sich selbst die Zeit durch Gespräche verkürzen, bis ihre Wirte erschienen.
»Steht jene Dchatalja, deren Namen Sie vorhin nannten, in Verbindung mit den befreiten Sklavinnen?« fragte der Lord Ellen.
»Ja, doch bitte ich Sie, auch die anderen Herren davon zu benachrichtigen, daß vorläufig dieser Name nicht wieder genannt wird. Ich hatte ihn mir als letztes Mittel aufgehoben, um in das Reich des Schlangenkönigs eindringen zu können. Entweder wurden wir dann sofort abgewiesen oder wir wurden zum Eintritt veranlaßt, aber ich fürchte, ich werde noch auf viele Schwierigkeiten stoßen. Sehen Sie da, ist das nicht Mukthar selbst?«
Im Hintergründe des Saales stand die hohe Gestalt eines Indiers an der Wand lehnend, die Arme übereinander gekreuzt und die Gesellschaft beobachtend. Er war in einfache, weite Gewänder gehüllt, aber der Stoff war ein sehr feiner, und der die schmalen Hüften umchließende Gürtel war mit Edelsteinen besetzt. Niemand hatte ihn vorher gesehen, er mußte durch einen geheimen Eingang in der Wand plötzlich in den Saal getreten sein.
Als er sah, daß Ellen ihn erblickt hatte, trat er auf diese zu.
»Ihr seid mir als Gäste willkommen. Wo ist die Dame, welche Shikari, meinem Vater, Grüße überbringen wollte?« fragte er mit wohlklingender Stimme.
»Ich bin es selbst,« entgegnete Ellen.
»Nicht mein Vater ist es,« fuhr er fort, »der Euch bei Nennung dieses Namens empfangen hat, sondern ich, Mukthar. Seht Euch vor, daß der Klang dieses Wortes nicht in das Ohr Shikaris dringt. Aber als meine Gäste seid Ihr auch die meines Vaters, er wird Euch gleich begrüßen.«
»Ich dachte es mir,« seufzte Ellen.
War der junge Indier auch nur ein Gaukler, so zeigte er sich doch als vollkommener Weltmann. Eine Vorstellung der einzelnen Personen schlug er mit der lächelnden Bemerkung ab, zum Gedächtniskünstler besitze er keine Talente, war aber nie in Verlegenheit, einem Herrn oder einer Dame etwas Angenehmes zu sagen. Die Danksagungen von Miß Thomson nahm er gelassen entgegen, er habe nur das gethan, was jeder andere auch gethan haben würde.
Der Eintritt Shikaris bewirkte eine Unterbrechung der Unterhaltung.
Er war ein sehr alter Mann, etwas gebeugt gehend, und mit schneeweißem Haupthaar und Vollbart. Er besaß dieselben edlen Gesichtszüge, wie sein Sohn, wie überhaupt fast alle Indier, nur zeigte er nicht das zurückhaltende, aber freundliche Benehmen desselben, sondern war lebhaft und schien Anlagen zum Jähzorn zu besitzen.
War die Gesellschaft erst sehr erstaunt gewesen, hier einen Salon zu finden, so trat bald das Gegenteil ein, nämlich Enttäuschung über den höflichen Empfang, der sich durch nichts von dem im Hause irgend eines vornehmen Indiers unterschied. Während aber niemand sich diese Enttäuschung nicht merken ließ, sprach Charles sie ungeniert aus.
»Claus Uhlenhorst,« sagte er zu dem neben ihm sitzenden Detektiven, der nebst dem Kapitän Hoffmann sich der Gesellschaft angeschlossen hatte – nur Lord Hastings und ein anderer Herr hatten den Besuch bei dem Schlangenkönig für Unsinn erklärt und spielten im Hotel eine Partie Whist – »Claus Uhlenhorst, warum stieren Sie so nachdenklich auf das Loch in der Wand?«
»Ich warte ab, ob nicht bald eine Schlange herauskriecht,« entgegnete gähnend der Gefragte.
»Stecken Sie doch einmal den Finger hinein. Beißt es, dann ist eine drin, sonst nicht.«
»Ich kam hierher in der Erwartung, Schlangen und andere geschwänzte Ungeheuer zu sehen, und jetzt sitzt man hier und fängt vor Langeweile Fliegen.«
»Kommen Sie,« sagte Charles und stand auf, »jetzt gehen wir einfach hinaus und suchen einmal auf eigene Faust die Menagerie. Halt!« unterbrach er sich, »Jetzt werden Erfrischungen herumgereicht, da stecken wir uns die Taschen voll und füttern dann die Affen.«
Diener brachten auf Präsentiertellern Kaffee und Gebäck.
Schon wollte sich Charles mit dem Detektiven hinausbegeben, als Shikari seine Gäste selbst aufforderte, ihn zu begleiten, und sein Sohn fügte lächelnd hinzu, wenn sie gehofft hätten, hier auf Schlangengrotten und ähnliche Sehenswürdigkeiten zu stoßen, so hätten sie sich allerdings getäuscht, schon manchem Besucher wäre es so ergangen.
Als Lord Harrlington mit Ellen einmal allein war, sagte sie zu ihm:
»Merkwürdig ist es, daß uns Shikari erst so grob abweisen ließ, während er sich jetzt der größten Höflichkeit befleißigt.«
»Mir ist es aber verständlich,« entgegnete der Lord. »Wenn er nicht jedem kurzweg die Thür wiese, so würde er bald von Reisenden überlaufen werden, welche schon wegen dieser Felsenwanderung herkämen. Hat er aber einmal einen Gast empfangen, so ist er auch ein freundlicher Wirt.«
Ellen suchte den Mukthar auf und führte mit diesem ein eifriges Gespräch, sie schien sich nicht sehr für das zu interessieren, was Shikari seinen Gästen zeigte.
Alle Spalten führten in ähnliche Felsenkammern, wie sie eben eine verlassen hatten, nur waren sie einfacher eingerichtet, je nach dem Zwecke, dem sie dienten.
In der einen hockten viele Indier am Boden und fertigten seltsame Gegenstände.
Auf die verwunderte Frage, wozu dieselben dienten, sagte ihnen Shikari, bei ihm würden fast alle in Indien gebrauchten Zauberapparate gefertigt.
»So bedienen sich diese Leute also auch der Apparate?« fragte einer der Herren.
»Natürlich. Sie können ohne diese ebensowenig etwas machen, wie die Zauberkünstler in Euren Ländern. Ich kenne diese sehr wohl, und wir sind ihnen in der Herstellung solcher Apparate weit überlegen. So zum Beispiel fertigt Ihr die Apparate schön, aus poliertem Holz, mit Verzierungen versehen, an, wir dagegen von möglichst plumpem Aussehen, und was dies für ein Vorzug ist, läßt sich leicht begreifen. Nehmen wir das Kunststück mit dem Krug an, welcher sich immer von selbst füllt. Ich habe dasselbe Kunststück von einem reisenden europäischen Taschenspieler gesehen, der sich dabei eines eleganten Kruges bediente. Zerschlüge er nun wirklich zum Schluß diesen kostbaren Krug, so würde dies an sich schon unnatürlich aussehen, aber er thut es nicht. Unsere Gaukler dagegen haben einen ganz plumpen Steintopf, für den sie zuletzt einen anderen unterschieben und zerschlagen. Diese Scherben können sie herumgehen lassen, um sich den Anschein zu geben, daß der Topf keinen Wert für sie habe.«
Man mußte ihm beistimmen.
Der Schlangenkönig, der Name kam ihnen jetzt wie Spott vor, sagte ihnen, daß er zu seinem Vergnügen wilde Tiere dressiere, und zeigte ihnen in einer anderen Grotte vergitterte Käfige mit Tigern, Wölfen, Panthern und anderen Raubtieren,
Keiner der Gäste hatte auch nur Lust, ihn aufzufordern, einige der Tiere vorzuführen.
Die Enttäuschung wuchs von Schritt zu Schritt.
»Wo aber sind die Schlangen?« fragte einer.
»Schlangen?« sagte lächelnd der Shikari. »Ich habe keine solche hier, der Name Schlangenkönig rührt nur daher, daß ich mich früher als Gaukler mit der Dressur derselben beschäftigt habe. Uebrigens können Schlangen eigentlich nicht dressiert werden. Die Musik und das Auge des Bändigers sind es, was die Tiere bezaubert und sie vom Beißen abhält. Man muß studiert haben, welche Töne bei ihnen die größte Wirkung hervorbringen, und je vollkommener man dieselben auf der Pfeife wiedergeben kann, desto williger verlassen die Schlangen ihr Versteck, lassen sich fangen und, wie man sagt, zum Tanzen abrichten. Ich gebe mich nicht mehr damit ab, es ist die Sache der gewöhnlichen Gaukler.«
Miß Thomson wandte sich an Charles und flüsterte:
»Dieser Mensch entnüchtert mir alle Poesie Indiens.«
Da wurde Charles schon wieder am Arm berührt, hinter ihm stand Sharp, der ihm winkte, etwas zurückzubleiben.
»Sir Williams, Sie wetten doch so gern! Was wetten wir, daß der Schlangenkönig und sein Kronprinz die ganze Gesellschaft zum Narren hält, mich natürlich ausgenommen?«
Charles starrte den Detektiven mit offenem Munde an.
»Wie meinen Sie das?« fragte er endlich.
»Daß es ein ganz geriebener Kerl ist, der viel mehr weiß und viel mehr hat, als er uns zeigt.«
»Woraus schließen Sie das?«
»Weil er so ungemein darauf bedacht ist, alles ganz selbstverständlich hinzustellen. Er wäre auch ein schöner Esel, wenn er dem ersten Besten seine Geheimnisse verraten wollte. Umsonst steht der Tiger aber jedenfalls nicht als Kettenhund an dem Thor.«
Jetzt forderte der Wirt seine Gäste auf, in dem ersten Felsenhof noch der Vorstellung eines dressierten Elefanten durch einen Indier beizuwohnen.
»Das heißt mit anderen Worten: dann sollen wir machen, daß wir hinauskommen,« sagte der Detektiv zu Charles, »und wie zum Teufel kommt denn überhaupt ein Elefant hier in dieses Labyrint? Die Spalte, durch welche wir kamen, ist viel zu schmal für einen solchen Riesen. Aber auch der Fuchs hat mehrere Ausgänge aus seinem Bau.«
Aus einer geräumigen Höhle wurde ein mächtiger Elefant mit prachtvollen Stoßzähnen geführt, der unter der Leitung seines Wärters Kunststücke ausführte. Sie waren wohl bewundernswert, aber den Herren und Damen waren sie nichts Neues.

Sie hatten in einem weiten Kreis auf Stühlen Platz genommen, und sonderbar war es, wie Mukthar die Aufstellung derselben vorgenommen hatte. Shikari saß neben Ellen, aber ihre Stühle waren weit von den anderen entfernt, als nähmen sie einen Ehrenplatz ein. Die Entfernung war eine so weite, daß ihr Gespräch nicht gehört werden konnte, und sie unterhielten sich sehr eifrig.
Ebenso, wie diese beiden, beschäftigten sich auch die anderen Gäste weniger mit den Künsten des Elefanten, sondern vielmehr mit Shikari und Ellen, welche ein ganz merkwürdiges Benehmen zeigten. Ellen sprach auf den Indier ein, dieser antwortete heftig, sprang sogar auf, stampfte mit dem Fuß auf den Boden und sank dann wieder wie gebrochen auf den Stuhl.
Nur einmal wurde die Aufmerksamkeit durch etwas anderes von diesen beiden abgelenkt.
Durch den Eingang kam ein Indier zu Pferd, in der Uniform der Postbeamten, gesprengt und fragte nach Kapitän Hoffmann. Dieser nahm ihm ein Telegramm ab, überflog es und verabschiedete sich dann von der Gesellschaft mit der Entschuldigung, er müsse sofort mit dem Eilzug nach Bombay reisen, seine Anwesenheit auf dem >Blitz< sei nötig. Der Steuermann Uhlenhorst dagegen könne noch hierbleiben und erst später nachkommen.
»Wir fahren nicht mit der Eisenbahn nach Bombay zurück,« sagte Ellen, »sondern von Madras aus mit einem Dampfer.«
Der Ingenieur sann eine Weile vor sich hin, besprach sich dann mit seinem Steuermann, d. h. mit dem Detektiven, längere Zeit und entfernte sich.
»Sie sind heute so furchtbar zerstreut,« sagte Miß Thomson zu Charles, der an ihrer Seite saß, »jetzt frage ich Sie, ob Sie dieses Kunststück schon einmal von einem Elefanten gesehen haben, und Sie antworten: Morgen, heute noch nicht. Warum starren Sie denn nur unverwandt nach Miß Petersen?«
»Ich muß. Es ist nämlich furchtbar interessant, was sich die beiden dort erzählen, und wenn ich nicht immerwährend aufpasse, dann ist alles verloren.«
»Sie sind heute wieder vollständig ver ... verlegen.«
»Verrückt,« ergänzte Charles, »sprechen Sie es nur ruhig aus. Aber nehmen Sie mir dies nicht übel, ich muß heute noch eine Hauptrolle spielen.«
»Sie haben doch keine Ahnung, über was sich diese beiden unterhalten.«
»Vielleicht mehr als Sie,« entgegnete Charles mit pfiffigem Lächeln.
»Ich glaube kaum.«
»Ich werde Ihnen aufschreiben, um was sich das Gespräch dreht, und wenn es auch die anderen erfahren, so können Sie nachsehen, ob ich alles nicht schon vorher gewußt habe. Wollen Sie?«
»Gut, es gilt.«
Charles riß aus dem Notizbuch ein Blatt Papier, schrieb einige Zeilen darauf und faltete es zusammen.
»So! Versprechen Sie mir aber auch, es nicht vorher zu lesen.«
»Nein, ich werde es nicht thun.«
»Dann stecken Sie es ein!«
Miß Thomson nahm das zusammengefaltete Blatt und steckte es in die Tasche. Beide begannen wieder eine Unterhaltung, plötzlich aber sprang Charles auf, ließ sich sein Pferd vorführen und jagte in Karriere über den Platz nach dem Ausgang.
»Das sieht fast so aus, als ob er wirklich wüßte, wovon die beiden sprechen. Nun, ich brauche ja nur seinen Zettel zu lesen. Allerdings habe ich gesagt, ich würde ihn erst nachher lesen, aber das macht ja nichts.«
So dachte Miß Thomson, zog den Zettel aus der Tasche und las:
»Teure Betsy, ich liebe Sie, aber Sie glauben mir doch nicht, wenn ich es Ihnen sage. Deshalb gestehe ich es Ihnen schriftlich.« – –
Lauschen wir nun dem Gespräch, welches Ellen während der Vorstellung mit Shikari führte und wodurch der Indier so aufgeregt wurde.
Ellen hatte lange Zeit der Vorstellung des Elefanten schweigend zugesehen. Als der Wärter des Tieres durch Mukthar abgelöst wurde, welcher mit ihm Kunststücke vornahm, kam Ellen auf den Sohn zu sprechen.
»Ist Mukthar dein einziges Kind?«
»Ja,« entgegnete kurz der Indier.
»Hast du keine anderen gehabt?«
»Nein.«
»Warum sagst du mir nicht die Wahrheit, Shikari? Ich weiß, daß du noch eine Tochter gehabt hast,« sagte Ellen einfach.
Der Indier sah mit finsterem Blick die Sprecherin an.
»Ich habe eine Tochter gehabt, ich kenne sie nicht mehr,« murmelte er dumpf.
»Warum nicht? Darum vielleicht, weil sie dem Manne, den sie liebte, in die Ferne gefolgt ist? Daran tust du sehr unrecht!«
Der alte Mann sprang auf.
»Du bist mein Gast,« grollte er. »Wenn du etwas erfahren hast, so brich meine alten Wunden nicht wieder auf.«
»Ich habe deine Tochter Dchatalja getroffen, sie hat mich beschworen, deine Verzeihung zu erflehen, und ich werde nicht eher von hier gehen, als bis ich diese erlangt habe.«
»Nimmermehr,« rief der Indier mit starker Stimme, »sie ist von mir gegangen ohne meine Einwilligung, sie ist von mir geflohen ohne Abschied, und nie werde ich mich bemühen, sie wiederzusehen.«
»Und warum ist sie von dir geflohen? Weil du nicht einwilligen wolltest, daß sie einem Engländer als Weib angehören sollte, denn du haßtest diese Nation.«
»Nicht mehr,« entgegnete Shikari wehmütig, »die Zeiten sind vorüber, da ich mich mit voller Manneskraft gegen ein aufgezwungenes Joch stemmen wollte. Das Alter macht klug, ich habe eingesehen, daß es für uns besser ist, wenn eine milde, aber kräftige Hand uns regiert, als wenn wir von despotischen Fürsten beherrscht werden. Aber damals,« fuhr er wieder hastig fort, »befahl ich ihr allerdings, sich von jenem Engländer loszureißen, an den sie ihr Herz gehängt hatte. Aber was that sie? Bei Nacht entfloh sie mit ihrem Geliebten. Als ich am Morgen aufstand, war sie fort, ohne Abschied, ohne mir ein Wort zu hinterlassen; der Tiger, der am Thore lag, war vergiftet, das Tier, das sie selbst groß gezogen hatte.«
Der Mann verbarg das Gesicht in seinen Händen.
»Du mißt dem Mädchen alle Schuld bei,« begann nach einer Pause Ellen wieder, »und von dem Manne sprichst du gar nicht.«
»Was geht er mich an?«
»Er ist der schuldige Teil, denn das Herz des Weibes hängt mehr an dem Geliebten, als an den Eltern, so zeigt es uns überall die Natur. Wäre er ein Ehrenmann gewesen, so hätte er sie nicht entführt, wenn ein wirklicher Grund eine Heirat unmöglich machte.«
»Habe ich meine Tochter zur Bajadere erziehen lassen, daß sie sich an den ersten Mann wegwirft?« fuhr Shikari auf. »Mag sie an der Seite ihres Entführers, fern vom Heimatlande, glücklich sein! Ich habe keine Tochter mehr, sprich nicht mehr von ihr.«

Auf diese Weise war mit dem Manne nichts anzufangen, sagte sich Ellen, aber sie hatte noch mehr Hilfsmittel zu Gebote, um das Herz des Vaters zu rühren. Sie glaubte aus dem Zittern seiner Stimme zu hören, daß es ihm mit seiner Entrüstung nicht der rechte Ernst war.
»Hast du nichts wieder von ihr gehört?« begann sie abermals.
»Nie wieder, ich will auch nichts mehr hören, sprich nicht mehr von ihr.«
»Ich habe deine Tochter Dchatalja getroffen,« fuhr Ellen unbeirrt fort. »Willst du nicht erfahren, wie es ihr geht?«
Der Indier schwieg.
»Willst du nicht wenigstens hören, ob die Tochter deiner noch gedenkt?«
»Wie fandest du sie, war sie glücklich?« fragte er endlich tonlos.
»In Elend, Schmach und Schande!« sagte Ellen mit Nachdruck.
Shikari starrte die Sprecherin entsetzt an.
»Auf dem Sklavenmarkt.«
Der alte Mann stöhnte laut auf, vergrub das Gesicht in den Händen und schluchzte wie ein Kind.
»Dchatalja, meine Tochter, auf dem Sklavenmarkt!« jammerte er.
In diesem Augenblick war es, als Charles plötzlich seinen Platz verließ und auf seinem Pferde davonjagte; in der nächsten Minute verschwand auch Mukthar durch die Spalte.
Als sich der alte Mann etwas beruhigt hatte, begann Ellen wieder:
»Willst du nun hören, wie und wo ich Dchatalja getroffen habe?«
Der Indier nickte nur.
»Du glaubtest, sie sei an der Seite jenes Mannes, den sie liebte und dem sie so willig folgte, glücklich und zufrieden?«
»Ich hoffte wenigstens so,« murmelte er.
»So laß dir ihre Geschichte erzählen, und du wirst dann selbst gestehen, daß sie nicht so schuldig ist, wie du glaubst. Und wäre sie es auch, die Leiden, welche sie durchzumachen gehabt hat, müßten das Herz eines jeden zur Verzeihung bewegen, um wieviel mehr das eines Vaters. Hast du noch niemals daran gedacht, daß du selbst den Anlaß dazu gegeben hast, indem du, anstatt Dchatalja, wie die anderen Töchter Indiens, in ihren Gemächern zu lassen, sie mit an die Höfe nahmst und bei deinen Vorstellungen verwendet hast, weil du auf ihre Schönheit stolz warst?«
»Du hast recht,« murmelte Shikari zerknirscht, »ich selbst war mit der schuldige Teil. Erzähle mir von meinem unglücklichen Kinde.«
»Es war ein Leichtes für den englischen Gesandten, der am Hofe weilte, das Herz des jungen Mädchens zu bestricken, es soweit zu bringen, daß es auf seinen Vorschlag, mit ihm zu fliehen, einging. Dchatalja wußte, daß, du ihr nie die Einwilligung geben würdest, einen verhaßten Engländer zu heiraten, aber die Liebe zu ihm war mächtiger als die zu dir, was man ihr nicht als Unrecht vorwerfen kann, und so floh sie mit ihm, in dem festen Glauben, er würde sie als sein Weib nach England führen,«
»That er dies nicht?«
Des Indiers Augen funkelten bei dieser Frage wie die seines Tigers.
»Nein. Es war nicht so leicht, Dchatalja unbemerkt aus diesem bewachten Felsenhaus zu entführen. Doch der Engländer fand für Geld einen Gaukler willig, ihn bei seinem Unternehmen zu unterstützen. Der schlaue Bursche mußte hier Bescheid wissen, mit der Gewandtheit der Schlange, die er dressierte, schlich er sich ein, betäubte die Wächter, vergiftete den Tiger am Ausgang und brachte Dchatalja hinaus.«
»Wie hieß der Gaukler?«
»Du wirst ihn wohl nicht kennen; ich weiß bestimmt, daß er nicht zu denen gehörte, über welche du befiehlst, denn er war weit aus dem Norden und trat, wie ich glaube, überhaupt nur gelegentlich als Gaukler auf, wenn er eine seiner Schandthaten ausführen wollte. Die beiden reisten nach einer kleinen Hafenstadt, um, wie der Engländer vorgab, einen Dampfer abzuwarten, der sie nach seiner Heimat bringen sollte. Aber dem Schurken kam eine solche Absicht gar nicht in den Sinn. Er schob die Abreise von Woche zu Woche hinaus, bis er schließlich eines Nachts spurlos verschwand. Dchatalja war außer sich und wollte verzweifeln, denn den Rückweg zu dir wußte sie verschlossen, und das unerfahrene Kind war in einer fremden Stadt sich vollkommen selbst überlassen. Es erschien ihr als ein großes Glück, als sie eines Tages jenen Indier traf, der bei ihrer Entführung geholfen hatte. Dieser Mann bot sich auch sofort an, sie einstweilen bei entfernten Verwandten unterzubringen, von wo aus sie sich um deine Verzeihung bemühen solle und brachte sie auch wirklich an Bord eines Schiffes. Es gehörte einem Mädchenhändler, an den ihr eigener Landesmann sie verkauft hatte. Sie wurde erst nach Kleinasien gebracht, wo sie einem Kinde das Leben schenkte. Auf der Fahrt nach der Türkei starb es, und so wurde Dchatalja auch noch ihres letzten Glückes beraubt.«
»Und wo trafst du sie?«
Bis jetzt hatte Ellen die Wahrheit erzählt, nun aber mußte sie etwas erdichten, um das Herz des Vaters noch weicher zu stimmen.
»Es war auf einem türkischen Sklavenmarkt, wie solche noch heimlich abgehalten werden. Einst verschaffte ich mir Zutritt zu einem solchen, und hier erfuhr ich das Schicksal Dchataljas aus ihrem eigenen Munde. Ich bot dem Sklavenhändler Summe für Summe, ich versprach ihm, das Gewicht des Mädchens in Gold auszuzahlen – er konnte sich nicht mehr darauf einlassen, Dchatalja war bereits an einen persischen Fürsten verkauft, der das schöne Mädchen um alles in der Welt nicht fahren lassen wollte.«
Der noch immer rüstige Shikari schien während dieser letzten Erzählung Ellens um Jahre gealtert zu sein. Völlig gebrochen saß er in seinem Stuhl, den Kopf auf die Brust gebeugt und ließ die Thränen ungehindert in den weißen Bart rinnen.
»Was hat sie zuletzt noch gesagt? Hat sie meiner noch gedacht?« brachte er endlich hervor.
»Ihre letzten Worte galten dir. Als ich ihr mit blutendem Herzen Lebewohl sagte, fiel sie weinend vor mir nieder und sagte: ›Wenn du meinen Vater siehst, so erzähle ihm, wie du mich gefunden hast, und erbitte seine Verzeihung für mich.«
Der Indier hörte nicht, wie der Tiger am Thor laut aufheulte. Weinend saß er da und jammerte um sein verlorenes Kind.
»Der Tod wird sie bald von ihren Leiden erlöst haben; der Gedanke, daß du ihr nie vergeben würdest, ließ sie verzweifeln,« schloß Ellen.
»Sprich nicht so,« rief der Indier außer sich, »ich kann es nicht länger ertragen. O, Dchatalja, mein Kind, könnte ich dich noch einmal an mein Herz drücken!«
Laut schluchzend verhüllte er sein Gesicht.
Da wurden seine Kniee umschlungen, und eine von Thränen erstickte Stimme rief:
»Vater, so kannst du mir verzeihen?«
Der Indier glaubte, seinen Ohren nicht trauen zu können, und doch, diese Stimme hatte er oft Schmeichelstimmen sagen hören, es war keine Täuschung – vor ihm lag Dchatalja, die wiedergefundene Tochter.

Was soll noch lange geschildert werden, wie der alte Mann sie an seine Brust zog und sie wieder und wieder küßte? Wo waren sein Zorn, seine Entrüstung über das ungehorsame Kind? Nur Freude war in den Augen des Greises zu lesen. —
Charles hatte, begleitet von Mukthar, auf einen Wink Miß Ellens das unter dem Schütze Hastings zurückgelassene Mädchen geholt. Es war ihnen kaum gelungen, sich den Durchgang durch den Spalt zu erzwingen, denn die Tigerin hatte ihre einstige Gebieterin erkannt und wollte das Mädchen mit Liebkosungen erdrücken. Dchatalja wußte noch nicht, daß die Mutter des treuen Tieres ihretwegen vergiftet worden war,
Charles wollte Miß Thomdon aufsuchen, um durch einige Späße sein weiches Herz aufzumuntern, aber das Mädchen drehte sich um und sagte:
»Ich mag nicht mehr mündlich mit Ihnen verkehren, Ihr Briefstil gefällt mir zu sehr.«
»Verwünscht,« dachte Charles und schlug sich vor die Stirn, »daran habe ich gar nicht mehr gedacht,«
Noch hielten sich Vater und Tochter umschlungen, als schon wieder neue Besucher den Felsenhof betraten.
Einige Indier führten einen Mann mit auf dem Rücken gebundenen Armen dem Schlangenkönig vor.
»Die Sonne ist noch nicht untergegangen; auf Befehl Mukthars bringen wir den Mann, der gestern die Schlange entschlüpfen ließ, welche eine Faringi biß,« sagte ein kleiner zierlicher Hindu und verneigte sich tief vor Shikari. »Er versuchte mehrmals uns zu entkommen, aber meine Fesseln vermochte er mit aller seiner Kunst nicht abzustreifen.«
Die Hände des Gefangenen waren auf sonderbare Art mit Stricken umschlungen, und die Knoten zeigten eine ganz eigentümliche Form; die Gaukler können sich zwar aus Banden befreien, aber sie können auch Knoten schürzen, welche selbst der Geschickteste unter ihnen zu lösen nicht im stande ist.
Nur zufällig blickte Dchatalja auf den Gefangenen, aber kaum begegneten sich beider Augen, so wich letzterer entsetzt zurück, während das Mädchen sich plötzlich aufrichtete.
»Das ist der, der mich verkauft hat,« rief sie und deutete auf den Gefangenen.
Willenlos ließ er sich unter der Aufsicht Mukthars nach einer Höhle führen; von hier gab es kein Entspringen, er war in der Mitte solcher Männer, welche jede Flucht unmöglich machen konnten.
Der Detektiv schaute dem Schurken sinnend nach und ging dann zu Harrlington, mit dem er lange Zeit leise sprach.
Es wurde schon dunkel, als die Gäste von Shikari, von dessen Sohn und der wiedergeschenkten Tochter Abschied nahmen. Bevor sie sich trennten, hatte Harrlington noch eine Unterredung mit Mukthar und wurde dabei von dem Detektiven scharf beobachtet, der, obgleich weit entfernt stehend, mit seinen unglaublich scharfen Ohren kein Wort verlor.
»So willst du den Gefangenen nicht abgeben?« fragte Harrlington.
Der junge Indier schüttelte verneinend den Kopf. »Um keinen Preis; er verfällt der Rache meines Vaters.«
»Ich zahle dir hundert Pfund,« fing Harrlington an, hoffend, daß Geld seine Bitte unterstützen würde.
»Nein.«
»Zweihundert Pfund, dreihundert, achthundert, tausend Pfund?«
»Um keinen Preis,« entgegnete Mukthar, »warum willst du für diesen Schurken, der keine Kupfermünze wert ist, eine so hohe Summe zahlen?«
»Einer meiner Freunde muß ihn haben, weil der Gefangene vielleicht ein für ihn sehr wichtiges Geheimnis enträtseln kann.«
»Dann thut es mir leid, daß es nicht mehr in meiner Macht liegt, ihn dir ausliefern zu können,« sagte Mukthar, »ich würde ihn dir sonst schenken.«
Er sah lange sinnend vor sich hin, blickte dann den Engländer fest an und sagte:
»Ihr hofftet, wunderbare Merkwürdigkeiten hier zu sehen, und seid etwas enttäuscht, keine gefunden zu haben. Ich traue dir und der Lady, welche meine Schwester befreit hat, Ihr werdet nicht plaudern. Rufe deine Freundin und folget mir.«
Er schritt voraus, gefolgt von Lord Harrlington und Ellen, aber auch der Detektiv schloß sich ihnen mit der ihm eigentümlichen Ungeniertheit an, ohne den abweisenden Blick Mukthars zu beachten.
Sie gingen zuerst durch eine finstere Höhle, welche aber wiederum in einer kleinen Schlucht endete. In dieser öffnete Muktar eine schwere Thür, zog eine lange Pfeife aus dem Gürtel und sagte:
»Fürchtet Euch nicht und haltet Euch dicht hinter mir; es geschieht Euch kein Leid.«
Er schritt schnell durch die halbdunkle Spalte, und entlockte der Pfeife eine schrille, nervenerschütternde Melodie. Schaudernd sahen die hinter ihm Gehenden, wie überall aus den Löchern in den Felsenwänden züngelnde Schlangenköpfe mit funkelnden Augen hervorlugten. »Die Lieblinge meines Vaters,« sagte der Inder kurz, als er auf der anderen Seite die Thür schloß.

Jetzt mußten sie eine in Stein gehauene Treppe emporsteigen, bis sie auf dem Rücken des hohen Felsens standen. Vor ihnen gähnte ein Abgrund, und es war den dreien, als ob sie ein drohendes Knurren und ab und zu ein Knacken hören könnten.
Der junge Indier winkte, sich vorsichtig an den Rand des Abgrundes zu begeben. Finster deutete er in denselben, und sagte mit tiefer Stimme:
»So bestraft der König der Gaukler denjenigen, der ihm seine Tochter geraubt hat.«
Der Anblick, der sich ihnen bot, machte das Blut in den Adern erstarren.
In einem tiefen Felsenkessel sprangen eine Unmenge von Königstigern, Panthern und anderen Raubtieren umher und jagten sich gegenseitig die Stücke eines zerrissenen Körpers ab. Die zerstreut umherliegenden Kleider verrieten, daß der eben ausgelieferte Gefangene dort unten ein schreckliches Ende gefunden hatte.
Noch ehe die kleine Gesellschaft den Rückweg nach dem Felsenhof antrat, zog der gewissenhafte Detektiv das Notizbuch hervor und strich den Namen und die Beschreibung jenes Fakirs aus seinem Verbrecherregister.
Der ›Blitz‹ lag im Hafen von Bombay zwischen der ›Vesta‹ und dem ›Amor‹.
Wie damals in Alexandrien hatten Ellen, wie auch Harrlington ihre Schiffe unter Aufsicht des Deutschen Ingenieurs zurückgelassen; da dieser aber mit vierzig von seinen Leuten selbst der Gesellschaft gefolgt war, um sie bei ihrer Expedition nach Indien zu begleiten, so hatte er seinen ersten Steuermann damit beauftragt, mit dem Rest der Mannschaft über die Schiffe, und besonders aber die zurückgebliebenen fünfzehn befreiten Mädchen zu wachen.
Jetzt stand der Steuermann, ein kleiner, untersetzter Mann mit intelligentem Gesicht, welches den Deutschen verriet, an Deck des ›Blitz‹ und verhandelte mit einem fremden Seemann. Ersterer schien in großer Verlegenheit zu sein; denn er drehte unaufhörlich seinen Schnurrbart, schob nervös den Kautabak von einer Backe zur anderen und schritt dann wieder einige Male auf und ab.
»Es ist so, wie ich Euch sage,« fing endlich der fremde Seemann wieder an, der den Steuermann spöttisch lächelnd betrachtete, »ich kann mir Euer Mißtrauen nicht erkären. Wenn es ein Telegramm wäre, so wäre Grund dazu vorhanden, aber ein Brief mit ihrer eigenen Unterschrift, müßte doch Euer Bedenken beseitigen.«
»Aber warum giebt mir mein Kapitän nicht den Bescheid, daß ich die ›Vesta‹ mit Euch segeln lassen soll? Offen gestanden, ich mißtraue Euch.«
»Hahaha,« lachte der andere. »Seid Ihr ein Hasenfuß! Ganz einfach, der Kapitän Hoffmamn ist nicht bei der Miß Petersen; wer weiß, wo er gerade steckt, und das Mädel bekam mit einem Male den Einfall, ihr Schiff nach Madras kommen zu lassen und sich von dort einzuschiffen. Wie gesagt, ich und meine Mannschaft haben gerade nichts zu thun, weil unser Schiff stark leckt und im Dock liegt. So kam nun Kapitänin Petersen zu mir, weil sie mir, dem Kapitän Green von der ›Eleanor‹ am meisten traute, und hieß mich mit meiner ganzen Mannschaft nach Bombay reisen, um die ›Vesta‹ nach Madras zu bringen. Ebenso wie Ihr, hat auch der Hafenbeamte den Befehl bekommen, die ›Vesta‹ unter meinem Kommando auslaufen zu lassen. Was giebt's da noch für Bedenken?«
Adam Nagel, der erste Steuermann des >Blitz< holte einen Brief aus der Brusttasche, der vom vielen Auseinander und Zusammenfalten schon ganz zerknittert war.
»Ja, es stimmt,« sagte er, nachdem er ihn wenigstens zum hundertsten Male gelesen hatte, »hier sagt Miß Petersen, die ›Vesta‹ soll unter dem Kommando von Kapitän Green und mit dessen Mannschaft nach Madras segeln, und Eure Papiere beweisen, daß Ihr wirklich der Kapitän Green von der ›Eleanor‹ seid. Auch schreibt sie, daß die Hafenbeamten davon benachrichtigt sind. Der Poststempel ist Madras, ihre Unterschrift kenne ich und sie ist die richtige, ich habe, weiß Gott, keinen Grund, Euch zu mißtrauen.«
»Dann begebe ich mich an Bord der ›Vesta‹, meine Matrosen liegen am Quai, und ich steche sofort in die See. In zwei Stunden haben wir Flut.«
»Stimmt,« entgegnete der Steuermann, »und ich sage Euch, in zwei Stunden sollt Ihr an Bord gehen dürfen, aber nicht eine Minute früher. Bis dahin werde ich von meinem Kapitän per Telegraph eine Antwort erlangen; ich weiß sein Hotel.«
»Thut das,« entgegnete Kapitän Green, stieg in sein Boot und ließ sich ans Land rudern, um Vorbereitungen für seine Abreise treffen zu können.
Adam Nagel schrieb einige Zeilen auf ein Blatt Papier.
»Georg,« rief er dann durch eine Luke ins Zwischendeck hinab. »Schnell auf die nächste Poststation und dieses Telegramm abgeben, halte Dich aber nicht so lange wie gewöhnlich auf.«
Damit händigte er der Ordonnanz das Papier ein.
»Well, Steuermann,« sagte Georg, als er über die Bordwand ins Boot stieg, »hin komme ich schnell, rückwärts aber desto langsamer.«
Der Steuermann schritt unruhig an Deck auf und ab und kaute an den Fingernägeln; es kam ihm zu sonderbar vor, daß ein fremder Kapitän mit der ›Vesta‹ nach Madras segeln sollte; ebensogut hätten diese Uebersiedelung doch einige Leute vom ›Blitz‹ besorgen können; denn nur zwölf Leute waren zu dieser kleinen Reise nötig, und so hätte er immer noch zehn Matrosen an Bord behalten.
Aber Adam Nagel gab etwas auf das Aeußere von Personen, und dieser Kapitän hatte mit seinem kühnen, treuherzigen Gesicht einen guten Eindruck auf ihn gemacht, nur daß er die Haare über die Stirn bis in die Augen gekämmt hatte, gefiel ihm nicht.
Uebrigens mußte ja bald ein Postbote mit der Antwort Kapitän Hoffmanns kommen, wenn nicht, so traf ihn trotzdem keine Schuld – es ging alles vorschriftsmäßig. Ehe noch der neugierige Georg, der sich immer, wenn er seinen Auftrag erledigt hatte, gern in der Stadt herumtrieb, an Bord zurückgekommen war, durchschnitt ein Postboot mit zwölf eingeborenen Ruderern wie ein Pfeil die Wellen und legte zur Seite des ›Blitz‹ bei.
Hinter ihm folgte langsamer das des fremden Kapitäns.
»Steuermann Adam Nagel, Vollschiff ›Blitz‹«,« rief unten der Postbeamte.
»Hier,« antwortete der Gerufene und nahm das Telegramm ab.
»Das ging ja ungeheuer fix, aber unmöglich ist es nicht, alles Schlag auf Schlag.« Er öffnete es und las.
»Die ›Vesta‹ segelt unter Kapitän Green nach Madras. F. Hoffmann.«
»Die Sache ist in Richtigkeit,« sagte er zu dem nun an Bord kommenden fremden Seemann. »Ihr könnt an Bord der ›Vesta‹ gehen und die Anker lichten.«
»Sagte ich es nicht? Lebt wohl! In einer Stunde stechen wir in See.«
Green begab sich wieder an's Land zurück, und Adam Nagel sah, wie er bald darauf mit fünfzehn Matrosen vom Lande abstieß und sich auf das Damenschiff begab. Die fremden Seeleute, anscheinend verschiedenen Nationen angehörend, trafen Vorbereitungen zur Abreise, ordneten die Takelage, schmierten die Ankerrollen, und eine Stunde später verließ die ›Vesta‹ den Hafen von Bombay, den Lootsen an Bord.
Der nachblickende Steuermann sah noch, wie das Vollschiff unsicher hin- und herkreuzte, bis es das offene Fahrwasser erreichte, der Wind legte sich in die Segel, und bald war die weiße Leinwand seinen Augen entschwunden.
»Georg!« rief wieder der Steuermann.
»Georg ist noch nicht wieder zurück,« autwortete ihm der Bootsmann.
»Was,« schrie Nagel, »nach zwei Stunden noch nicht wieder an Bord? Der Bursche übertreibt die Sache denn doch etwas, ich werde es einmal dem Kapitän erzählen!«
Er schritt mit auf den Rücken gelegten Händen an Deck hin und her, manchmal nach der Uhr sehend. Seine Züge nahmen einen immer besorgteren Ausdruck an, wenn er auf die Frage nach Georg eine verneinende Antwort erhielt.
»Rätselhaft,« brummte er vor sich hin, »Georg ist zwar ein Bursche, der sich gern alles ansieht, aber er braucht zu seinen Wegen nicht länger Zeit als ein anderer, weil er auf dem Hinwege rennt und erst auf dem Rückwege gemütlich schlendert. Sollte ihm etwas zugestoßen sein? Weiß der Teufel, ich bekomme einen Verdacht gegen den Kapitän Green nicht aus dem Hirnkasten. Werde einmal selbst an Land gehen und nach Georg forschen.«
Er ließ sich an Land rudern, nahm einen Wagen und fuhr nach der nächsten Poststation. Ein Telegramm jenes Inhalts, wie der Steuermann angab, war hier nicht aufgegeben worden — Nagels Gesicht zog sich in die Länge. Er wollte wieder gehen, doch er drehte wieder um und füllte ein Telegrammformular aus.
»Kapitän Felix Hoffmann, Madras, Hotel France. Die ›Vesta‹ ist unter Kapitän Green nach Madras abgesegelt. Richtig? A. Nagel.«
Dann gab er die Weisung, daß die Antwort hier liegen bleiben sollte, bis er sich selbst das Telegramm abholen würde, und fnhr nach dem Haupttelegraphenamt.
Fast eine Stunde verging, ehe der Steuermann den ihn niederschmetternden Bescheid erhielt, daß in ganz Bombay kein Telegramm mit angegebenem Inhalte aufgegeben worden sei.
Wie ein Verzweifelter langte er auf der ersten Station wieder an, wo bereits eine Antwort seiner wartete, und das Papier zitterte in seinen Händen, als er las:
»Kreuzt die ›Vesta‹ noch vor dem Hafen, bringt sie zurück, ist sie außer Sicht, macht den ›Blitz‹ seebereit Komme sofort. Felix Hoffmann.«
»Meine Ahnung,« stöhnte der Steuermann und stürzte nach dem Wagen.
Der zum ersten Male so Hintergangene dachte vorläufig gar nicht an den verschwundenen Georg; er trieb den Kutscher zur höchsten Eile an. Ehe er sich über die Bordwand schwang, erfuhr er schon, daß Georg noch immer nicht zurück sei; aber das galt ihm jetzt gleich, erst mußte er den Auftrag des Kapitäns erfüllen.
Hell schrillten die Töne seiner Pfeife durch das Schiff, wiederholt vom Bootsmann, und im Inneren des stählernen Baues begann ein Laufen und Arbeiten, daß die Masten bis in die Spitzen erzitterten.
»Wie verhalten sich die Weiber?« fragte an Bord der ›Vesta‹ Kapitän Green einen vierschrötigen Kerl mit einer Galgenphysiognomie, der sich neben ihm über Bord lehnte und dem Spiel des Kielwassers zusah.
»Sie glauben mir alles, nur die eine Schwarze ist mißtrauisch,« antwortete er, »die scheint überhaupt ein Teufelsweib zu sein. Augen hat sie im Kopfe, wie glühende Kohlen, und merkwürdig, ich bin doch ein guter Schläger, aber mit der möchte ich nicht boxen, ich glaube, die kann einem die Knochen im Leibe zerschlagen.«
Der Kapitän lächelte.
»Hat jedenfalls auf einer Plantage schwere Arbeiten verrichten müssen.«
»Fesselt sie lieber, Kapitän, ich traue ihr nicht. Viel ausrichten kann sie nicht, aber die ist so eine, die über Bord springt und dabei jemanden zur Gesellschaft mitnimmt.«
»Unsinn, Jack. Wir wollen lieber möglichst harmlos die Sache erledigen. Sind sie erst an Bord der ›Seenixe‹ dann kann uns gleichgiltig sein, was weiter mit ihnen geschieht.«
»Der Demetri hat immer wundervolle Namen für sein Schiff, erst ›Undine‹ und nun wieder ›Seenixe‹. Möchte wissen, welchen Namen er dann ausfindig macht. Wann will er Euch die Ladung abnehme?«
»Weiß nicht, Jack,« antwortete der Kapitän zerstreut, denn er hatte die Takelage gemustert und gab jetzt ein Kommando, an dessen Ausführung sich alle Matrosen beteiligten, ausgenommen, der mit Jack Angeredete, der ruhig neben dem Kapitän stehen blieb.
Als die Segel in Ordnung waren, sagte Green:
»Demetri kreuzt in diesen Breiten, wir können ihn jede Stunde treffen.«
»Was habt ihr für einen Vertrag mit ihm abgeschlossen?« fragte Jack, der mit dem Kapitän auf sehr vertraulichem Fuße zu stehen schien.
»Ich behalte die ›Vesta‹, und er bekommt die Mädchen, ein sehr gutes Geschäft für mich. Ich hätte mich ja eigentlich nicht in seine Angelegenheiten mischen dürfen, da aber die Sache geglückt ist, so schadet es nichts. Demetri wird glücklich sein, wenn er seine Ladung hat; besser ist es, es fehlen nur drei Sklavinnen, als wenn sie alle weg wären. Den Schlag würde er nicht aushalten können; der Meister hat dafür gesorgt.«
»Der Tausch ist nicht schlecht,« meinte Jack. »Habt Ihr die Einrichtung der ›Vesta‹ schon genauer angesehen? Sie ist pompös!«
»Wertloser Plunder!« sagte der andere geringschätzend. »Das Schiff ist mir die Hauptsache. Als mein voriges wrack wurde, hätte ich nicht gedacht, daß ich hier ein solches bekommen würde.«
Beide schwiegen einige Zeit.
»Die Geschäfte gehen jetzt schlecht,« begann wieder der Kapitän.
Jack stieß einen furchtbaren Fluch aus.
»Nichts ist es mehr,« sagte er ingrimmig, »wohin man auch hört, überall wird eiem von Mißerfolgen erzählt. Dem Demetri werden die Sklavinnen abgenommen, und jene verfluchten Weiber, welche es gethan haben, eutziehen sich allen Schlingen des Seewolfs. Wenn der übrigens nicht schnell einen Handstreich ausführt, wird er seine Rolle bald ausgespielt haben. Mein Kollege Bill munkelte davon, daß bereits andere vom Meister auf die Mädchen gehetzt worden wären.«
»Was macht denn dein Kollege? Kocht er noch immer seine schmackhaften Gerichte?« lachte der Kapitän.
Jack fluchte wieder.
»Dem ist ebensowenig wie mir jemals etwas mißglückt, das wißt Ihr auch, Green,« sagte er prahlerisch, »aber wenn wir keine Aufträge bekommen, können wir natürlich nichts machen. Nun fahre ich schon ein Vierteljahr mit Euch herum und habe uoch keine Gelegenheit gehabt, ein Schiff auf den Grund zu senken. Des Meisters Kasse muß gut gefüllt sein, daß er kein Versicherungsgeld braucht.«
»Sagt, Jack, was wird mit dem Burschen gemacht, dem wir das Telegramm abnahmen?«
»Weiß nicht, so ein indischer Großer hat ihn gleich mit Beschlag belegt, will wahrscheinlich von ihm etwas über den ›Blitz‹ erfahren. Seht da,« unterbrach sich der Sprecher, »ein Segel.«

Der Kapitän hatte während des Gesprächs nicht acht auf den Horizont gehabt. Das ankommende Schiff hatte sich soweit genähert, daß man seine Bauart mit den bloßen Augen erkennen konnte.
»Endlich,« rief er, »die ›Seenixe‹!«
»Dann rate ich Euch nochmals, bindet die Schwarze, sie macht Euch sonst Schwierigkeiten, wenn sie die Täuschung bemerkt.«
»Ihr seid ja furchtbar ängstlich!« lachte Green. »Doch ich werde Euren Rat befolgen.«
Er gab einigen Matrosen Befehle, und diese verschwanden im Zwischendeck.
Die Brigg kam schnell näher und lag nach einer halben Stunde längsseit der ›Vesta‹.
Wie erschraken die armen Mädchen, als sie, sich über die durch das Aneinanderstoßen entstandene Erschütterung ängstigend, an das Deck kamen und in das vor Freude strahlende Gesicht des Demetri blickten, der eben über die Bordwand sprang.
»Habe ich Euch wieder, meine Täubchen?« frohlockte er. »Diesmal werde ich Euch besser behüten.«
Ohne sich zu sträuben, begaben sich die Mädchen an Bord des Schiffes, welches sie einst mit solchem Entzücken verlassen hatten. Ihre Hoffnung war dahin.
Yamyhla wurde gebunden hinübergeschafft. Mit fest zusammengepreßten Lippen schritt sie an dem Griechen vorüber, ohne ihn eines Blickes zu würdigen.
»Wohin segelt Ihr, Demetri?« fragte Green diesen. »Nach Smyrna, wohin Ihr sie zuerst bringen solltet?«
»Seid Ihr verrückt? Nachdem diese dummen Amerikanerinnen ihre That in der Welt ausposaunt haben? Nein, ich gehe nach einem Schlupfwinkel an der Ostküste Afrikas, in der Nähe von Mogador, und hole mir dort weitere Befehle vom Meister. Und Ihr?«
»Wir segeln westwärts, nach Sumatra zu. Unterwegs müssen wir das Aussehen der ›Vesta‹ ändern. Nehmt Euch in acht, daß die Weiber Euch die Mädchen nicht wieder abjagen!«
Sie sprachen noch einige Zeit zusammen, dann schlug jedes Schiff seinen Kurs ein.
Die Gefühle der Mädchen lassen sich nicht beschreiben, als sie sich wieder in dem niedrigen Zwischendeck befanden, an demselben Platze, wo sie vor einigen Monaten gesessen hatten. Doch über jene Treppe war Ellen zu ihnen gekommen, wie ein Engel, und hatte ihnen die Freiheit verkündet, und nun – alles vorbei. Wie glücklich waren ihre drei Gefährtinnen, welche bereits in die Heimat zurückgebracht worden waren! Ach, wären sie doch damals lieber gleich verkauft worden, als daß sie sich so lange mit Hoffnungen und Zukunftsträumen herumgetragen hätten.
Yamyhla war nicht bei ihnen. Sie war gebunden in eine enge Kabine gesperrt, denn Demetri war jetzt vorsichtig geworden und traute der wildblickenden Negerin nicht mehr.
Der Grieche weidete sich an der Furcht der Mädchen und konnte es nicht unterlassen, dieselben zu verhöhnen. Leider gelang es ihm nicht, sie zu reizen, denn die armen Geschöpfe waren viel zu geängstigt, als daß sie seine beißenden Witze verstanden hätten.
Er versprach sich besseren Erfolg bei Yamyhla und begab sich zu dieser, denn er hatte von Green erfahren, daß sie jetzt ziemlich gut Englisch spräche.
Als er in die Kabine trat, lehnte die Negerin, die Hände auf den Rücken gebunden an der Wand der Koje und hatte den Blick zu Boden geheftet.
»Nun, Schatz,« begann der Grieche, »ist es hier nicht viel schöner, als auf der ›Vesta‹? Hier brauchst du nicht zu arbeiten, sondern bekommst dein Essen umsonst. Was meinst du?«
Die Negerin beachtete ihn nicht.
»Nur nicht so stolz,« lächelte er, »wenn du erst die hundertste Frau eines Türken oder Persers bist, dann ist immer noch Zeit dazu, es zu werden. Was sagst du zu meinem Vorschlag, willst du nicht so lange mein angetrautes Eheweib werden?«
Yamyhla schwieg beharrlich.
»Ihr Negerinnen seid doch sonst nicht so spröde,« fuhr er lachend fort und streckte die Hand aus, um sie am Kinn zu fassen, »Sieh mich doch einmal an, bin ich nicht ein ganz schmucker –«
Er kam nicht weiter.
Wie ein Raubtier sprang die Negerin auf den Griechen zu und grub ihre Zähne in seinen Hals. Der Grieche stürzte rücklings zu Boden und Yamyhla über ihn weg, ohne ihn loszulassen; er versuchte, nach dem Dolch zu greifen, aber das starke Weib lag so fest auf ihm, daß er sich nicht bewegen konnte.
Mit blutunterlaufenen Augen – schon verging ihm der Atem – griff er nach dem Halse des furchtbaren Mädchens und würgte es, aber vergebens, es ließ nicht ab, die Zähne tiefer und tiefer in das Fleisch des Verhaßten zu graben.
Fast schwand ihm die Besinnung, als einige Matrosen, durch den schweren Fall herbeigelockt, die Thür öffneten und ihren Kapitän von der Negerin überfallen sahen. Aber auch ihnen gelang es nicht, denselben den Zähnen der Wütenden zu entreißen, bis ein Schlag mit dem Pistolenkolben auf den Kopf sie bewußtlos machte.
Als Yamyhla wieder zu sich kam, war es Abend. Sie lag an Deck an Händen und Füßen gefesselt, und Demetri stand vor ihr, den Hals mit Tüchern verbunden. Er hatte schon längst auf ihr Erwachen gewartet.
»Das sollst du mir büßen, Kanaille,« schrie er mit vor Wut heiserer Stimme und trat sie mit Füßen. »Hast du endlich ausgeschlafen? Dann ist es Zeit, dich für dein Beißen zu belohnen. Habe ich drei Mädchen schon verloren, so kommt es auf eins mehr auch nicht an. An den Mast mit dir, ich selbst will dir die neunschwänzige Katze zu schmecken geben, bis dir das Fleisch vom Rücken fällt!«
Yamyhla wurde emporgerissen und an einen Mast gebunden, das Gesicht diesem zugewandt, ihr Rücken entblößt, und dann begann Demetri, sein Rachewerk auszuüben.
Pfeifend sausten die langen Lederriemen der Peitsche, auf Schiffen die geschwänzte Katze genannt, durch die Luft, klatschend fielen sie auf den nackten Rücken der Unglücklichen, und jeder der neun Riemen hinterließ stets einen blutigen Streifen.

Nicht eher senkte Demetri den Arm, als bis die Ermüdung ihn dazu zwang, und da glich der Rücken der Schwarzen nur noch einer blutigen Masse. Es war eine Wohlthat für sie, daß ihr schon nach den ersten Hieben die Besinnung geschwunden war.
Atemlos hielt der Grieche inne, er warf die Peitsche weg und ging, selbst von dem Blute der Gepeitschten über und über bespritzt, in seine Kajüte, um durch einige Gläser Wein seine Nerven zu beruhigen,
Einer der Matrosen fühlte in seinem steinernen Herzen wenigstens so viel Erbarmen, daß er die Gemarterte aus ihrer stehenden Lage erlöste, er ließ sie aber mit gebundenen Händen und Füßen liegen, wohin sie fiel. Dann ging auch er in das Zwischendeck, um sich durch Kartenspiel mit seinen Kameraden die Zeit zu vertreiben.
Yamyhla wußte nicht, wie lange sie so gelegen hatte; als sie erwachte, war es finstere Nacht.
Sie wußte erst nicht, was mit ihr vorgegangen war, aber die heftigen Schmerzen riefen ihr nur zu bald alles ins Gedächtnis zurück.
Sie war geschlagen worden, sie, die Anführerin der Dahomeamazonen.
Ein brennender Durst quälte sie, der Schmerz der Wunden peinigte sie, aber das alles vermochte nicht, die Nerven dieses Mädchens zu erschüttern. Es war dies nicht das erste Mal, daß sie einen starken Blutverlust erleiden mußte, sie hatte schon öfter in Schwert- und Lanzenkämpfen mit Negern, mit denen sie fortwährend in Streit lagen, Wunden davongetragen, sie war einst schwach, hungrig und fast verdurstet, Tage und Nächte lang durch Wüsten gelaufen, bis ihr Dolch den Weg zum Herzen des Verräters gefunden, und so dachte sie auch jetzt nicht an ihre Leiden, sondern nur daran, wie sie Rache, die furchtbarste, entsetzlichste Rache üben könnte.
Schon früher, ehe sie von den Vestalinnen befreit wurde, hatte sie sich mit dem Gedanken an Flucht beschäftigt. Es wäre ihr ein Leichtes gewesen, zu jeder Zeit sich ihren Wächtern zu entziehen, aber sie hatte es stets hinausgeschoben, bis sie auch weiter fortkommen konnte. Sie hatte ja noch sechzehn Monate Zeit. Jetzt aber galt es zu handeln, denn Rache erleidet keinen Aufschub – so war ihr gelehrt worden.
Sie blickte sich um.
Ein Matrose stand am Steuerrad, und ein anderer, welcher auf den etwa wechselnden Mond zu achten hatte, ging an Deck auf und ab – die übrigen lagen im Zwischendeck und schliefen.
Sie lag neben einem Anker. Geräuschlos wandte sie sich so, daß sie mit den Händen die scharfe Kante desselben erreichen konnte, und fing an, daran die Stricke zu reiben. Jedesmal, wenn der Matrose an ihr vorüberkam, stellte sie ihre Arbeit ein und blieb wie tot liegen.
Es dauerte nicht lange, so fielen die Stricke von ihren Händen.
Als der rastlos Wandernde am weitesten von ihr entfernt war, zog sie aus den buschigen Haaren einen kleinen Dolch in einer Lederscheide und zerschnitt vorsichtig die Banden an den Füßen. Sie verfuhr dabei so behutsam und langsam, daß sie zweimal den Matrosen vorüberlassen mußte.
Dieser ging zum dritten Mal an ihr vorbei und hatte eben das Häuschen, in welchem sich die Küche befand, die Kombüse, zwischen sich und dem am Ruder stehenden Matrosen, als sich eine Hand um seinen Hals legte und ihm ein Dolch in den Rücken gestoßen wurde.
Lautlos fiel er, nein, wurde er zu Boden gelegt. Nicht das geringste Geräusch hatte verraten, daß hier eben ein kräftiger Mann seine Seele ausgehaucht hatte.
Der Mann am Ruder stand arglos vor dem Kompaß und beobachtete die unruhig zitternde Magnetnadel. Er bemerkte nicht, wie sich gleich einer Schlange ein dunkler Körper an der Bordwand entlang wand. Kein Geräusch, kein Anstoßen warnte ihn.
Eine halbe Minute später gab auch er seinen Geist auf, von Yamyhlas Dolch getroffen.
Jetzt galt es, schnell zu handeln, denn gleich mußte das Schiff, dessen Ruder nicht mehr gehalten wurde, aus dem Wind drehen. Die Segel schlugen dann klatschend an die Raaen, das Schiff fing stark an zu schwanken, und so konnte leicht die übrige Mannschaft geweckt werden.
Aber schon stand Yamyhla unten im Zwischendeck, wo die Matrosen schliefen, und hatte die Thür abgeschlossen, dann stieg sie wieder nach oben und verschloß auch noch die Luke – die Besatzung war gefangen, es kostete große Anstrengung, ehe sie sich befreien konnte.
Nun schritt Yamyhla nach der Kajüte, leise öffnete sie die Thür, den Dolch in der Hand, trat sie in den Vorraum und dann in das Zimmer des Kapitäns. Er schlief auf dem Sopha.
Sie näherte sich ihm behutsam, den Dolch zum Stiche erhoben, und tastete vorsichtig nach der Tasche, in welcher er den Schlüssel zu jener Luke hatte, durch welche man zu den Mädchen gelangte. Yamyhla fürchtete immer, er könnte aufwachen, denn dann mußte sie ihn töten, und nur ein einziger kleiner Stoß von dem vergifteten Dolch brachte sofort den unfehlbaren Tod.
Es wäre schade gewesen, wenn er jetzt schon aufgewacht wäre.
Als sie den Schlüssel hatte, ging sie zurück, beide Thüren hinter sich zuschmetternd und abschließend.
»Kommt, Ihr seid frei!« flüsterte eine Stimme den Mädchen zu, welche zu träumen glaubten und der Aufforderung nicht Folge leisten wollten.
Sie wurden mit Gewalt an Deck gedrängt.
»Hört Ihr, wie Eure Peiniger gegen die Thür wüten? Schnell dieses Boot ins Wasser gelassen, dort dieses Wasserfaß und diesen Brotsack hineingethan.«
So ordnete Yamyhla an und eilte zu den übrigen Booten, deren Taue sie durchschnitt, so daß sie klatschend ins Wasser fielen.
»Schnell, in das Boot! Besser wir kommen in den Wellen um, als daß wir länger Sklavinnen sind. Ihr könnt doch nicht gegen die Männer kämpfen, und ich bin jetzt zu schwach dazu, um sie alle einzeln zu überwältigen. Schnell, ins Boot!«
Die noch halb schlaftrunkenen Mädchen ließen das Boot ins Wasser und ergriffen auf Geheiß der Negerin die Riemen, während sie sich ans Steuer setzte, sie stießen ab.
Glücklicherweise hatten die Mädchen wahrend ihres Aufenthaltes auf der ›Vesta‹ mehrere Male Gelegenheit gehabt, sich im Rudern zu üben, so daß die Handhabung der Riemen ihnen nicht so viel Schwierigkeiten bereitete.

»Was wird aus den Matrosen?« fragte scheu eines der Mädchen, als sie sich etwa fünfzig Meter von dem Schiff entfernt hatten.
Stumm deutete Yamyhla nach demselben.
Sie blickten sich um und sahen, wie eben in der Mitte des Schiffes ein roter Schein sichtbar ward. Einige Sekunden später schlug eine mächtige Feuersäule zum Himmel empor, das Meer im weiten Umkreis erleuchtend und jeden Gegenstand an Deck deutlich erkennen lassend.
Da stürzten aus der aufgesprengten Luke die Matrosen, sprangen nach den Booten und fuhren entsetzt zurück – dieselben waren weg.
Yamyhla lachte laut auf und winkte mit der Hand, aber die Zurückgebliebenen konnten die Flüchtlinge nicht mehr sehen.
Plötzlich erschütterte ein furchtbarer Knall die Luft, eine Feuergarbe loderte zum Himmel – und Schiff und Mannschaft waren für immer verschwunden.
Laut Fahrplan sollte der Passagierdampfer ›Medusa‹ Abends 8 Uhr 30 Minuten die Rhede von Madras verlassen. Aus den beiden Schornsteinen quollen dichte Rauchwolken, die Dampfpfeife heulte zu verschiedenen Malen, und die Mannschaft hielt sich an den Winden bereit, die Anker aus dem Grund zu reißen. Aergerlich stand der Kapitän auf der Kommandobrücke, in der Hand die Uhr, deren Zeiger die bestimmte Zeit überschritten hatten, er zögerte aber noch immer, das Zeichen zur Abfahrt zu geben.
Von der ›Medusa‹ waren im letzten Augenblick zwei Matrosen desertiert, zuverlässige waren in dieser indischen Hafenstadt schwer wiederzubekommen, und ohne die festgesetzte Anzahl von Leuten, darf ein Passagierschiff nicht in See stechen, weil bei einem eventuellen Schiffbruch jedes Rettungsboot mit den notwendigen Matrosen als Ruderer besetzt werden muß.
Da hatten sich endlich noch zwei englische Seeleute gefunden, welche gegen Versprechen einer guten Heuer zur Mitreise bereit waren, und der erste Steuermann war schnell mit ihnen nach dem Seemannsamt gegangen, um der gesetzlichen Form der Anmusterung zu genügen.
Jetzt wartete der Kapitän nur noch auf die Rückkehr dieser zwei Leute und des Steuermannes, dann klingelte unter seiner Hand der elektrische Apparat, und unten im Maschinenraum ließ der diensthabende Ingenieur die Schraube sich umdrehen.
An der Bordwand lehnten einige Damen und Herren, darunter auch Claus Uhlenhorst, der angebliche zweite Steuermann des ›Blitz‹ der sich mit der ganzen Gesellschaft per Schiff ebenfalls nach Bombay zurückbegeben wollte.
Neben ihm stand Ellen, die sich bei diesem Seemann von Profession nach den Formalitäten erkundigte, welche bei einer Anmusterung notwendig sind.

»Haben Sie Ihre Papiere vom Hafenmeister empfangen,« fuhr der Steuermann in seiner Erklärung fort – wie wir bereits wissen, war der Detektiv selbst lange Jahre zur See gefahren, »so gehen Sie sofort an Bord Ihres Schiffes, ankern aber vorher noch einmal in einer Bierstube, um auf gute Reise und guten Wind erst einige Gläser zu trinken.«
»Aber doch nicht in diesem Falle, wo Hunderte von Passagieren auf Ihr Kommen warten,« sagte Ellen vorwurfsvoll. »Bedenken Sie, welch eine Verantwortung die Leute haben, wenn durch ihr Verschulden das Schiff sein Ziel zu spät erreicht. Durch die Verzögerung können Millionen in Geld verloren gehen, ein Vater kann seinem im Sterben liegenden Kinde vielleicht nicht mehr die Augen zudrücken.«
»Matrosen haben immer Zeit, so lange sie an Land sind,« meinte der Detektiv trocken,
»Dort kommt das Boot,« unterbrach ihn Ellen, »Ihre Behauptung ist diesmal doch nicht richtig gewesen.«
Hinter einem anderen Schiff schoß ein Boot hervor, in dem die drei Erwarteten saßen, und lag im nächsten Augenblick an der ›Medusa‹, die Leute kletterten an Deck und hißten ihre Kleiderkisten nach.
»Haben die Matrosen kein Glas auf eine glückliche Reise getrunken, so werde ich dies noch besorgen,« sagte Nick Sharp und stand schon auf der Bordwand, »ich kann nicht mit ansehen, daß Sie in Ihr Unglück rennen. Adieu Miß Petersen.«
Damit sprang er in das Boot, welches schon wieder mit seinen Ruderern vom Schiff abstieß. Sprachlos schaute das Mädchen diesem seltsamen Benehmen zu, auch der Kapitän und die übrigen Passagiere an Deck wurden auf den Menschen aufmerksam, der seine Reise bereits bezahlt hatte und sie nun im letzten Moment aufgeben wollte.
»Was thun Sie denn, Herr Uhlenhorst?« rief Ellen ihm zu, der schon den Ruderern die Weisung gab, ihn an Land zu bringen.
»Ich habe Angst vor der Seekrankheit,« lachte der Detektiv zurück, »auf Wiedersehen, meine Damen und Herren! Bringen Sie mein Zeug einstweilen nach Bombay oder sonstwohin.«
Die Ruderer legten sich in die Riemen, und das Boot schoß dahin.
»Einen solchen Narren habe ich noch nie gesehen,« brummte der Kapitän auf der Brücke. »Bezahlt die Reise, wartet bis das Schiff endlich abgeht und fährt dann an Land zurück.«
Er gab das Signal zur Abfahrt.
Die Anker rasselten in die Höhe, die Dampfpfeife gab drei schrille Pfiffe von sich, und hinten an Deck entstand durch die Schraube eine kräuselnde Bewegung im Wasser. Langsam setzte sich die ›Medusa‹ in Bewegung, dann, als sie aus den Schiffen heraus war, nahm sie eine schnellere Fahrt an, bis sie endlich draußen in offener See mit achtzehn Knoten Fahrt dem Süden zustrebte.
»Wissen Sie, was dieses Benehmen des Steuermannes zu bedeuten hat?« fragte Ellen Lord Harrlington.
Auch dieser konnte sich den Vorfall nicht erklären.
»Ich weiß nur einen Grund,« meinte Williams lachend. »Jedenfalls hat Uhlenhorst seine klebrige Tabakspfeife im Hotel liegen lassen, und fühlt er diese nicht in der Tasche, so geht er nicht von einer Stube in die andere, um wieviel weniger unternimmt er ohne sie eine Seereife. A propos, Miß Petersen, in wieviel Tagen erreichen wir Bombay?«
»In dreiundeinemhalben Tag, wenn wir gutes Wetter haben. Morgen Mittag kommen wir durch die Palkstraße zwischen Ceylon und dem Festland.«
»Sie scheinen ja den ganzen Fahrplan im Kopf zu haben,« sagte Charles verwundert.
»Das nicht,« lächelte Ellen, »aber die Karte.«
»Warum fahren Sie eigentlich in einem Schiff nach Bombay und nicht mit der Eisenbahn? Sie hätten dadurch doch zwei Tage erspart.«
»Allerdings, aber die Damen wollen einmal eine Seereise genießen, ohne dabei arbeiten zu müssen, und ich ging auf den Vorschlag ein.«
»Und wohin reisen Sie von Bombay aus?«
»Solche Fragen sind nicht erlaubt, Sir Williams, und Ihnen würde ich es am allerwenigsten sagen, denn wären Sie damals nicht auf die Raa gestiegen und hätten nach uns ausgespäht, so würden wir Vestalinnen unsere Wette bereits gewonnen haben.«
»Ach,« seufzte Charles, »ich bin unglücklich darüber, daß ich diese Dummheit begangen habe, welche mir den Haß aller Damen zugezogen hat. Sehen Sie, ich brauche Miß Thomson nur anzusehen, so dreht sie mir schon den Rücken. Hundertmal habe ich es heute schon probiert und hundertmal mit demselben Erfolg. Nie wieder werde ich einen so voreiligen Ruf ertönen lassen.«
»Dann schreibt er es auf, daß die ›Vesta‹ in Sicht ist,« lächelte Miß Thomson.
Ellen hatte richtig gerechnet.
Als die Gesellschaft am anderen Morgen ihr Frühstück an Deck einnahm, erblickten sie bereits die nördlichste zu Ceylon gehörige Insel Timorathi, und einige Stunden später passierten sie die sogenannte Adamsbrücke, die eigentliche Wasserenge zwischen dem Festland und Ceylon, in welcher die zwei Telegraphenkabel liegen, die Insel und Festland verbinden.
Nach kurzer Zeit hatte man das Land hinter sich, und dem Auge bot sich wieder nichts als das unendliche Meer dar.
Ab und zu kam der ›Medusa‹ ein anderes Schiff entgegen, da sich aber jetzt das Fahrwasser wieder erweiterte, und da jedem Dampfer ein besonderer Kurs vorgeschrieben ist, so verringerte sich mit den Stunden die Zahl der Schiffe, bis man endlich lange Zeit weder Dampfer, noch Segel zu sehen bekam.
Sir Williams besaß ausgezeichnete Augen, und er hielt sich etwas darauf zu gut, daß er stets früher als die anderen etwas genau erkennen konnte. Um diese Eigenschaft noch zu vervollkommnen, trug er immer ein kleines Fernrohr bei sich, mit welchem er jeden am Horizont auftauchenden Gegenstand musterte.
So richtete er auch jetzt, als der auf dem Ausguck stehende Matrose den Ruf ›ein Schiff‹ erschallen ließ, sofort sein Fernrohr nach dem dunklen Punkt in der Ferne.
Ellen stand mit Johanna, Miß Thomson und noch einigen anderen Damen auf dem Vorderteil und wartete, bis sie sich dem Schiff auf Sehweite genähert hatten, denn auf dem Meere erregt ein anderes Fahrzeug stets das größte Interesse.
Plötzlich fühlte Miß Thomson, wie in ihre Hand ein Zettel gesteckt wurde.
Hinter ihr stand Charles.
»Bitte lesen Sie! Wenn ich es Ihnen sage, glauben Sie es mir doch nicht,« sagte er. »Ich darf übrigens auch gar nicht mehr sprechen.«
Miß Thomson warf einen Blick auf das Blatt und entgegnete dann etwas unwillig:
»Ich dächte, es würde nun Zeit, daß Sie einmal Ihre Albernheiten ließen. Ich lasse mir gern Ihre Späße gefallen, weil sie gut gemeint sind; wenn Sie mich aber verspotten wollen, so hört unsere Freundschaft auf.«
»Aber Miß Thomson,« sagte Charles mit kläglicher Stimme, »habe ich Ihnen denn schon einmal eine Unwahrheit gesagt? Kann ich etwas dafür, daß es wirklich wahr ist?«
»Ich finde es sehr unpassend,« fuhr das Mädchen fort und war wirklich sehr ärgerlich, »oder vielmehr lächerlich, daß Sie mir mit solchen Späßen kommen. Was veranlaßt Sie denn zu der Behauptung, daß jenes Schiff dort die ›Vesta‹ ist? Glauben Sie etwa, ich fasse dies als einen Witz auf?«
»Na, was wetten wir denn, daß es wirklich die ›Vesta‹ ist?« entgegnete Charles, Entrüstung heuchelnd.
»Ich habe Ihnen schon einmal erklärt, wenn Sir Williams sagt, es ist die ›Vesta‹, dann ist sie es, wenn es auch ein anderes Schiff ist.«
»Aus Ihnen werde ein anderer klug, ich kann es nicht!«
Mit diesen Worten wandte sich das Mädchen ihren Gefährtinnen zu, die das fragliche Schiff betrachteten, von dem man schon mit bloßem Auge die Takelage erkennen konnte.
Plötzlich faßte Johanna Ellens Arm und rief:
»Ist es eine Täuschung oder nicht? Das kann nur die ›Vesta‹ sein!«
Ellen lachte auf über diese sonderbare Vermutung, wurde aber mit einem Male wieder ernst.
»Sonderbar, es sieht der ›Vesta‹ zum Verwechseln ähnlich, die zierliche Takelage, die weiße Farbe und doch, es ist unmöglich. Warum haben nur die Matrosen keine Segel gesetzt? Sollte das Schiff verlassen sein? Fast sieht es so aus.«
Der Kapitän hatte ebenfalls bemerkt, daß mit diesem Segler, der bei günstigem Wind mit festaufgerollten Segeln dalag, etwas nicht richtig war, und nahm direkten Kurs darauf zu.
»Bei Gott, es ist die ›Vesta‹!« rief jetzt Johanna, außer sich vor Staunen. »Ich erkenne sie nun deutlich.«
Ellen wollte ihr dies ausreden, aber ein Blick durch das Fernrohr belehrte sie, daß kein Zweifel mehr möglich war.
Jenes Schiff dort, welches ohne Mannschaft, die Segel festgebunden und wahrscheinlich auch das Steuerrad, weil es nicht schwankte, als ein Spiel der Wellen umhertrieb, neunhundert Meilen von Bombay entfernt, war die ›Vesta‹.
»Meine Damen,« sagte Ellen, »wir wollen jetzt alles Staunen beiseite lassen. Es ist kein Zweifel mehr, daß dies die ›Vesta‹ ist, die uns hier auf irgend eine rätselhafte Weise entgegentreibt, und unsere Mädchen sind nicht darauf. Jetzt begebe ich mich zum Kapitän und legitimiere mich als Kapitänin dieses Schiffes, und wir können wieder auf die Suche nach den Sklavinnen gehen.«
Sie ging auf die Kommandobrücke.
»Mir bleibt der Verstand stehen,« sagte Miß Thomson zu Charles.
»Das macht nichts,« war die Antwort, »aber jammerschade ist es, daß Sie uns nun verlassen wollen; ich gucke immer aus, ob der ›Amor‹ nicht auch so freundlich ist, uns entgegenzukommen, aber der Kerl hat keine Lust. Sehen Sie nun ein, Miß Thomson, welch' niederträchtiges Unrecht Sie mir angethan haben, als Sie mich einen Lügner, Heuchler, Unverschämten u. s. w. genannt haben?«
»Ich sehe ein, verzeihen Sie mir! Aber woher in aller Welt wußten Sie gleich, daß es die ›Vesta‹ war?«
»Das ist mein Geheimnis. Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag, Miß Thomson. Lassen Sie die anderen Damen allein weiterfahren; hängen Sie diese Weltreise an den Nagel und begeben Sie sich unter meiner sicheren Führung wieder in kultivierte Länder, wo man nicht von Schlangen gebissen und von Tigern gefressen wird.«
Gespannt hingen seine Augen an den Lippen des Mädchens.
Es schwieg einige Minuten lang. Dann gab es ihm die Hand und sagte herzlich:
»Nein, Sir Williams, noch nicht. Machen wir erst diese Reise zusammen.«
»Nein? Dann lassen –« Charles verschluckte eine sehr beliebte Redensart.
»Was wollten Sie sagen?« fragte das Mädchen lächelnd, denn es wußte sehr wohl, was er unterdrückte.
»Dann lassen Sie es sich recht gut gehen und sich nicht wieder von Schlangen beißen.«
Die ›Medusa‹ lag neben dem Vollschiff, ein kurzer Abschied noch, und die Damen waren auf ihrem Schiff.
Zehn Minuten später konnten die weiterfahrenden Passagiere sehen, wie sich auf der ›Vesta‹ die weißen Segel entfalteten, wie sich das Schiff auf die Seite legte und zu kreuzen begann.
Die Herren blickten sich an und fanden lange keine Worte.
»Weinen hilft hier nichts,« unterbrach Charles endlich das Schweigen, »sie sind eben futsch, und wenn uns der ›Amor‹ nicht entgegenkommen will, so müssen wir ihn uns selbst holen.«
»Giebt es denn nur gar keine Erklärung?« rief Lord Harrlington. »Das Schiff kann doch nicht allein hierhergefahren sein.«
Niemand fand eine Antwort.
»Und wie sollen wir die ›Vesta‹ wiederfinden? Ehe wir nach Bombay kommen, vergehen noch zwei Tage, und wer weiß, wo sie sich dann schon befindet,« jammerte man. »Unsere Reise ist zu Ende.«
»Nein,« entgegnete Harrlington, »dafür ist gesorgt. Wir werden die ›Vesta‹ wiederfinden.«
Als die Vestalinnen an Bord ihres Schiffes waren, überzeugten sie sich sofort, daß die fünfzehn Mädchen verschwunden waren.
Ellen eilte durch die Kajüten, durch die Kammern und Räume, sie sah in jede Kabine; nirgends war ein Mensch zu entdecken. Und doch schien es ihr, als ob fremde Hände in ihren Papieren gewühlt hätten. Einige Gegenstände lagen nicht mehr so wie damals, als sie in Bombay das Schiff verlassen hatten, aber es fehlte nichts.
Aus ihrer Arbeitsstube eilte sie auf die Kommandobrücke und begab sich in das Kartenhäuschen.
Da plötzlich entdeckte sie etwas, was eine Auflösung dieses Rätsels bringen konnte: mitten auf dem Tisch lag ein Couvert, adressiert an Miß Petersen, Kapitänin der ›Vesta‹.
Hastig riß sie den Umschlag auf, ein schmaler Pergamentstreifen fiel ihr entgegen, auf welchem nichts weiter stand als:
76° 44' 32" ö. L., 7° 12' 57" s. B.
das hieß, 76 Grad 44 Minuten 32 Sekunden östlicher Länge; 7 Grad 12 Minuten 57 Sekunden südlicher Breite.
»Seltsam,« murmelte Ellen, »eine ähnliche Aufforderung, einen bestimmten Kurs zu nehmen, wollten damals die englischen Herren von dem Geisterschiff bekommen haben, als wir uns im Boot befanden. Ist dieses gespenstische Schiff, von dessen Vorhandensein ich mich mit eigenen Augen überzeugt habe, auch hier im Spiele? Ich wollte es den Herren fast nicht glauben, nun bekomme auch ich einen solchen Befehl.«
Sie suchte die bezeichnete Stelle auf der Karte nach, dort lagen die Lakkadive-Inseln, und gerade da, wo sich die angegebenen Längen- und Breitengrade schnitten, ein winziges Inselchen. Sie waren bewohnt, aber nicht alle, das wußte Ellen. Gerade die bezeichnete war felsig und öde.
Die Vestalinnen wurden zusammenberufen, und es wurde beschlossen, sofort dorthin zu segeln. Eine Ahnung sagte allen, daß sie dort die vermißten Mädchen wiederfinden würden.
Die Entfernung von der Stelle, wo sie sich gerade befanden, bis nach der Inselgruppe, betrug etwa vierhundert Seemeilen, und da sie günstigen Wind hatten, so konnten sie diese in einundeinenhalben Tag zurücklegen.
Unverzüglich wurden dazu Anstalten getroffen.
Am Morgen des zweiten Tages kam die erste jener Inseln in Sicht. Ellen nahm die Sonne auf und fand, daß die ›Vesta‹ bereits dicht in der Nähe der vorgeschriebenen Stelle war.
»Die Insel ist zu sehen,« rief eine Vestalin von der Raa herab, »aber nichts von unseren Schützlingen.«
Es war ein sehr felsiges Eiland, durch frühere Erdbeben entstanden, bergig und zerrissen, sodaß sich die etwaigen Bewohner leicht den Augen der Mädchen entziehen konnten.
Als die ›Vesta‹ um einen Vorsprung herumsegelte, rief wieder die Obenstehende herab:
»Sie sind dort. Sie haben die ›Vesta‹ gesehen und winken uns.«
»Dann werden wir hoffentlich bald eine Lösung dieses Rätsels erwarten können.«
Ellen suchte einen guten Platz, ließ die Anker fallen und stieg selbst mit in das Boot, welches die Mädchen nun zum zweiten Male auf die ›Vesta‹ bringen sollte.
Sie fanden alle beisammen, unversehrt, aber die meisten vor Angst erschöpft.
Yamyhla schilderte nun, was sich zugetragen hatte, und das Erstaunen der Vestalinnen wuchs von Minute zu Minute. Hätten sie nicht selbst ein Wunder erlebt, so würden sie die Erzählung der Mädchen für ein Märchen gehalten haben.
Sie erfuhren, wie Kapitän Green von Madras gekommen sei, um auf Befehl Ellens die ›Vesta‹ nach Madras zu bringen; wie er die Befreiten dem griechischen Mädchenhändler ausgeliefert habe, die Züchtigung Yamyhlas, wie sich diese gerächt, und schließlich, wie die Mädchen auf diese Insel gekommen waren.
»Als die Explosion der Pulvervorräte das Schiff vernichtet hatte,« erzählte die Negerin, »fuhren wir ziellos in die dunkle Nacht hinein. Wir wußten nicht, wo wir waren, wir wußten nicht einmal, nach welcher Himmelsrichtung wir fuhren; aber dennoch waren wir alle froh, jenem schurkischen Demetri abermals entkommen zu sein. Lieber wollten wir in den Meereswogen umkommen, als daß wir zum zweiten Mal auf den Sklavenmarkt geschleppt würden. Ueberdies hatten wir genügend Wasser mit, verstanden uns einigermaßen aufs Rudern, und so konnten wir hoffen, von einem Schiff gesehen und aufgenommen zu werden, wenn auch nicht gleich am ersten Tage.
»Es war eine ruhige, warme Nacht, aber gegen Morgen fiel ein dichter Nebel, daß wir uns bald selbst nicht einmal mehr im Boote sehen konnten. Mir waren kühlende Umschläge auf meine Wunden gemacht worden; ich lag in unruhigem Schlummer, während die Mädchen abwechselnd langsam ruderten, als ich plötzlich geweckt wurde. Der Nebel war so dick geworden, daß ich die Hand nicht mehr vor den Augen sehen konnte, obgleich, meiner Berechnung nach, der Morgen bereits angebrochen sein mußte.
»Die Mädchen klagten mir, daß sie nicht rudern könnten, die Riemen würden ihnen förmlich aus der Hand gerissen, und wollten von mir Rat haben. Ich selbst versuchte zu rudern, aber auch ich konnte es nicht. Der Riemen wurde sofort zur Seite geschlagen. Jetzt tauchte ich meine Hand ins Wasser und fand, daß wir mit ungeheurer Schnelligkeit von einem Strom fortgerissen wurden, vielleicht schon stundenlang fortgerissen worden waren, ohne es bis jetzt bemerkt zu haben. Dies verschlimmerte unsere Lage jedoch nicht, und so warteten wir geduldig, bis wir aus dem Strom herauskommen würden und der Nebel wiche.
»Dann hörten wir, wie der Kiel des Bootes mehrere Male aufscheuerte; den Mädchen wurde es angst, aber ich freute mich darüber, denn jedenfalls trieb uns der Strom an eine Küste. Land konnte ich nicht entdecken, denn noch immer umgab uns ein undurchdringlicher Nebel. Da plötzlich bekam das Boot einen Ruck, daß wir fast von den Ruderbänken geschleudert wurden, und es blieb stehen, es war irgendwo aufgelaufen.
»Wir warteten, bis sich der Nebel verzogen hatte. Als es hell wurde, befanden wir uns hier in dieser Bucht, nur wenige Schritte vom Lande entfernt. Das Boot selbst hatte ein Leck bekommen, aber wir merkten es nicht, denn es saß vollkommen fest, und erst bei Ebbe, als es sich auf die Seite legte, wurden wir das gewahr. Wir wateten ans Land, das zwar eine unbewohnte, felsige Insel war; aber zum Glück fanden wir dort eine Kiste mit Büchsenfleisch und ein Faß mit Trinkwasser, die hier angespült worden sein mögen, sodaß wir wohl für einen Monat mit Nahrung versorgt gewesen wären. Das Boot war unbrauchbar, die nächste, sichtbare Insel schien eine eben solche wie unsere zu sein, und so bestand unsere einzige Aufgabe darin, nach einem Schiff auszuspähen, was wir auch thaten. Zwei Nächte haben wir hier geschlafen, das erste Mal im Freien, weil schönes Wetter war, das zweite Mal, als es regnete, in einer Höhle. Die ganze Insel ist mit solchen durchzogen. Vor einer Stunde sahen wir die ersten Segel, und wunderbarerweise waren es gerade die der ›Vesta‹, wir winkten mit Tüchern, ihr bemerktet es, und so habt ihr uns abermals dem Leben wiedergegeben.«
Die Damen sahen sich groß an.
»Ist dies nicht fast ebenso gewesen, wie damals bei uns, als wir im Boot waren?« sagte Jessy zu Ellen.
Diese ging kopfschüttelnd dahin, wo die Kiste mit dem präservierten Fleisch und das Wasserfaß lagen. Nirgends war ein Schiffszeichen oder eine Fabrikmarke zu entdecken.
»Wäre die Kiste angespült,« dachte sie, »so müßte das Holz beschädigt sein, aber davon ist nichts zu bemerken. Sie ist ganz neu, ebenso wie das Wasserfaß. Was hat das Geisterschiff hiermit zu thun? Wußte es den Aufenthalt der Mädchen? Warum hat es sie nicht selbst an Bord genommen? Oder halt, könnte es das Boot nicht hierher gelenkt, die Mädchen mit Nahrungsmitteln versehen und uns dann benachrichtigt haben, wo wir sie finden würden? Aber wiederum, wo sind jene Männer, wahrscheinlich auch Sklavenhändler oder etwas Ähnliches, welche die ›Vesta‹ besetzt hatten? Es sind noch viele Rätsel zu lösen.«
Georg, die Briefordonnanz des Kapitäns Hoffmann, fuhr mit der ihm vom Steuermann gegebenen Depesche ans Land und schlug den Weg nach dem nächsten Postgebäude ein. Zuerst mußte er an Kapitän Green und dessen Matrosen vorbei, welche auf dem Hafendamm bei ihren Kleidersäcken standen und die Erlaubnis abwarteten, an Bord der ›Vesta‹ sich einschiffen zu dürfen.
Georg war auf der See groß geworden; er hatte schon unter allen Flaggen der Welt gefahren und sich also auch mit verschiedenen Nationen an Bord eines Schiffes zusammenbefunden, aber er mißtraute von vornherein einer Schiffsbesatzung, welche sich aus Matrosen verschiedener Länder zusammensetzte. Denn entweder bekam der Kapitän keine tüchtigen Seeleute, das heißt, Deutsche, Engländer, Holländer oder Skandinavier, weil er als grausamer Tyrann bekannt war, der die Besatzung schikanierte, und er mußte sich mit solchen südländischen Matrosen behelfen, welche Georg mit dem Ausdruck ›Gesindel‹ bezeichnete; oder der Kapitän war selbst ein dunkler Ehrenmann, der sich unter anständigen Menschen nicht wohl fühlte und sich daher extra Italiener, Griechen, Spanier, Amerikaner und Engländer mit wüsten Physiognomien aussuchte.
Und aus solchen Gestalten setzte sich auch die Mannschaft des Kapitäns Green zusammen. Die Hände in den Hosentaschen, die abgebrochene Thonpfeife zwischen den Zähnen, wanderten die südländisch aussehenden Matrosen umher und unterhielten sich in einem Kauderwelsch, welches ebensowohl als Englisch, wie als Spanisch hätte gelten können, andere wieder mit schwarzen Bärten, um den Leib eine bunte Schärpe, hockten phlegmatisch auf ihren Kleidersäcken und pafften eine Cigarette nach der anderen in die Luft, wahrscheinlich Spanier, und wieder andere mit schwarzen Vollbärten, in enganschließende, schwarze Anzüge gekleidet, schwatzten zusammen mit einer Lebhaftigkeit und mit Armbewegungen, daß man immer glaubte, sie wollten sich gegenseitig ermorden, während sie nur ein harmloses Gespräch führten. Das waren Griechen, als Seeleute von Georg gründlich verachtet. Der einzige, der ein einigermaßen vertrauenerweckendes Gesicht aufweisen konnte, war der Kapitän.
Georg selbst befand sich zwar auf einem Schiff, dessen Mannschaft sich nicht nur aus allen Nationen Europas, sondern aus allen denen der Welt zusammensetzte; aber bei dem ›Blitz‹ war dies etwas anderes. Georg wußte, welche Mühe Kapitän Hoffmann gehabt hatte, diese Leute um sich zu sammeln. Stieß er auf seinen früheren Reisen auf Seeleute, die ihm imponierten, so scheute er keine Kosten, sie von ihrem jeweiligen Schiff abmustern zu lasten, es galt ihm gleich, ob ihre Farbe weiß, gelb oder schwarz war. Dann schickte er den betreffenden Mann nach einer deutschen Hafenstadt, ließ ihn dort verpflegen und so lange warten, bis eines Tages der neugebaute ›Blitz‹ gesegelt kam, die erste Besatzung entließ und die nach und nach gesammelte an Bord nahm.
Mit diesen Gedanken beschäftigte sich Georg, als er mit beschleunigten Schritten die Richtung nach der Post einschlug, er bemerkte nicht, daß zwei Männer sich immer in einiger Entfernung hinter ihm hielten und ihn scharf beobachteten.
Jetzt führte der Weg durch den Tempelgarten, welcher in seiner Mitte von Fußpfaden für die Spaziergänger durchkreuzt wird, während rings um ihn herum ein Fuhrweg läuft, auf dem abends Equipagen und Reiter sich bewegen. Am Tage aber, wenn die Sonne mit ihren glühenden Strahlen den Aufenthalt im Freien unangenehm macht, ist dieser Garten völlig verödet.
Georg eilte quer durch die Anlagen nach dem gegenüberliegenden Fahrweg, auf dem eben ein geschlossener Wagen gefahren kam.
»Guter Freund,« sagte da auf englisch eine Stimme hinter Georg, »wo ist der Weg nach dem Hafen?«
Georg wandte sich um und sah zwei elegant gekleidete Herren vor sich stehen, deren Annäherung er gar nicht bemerkt hatte.
»Da sind Sie gerade in der falschen Richtung,« antwortete er höflich, »Gehen Sie diesen Weg zurück und fragen Sie am Ausgang des Gartens nach –«
Er kam nicht weiter.
Der Begleiter des Fragers war wie zufällig etwas hinter Georg getreten, hatte eine Kappe aus der Tasche gezogen und sie dem Ahnungslosen über den Kopf geworfen.
Georg kam gar nicht dazu, an Gegenwehr zu denken, sein erster und letzter Gedanke war nur, daß ihm ein furchtbar betäubender Geruch in die Nase stieg, dann hatte ihn schon das Bewußtsein verlassen.

Ohne aufgefordert zu werden, lenkte der Kutscher die Pferde etwas nach der Seite, die Herren trugen den Besinnungslosen nach dem Wagen, öffneten die Thür und stiegen mit ihm ein. Sofort ließ der Rosselenker seine Tiere anziehen, und der Wagen rollte davon.
»Erst die Depesche,« sagte einer der Herren und untersuchte die Brusttasche Georgs.
»Es ist so, wie wir dachten,« lachte er, als er das Papier gefunden und gelesen hatte, »dieser Tölpel fragt Kapitän Hoffmann, ob die ›Vesta‹ unter Kapitän Green nach Madras segeln soll. Es ist gut, daß wir schon alle Vorbereitungen dazu getroffen haben.«
»Habt Ihr schon eine Antwort ausgefertigt?« fragte der andere.
»Ja, sie ist bereits unterwegs und wird zur rechten Zeit in den Sack des Postbeamten gespielt werden. Darüber seid unbesorgt, es wird nichts fehlschlagen, den einzigen Kummer macht mir nur, wohin wir jetzt diesen Burschen bringen sollen.«
»Wir müssen ihn verschwinden lassen.«
»Natürlich, aber wie, daß es nicht auffällt?«
Beide schwiegen längere Zeit.
Dann zog der erste Sprecher dem Bewußtlosen die Kappe vom Gesicht und sagte:
»Das Einfachste ist, wir geben ihm noch eine kleine Dosis Chloroform einzuatmen und fahren ihn irgendwo in eine menschenleere Gegend, wo wir ihn aus dem Wagen werfen und liegen lassen. Kommt er dann zu sich und schlägt Lärm, so ist unterdes die ›Vesta‹ schon längst verschwunden und hat ein neues Kleid angelegt. Und dann sollen sie hier in Bombay einmal suchen. Hoho!«
»Der Bursche hatte kaum Zeit genug, uns zu sehen, da war ihm schon die Kappe über die Augen gezogen. Deshalb also brauchten wir nicht ängstlich zu sein, selbst wenn wir keine Schlupfwinkel hätten,« meinte der andere.
Er öffnete das Fensterchen an der Vorderseite, welches zu dem Kutscher führte, und rief diesem den Namen eines kleinen Vorortes von Bombay zu, nach welchem der Weg durch ein Gehölz führte.
Dann zog er aus der Tasche ein Fläschchen, entkorkte es und wollte den im Innern der Kappe befindlichen Schwamm anfeuchten, als er plötzlich in seinen Bewegungen innehielt und das Fläschchen schnell wieder verbarg.
Die beiden Männer sahen sich mit ängstlicher Miene an.
Der Wagen hatte gehalten, und sie hörten, wie der Kutscher mit einem Manne auf englisch sprach.
»So geben Sie den Weg frei!« rief der Kutscher ärgerlich, »oder ich überfahre Sie, wenn Sie auch meinetwegen ein Maharadjah wären. Ich sage Ihnen, der Wagen ist besetzt!«
»Werden wir visitiert,« flüsterte der eine der Insassen dem anderen zu, »so sagen wir, den Mann hätten wir bewußtlos, wahrscheinlich infolge Sonnenstichs, im Tempelgarten gefunden. Wir brächten ihn nach unserem Hotel. Verstanden?«
Sein Gegenüber nickte und schob dem Bewußtlosen das entwendete Papier wieder in die Brusttasche.
»Fahren Sie ruhig weiter,« hörten sie die Stimme des Fremden wieder, »ich fahre mit den Herren.«
»Das erlaube ich nicht, wenn meine Fahrgäste damit nicht einverstanden sind,« schrie der Kutscher wütend.
Da aber wurde schon die Thür aufgerissen, und ein vornehmer Indier stieg ohne weiteres in den Wagen.
»Mein Herr,« sagte der eine der Insassen in möglichst ruhigem Tone, »Sie sehen doch, daß der Wagen besetzt ist. Was verschafft uns die Ehre, Sie mit uns fahren zu sehen?«
»Still,« sagte der Indier und winkte mit der Hand, »ich bin einer der Ihrigen. Wohin fahren Sie?«
Die beiden waren über diese Anrede gar nicht so erstaunt, denn es war ihnen schon oft passiert, daß sich ihnen ein Fremder als ihr stiller Helfer vorgestellt hatte. Aber noch fehlte das Zeichen.
»Wir verstehen Sie nicht,« sagte der Herr, der überhaupt die Hauptrolle zu spielen schien, »wir haben einen Bewußtlosen –«
»Schon gut,« unterbrach ihn der Indier und streckte ihm die Hand entgegen, »seien Sie versichert, daß ich Ihr Freund bin.«
Der Herr ergriff die dargebotene Hand und fühlte, wie sich die Finger des Indiers in eigentümlicher Weise um die seinen schlossen.
Jetzt war er beruhigt, er hatte das Zeichen erhalten – dieser Mann gehörte in der That zu derselben Vereinigung, wie er, sein Kollege und auch der Kutscher.
Als letzterer bemerkte, daß seine Fahrgäste gegen die Mitnahme des fremden Indiers keinen Einspruch erhoben, ließ er die Pferde wieder ausgreifen und schlug den Weg ein, der nach dem angegebenen Gehölz führte.
»Wohin fahren Sie?« war des Indiers erste Frage, nachdem er Platz genommen hatte.
Er erfuhr, nach welchem Ziel der Wagen sie führte.
»Gut! Mein Wagen folgt mir, Sie können mir den Burschen überlassen, der für Sie doch keinen Zweck weiter hat.«
»Was wollen Sie mit ihm beginnen?«
»Ich gehe schon lange mit der Absicht um, einen der Matrosen vom ›Blitz‹ wegzufangen,« erklärte der Indier, »weil ich etwas über dessen Kapitän erfahren muß. Als diese Ordonnanz vorhin das Schiff verließ, paßte ich auf und folgte ihr, um mich ihrer zu bemächtigen, weil sie gerade das wissen wird, was ich erfahren will. Sie werden in Verlegenheit sein, wie Sie ihn beseitigen sollen, also ist Ihnen mein Anerbieten, mich seiner anzunehmen, jedenfalls angenehm.«
Die beiden wußten, daß auch dieser Indier einen Auftrag auszuführen hatte, aber ebensowenig wie sie über ihr Vorhaben, sprach auch er über das seinige. Daher fragten sie ihn nicht weiter aus, denn die Wahrheit erfuhren sie doch nicht.
Der Wagen verließ die Häuserreihen und bog in einen mit Bäumen bepflanzten Weg ein.
Da klopfte der Kutscher an das Fenster und sagte:
»Es folgt uns ein anderer Wagen.«
»Es ist richtig! Halte jetzt!«
Die Herren stiegen aus und sahen sich um. Niemand war zu sehen.
Unterdes war der zweite Wagen herangekommen. Er mußte dicht an den ersten heranfahren, und der noch immer bewußtlose Georg wurde, nachdem ihm die Depesche wieder aus der Tasche genommen worden war, hinübergeschafft, ohne daß ein etwaiger Beobachter den Wechsel wahrgenommen hätte.
»Ich fahre jetzt zurück,« sagte der Indier, »und Sie?«
»Auch wir begeben uns nach Bombay zurück, aber auf Umwegen.«
»Gut! Wie lange wird die Betäubung noch vorhalten?«
»Sie war für eine halbe Stunde berechnet, in zehn Minuten wird er wieder erwachen.«
»Haben Sie noch Chloroform bei sich, um ihn für länger besinnungslos zu machen? Sonst müssen wir ihn erst binden und knebeln.«
Georg erhielt abermals den mit Chloroform getränkten Schwamm vor die Nase gedrückt, und die Kappe wurde ihm über den Kopf gestülpt.
»Können wir uns darauf verlassen, daß er Ihnen nicht entschlüpfen und plaudern wird?«
»So sicher, als wenn er jetzt schon tot wäre,« entgegnete der Indier, sprang in den Wagen und nahm neben dem bewußtlosen Körper Platz.
»Gute Geschäfte, meine Herren! Fort, Kutscher!«
Der Indier schlug die Richtung nach Bombay ein, während die Herren vorläufig den eingeschlagenen Weg weiterfuhren. – – –
Als Georg aus seiner Betäubung erwachte, fand er sich auf einem Diwan liegend.
Es dauerte nicht lange, so entsann er sich, warum er sich nicht im Zwischendeck seines Schiffes befand.
»Mein Gott,« rief er und griff in die Brusttasche.
Die Depesche war fort – jetzt war ihm alles klar. Er entsann sich, wie ihn zwei Herren im Tempelgarten nach dem Weg gefragt hatten, wie ihm etwas über die Augen gelegt und ihm plötzlich die Besinnung geschwunden war.
Was weiter mit ihm vorgegangen, wußte er nicht.
Alles war ein wohl überlegter Plan gewesen; der angebliche Kapitän Green hatte also von Miß Petersen gar nicht den Auftrag erhalten, die ›Vesta‹ nach Madras zu bringen, sondern wollte sich der befreiten Mädchen oder vielleicht auch nur des Schiffes bemächtigen und nahm die Mädchen als Zugabe mit.
Adam Nagel war schändlich getäuscht worden, seine Anfrage an Kapitän Hoffmann war in die Hände dieser Piraten gefallen und würde ihn nie erreichen.
Wie die Spitzbuben den Steuermann, der nun nach der Meinung Georgs keine Antwort vom Kapitän erhielt, weiter täuschen würden, um sich in Besitz der ›Vesta‹ zu bringen, wußte er nicht; aber wenn diese Schurken solche Mittel anwendeten, um bloß die Depesche abzufangen, so konnten sie jedenfalls auch Wege finden, dem Steuermann eine erlogene Antwort zu geben.
Georg hatte ganz richtig gerechnet. Als ein treuer Mensch hatte er zuerst an den Schaden gedacht, den sein Herr durch seine Gefangennahme erlitt.
Aber er selbst?
Daß sie ihn aus der Welt verschwinden lassen würden, glaubte er nicht. War die ›Vesta‹ erst fort, so wurde er sicher frei gelassen, aber so, daß er nicht merkte, wo er sich befunden hatte, und er konnte sein Schiff wieder aufsuchen.
Georg kratzte sich hinter den Ohren, wenn er sich ausmalte, was geschehen würde, wenn er, der sonst so schlaue und zuverlässige Bote, wieder an Bord des ›Blitz‹ erschien. Aber er fühlte sich unschuldig, er hatte nichts getrunken und sich nirgends aufgehalten, und so konnte er dem Steuermann, wie dem Kapitän ruhig in's Auge blicken.
Die Thüren des Gefängnisses waren natürlich verschlossen, das Fenster lag im zweiten Stock und war vergittert. Es führte nach einem parkähnlichen Garten hinaus, der aber vollständig verwildert war, Georg konnte keinen Menschen darin erblicken.
An Flucht war demnach nicht zu denken. Er legte sich also ruhig auf den Divan und wartete der kommenden Dinge. Entweder mußte er einmal freigelassen werden, oder auch, daran zweifelte er nicht, Kapitän Hoffmann würde bald Himmel und Hölle in Bewegung setzen, seine Ordonnanz tot oder lebendig wiederzubekommen. Unter Georgs Kameraden gab es auch welche, die mehr als Brot essen konnten.
Georg hatte durch Einatmen des Chloroforms Kopfschmerzen bekommen, er fühlte sich noch sehr schläfrig und war bald wieder sorglos entschlummert.
Da wurde er am Arm gefaßt und geschüttelt.
Als er emporfuhr und sich die Augen rieb, bemerkte er, daß es bereits Nacht geworden war. Auf einem Tischchen brannte eine Lampe, und vor ihm stand ein reich gekleideter Indier.
»Steh' auf,« sagte derselbe in kurzem, aber nicht unfreundlichen Tone eines Menschen, der das Befehlen gewohnt ist.
Georg stand auf.
»Fühlt Ihr Euch wohl?«
Georg bejahte; er wußte zwar nicht, was man mit ihm vorhatte, jedenfalls aber sollte er jetzt entlassen werden.
»Hört, was ich Euch jetzt sagen werde!« begann der Indier. »Beantwortet Ihr die Fragen, die ich an Euch stellen werde, so gut Ihr könnt, so soll Euch kein Leids geschehen. Ihr werdet noch heute nacht dieses Haus verlassen und zwar reich beschenkt – Ihr braucht nicht mehr zu arbeiten – weigert Ihr Euch aber, so werde ich die Antworten mit Gewalt von Euch erpressen, und Ihr verlaßt dieses Haus nicht lebendig. Habt Ihr mich verstanden?«
Georg war verblüfft. Was konnte dieser Indier von ihm erfahren wollen? Er hatte keine Ahnung, was der Mann im Sinne hatte.
»Dann ziehe ich das Erstere vor. Fragt los!« sagte er.
»Es freut mich, daß Ihr vernünftig seid,« entgegnete der Indier, »so werden wir als gute Freunde von einander scheiden. Also erstens: Wo ist der ›Blitz‹ gebaut worden?«
Georg riß vor Staunen Mund und Nase auf. Wie kam dieser Indier zu einer solchen Frage?
»Oho,« dachte er, »da kennst du Georg schlecht, wenn du von ihm etwas über den ›Blitz‹ erfahren willst.«
Er schwieg.
»Bist du nicht die Ordonnanz vom ›Blitz‹?« fragte der Indier.
»Ich bin's.«
»Nun also nochmals: Wo ist der ›Blitz‹ erbaut worden?«
Georg blieb wieder die Antwort schuldig.
»Vielleicht auf einer Insel an der Ostküste Schottlands?«
Keine Antwort.
»Willst du mir nicht antworten, Bursche?« fuhr der Indier jetzt heftig auf.
»Mein Herr,« sagte Georg ruhig, »fragen Sie mich, über was Sie wollen, und ich werde Ihnen antworten, nur nicht über den ›Blitz‹ und alles, was diesen betrifft. Da werden Sie nie eine Antwort von mir erhalten.«
Fest sah er den vor ihm Stehenden an.
Der Indier machte eine drohende Bewegung, aber er bezwang sich sofort, als er in den blauen Augen des Mannes ein seltsames Aufleuchten bemerkte.
Er hatte keinen eingeborenen Diener vor sich, den er nach Belieben schlagen durfte. Dieser Mann war jetzt noch frei und würde ihm jeden Schlag mit seinen kräftigen Fäusten zurückgegeben haben. Er ging zur Thür hinaus und schloß hinter sich ab.
»Also das ist es,« seufzte Georg und ließ sich auf das Polster fallen, »dann steht es allerdings schlimm mit mir. Und ich weiß gar nicht viel vom ›Blitz‹, was ich verraten könnte. Aber nein!« Er sprang heftig auf. »Ich habe versprochen, das Geheimnis des Schiffes zu wahren, und auch das Wenige, was mir bewußt ist, soll mir keine Macht der Erde entreißen können. Mag man mich quälen, foltern oder verhungern lassen, mein Mund wird schweigen.«
Ein Diener brachte einige Teller mit kalten Speisen herein und setzte sie auf den Tisch.
Gleichzeitig betrat wieder der Indier das Zimmer.
»Na,« dachte Georg, »mit dem Verhungern sieht es ja noch nicht so schlimm aus.«
»Ihr seht,« begann der Indier, »ich will Euch mehr als Gast, denn als Gefangenen behandeln. Beantwortet mir die wenigen Fragen, und Ihr könnt sofort in meinem Wagen dieses Haus verlassen! Ich weiß wohl, daß Ihr selbst nicht viel vom ›Blitz‹ erzählen könnt, und deshalb will ich Euch möglichst freundlich behandeln. Antwortet mir, dann könnt Ihr ruhig essen, wenn Ihr wollt, und werdet entweder fortgebracht, oder Ihr verbringt diese Nacht in einem Kellerraum. Vielleicht seid Ihr morgen gefügiger, sonst giebt es noch andere Mittelchen, Euch mitteilsam zu machen.«
Georg blieb stumm.
»Ihr wollt nicht antworten?«
»Zum Teufel, nein!« schrie Georg. »Merkst du dies nun endlich?«
»Oho,« sagte der Indier und rief einige Namen.
Sofort kamen vier Hindus in das Zimmer und wollten Georg fassen, um ihn hinauszubringen. Sie hatten sich aber verrechnet.
Als sie ihn ergreifen wollten, fuhr dem einen die Faust des jungen Deutschen in die Augen, dem anderen an den Magen, und die übrigen bekamen ein paar Fußtritte, daß sie ächzend an die Wand flogen.
»Nur immer her!« schrie Georg. »Solche Ware habe ich noch mehr auf Lager.«
Auf das Geschrei der Diener stürzten noch mehr Hindus in's Zimmer, und schließlich gelang es ihnen, den wütend um sich Schlagenden zu bändigen.
»Ihr seid selbst schuld daran,« sagte der Indier, noch immer ruhig, »daß mit Euch so verfahren wird. Gebt mir Antwort, und sofort seid Ihr frei!«
Er stand dicht vor Georg.
»Selber schuld daran?« lachte dieser bitter, »Hund verdammter, da, nimm das als Gutenachtgruß.«
Dabei stieß er dem Indier den Fuß in den Leib, daß dieser mit einem Schmerzensschrei zu Boden fiel. Schäumend vor Zorn sprang er auf den Gefangenen zu, erhielt aber sofort abermals einen Fußtritt, daß er wieder niederstürzte.
»In den Stock mit ihm, in den Stock,« brüllte er. »Dort wird er das Treten vergessen lernen.«
Er wagte es nicht, sich zum dritten Male dem schlagfertigen Deutschen zu nähern.
Georg wurde aus dem Zimmer in einen Kellerraum geschleppt, in dem sich ein sogenannter Stock befand, in welchen widerspenstige und ungehorsame Diener für einige Stunden eingesperrt wurden. Der junge Mann wurde gezwungen, sich niederzulassen, und die Hindus spannten seine Beine und Hände in einen Block, so daß Georg in gekrümmter Lage saß, ohne sich rühren zu können.
Es machte den Hindus ein ungeheures Vergnügen, Georg zu quälen, war es doch das erste Mal, daß anstatt eines Eingeborenen ein Faringi diesen Platz einnahm. Glücklicherweise verstand der junge Deutsche kein Indisch, sodaß ihn die höhnischen Bemerkungen nicht ärgerten.
Er befand sich in einer verzweifelten Lage. Den Rücken krumm gebogen, die Beine so emporgezogen, daß die Kniee die ausgestreckten Arme berührten, und Hände und Füße in die Löcher des Balkens gespannt, so saß er da und grübelte über sein ferneres Schicksal nach.

Das war eine trostlose Aussicht, denn der gereizte Indier würde jetzt nicht zögern, seine Drohungen zu erfüllen, das heißt, den Gefangenen solange zu foltern, bis derselbe das, was er über den ›Blitz‹ und dessen Kapitän wußte, gesagt hätte.
Georg hatte einst in seiner Jugend auf einem Jahrmarkt eine Folterkammer mit allen jenen schrecklichen Instrumenten gesehen, wie sie im Mittelalter bei Hexenprozessen gebraucht wurden, und große Bilder zeigten überdies recht anschaulich, wie jene angewendet wurden. Frauen mußten auf glühenden Kohlen stehen, ihre Körper wurden auf Bänken gereckt, bis die Knochen auseinanderrissen, sie wurden an den Händen aufgehängt, an den Füßen Centnerlasten befestigt, mit glühenden Eisen gezwickt und gestochen, aufs Rad geflochten und anderes mehr.
Georg schauderte es, wenn er daran dachte, daß ihm Aehnliches bevorstand. Aber dennoch, sie mochten ihn schinden, plagen und quälen, er nahm sich fest vor, sich lieber die Zunge abzubeißen, ehe er ein ihm anvertrautes Geheimnis verriet.
Er hätte sich deshalb ja vor sich selbst schämen müssen, daran gar nicht zu denken, daß er sich auf dem ›Blitz‹ jemals wieder hätte sehen lassen dürfen.
Unterdes vergingen noch einige Stunden, ehe der Tag anbrach, und Georg hoffte, daß bis dahin seine Kameraden alles aufbieten würden, seinen Aufenthalt zu erfahren.
Der Morgen kam, und Georg saß noch immer im Stock. Er wußte nicht mehr, ob er noch Arme und Beine habe. Jede Empfindung war aus denselben verschwunden.
Gegen Mittag öffnete sich die Thür, und der Indier trat ein. Mit finsteren Blicken blieb er vor dem Gefangenen stehen.
»Hat sich nun Euer hitziges Blut beruhigt?« fragte er, ohne zu verraten, daß er noch an die gestern empfangenen Fußtritte dachte.
Georg wunderte sich darüber. Er hatte geglaubt, der Indier würde seine Wut an ihm auslassen, aber wunderbarerweise war derselbe vollkommen ruhig. Er schloß daraus, daß es dem Indier lieber war, wenn er erst die Fragen beantwortet bekäme, als wenn er den Gefangenen wieder reizen müßte. Aber daß er später noch seine Rache befriedigen würde, davon war Georg vollkommen überzeugt.
»Seid Ihr nun geneigt, mir zu antworten? Es ist noch dasselbe: entweder Ihr antwortet und seid frei, oder Ihr werdet gefoltert, und wenn Ihr dabei sterben müßt.«
Der Gefangene lachte höhnisch auf.
»Macht das einem anderen weiß, daß Ihr mich laufen lassen werdet,« entgegnete er.
»Euer Wort gilt mir ebensoviel, wie das Bellen eines Hundes. Nein, nein und abermals nein. Ihr sollt nichts erfahren.«
»Verfluchter Faringi,« schrie der Indier, der seine Wut nicht mehr bezähmen konnte, »Dein Trotz soll bald gebrochen werden. In einer Viertelstunde wirst Du Dein Wehgeschrei vergebens zu Deinem Gott aussenden.«
Er trat Georg mit den Füßen.
In diesem Augenblicke ging die Thür auf, und im Rahmen derselben erschien ein eingeborener Diener, der seinem Herrn auf Indisch etwas sagte. Dieser stellte mehrere Fragen und ging dann hinaus, sich vorher noch einmal umwendend.
»Mache Dich bereit,« sagte er, »noch heute wird Dir Deine Zunge geschmeidig gemacht werden.«
Hinter ihm fiel die Thür in's Schloß, und Georg hörte, wie der Schlüssel umgedreht wurde.
Er war wieder allein und beschäftigte sich mit traurigen Gedanken. Jedenfalls hatte der Indier von dem Diener eine Mitteilung erhalten, welche ihn abrief, also war die Folter nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben.
Manchmal eilte jemand an der Gefängnisthür vorüber, und jedesmal glaubte Georg, der Unbekannte würde seinen Lauf hemmen, den Schlüssel in's Schloß stecken, und zu ihm kommen, um ihn nach der Folterkammer zu führen, aber immer ging der Betreffende vorbei. Es waren Stunden der entsetzlichsten Qualen.
Der Tag verging; die Sonne warf bereits ihre letzten Strahlen durch das kleine, starkvergitterte Fenster in den Kellerraum, und Georg hockte noch immer mit gekrümmtem Rücken da. Er begann jetzt zu hoffen, daß irgendetwas seine Folterung unmöglich gemacht habe, dann aber ward er wieder ängstlich.
Bereits vierundzwanzig Stunden saß er hier, ohne Essen, ohne Wasser; Hunger und Durst begannen sich fühlbar zu machen. Wie aber, wenn er vergessen würde? Wenn der Indier abgerufen ward und nicht mehr an sein Opfer dachte?
Entsetzlich! Schon jetzt versuchte Georg, ob er mit den Zähnen den Arm erreichen könnte, um sein eigenes Blut zu trinken, er machte den Versuch erst nur aus Scherz, aber das Blut gerann ihm in den Adern; die Haare sträubten sich, wenn er sich die Qualen der nächsten Tage ausmalte.
Die Nacht brach an, und Georg saß im Block und wartete. Es waren Menschen im Haus, er hörte Schritte über dem Kellergewölbe, aber zu ihm kam niemand.
Der Gefangene schien vergessen.
Mehr noch als der Hunger, fing der Durst an, ihn zu quälen. Es war den ganzen Tag schwül gewesen, es war heiß in dem Keller. Die Kehle war ihm vertrocknet, der junge Mann war dem Verzweifeln nahe.
Er schrie, so laut er konnte: Wasser! Es war das Einzige, was er jetzt herbeisehnte; mochten sie ihn dann foltern, aber nur erst eine Linderung!
Seine Kehle wurde durch das Schreien nur noch trockener, er gab es als nutzlos auf, denn die Menschen, die bereit waren, jemanden bis aufs Blut zu quälen, hätten ihn auch verdursten sehen können.
Stunde auf Stunde verrann, vollständige Dunkelheit umgab Georg, sein Mut war gebrochen. Stumpfsinnig saß er da und stierte vor sich hin. Wasser, das war sein einziger Gedanke. Er bekam schon Halluzinationen; er glaubte sich an einer Quelle, er hörte sie rauschen; er trank und trank, und sein Durst wurde doch nicht gelöscht.
Ein lauter Schritt weckte ihn einmal aus seinem Brüten.
»Wasser!« murmelte der Unglückliche mit brennenden Lippen. »O Gott, erbarme Dich meiner, sende Deinen Engel!«
Da legte sich eine Hand auf seine Schulter. Er konnte zwar niemanden sehen, aber er erschrak nicht. Er hörte nur das eine Wort:
»Trinke!«
In langen Zügen sog der Unglückliche aus der vorgehaltenen Flasche das erquickende Naß, bis sie keinen Tropfen mehr enthielt.
»In dem Wasser war ein Viertelliter Wisky,« flüsterte eine Stimme vor ihm, »das Geld dafür giebst Du mir ein ander Mal wieder, vergiß es aber nicht! Jetzt mach', daß du aus dem Block kommst!«
»Sharp,« rief Georg; er hatte ihn weder gesehen, noch an seiner Stimme erkannt, aber die Sprechweise verriet ihm den Namen des Helfers.
»Schrei nicht so! Wie lange bist Du schon hier?«
»Ich weiß nicht; ich glaube zwei Tage,« flüsterte Georg zurück.
»Ein bißchen lange.«
Georg hörte, wie der Detektiv – denn der war es wirklich – am Schloß des Stockes hantierte. Dann wurde der doppelte Balken anseinander genommen, und Georg war frei.
Wie ein Stück Holz rollte er zur Seite.
»Jetzt mach', daß deine Knochen beweglich werden, während ich das Fenstergitter durchsäge.«
Kaum vernahm Georg das Geräusch, welche die haarscharfe Säge verursachte, so geschickt wußte der Detektiv damit umzugehen.
»Wie kommen Sie hier herein?« fragte er leise, während er, noch immer am Boden liegend, Arme und Beine bewegte.
»Immer durch die Thür.«
»Ich habe Sie aber nicht gehört.«
»Entschuldige nur, daß ich nicht vorher angeklopft habe. Bist du bald im stande, gehen zu können? Ich habe nur noch zwei Stäbe zu durchfeilen.«
»Gleich.«
Georg war überglücklich. Er war, den Kapitän und die beiden Steuerleute ausgenommen, der Einzige von der Besatzung des ›Blitz‹, der Sharps eigentlichen Beruf kannte; die anderen hielten denselben für einen Freund des Kapitäns, der die Reisen mitmachte, oft tagelang sich in seiner Kabine einschloß und dann wieder für Wochen wegblieb. Aber mit Georg hatte er Freundschaft geschlossen und verkehrte viel mit ihm, weil er manchmal dessen Aussehen annahm.
Dieser fühlte sich in der Nähe des Detektiven so sicher, als wäre er in seiner Koje an Bord des ›Blitz‹. Von diesem Manne, der über alles in scherzhaftem und wegwerfenden Tone sprach, ging eine Sicherheit und Ruhe aus, die selbst gebildeten Personen imponierte, geschweige denn Georg, dem einfachen Matrosen, der den Detektiven wie einen Gott verehrte.
»Fertig?« fragte derselbe.
»Es geht.«
»So ziehe schnell deine Sachen aus, ich habe das schon gethan.«
»Wozu denn?« fragte Georg verwundert.
»Frage nicht lange, sondern beeile Dich! Ich werde dir schon alles erzählen.«
Georg gehorchte, und der Detektiv, der im Dunklen ebensogut wie am Tage zu sehen schien, tauschte seine Kleider mit ihm.
»So,« sagte Sharp, nachdem er selbst die Sachen Georgs angezogen hatte, »weißt du, wohin du gehen mußt?«
»Nein.«
Der Detektiv beschrieb ganz genau den Weg, den Georg einzuschlagen hatte, um nach dem Hafen zu kommen. »Der ›Blitz‹ ist nicht mehr da, weiß nicht, wo er sich herumtreibt, aber dafür liegt der ›Amor‹ auf der Rhede, und auf den gehst du vorläufig. Die Herren werden dein Verschwinden schon erfahren haben, denn Hoffmann hat einen Brief für sie hinterlassen, und jedenfalls werden sie nach dir suchen, natürlich vergeblich, kalkuliere ich.«
»Und Sie?« fragte Georg.
»Ich setze mich als Georg in den Stock.«
»Sie werden gefoltert werden.«
»Werde wohl nicht stille halten.«
»Aber wozu wollen Sie denn nur hier bleiben?« fragte Georg wieder, der das Benehmen des Detektiven oft nicht begreifen konnte, und jetzt am allerwenigsten.
»Will mich einmal etwas mit dem Indier unterhalten, der sich so für dich interessiert,« entgegnete Sharp. »Was habt ihr bis jetzt miteinander verhandelt?«
Georg teilte ihm so kurz wie möglich das Geschehene mit.
»So, jetzt kriech' leise durch das Fenster und komme gut an Bord,« sagte Sharp.
»Soll ich Ihnen nicht erst helfen, in den Stock zu kriechen?« fragte Georg.
»Glaube gar! Das mache ich allein.«
»Aber Sie können dann nicht zuschließen.«
»Ich schließe eben erst zu und stecke dann die Hände und Füße durch,« lachte der Detektiv, »die gehen durch alles, was Hand- oder Fußgelenk auch noch so knapp umspannt.«
»Dann viel Vergnügen, und geben Sie es dem Schurken ordentlich, er hat es verdient!«
»Well, Georg, wird besorgt! Gute Nacht, mein Junge!«
Georg kroch durch das Fenster und war bald in der Finsternis verschwunden.

Als sein leiser Schritt selbst dem scharfen Ohr des Detektiven nicht mehr vernehmbar war, setzte derselbe vorsichtig seine Pfeife in Brand und rauchte Stunde um Stunde, bis der Morgen zu dämmern begann.
Da setzte er die zersägten Stäbe wieder derart ein, daß von dem Zerstörungswerk nichts mehr zu sehen war, und schloß mit einem Draht den Stock. Dann entledigte er sich seiner Schuhe, schob die Füße ohne Anstrengung durch die engen Löcher und zog die Schuhe wieder an. Bevor er die Hände in die Öffnung schob, biß er sich ein Stück Kautabak ab, um bei diesem langweiligen Warten wenigstens eine angenehme Unterhaltung zu haben.
Wer von dem vollzogenen Tausch nichts wußte, hätte schwören können, immer noch Georg vor sich zu haben, denn der Detektiv hatte ganz das Aussehen desselben angenommen.
Sharp mußte lange warten, ehe das Leben in dem Hause erwachte, dann aber kam es auch mit einem Male. Schritte eilten hin und her, überall erscholl Pochen und Lärmen. Stimmen schrieen so laut, daß man sie selbst im Keller hören konnte.
»Was mag das sein?« dachte Sharp. »Das klingt ja sonderbar, gerade wie ein Überfall.«
Er sollte nicht lange im Zweifel sein.
Jetzt näherten sich seiner Zelle hastige Schritte – der Detektiv zog ein klägliches Gesicht – die Thür wurde aufgeschlossen, aufgerissen, und herein traten – Lord Harrlington, Williams und noch mehrere Herren vom ›Amor‹.
»Sind Sie die Ordonnanz vom ›Blitz‹?« rief Harrlington. »Freuen Sie sich, Mann, Sie sind frei!«
Der Detektiv war anfangs starr, aber im nächsten Augenblick war die Reihe des Erstaunens an den Herren.
Plötzlich zog der Gefangene die Hände und Füße aus dem Stock, sprang auf und schrie mit donnernder Stimme:
»Nun schlage aber doch Gott den Teufel tot! Jetzt sitze ich hier die ganze Nacht im Stock, damit Sie mich befreien können! Stecken Sie doch Ihre Nase in Ihre stinkigen Theerfässer und nicht in meine Angelegenheiten. Adjös, meine Herren, mich sehen Sie nicht wieder.«
Schmetternd fiel die Thür hinter ihm ins Schloß.
Die Herren fanden lange keine Worte, sprachlos schauten sie sich an. Dann griff sich Williams langsam an die Stirn und sagte:
»Ich glaube, ich bin ein großer Esel gewesen, kann aber nichts dafür. Kommen Sie mit, vielleicht finden wir den Beweis dieser Behauptung schon auf dem ›Amor‹, und Sie stimmen mir dann bei.«
Sie gingen an den Hafen zurück.
Kapitän Hoffmann hatte allerdings für die Engländer einen Brief hinterlassen, worin er ihnen mitteilte, daß er sofort in See gehen müsse und daß seine Ordonnanz, Georg, verschwunden sei. Vielleicht würden die Herren bis zu seiner Rückkehr nach Bombay sich bemühen, nach dem Verschwundenen zu forschen.
Hoffmann selbst hatte keine Ahnung, daß Nick Sharp auch nach Bombay gefahren war, er glaubte, derselbe wollte sich an der Seite von Ellen halten. Der Detektiv aber kam auf den Einfall, sich nach Bombay zu begeben, weil natürlich, wie er gleich schloß, die Entführung der ›Vesta‹ und der Mädchen wieder vom ›Meister‹ ausging, dem er nachspürte. Ehe er Ellen verließ, mußte er jedoch für sich einen Ersatz haben, und da er in jeder Stadt seine Helfer hatte, so ließ er in Madras einen solchen als Matrosen auf die ›Medusa‹ anmustern. Als er sah, daß der betreffende Mann wirklich an Bord kam, verließ er das Schiff wieder, eben in der letzten Minute, und reiste mit dem nächsten Zuge nach Bombay.
Es war ihm bald gelungen, sich über alles Vorgefallene zu orientieren, er erfuhr die seltsamen Umstände, unter welchen die Gefangennahme Georgs vor sich gegangen, befreite diesen und nahm dessen Stelle ein, um, wie er sagte, mit dem Indier näher bekannt zu werden.
Aber auch Lord Harrlington war es geglückt, den Aufenthaltsort Georgs zu erfahren. Ein Diener des Indiers hatte gehört, daß der Lord eine hohe Summe demjenigen zusagte, der ihm etwas über den Verschwundenen mitteilte, daher war der Eingeborene einfach seinem Herrn weggelaufen und hatte alles verraten.
Ohne zu ahnen, weshalb Georg eigentlich gefangen gehalten wurde, eilten Harrlington und etwa zehn Herren sofort nach dem bezeichneten Haus, nahmen unterwegs noch Polizei mit, fanden aber den Indier selbst nicht mehr vor – er hatte von dem Verrat erfahren und war, ebenso wie seine Diener, welche sich schuldig fühlten, bei Zeiten geflohen. Einige der Eingeborenen sagten aus, sie hätten wohl gemerkt, daß ihr Herr jemanden im Keller festhielt, aber sie wüßten nicht wen und dürften sich überhaupt nicht um das Thun und Treiben ihres Herrn kümmern.
In dem bezeichneten Kellerraum fand man denn auch Georg, der sich so heftig über seine Befreiung beschwerte.
Als die Engländer auf dem ›Amor‹ anlangten, fanden sie zu ihrem nicht geringen Erstaunen Georg schon vor, diesmal den echten, der zwar die Sache aufklären wollte, so weit er durfte, aber vor Lachen nicht sprechen konnte.
Endlich erfuhren Harrlington und Williams, beide mit Sharps Wesen vertraut, den ganzen Sachverhalt, und Georg sagte betreffs seiner Gefangennahme nur noch, daß der Indier etwas Wissenswertes über den ›Blitz‹ habe hören wollen.
»Es ist unmöglich, ihnen zu entkommen,« sagte Ellen ärgerlich und deutete dabei nach zwei Segelschiffen, welche eben in den Hafen von Colombo einliefen, »und nicht einmal die Ehre lassen sie uns, daß die ›Vesta‹ das einzige Schiff ist, welches keinen Lotsen an Bord hat. Auch sie verschmähen es, die Lotsenflagge zu hissen und fahren noch dazu mit vollen Segeln herein.«
»Weinen hilft hier nichts,« würde Charles gesagt haben, hätte er diese Rede Ellens gehört. Die Sache ließ sich nun nicht ändern, allerdings kamen der ›Amor‹ und der ›Blitz‹, welche sich angesichts Colombos auf offener See getroffen hatten, mit voller Fahrt in den Hafen gelaufen, ohne bei dem günstigen Wind weder einen Schleppdampfer, noch einen Lotsen zu begehren. Sie erreichten den Hafen zwei Stunden später als die ›Vesta‹.
Jeder, auch der kleinste Hafenplatz hat seine Lotsen, welche die Schiffe durch das unbekannte Fahrwasser geleiten, aber es ist nicht nötig, daß der Kapitän einen solchen annimmt, wenn er die Einfahrt selber genau zu kennen glaubt.
Hat das ankommende Schiff eine Flagge gehißt, welche anzeigt, daß es einen Lotsen wünscht, so wird ein des Fahrwassers kundiger Mann an Bord geschickt, und in dem Augenblick, da derselbe die Kommandobrücke betritt, übernimmt er die Führung des Schiffes, und der Kapitän ist meist außer Dienst gestellt, bis das Schiff sicher vor Anker liegt.
Passiert es trotzdem, daß das Schiff auf Strand läuft, mit anderen in Kollision kommt oder sonst einen Schaden erleidet, so muß die Gesellschaft, welcher der Lotse angehört, für den Schaden aufkommen, im anderen Falle übernimmt der Kapitän selbst das Risiko. Doch kommt es selten vor, daß ein Kapitän den Lotsen ablehnt, obgleich die Kosten dafür hoch genug sind, er zahlt lieber die Summe und ist dann von jeder Verantwortung frei.
Die ›Vesta‹ hatte es gewagt, unter eigenem Kommando in den Hafen zu segeln, und hatte erst kurz vor dem Ankerplatz einen Schleppdampfer angenommen, was unter den Besatzungen der bereits daliegenden Schiffe Enthusiasmus hervorrief, die beiden aber, der ›Amor‹ und voran der ›Blitz‹, segelten sogar bis auf den Platz, wo sie Anker werfen wollten, bargen gleichzeitig ihre Segel und lagen bald an den straff gespannten Ankertauen. Die Bewunderung der fremden Seeleute über dieses kecke Manöver verminderte sich, als man erfuhr, daß die beiden Kapitäne ihre eigenen Lustschiffe fuhren, die Seefahrt also mehr zum Sport, als zum Geschäft betrieben. Was kümmert es solche Herren, wenn sie Schäden erleiden, die mittels des vollen Geldbeutels wieder geheilt werden können?
Colombo, der größte Hafen und zugleich die Hauptstadt der Insel Ceylon, ist, wie fast jeder Ort, in dem das europäische mit dem eingeborenen Element in Geschäftsbeziehungen tritt, streng in zwei Hälften geschieden. Am Hafen liegt die ›europäische Stadt‹ – sie hat keinen anderen Namen – mit ihren Geschäftshäusern, Bureaux und kleineren Wohnungen, meist von Engländern, Holländern und Portugiesen besetzt, während der Aufenthaltsort der Eingeborenen ›Pettah‹ oder ›die schwarze Stadt‹ genannt wird und mehr nach dem Lande zu, am Flusse Kailanigonga, liegt. –
An die europäische Stadt grenzt auf der einen Seite das Meer, auf der anderen ein großer Südwassersee.
Colombos eingeborene Bewohner setzen sich aus vier Hauptklassen zusammen: aus den Singhalesen, welche meist als Handwerker ihr Brot verdienen, d. h. nur in den Städten, und als die eigentliche Bevölkerung Ceylons bezeichnet werden können, aus Tamulen, als Soldaten oder Diener beschäftigt, aus den Parßi, Mischlingen von Eingeborenen, und Holländern, vom Großhandel lebend, und aus sogenannten Mohren, Mischlinge von Europäern, Eingeborenen, Malayen, Negern u. s. w., welche verachtet sind und den Kleinhandel betreiben.
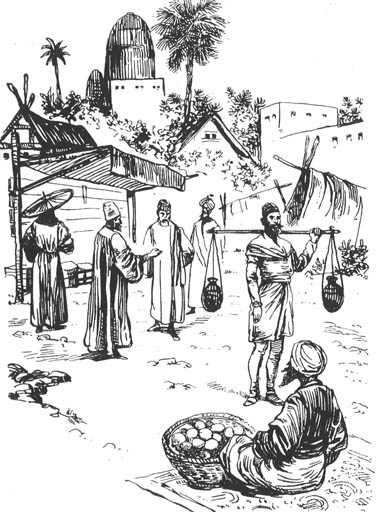
Nach einigen Tagen hatten sich die Damen und die Herren vollkommen in Colombo orientiert, und besonders die abenteuerlustige Ellen war es, welche auf ein Unternehmen sann, das eine Abwechselung bieten sollte.
Eines Tages erschien auch in Colombo jene französische Lustyacht, mit deren Kapitän man einst in Konstantinopel eine Regatta ausgemacht hatte, welche aber wegen des gegen die Mädchenhändler geplanten Unternehmens unterblieben war.
Sofort wurde beschlossen, diesen Plan wieder aufzunehmen, und zwar sollte diesmal ein Wettsegeln in Booten nach Pantura veranstaltet werden. Dieser kleine Hafen ist von Colombo nur fünfzehn Meilen entfernt, also bei einigermaßen günstigem Wind in zwei Stunden zu erreichen und außerdem noch der Sitz einer Gesellschaft, welche durch Taucher in einer nahen Bucht Perlmuscheln fischen läßt.
So konnte man gleich diese Leute einmal bei ihrer Arbeit beobachten.
Die Herren des ›Amor‹ waren mit dem Vorschlage einverstanden, ebenso der Kapitän des französischen Schiffes, nur Hoffmann wollte sich nicht beteiligen, und es kostete Ellen viele Mühe, ihn dazu zu bewegen.
»Sie alle haben hölzerne Boote,« entschuldigte er sich, »die meinen sind mit Stahlblech beschlagen und bedeutend schwerer, also sind Sie in großem Vorteil mir gegenüber.«
»Aber, Herr Hoffmann, selbst wenn Ihre Boote viel schwerer wären, als die der ›Vesta‹, so dürfen Sie sich doch nicht weigern, mit uns um die Wette zu fahren. Bedenken Sie, daß Sie an Bord Ihres Schiffes nur alte, erfahrene Seeleute haben, während unsere Boote von schwachen, in diesen Künsten wenig erfahrenen Damen bedient und gesteuert werden. Kommen Sie nicht mit, so nehme ich an, daß Sie wenigstens so von uns denken und mir nur deshalb eine abschlägige Antwort geben.«
Hoffmann willigte schließlich doch ein.
Der nächste Morgen versprach einen prächtigen Tag; einen besseren Wind, um nach Süden zu fahren, hätte man nicht wünschen können, und so wehte schon bei Sonnenaufgang an einem Maste der ›Vesta‹ die Signalflagge, als Zeichen, daß heute das Wettsegeln nach Pantura stattfinden solle. Die Boote konnten beliebig besetzt und beliebig ausgerüstet werden, ebenso wie sich jedes Schiff der vier Nationen mit so vielen Booten beteiligen konnte, als es wollte.
Es würde den Leser ermüden, sollte hier die Takelage eines Bootes beschrieben werden. Nur so viel sei erwähnt, daß jedes Boot mit Vorrichtungen zum Aufrichten von Masten versehen ist, und zwar gewöhnlich für zwei derselben. Die beiden mittelsten Sitzplätze sind durchbohrt, durch die Löcher wird der Mast gesteckt, unten befestigt, die Segel gehißt, und aus dem Ruderboot ist ein Segelboot geworden. Ebenso wie auf den Schiffen ist ein kleiner Klüverbaum, der am Bug schräg vorspringende Mast, vorhanden, und gerade die Bedienung desselben erfordert die größte Geschicklichkeit, weil von ihm das schnelle Wenden des Bootes abhängt, er aber, wegen des Platzes, nur von einem Manne gehandhabt werden kann.
Im Segelboot sind die Kommandos anders als auf dem Schiff, aber nirgend anders, als in einem solchen, können die Matrosen ihre Tüchtigkeit zeigen. Hier arbeitet eine Hand der anderen zu, ein einziger, falscher Griff kann ein Manöver um Minuten verzögern und die Fahrt des Bootes bedeutend hemmen. Ein gut bedientes Segelboot gewahrt einen wunderschönen Anblick, aber man bekommt einen solchen nur bei der Kriegsmarine oder bei Sportyachten zu sehen, die Handelsschiffe üben ihre Leute nicht in Bootsmanövern.
Das Aufrichten der Masten, das Aufziehen des Segels und besonders das Vorschieben des Klüverbaumes ist keine Kleinigkeit, und doch gilt es als grober Verstoß, wenn jemand während eines Manövers von der Ruderbank aufsteht. Jede Handlung muß erscheinen, als wenn sie spielend vor sich ginge, und dazu ist es eben notwendig, daß alle Mann im rechten Augenblick ihre Kräfte konzentrieren. Die Hauptperson ist der am Steuer Sitzende. Er muß das Boot so zu regieren wissen, daß sich der Wind mit voller Macht in die Segel legen kann, und daß es doch dem Ziele direkt zustrebt, er muß ferner das Gleichgewicht zu wahren trachten. Wenn er den Wind recht ausnutzen will, drängen sich auf seinen Wink alle nach der einen Seite des Bootes, er wendet das Steuer etwas, und das Fahrzeug legt so über, daß es umzuschlagen droht. Es darf natürlich nicht so weit kommen, und dieses genau zu beobachten, ist die Hauptkunst des Steuernden. Das fortwährend ins Boot strömende Wasser darf die Leute nicht genieren, es wird schnell wieder ausgeschöpft.
Jedes Schiff hatte zwei Kutter, die größten Boote, gestellt, in welchen die ganze Besatzung untergebracht war, nur der ›Blitz‹ war bloß mit einem vertreten, und nachdem ausgemacht worden war, daß derjenige, der zuerst in Pantura eine hervorspringende Landzunge Passiere, als Sieger hervorgehen sollte, gab Ellen das Zeichen zur Abfahrt!
Schon beim Emporrichten der Masten zeigte sich, daß die Vestalinnen den anderen weit überlegen waren, denn sie hatten sich im kleinen Segelboot fortwährend geübt, während die Engländer nur gewohnt waren, ihre großen Yachten zu bedienen.
Die ersten Boote, deren Segel den Wind abfingen, waren die beiden der ›Vesta‹ mit der Kapitänin und Miß Murray am Steuer, dann folgte Lord Harrlington, hierauf der Kapitän der ›Justica‹ und das andere französische Boot, dann kam der vollständig schwarze Kutter des deutschen Kapitäns und schließlich das Boot von Lord Hastings, dem ein Manöver mißlungen war.
Es dauerte nicht lange, so hatte letzteres das Hoffmanns überholt, und so blieb die Reihenfolge, ohne daß jemand einen besonderen Vorsprung erreicht, noch überhaupt zu gewinnen suchte, denn, wie bei jedem Messen der Schnelligkeit, wird auch beim Segeln die letzte Kraft und Geschicklichkeit bis zuletzt aufgespart. Die fünf ersten Boote hatten gleichmäßige Entfernung voneinander, nur Kapitän Hoffmanns Boot blieb immer mehr zurück. Während die anderen schon stark auf der Seite lagen und bereits ab und zu Wasser schöpften, hielt er sein Boot aufrecht, aber das Steuer schien doch in einer guten Hand zu sein, welche ein Fahrzeug gar wohl zu führen wußte.
Eine Stunde war bereits vergangen, als Jessy einmal aus dem Wind kam, sodaß ihr Boot dadurch etwas im Lauf gehemmt wurde und Harrlington an ihre Seite kam.
»Den Schaden machen Sie nicht wieder gut, Miß Murray,« sagte derselbe.
Die Insassen des Bootes wurden sehr ärgerlich, und am meisten natürlich das Mädchen, welches die Schuld trug.
»Weinen Sie nicht, Miß Thomson,« rief Charles hinüber, »geben Sie mir ein freundliches Wort, und ich schneide hier alle Segel ab. Soll ich?«
Aus Spaß zog der Baronet sein Messer heraus und that, als wolle er das Tau, an dem er saß, durchschneiden.
Da aber richtete sich die Aufmerksamkeit aller nach vorn, denn vor ihnen tauchte eine Rauchwolke auf, und nicht viel später konnten sie den Schornstein eines kleinen Dampfers sehen, der direkt ans sie zuhielt.
»Was will er?« fragte der Lord. »Es scheint fast, als ob er gerade auf uns zuführe.«
Nach einigen Minuten konnte man deutlich bemerken, daß der Dampfer allerdings keine Miene machte, eine Schwenkung auszuführen, denn nach den Seegesetzen müssen Dampfer Segelschiffen und Booten schon in großer Entfernung ausweichen.
»Der weicht nicht aus,« meinte Charles. »Miß Petersen scheint auch keine Lust dazu zu haben, und so können wir in fünf Minuten einige Menschen aus dem Wasser fischen.«
Jetzt ging am Signalmast des Dampfers eine Flagge hoch, das Zeichen, daß die Boote ihre Fahrt einstellen sollten.
»Unsinn!« rief Ellen. »Keinen Augenblick halten wir.«
»Es ist ein Regierungsdampfer,« meinte ein Mädchen, »der versteht keinen Spaß.«
Ellen lenkte das Boot etwas zur Seite, denn fast wäre es mit dem Dampfer zusammengestoßen, aber der auf der Kommandobrücke stehende Kapitän winkte heftig, zu halten und ihn anzuhören.
Ellen ließ ihr Boot vorbeischießen und gab somit das Signal, daß auch die anderen ihr folgten, und kein Boot schloß sich aus. Ehe der Kapitän nur Zeit fand, etwas zu rufen, waren die fünf Fahrzeuge vorbei, nur Hoffmanns Kutter war noch hinten, aber in weiter Entfernung.
»Dampf auf,« rief der Kapitän durchs Sprachrohr, »wir wollen diesen Leutchen zeigen, was es heißt, meine Befehle zu mißachten.«
Der Dampfer wandte und hatte in kurzer Zeit das letzte Boot, welches Lord Hastings steuerte, eingeholt. Ein Strick, an dem vorn ein Enterhaken befestigt war, sauste durch die Luft, legte sich um den vordersten Mast und nur der kaltblütigen Geschicklichkeit des Lords war es zu verdanken, daß das Boot nicht umschlug. Aber im gleichen Augenblick blitzte es auch in Hastings Hand auf und das Tau fiel klatschend ins Wasser – es war durchschnitten.
Der Kapitän war außer sich, daß er das Boot nicht, wie er gehofft hatte, aus dem Winde gebracht hatte, sondern daß es schon wieder weiterfuhr. Mit aller Geschwindigkeit jagte der kleine Dampfer ihm nach und hatte es im Nu wieder eingeholt.

Jetzt sprang Lord Hastings auf. Er hatte gesehen, daß das Schiff nicht die englische Flagge am Heck führte, sondern daß sie dieser nur ähnlich sah, wodurch vorhin das Mädchen getäuscht worden war.
»Wollen Sie uns in den Grund bohren, Kapitän?« rief er.
»Bergt die Segel, oder ich thue das,« war die Antwort.
»Bei Gottes Tod,« schrie der Lord, »wagt es, und Ihr sollt uns kennen lernen!«Lord Hastings war ein sehr phlegmatischer Mensch, wurde er aber einmal gereizt, so kannte sein Zorn keine Grenzen.
Aber der Kapitän wagte es; immer mehr näherte sich der scharfe Bug des Dampfers dem hölzernen Boot, bis ein Knirschen und Krachen hörbar ward. Im nächsten Moment war das Wasser mit Planken und schwimmenden Menschen bedeckt.

Jetzt bemerkten die vorausgesegelten Boote, was hinter ihnen passiert war, stoppten, wendeten und fuhren nach der Unglücksstelle. Der Kapitän schien sich zu besinnen, daß er doch eben eine große Unklugheit begangen habe, ließ den kleinen Dampfer einen Bogen beschreiben und fuhr nach Westen zu, ohne sich um die Verunglückten zu kümmern.
Die ankommenden Boote hatten Mühe, die im Wasser Schwimmenden an Bord zu bringen.
Lord Hastings fluchte in allen Tonarten und wollte dem Dampfer am liebsten folgen, natürlich war dies unmöglich.
»Was für ein Fahrzeug war das nur, das uns hier ohne weiteres aufhalten wollte?« fragte Ellen. »War es wirklich ein englischer Regierungsdampfer?«
»Unsinn,« brüllte Hastings, »und wenn es zehnmal ein englischer Regierungsdampfer oder ein Kriegsschiff gewesen wäre, wie kann es wagen, ein Boot zu rammen!«
»Ich habe keine Ahnung, wie es überhaupt hierherkommt,« meinte Harrlington. »Das Einzige wäre, daß es ein Lotsendampfer ist oder einer Gesellschaft angehört. Hat sich jemand der Herren oder Damen Flagge und Namen des Schiffes gemerkt?«
Niemand hatte es gethan. Die Aufregung war eine so große gewesen, daß keiner daran gedacht hatte. Man wußte nur, daß die Flagge der englischen zum verwechseln ähnlich gesehen hatte.
Während die Boote noch zusammenlagen und berieten, kam Kapitän Hoffmann angefahren.
»Haben Sie gesehen, was passiert ist?« rief ihm Ellen entgegen.
Hoffmann bejahte.
»Ich habe es nicht für nötig gehalten, ihn dingfest zu machen,« antwortete er, »denn ich weiß, wem das Schiff gehört, und wir werden ihn vielleicht heute noch treffen und zur Verantwortung ziehen.«
Niemand war unter den Herren, der ein Lächeln unterdrücken konnte.
»Na, Herr Hoffmann,« konnte Charles sich nicht enthalten zu sagen, »beim Wettsegeln haben Sie sich nicht gerade mit Ruhm bedeckt, und wie Sie den Dampfer ›dingfest‹ machen wollen, müssen Sie uns noch näher erklären.«
Es passierte öfters, wenn sich Hoffmann als der Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit fühlte, daß er verlegen wurde, und so schoß auch jetzt ein flüchtiges Rot über sein offenes Gesicht.
»Er gehörte jener portugiesischen Gesellschaft an, welche in der Bucht von Pantura Perlenfischer unterhält,« fuhr er fort, ohne auf die Frage des Baronets einzugehen.
»Ah,« rief Ellen, »das kann ja heute noch interessant werden.«
»Nun fällt mir auch ein,« murrte Lord Hastings, der mit triefenden Kleidern in einem französischen Boot Platz genommen hatte, »daß jener Schurke so eine gelbe, spanische oder portugiesische Spitzbubenphysiognomie hatte. Na warte, ein Gericht rufe ich nicht zusammen, aber–«
Der Lord streckte seine Arme aus, als hätte er sein Opfer schon vor sich.
»Warum mag er uns zum Halten aufgefordert haben?« meinte Ellen wieder,
»Es fährt immer ein Damfer vor der Bucht auf und ab, welcher ein etwaiges Entwischen von Tauchern mit Perlen verhindern soll,« entgegnete Hoffmann, »leicht möglich, daß es ein solcher gewesen ist.«
»Und daß er glaubte, wir hätten Perlen gestohlen,« lachte Charles. »Aber wenn wir hier liegen bleiben, werden wir nie nach Pantura kommen, was dem portugiesischen Kapitän vielleicht recht angenehm sein könnte. Hastings, stecken Sie Ihre langen Beine unter die Bank, oder besser, legen Sie sich gleich unter die Bänke, sonst sind Sie im Wege.«
Die Regatta wurde natürlich nicht wieder aufgenommen, denn einige Boote waren mit den Verunglückten beschwert, die der Damen dagegen nicht. Die Engländer warfen noch einen bedauernden Blick nach den Trümmern, welche von dem schöngebauten Boot übrig geblieben waren und zerstreut auf dem Wasser schwammen, dann setzten auch sie Segel und folgten den Vestalinnen, welche bereits ein gutes Stück voraus waren. –
Die Bucht von Pantura gewährt einen wunderbar lieblichen Anblick. Rings sind die Ufer von Kokospalmen bestanden, wie überhaupt Ceylon die meisten Kokosnüsse liefert – auf Lichtungen zwischen den Bäumen erheben sich auf der einen Seite reizende Häuschen, Beamten der portugiesischen Gesellschaft gehörend, und ihnen gegenüber liegen zerstreut die Hütten der eingeborenen Muscheltaucher. Gerade dem Buchteingang gegenüber stand ein stattliches Gebäude, aber uon leichtem Fachwerk ausgeführt, in welchem die Komptore und die Warenlager untergebracht waren. Das Häuschen dicht daneben war unbedingt das schönste und geräumigste, in ihm wohnte der Direktor der Gesellschaft.
Auf das ganze schien freundlich die Sonne. Der blaue Himmel verlieh dem Meere seine Farbe. Alles atmete Ruhe und Frieden, und doch wurden hier einige hundert Menschen dafür bezahlt, in jeder Stunde einige Male ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um Muscheln vom Meeresgrund ans Tageslicht zu befördern, in welchen der unersättliche gierige Mensch nach kostbaren Perlen sucht.
In der geräumigen Bucht wimmelte es von kleinen Kähnen, in denen immer vier bis sechs Mann zusammenhockten. Einer von ihnen hatte ein einfaches Ruder in der Hand und lenkte das Boot dahin, wohin es ein europäisch gekleideter Mann haben wollte. Dieser war der Befehlende über die anderen, welche alle nackt waren. Um die Hüften trugen sie nur einen Gürtel, an dem ein netzartiger Beutel hing. Außerdem lagen in jedem Boot noch mehrere schwere Steine und lange Taue.
Das Perlenfischen geht in folgender Art vor sich:
Der Mann, welcher au der Reihe ist, klemmt sich mit einem elastischen Hornstück die Nase zu, nimmt in die Hände einen der Steine, welcher an einem Taue befestigt ist und springt ins Wasser. Der Stein zieht ihn natürlich schnell auf den Grund, wo sich der Taucher, weil er sonst immer wieder nach oben getrieben würde, mit der einen Hand an dem Tau fest hält, oder Geschickte wohl auch mit den Füßen, und nun so lange die angewachsenen Muscheln abreißt und in das Netz steckt, bis ihn das Bedürfnis nach Luft zwingt, wieder an die Oberfläche hinaufsteigen.
Er läßt das Tau einfach los, macht mit den Händen und Füßen Schwimmbewegungen und schießt nach oben, wo dem Erschöpften ins Boot geholfen wird.
Der Stein wird darauf wieder emporgewunden.
Während sich der Mann ausruht, taucht ein anderer aus dem Boote, dann ein dritter und so fort, bis an den ersten wieder die Reihe kommt.

Ist das Boot genügend mit Muscheln angefüllt, so wird es ans Land gerudert und ausgeladen. Unter strenger Aufsicht werden die Muschel nach einem entfernt liegenden Ort gebracht und den Strahlen der Sonne ausgesetzt. Es dauert nicht lange, so fangen sie an zu verwesen, sie öffnen sich, und nun beginnen besonders Angestellte, nach etwaigen Perlen zu suchen.
Alles geschieht natürlich unter der peinlichsten Aufsicht seitens der Beamten, welche am Gewinn der Aktiengesellschaft beteiligt sind.
Vor dem großen Gebäude befand sich im Wasser ein Holzbau zum Anlegen von Booten, und zwischen diesen lagen auch die sechs, welche heute die fremden Gaste gebracht hatten.
Der Direktor der Fischerei stand am Ufer und hatte eben den ihn Umringenden die Eigentümlichkeit des Tauchens erklärt.
»Wie lange hält so ein Mensch unter Wasser aus?« fragte einer den Portugiesen, einen älteren Herrn von einnehmendem Aeußeren.
»Selten länger als eine halbe Minute,« entgegnete er. »Wenn behauptet wird, es gäbe Taucher, welche sogar fünf Minuten unten bleiben können, so ist dies eine Uebertreibung.
»Ich habe wohl einige unter meinen Leuten, die es bis achtzig Sekunden aushalten könnten, aber sie thun es nicht, denn ihre Lunge wird dadurch zu sehr angestrengt, und sie würden die Taucherei nicht lauge aushalten können. Ein geschickter Taucher kann den Kopf zwar lange unter Wasser stecken, aber auf dem Meeresboden, wo zugleich gearbeitet werden muß, also vielmehr Luft verbraucht wird, hält auch er nicht länger aus.«
»Wird viel gestohlen?« fragte Ellen.
»Ja und nein, wie man's nimmt; es wird nämlich selten gestohlen, wenn aber einmal eine Perle verschwindet, dann ist dies natürlich stets ein namhafter Verlust für uns.«
»Auf welche Weife wird denn gestohlen? Schneiden sie sich wirklich die Fußsohlen auf und stecken dann die Perlen hinein?« fragte die neugierige Hope Staunton.
Der Portugiese lächelte,
»Auch das ist eine Fabel. Solch' einen Diebstahl würden wir schnell genug entdecken, denn Sie können sich denken, daß unsere Beamten alle Schliche und Kniffe kennen. Das Gewöhnlichste ist, daß die mit dem Suchen der Perlen in den Schalen beschäftigten Arbeiter eine verschlucken, und haben wir Verdacht auf einen Mann, so muß zu einem sehr drastischen Mittel gegriffen werden, um die gestohlene Perle wieder aus dem Magen zu bringen.«
»Ist dies lange Tauchen der Gesundheit nicht sehr schädlich?«
»Es ist ungesund und außerdem sehr gefahrvoll. Die Taucher erreichen selten ein Alter über vierzig Jahre, denn die Lunge weitet sich nach und nach zu sehr aus, auch das Herz wird angegriffen. Die Sehkraft verliert sich. An den Augen bilden sich Geschwüre, und Wunden brechen am ganzen Leibe auf. Nicht selten trifft einen der Taucher mitten im Meere der Schlag. Und was die Gefahren anbetrifft – sehen Sie dort am Ufer die zwei alten Weiber stehen?«
Der Direktor deutete nach einer in die Bucht vorspringenden Landzunge, auf welcher zwei alte, häßliche Weiber standen und mit den Armen lebhafte Gestikulationen machten.
»Es sind dies die Zauberinnen des Fischerdorfes,« erklärte der Portugiese. »Die Taucher, meist Eingeborene oder Mischlinge von Holländern und solchen, sogenannte Eurasi, sind sehr abergläubisch und meinen, daß diese Weiber die Kraft besitzen, durch bloße Sprüche und Zeichen die Haifische, welche das Leben der Taucher bedrohen, aus der Bucht zu vertreiben.«
»Kommen oft Unglücksfälle durch Haifische vor?«
»Im allgemeinen wagen es diese gefräßigen Tiere nicht, in die belebte Bucht zu kommen, ist aber erst einmal eines darin und hat eine Beute gemacht, dann verschwindet fast jeden Tag ein Mann.«
»Entsetzlich! Wie verhalten sich dann die Taucher?«
»Es wird ruhig weitergearbeitet, die Leute sind daran gewöhnt. Es giebt unter ihnen welche, die das Töten solcher Haifische als eine lohnende Nebenbeschäftigung betreiben. Es ist kaum glaublich, mit welch' unerhörter Kühnheit sie sich dabei benehmen. Nur mit einem langen spitzen Holz bewaffnet, schwimmen sie dahin, wo sich der Haifisch gewöhnlich aufhält und warten, möglichst ohne Bewegung sich über Wasser haltend, bis dieser herankommt. Bekanntlich muß sich nun der Haifisch auf den Rücken legen, wenn er sein Opfer verschlingen will, weil sein Maul unten am Kopf, an der Bauchseite ist. Diesen Augenblick benützt der Taucher und stößt dem Ungeheuer das Holz in den Rachen, sodaß er denselben nicht schließen kann. Gewöhnlich flieht dann das Tier dem offenen Meere zu. Aber es giebt auch Männer, welche sich mit Haifischen in förmliche Kämpfe einlassen und sie schließlich mit dem Messer töten. Nur wer diese Taucher kennt, deren Element das Wasser ist, welche mehr als die Hälfte ihres Lebens darin zubringen, hält so etwas für möglich – man muß es gesehen haben. Matale, einer meiner Taucher, der jetzt in der Untersuchungszelle sitzt, hat auf diese Weise unzählige Haifische getötet und dadurch einen berühmten Namen bekommen. Schade um den Mann!«
Der Portugiese seufzte.
»Hat man nicht versucht, statt dieser Taucher solche mit Apparaten zu verwenden?« fragte der deutsche Ingenieur.
»Natürlich hat man das gethan, aber es rentiert sich nicht; ein Mann im Taucheranzug ist in seinen Bewegungen sehr gehindert und kann daher nicht den vierten Teil von Muscheln in derselben Zeit einsammeln, wie ein Eingeborener. Da sich nun die Taucher fortwährend ablösen, so erleidet das Sammeln keine Unterbrechung. Außerdem verlangt ein europäischer, geschulter Taucher fünfzehn bis zwanzig Schillinge für die Stunde, die er unter Wasser zubringt, außer seinem ständigen Gehalt, und unsere bekommen nur fünf Cents für jede von ihnen gefundene Muschel, die eine Perle enthält. Unser Geschäft hat freilich ein Risiko, wie kein anderes. Wir lassen eine Bucht untersuchen, von der wir vermuten, daß sich viele Muscheln darin befinden, öffnen einige Hundert und berechnen dann den Prozentsatz. Glauben wir, daß sich die Taucherei lohnen wird, so beginnen wir ohne weiteres und können entweder großem Erfolg oder Mißerfolg hierbei begegnen.«
»Haben Sie denn viele Kosten?«
»Das nicht, aber den Preis, den wir jeden Tag zu zahlen haben, um tauchen zu können, und die Pacht ist enorm hoch.«
Der Direktor sah nach der Uhr.
»Es ist zwölf Uhr; der Kapitän jenes Dampfers, welcher sich in solch unerhörter Weise gegen Sie vergangen hat, muß sich bei mir melden. Unsere beiden Dampfer liegen nicht in dieser Bucht selbst, sondern in einem kleinen Hafen nebenan, der Mann kommt auf dem Landweg in mein Comptoir. Seien Sie versichert, daß ich alle Strenge gegen ihn walten lassen werde; seine Rücksichtslosigkeit und Heftigkeit haben schon oft meinen Unwillen erregt, nun aber ist sein Maß voll – er wird entlassen. Leider muß ich ihn vorläufig noch hier behalten, weil er als Hauptzeuge in der Verhandlung wegen eines kürzlich vorgekommenen, großen Perlendiebstahls auftreten muß, in welchen auch Matale verwickelt ist.«
»Lieber wäre es mir, ich könnte ihn unter vier Augen sprechen,« meinte Lord Hastings.
Der Direktor lächelte flüchtig.
»Jedenfalls wird die Gesellschaft Ihnen das Boot ersetzen, ich selbst kann nichts weiter thun, als den Menschen durch Entlassung zu bestrafen. Wollen Sie noch mehr haben, so müssen Sie sich in Colombo an das Seegericht wenden, und ich selbst würde, obgleich ich dadurch sehr viele Umstände hätte, gegen den Kapitän auftreten. Sie sind also meine Gäste, so lange Sie wollen. Für Ihre bequeme Unterkunft im Geschäftshaus wird gesorgt werden, wenn Sie einige Tage hier bleiben wollen!«
Der freundliche Mann ging, um den Kapitän, welcher absichtlich Lord Hastings Boot gerammt hatte, zu vernehmen.
Die Herren und Damen gingen langsam am Ufer der Bucht spazieren, beobachteten das Treiben der Taucher, sahen nach der Uhr, wie lange dieselben unter Wasser blieben, und freuten sich über die sonnige Landschaft.
Charles Aufmerksamkeit erregten ganz besonders die zwei alten Weiber, welche unermüdlich die Hände zum Himmel streckten und Beschwörungsformeln murmelten.
Nachdem er sie lange genug betrachtet hatte, wandte er sich endlich mit den Worten ab:
»Es muß ein sehr kühner Haifisch sein, der sich in die von diesen beiden Hexen bewachte Bucht wagt. Ich wenigstens würde es nicht thun.«
Ellen, Jessy und Johanna, die drei Freundinnen, bildeten wie gewöhnlich eine Gruppe. Sie wollten sich den Platz ansehen, wo die Muscheln der Sonne ausgesetzt werden, aber schon in hundert Meter Entfernung davon mußten sie eiligst kehrt machen, einen solch pestilenzialischen Geruch brachte ihnen der Wind entgegen.
Nun schlugen sie einen Weg ein, der nach dem Dorfe der Perlenfischer führte, um sich in diesem umzusehen. War es ebenso sauber, wie es vom Ufer aus freundlich anzusehen war, so mußte es ein reizendes Hüttendorf sein.
Der Weg führte immer zwischen Palmenwäldern hindurch, der Boden war mit Rasen bedeckt, ohne Unterholz, sodaß man weit sehen konnte. Die drei Freundinnen hatten bis jetzt noch niemanden erblickt, die Männer waren auf dem Wasser beschäftigt, die Frauen verrichteten im Dorf häusliche Arbeiten, und die Kinder dieser armen Leute mußten ihren Eltern helfen. Da deutete Ellen auf einen umgestürzten Baumstamm, der nicht weit vom Wege ablag.
»Ist das nicht jener Georg, der in Bombay gefangen genommen wurde und den der ›Amor‹ mitbrachte?«
»Ich kenne ihn,« sagte auch Johanna, »er ist es und spricht mit einem eingeborenen Weibe. Jetzt zeigt er auf uns. Die Frau kommt zu uns, sie scheint sehr ängstlich zu sein. Will sie etwas von uns?«
Von jenem Baumstamm her, auf dem Georg saß, näherte sich den drei Mädchen eine weibliche Gestalt, blieb mehrmals unterwegs stehen und fiel dann, als sie sich vor den Ankommenden befand, auf die Kniee.
Es war ein dunkelbraunes, junges Weib mit schönen Gesichtszügen und dunklen Augen, aber diese waren jetzt matt und erloschen, alles an ihr drückte Seelenschmerz aus.
»Ihr seid die fremden Damen, welche die Sklavinnen befreit haben, jener Matrose dort hat es mir erzählt,« rief sie in fließendem Englisch, »o, so erbarmt Euch auch meiner und gebt meinem Manne die Freiheit wieder! Er schmachtet schon seit langer Zeit unschuldig, mein Kind und ich warten täglich auf den Vater, aber er kommt nicht, vielleicht kehrt er nie wieder. O, helft ihm!«
»Steh' auf,« sagte Ellen freundlich, »wer ist Dein Mann?«
»Matale, der beste Taucher und der ehrlichste Mensch. Seit Jahren ist er bei der Perlenfischerei beschäftigt, man hat ihm alles anvertraut, er hat viele Diebstähle entdeckt, und jetzt soll er plötzlich selbst ein Dieb geworden sein.«
Das Weib war auf den Knieen liegen geblieben.
»Aber wie sollen wir ihm helfen?«
»Ihr könnt es, Ihr seid mächtig. Ich könnte tagelang vor den Thüren der Beamten auf den Knieen liegen und bitten, ihre Ohren blieben geschlossen, aber Ihr braucht nur zu bitten, so geschieht es.«
»Du überschätzest unsere Macht!« sagte Ellen. »Was sollen wir thun, um ihn zu befreien? Was möglich und recht ist, soll von unserer Seite geschehen.«
Das braune Weib schwieg, es wußte keinen Rat.
»Ihr seid klüger als ich,« sagte sie endlich, »Matale muß frei sein, damit er nach dem forschen kann, der ihn als Dieb verdächtigt hat, denn nur dieser hat die Perlen gestohlen. Nimmermehr glaube ich, daß Passera der Thäter gewesen ist.«
»Wir verstehen dich nicht,« – Ellen hob die Knieende auf – »erkläre uns diese Geschichte des Diebstahls, und was damit zusammenhängt, näher!«
Sie nahmen das junge Weib zwischen sich und nötigten es zum Sprechen.
»Es ist schon drei Wochen her, als aus dem Sortierraum im Geschäftshaus eine große Menge Perlen gestohlen wurde. Als Thäter wurde sofort Passera, ein Freund von Matale, bezeichnet, weil er seit jener Nacht verschwunden ist, in welcher der Diebstahl ausgeführt wurde. Natürlich wurden auch die Hütten aller Fischer untersucht, nur diejenigen nicht, deren Bewohner als vollkommen ehrlich galten. Daß Matales Hütte auch visitiert werden sollte, war vollkommen ausgeschlossen, in solch' gutem Ruf stand er bei dem Direktor. Da aber trat ein Mann auf, der darauf drang, daß auch bei uns gesucht würde, und wir alle glaubten vor Schreck sterben zu müssen, als der Beamte unter der Matratze Matales ein Beutelchen mit Perlen fand. Es waren welche von denen, die geraubt worden waren. Alle Beteuerungen –«
Da unterbrach sie Johanna.
»Wer war der Mann, der Matale verdächtigte?«
»Kapitän Esplanza, von dem mir vorhin der Matrose erzählte, daß er eins Eurer Boote gerammt hat. Er ist ein böser Mensch, der nur Uebles im Sinn hat, man kann es ihm schon ansehen. Dieser war es, der zuerst forderte, auch bei uns eine Haussuchung vorzunehmen.«
»War Matale freundlich gegen den Kapitän gesinnt, oder haben sie einmal einen Streit miteinander gehabt?«
»Nein,« entgegnete das Weib.
»Hatte der Kapitän sonst Ursache, dem Matale übel zu wollen, oder trugst du die Schuld daran, daß er die Verhaftung Matales herbeiführte?«
Johanna hatte den richtigen Punkt berührt; trotz der braunen Hautfarbe errötete das Weib. Aber es schwieg.
»Du mußt dich offen aussprechen, wenn wir dir helfen sollen,« ermahnte Ellen, »wie können wir sonst klar sehen?«
»Ja, er hat mich oft mit Anträgen verfolgt,« entgegnete es.
»Und was wurde dann?«
»Es ist alles. Matale wurde gefangen genommen, und es ist keine Hoffnung vorhanden, daß er wieder freikommt, denn Passera ist und bleibt verschwunden. Kapitän Esplanza selbst fährt fortwährend mit seinem Dampfer die Küste entlang, weil vermutet wird, daß Passera sich irgendwo versteckt hält und bei Gelegenheit mit einem Boote nach dem Festlande entfliehen will, wie gewöhnlich geschieht, aber bis jetzt ist er noch nicht ergriffen worden.«
»Hältst auch du ihn für den Dieb?« unterbrach es Johanna abermals, welche überhaupt die Fragerin spielte.
»Niemals hat Passera so etwas gethan. Er war der Freund meines Mannes, und das genügt, um ihm den Namen eines Ehrlichen zu geben. So lange aber der Thäter nicht entdeckt wird, muß Matale gefangen bleiben, ja, er kann schon auf den bloßen Fund der Perlen unter seinem Kissen hin verurteilt werden. Denn wer ist da, der den Beweis widerlegen kann?«
Das Weib brach in Thränen aus.
»Hat dich dieser Kapitän wieder verfolgt, seit der Zeit, da dein Mann in Untersuchung sitzt?«
»Ja, schon oft wieder.«
»Was hat er gesagt?«
»Der Abscheuliche will, ich soll mit ihm als sein Weib in die Ferne ziehen, in das Land, woher er stammt, denn, sagt er, Matale käme doch nicht wieder frei, und außerdem sei ich viel zu gut für einen Dieb. Als wenn nicht jedermann von den Fischern wüßte, daß Matale nie zum Diebe werden kann.«
»Ist Esplanza nicht hier angestellt? Wie will er da in seine Heimat zurückkehren?«
»Er will den Dienst aufgeben, er sagte mir, er wäre ein reicher Mann.«
»Hast du schon jemandem erzählt, was du uns gesagt hast?«
»Nein, einem Manne könnte ich es nicht sagen. Die Aussage einer Frau gilt auch nicht viel, die Männer hören nicht auf uns. Ich würde verlacht werden.«
»Hast du auch keinen Verdacht auf einen anderen?«
»Ich kenne wohl viele in unserem Dorfe, welche ich eines Diebstahls für fähig halte, denn sie sagen, die Perlen gehörten eigentlich ihnen, die weißen Fremdlinge nähmen sie ihnen nur, aber niemand ist so schlecht, einen Unschuldigen zu verdächtigen.«
Also dieses unschuldige Weib dachte gar nicht daran, daß auch ein Weißer einen Diebstahl heimlich begehen und dann einen anderen als Schuldigen hinstellen konnte. Sie suchte den Dieb höchstens unter ihren eigenen Landsleuten, nicht aber unter den Beamten. Der Direktor hatte ihnen vorhin erzählt, daß, wenn wirklich einmal eine Untersuchung bei den Beamten stattfände, dies doch möglichst verheimlicht werde, um bei den Eingeborenen nicht den Respekt einzubüßen.
Sie hatten fast das Dorf erreicht. Ellen blieb stehen und reichte dem Weibe die Hand.

»Gehe jetzt heim!« sagte sie liebevoll. »Ich glaube, ich kann deinen Mann in Freiheit setzen, vielleicht ist er schon morgen bei dir und deinem Kinde. Was wird Matale thun, wenn er frei ist? Wird er wieder arbeiten?«
»Nein, er wird nur nach dem Diebe forschen. Doch sprichst du die Wahrheit, werde ich Matale morgen wieder haben?«
Die matten Augen des Weibes glänzten mit einem Male wunderbar auf.
»Ich hoffe so, bestimmt kann ich es dir nicht versprechen. Aber sei versichert, er soll nicht verurteilt werden, so lange weiter keine Beweise seiner Schuld beigebracht werden können, als die, daß die Perlen bei ihm gefunden worden sind.«
»Wie wollen Sie dies anfangen, dem Manne die Freiheit wiederzugeben?« fragte Jessy ihre Freundin, als sie sich von der überglücklichen Frau getrennt hatten und den Rückweg einschlugen.
»Nun,« lächelte Ellen, »die gestohlenen Perlen werden sich wohl bezahlen lassen, und wenn ich dafür bürge, daß dies geschieht, wenn der Dieb nicht gefunden wird, dann wird auf meinen Wunsch hin Matale bald frei sein.«
»Thun Sie dies nicht!« riet Johanna. »Bürgen Sie mit einer Summe für den Mann allein, die Gesellschaft wird dies nicht ausschlagen, und Sie erzielen denselben Erfolg.«
»Das kann ich auch thun, obgleich der eigentliche Dieb uns jetzt doch ganz genau bekannt ist.«
»Allerdings,« warf Jessy ein, »aber Beweise werden wir nicht bringen können.«
»Er muß sich selbst fangen,« meinte Johanna, »allzu klug scheint dieser Kapitän sowieso nicht zu sein; er ist ein sehr plumper Spitzbube.«
»So gedenken Sie vorläufig noch hierzubleiben?« fragte Jessy.
»Ja, bis sich die Sache aufgeklärt hat! Allzulange wird es nicht dauern.«
Sie machten untereinander aus, vorläufig alles geheimzuhalten und auch Matales Weib aufzufordern, daß es schweige.
Lange Zeit berieten sie sich noch, und als sie das Geschäftshaus wieder erreichten, war es abermals Johanna gewesen, welche den besten Vorschlag gemacht hatte.
»So geht es,« rief Ellen erfreut, »Johanna, an Ihnen ist ein Advokat verloren gegangen.«
Aus dem Geschäftshaus trat ein in einen Leinwandanzug gekleideter Herr und ging einige Schritte weiter nach einem hübschen, villenartigen Bau. Er stieg die wenigen Stufen hinauf und öffnete, ohne anzuklopfen, eine Thür.
»Nun,« empfing ihn ein junger, bartloser Mann mit fleischigem Gesicht und schnarrender Stimme, »was hat's gegeben, Kapitän Esplanza?«
Der Angekommene, ein Mann mittleren Alters mit schwarzem Knebelbart, warf sich in einen Stuhl und brach in ein lautes Lachen aus.
»Es ist alles so gekommen, wie ich es Ihnen vorhergesagt habe, ich bin aus den Diensten der Gesellschaft entlassen worden, und zwar darum, weil ich aus Versehen an das Boot jener verdammten Engländer gestoßen bin, die jetzt zum Vergnügen in der Bucht umherschnüffeln.«
Der junge Mann war vor einen großen Spiegel getreten und musterte mit lächelndem Blick seinen tadellosen Anzug.
»Hm,« meinte er dann, »und wann reisen Sie ab?«
»Das ist es ja eben,« rief der andere und sprang erregt auf, »der Direktor, dieser Mucker, will mich nicht eher entlassen, als bis die Geschichte wegen des Perlendiebstahls klar ist.«
»So so!« Der Bartlose spielte gedankenvoll mit der goldenen Uhrkette, die seine weiße Weste schmückte, »und was werden Sie bis dahin treiben?«
»Ich weiß nicht, Henrico, ich muß mich auf Befehl des Direktors so lange hier aufhalten, bis entweder Matale überführt oder ein anderer Dieb gefunden worden ist.«
»Eine langweilige Geschichte,« meinte der mit Henrico Angeredete und nahm ein Zeitungsblatt vom Tisch. »Haben Sie schon die neuesten Berichte gelesen? Aus dem Staatsgefängnis zu Colombo ist der Amerikaner Selby entsprungen und zwar mit einer ganz unerhörten Kühnheit, er ist über –«
»Was geht mich Selby an,« brauste der Kapitän ungeduldig auf, »geben Sie mir lieber einen Vorwand an, unter dem ich mich aus diesem elenden Loche entfernen kann.«
»Ich glaubte, diese Geschichte würde Sie interessieren,« fuhr Henrico ruhig fort. »Selby war nämlich, ebenso wie ich es bin, Beamter bei einer englischen Perlenfischereigesellschaft und verschwand eines Tages mit Perlen im Werte von ungefähr einer Million Pfund Sterling. Interessiert Sie das nicht?«
Der Gefragte wandte langsam den Kopf nach dem Sprecher um und musterte ihn mit finsterem Blick. Doch der junge Mann schien das nicht zu beachten, er steckte sich gleichgültig eine Cigarette an.
»Sagen Sie einmal, Esplanza,« fragte er dann, »wenn Sie nun von hier weggehen, nehmen Sie auch Ihre Monika mit?«
»Zum Teufel, was haben Sie denn heute mit Ihrer merkwürdigen Fragerei?« rief der andere ungeduldig. »Was geht Sie dies Weib an?«
»Mich geht es allerdings nichts an, aber Sie eigentlich ebensowenig. Gestehen Sie einmal offen, wie weit sind Sie nun mit ihr gekommen, seit der Mann im Gefängnis sitzt?«
Der junge Geck sprach die Worte unter höhnischem Lachen.
»Noch heute verfluche ich die Stunde, in welcher ich Sie zum Vertrauten dieses Geheimnisses machte. Wie oft nun haben Sie mich damit schon aufgezogen!«
»Wer mir den kleinen Finger reicht, von dem nehme ich die ganze Hand.«
»Man sagt dies nur vom Teufel, vergleichen Sie sich mit diesem?«
Henrico zuckte mit den Achseln.
»Gut denn, lassen wir das Weib! Aber mit ihrem Manne wollen wir uns noch etwas beschäftigen. Der arme Kerl wird wohl daran glauben müssen. Wird der richtige Dieb nicht gefunden, kann Matale seine Unschuld nicht beweisen, so wird sein Leben im Gefängnis zu Colombo enden.«
»Wie?« fragte der Kapitän verwundert. »Sie zweifeln an der Schuld Matales? Dann sind Sie wohl der einzige, der dies thut.«
»O nein, ich kenne zum Beispiel einen Mann, der ganz genau weiß, daß Matale völlig unschuldig an dem Diebstahle ist.«
Wieder wandte der im Stuhle Sitzende langsam den Kopf nach dem jungen Manne, der noch vor dem Spiegel stand.
»Wer sollte das sein? Der Direktor vielleicht? Nun, dessen Schrullen sind ja zur Genüge bekannt.«
»Nicht der Direktor, nein, jemand anderes. Sehen Sie einmal, dort können Sie ihn sehen.«
Der Kapitän folgte dem ausgestreckten Finger seines Freundes und sah sein eigenes Spiegelbild, sah, wie er zu zittern begann und sich entfärbte.
Aber im nächsten Augenblicke gewann er die Fassung wieder.
»Ich?« lachte er gezwungen. »Habe ich doch selbst zuerst die Spur des Diebes entdeckt, und daß ich mich nicht getäuscht hatte, zeigten ja die gefundenen Perlen. Wie kommen Sie auf diese sonderbare Idee, daß ich Matale für unschuldig halte, was gar nicht der Fall ist?«
Der junge Mann wurde mit einem Male sehr ernst. Er rückte einen Stuhl vor den des Kapitäns und sah ihm forschend in die Augen.
Der Kapitän konnte den Blick nicht ertragen, er wandte den Kopf weg.
»Kapitän Esplanza,« sagte Henrico langsam und mit Nachdruck, »spielen wir nicht Katze und Maus zusammen. Haben Sie noch nie daran gedacht, daß auch noch andere Matale für unschuldig halten und den Dieb ganz wo anders suchen können? Offen gestanden, Sie haben furchtbar plump operiert.«
Mit glanzlosen Augen starrte der Kapitän den Sprecher an.
»Was wollen Sie damit sagen?« stammelte er endlich mit bebenden Lippen, scheu nach der Thür sehend, als suche er einen Weg zur Flucht.
»Ich will damit sagen, was mir sonnenklar ist: Nur Sie haben die Perlen gestohlen oder entwendet oder beiseite gebracht, wie Sie es ausdrücken wollen, und dann Matale beschuldigt, um in den Besitz seiner Frau zu kommen, die Sie lieben.«
Der Kapitän schwieg, er hatte die Fassung verloren.
»Bleiben Sie ruhig sitzen!« fuhr Henrico fort und legte dem Kapitän, der mit zitternden Gliedern aufstehen wollte, die Hand aufs Knie. »Sie sind vor mir vollkommen sicher, ja, ich kann Ihnen sogar behilflich sein, von hier fortzukommen, ohne Aufsehen zu erregen.«
»Was fällt Ihnen ein?« brauste der Kapitän jetzt auf. »Was berechtigt Sie, mich einer solchen That zu beschuldigen?«
»Nur gemach!« lächelte der bartlose Mann höhnisch; Er neigte sich vor, daß er mit dem Munde fast das Ohr des vor ihm Sitzenden berührte und flüsterte mit heiserer Stimme: »Ein Narr sind Sie gewesen, diese paar lumpigen Perlen zu nehmen und die anderen liegen zu lassen, dadurch haben Sie mir meinen ganzen Plan verdorben, es wird jetzt alles mit doppelter Schärfe bewacht.«
Erstaunt, ja freudig überrascht, blickte Esplanza auf.
»Und dennoch wird es mir gelingen, mit einem Schlage ein reicher Mann zu werden,« fuhr Henrico fort, »aber ich kann nicht allein fertig werden, ich brauche einen Kompagnon, und der sollen Sie sein. Schlagen Sie ein, Kapitän, sind Sie der Meinige?«
Er hielt dem Kapitän die Hand hin, ihn scharf fixierend, doch dieser traute nicht recht. Konnte dieser Mann nicht ein Spion sein, der ihn aufs Glatteis führen wollte? Solche Sachen waren schon öfter passiert. Aber nein, er kannte ihn ganz genau, sie hatten immer freundschaftlich miteinander verkehrt und er wußte, daß jener gern auf krummen Wegen wandelte. Henrico war Kassenverwalter bei der Gesellschaft, aber man munkelte unter den Beamten, daß in seinen Büchern nicht alles stimmte, obgleich ihm niemand etwas nachzuweisen im stande war. Wurde eine Kassenrevision abgehalten und war einmal ein Defizit vorhanden, so deckte Henrico immer die fehlende Summe aus seiner Tasche, obgleich niemand wußte, woher er das Geld nahm, denn er lebte auf großem Fuße.
Viel zu bedeuten hatte die Stelle eines Kassenverwalters übrigens nicht, denn mit dem Verkauf von Perlen hatte derselbe nichts zu thun, sondern nur die Gelder unter sich, von denen die Taucher bezahlt und der Betrieb des Unternehmens bestritten wurde.
»Was haben Sie vor, Senor Henrico?« fragte er.
»Sie und mich zum reichen Manne zu machen,« war die Antwort. »Alles ist dazu bereit, aber ich kann es nicht allein vollbringen.«
»Und wie wollen Sie von hier fortkommen, wenn es Ihnen wirklich gelingen sollte, den Dieb – die That auszuführen?«
»Auch dafür ist gesorgt. Ja, Sie können sogar Ihre Monika mitnehmen, wenn Sie wollen.« Henrico lachte bei diesen Worten leise auf. »Wir ziehen uns in eine Stadt Südamerikas zurück, dort findet uns kein Mensch, und wir können wie die Fürsten leben.«
»Wann wollen Sie ans Werk gehen?«
»Sagen Sie mir immer ›wir‹, mein lieber Kapitän, denn ich kann doch auf Sie rechnen. Einen solchen Mann wie Sie habe ich gesucht, es gehört etwas Mut dazu.«

»Sie kennen mich,« sagte der Kapitän nun, sich emporreckend.
»Ich weiß, daß ich auf Sie zählen kann; in einigen Tagen schon müssen wir den Plan ausführen, denn in etwa einer Woche erwartet der Direktor den Dampfer, der die Schätze abholt, und mit dem wertlosen Plunder, der zurückbleibt, wollen wir uns natürlich nicht begnügen.«
»Aber werden die Gäste uns nicht im Wege sein?« warf der Kapitän dazwischen, der nur zu gern auf den Vorschlag seines gleichgesinnten Gefährten einging.
»Ewig werden sie nicht hierbleiben; zwar habe ich den Direktor vorhin sagen hören, daß er für sie Quartiere hergerichtet hat. Aber hindern dürfen sie uns auf keinen Fall, oder sie müssen daran glauben.«
»Was?« rief der Kapitän erschrocken, »Sie gehen mit Mordgedanken um?«
»Still,« fuhr ihn der andere an, »nicht so laut, wir sind in einem Hause mit Holzwänden. Kann ich den Mord vermeiden, so thue ich es, aber er soll mich nicht abschrecken, mein Ziel zu erreichen.«
»Wie aber soll ich Ihnen trauen?« fragte Esplanza noch etwas mißtrauisch.
»Ich glaube doch, das, was ich Ihnen gesagt habe, müßte Ihnen genügen.«
Und nun setzte er seinen Plan auseinander, der dem aufmerksam zuhörenden Kapitän zu wiederholten Malen ein beifälliges Schmunzeln abnötigte.
»Und noch eins, Kapitän!« sagte Henrico, als sie ihren Bund durch ein Händeschütteln bekräftigten. »Lassen Sie einmal Ihren verdammten Jähzorn fahren. Nutzen hat er Ihnen noch niemals gebracht. Wären Sie mit jenen Fremden nicht so unhöflich verfahren, so säßen Sie jetzt noch hier als Beamter, und wir hätten viel freieres Spiel.«
»Ich konnte mir nicht helfen,« entgegnete der Kapitän, das stolze Betragen dieser Burschen ärgerte mich so, daß ich sie am liebsten in den Grund gerammt hätte. Was haben die Fremden übrigens hier zu suchen?«
»Well, denken Sie an das, was ich Ihnen gesagt habe! Halten Sie Ohren und Augen gut offen.«
Henrico blickte nach der Thür, welche sich hinter dem Hinausgehenden geschlossen hatte.
»Er geht in die Falle, als wäre er ein Kind,« murmelte er, »jähzornig, eitel und dumm; solche Leute können wir eben brauchen. Um die Kastanien aus dem Feuer zu holen, ist er gut genug. Wenn ich ihn nicht mehr brauche, werde ich schon Mittel und Wege finden, mich seiner zu erledigen.«
Die braunen Weiber standen vor den Hütten des Dorfes und steckten die Köpfe zusammen; die Beamten im Geschäftshaus hatten heute kein Interesse für ihre Beschäftigung, sie unterhielten sich über etwas, was vorläufig nur Vermutung war. Als aber der Direktor ins Zimmer trat und die fragenden Mienen seiner Untergebenen bemerkte, wurde die Vermutung durch seine Aussage bestätigt.
»Matale ist diese Nacht aus seiner Zelle geflohen.«
Der Direktor erklärte näher, wie die Flucht stattgefunden hatte.
Der Gefangene war einfach in ein hochgelegenes Zimmer geschlossen worden, aus dessen Fenster zu springen wohl nicht möglich gewesen wäre, ohne unten mit zerschmetterten Gliedern anzulangen, außerdem schritten während der Nacht beständig einige Beamte durch dieses Haus, in welchem sich die gesammelten Perlen befanden, sodaß jedes Geräusch, wie zum Beispiel der Sprung zum Fenster hinaus oder das gewaltsame Aufbrechen der Thür, sofort gehört worden wäre.
Als der Wärter am Morgen dem Untersuchungsgefangenen das Frühstück bringen wollte, fand er die Fensterflügel geöffnet und am Kreuz eine Strickleiter befestigt, welche bis auf den Erdboden hinunterreichte. Wie Matale in den Besitz einer solchen gekommen war, wo er doch mit niemandem, ausgenommen mit dem Direktor und dem Wärter in Berührung gekommen, war allen ein Rätsel.
Der im Komptoir anwesende Henrico bezeichnete ohne Zögern die fremden Gäste als diejenigen, welche an dem Schicksal Matales teilgenommen hätten.
»Sehen Sie sich mit einer solchen Behauptung vor!« entgegnete ihm der Direktor. »Fühlen sich diese Herren schuldlos, und erfahren sie von dieser Ihrer Aussage, so dürften sie die Beleidigung wohl nicht auf sich sitzen lassen.«
»Haben die Damen nicht gestern versucht, durch Angebot einer Summe Matales Freilassung zu erwirken?« fragte Henrico. »Was veranlaßte sie überhaupt dazu, sich so für das Schicksal des Diebes zu interessieren?«
»Und woher haben Sie erfahren, daß Sie es wirklich gethan haben?« fuhr der Direktor heftig auf.
»Soviel ich mich erinnern kann, war in dem Zimmer, in welchem mir allerdings Miß Petersen als Sicherheit für Matale eine Summe anbot, niemand als wir beide. Woher haben Sie unser Gespräch erfahren?«
Der junge Beamte schwieg verlegen; er hatte eben verraten, daß er im Hause des Direktors Spione unterhielt.
»Aber Sie sehen,« fuhr der Direktor ruhiger fort, »daß ich das Geld nicht angenommen habe, umsoweniger, als ich selbst nicht an die Schuld Matales glaube.«
»Seine Flucht beweist jetzt aber, daß er doch der Dieb ist,« bemerkte Henrico höhnisch. »Sie haben eine bessere Meinung von ihm, als er von sich selbst hat.«
Achselzuckend wandte sich der Direktor ab, er ärgerte sich sehr darüber, daß Matale sich selbst befreit hatte. An eine Verfolgung des Flüchtlings war nicht zu denken, denn in den Urwäldern Ceylons geht jede Spur verloren. Der Direktor ging hinaus, um den Gästen einen guten Morgen zu wünschen, welche er bereits am Ufer der Bucht spazieren gehen und die Taucher beobachten sah.
»Haben Sie schon erfahren, Miß Petersen, daß jener Mann, den Sie freikaufen wollten, durch Flucht sich dem Gericht entzogen hat?« war des Direktors erste Frage.
Das Mädchen fühlte, wie die Augen des Portugiesen fest an ihren Zügen hafteten, als hätte er einen Argwohn gegen sie, und Ellen war eine zu offene Natur, um eine Verlegenheit verbergen zu können. Sie konnte diesem ehrlichen Manne gegenüber kein Erstaunen heucheln.
»Das freut mich,« sagte sie ausweichend, »und da auch Sie so gut von Matale dachten, so wird Ihnen diese Nachricht auch nicht unangenehm gewesen sein.«
Ellen fürchtete schon, daß der Direktor jetzt eine Frage an sie richten würde, ob sie vielleicht ihre Hand dabei mit im Spiele gehabt, aber statt dessen spielte ein flüchtiges Lächeln um seine Lippen, und ohne weiter darüber zu sprechen, sagte er:
»Ich hoffe, Sie heute morgen mit einer Einladung zu überraschen, welche Sie und Ihre Freundinnen, wie auch die Herren mit großer Freude erfüllen wird. Die singhalesischen Häuptlinge im Innern von Ceylon halten jedes Jahr ein Elefantentreiben ab, um sich in den Besitz schöner Tiere zu bringen, welche sie dann zur Arbeit abrichten oder auch an indische Fürsten verkaufen. Vorhin nun brachte einer unserer Dampfer die Nachricht mit, daß in der Provinz Sabaragamua ein solches Kesseltreiben stattfindet. Wenn wir noch heute aufbrechen, können wir morgen früh dort eintreffen. Wir legen den Weg auf zwei Dampfern zurück, denn der Fluß, welcher in unsere Bucht einmündet, zweigt sich vom Black-River ab, und dieser führt direkt nach Sabaragamua. Diese Provinz ist mit Flußstraßen völlig durchzogen, sodaß wir uns überallhin begeben können. Sind Sie damit einverstanden, einer solchen Elefantenjagd beizuwohnen?«
Unterdessen hatten sich alle Herren und Damen um den Sprecher versammelt und nahmen den Vorschlag natürlich mit Freuden an. Nur wurde allgemein bedauert, keine Jagdgewehre mitgenommen zu haben, denn die in der Ansiedlung vorhandenen reichten nicht für die ganze Gesellschaft aus.
»Sie werden wohl auch keine Gelegenheit dazu haben, Waffen anzuwenden,« meinte der Direktor. »Wenn wir an dem Platze ankommen, sind die Tiere bereits zusammengetrieben, und Sie können nur als Zuschauer dem Einfangen derselben beiwohnen. Wenn Sie dies noch nicht gesehen haben, so werden Sie ein Schauspiel erleben, welches der aufregendsten Jagd vorzuziehen ist. Wissen Sie, wie man die Tiere einfängt, nachdem sie zusammengetrieben worden sind? Der Mensch ist diesem Riesen gegenüber natürlich vollkommen ohnmächtig.«
»Die Singhalesen richten ihre stärksten Elefanten dazu ab, daß dieselben ihre eigenen Brüder fangen und dabei auf Kommando des ›Gal-Oya‹ arbeiten, das heißt, des Elefantenbändigers, der in Indien und auf Ceylon dieselbe Rolle spielt wie ein berühmter Stierkämpfer in Spanien. Jeder indische Fürst hält sich einen solchen ›Gal-Oya‹ und bezahlt dessen Dienste mit Gold. Sie werden Staunenswertes von diesen braunen Burschen zu sehen bekommen.«
»Es ist aber doch besser, wenn wir uns mit Jagdgewehren bewaffnen,« unterbrach ihn Harrlington. »Mit unseren kleinen Revolvern uns so ohne weiteres in die Wälder Ceylons und unter die Eingeborenen zu wagen, erscheint mir doch etwas riskant.«
»Sie sind ja auf unseren Dampfern, und wir können zum Vergnügen bis in die Mitte der Insel fahren,« lachte ein junger Indier, der herzugetreten war.
»Wenn Ihnen die Gewehre, die wir Ihnen anbieten können, nicht genügen, so steht Ihnen einer unserer Dampfer zur Verfügung, um nach Colombo zurückzukehren und sich mit allem Nötigen auszurüsten,« schlug der Direktor vor. »In drei Stunden sind Sie wieder hier, und wir haben inzwischen alles vorbereitet, um sofort unsere Flußreise antreten zu können.«
Damit war man einverstanden.
Einige der Herren und Damen wurden auserlesen, nach Colombo zu fahren und dasjenige herbeizuschaffen, was zu einem Jagdausflug für nötig befunden wurde. Unverzüglich fuhren die Betreffenden auf einem Dampfer ab, während die Zurückgebliebenen zusahen, wie die Eingeborenen das andere Fahrzeug mit Lebensmitteln beluden.
Nach drei Stunden waren die Abgesandten wieder eingetroffen, und die Gesellschaft verteilte sich auf die beiden Dampfer. Außer dem Direktor nahmen noch verschiedene andere Beamte an dem Ausflug teil, denen es der Dienst erlaubte, nur wenige blieben zurück, darunter auch Henrico und der entlassene Kapitän Esplanza, an dessen Stelle vom Direktor der Steuermann gesetzt worden war.
Es kam öfters vor, daß die Ansiedlung nur unter der Aufsicht von einigen Beamten zurückgelassen wurde; unter den Eingeborenen herrschte vollkommene Ruhe, es war ein zufriedenes, heiteres Völkchen, und die Europäer waren am Gewinn aus dem Verkauf der Perlen beteiligt, sodaß man sich auf sie verlassen konnte.
Die beiden Dampfer steuerten in den Fluß, der in die Bucht von Pentura mündet.
»Dort steht der Senor Esplanza am Fenster und blickt uns nach,« sagte Lord Hastings und deutete nach einem Häuschen, welches der Kapitän bewohnte. »Was der Kerl für ein höhnisches Gesicht zieht! Schade, daß er mir immer so geflissentlich aus dem Wege geht, sein böses Gewissen läßt ihm keine Ruhe.«
»Mir wäre es lieber, wenn er uns schon verlassen hätte,« meinte der Direktor, »ich kann ihm zwar nichts weiter nachsagen, als daß er sehr jähzornig ist, aber immerhin, ein entlassener Beamter taugt nichts mehr, er versucht nur, die jüngeren Leute unzufrieden zu machen.«
»Wie lange bleibt er noch hier, seit, wie jetzt allgemein behauptet wird, Matale durch seine Flucht den Diebstahl eingestanden hat?« fragte Ellen.
»Ich glaube kaum,« war die Antwort, »daß der Taucher aus Furcht vor Strafe geflohen ist, sondern vielmehr, um auf eigene Faust nach dem Diebe zu forschen. Ich kenne den Burschen, er ist ein schlauer, thatkräftiger Mann und verwegen bis zur Tollkühnheit, er wird kein Mittel scheuen, den eigentlichen Thäter zu fassen. Doch sehen Sie dort,« unterbrach sie der Portugiese und deutete auf einige dunkle Körper, die wie Baumstämme an den Ufern des mit Wald umgrenzten Flusses schwammen, »wir kommen in das Gebiet der Alligatoren. Schießen Sie noch nicht,« fügte er hinzu, als bereits einige nach den Gewehren griffen, »wir bekommen noch bessere Gelegenheit zum Schuß. Wenn Sie jetzt auch eins der Tiere wirklich tödlich treffen, so geht es Ihnen doch verloren, weil es im Todeskampf untertaucht und erst nach einigen Tagen als verwester Leichnam wieder an die Oberfläche kommt. Später treffen wir auf Sandbänke, auf denen sich die Alligatoren in Unmenge sonnen.«
Der Direktor hatte richtig vorausgesagt.
Bis jetzt hatten die Ränder des Flusses den Eindruck eines Urwaldes gemacht. Ueber das träge fließende Wasser hingen von mächtigen Baumriesen Schlingpflanzen herab, welche die Aussicht in den Wald versperrten. Nur ab und zu verriet ein Knacken von Zweigen, eine heftige Bewegung im Blätterwerk, daß diese Wildnis von Tieren bevölkert wurde, die sich beim Herannahen der kleinen Dampfer mit den vielen Menschen scheu zurückzogen.
Nach einigen Stunden aber wurde der Wald manchmal durch eine Lichtung unterbrochen, und an solchen konnte man sehen, daß des Direktors Behauptung, der Uferrand sei vollständig versumpft, richtig war.
Soweit das Auge in den Wald reichte, sah man statt des festen Bodens nur Sumpf, belebt von Wasservögeln, und hier und da ragte auch aus dem Morast der bepanzerte Kopf eines Alligators hervor, der mit tückischen Augen die Vorbeifahrenden anstierte, ohne seine Lage zu ändern.
Dann verbreiterte sich der Fluß ungemein, dafür wurde er aber flacher, und die Kapitäne mußten alle Aufmerksamkeit aufbieten, sicher die tiefsten Stellen aufzufinden, um ihre Fahrzeuge nicht auf den Grund laufen zu lassen. Doch war es nicht das erste Mal, daß sie diese Binnenwässer befuhren, und so ließen sie immer solche gefährliche Stellen hinter sich, ohne die Fahrt des Dampfers gemäßigt zu haben.
Schließlich verschwand der Wald ganz, er machte einer mit hohem Buschwerk bewachsenen Ebene Platz, und ebenso änderte sich die Beschaffenheit des Flußbettes. Es war sehr breit geworden, und man sah an mehreren Stellen Sandbänke aus den trüben Fluten hervorragen.
Diese Sandbänke waren die Lieblingsplätze der Alligatoren.
Träge lagen sie auf ihnen, die Augen halbgeöffnet, und setzten den beschuppten Leib den Strahlen der Sonne aus. Es kam selten einmal vor, daß sie hier in ihrer beschaulichen Ruhe von Menschen gestört wurden, Dörfer von Eingeborenen waren in der Nähe nicht vorhanden, und so hielten sie es jetzt nicht der Mühe für wert, ihre Zuflucht nach dem sicheren Wasser zu nehmen.
Der Alligator ist am Land ein sehr unbeholfenes Geschöpf. Mit den im Verhältnis zu dem mächtigen Körper sehr schwächlichen kurzen Beinen kann er sich nur langsam im Sande fortschleppen, während er im Wasser, seinem eigentlichen Element, sich mit der Geschwindigkeit des Fisches bewegt. Ja, er ist diesem sogar an Schnelligkeit überlegen, denn seine Nahrung besteht aus Fischen, und er muß sich diese also fangen. Mit weit geöffneten Rachen schießt er am Grunde des Flusses hin und verschlingt alles Lebendige, was sich dem Bereiche seiner furchtbaren Zähne nähert. Aber auch der Mensch, der über Bord ins Wasser fällt, ist fast immer verloren. Ehe dem Unglücklichen noch Rettung werden kann, schießen schon von allen Seiten die greulichen Ungeheuer herbei, packen ihn und machen sich den Raub streitig, bis der Körper in ebensoviele Teile getrennt ist, wie sich Tiere um ihn gesammelt haben.
Selbst die flüchtige Antilope weiß der Alligator zu erbeuten. So scheu sich auch das dürstende Tier dem Wasser nähert, so vorsichtig es auch den Wasserspiegel beobachtet, plötzlich kräuselt sich vor ihm die Fläche, es erhält mit dem schuppigen Schweif einen Schlag, und in der nächsten Sekunde zappelt die Beute in dem bezahnten Rachen des Ungeheuers.
»Noch eine Minute,« sagte der Portugiese, als sich sein Dampfer einer Sandbank mit Alligatoren näherte. »Sind wir quer vor der Bahn, so schießen Sie auf mein Signal gleichzeitig, aber zielen Sie nur nach den Augen! Ein anderer Schuß wäre vergeblich.«
Jetzt stieß der Portugiese einen Pfiff aus, zehn Gewehre krachten, und ebensoviele Körper rollten unter gräßlichen Zuckungen auf der Sandbank umher, bis sie bewegungslos liegen blieben, nur eins der Tiere hatte dabei das Wasser erreicht und verschwand in den Fluten, sie mit seinem Blute rötend.

»Wollen Sie eins der Reptile abhäuten lassen, um den Panzer als Jagdtrophäe mitzunehmen?« fragte der Direktor.
Auf die Bejahung hin ließ er ein Boot aussetzen, einige der Eingeborenen, meist malayische Matrosen stiegen ein und betraten die Insel. Sie befestigten das größte Tier, welches fast vier Meter Länge erreichte, in einer Schlinge, ruderten nach dem Dampfer zurück und hißten mit einer Winde den toten Körper über. Nach einer Viertelstunde hingen die Haut, die Kiefer mit den Zähnen und das abgeschälte Rückgrat zum Trocknen an Leinen. Der biegsame Rückenknochen des Alligators wird mit Vorliebe zu Spazierstöcken verarbeitet.
Da stieß plötzlich einer der Malayen, der aus Neugierde den Magen des Reptils geöffnet hatte, um die Menge der verschlungenen Fische zu sehen, einen lauten Schrei aus, er hatte eine Masse großer Knochen entdeckt, die nur von einem Menschen herrühren konnten.
»Gott weiß, wer hier sein Leben auf solch elende Weise verloren haben mag,« sagte der Direktor erschüttert, »jedenfalls ein Eingeborener, der toll genug war, den Fluß durchschwimmen zu wollen. Es kann noch keinen Tag her sein, seit er dem Alligator zum Opfer gefallen ist, denn die Kochen sind noch ganz unversehrt. Findest du noch etwas darin, was auf die Person des Unglücklichen schließen läßt?« wandte er sich an den Malayen.
Dieser brachte die Fetzen eines Kleides heraus, und plötzlich hielt er einen goldenen Fingerreif in der Hand. »Passera!« schrie er, als er nur einen Blick auf den Ring geworfen hatte. »Ich kenne ihn, er trug diesen Ring mit den sonderbaren Aetzungen.«
»Irrst du dich nicht?« fragte der Direktor ungläubig. »Ihr tragt alle Ringe und Schmuckgegenstände.«
»Ich irre mich nicht,« beteuerte der Malaye, den Ring vorzeigend, »es ist kein Ring, wie wir ihn in Colombo zu kaufen bekommen. Passera erhielt ihn einst von einem Neger geschenkt, der weit, weit her kam, er nannte seine Heimat Guinea. Niemand anders trug einen solchen Ring als Passera, nur er kann es sein.«
»Dann wäre es ein Gottesgericht, wenn Passera wirklich den Diebstahl begangen hat. Aber nein, ebensogut kann Passera verunglückt sein, und eben darum, weil er plötzlich verschwand, hielten wir ihn für den Dieb.«
»Seit wann ist Passera verschwunden?« fragte einer der Herren.
Der Portugiese rechnete nach.
»Vor sechs Tagen, eben in derselben Nacht, da wir das Fehlen der Perlen entdeckten, obgleich sie schon früher geraubt sein müssen.«
»Aber Sie selbst sagten vorhin, die Knochen könnten erst seit einem Tage im Magen des Tieres sein,« sagte Johanna.
»Allerdings, und gerade dies wirft ein schlechtes Licht auf Passera. So muß er sich also so lange in den Wäldern versteckt gehalten haben und ungefähr erst gestern eine Beute des Alligators geworden sein. Aber was weiß ich? Ich will kein Urteil über jemanden fällen, der schon gerichtet worden ist.«
Die Gesellschaft verhielt sich sehr schweigsam, als die Dampfer ihre Fahrt fortsetzten.
»Hätten wir nur unseren Freund Sharp nicht verjagt, sondern reiste er immer noch mit uns als Claus Uhlenhorst, so würde er das Rätsel bald lösen,« meinte Williams zu Lord Harrlington. »Er würde haarklein beweisen, wielange die Knochen im Magen sind, wo der Alligator den Körper gefunden hat und wie er dahin gekommen ist.«
»Lassen Sie Ihre Scherze über so etwas,« entgegnete der Lord. »Aber wissen Sie nicht, wo er jetzt stecken mag?«
»Seit wir ihm damals in Bombay einen Strich durch die Rechnung machten und er uns in hellem Zorn verließ, habe ich ihn ebensowenig, wie Sie wiedergesehen. Hat er Ihnen den Dienst gekündigt? Ich weiß ja nun, warum er sich immer in der Nähe von Miß Petersen hielt oder dies wenigstens thun sollte.«
»Nein,« antwortete der Lord, »er ist einfach spurlos verschwunden.«
»Dann treibt er sich auf jeden Fall hier herum,« meinte Charles bestimmt, »er will eben niemanden mehr in seine Karten blicken lassen, und er thut schließlich auch ganz recht daran, ich machte es ebenso. Entweder läßt er sich jetzt als Perlentaucher beschäftigen oder schleicht als Wilder im Urwald herum oder hält sich in sonst einer Gestalt in unserer Nähe auf. Wer weiß, ob da neben so einem Alligator Nick Sharp nicht sein mit Schlamm bedecktes Haupt emporreckt und uns beobachtet. Zuzutrauen ist ihm alles.«
Der Lord lachte.
»Wir biegen nun in den Black-River ein, in den eigentlichen Hauptstrom, von dem sich dieser Fluß nur abzweigt. Er ist viel breiter und gestattet ein viel schnelleres Fahren, so daß wir bequem morgen früh den Ort erreichen können, wo die Elefanten in einem Kraal zusammengetrieben sind. Ich hoffe,« fügte der Direktor lächelnd hinzu, »daß Sie eine recht angenehme Nacht an, Deck verbringen werden. Haben wir Glück, so werden Sie die schönste Nacht auf diesem Flusse verleben, wie sie Ihnen nie wieder geboten wird, im anderen Falle die entsetzlichste, an die Sie noch in späteren Jahren mit Schaudern gedenken werden.«
»Wieso?« fragte Ellen verwundert.
»Ich will Ihnen keine schwarzen Bilder vormalen, aber machen Sie mich nicht verantwortlich, wenn der schlimmste Fall eintritt. Gefahr droht Ihnen nicht, aber umsomehr Leiden.«
Die Dunkelheit senkte sich bald mit jener Schnelligkeit herab, wie man sie nur in den Tropen beobachtet. Eben noch hatte man alle Gegenstände an Deck, selbst im Walde deutlich erkennen können, in der nächsten Minute war alles in Nacht gehüllt.
Auf den Dampfern wurden die Laternen angesteckt, nur aus Gewohnheit, denn hier hatten sie keinen Zweck. Ein Zusammenstoß war auf diesem verlassenen Gewässer nicht zu fürchten, und um den Steuerleuten den Weg zu zeigen, genügte das schwachstrahlende Licht auch nicht. Diese Männer, welche ihr halbes Leben zwischen den Wäldern, zu Wasser und zu Lande zugebracht hatten, kannten jeden Zoll des Uferrandes, wußten an jeder Stelle des Flusses wie tief er war, ohne erst die Lotschnur befragen zu müssen. ^
Der Portugiese hatte nicht zuviel gesagt, als er seinen Gästen eine herrliche Nacht versprach.
Die tiefste Ruhe lag über dem Wald; nur das leise Gurgeln des Kielwassers und manchmal der klagende Schrei eines Wasserhuhnes unterbrachen die Stille, die selbst die Passagiere nicht durch lautes Sprechen zu stören wagten. In Gruppen standen sie zusammen und unterhielten sich in flüsterndem Ton, beobachteten die Funken, die ab und zu aus dem Schornstein aufflogen, eine Zeit lang über dem Walde schwebten und dann verschwanden, nicht zu unterscheiden von den Leuchtkäfern, welche in dem Laubgewinde auftauchten, wieder erloschen und sich an einer offenen Stelle wie in einem feurigen Kugelspiel bewegten.
Es war keine schwüle Nacht, aber die Luft doch so warm und weich, daß man den leisen Windhauch wie einen Kuß zu spüren meinte. Alles dies, vereinigt mit dem monotonen Gemurmel des Wassers, dem melancholischen Ruf des Vogels, äußerte sich auch in den Stimmungen der Herren und Damen. Gedanken, schwermütig und seltsam, wie man sie wohl sonst nicht häufig bei ihnen fand, bemächtigten sich ihrer Gemüter.
»Was wird uns die Reise wohl bringen?« fragte Ellen den Lord Harrlington, der neben ihr an der Brüstung lehnte und den Wellen zusah, die sich am Bug brachen und im roten Schein der Laterne leuchteten.
»Ich habe nie so trübe Ahnungen gehabt wie diese Nacht; diese Wellen, die mir wie Blut entgegenschimmern, kommen mir wie eine üble Vorbedeutung vor.«
»Es ist nicht das erste Mal,« entgegnete der Lord, »daß wir während unserer Reise auf Blut trafen, sie ist schon oft genug über Leichname gegangen, ohne daß wir es ändern konnten. Fällt Ihnen erst jetzt ein, Miß Petersen, welche große Verantwortung Sie auf sich genommen haben?«
»Verantwortung?« fragte Ellen, und der Lord konnte wohl vernehmen, daß Unwillen aus diesem Worte klang. »Meine Freundinnen haben sich freiwillig erboten, mich zu begleiten, ich habe niemanden gezwungen oder auch nur überredet. Sind Sie den Herren gegenüber nicht in ebenderselben Lage?«
»Nein, nicht so ganz! Sie unternahmen die Reise nur zum Vergnügen, ohne eine Absicht zu verfolgen und –«
»Halt,« unterbrach ihn Ellen, »ist es nicht eine gute Aufgabe, wenn wir die Mädchen, nachdem wir sie erst befreit haben, auch in ihre Heimat bringen? Jeder Mensch muß unser Vorhaben lobenswert finden, wenn er nicht gerade ein verknöchertes Herz in der Brust hat.«
Harrlington lächelte.
»Das ist aber nur etwas, was Ihnen zufällig in den Weg gestoßen ist. Sie sind nicht mit dem Vorsatz von New-York abgefahren, diese Mädchen zu befreien und in ihre Länder zurückzubringen –«
Wieder unterbrach ihn Ellen. »Aber ich verstehe Sie nicht! Wie können Sie mich tadeln oder etwa, wie ich fast glaube, eines abenteuerlichen Sinnes zeihen wollen, wenn Sie selbst eine Reise angetreten haben, bei welcher Sie keinen Zweck im Auge haben?«
»O, Miß Petersen, bei uns oder speziell bei mir, ist dies doch eine ganz andere Sache. Bin ich planlos in die Welt gefahren?«
»Wieso nicht?«
»Ich folgte der ›Vesta‹, weil sie das Teuerste barg, was die Welt für mich besitzt, und so mögen noch andere unter den Herren sein, welche mein Beispiel nachahmen.«
Ellen wandte sich hastig ab.
»Sie hören nicht auf, mir Vorwürfe zu machen,« sagte sie ärgerlich, »es ist überhaupt nicht möglich, daß wir uns gleichmütig unterhalten können, stets stoßen wir dabei auf Meinungsverschiedenheiten, oder Sie sagen mir etwas, was ich nicht hören will.«
Lord Harrlington sah dem Mädchen lange nach, welches sich einigen ihrer Freundinnen zugesellte.
»Was wird uns diese Reise wohl bringen?«
Dieselbe Frage wurde auch am Heck des Dampfers gestellt, und der Sprecher sprach die Worte in einem so seltsamen Tone, daß Williams seinem Freunde, dem Marquis Chaushilm forschend ins Auge blickte.
»Nanu,« sagte er trocken, »können Sie die warme Luft nicht vertragen, oder leiden Sie wieder einmal an Melancholie?«
»Melancholie?« jauchzte der Marquis förmlich auf. »Mein lieber Baronet, ich bin der glücklichste Mensch unter der Sonne.«
»So, seit wann denn?«
»Seit vorhin. Endlich ist der Tag angebrochen, an dem die Sonne meines Glückes mich mit den Strahlen ihres Götterlichtes übergießt.«
»Aber Herzog, Sie fangen ja an zu dichten! Was veranlaßt Sie denn eigentlich, hier, mitten in der Nacht, von Göttern, Tag und Licht zu träumen, während man nicht einmal die Hand vor den Augen schen kann?«
»Ach,« seufzte Chaushilm, »ich weiß, Sir Williams, Sie sind mein Freund, und ich kann mich auf ihre Verschwiegenheit verlassen.«
»Bombenfest.«
»Ich brauche jetzt einen Menschen, an dessen Brust ich mich werfen und meine Wonne aushauchen kann.«
»Dann hauchen Sie mal zu, aber rühren Sie mich nicht auch zu Thränen.«
»Sie täuschen mich nicht, lieber Charles, in ihrer rauhen Schale steckt ein guter Kern, Sie sind ein guter Mensch.«
»Aber so fangen Sie doch endlich mal an, sonst weiß ich morgen, wenn wir die Elefanten fangen, immer noch nichts,« drängte Charles.
»Sie wissen doch,« begann Chaushilm, »daß ich schon immer für Miß Thomson eine tiefere Neigung gehegt habe.«
Charles blieb vor Staunen über dieses Geständnis anfangs stumm.
»Haben Sie dies noch niemals gemerkt?«
»Ich? Nein,« brachte Charles endlich hervor, »ich dachte Sie hätten sich für Miß Nikkerson interessiert.«
»O nein,« meinte Chaushilm verlegen, »das war früher einmal, als sie sich so famos dem Mädchenhändler gegenüber benahm, aber schon längst nicht mehr.«
»Und dann glaubte ich, Miß Stannton wäre der Gegenstand Ihrer tieferen Verehrung gewesen?«
»Nein, das war wieder später, als Miß Stannton über Bord gefallen war. Ich fand aber nachher, daß es nur ein Gefühl des Mitleides gewesen war, alles nur oberflächlich, aber jetzt habe ich erkannt, daß mich an die Thomson ein stärkeres Gefühl fesselt.«
»Wissen Sie das auch genau, ehe Sie Miß Thomson nachher unglücklich machen?« fragte Charles in gutmütigem Spott.
»Ich weiß es ganz bestimmt, ich habe ihr vorhin meine Liebe gestanden, und haben Sie eine Ahnung, was dieses göttliche Mädchen mir gesagt hat?«
»Eine Schmeichelei jedenfalls nicht.«
»Nein, sie sagte, auch ich hätte schon längst ihr Herz mit Liebe bezaubert.«
Und Chaushilm warf sich dem Freunde an die Brust.
Charles stieß einen langen Pfiff aus.
»O, Sie Glücklicher,« seufzte er dann, »wie beneide ich Sie! Wen suchen Sie sich denn nachher unter den Damen aus?«
»Mit Ihnen kann man doch aber kein vernünftiges Wort reden,« sagte Chaushilm unwillig und trat zurück. »Glauben Sie etwa, ich treibe mit so etwas Heiligem, wie mit der Liebe eines Weibes, Spott?«
»Zaubern Sie nur ruhig weiter, lieber Herzog,« entgegnete Charles lächelnd, »und geben Sie acht, daß Ihnen nicht etwas vorgezaubert wird.«
Als der Marquis hinter dem Schornsteinmantel verschwunden war, sagte Charles zu sich selbst:
»Es ist jammerschade, daß Nick Sharp nicht hier ist, sonst könnte ich mit dessen Hilfe einmal einen Spaß arrangieren. Na, vielleicht läßt sich auch Hendricks dazu verwenden. Wollen sehen, was sich anfangen läßt.«
»In's Zwischendeck,« rief plötzlich die Stimme des Direktors, »so schnell, wie möglich, und alle Fenster und Luken schließen!«
Man vernahm ein sonderbares Summen und Schwirren in der Luft, wie eine Wolke fiel plötzlich etwas von oben herab auf das Deck nieder, und ehe die Passagiere den Rat des Portugiesen noch hatten befolgen können, waren Gesicht, Hände, ja, alle Teile des Körpers, selbst die, welche von Kleidern verhüllt waren, mit Stichen bedeckt.
»Die Moskitos!« hallte es jetzt von allen Seiten.
Man hatte schon einige Male die Bekanntschaft dieser böswilligen, zollgroßen Blutsanger gemacht, aber mit einer solchen Heftigkeit wie hier, waren die Tiere noch niemals über die Reisenden hergefallen.
Der Himmel schien sie förmlich herabzuregnen; wohin man an Deck trat, zerquetschte der Fuß Hunderte der Tiere, die sich nach dem Sturze nicht gleich erheben konnten. Hatten sie aber den Gebrauch der Flügel wiedergefunden, so stürzten sie sich heißhungrig auf die Menschen, um sich an deren Blut zu sättigen.

Schreiend flüchteten die Damen die Treppe nach dem Zwischendeck hinab; fluchend folgten ihnen die Herren, und nun begann unten eine Treibjagd nach den Moskitos, welche mit ihnen in den unteren Raum geschlüpft waren. Oeffnete sich einmal die Luke, um einen verspäteten Flüchtling einzulassen, so drang stets ein neuer Schwarm der zudringlichen Gäste herab, und wieder begann unter Schreien und Lachen ein Schlagen mit Tüchern und Klatschen, bis der Boden mit den Leichen aller Tiere besäet war.
Der Portugiese hatte ein Mittel mitgenommen, welches verhindert, daß die gestochene Hautstelle hinterher anschwillt, und so waren besonders die Damen froh, daß sie nicht zu befürchten brauchten, am nächsten Morgen mit angeschwollenen Gesichtern zu erscheinen. Aber die Atmosphäre in dem abgeschlossenen Raume ward bald drückend, an Schlafen in den Kabinen war nicht zu denken, teils vor Hitze, teils, weil eine einzige der Schlacht entgangene Mücke den Ruhenden zur Verzweiflung bringen konnte, und man sehnte sich nach der Erfüllung der Prophezeiung des Direktors, daß der kühle Morgenwind die Moskitos ebenso schnell wieder verjagen würde, wie sie ein heißer hergebracht hätte.
Nach einigen Stunden entsetzlichen Wartens trat diese Veränderung ein: durch die geöffneten Luken und Fenster drang die frische Luft, ohne einen der Quälgeister mitzubringen, und die letzten kühlen Stunden verbrachten die Passagiere in erquickendem Schlummer in ihren Hängematten, welche sie teils an Deck, teils in den Kabinen aufhingen.
Im weiten Umkreis reihte sich Zelt an Zelt auf, der großen Grasfläche, überall waren aus Bambusrohren und dünnen Baumstämmen Gerüste aufgeschlagen worden, von denen aus die indischen und europäischen Großen von Ceylon dem Schauspiel zusehen wollten, das der Fürst Kalawya arrangiert hatte.
Schon vor Wochen waren die singhalesischen Häuptlinge beauftragt worden, mit ihren Leuten eine Treibjagd auf Elefanten abzuhalten und möglichst viele der Herden nach diesem Platze zu locken, wo sie dann in einen künstlich aus Balken gezimmerten Kraal getrieben wurden.
Eine solche Jagd erfordert nur Geduld, gefährlich ist sie nicht.
Die Elefanten leben in Herden von sechs bis fünfzig und mehr Stück zusammen und sind an und für sich friedliche Tiere, nur, wenn sie zur äußersten Wut gereizt oder erschreckt werden, verlieren sie ihre Scheu vor den Menschen und treten rücksichtslos alles unter ihren Füßen zusammen, reißen Baumstämme mit dem Rüssel aus dem Erdreich, als wären es Grashalme, und schleudern auch den Menschen, der ihnen nicht ausweicht, mit dem Rüssel in die Luft, zerfleischen ihn mit den Stoßzähnen, oder zermalmen ihn durch ihr Gewicht zu Brei.
Nun giebt es aber auch Elefanten, deren Jagd eine der gefährlichsten ist. Dies sind die von den Eingeborenen als ›Einsiedler‹ bezeichneten männlichen Tiere, welche entweder einmal von ihrer Herde versprengt worden sind und in keine andere aufgenommen wurden, oder aber alte Elefanten, welche, wegen zu großer Anzahl von männlichen Tieren, nach hartem Kampf von den jüngeren aus der Herde gestoßen worden sind.
In mürrischem Alleinsein verbringen sie ihr Leben, suchen mit Vorliebe Streit mit anderen ihres Geschlechtes und greifen auch oft den Menschen ohne jeden Grund an, selbst wenn sie die Gefährlichkeit der Feuerwaffe schon an sich selbst gespürt haben. Alles Lebende erregt ihren heftigsten Zorn. Entgeht ihnen der Gegenstand ihrer Wut trotz der hartnäckigsten Verfolgung, so lassen sie ihre Wut wenigstens noch an toten Sachen aus, entwurzeln ganze Wälder und stampfen in einer Nacht die Reisernte eines Dorfes in den Boden. Deshalb sind sie auch von den Eingeborenen gehaßt, und einen ›Einsiedler‹ erlegt zu haben, gilt als eine größere Ehre, als zehn in Herden lebende Elefanten aus sicherem Hinterhalt geschossen zu haben.
Die Einwohner Ceylons, überhaupt ganz Indiens, brauchen die Elefanten zu vielen Zwecken.
Die gelehrigen Tiere werden abgerichtet, beim Ausroden von Wäldern zu helfen, d. h. sie müssen die gefällten Baumstämme mit dem Rüssel forttragen, und diesen Tieren, deren Stärke jeder Beschreibung spottet, ist es möglich, mit einem mächtigen Pfluge den von Wurzeln durchzogenen Boden des ehemaligen Urwaldes zu durchschneiden, sie helfen beim Häuserbau, indem sie auf ihren Rücken ganze Wagenladungen von Sand und Steinen schleppen, sie werden zur Tigerjagd verwendet, und außerdem hat jeder indische Tempel einige besonders schöne Exemplare von Elefanten aufzuweisen, die bei feierlichen Umzügen mitgeführt werden.
Von jeher spielte bei den Indiern der weiße Elephant eine Rolle, und man glaubte lange, er gälte ihnen für heilig, doch ist dies nicht der Fall, sondern die Tempeldiencr und die zum Tempel gehörenden Anbeter sind deshalb stolz darauf, einen solchen zu besitzen, weil der weiße Elefant sehr selten ist. Uebrigens ist die Bezeichnung ›weiß‹ nicht richtig, denn die Farbe dieser Tiere ist nur eine Schattierung heller, als die der gewöhnlichen, schmutziggrauen Elefanten.
Man hat auf Jahrmärkten, in Tierbuden u. s. w. öfters Gelegenheit, Elefanten im Ausführen von Kunststückchen zu bewundern, aber dies alles sind nur angelernte Sachen, nach denen wir ihre Klugheit nicht beurteilen dürfen. Um diese zu erkennen, muß man Elefanten beobachten, wenn sie ohne Aufsicht, vollkommen sich selbst überlassen, ihnen aufgetragene Arbeiten verrichten.
Man muß sehen, wie sie die Baumstämme, an denen noch das Laubwerk hängt, nach einer Blöße schleppen und dort aufstapeln, wie andere wieder die Bäume auf Wagen laden, wie geschickt sie sich durch den dichten Urwald winden, und wie sie unwillig brummen, wenn sich der getragene Stamm zwischen zwei Bäumen einklemmt. Sieht ein anderer Elefant, daß sein Kamerad weder vor-, noch rückwärts kann, so legt er seine Last einstweilen nieder, hilft dem vor ihm Gehenden freizukommen und nimmt dann seinen eigenen Stamm wieder auf. Und das alles geschieht ohne Aufsicht, wenigstens ohne solche von Menschen, denn unter den Elefanten giebt es solche, die den anderen Tieren mit gutem Beispiele vorangehen, ihnen helfen, wenn sie sich anfangs ungeschickt benehmen und sie auch durch Schlagen mit den Rüsseln und Stoßen mit den Zähnen zum Gehorsam zwingen.

Um nun in den Besitz neuer Elefanten zu kommen, hatte Kalawya, ein eingeborener, mächtiger Fürst, die Häuptlinge der in dieser Gegend wohnenden, meist von der Jagd lebenden Singhalesen aufgefordert, eine Treibjagd abzuhalten.
Schon seit vielen Tagen waren die Eingeborenen damit beschäftigt, die Herden der Dickhäuter zu umgehen und sie nach und nach dorthin zu treiben, wo auf einem freien Wiesenplatz ein Kraal gebaut, d.h., ein Platz rings mit einem etwa zwei Meter hohem Bollwerk aus Holz eingezäunt worden war.
Beim Treiben selbst wurde jeder Einsiedler vorsichtig gemieden, er hätte alle Herden wieder auseinandersprengen können; aber auch so geriet manche Herde in Schrecken, drehte um und jagte in wilder Flucht durch die Reihen der Treiber. Ein Aufhalten oder Zurückscheuchen gab es dann natürlich nicht.
Endlich war es den Leuten doch gelungen, etwa siebzig Tiere in den Kraal zu bringen, in dessen Umgebung vorläufig noch kein Mensch zu sehen war. Dagegen standen in dem Kraal bereits gegen zwanzig gezähmte Elefanten, und gerade der Anblick ihrer Kameraden veranlaßte die neuen Tiere, den eingezäunten Platz zu betreten.
Kaum waren sie darin, so drängten sich die gezähmten Elefanten wie auf Kommando nach dem etwa acht Meter breiten Eingang, besetzten diesen und stellten sich rings um das Bollwerk auf, um etwaige Fluchtversuche zu verhindern, denn die eingerammten Baumstämme hätten den Elefanten nur soviel Widerstand geboten, wie einem Manne ein in den Weg gestellter Stuhl.
Als dies so weit war, kamen aus dem nahen Walde der Fürst, sein Gefolge und seine Gäste hervor und bestiegen die Tribünen, von denen aus sie den Kraal übersehen konnten, während von der Flußseite her der portugiesische Direktor mit den Damen und Herren erschien, die, nachdem er von Kalawya die Erlaubnis dazu erhalten, auf schnell aufgerichteten Gerüsten ebenfalls Platz nahmen.
Die Elefanten waren sehr scheu geworden, die Herden hatten sich vermischt, unruhig rannten sie bald nach der einen, bald nach der anderen Seite der Umzäunung, und es hätte nur eines derben Anlaufs bedurft, so wäre diese umgeworfen worden, und die Tiere wären frei gewesen. Aber sie berührten die Wand gar nicht; sobald sich ein Elefant der Umzäunung näherte, streckten sich ihm einige Stoßzähne und Rüssel entgegen, und immer wieder fuhr das bestürzte Tier zurück, drehte um und rannte der anderen Seite zu, wo es ebenso zurückgetrieben wurde.
»Wie lange soll denn dieses Spiel währen?« fragte Ellen den Direktor, als sie bereits eine halbe Stunde diesem Treiben zugesehen hatten. »Es ist ja ganz interessant zu beobachten, wie klug die gezähmten Elefanten sich dabei benehmen, aber es kann schließlich auch langweilig werden.«
»Mir wäre es lieber,« meinte Miß Murray, »wenn die gezähmten Tiere selbst die Holzwände einbrächen und dann mit ihren Kameraden auf Nimmerwiedersehen verschwänden, das wäre wenigstens natürlich.«
»Und vorher rissen sie aus Wut über uns Menschen unser schwankendes Holzgestell um,« lachte Charles, »das wäre auch natürlich.«
»Der indische Fürst ist auch kein Freund vom Warten,« sagte der Direktor, »aber ehe sich die Tiere nicht vollkommen beruhigt haben, kann der Gal-Oya nichts mit ihnen anfangen. Er wird schon irgendetwas in Bereitschaft haben, um seine Gäste einstweilen zu unterhalten, vielleicht Bajaderen.«
»Werden alle diese Elefanten gefangen? Dann müssen ja einige Tage vergehen.«
»O nein, nur die schönsten, höchstens zehn, und die kleineren dürfen dann wieder laufen. Der Fürst behält die Gefangenen für sich oder verschenkt sie. Sehen Sie dort, er will seinen Gästen zeigen, wie einer seiner Schwertfechter einen Panther nur mit Schwert und Schild bekämpft.«
Vor die hohe Tribüne des Fürsten war ein Wagen aus Bambusgeflecht gefahren worden, und um ihn herum hatte sich eine dreifache Reihe von Lanzenträgern aufgestellt; die innerste Reihe hielt ihre Lanzen gesenkt, die zweite schräg und die äußerste senkrecht, sodaß der Kreis von den Lanzenspitzen vollständig umringt war.
In ihre Mitte trat jetzt ein nur mit einem Schurz bekleideter Indier, in der einen Hand einen runden Schild, in der anderen ein kleines, krummes Schwert. Er schritt gerade auf den Wagen zu, ließ sich vor demselben auf die Kniee nieder und hielt den Schild über seinen Kopf, während ein anderer Eingeborener hinter den Wagen trat und mittels einer Leine die Thür desselben emporzog. Dann begab er sich schnell hinter die Reihen der Lanzenträger zurück.
Aus dem Wagen aber sprang mit einem Satze ein gefleckter Panther im Bogen auf den Indier zu, doch dieser fing ihn mit dem Schilde auf, hob ihn hoch empor, bog den Kopf zurück und beobachtete die weiteren Bewegungen des Raubtieres.
Einen malerischen Anblick bot die sehnige und graziöse Gestalt des nackten Hindus, dessen Armmuskeln von der emporgehaltenen Last anschwollen, wie er den anderen Arm mit dem Schwert nach hinten zurückbog, dem etwa auf ihm herabspringenden Panther mit der Spitze der Waffe zu begegnen. Der Schild war breit genug, um zu verhindern, daß der Panther mit der Tatze den haltenden Arm erreichen konnte, aber doch stockte den Zuschauern der Atem.

Fauchend sprang das Tier über den Kopf des Hindus hinweg nach den Lanzenträgern, wurde aber mit einigen Stichen empfangen, die es wieder zurücktrieben. Es sprang abermals auf den Schwertträger los, aber wieder kam es auf den Schild zu sitzen; das Tier geriet in Wut. Es sprang bald gegen die Lanzenträger, bald gegen den einzelnen Mann, aber stets begegnete ihm der Schild, und wieder schwebte er über dem Haupte des Schwertkämpfers.
Schließlich wurde der Panther von einem neuen Abschlag seines Angriffes so bestürzt, daß er mit eingezogenem Schweif in den Wagen kroch und nicht wieder herauskommen wollte, obgleich der Hindu dicht vor die Thür trat und ihn mit seinem blitzenden Schwert blendete.
Jetzt rief der Fürst einige Worte.
Ein Lanzenträger trat hinter den Wagen und stach wiederholt durch die Zwischenräume der Stäbe, bis der Panther endlich mit voller Wut auf den Schwertfechter sprang, der aber jetzt, um im letzten Gang noch seine ganze Geschicklichkeit zu zeigen, dem Wagen den Rücken zuwandte und lässig dastand.
Er mußte jedoch gehört haben, wie das Raubtier durch die Luft sauste, denn im letzten Augenblicke drehte er sich um, und wieder saß das Tier auf dem Schild, aber sofort wurde es wie eine Feder in die Höhe geschleudert. Man sah noch, wie es in der Luft eine schlangengleiche Bewegung mit dem langgestreckten Körper machte, dann fuhr ein leuchtender Blitzstrahl herab, der von dem in der Sonne funkelnden Schwert herrührte, und auf der Erde lag der Panther, den Kopf in zwei Teile gespalten.
Ein brausendes Beifallsrufen, begleitet von einen Goldregen, belohnte von der Tribüne herab den gewandten Fechter, der sich tief verneigte und den Kreis verließ, das Einsammeln des Geldes einem Diener überlassend.
Auch unsere Gesellschaft war von der Geschicklichkeit des Hindus entzückt, der alles mit einer Grazie und Ruhe ausgeführt hatte, als spiele er mit einer kleinen Katze und befände sich nicht einem der furchtbarsten Raubtiere seines Heimatlandes gegenüber. Selbst Ellen konnte nicht unterlassen, ihre Bewunderung in Worten anszudrücken.
»So einen Kampf lasse ich mir gefallen, da steht der Mensch dem Tier, das er erlegen will, mit Gefahr, seines eigenen Lebens gegenüber. Eine Jagd mit Büchse und zu Pferd ist dagegen ein Unrecht zu nennen.«
Die Aufmerksamkeit aller wandte sich jetzt wieder den Elefanten zu, welche sich beruhigt hatten, ergeben zusammengedrängt auf einem Platz standen und nur die Rüssel unaufhörlich bewegten.
Ein kleiner Singhalese mit eisgrauem Haar und Bart, um den Leib nur einige Stricke, näherte sich der Tribüne des Fürsten, machte eine tiefe Verbeugung und schritt dann dem Eingange des Kraals zu. Er hob nur etwas den Kopf, da löste sich einer aus der Reihe der dressierten Elefanten, ein mächtiges Tier mit kolossalen Stoßzähnen, der Gal-Oya kroch unter dessen Bauch, stellte sich mit den Zehen auf eines der Vorderbeine und ließ sich auf diese Weise nach den zusammenstehenden Elefanten tragen, welche den Menschen gar nicht bemerkten, sondern stumpfsinnig den herankommenden Kameraden betrachteten.
Diesem folgten noch einige andere, welche sich sofort unter die Herde mischten, und, ob sie sich die Tiere selbst aussuchten, oder ob ihnen die Betreffenden vorher von ihrem Meister bezeichnet worden waren, jedenfalls trieben sie das stärkste Exemplar durch Schieben des Körpers und Stoßen der Zähne aus der Menge heraus, bis er von dem Elefanten des Gal-Oya erreicht werden konnte.
Der riesige Dickhäuter schmiegte sich dicht an das noch wilde Tier, welches von den anderen gezähmten Elefanten umstanden wurde, und im Nu hatte der Bändiger um ein Bein desselben eine Schlinge gelegt; der Elefant wurde mißtrauisch, er stieß einen trompetenähnlichen Ton aus und versuchte vorwärtszugehen, aber die ihn Umstehenden drängten sich so fest an ihn heran, daß er es dulden mußte, daß der Gal-Oya auch um den anderen Fuß eine Schlinge legte.
Dann klammerte er sich wieder an seinen Elefanten an, und dieser trug ihn zu einem anderen Tier, welches bereits herausgetrieben worden war und bei dem sich dasselbe Manöver wiederholte.
Der erste Gefangene wollte unterdes eine Bewegung machen, strauchelte aber und stürzte mit einem dumpfen Gebrüll zu Boden, wodurch die anderen Elefanten wieder scheu gemacht wurden und hin- und herzulaufen begannen. Aber die gezähmten Elefanten waren jetzt einmal an der Arbeit, sie hielten das Tier, welches ihnen durch einen leisen Wink bezeichnet wurde, fest, und der Gal-Oya legte ihm die Schlingen an, es mochte stampfen und sich sträuben wie es wollte; ohne sich beim Schürzen der Knoten stören zu lassen, wand sich der kleine Mann wie ein Aal zwischen den Beinen des Ungeheuers.
Schon war der dritte auf diese Weise gefesselt, zwei lagen schon am Boden, als plötzlich ein lautes Geschrei der Eingeborenen erschallte.
»Ein Dambool, ein Dambool,« gellte es von den Lippen derselben, und in wilder Flucht stürzte alles davon.
Unsere Gesellschaft wußte noch nicht, was der Grund zu diesem Schrecken sei, als es schon hinter ihnen im Unterholz des Waldes krachte und in Carriere, den Rüssel weit vorgestreckt, ein Elefant hervorgerannt kam, gerade auf das Gerüst unserer Freunde zu.
Aber mitten im Laufe änderte er nochmals seine Richtung. Die Leute auf der Tribüne des Fürsten hatten durch ihr Geschrei seine Aufmerksamkeit erregt, und toll vor Wut rannte er gegen dieselbe an; im nächsten Augenblick war er von am Boden zappelnden Menschen umgeben, raste weiter gegen die Holzwand, riß diese nieder und stürmte fort, gefolgt von allen Elefanten, außer den gezähmten und einem gefesselten – den anderen beiden war es auch gelungen, sich von den Fesseln zu befreien.
Es war noch niemandem zum Bewußtsein gekommen, was eigentlich passiert sei, da verschwanden die letzten schon hinter den Bäumen des Waldes. Ein ›Einsiedler‹ hatte sich hierher verirrt, war durch den Anblick der vielen Menschen und Elefanten erst stutzig, dann zornig geworden, war darauf losgestürmt, hatte schließlich alles im Wege Stehende mit blinder Wut niedergerissen, und hatte endlich, gefolgt von seinen Kameraden, welche durch das tapfere Benehmen des mürrischen Gesellen wieder neuen Unternehmungsgeist bekommen und die sie bewachenden Elefanten einfach mit Wucht zur Seite geschleudert hatten, das Weite gesucht.
Aengstlich befühlten die von ihrer Höhe herabgestürzten Gäste des Fürsten und dieser selbst die Glieder, ob nichts verletzt sei, riefen die Diener und traktierten diese feigen Geister, welche schon beim Anblick des alten Burschen davongelaufen waren und sich jetzt nach und nach mit demütiger Miene wieder einfanden, mit Fußtritten; aber alles dies konnte die geflohenen Elefanten nicht wieder herbringen, ja, der Fürst war in solcher Wut, daß er auch dem einzigen zurückgebliebenen die Fesseln lösen und ihn mit Lanzenstichen davonjagen ließ.
Auf dem Holzgerüst herrschte dagegen die ausgelassenste Fröhlichkeit. Der alte Einsiedler, der sich, wenn auch unbeabsichtigt, mit solchem Heroismus seiner gefangenen Kameraden angenommen und sie befreit hatte, wurde als ein Held gepriesen und mit Lobpreisungen überhäuft. Besonders Ellen konnte sich nicht enthalten, ihn mehrere Male mit Lord Hastings zu vergleichen, als er damals im Flußbett zuerst seine Fesseln sprengte, und der Lord war über diesen Vergleich durchaus nicht erzürnt.
»Dort war es, wo wir den Alligator erlegten, der die Ueberreste des unglücklichen Tauchers im Magen hatte,« sagte der Direktor, als die beiden Dampfer am Morgen des folgenden Tages sich wieder jener Stelle im Flusse näherte.
Er deutete dabei in die Ferne, wo vor den Blicken der Reisenden die gelbe Sandbank aus dem Wasser auftauchte.
»Es ist doch merkwürdig,« sagte einer der Herren, »daß gestern so viele der Ungetüme darauf lagen und jetzt nicht ein einziges zu sehen ist, obgleich die Sonne heiß genug brennt.«
»Sie werden auf der Jagd nach ihrem Frühstück sein,« meinte der Direktor, »oder sind sonst durch etwas in ihrer Ruhe gestört worden.«
Eben fuhr der erste Dampfer an der Sandbank vorbei, als sich an der linken Seite des buschigen Uferrandes die Zweige auseinander bogen, ein Boot mit einem einzelnen Ruderer zum Vorschein kam und von diesem pfeilschnell nach dem vorderen Dampfer dirigiert wurde.
»Matale!« riefen alle wie aus einem Munde.
Es war in der That der Taucher, der hier auf die Fahrzeuge gewartet zu haben schien.
Er lenkte das Boot an den Dampfer, auf dem der Direktor stand, schwang sich an Bord und blieb ruhig stehen, eine Anrede erwartend.
Der Direktor gab sofort das Zeichen zum Halten, denn er ahnte, daß der Taucher nicht zufällig gerade hier an Bord kam, wo sein Freund getötet worden war, sondern daß er auf dessen Spur gewesen war und irgend ein Rätsel gelöst hatte.
»Matale,« redete er ihn ernst an, »wie kannst du es wagen, der du dich deiner Gefangenschaft durch die Flucht entzogen hast, hier ohne weiteres vor uns zu treten? Wir müssen dich nun natürlich nach Pantura zurückbringen.«
Der Taucher lächelte flüchtig.
»Das will er auch,« entgegnete er, »aber er weiß jetzt genau, warum Passera verschwunden ist und niemals wiederkommen wird.«
»Nun? Wir wissen auch, daß er verunglückt ist.«
Der Taucher schüttelte den Kopf mit den funkelnden Augen.
»Passera ist ermordet worden,«
»Mensch, was sprichst du?« sagte der Direktor leise. »Passera ermordet? Sieh dich mit einer solchen Behauptung vor! Wir selbst haben seine Ueberreste in dem Magen eines Alligators gefunden.«
»Passera war ein geschickter Taucher und hätte sich von keinem Alligator fangen lassen,« war die bestimmte Antwort. »Er ist den Alligatoren vorgeworfen worden, damit er nicht schwatzen konnte.«
Alle horchten atemlos.
»Und wen hast du im Verdacht, daß er eine solche scheußliche That vollbracht habe?« fragte der Portugiese weiter.
»Ich habe niemanden im Verdacht, sondern kenne den Mörder jetzt so genau, als hätte ich selbst der That zugesehen.«
Er griff in seinen Schurz, holte eine kleine, silberne Streichholzbüchse hervor und hielt sie dem Direktor hin.
»Wem gehört diese?« fragte er triumphierend.
»A. E.« las dieser auf dem Deckel eingraviert.
»Alfonso Esplanza, es ist sein Monogramm,« rief er dann, »aber das beweist noch nichts! Wo hast du das Büchschen gefunden?«
Der Taucher deutete nach der Stelle, wo er den Wald verlassen hatte.
»Kommt mit mir und überzeugt Euch selbst, daß Passera hinterrücks überwältigt worden ist und dann dem Alligator zum Fraß diente!«
Der Direktor, die Beamten und einige seiner Gäste begaben sich mit dem Taucher an Land. Das Ufer war gerade hier nicht sumpfig, sondern festes Land.
Matale führte seine Begleiter unter einen Baum, unter welchem man alle Anzeichen dafür fand, daß hier ein heftiger Kampf stattgefunden haben müsse. Der Boden war ringsum zerstampft, ein tiefer Eindruck kennzeichnete die Stelle, wo ein Körper gelegen hatte, der aus einer Wunde blutete, denn das Gras war dunkelbraun gefärbt. Außerdem lagen Stricke umher, als wäre der Verwundete auch noch gebunden gewesen.

»Der Kapitän,« erklärte Matale, »ist mit Passera auf die Alligatorenjagd gefahren, um sich eine Satteldecke für sein Pferd zu beschaffen. Ich weiß dies bestimmt, denn mein Freund hatte es mir vorher erzählt, aber auch gesagt, Esplanza wollte es die anderen nicht wissen lassen, um keine Begleiter mitnehmen zu müssen. Passera sagte es mir nur, weil wir überhanpt keine Geheimnisse voreinander hatten. Hier,« er wies auf den Uferrand, »sind beide aus dem Boot gestiegen, um vom Ufer aus nach Alligatoren zu schießen, und als Passera neben dem Kapitän lag, hat dieser ihm entweder das Messer in den Rücken gestoßen oder ihn von hinten erschossen. Die umherliegenden Stricke zeigen aber auch, daß er ihn außerdem noch gebunden haben mag, warum, weiß ich nicht, vielleicht scheute er sich, ihn gleich zu töten, und schleppte ihn dann weiter von hier fort.«
Matale führte seine Begleiter etwas tiefer in den Wald.
»Hier,« fuhr er fort, »hat er den Bewußtlosen an diese Baumwurzel gebunden und ihn seinem Schicksal überlassen. Entweder war Passera schon tot, oder er ist erst später gestorben, und als sein Leichnam zu verwesen begann, haben die Alligatoren die Beute gewittert, sind ans Land gekommen und haben den Körper von der Wurzel abgerissen.«
Der Direktor schaute überlegend vor sich hin.
»Warum soll er den Körper nicht gleich in den Fluß geworfen haben?«
»Er fürchtete sich vor den Alligatoren. Um ihn ins Wasser zu stoßen, mußte er dicht an den Rand gehen, und davor hatte er Angst.«
»Das ist keine genügende Erklärung. Wenn sich alles wirklich so verhält, wie du sagst, so glaube ich eher, daß diese Bestie in Menschengestalt an einem solchen Akt Wohlgefallen gehabt hätte,« erklärte Harrlington.
»Und die Streichholzschachtel?«
»Die lag dort auf dem Kampfplatz. Der Kapitän hat sie bei dem Ringen verloren und es nicht bemerkt. Aber wenn ich sie auch nicht gefunden hätte, so würde ich jetzt doch Esplanza nicht nur als Mörder Passeras bezeichnen können, sondern auch als denjenigen, der die Perlen gestohlen hat.«
»Woraus willst du das schließen?«
»Esplanza ist es gewesen, welcher auf mich den Verdacht gelenkt hat, und er hat mir auch einen Teil der Perlen unter das Bett gesteckt, jedenfalls erst bei der Untersuchung, um so gleich einen Beweis in der Hand zu haben.«
»Wie aber kommt es, daß du erst jetzt diese Behauptungen aufstellst, du hättest sie doch schon früher zu deiner Verteidigung machen können?«
Finster blickte der Taucher den Direktor an.
»Weil ich erst vor zwei Tagen erfahren habe,« antwortete er, »daß Esplanza meinem Weibe nachstellte.«
»Ach so,« sagte der Direktor, und die übrigen Beamten sahen sich verständnisvoll an.
»Von wem hast du dies erfahren? Von deinem eigenen Weibe?«
Der Taucher wendete langsam den Kopf, bis seine Augen denen Ellens begegneten. Als diese nickte, sagte er:
»Nein, ich habe Monika noch nicht gesprochen, seit ich der Gefangenschaft entflohen bin, aber jene Dame dort hat es mir erzählt.«
»Jene Dame?« riefen alle verwundert, und die Köpfe drehten sich nach Ellen um, welche den auf sie gerichteten Blicken ruhig begegnete.
»So war sie es wohl auch, die dich befreite?« war einer der Beamten so indiskret, zu fragen.
Aber der Direktor ließ Matale diese Frage nicht beantworten.
»Wir wollen uns wieder auf die Dampfer begeben und so schnell wie möglich nach Pantura fahren, um dort den Kapitän festzunehmen,« sagte er und fuhr dann zu seinen Beamten gewendet fort: »Diese Mitteilungen überraschen mich nicht sehr, vielleicht auch Sie nicht.«
Als die Dampfer wieder in Fahrt waren, trat Miß Murray zu Ellen.
»Wir hatten ja immer die Vermutung, daß Sie doch die Befreiung des Matale bewerkstelligt haben,« begann sie, »aber wie in aller Welt haben Sie das angefangen? Wir alle haben keine Ahnung davon.«
»Nun kann ich es Ihnen sagen,« lächelte Ellen, »da es der Taucher selbst fast gestanden hat. Ich hatte dem Direktor eine Summe geboten, wenn Matale freigelassen würde, aber der Mann war so ehrlich, daß er nicht auf meinen Vorschlag einging. Nun sprach ich mit Miß Lind, weil sie gewöhnlich den besten Rat weiß, und fragte sie, ob ich nicht die Wächter des Gefangenen bestechen sollte. Johanna aber meinte, ich sollte dies nicht thun, sie wüßte einen anderen Plan, und wirklich, noch in derselben Nacht entfloh Matale mit Hilfe einer Strickleiter. Wie er aber zu dieser gekommen, weiß ich nicht, Johanna wollte es mir bis jetzt nicht sagen. Da das Geheimnis nun verraten ist, wird sie wohl auch nicht länger schweigen.«
Johanna trat eben zu den beiden.
»Wollen Sie mir immer noch nicht verraten, wie Sie die Strickleiter in Matales Zelle geschmuggelt haben?« fragte Ellen.
»Doch, jetzt sollen Sie es erfahren. In einem Brot.«
»In einem Brot?« riefen beide Mädchen erstaunt. »So haben Sie also doch den Wächter bestochen!«
»Nein, er hatte keine Ahnung. Wir haben selbst das Brot gebacken.«
»Wer, wir?«
»Georg und ich; oder vielmehr, ich habe es gemacht, und Georg hat es mit dem Brote des Gefangenen vertauscht, welches derselbe jeden Abend empfing.«
»Ist denn dieser Matrose Georg ein so pfiffiger Bursche?«
»Manchmal,« lachte Johanna. »Mich wundert es aber, daß Matale es Ihnen nicht erzählt hat, da Sie ihn doch nachher gesprochen haben.«
»Er war stumm wie ein Grab, als er erfuhr, daß ich mir seine Befreiung auch nicht erklären könne. – Hören Sie, sind das nicht Schüsse?«
Man hörte in einiger Entfernung Gewehre knallen.
»Es wird eine Jagdgesellschaft sein, die von einem Städtchen der Küste aus in diese Gegend gekommen ist, um Wasservögel zu erlegen,« meinte einer der Beamten.
Die Fahrzeuge waren schon wieder weitergefahren, als es in dem Buschwerk zur Rechten krachte, man sah einige rote Röcke sich durch die Zweige drängen und am Ufer erschienen bewaffnete, englische Soldaten.
Einer derselben, wahrscheinlich ein Unteroffizier, hob den Arm nach dem Dampfer zu, zum Zeichen, daß er sprechen wolle und rief:
»Haben Sie niemanden gesehen und nichts Auffälliges bemerkt? Warum?«
Die Soldaten drehten sofort wieder um und verschwanden in dem Walde, ohne der Frage Beachtung zu schenken.
»Wahrscheinlich sind Sträflinge entsprungen und die Soldaten sind hinter ihnen her,« erklärte der Portugiese, »das ist auch ein undankbares Amt. Die Leute müssen Tag und Nacht in den Wäldern liegen, über Flüsse und Ströme setzen, und wenn der Flüchtling vor ihren Augen durch das Wasser schwimmt, so müssen sie ihm nach und wenn es auch darin von Alligatoren wimmelt.«
Jetzt knallte wieder ein Schuß im Walde.
Eine halbe Stunde weit hatte sich der Dampfer von dieser Stelle entfernt, als plötzlich Matale scharf nach dem Ufer spähte. Dann sprang er mit einem Male in sein kleines Boot, welches nachgeschleppt wurde, ruderte an Land, und man sah, wie er sich mit etwas auf dem Boden beschäftigte.
Er drehte sich um und winkte, daß der Dampfer halten sollte.
Als er mit dem Boote zurückkehrte, lag darin ein in zerfetzte Kleider gehüllter Mann, der aus einer schrecklichen Kopfwunde blutete.
Die Matrosen warfen ein Tau hinab. Matale machte unter den Armen des Verwundeten eine Schlinge und ließ ihn so an Deck ziehen.
Eine Ahnung sagte allen, daß man hier den Mann vor sich hatte, der von den Soldaten verfolgt und von einer Kugel getroffen worden war. Trotzdem er jedenfalls ein Verbrecher war, fühlte man doch Mitleid mit ihm, und viele Hände streckten sich aus, um den Verwundeten, der sich noch bis zum Fluß geschleppt hatte und dann bewußtlos liegen geblieben war, möglichst sanft über die Bordwand zu heben und an Deck zu legen.

Kaum hatte der Direktor einen Blick in das Gesicht des Bewußtlosen geworfen, so fuhr er erschrocken zurück.
»Selby,« schrie er auf, »ist es denn möglich, so müssen wir uns also wieder treffen.«
Der Ohnmächtige schlug bei Nennung des Namens die Augen auf und erkannte den Portugiesen.
»Farvas,« stöhnte er abgerissen, »ich sterbe unschuldig – es ist zu spät – du wirst es bezeugen –« Der Direktor beugte sich dicht zu dem Verwundeten herab, denn schon konnte er kaum noch dessen Worte vernehmen.
»So sprich,« drängte er, als der Sterbende vor Erschöpfung nicht weiter konnte, »ich habe dich auch nie für schuldig gehalten, obgleich aller Verdacht damals auf dich fiel. Wir aber konnten den nicht finden, den du als den Dieb angabst.«
»Ich habe – ihn – vorhin gesehen,« stammelte der Sterbende, »er selbst – hat mich – geschossen – als ich gestern in Pantura war.«
»In Pantura? Wie heißt er?«
»Er nannte sich – damals – Carlos –«
»Carlos Cassero, ich weiß es,« drängte der Direktor. »Wie sieht er aus?«
»Klein – dick – bartlos – ein anderer Mann nannte ihn – Henrico.«
»Henrico,« riefen die Beamten gleichzeitig.
»Eilt nach – Pantura,« flüsterte der Sterbende weiter, dessen Leben entfloh, »ich habe – sie belauscht – und sie wollten – mich ermorden –«
Der Direktor beugte den Kopf hinab, bis sein Ohr den Mund des Sterbenden berührte, aber er vernahm keinen Laut mehr – vor ihm lag eine Leiche.
»Zu spät,« sagte er, »er hat uns nicht alles gestehen können, was er wußte. Seine letzten Worte waren: ›Eilt nach Pantura, Pantura ist‹ – und dies wollen wir auch thun, denn eine Ahnung steigt in mir auf, die sich nur zu leicht erfüllen wird oder sich schon erfüllt haben kann.«
Auf den beiden Dampfern, die mit möglichster Schnelligkeit den Fluß hinabfuhren, herrschte eine gedrückte Stimmung. Erst der Fund von Passeras Ueberresten, dann die Enthüllungen Matales, welcher den Kapitän als Mörder und Dieb bezeichnete, dann auch noch der Tod dieses Sträflings, der im Sterben seine Unschuld beteuerte und das ihm zugeschriebene Verbrechen einem anderen zuzuschieben suchte und zwar jemandem, den sie kannten, und der in Gemeinschaft mit dem Kapitän fast allein in Pantura war, dies alles erklärte den Wunsch, so schnell wie möglich nach Pantura zu kommen. Unterwegs aber mußte der Direktor erzählen, woher er diesen Sträfling, dessen Leiche die Matrosen mit Leinwand bedeckt hatten, kannten.
»Selby war ebenso wie ich Direktor einer portugiesischen Gesellschaft, die an der Südküste Ceylons Perlenfischerei betrieb. Eines Tages sollten die angesammelten Perlen abgeholt werden, Selby öffnete mit der ruhigsten Miene den eisernen Schrank, die Schubfächer – und die Beamten sahen nur die leeren Kästen – nichts war mehr darin. Selbverständlich fiel kein Verdacht auf Selby, der selbst tödlich erschrocken war, aber die Aktionäre bestanden dennoch darauf, daß alle Beamten in Untersuchungshaft genommen würden, also auch er.
»Selby selbst erklärte, daß er keinen seiner Leute eines Diebstahls fähig hielte, dagegen wende sich sein Argwohn gegen einen gewissen Carlos Cassero, der sich öfters bemüht habe, mit ihm privatim Perlengeschäfte abzuschließen, ihn auch im Geschäftshaus aufgesucht und sich immer über die örtlichen Verhältnisse zu orientieren bemüht habe. Dieser Cassero aber war plötzlich verschwunden.
»Nach einem Monat etwa sollte Selby freigelassen werden, als die Polizei in einer Stadt Ceylons einen Kerl abfing, der im Besitz einer Anzahl echter Perlen war. Auf die Frage, woher er die Schätze habe, erzählte er erst die unglaublichsten Sachen, wurde aber dann, als er in die Enge getrieben, geständig und beschwor, daß Selby ihm und einer ganzen Bande von Gaunern eine Unmenge von Perlen gegen ein Billiges verkauft habe. Der Bursche wurde unter Bedeckung nach Colombo geführt, aber weder er, noch die Soldaten erreichten die Stadt. Man nimmt an, daß sie von Eingeborenen, welche damals gerade aufrührerisch gesinnt waren, ermordet worden sind.
»Aber das Geständnis dieses Menschen brach dem Direktor Selby den Hals. Man wußte nicht, warum der Gauner eine falsche Aussage hätte machen sollen, warum er gerade Selby, der ihn gar nicht kannte, hätte beschuldigen sollen; kurz und gut, der Direktor kam nicht mehr frei, umsoweniger, als man nun nochmals seine Effekten visitierte und in einem Shlips einige Perlen vorfand, über deren Erwerb er sich nicht ausweisen konnte, von deren Vorhandensein er auch überhaupt nichts wissen wollte.
»Wir alle, die wir Selby näher kannten, hielten ihn für das Opfer eines Verbrecherstreichs, aber unsere gute Meinung von ihm konnte ihn nicht frei machen. Vor einigen Tagen las ich in der Zeitung, daß er aus dem Gefängnisse zu Colombo entwichen sei, und wünschte ihm aus vollem Herzen, daß es ihm glücken möge, zu entkommen und irgendwo ein neues Leben anzufangen.
»Dort liegt er nun,« schloß der Direktor, »und hat noch im Sterben seine Unschuld beteuert.«
»Und Henrico?« fragte einer seiner Beamten, »glauben Sie, daß etwas Wahres an der Behauptung des Sterbenden war?«
Der Direktor zuckte nervös mit den Achseln.
»Ich kann es noch nicht wissen, in zwei Stunden werden wir mehr davon erfahren, wenn überhaupt dann noch Zeit dazu ist. Kapitän,« rief er nach der Luke, »fahren Sie mit Volldampf, wenn es möglich ist.«
Ungeduldig schritt er an Deck auf und ab. Man sah ihm an, daß er sich mit ernsten Gedanken beschäftigte und äußerst erregt war.
Nach zwei Stunden näherte sich der erste Dampfer der Mündung des Flusses und fuhr in die Bucht.
»Mein Gott, was ist denn das?« rief einer der Beamten entsetzt aus.
Der Direktor stand wie erstarrt über den Anblick, der sich ihm bot. Er sah nichts als rauchende Trümmerhaufen, und der Boden war überall mit Leichen bedeckt.

»Alles ermordet!« schrie der Direktor außer sich, als er sofort ans Land sprang und auf die Leichname der Beamten stieß, »und auch das Dorf ist niedergebrannt.«
Der deutsche Ingenieur stürzte nach dem Platz, wo sein Boot und die der anderen Gäste gelegen hatten sie waren fort, aber auf der Plattform lagen gegen zwanzig Matrosen, alle mit Schußwunden bedeckt, außer den französischen auch fünf seiner eigenen.
Während er noch entsetzt vor den Leichen stand und das Unglaubliche nicht fassen konnte, fühlte er sich am Arm berührt. Als er sich umdrehte, blickte er in die entgeisterten Augen Johannas.
»Hatten Sie nicht sechs Mann mit?« flüsterte sie, und dann schrie sie spötzlich laut auf:
»Wo ist Georg? Haben Sie ihn schon gefunden?«.
»Er wird der Metzelei entgangen sein,« antwortete er und atmete erleichtert auf, »wir wollen jetzt untersuchen, wohin sich die Verbrecher gewendet haben; wir werden noch genug versprengte Eingeborene finden, die uns über alles Auskunft geben können. Hier muß eine ganze Bande gehaust haben. Sehen Sie den Direktor, er hat die Trümmer des Geschäftshauses untersucht, nichts gefunden, und nun läßt er schon die Dampfer heizen, um nach Colombo zu fahren. Sie aber bleiben bei mir, ich gehe nicht eher von hier, als bis ich meines letzten Matrosen Leiche gefunden habe, und auch die anderen werden meinem Rate folgen. Wir wollen ihnen bald auf den Hacken sitzen.«
Nach diesen kurz hervorgestoßenen Sätzen eilte er zu den übrigen zurück und überredete sie, nicht nach Colombo zu fahren, wie der Direktor vorhatte, um die Regierung um Hilfe zu bitten, sondern vorläufig in der Bucht zu bleiben. Nur der Franzose kehrte zu seinem Schiffe zurück.
Es war Abend; die Taucher ruderten die Boote ans Land, schafften die letzte Ladung Muscheln nach den Stapelplätzen und gingen dann ins Dorf zu Weib und Kind, froh, daß der Friede der Nacht die gefährliche Arbeit des Tages abgelöst hatte.
Unter den Bäumen, welche vom Geschäftshaus nach dem Walde zu liefen, wandelten zwei Männer, in ein leises Gespräch vertieft.
»Ich sage Ihnen, Esplanza,« fuhr der eine in seiner Rede fort, »heute nacht noch muß es geschehen, denn möglicherweise kann die ganze Gesellschaft schon morgen früh wieder zurückkommen, und wir würden dann auf Hindernisse stoßen, die schwer zu überwinden wären. Also diese Nacht!«
»Aber warum warten Sie denn nicht, Henrico,« unterbrach ihn Kapitän Esplanza, »bis diese verwünschten Fremden fort sind? Sie treiben ja, als könnten Sie durchaus nicht erwarten, ein reicher Mann zu werden.«
Der andere lachte heiser.
»Das kann ich auch nicht. Setzen Sie sich hier auf die Bank,« er deutete auf ein roh gezimmertes Holzgestell, »ich habe noch etwas anderes mit Ihnen zu besprechen.«
»Sie sehen,« fuhr Henrico nach längerem Besinnen fort, nachdem beide nebeneinander Platz genommen, »ich will, daß wir ehrlich gegen einander sind. Das heißt, wir teilen das, was uns das Geschäft einbringt, brüderlich. Sie die Hälfte, ich die Hälfte! Nicht wahr?«
»Natürlich, so haben wir es ausgemacht, und dabei bleibt es. Das Amt, welches Sie mir dabei aufgetragen haben, ist freilich noch bedeutend schwieriger, als das Ihrige.«
»Hm,« brummte Henrico, »aber die Sache ist diese. Wenn Sie den Raub ausgeführt haben und nicht nach dem Strand kommen, wo ich mit dem Segelboot auf Sie warte, sondern sich einstweilen im Walde verstecken und später mit einer anderen Gelegenheit nach dem Kontinent gehen oder sonstwohin, was soll ich dann machen? Dann sitze ich mit langer Nase da und warte, bis mich der Direktor und dessen Sippschaft am Kragen packt!«
Der Kapitän lachte leise auf.
»Erst machen Sie mir den Vorwurf, daß ich mißtrauisch gegen Sie sei, und jetzt plagen Sie mich fortwährend mit Zweifeln. Gut, wenn Sie lieber den ersten Teil ausführen wollen, so werde ich im Boot auf Sie warten, mir soll dies auch recht sein.«
Dem jungen Manne schien aber dieser Vorschlag nicht zu gefallen, denn er schüttelte energisch den Kopf.
»Das geht nicht,« erwiderte er, »ich bin nicht kräftig genug, die eisernen Kisten emporzuheben, sie könnten mir entfallen und würden einen Höllenspektakel machen. Das meinte ich auch eigentlich nicht, aber sehen Sie, ich muß doch eine Sicherheit oder doch wenigstens eine Entschädigung haben, wenn Sie mich im Stich lassen.«
Der Kapitän sah den Sprecher nachdenklich an.
»Wohinaus wollen Sie mit ihren Worten?«
Henrico war in sichtlicher Verlegenheit, wie er diesen besonderen Punkt erörtern sollte.
»Nun,« sagte er endlich, »wir haben also ausgemacht, alles brüderlich zu teilen. Sie haben aber bereits von den Perlen eine ansehnliche Zahl beiseite gebracht. Wieviel würden Sie aus deren Erlös wohl herausschlagen?«
Jetzt hatte Esplanza verstanden, was sein Gefährte bezweckte. Wie dieser aber keine Heimlichkeit hatte, so mußte auch er ihm gegenüber offen sein.
»Mindestens 1000 Pfund.«
»Ohne die, welche bei Matale gefunden worden sind? Denn diese kleinen Dingerchen waren höchstens 20 Pfund wert.«
»Ohne diese.«
»Gut! Um die Hälfte dieses Betrags würden Sie mich also schon geschädigt haben,« lachte Henrico, »denn sie fehlt bei den anderen Perlen.«
»Ach so! Sie meinen, ich soll Ihnen die Hälfte davon abgeben? Sie haben in der That recht, ich bin gern dazu bereit, so bald wir mit unserem Raub in Sicherheit sind.«
»Das geht nicht,« rief Henrico erregt und sprang auf, »Sie geben mir jetzt die Hälfte und behalten die andere, sonst habe ich schließlich doch das Nachsehen. Ehrlich wäre es sogar, wenn Sie mir alle gäben, denn dann wäre ich auch mehr beruhigt, wenn ich Sie dort im Geschäftshaus mit einem Schatz hantieren weiß, der hundertmal mehr Wert besitzt als das, was ich von Ihnen fordere.«
»Ich bin damit einverstanden, Ihnen die Hälfte zu geben,« schlug Esplanza vor, »aber etwas muß ich haben, für den Fall, daß ich ertappt werde und fliehen muß. Sie haben mir zwar sehr genau beschrieben, wo ich den Schatz im Kellergewölbe finden werde, und wie ich die Platte abheben kann, aber wer weiß, ob mir das nicht unmöglich wird. Wie gesagt, es wäre besser, wenn sie selbst ins Haus gingen und den Raub ausführten und mich dafür im Boote auf Sie warten ließen; ich passe überhaupt besser als Sie in dieses.«
»Aber ich erkläre Ihnen, meine Kraft reicht nicht, die Platte emporzuheben. Sie sind bedeutend stärker als ich.«
»Seit wann werden überhaupt die Perlen nicht mehr oben in den Kassenschränken aufbewahrt?«
»Seit dem letzten Diebstahl. Kein Beamter weiß darum, nur ich habe ausspioniert, daß der Direktor Varvas mit einem seiner Diener, auf dessen Ehrlichkeit er schwört, diesen Platz im Keller eingerichtet hat, in den sehr leicht einzudringen ist, ohne daß es irgend eine Menschenseele merkt.«
Henrico schwieg eine Weile, dann fuhr er fort:
»Aber ich will sogar Ihre letzten Bedenken zerstreuen. Ich will mit Ihnen gehen und Ihnen den Ort genau zeigen, ja, sogar bei Ihnen bleiben, bis Sie den Schatz in Händen haben. Dafür aber mache ich mir zur Bedingung, daß Sie Ihre Perlen mit mir teilen, ehe wir ans Unternehmen gehen, damit ich, sollten wir doch dabei überrascht und vertrieben werden, Mittel zur weiteren Flucht habe. Einverstanden?«
»Einverstanden!« rief der Kapitän und schlug in die dargebotene Hand. »Nun habe ich kein Mißtrauen mehr gegen Sie.«
»Und wann geben Sie mir die Perlen?«
»In meinem Hause habe ich sie natürlich nicht,« lachte der Kapitän leise, »unsereins steckt solche Schätze nicht unter das Bett. Ich muß sie erst bei Nacht ausgraben. Wann wollen Sie die Arbeit beginnen? Sie können sie dann jederzeit erhalten.«
»Hören Sie mich an, Esplanza! Ich komme heute nacht Punkt zwölf Uhr in Ihr Haus, und Sie halten sich um diese Zeit bereit, sofort mit mir nach dem Geschäftshaus zu schleichen. Bevor wir aus Ihrem Zimmer gehen, geben Sie mir meinen Anteil, und die Sache ist abgemacht. Bis dahin werde ich mein Boot bereitmachen, um scheinbar eine kleine Segelfahrt zu unternehmen, es dann aber in eine Bucht bringen, wo es im Schilf völlig versteckt liegt. Haben wir nur einigermaßen guten Wind, so können wir morgen mittag auf dem Festlande sein, wo ich wie zu Hause bin, und alle Gelegenheiten kenne, erst nach Australien und dann, wenn Sie mit mir gehen wollen, unentdeckt nach Amerika zu kommen.«
Der Kapitän erhob sich.
»Es bleibt also dabei, heute nacht um zwölf Uhr bei mir!«
Mit kurzem Gruß entfernte er sich.
Der junge Verbrecher blieb auf der Bank sitzen und sah dem Fortgehenden nach, bis dieser seinen Blicken entschwunden war.
»Ist das ein Narr,« murmelte er zwischen den Zähnen, »er beißt an jeden Köter. Ein Glück ist es, daß er diesen Perlendiebstahl begangen hatte, ehe wir damit beauftragt wurden. Unser Chef weiß ganz genau, wieviele Perlen hier aufgestapelt sind, und ebensoviel müssen wir abliefern, aber die schon geraubten giebt er natürlich verloren, während sie nun in meine Hand kommen.«
»Es ist das erste Mal,« fuhr er nach längerer Pause in seinem Selbstgespräch fort, »daß ich unsere Bande um einen Raub betrüge, aber diese Gelegenheit ist zu günstig. Der Chef rechnet nicht mehr auf die Perlen, Esplanza hat sie, giebt mir die Hälfte davon, die andere nehme ich mir, und tausend Pfund habe ich an diesem Geschäft Nebenverdienst gehabt.«
Er schlug sich vergnügt auf den Schenkel, stand auf und wollte gehen.
Da raschelte es neben ihm im Laube. Zusammenfahrend drehte er sich um und sah vor sich einen mit Lumpen bekleideten Menschen stehen, die Züge eingesunken, die Augen hohl. Er sah nur noch, daß die Kleider solche waren, wie sie die Sträflinge in Colombo trugen, dann fuhr er vor der Gestalt zurück, als hätte er ein Gespenst vor sich.
Aber auch der Mann hatte ihn erkannt. Wie ein Raubtier, das sich zum Sprunge vorbereitet, krümmte er sich, krallte die Finger zusammen, und sein Gegenüber mit kleinen Augen betrachtend, stieß er zischend über die Lippen:
»Carlos Cassero, habe ich dich endlich – –«
Er hatte nicht gemerkt, wie der elegante Herr blitzschnell einen Revolver aus der Rocktasche hervorholte, sein Auge hing nur an den verhaßten Zügen des Mannes, der ihn ins Unglück gestürzt hatte.
Der Revolver entlud sich und lautlos sank der entsprungene Sträfling in das dichte Buschwerk.

Da kamen eilende Schritte durch das Unterholz, der Portugiese sah rote Jacken sich zwischen den Bäumen bewegen, und rasch entschlossen sprang er ihnen entgegen.
Ein Gedanke war ihm durch das Gehirn geblitzt: Die Verfolger dürfen den Entsprungenen nur tot, nicht aber lebendig finden, sonst bin ich verloren, denn Selby hat mich erkannt.
»Haben Sie einen Mann in der Kleidung der Sträflinge von Colombo gesehen?« fragte ihn der Unteroffizier.
»Ja, jetzt eben, er versuchte einen Raubanfall auf mich, ich habe nach ihm geschossen und ihn gefehlt. Es deuchte mir, als hätte ich ihn dort hinter den Bäumen verschwinden sehen.«
Dabei deutete Henrico kaltblütig nach einem dichten Geflecht von Schlingpflanzen, welches wie ein Teppich zwischen zwei Bäumen niederhing. Dabei aber schielte er dahin, wo er Selby hatte fallen sehen, und zu seinem Schrecken bemerkte er das graue Sträflingskleid zwischen den Blättern.
Wehe ihm, wenn die Soldaten den Mann fanden, und zwar noch lebend, dann war er verloren!
»Wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn einholen,« sagte er wieder, um das Militär loszuwerden.
Einige Minuten verstrichen noch; der Unteroffizier ließ sich genau das Aussehen des Flüchtlings beschreiben, dann schritten die Häscher in der angegebenen Richtung davon.
Kaum hörte Henrico die knackenden Schritte verhallen, kaum waren die Gestalten hinter dem grünen Teppich verschwunden, so zog er mit krampfhaft zusammengepreßten Lippen wieder den Revolver aus der Tasche und ging zu dem Sträfling zurück.
Ein neuer Schreck – der Platz war leer.
»Carracho! Wenn er die Soldaten trifft!«
Er zog die Uhr.
»Ein halb vor neun, noch drei Stunden Zeit also. Mag es nun kommen, wie es will, meine Pflicht muß ich thun, sonst hänge ich morgen am höchsten Baume.«
Mit finster gerunzelten Brauen schritt er nach der Bucht, wo an der Plattform die Boote lagen. Er suchte sich das größte der Gesellschaft aus und brachte es in Ordnung, um mit Segeln fahren zu können.
Neben dem seinen lag das große schwarze Boot des ›Blitz‹ in dem der zurückgebliebene Georg mit seinen Kameraden saß und ein Segel flickte.
»Sie haben wohl Eidechsen geschossen, Mister Henrico?« sprach Georg durch die Zähne, zwischen denen er seine kurze Pfeife hielt.
Der Portugiese würdigte ihn keiner Antwort, heftig riß er an einem Tau, welches sich in einem Ringe festgehakt hatte.
»Nix englisch verstehe?« fragte der Bursche weiter, der mit spöttischen Blicken das Gebahren des Beamten in dem Segelboote beobachtete, dann fuhr er in fließendem Spanisch fort: »Sie dürfen nicht auf den Bindfaden treten, wie Sie thun, sonst kriegen Sie ihn nicht los.«
Der Portugiese hißte das Segel, setzte sich ans Steuer und warf dem Schiffer, einen wütenden Blick zu. Als sich das Boot vom Lande entfernte, rief ihm Georg noch nach:
»Kippen Sie nicht draußen um, Herr Henrico, in einer Stunde schlägt der Wind um, und wenn Sie dann nicht wenden können, so sind Sie übermorgen in Afrika.«
»Diese Nacht wird dir dein Spott vergehen, Bursche,« knirschte Henrico und lenkte sein Boot dem Ausgange der Bucht zu.
Es wehte ein schwacher Westwind, also zum Fortkommen vom Land sehr ungünstig, und wenn der Matrose recht hatte, und der Wind wirklich umsprang, so war es schwer, wieder in die Bucht einzufahren. Dennoch kreuzte Henrico die Küste auf und ab, bald nach Norden hinunter, bald nach Süden hinauf, konnte sich aber nicht weit entfernen.
Er schien auch etwas ganz anderes im Sinne zu haben, als zum Vergnügen eine Segelpartie zu machen, denn ab und zu suchte er mit einem kleinen Fernrohr den Horizont ab.
Die Dunkelheit brach an, und noch immer kreuzte der Portugiese vor der Bucht. Er hatte eine Laterne im Boot und hätte sie eigentlich hissen müssen, aber er unterließ es; seine ganze Aufmerksamkeit war auf einen Punkt des Horizontes gerichtet, an dem er vorhin durch das Fernrohr ein Segel bemerkt hatte.
Da stieg plötzlich dort, wohin er spähte, langsam eine Rakete in die Luft. Das Schiff mußte sich während der Dunkelheit sehr der Küste genähert haben, denn man konnte das aufsteigende Signal sehr deutlich wahrnehmen.
»Teufel, die benehmen sich sehr ungeniert. Aber es wird auch Zeit, daß ich mein Licht hisse.«
Er zündete das Licht an, band die Laterne an ein Tau, welches oben am Mast durch einen Ring lief, und zog sie hoch. Nur einige Sekunden ließ er sie oben, dann holte er sie wieder herunter, zog sie nochmals hoch und wieder herunter, und als er sie schließlich zum dritten Mal unten hatte, schlug er eine Scheibe der Laterne entzwei.
»So,« lachte er, »wenn jemand dies für ein Signal gehalten haben sollte, dann werde ich dem Bootswächter den Kopf heiß machen, warum er die Lampe nicht besser in stand hält, sodaß sie der Wind immer zu verlöschen droht.«
Er wartete noch eine Weile, bis wieder am Horizont eine Rakete aufstieg, dann fuhr er mit dem Westwind, der noch nicht umgesprungen war, direkt in die Bucht hinein.
Im Dorfe war alles still, nicht einmal ein Feuer war zwischen den Hütten zu erblicken, nur in einigen der Beamtenwohnungen brannte noch Licht.
Henrico band das Boot an seine Stelle und bemerkte dabei, daß der Matrose, der vorhin mit ihm gesprochen hatte, noch immer in dem schwarzen Boote saß und seine Pfeife rauchte.
»Hübsches Feuerwerk da draußen, nicht?« begann derselbe auch jetzt wieder die Unterhaltung. »Möchte wissen, wem die zwei Raketen galten!«
Der Portugiese antwortete nicht, sondern stieg aus dem Boote und schritt nach seiner Wohnung.
»Verflucht!« knirschte er. »Der Bursche hat Witterung bekommen. Aber es hilft ihm nichts, es ist zu spät für ihn und sie alle.«
Er schloß in seiner Arbeitsstube sorgsam alle Fensterflügel und begann aus einem Schreibsekretär Papiere zu nehmen und dieselben über der Lampe zu verbrennen.«
»Bis jetzt ist alles gut gegangen,« murmelte er während dieser Beschäftigung, »es ist schon zehn Uhr. Die Soldaten habe ich diese Nacht also nicht mehr zu erwarten. Und kämen sie wirklich, so brächte mir ein Schuß Hilfe. Es wird ein Blutbad geben, aber kann ich es ändern? Mit List ist den Perlen nicht beizukommen, die Beamten und Diener des Direktors wachen über sie wie bissige Hunde über Knochen. Dieser dumme Esplanza, hahaha!«
Er entleerte einen Kasten mit Geld in seine Taschen, untersuchte seinen Revolver, versah sich mit Patronen, löschte dann das Licht aus und schlüpfte wieder zur Hausthüre hinaus.
Alles war draußen still, nur noch in einem Hause brannte Licht – es war das des Kapitäns.
Unhörbar schlich er sich um dasselbe herum, am Waldessaume entlang, wo er dann seinen Schritt bis zum Laufen beschleunigte, bis er nach zehn Minuten direkt nach der Küste abbog.
Jetzt erreichte er das mit hohem Schilf bewachsene Meeresufer.
Vorsichtig bog er die Halme auseinander, schnell, aber doch lautlos bewegte er sich darin vorwärts, aber sein Nahen war dennoch bemerkt worden.
Plötzlich stand, wie aus der Erde gewachsen, eine Gestalt vor ihm und drückte dem Kommenden eine Pistole vor die Brust.
»Wer seid Ihr?« fragte eine rauhe Stimme.
»Ich bin es, seid Ihr bereit?« gab Henrico zurück.
»Gebt das Zeichen!«
»Seewolf.«
»Richtig, aber Ihr irrt, wenn Ihr glaubt, der Seewolf läge hier mit seiner Mannschaft.«
»Nicht der Seewolf mit dem ›Friedensengel‹? Wer denn?« fragte Henrico erstaunt.
»Der Seewolf hat einen anderen Auftrag bekommen, er kann aber auch nicht weit von hier kreuzen. Es ist Kapitän Broker, der vor Euch steht!«
»Ah, Kapitän Blutfinger wollt Ihr wohl sagen?«
»Meinetwegen auch,« lachte der Mann heiser, »Kapitän Blutfinger von der ›Evangeline‹, der Name paßt wie die Faust aufs Ange. Wann soll der Tanz losgehen?«
»Um zwölf Uhr, wenn in der Ansiedlung ein Schuß fällt und eine Feuerflamme hoch aufschlägt. Ihr werdet aber einen heißen Kampf bestehen müssen. Habt Ihr genug Leute mit?«
»Zwanzig Mann, alle gut bewaffnet. Warum?«
»Es sind etwa vierundzwanzig fremde Matrosen in der Bucht.«
»Teufel, wie kommt das?«
»Eine Gesellschaft von fünfzig Personen wollte sich die Perlenfischerei besehen, ist aber jetzt nach dem Inneren der Insel aufgebrochen, um zu jagen; vor morgen abend kommen diese Leute nicht zurück, aber die Matrosen haben sie zurückgelassen.«
»Aus wem besteht diese Gesellschaft?«
»Aus verrückten Engländern und noch verrückteren Amerikanerinnen.«
»Alle Wetter,« lachte der Kapitän, »hinter denen ist ja der Seewolf her; aber der arme Kerl wird von ihnen immer noch an der Nase herumgeführt.«
»Können Eure Leute den Kampf bestehen?«
»Pah,« sagte der Kapitän Broker oder Blutfinger, »einen gegen zehn. Haben die Burschen eine Ahnung?«
»Ich glaube nicht, nur einer hat vorhin das Signal bemerkt, aber er denkt sich nichts weiter dabei, sonst hätte er es mir nicht erzählt.«
»All right, es ist elf Uhr! Habt Ihr in einer Stunde alles vorbereitet?«
»Gewiß, ich gehe zurück, Kapitän! Paßt hauptsächlich auf den Schuß auf, die Flamme könnte auf sich warten lassen, und haltet Euch bis dahin der Ansiedelung nahe!«
Henrico machte denselben Weg zurück, den er gekommen war. Angesichts der Ansiedelung blieb er stehen, bis die Uhr füuf Minuten vor Zwölf zeigte, dann schritt er rasch auf das Haus des Kapitäns Esplanza zu und klopfte nur einmal schwach mit dem Finger an den verschlossenen Fensterladen, durch dessen Ritzen Licht schimmerte.
Sofort öffnete ihm der Kapitän und ließ ihn einschlüpfen. »Ich habe Sie sehnsüchtig erwartet,« flüsterte er, als er Henrico ins Zimmer geleitete.
»Bin ich nicht pünktlich gewesen?« antwortete dieser. »Es ist alles bereit, ich habe Sägen bei mir, um hinten am Haus die Gitterstäbe des Kellerfensters zu zerfeilen. In einer halben Stunde können wir reiche Leute sein.«
»Und das Boot? Ich sah Sie vorhin wegfahren, aber Sie kamen mit demselben Fahrzeuge zurück. Wie soll ich mir das deuten?«
Henrico lachte auf.
»Das muß ich doch thun, sonst schöpfte man Verdacht. Ich habe schon lange am Schilfufer ein Boot versteckt gehalten und jenes vorhin nur seebereit gemacht.«
Der Kapitän gab sich mit dieser Erklärung zufrieden.
»Und die Perlen?« fragte Henrico lauernd.
Esplanza holte aus der Brusttasche ein Säckchen und hielt es dem verbrecherischen Kameraden hin.
»Hier,« sagte er, »es ist genau die Hälfte, ich habe sie vorhin geteilt.«
»Das kann jeder sagen,« höhnte Henrico. »Sie haben wohl die Anzahl abgezählt und mir die kleinsten zugeteilt?«
»Ueberzeugen Sie sich selbst,« sagte der Kapitän entrüstet und zog aus der Brusttasche einen anderen Beutel, »ich kann Sie wählen lassen.«
Der Kapitän wollte den Beutel öffnen, aber ehe er noch die Schnur gelöst hatte, fiel er ihm aus der Hand zu Boden.
Das war eine günstigere Gelegenheit, als Henrico erhofft hatte.
Esplanza bückte sich, den Beutel aufzuheben, da aber sauste ihm ein Schlag auf den Kopf, daß er bewußtlos niederstürzte.
»Besser so, als ein voreiliger Schuß!« flüsterte Henrico, hob den Beutel auf, nahm die Lampe vom Tische und goß das Petroleum über den Bewußtlosen. Er setzte das über den Boden fließende Oel in Brand und stürzte zur Thür hinaus, den Unglücklichen dem unabwendbaren Verbrennungstode überlassend.
Draußen blieb der Verbrecher aufatmend stehen, den Revolver in der Hand, aber nur eine Viertelminute, denn schon drang aus den Fugen des eben verlassenen Hauses eine stickige Rauchluft, und in der nächsten Sekunde flammte aus dem von sonnenverdorrten Brettern erbautem Hause eine hohe Feuersäule in die Luft.
Sofort war Henrico von einer Menge Gestalten umringt.
»Nach dem Geschäftshaus dort! Schießt alles nieder, was herauskommt!« schrie er und stürzte selbst nach dem bezeichneten Gebäude.
Ehe sie dieses noch erreicht hatten, sprangen wohl schon zehn Männer heraus. Sie blieben erst wie versteinert stehen und eilten dann nach den an der Plattform angebundenen Booten.
»Ihr Dummköpfe,« hörte man eine Stimme schreien, »habe ich es euch nicht gesagt!«
Da krachte schon eine Salve, und die den Booten am nächsten Befindlichen wälzten sich in ihrem Blute; wieder feuerten die Räuber, und auch die anderen Matrosen, welche erst jetzt das Haus verließen, brachen zusammen.
»Haltet das Boot!« schrie Henrico und sprang selbst auf die Plattform.
Aber er kam zu spät. In der finsteren Nacht verriet nur ein leises Reiben an den Holzpfosten, daß eben noch ein Boot dagelegen hatte, wo jetzt ein freier Platz war.
Mehrere Salven wurden über die Bucht gesendet, aber auf dem von den Feuerstrahlen erhellten Wasser war kein Boot zu sehen.
»Unsinn,« überschrie Kapitän Blutfinger den Tumult, »es ist nichts gewesen! Auf, ins Geschäftshaus, Henrico! Plündert, Jungens, und gebt keinen Pardon, wir haben auch keinen zu erwarten.«
Die eben noch so friedliche Bucht war mit einem Male zum blutigen Kampfplatze, nein, zum Schlachtplatz geworden. Ueberall knallten Schüsse den Beamten entgegen, die verstört die Häuser verließen; noch gar nicht wissend, was dieser nächtliche Lärm bedeute, eher an eine Feuersbrunst, als an einen Ueberfall denkend, sanken sie schon, mit einer Kugel in der Brust, zusammen. Ihre Häuser wurden geplündert und dann an allen Ecken angezündet, damit man bei der Arbeit sehen konnte, und nicht lange dauerte es, so flammte es auch in dem Dorfe der Perlenfischer auf.
Die Matrosen waren einmal im Morden, sie hatten Blut gekostet und metzelten nun unter den Eingeborenen weiter.
»Monika, mein Schatz,« heulte Henrico, der bereits seine Arbeit, den Raub der Perlen, besorgt hatte und auch nach dem Dorfe geeilt war. »Nimm mich einstweilen für Esplanza, bis dein Mann dich abholt.«
Er schleuderte die Halbbetäubte einem Matrosen zu, der sie nach der Bucht schleppte, wohin andere Leute die Boote der ›Evangeline‹ gebracht hatten.
Eine halbe Stunde hatte dieses blutige Gemetzel gedauert, als die Pfeife des Kapitäns Blutfinger – er und seine Mannschaft hatten diesem Namen Ehre gemacht – in die Boote rief. Sie brachten die geraubten Eisenlasten, welche die Perlen enthielten, hinein, sowie alles, was in den Häusern des Mitnehmens wert gefunden worden war, und schließlich wurde auch noch Monika, Matales Weib, trotz des Kapitäns Gegenrede, hineingeschleppt.

Der junge Verbrecher, Henrico, schien unter den Piraten einen gewissen Rang einzunehmen, denn seinen Befehlen wurde sofort Folge geleistet. Sein Boot nahm auch das braune Weib auf.
Zur Vorsicht bohrten die Piraten noch alle Boote an bis auf das kleinste, welches sie selbst mitnehmen wollten, und Henrico konstatierte dabei, daß wirklich das große, schwarze unter ihnen fehlte. Einigen war es also doch gelungen, zu entschlüpfen, obgleich Henrico fest behauptete, höchstens ein einziger hätte es erreichen können, wahrscheinlich durch Kriechen am Boden, denn er selbst hätte gesehen, wie alle nach den Booten fliehenden fremden Matrosen von den Kugeln getroffen zusammengesunken wären; der Kapitän Blutfinger lachte darüber, daß ein Mann allein ein Boot so schnell von der Stelle bringen wollte, daß er gleich außer Gesichtsweite käme.
Und wieder nach einer halben Stunde war an den Ufern der Bucht Ruhe eingetreten, aber statt einer freundlichen Ansiedelung war jetzt nur eine rauchende Trümmerstätte zu erblicken. Ab und zu wagte es ein dem Gemetzel entgangener Perlfischer, der sich im Walde versteckt gehalten hatte, sich den rauchenden Trümmern zu nähern; tönte aber unter diesen ein wimmernder Ton hervor, so floh er scheu ins schützende Dickicht zurück.
Georg hatte richtig vorausgesagt, der Wind war umgesprungen und wehte schon die ganze Nacht direkt aus West, sodaß am anderen Morgen die ›Evangeline‹ eben erst das Land außer Sicht bekommen hatte, und als endlich Kapitän Blutfinger alle Segel setzen ließ, um nun mit vierzehn Knoten Fahrt erst dem Norden und dann mit dem Wind den Osten zuzustreben, da sprang der Wind wieder um, er kam aus Nordwest, und der Kapitän fluchte das Blaue vom Himmel herunter, daß er bei diesem Katzensprunge nach Australien nicht mit einem guten Wind bedient würde, aber der Teufel, sein Kompagnon hörte diesmal nicht aus das Gebet des Schurken. Die ›Evangeline‹ mußte lange Striche kreuzen und rückte doch nur langsam vorwärts.
Noch wütender über den ungünstigen Wind war Henrico, der ungeduldig an Deck hin- und herwanderte, sodaß ihn schließlich selbst der etwas phlegmatischere Kapitän zu trösten suchte.
»In einigen Stunden passieren wir den Aequator,« meinte er, »und da müßte es mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht in den Monsun kämen. Aber erst einmal darin, dann ade, ›Evangeline‹, uns holt so leicht kein anderer Segler ein.«
»Wenn uns nun aber ein Dampfer folgt?« fragte Henrico zweifelnd.
»Ihr habt doch selbst gesagt, vor heute abend könnten die Jäger nicht zurückkommen.«
»Allerdings, eher nicht.«
»Nun also, bis dahin sind wir schon, wer weiß wie weit. Die kleinen Dingerchen von Dampfern brauchen wir nicht zu fürchten, die sind wohl gut in Flüssen und meinethalben an der Küste, aber auf offener See sind es doch richtige Nußschalen.«
»Sie können aber nach Colombo fahren und dort Hilfe suchen. Jedes englische Kriegsschiff oder überhaupt jedes Kriegsschiff wird bereit sein, uns zu verfolgen,« klagte der ängstliche Henrico weiter.
Der Kapitän brach in ein herzliches Lachen aus.
»Wir sind nicht im mittelländischen Meer, sondern im Indischen Ozean,« erwiderte er, »und das heißt etwa ebensoviel als: Sucht einmal einen Menschen, der sich in Afrika verlaufen hat. Nein, da braucht Ihr keine Furcht zu haben. Und wenn uns wirklich eine Fregatte auf den Hals kommt, nun, Kapitän Blutfinger führt seinen Namen nicht umsonst, und unsere Kanonen sind auch nicht von Kuchen.«
»Ihr würdet es auf einen Kampf ankommen lassen?«
»Selbstverständlich,« antwortete der Kapitän siegesbewußt. »Ihr sollt einmal sehen, wie meisterhaft meine Matrosen die Geschütze bedienen und dem Gegner immer die volle Breitseite geben, während unser Schiff das andere gar nicht zum Schuß kommen läßt.«
»Heh, Jim,« rief der Kapitän einem vorübergehenden Matrosen zu, »was macht denn Willy, wird er aufkommen? Sag's ihm, er soll sich ein bißchen beeilen, unnütze Esser können wir an Bord nicht brauchen, und die Haifische wollen auch gefüttert sein.«
Der Kapitän lachte laut auf über seinen rohen Witz.
»Was ist es mit diesem Willy, er ist verwundet worden?« fragte Henrico.
»Er ist selbst daran schuld gewesen, der einzige, der blessiert worden ist. Weiß der Teufel, was den Burschen dazu veranlaßt hat, in ein lichterloh brennendes Haus zu kriechen und sich die Arme halb verkohlen zu lassen; mag wohl Schätze darin vermutet haben, oder nein, wahrscheinlich Wisky.«
»War das vorhin Euer Ernst wegen des unnützen Brotessers, mit dem die Haifische gefüttert werden können?«
»Ja und nein,« entgegnete gleichgiltig der Kapitän, »das hängt nicht von mir ab. Ich bringe einen Verunglückten nach dem ersten Hafen und empfange dort die Weisung, was ich mit dem Kerl anfangen soll. Zum ersten Male wäre es nicht, daß ein Krüppel, der sonst zu allem unfähig war, auf diese Weise in ein besseres Leben geschickt wurde.«
»Entsetzlich!«
»Du lieber Gott, was soll man denn auch mit einem Menschen anfangen, dem beide Beine oder Arme abgeschlagen, abgequetscht oder abgebrüht sind. In ein Hospital kann er natürlich nicht geschafft werden, denn da kommen die Betschwestern zu ihm und reden ihm soviel von der Bibel und der Liebe Gottes vor, bis er selbst wie ein Buch zu sprechen anfängt und aus der Schule plaudert. Das wäre ein schöne Geschichte, wenn wir unsere Verwundeten bei barmherzigen Schwestern unterbrächten! Hahaha.«
Der abgeschickte Matrose kam aus dem Zwischendeck.
»Dem Willy geht es sehr elend,« sagte er zum Kapitän, »er wirds wohl nicht mehr lange treiben. Jetzt ist er zum ersten Male zu sich gekommen und will Euch sprechen, Kapitän; er scheints furchtbar eilig zu haben.«
»Na, wollen mal sehen, was sich thun läßt,« und zu Henrico gewendet fuhr er fort, »ich bin auch ein so halber Doktor, hätten mal dabei sein sollen, wie ich vor einem Monat einem meiner Leute das Bein abgesägt habe – wunderschön, sage ich Euch, so glatt wie einen Baumast.«
»Lebt der Mann noch?«
Der Kapitän blickte ihn erstaunt an.
»Nein, natürlich nicht, er schrie sich dabei tot.«
Und Doktor Eisenbart ging nach dem Zwischendeck, um mit dem verbrannten Willy eine lindernde Kur vorzunehmen.
Henrico blickte nach Osten.
Dort lag Australien, in vierzehn Tagen war es erreicht, und dann adieu, Verbrecherleben, in dem man nicht einmal für sich selbst arbeiten kann, sondern wie ein Sklave vor der Peitsche des Herrn zittern muß. Was war aus ihm geworden! Einer guten portugiesischen Familie entstammend, hatte er die beste Erziehung genossen, aber durch angeborene Genußsucht und schlechte Kameraden war er tiefer, und tiefer gesunken, bis er sich eines Nachts in einer Bande von Verbrechern wiedergefunden. Wie bei einer heiligen Zeremonie, aber unter Lachen und Zoten wurde er als Mitglied aufgenommen, man sagte ihm, er könne seine Talente besser anwenden, als nur für andere zu arbeiten, in einem Jahre könne er ein reicher Mann sein ...
Henrico blickte sich um, überall sah er nur die vertierten Gesichter der Matrosen, er gedachte der eben gehörten Rede des Kapitäns, und es schauderte ihn.
Fort, fort, nur fort von ihnen! Die Perlen, die er auf der Brust barg, hatten nicht einen Wert von tausend Pfund, wie Esplanza gesagt hatte, sie waren wenigstens das Dreifache wert, von ihren Erlös konnte er sich eine Existenz gründen.
Man sagte, die Hand des Meisters reiche überallhin, es gäbe keinen Flecken auf der Erde, kein Inselchen im Meere, wo er nicht den Verräter zu finden wisse. Aber das war gewiß Übertreibung, Henrico glaubte nicht daran. Er hatte zwar selbst schon sehr merkwürdige Fälle erlebt, daß, zum Beispiel ein Mann, der einen Verrat oder eine Flucht mit eigenem Raub vorhatte, plötzlich aufgehangen, ermordet oder sogar gräßlich verstümmelt aufgefunden wurde, meist das Zeichen des Meisters an der Stirn, aber, dachte Henrico, dies kam eben daher, daß der Betreffende niemals seinen Plan geheim gehalten, sondern stets Mitwisser gehabt hatte.
Nein, übernatürliche Dinge passierten nicht auf der Erde, der Meister, wenn überhaupt eine solche Person existierte, war ebensowenig allwissend, wie er, aber jedes Mitglied der über der ganzen Erde verbreiteten Verbrecherbande war ein Spion, der über das Treiben seines Kameraden wachte.
Mit solchen Gedanken war Henrico beschäftigt, als er sich am Heck über Bord lehnte und dem Schaukeln des kleinen Bootes zusah, das mitgenommen worden war und vom Schiff nachgeschleppt wurde.
Da fühlte er sich plötzlich von hinten durch zwei eiserne Arme umschlungen. Der junge Verbrecher, dessen böses Gewissen sofort ängstlich zu schlagen begann, versuchte vergeblich, sich ihnen zu entwinden; im Nu waren ihm die Hände auf dem Rücken gefesselt, und als er herumgerissen wurde, blickte er in die blutunterlaufenen Augen des Kapitäns.
»Henrico,« zischte dieser, »sieh, da haben wir wieder einen Verräter entdeckt. Haha, mein Bürschchen, den feinen Gentleman spielen, an Land in Saus und Braus leben, während unsereins sich auf See den Wind um die Nase pfeifen lassen und Salzfleisch und Hartbrot kauen muß. Komm her,« rief er wütend, »verantworte dich!«
Durch Henricos Kopf zuckte der Gedanke: Sie haben erfahren, daß ich die Perlen für mich behalten habe. Woher wissen sie es? Es ist gleichgiltig, sie haben es erfahren. Lieber in die Krallen von Raubtieren fallen, der Gnade von Haifischen überlassen, als auf die Gerechtigkeit dieser Leute angewiesen sein. Aufschub, nur jetzt Aufschub erzielen, das mußte seine einzige Absicht sein.
Henrico wurde vor den Mast geschleppt und dort angebunden. Mit der Gefahr wuchs sein Mut. Er hatte die erst verlorene Fassung wiedergewonnen.
»Was giebt Euch Grund, Kapitän, mich auf einem Schiff, das ebensogut mir gehört, wie Euch, zu fesseln und zur Verantwortung zu ziehen?«
Statt aller Antwort riß ihm Kapitän Blutfinger die Jacke und Weste auf und untersuchte die Taschen. Auf den ersten Griff hielt er zwei Beutelchen in der Hand.
»Ihr könnt auch noch fragen, was ich für einen Grund dazu habe?« brüllte er mit vor Wut heiserer Stimme. »Wie kommt Ihr zu diesen Perlen, he? Sprecht, oder ich schlage Euch die Antwort aus dem Munde!«

Der Kapitän hob die Faust und hielt sie dem Gefangenen vor die Augen. Dieses Mannes alle Grenzen überschreitende Roheit und Blutgier waren bekannt, sie hatten ihm seinen Spitznamen eingebracht.
»Es sind meine eigenen,« antwortete Henrico, noch ruhig. »Ich habe sie mir von der Gesellschaft nach und nach statt meines Gehaltes auszahlen lassen.«
Klatschend fuhr die Faust ihm ins Gesicht; laut schrie Henrico auf.
»Lügner, elender!« brüllte der Kapitän. »Verschone uns mit solcher Flunkerei, die Wahrheit will ich hören, oder – –«
Henrico begann zu zittern, aber noch einmal versuchte er eine Ausrede zu machen.
»Hütet Euch, Kapitän,« begann er wieder und richtete sich unter Zusammennahme aller Fassung hoch auf. »Da Ihr mich dazu zwingt, so will ich Euch allerdings die Wahrheit gestehen, aber es wird Euer eigener Schaden sein. So wißt denn, daß ich speziell vom Meister beauftragt bin, ihm eine Quantität Perlen zu verschaffen, von denen Ihr nichts wissen sollt. Nun habt Ihr mir das Geheimnis entrissen, und Ihr seid der Rache des Meisters verfallen.«
Auf diese Lüge hatte der junge Verbrecher alle seine Hoffnung gesetzt, sie war ihm eben eingefallen, aber er fühlte sich sofort getäuscht, sie brachte nicht die Wirkung hervor, die er erwartet hatte.
Der Kapitän trat einen Schritt zurück und brach in ein höhnisches Lachen aus.
»Es wird immer besser! Haltet Ihr mich für einen Dummkopf, daß ich Euch solchen Unsinn glaube? Aber wartet, wir wollen Euch jetzt sagen, woher uns Eure Schurkerei bekannt geworden ist.«
Er wandte sich zu den Matrosen.
»Bringt Willy her,« befahl er.
»Willy liegt im Sterben,« sagte einer der Schiffsleute. »Er wird nicht einmal mehr bei Bewußtsein sein.«
Eine neue Hoffnung blitzte in Henrico auf. Ja, das war's. Der Matrose, der bei dem Ueberfall die Brandwunden davongetragen hatte, war in das Haus des Kapitäns Esplanza gedrungen, hatte diesen noch lebend gefunden und von ihm den Perlenraub erfahren, und wie er von seinem vermeintlichen Freund betrogen worden war.
Der verbrannte Matrose hatte also dem Kapitän ein Geständnis gemacht, er war der einzige Zeuge, der gegen ihn auftreten konnte, und starb der Mann, bevor er ihn zu sehen bekam, so war immer noch Hoffnung vorhanden, sich herauszureden.
Der Verbrecher betete zum ersten Male, aber er betete, daß dieser Matrose während des Transports auf Deck sterben oder doch bewußtlos bleiben möchte.
»Das ist mir gleich,« brüllte Kapitän Blutfinger wütend, »und wenn der Kerl bewußtlos ist, so werde ich ihn schon aufrütteln. Her mit ihm!«
Gehorsam verschwanden einige Matrosen im Zwischendeck und brachten nach einigen Minuten den Verunglückten in einer Art von Siechkorb herauf.
Die schrecklich verbrannten Arme des Mannes waren nur einfach mit Tüchern umwunden, und man konnte es in seinem Gesicht lesen, daß der Tod nicht lange mehr auf sich warten ließ.
Willy war nicht bewußtlos. Mit schon halb erloschenen Augen starrte er den an den Mast Gebundenen an.
»Wiederhole, was du mir vorhin erzählt hast.« herrschte der Kapitän ihn an, »damit der Schurke erfährt, daß sein Diebstahl an uns klar zu Tage liegt und wir ihn nach unseren Gesetzen richten können.«
»Kapitän,« schrie Henrico auf, »Ihr dürft mich nicht richten! Habe ich etwas begangen, so verfalle ich dem Meister, aber nicht Euch.«
»Oho,« höhnte der Kapitän, »jetzt pfeift Ihr ja mit einem Male in einem ganz anderen Tone. Wir werden Euch zeigen ob wir dürfen oder nicht.«
»Nein, Ihr dürft es nicht,« schrie der Verbrecher wieder.
Lieber wollte er dem Meister in die Hände geliefert werden, der henkte ihn höchstens lieber selbst über Bord springen und Haifischen zur Beute werden, als der Willkür des Kapitäns Blutfinger und seiner Mannschaft preisgegeben werden, von denen er schon entsetzliche Dinge hatte erzählen hören.
»Wir dürfen es nicht?« höhnte der Kapitän weiter. »Ihr wißt es selbst ganz genau, daß wir allerdings die Berechtigung dazu haben, denjenigen sofort zu töten, der uns bestiehlt, verrät oder sonst in Gefahr bringt. Ihr habt diese Bedingungen oft genug mit angehört.«
Angsterfüllt blickte Henrico den Verwundeten an, den der Kapitän jetzt zu fragen begann:
»Wie heißt der Mann, den du in dem brennenden Hause gefunden hast?«
»Esplanza,« kam es hauchend über die Lippen des Sterbenden.
»Wen bezeichnete er als den Dieb, der die Perlen, die er selbst gestohlen, ihm wieder geraubt hatte, nachdem er ihn zuvor zu einem großen Diebstahl aufgefordert hatte?«
Der Matrose nickte nur nach dem Orte hin, wo Henrico stand. Dessen Hoffnung war erloschen, diese Leute brauchten keine langwierige Beweisführung, die Aussage eines ihrer Kameraden genügte ihnen – er gab sich verloren.
»Kommt alle hier zusammen, meine Burschen!« rief der Kapitän. »Wer den besten Vorschlag macht, wie wir den Verräter mit möglichst viel Pläsier aus der Welt schaffen, erhält eine Flasche extra.«
Hohnlachend scharten sich die Matrosen um den Gefangenen, vor dessen Augen es zu flimmern begann,
»Kapitän,« rief aber der am Steuer Stehende, »gebt acht auf den Wind, er springt gleich um, die Segel stehen schon nicht mehr!«
Der Kapitän musterte den Himmel und erschrak.
Am Horizont waren finstere Wolken aufgestiegen, schon sausten pfeifende Windstöße durch die Takelage, und Segel und Stricke klapperten an den Rallen. Alle waren mit dem Verhör so beschäftigt gewesen, daß niemand den Umschlag bemerkt hatte.
»Nun, Senor Henrico,« wandte er sich an den Gefangenen, »eine Stunde habt Ihr noch Frist bekommen, um Eure Sünden zu bereuen, oder Ihr könnt Euch auch inzwischen die schönste Raae aussuchen, an der Ihr hängen wollt, um uns als Zielscheibe zu dienen.«
Er gab schleunigst Befehle, die Segel anders zu setzen und das Schiff wieder in den Wind zu bringen. Aber es war schon sehr spät geworden, das Schiff begann stark zu schwanken, und den auf den Raaen arbeitenden Matrosen wurden die Segel immer wieder aus der Hand gerissen.
Dazu kam noch, wie es unter dem Aequator öfter geschieht, daß eine pechschwarze Wolke mit einem Male den ganzen Horizont überzog und dadurch den Tag in die finsterste Nacht verwandelte. Alles dies erschwerte das Manövrieren ungemein, und fast zwei Stunden waren vergangen, ehe die Matrosen die Takelage wieder verlassen konnten.
Die schwarze Wolke sandte jetzt einen enormen Regenguß auf die ›Evangeline‹ herab.
»Hölle und Teufel!« schrie plötzlich der Kapitän auf, »wo ist unser Gefangener? Hat ihn jemand etwa aus dem Regen gebracht, damit er nicht naß wird?«
Sprachlos sahen sich die Matrosen an. Niemand hatte Henrico beachtet, niemand denselben sich vom Mast entfernen sehen.
»Sucht ihn, er wird sich befreit und irgendwo versteckt haben, im Zwischendeck, im Ballastraum oder in einem Faß. Schnell her mit ihm, daß wir uns etwas mit ihm amüsieren können! Der Regen wird bald aufhören.«
Ein hastiges Durchsuchen des Schiffes ward vorgenommen, aber es blieb fruchtlos – Henrico war spurlos verschwunden.
»Sollte der Bursche über Bord gesprungen sein, um unserer Rache zu entgehen?« meinte der Kapitän ärgerlich.
Da deutete ein Bursche am Heck ins Wasser, alle folgten seiner Hand und hatten ihn sofort verstanden – das kleine Boot war fort und mit ihm Henrico.
Fünf Tage waren vergangen, die ›Evangeline‹ war allerdings in den Monsun, das heißt in einen gleichmäßigen Wind gekommen, aber er wehte direkt aus Osten, und so mußte Kapitän Broker beständig hin- und herkreuzen, um sich seinem Ziele, Australien, zu nähern; das gab natürlich eine sehr langsame Fahrt. Am Tage segelte er Hunderte von Meilen nach Norden, während der Nacht denselben Weg wieder nach Süden, und berechnete er dann am Morgen, um wieviel er sich dem Ziel genähert hatte, so fand er immer nur wenige Meilen.
Der Kapitän fluchte, die Mannschaft fluchte, aber dies alles brachte das Schiff weder schneller vorwärts, noch änderte es die Richtung des Windes.
»Ein Segler im Norden,« rief am Morgen des fünften Tages ein Matrose, und ehe der Kapitän das entgegenkommende Schiff durch das Fernrohr gemustert hatte, wurden schon zwei andere gemeldet.
»Sie segeln gerade, als ob sie zusammengehörten,« murrte der Kapitän, »und halten voneinander gleichen Abstand. Wenn ich jetzt nicht wenden lasse, muß ich in einer halben Stunde zwischen ihnen durch, und das ist mein Wunsch nicht.«
Er gab den Befehl, das Schiff zu wenden, was er eigentlich erst des Abends hatte thun wollen.
Indes hatten sich die drei Schiffe schon so genähert, daß er sie unterscheiden konnte.
Das mittelste war ein schlankes Vollschiff, ebenso das rechte, vollständig schwarz gemalt, aber bedeutend größer als das erste, und das westliche war eine kleine Brigg, auf welcher er auch einen Schornstein erkannte.
Mit einem furchtbaren Fluch ließ Kapitän Blutfinger das Fernrohr sinken.
»Sie sind es,« schrie er seinen Leuten zu, die noch in den Raaen arbeiteten, »die ›Vesta‹ und der ›Amor‹, das dritte kenne ich nicht. Weiß der Teufel, was sie hier zu suchen haben!«
Er glaubte noch nicht, daß die Schiffe seinetwegen hierherkamen, sondern hielt die Begegnung nur für eine zufällige. Die ›Evangeline‹ war als ein gewerbsmäßiges Handelsschiff gesetzlich eingetragen, sie fuhr wie jedes andere Schiff nach Häfen, nahm Ladung, die allerdings oftmals nur aus wertlosen Kisten mit Sand bestand, und steuerte dann nach einem anderen Land, alles auf Geheiß des Meisters. Als Kapitän Blutfinger den Ueberfall in Pantura ausführte, hatte er sein Schiff weit draußen in der See ankern lassen, war bei Nacht mit seiner Mannschaft in Booten nach einer versteckten Bucht gefahren und von hier aus nach der Ansiedlung vorgegangen, daß also die ›Evangeline‹ dabei erkannt worden wäre, fürchtete er nicht, er selbst ebensowenig, wie seine Besatzung, denn es war vorher der strenge Befehl gegeben worden, keinen Namen zu nennen.
Aber daß er dennoch gerade jetzt mit diesen Schiffen zusammentreffen sollte, deren Besatzungen schon verschiedene Male mit der unter dem Meister stehenden Bande in Berührung gekommen war, beunruhigte ihn mehr, als er sich selbst gestehen wollte.
»Ich werde ihnen aus dem Wege gehen,« dachte er, »indem ich mit dem Winde nach Westen segele. Schlagen sie dieselbe Richtung ein, so haben sie es auf mich abgesehen, und ich kann daran denken, die Geschütze an Deck in Bereitschaft zu bringen.«
Fünf Minuten später flog die ›Evangeline‹ pfeilschnell mit aufgeblähten Segeln dem Westen zu, direkt vor dem Wind.
»Sie signalisieren, Kapitän,« sagte ein Matrose, »alle drei Schiffe. Könnt Ihr lesen, was es heißt?«
Der Kapitän beobachtete die Signale, welche wirklich an den Masten der Schiffe erschienen und schlug im Signalbuche nach.
»Uns gilt es nicht,« sagte er, »aber ich kann es überhaupt nicht ablesen, es ist ganz ungereimtes Zeug, was sie da zusammengesetzt haben.«
»Na, Kapitän,« meinte neben ihm ein alter Kerl, die zweite Hand des Kapitäns, »ich dächte doch, wir wissen, was das zu bedeuten hat. Wenn wir uns mit einem Schiffe unseres Schlages unterreden wollen, signalisieren wir doch auch nicht so, daß jeder den Sinn ausspionieren kann. Seht nur da, Kapitän, wie schön sich die Schiffe verständigt haben!«
Fluchend wandte sich Broker ab; es war wirklich so. Als die ›Evangeline‹ ihr Manöver ausgeführt hatte, waren an den Masten der fremden Schiffe Signale hochgegangen und sofort das Manöver nachgeahmt worden, das heißt, die Verfolger schlugen dieselbe Richtung wie die ›Evangeline‹ ein.
Als dies von allen Matrosen bemerkt worden war, brach ein allgemeines Hohngelächter aus, in welches zuletzt anch der Kapitän mit einstimmen mußte.

»Sie wollen uns wirklich jagen,« lachte er aus vollem Halse, »diese Sportleute! Wir wollen ihnen einmal zeigen, was für ein Unterschied zwischen uns und ihnen ist. Seht nur, die Brigg macht Dampf auf, um wenigstens den beiden Vollschiffen zur Seite bleiben zu können. Lustig, Jungens, wir haben so etwa hunderttausend Meilen freies Wasser vor uns, das wird eine heitere Jagd abgeben!«
»Sie verteilen sich richtig, als wollten sie uns den Weg abschneiden,« meinte wieder der alte Kerl, der der einzige war, dem die Sache nicht lächerlich vorkam. »Das schwarze Schiff scheint ein flotter Segler zu sein, es fährt vielmehr nach Norden, die Brigg dampft etwas nach Süden, und die ›Vesta‹ folgt uns.«
»Wißt Ihr auch, Jungens,« fragte der Kapitän, »was dort auf der ›Vesta‹ für eine Besatzung ist? Ihr habt die Ehre, von Frauenzimmern verfolgt zu werden!«
Wieder brachen die Leute in ein jubelndes Gelächter aus. Sie alle schon hatten von diesen Damen gehört, welche als Matrosen auf einem Segelschiffe eine Reise um die Erde machen wollten und dabei von englischen Sportsleuten begleitet wurden. Allerdings war ihnen auch bekannt, wie die Vestalinnen damals den Demetri, einen ihrer Kollegen überlistet und ihm die Sklavinnen abgenommen hatten, aber das war etwas ganz anderes. Davon waren sie fest überzeugt, daß es mit der ›Evangeline‹, einer schnellsegelnden Bark, kein anderes Schiff aufnehmen konnte, denn sie, denen das Meer zur Heimat geworden, kannten Kniffe, von denen diese da keine Ahnung hatten.
Das einzige der drei Fahrzeuge, welches sie vielleicht hätte einholen können, war die kleine Brigg mit der Hilfsmaschine, aber sie wußten, daß der ›Amor‹ ebenso, wie die ›Vesta‹ nur Revolverkanonen an Bord hatte, während ihr Schiff schwere Geschütze führte. Ehe die Brigg sich auf fünfhundert Schritte genähert hatte, war sie schon in den Grund geschossen. Außerdem flog die ›Evangeline‹ jetzt bei dem starken Winde mit sechzehn Knoten Fahrt die Stunde dahin, und mehr konnte der ›Amor‹ mit Segel und Schraube zugleich auch nicht machen.
Es war Mittag, bis zum Abend wollte Kapitän Blutfinger noch dem Treiben der Verfolger zusehen, in der Nacht schlug er dann einfach eine andere Richtung ein und war, weil er natürlich keine Lichter aussteckte, am anderen Morgen verschwunden. Bevor er wieder einen Hafen anlief, änderte er in etwas die Takelage – in solchen Arbeiten hatten seine Leute genug Erfahrung – der Name des Schiffes wurde gewechselt, falsche Papiere waren immer in Masse vorrätig, und die Sache war wieder in Ordnung.
Jetzt beobachteten sie, wie sich die drei Schiffe verhielten.
Die ›Vesta‹ blieb also hinter der ›Evangeline‹, aber die Entfernung war so groß, daß man selbst mit dem besten Fernrohre die Menschen an Deck nur undeutlich erkannte, und von einem Näherkommen war nichts zu bemerken.
Gar nicht erklären konnte sich der Kapitän das Verhalten des schwarzen Vollschiffes ›Blitz‹. Dieses fuhr fast direkt nach Norden, als wollte es sich von den beiden anderen trennen. Warum war es denn mit hierhergekommen und hatte das Manöver der ›Evangeline‹ nachgemacht? Fast glaubte er schon, es beabsichtige wirklich, nach Norden zurückzufahren, woher es gekommen, als es plötzlich wieder wendete und dieselbe Richtung wie die ›Vesta‹ einschlug, aber weit von dieser getrennt.
Das schwarze Schiff segelte gut, darüber waren sich alle einig, aber mehr Fahrt, als die verfolgte Bark machte es auch nicht.
Die Brigg dagegen machte einen Umweg nach Süden, dampfte mit voller Kraft, und es war nicht zu verkennen, daß sie doch nach und nach aufkam, aber so langsam, daß Tage darüber vergehen konnten, ehe der ›Amor‹ die Bark erreicht haben würde. Jedenfalls wollte der Engländer der ›Evangeline‹ den Weg abschneiden, bog sie dann zur Rechten aus, so war das schwarze Schiff da, wich sie nach links aus, so nahm die ›Vesta‹ dieselbe Richtung an, und die Seeräuber wären gefangen gewesen.
»Haha,« lachte Kapitän Blutfinger vor sich hin, »auf die Gesichter der Engländer freue ich mich, wenn ich die erste Breitseite in den Bauch ihres verfluchten Schiffes sende. Ich wollte mit ihnen spielen, wie die Katze mit der Maus, erst schösse ich einen Mast nach dem anderen ab, und dann ging es an die Maschine. Wenn es nur erst in Schußweite wäre, aber vor morgen früh ist nicht daran zu denken, und daß sie mich morgen nicht mehr sehen, dafür will ich sorgen.«
Der Abend brach an, die Sonne sank am Horizont, und kaum war der blutige Saum in der Ferne verblichen, so legte die Nacht ihre schwarzen Schleier auf das Meer.
Der Kapitän des Piratenschiffes unterließ es, durch die jedem Schiffe vorgeschriebenen bunten Laternen, rechts eine grüne, links eine rote, den Ort zu bezeichnen, an dem sich die ›Evangeline‹ befand, dagegen zündeten die drei Schiffe solche an.
Als vollständige Finsternis herrschte, gab Broker einen noch mehr nördlichen Kurs an, und mit Jubel sahen die Matrosen, wie die drei Schiffe, die durch ihre Lichter gekennzeichnet waren, ruhig weiterfuhren. Gegen zwei Uhr, berechnete der Kapitän, mußte er bei dem schwarzen Schiffe vorbeischlüpfen, dann ging es direkt nach Norden, später wieder noch Osten, und wenn der Tag anbrach, hatten die Verfolger das Nachsehen.
Kapitän Blutfinger ging ins Zwischendeck, um einige Stunden zu schlafen.
Es mochte gegen Mitternacht sein, als heftig an die Thür seiner Kabine gepocht wurde. Schnell ermunterte er sich und fragte fluchend den Störenfried seines Schlafes nach der Ursache.
»Kapitän,« meldete der Mann hastig, »die Lichter des schwarzen Schiffes sind nicht mehr zu sehen.«
»So, seit wann nicht mehr?«
»Das können wir nicht genau sagen, es mag eine halbe Stunde her sein.«
Schimpfend eilte der Kapitän an Deck, um den Matrosen, der auf dem Ausguck gestanden und geschlafen hatte, zur Verantwortung zu ziehen.
Es waren nur noch der ›Amor‹ und die ›Vesta‹ zu erblicken, in weiter, weiter Ferne, aber so, wie es der Kapitän erwartet hatte, gerade links von der ›Evangeline‹ ab. Von den Lichtern des schwarzen Schiffes dagegen war nichts mehr zu sehen.
»Meinetwegen,« brummte der Kapitän, »wer weiß, was die Kerls dazu veranlaßt hat, ihre Lampen zu löschen; uus schadet das jedenfalls nichts.«
Da seine Ruhe nun einmal gestört war, blieb er an Deck und ging auf und ab, während die Hälfte der Mannschaft, welche gerade die Wache hatte, müßig herumlag, schwatzte oder durch Rauchen sich die Zeit vertrieb. Die Nacht war sehr dunkel, nur die Sterne sandten ihr unsicheres Licht herab, welches kaum ausreichte, auf einige Meter Entfernung einen Gegenstand erkennen zu können.
»Da sind die Lichter wieder,« rief plötzlich ein Matrose.
In der That, da, wo sich das schwarze Schiff jetzt befinden mußte, tauchten wieder das rote und das grüne Licht auf. Der ›Evangeline‹ war es gelungen, den Verfolgern zu entschlüpfen, denn der ›Amor‹ und die ›Vesta‹ waren ihr schon voraus und der ›Blitz‹ war hinter ihr. Ehe der Morgen tagte, vergingen noch einige Stunden, und bis dahin waren die Piraten längst aus dem Gesichtskreis der Verfolger.
»Was ist denn das? Haben die dort einen elektrischen Signalapparat?« rief der Kapitän.
In der Ferne, etwa da, wo sich das schwarze Schiff jetzt befinden mußte, konnte man bald blaue, bald rote und weiße Lichter aufblitzen sehen, immer Zwischenpausen einhaltend, und die Farben in den verschiedensten Zusammenstellungen folgen lassend.
»Sie signalisieren,« rief wieder der Kapitän, »aber der Teufel mag wissen, was es heißt, ich werde daraus nicht klug. Sie werden eine Geheimsprache untereinander ausgemacht haben. Die Hauptsache ist für uns, daß sie nicht wissen, wo wir sind – und das werden sie auch nicht erfahren.«
Vergnügt rieb sich der Kapitän die Hände und sah ebenso, wie seine an Deck befindlichen Matrosen, nach dem Horizont, wo fortwährend farbige Lichter auftauchten und wieder verschwanden.
Die Piraten waren so in dieses seltsame Farbenspiel vertieft, welches sie höchstens einmal bei einem Kriegsschiff gesehen hatten, das im Hafen zur Uebung signalisierte, daß sie gar nicht darauf achteten, daß das Schiff plötzlich einen leichten Stoß erhielt, als würde es etwa von einem Boot berührt. Es kommt übrigens öfters vor, daß man auf hoher See plötzlich eine Erschütterung des Schiffes verspürt, ohne sich die Ursache davon erklären zu können; es mögen große Fische sein, welche an das Fahrzeug stoßen, ein gesunkenes Schiff mag seine Masten bis dicht unter die Oberfläche des Wassers recken, oder aber, wie sich abergläubische Seeleute nachts im Logis erzählen, Wassergeister mögen zornig an dem Kiel des Ungetüms rütteln, welches wagt, ihr Gebiet ohne ihre Einwilligung zu durchfurchen.
Die Matrosen achteten nicht darauf, sie bemerkten auch nicht, wie sich vorn am Bug dunkle Gestalten über die Bordwand schwangen, im Gürtel den Revolver, zwischen den Zähnen das blitzende Messer, und als die Ahnungslosen plötzlich von hinten ergriffen und zu Boden gerissen wurden, da dachten sie nicht einmal an Gegenwehr. Die Haare sträubten sich ihnen vor Entsetzen, willenlos ließen sie es geschehen, daß die finsteren Gestalten ihnen Hände und Füße banden, daß sie dann unter Deck schlichen, um dieselbe unheimlich schnelle Arbeit an den noch Schlafenden zu vollziehen. – Sie meinten nichts anderes, als daß das Meer die Toten, welche sie im Laufe vieler Jahre diesem überliefert hatten, wiedergegeben habe, damit sie Rache für die an ihnen verübten Greuelthaten nehmen könnten.

Auch auf der ›Vesta‹ hatte das plötzliche Verschwinden der Lichter des ›Blitz‹ erst Bestürzung und dann, als sie nicht wieder erschienen, Sorge erregt. Allerhand Vermutungen wurden laut, was der Grund hierzu sein könnte.
»Es wird dem Schiff doch kein Unglück zugestoßen sein?« meinte Ellen. »Wenn wir nicht vorher ausgemacht hätten, immer mit Laternen zu fahren, um uns nicht zu verlieren, so würde es mir keine Sorge machen, aber es ist nun bereits eine halbe Stunde her, seit wir das Schiff aus den Augen verloren.«
»Ich glaube, wir brauchen um Herrn Hoffmann keine Sorge zu haben,« antwortete Johanna, »er hat uns bis jetzt mit einer solchen Sicherheit geleitet, daß es fast übernatürlich erscheint.«
»Es ist wirklich sonderbar, daß einige Stunden, nachdem der Direktor abgefahren war, unsere Schiffe mit der Besatzung des ›Blitz‹ angesegelt kamen, woher diese überhaupt erfahren hatte, daß wir sie gebrauchten –«
»Georg war der Metzelei entflohen und mit dem Boot sofort nach Colombo zurückgesegelt,« unterbrach Johanna die Sprecherin.
»Nun gut, angenommen, die Verhältnisse wären wirklich so günstige gewesen, daß alles so schnell vor sich ging, wie aber erklären Sie, daß Hoffmann nach fünf Tagen den Seeräuber richtig auf dem unendlichen Ozean wiederfand?«
»Sie müssen doch zugeben, daß Hoffmann mit seinem Schiff so ausgezeichnet zu segeln weiß, wie wir uns dessen nicht rühmen können,« entgegnete Johanna.
»Allerdings,« bestätigte die Kapitänin, »nie hatte ich dem stillen Menschen so etwas zugetraut. Jetzt glaube ich auch, daß er damals bei dem Wettsegeln im Boot absichtlich zurückblieb.«
»Also ist er auch ein sehr guter Seemann,« fuhr Johanna fort. »Und warum soll er, wenn er Kenntnis von den jeweiligen Windströmungen hat, nicht berechnen können, wo er ein Segelschiff ungefähr zu suchen hat?«
»Die Behauptung ist etwas kühn, aber es mag sein, daß er so etwas fertig bringt – ich wüßte nicht, wie ich es anfangen sollte; dann ist er hoffentlich auch morgen in der Lage, das Schiff jenes Schurken wiederzufinden, denn ich wette, wir werden es bei Tagesanbruch nicht mehr sehen.«
»Machen Sie sich darum keine Sorge,« entgegnete Johanna bestimmt. »Hat uns Herr Hoffmann so weit geführt, so wird er uns auch zum Ziel bringen.«
»Sie halten ja ungeheuer viel auf den Herrn,« lächelte Ellen.
»Warum sollte ich auch nicht? Ich dachte doch, er hätte uns schon so viele Zeugnisse seiner Fähigkeiten gegeben, daß wir nicht mehr an diesen zweifeln sollten. Sehen Sie, da sind die Lichter wieder,« unterbrach sich Johanna. »Jetzt signalisiert er uns etwas.«
Ellen nahm sofort eine Schreibtafel und einen Bleistift in die Hand und notierte die Reihenfolge der farbigen Flammen, ebenso wie es jedenfalls auf dem ›Amor‹ geschah. Die Vestalinnen warteten gespannt, bis die Kapitänin ihnen das Signal erklären würde, denn Kapitän Hoffmann hatte mit ihr und Lord Harrlington zuvor verabredet, daß er, wenn er mittelst eines elektrischen Apparates zu ihnen sprechen würde, sich nicht der gewöhnlichen, sondern geheimer Zeichen bedienen wolle. Wenn der Kapitän des verfolgten Schiffes dieselbe verstehen sollte, so würde er doch keinen Sinn in den Signalen finden, ebensowenig wie am Tage in den mit den Flaggen gegebenen.
Als das Schlußzeichen, dreimal hintereinander ein rotes Licht, erschienen war, fing Ellen an, statt der sonstigen Bedeutungen, die verabredeten unterzuschieben.
»Rot, weiß, blau,« erklärte sie nun, »das würde bei uns Kurs heißen – er giebt uns also einen neuen Kurs an; weiß, blau, blau – Nord, weiß, blau, grün – Nord-Ost.«
So fuhr sie fort, bis sie das ganze Signal übersetzt hatte, und es lautete nun:
»Kurs Nord zu Nord-Ost, dreiviertel Ost.«
Jetzt ließ sie das verabredete Verstandenzeichen geben, das heißt, für eine halbe Minute die grüne Laterne auf der Steuerbordseite verlöschen, und diejenigen Mädchen, welche dabei den ›Amor‹ beobachteten, bemerkten, daß dort dasselbe Zeichen erschien; also auch die Brigg der Engländer hatte das Signal abgelesen.
»Natürlich muß ich diesen Rat Kapitän Hoffmanns befolgen,« sagte Ellen, »obgleich ich nicht glauben kann, daß wir dadurch der ›Evangeline‹ auf der Spur bleiben werden. Wie will er denn nur bei dieser Finsternis eine Ahnung haben, wo sich der Pirat gerade aufhält, oder wohin er sich wendet.«
»Und ich glaube, er weiß es doch,« stimmte Miß Murray ihrer Freundin Johanna bei. »Sonst hätte er uns nicht mit solcher Bestimmtheit den Kurs angegeben.«
Einige Minuten später segelte die ›Vesta‹ den neuen, vorgeschriebenen Weg, und an der gegenseitigen Verschiebung der Seitenlichter des ›Amor‹ sahen die Mädchen, daß auch die Brigg das Gleiche that.
»Es ist jetzt zwei Uhr,« sagte Ellen eine halbe Stunde später, »in zwei Stunden bricht die Morgendämmerung an, und dann werden wir ja sehen, ob Kapitän Hoffmann recht gehabt hat oder nicht, uns von der alten Richtung abzulenken. Es ist allerdings zu vermuten, daß der Pirat uns bei Nacht zu entschlüpfen sucht, aber meiner Meinung nach können wir ihn auch daran nicht verhindern, weil keines unserer Schiffe einen Scheinwerfer an Bord hat, mittels dessen man das verfolgte Fahrzeug immer mit einem Strahl beleuchten kann.«
»Wenn nun die ›Evangeline‹ früh wirklich noch in Sicht ist, wie wollen wir sie dann nehmen?« fragte eine andere Vestalin.
»Der Pirat wird gute Geschütze an Bord haben,« warf Jessy dazwischen.
»Wir müssen eben versuchen, alle drei gleichzeitig an ihn heranzukommen, und zwar möglichst schnell, ehe er Gebrauch von seinen Kanonen machen kann. Wir beide, der ›Blitz‹ und die ›Vesta‹, segeln mit dem Wind auf ihn zu, und der ›Amor‹ dampft gegen den Wind an ihn heran,« entgegnete Ellen.
»Da kann Blut fließen.«
»Ja. Haben wir die Verfolgung aber einmal angefangen, so können wir sie auch jetzt nicht mehr aufgeben, diese Blamage wäre zu groß. Ich fühle mich von jeder Verantwortung frei, denn die Verfolgung ist nach einstimmigem Beschluß aller Damen aufgenommen worden, überdies ist es nicht das erste Mal und wird wohl auch nicht das letzte Mal sein, daß wir dem Tode entgegengehen. Sind aber alle Damen damit einverstanden, von einem eventuellen Kampf abzusehen, das heißt also, die Jagd hinter dem Piraten aufzugeben, so muß ich mich diesem Beschlusse fügen, ich lasse sofort wenden.«
Ein unwilliges Gemurmel wurde unter den Mädchen hörbar, daß die Kapitänin so von ihnen dachte, als ob sie nicht auch schon verschiedene Male gezeigt hätten, daß sie ihr Leben ebensowenig wie Miß Petersen schonten, wenn es die Ehre der ›Vesta‹ galt.
»Wohlan denn!« rief Ellen. »Machen Sie die Kanonen klar. Im Osten zeigt sich schon ein roter Streifen. In einigen Minuten müssen wir sehen, ob uns Kapitän Hoffmann richtig hinter dem Piraten hergeführt hat.«
Es wurden alle Vorbereitungen getroffen, um einen Kampf mit dem Piratenschiff bestehen zu können, die Revolverkanonen wurden an die Bordwand gerollt, die Waffen in Bereitschaft gesetzt und noch einmal jedes Tau in der Takelage gemustert, damit es nicht etwa bei einem schnellen Segelmanöver reiße und der ›Vesta‹ verderblich würde, denn nun galt es, die ganze Geschicklichkeit im Segeln zu zeigen, nämlich immer so zu kreuzen, daß es dem Piratenschiff nie gelang, der ›Vesta‹ die Breitseite zuzuwenden, und ihr eine volle Ladung der Kanonen zu geben, sondern daß es höchstens mit einem am Heck aufgestellten Geschütz operieren konnte. Bei einem Seegang wie jetzt, ist es auf dem Meere äußerst schwer, ein Ziel sicher zu treffen, von einer Kanone hat man daher nicht viel zu befürchten, während von den Kugeln einer Batterie, deren Geschütze verschieden gerichtet sind, immer wenigstens eine trifft.
Eine wilde Freudigkeit bemächtigte sich der Mädchen. Es war dasselbe Gefühl, welches die Herzen unserer Matrosen beseelt, wenn an der Ost- oder Westküste Afrikas Patronen an sie verteilt werden, wenn hinter ihnen die berauschenden Klänge der Schiffskastelle ertönen und vor ihnen in dem Unterholz die Waffen der feindlichen Neger blitzen oder über dem Palissadenbau, den sie stürmen sollen, wollhaarige Köpfe zum Vorschein kommen. Fällt auch neben ihnen, von einer Kugel getroffen, manch' lieber Kamerad, sie können das Kommando des führenden Offiziers: »Zum Sturm, Marsch, Marsch!« nicht erwarten. Kaum vernehmen sie die feurigen Worte, mit denen sie noch einmal entflammt werden; dieselben wären nicht nötig, eine unnennbare Begeisterung reißt auch den sonst Mutlosesten mit fort, bis die deutsche Flage hoch über den Palissaden weht. Noch einmal ertönt ein dreifaches Hurrah für Kaiser und Reich, das Kommando erschallt, die verstummte Musik setzt wieder ein, und im Sturmschritt geht es vorwärts, mit unwiderstehlicher Gewalt alles niederwerfend.
So brachen auch jetzt die Mädchen in ein »Hip, hip, hurra!« aus, als die Morgenröte die Finsternis erhellte, und sie, nur einige Meilen von ihnen entfernt, das Piratenschiff segeln sahen.
»Es hat in der Nacht Havarie erlitten,« rief Ellen, »einige Segel sind eingezogen, sie fahren langsam. Hoch die amerikanische Flagge! Wir entern das Schiff!«
Das Sternenbanner der Vereinigten Staaten stieg am Heck auf, die Enterhaken wurden an Deck bereitgelegt, und dicht gedrängt standen die Mädchen an der Bordwand, das feindliche Schiff betrachtend.
Kapitän Hoffmann hatte zwar Miß Petersen ausdrücklich gebeten, unter keinen Umständen zu entern, wenn ihr Schiff den Piraten zuerst erreichen sollte, sondern entweder erst auf die anderen zu warten und dann gleichzeitig zu einem Angriff überzugehen, oder aber dem ›Blitz‹ die Enterung zu überlassen, weil er die grötzte Besatzung an Bord habe, die sich überhaupt aus Leuten zusammensetze, welche in dergleichen Unternehmungen bewandert wären. Der ›Blitz‹ sei es auch, der sich zuerst an dem Kapitän zu rächen habe, denn durch diesen hatten fünf Matrosen Hoffmanns den Tod gefunden.
Aber die Gelegenheit war eine zu günstige, wieder einmal als erste sich zu zeigen, als daß sich die Mädchen dieselbe hätten entgehen lassen.
Der ›Blitz‹ war viel zu weit nördlich, und der ›Amor‹ hatte wirklich die ›Evangeline‹ umgangen und dampfte jetzt gegen den Wind an. Aber er brauchte wenigstens zwei Stunden, ehe er sie erreicht hatte, und die ›Vesta‹ konnte den Piraten in einer halben Stunde bequem einholen, denn das verfolgte Schiff segelte merkwürdig schwerfällig.
»Es muß etwas mit dem Schiff nicht in Ordnung sein,« meinte Ellen, »die meisten Segel sind festgemacht, nur wenige stehen noch, und in der Takelage sind auch keine Matrosen zu sehen.«
Die Bordwand der ›Evangeline‹ war, wie auf vielen Segelschiffen, über zwei Meter hoch, sodaß man an Deck keine Leute sehen konnte. Nur auf der Back, dem vordersten Teil des Schiffes, und am Heck war sie niedriger, aber dort hält sich gewöhnlich niemand auf.
Ellen schickte einige Mädchen in die Takelage, damit sie sich überzeugten, was die Matrosen eigentlich trieben, aber wie groß war aller Erstaunen, als diese herunterriefen, an Deck wäre überhaupt niemand zu sehen.
»Dann sind sie unter Deck und beschäftigen sich mit den Kanonen,« sagte Ellen.
Die Kanonenpforten waren aber noch geschlossen, und ob am Steuerrad ein Matrose stände, konnte man nicht erkennen, weil dasselbe in einem Häuschen untergebracht war.
Schnell hatte sich die ›Vesta‹ dem Piratenschiff genähert.
»Wir wollen sie aus ihren Träumen wecken,« rief die Kapitänin. »Zeigen Sie einmal Ihre Kunst an den Revolverkanonen. Schießen Sie die Segel weg.«
Schuß krachte auf Schuß, die Taue zerrissen, die Holzsplitter der Raaen flogen in die Luft, aber an Bord zeigte sich kein Mensch.
Erstaunt sahen sich die Mädchen an.
Jetzt lag die ›Vesta‹ neben der ›Evangeline‹. Die Enterhaken fielen über die Bordwand, die eine Hälfte der Mädchen zogen das Schiff heran, die andere stand mit dem Revolver in der Hand bereit, um einer List der Piraten zu begegnen, aber es war nicht nötig – sie trafen auf keinen Widerstand.
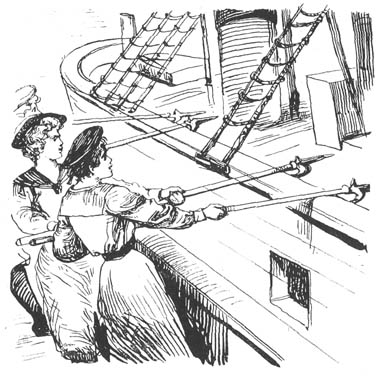
Ellen sprang auf die ›Evangeline‹ hinüber, gefolgt von einigen anderen, vorsichtig begaben sie sich ins Zwischendeck – niemand war darin, das Ruder war festgebunden. Das Schiff war wie ausgestorben.
Da deutete Johanna auf den Platz, wo sonst gewöhnlich die Boote hängen.
»Wie konnten wir das nur übersehen! Die Boote sind ja fort.«
»So sollten sich uns die Piraten also in den Booten durch Flucht entzogen haben?«
Diese Frage kam sehr zweifelnd aus Ellens Munde.
Sie begab sich wieder unter Deck und öffnete alle Thüren. Als sie an eine kam, welche verschlossen war, sprengte sie das Schloß durch einen Revolverschuß.
Es war so, wie sie vermutet hatte: sie befanden sich im Kartenzimmer des Kapitäns, wo alles Wertvolle, wie Geld, Papier und so weiter aufgehoben wurde, und sofort sprang Johanna nach einem Winkel der Kammer und schob mit dem Fuß zwei eiserne Kisten hervor.
»Hier sind die Perlen,« sagte sie einfach, »ich kenne die Kisten genau aus der Beschreibung des Direktors. Wir brauchen die Deckel nicht erst aufzumachen, die kunstvollen Schlösser sind vollkommen unbeschädigt, der Inhalt ist also noch darin.«
Es war eine Thatsache, die nicht zu bezweifeln war. Die Piraten hatten ihr Schiff in den Booten verlassen, aber den geraubten Schatz nicht mitgenommen. Hatte ihnen irgendetwas einen so furchtbaren Schreck eingejagt, daß sie Hals über Kopf in die Boote gestürzt und davongefahren waren, ohne an die Perlen zu denken? Wer konnte es sagen? Die Vestalinnen gaben sich gar nicht mehr die Mühe, über solche Rätsel zu grübeln, auf ihrer Reise waren ihnen schon merkwürdige Dinge genug begegnet.
Als sie mit den eisernen Kisten an Deck zurückkamen, legte eben der ›Amor‹ zur Seite des verlassenen Schiffes an, und die Engländer wollten zuerst nicht glauben, was ihnen die Damen erzählten, bis sie sich selbst überzeugt hatten.
Als sie ihre Aufmerksamkeit dem ›Blitz‹ zuwenden wollten, bemerkten sie zu ihrem Erstaunen, daß dieser gar nicht mehr zu sehen war. Charles wollte zwar noch seine Mastspitzen am Horizont bemerken, aber er mußte diesmal zugeben, daß es ebensogut ein anderes Schiff gewesen sein konnte.
»Er ist nach Norden gefahren, ohne sich weiter um uns zu kümmern, als er sah, daß wir die ›Evangeline‹ genommen hatten, und zwar ohne Blutvergießen,« murmelte Ellen. »Seltsam, sollte Kapitän Hoffmann vielleicht mehr davon wissen, als er sagen will, wo die verschwundene Mannschaft geblieben ist?« – – –
Noch an demselben Abend geschah etwas, was Licht in die Sache zu bringen schien.
Die ›Vesta‹ und der ›Amor‹ fuhren einträchtiglich nebeneinander den Weg zurück, sie wollten beide nach Colombo, um dort die Perlen abzugeben, als in der Ferne ein Boot mit einem einzelnen Menschen darin erkannt wurde.
Als das Boot neben dem ›Amor‹ lag, fand man, daß der vermeintliche Matrose tot war, und Charles kletterte an einem Tau hinunter, um die Leiche an Deck hissen zu können. Aber ein entsetzlicher Gestank wehte ihm entgegen, er hatte nur noch Zeit, den auf dem Gesicht liegenden Körper umzuwenden, dann kehrte er eiligst an Bord zurück.
Er wollte seine Gefährten mit einer großen Neuigkeit überraschen, aber dieselben hatten ebenfalls schon in dem halb verwesten Leichnam, dessen Gesicht und Hände bereits von Seevögeln zerhackt worden waren, Henrico erkannt, weniger an seinen Zügen, denn diese waren völlig entstellt, als vielmehr an seiner Kleidung.
Der Verbrecher mußte schon tagelang im Boote auf See herumtreiben und war auf alle Fälle aus Mangel an Nahrung und Wasser gestorben; daß er ursprünglich auf der ›Evangeline‹ gewesen war, daran zweifelte niemand, was ihn aber dazu veranlaßt hatte, das Schiff in einem Boot zu verlassen, ohne Segel, ohne Riemen und ohne Nahrung, das blieb in tiefes Dunkel gehüllt. Charles überwand den aufsteigenden Ekel und untersuchte den Leichnam, aber nichts wurde gefunden, was den Schleier des Geheimnisses gelüftet hätte.
Die Bierhalle des ›Schiffsankers‹, des besuchtesten Matrosenlokals von Sydney, war dicht gedrängt besetzt. Alle Nationen der Erde waren hier vertreten, aber man konnte die einzelnen Typen höchstens nach ihren Gesichtszügen und der Farbe ihres Haares erkennen, denn alle zeigten im Gesicht und an den Händen die gleiche Schattierung von Braun und Rot, wie sie den Seeleuten eigentümlich ist.
Der dicke Wirt hinter der Bar schmunzelte jedesmal, wenn eine der flinken Kellnerinnen vor derselben erschien, in jeder Hand zehn leere Biergläser tragend, und er dieselben wieder mit dem goldgelben Stoffe füllen mußte, der die Gemüter seiner Gäste immer mehr erhitzte.
Von den Schiffen, deren Mannschaften hier versammelt waren, um nach des Tages Arbeit sich an einigen Gläsern Bier und an lustiger Unterhaltung zu erquicken, waren hauptsächlich englische vertreten, aber man konnte den an den einzelnen Tischen verteilten Besatzungen nicht ansehen, daß es englische waren, denn die wenigsten Matrosen unter ihnen zeigten das Aussehen von Engländern, vielmehr setzten sie sich meistens aus Negern, Mulatten und Südeuropäern zusammen, nur die englisch geführte Unterhaltung verriet, unter welcher Flagge sie segelten.
Es ist überhaupt eine Eigentümlichkeit der englischen Schiffe, daß auf ihnen wenige englische Matrosen, dagegen sehr viele Fremde fahren, mit Vorliebe Deutsche, Holländer und Skandinavier, und zwar darum, weil englische Kapitäne die beste Heuer bezahlen. Um seine riesige Handelsflotte vollständig mit Matrosen zu besetzen, kann England selbst nicht genug Männer liefern, besonders auch darum, weil die sehr große Kriegsmarine fast die ganze seemännische Bevölkerung der Insel verbraucht. Die hohen Heuer ziehen dafür die Matrosen anderer Nationen an, und ebenso liefern die Kolonien einen großen Teil der Mannschaft, Neger, Hindus, Chinesen, Japanesen und so weiter, von denen besonders die letzten ausgezeichnete Seeleute sind oder doch werden, sobald sie unter einen tüchtigen Kapitän kommen.
Auf amerikanischen Schiffen ist es noch schlimmer. Anders ist es mit den Schiffen der übrigen Nationen. Auf den holländischen fahren Holländer, auf den norwegischen und schwedischen fahren Skandinavier, und auf den deutschen fahren Deutsche, nur selten kommt es vor, daß sich unter diesen Schiffsbesatzungen fremde Matrosen befinden.
So konnte man hier in dieser Bierstube auf den ersten Blick sehen, daß jene Männer, welche im Hintergrunde des Saales allein um eine große Tafel saßen, zu einem deutschen Schiff gehörten. Die offenen, ehrlichen Züge, die blonden Haare, die blauen Augen kennzeichneten sie schon als Söhne Deutschlands, wenn sie sich auch nicht auf deutsch unterhalten hätten.
»Wenn dem Jungen nur nichts zugestoßen ist,« sagte eben ein hünenhafter, breitschultriger Mann mit verwittertem Gesicht, der von den anderen mit Bootsmann angeredet wurde. »Sidney wimmelt von Gesindel aller Art; der Junge steckt immer voll allerlei dummer Streiche, und wer weiß, ob sie ihn nicht wegen irgend etwas gefaßt und ohne weiteres gelyncht haben. Auch die englische Polizei läßt nicht mit sich spaßen.«
»Unsinn,« meinte ein anderer, »Hannes ist viel zu schlau, als daß er sich ohne weiteres kriegen lassen sollte. Gott, als wir noch so jung waren und als Leichtmatrose in der Welt umhergekreuzt sind, haben wir es auch nicht besser gemacht, Bootsmann. Wenn der Junge auch einmal über den Strang haut, du wirst wohl auch eben kein Goldkind gewesen sein, meine ich.«
Der Bootsmann lachte laut anf.
»Wetter noch einmal, nein, wenn es einen Streich auszuführen gab, da war Karl immer der erste voran, und von Kriegenlassen gab's bei uns auch nichts. Aber damals waren auch noch andere Zeiten; in den Hafenstädten herrschte Ordnung, und die Seeleute bildeten eine Klasse für sich, die unter sich zusammenhielt. Jetzt dagegen glaubt jeder Spanier berechtigt zu sein, einem Engländer das Messer in den Leib zu rennen, und dieser wieder prahlt damit, wenn er einem deutschen Matrosen die Augen blau geschlagen hat. Daß er aber mit so und so vielen Kerlen auf einen gegangen ist, verschweigt er natürlich.«
Der Bootsmann stärkte sich nach dieser langen Rede durch einen ebenso langen Zug aus dem vor ihm stehenden Glase.
»Ja, ja,« seufzte der andere, ein schon weißhaariger Bursche, der Koch von der in Sidney liegenden ›Kalliope‹, »besser werden die Zeiten nicht. Besonders seitdem die Dampfer immer mehr und mehr überhand nehmen, kommen Elemente unter die Seeleute, welcher sich jede brave Theerjacke schämen muß. Da bezahlen die Comptoirs bloß noch dreiviertel der eigentlichen Heuer, richtige Matrosen wollen dafür natürlich nicht fahren, weil sie sich ja vor ihren Kameraden blamieren würden, und was ist die Folge davon? Die Herren da in den Schreibstuben nehmen den ersten Besten, der sich als Matrose anmeldet, er mag Schneider, Schuster, Bäcker oder Barbier sein, schreiben ihm sein Seemannsbuch aus und stecken ihn an Bord – fertig ist der Seemann.«
»Was hat denn auch ein Dampfer für besonders geschickte Matrosen nötig?« lachte der Bootsmann. »Sie waschen doch bloß die weiße Farbe ab, scheuern das Deck, und für die Arbeiten, zu denen ein richtiger Matrose gehört, wie zum Beispiel fürs Steuern, ist doch immer ein Seemann unter ihnen. Auf einem Dampfer können ebensogut Schornsteinfeger als Matrosen fahren wie Seeleute von Profession, denn in der Takelage haben sie nichts zu suchen, mit Ausnahme von monatlich einmal, wenn die Masten und Raaen gescheuert werden, und klettern können Schornsteinfeger auch.«
»Oho,« rief aber der Koch dagegen, ein alter Seebär, der nur jetzt als Koch fuhr, weil ihm seine steif gewordenen Knochen das Springen nicht mehr erlaubten, »oho, Bootsmann, da steuert Ihr aber doch einen falschen Kurs, wenn Ihr so denkt. Nehmt nur einmal ein Pasagierschiff an, auf dem könnte manchmal eine tüchtige, fixe Schiffsbesatzung, so vom alten Schrot und Korn, die sich vor Gott und den Teufel nicht fürchtet, nicht mit Geld bezahlt werden.«
»Ich weiß nicht, was Ihr meint,« sagte der Bootsmann lächelnd, »Ihr geratet ja ordentlich ins Feuer, wenn Ihr an Passagierschiffe denkt. Gerade auf diese will kein ordentlicher Seemann mehr gehen, weil sie die niedrigsten Heuer zahlen und weil die Mannschaft fortwährend damit zu thun hat, die Andenken von den Seekranken wegzuräumen. Mir könnte einer dreihundert Mark monatlich bieten, ich würde nicht auf einen solchen Dampfer gehen.«
»Das ist es eben,« schrie der Koch erbost und schlug donnernd mit der Faust auf den Tisch, daß die Gläser zu tanzen begannen. »Natürlich will niemand mehr draufgehen und die Schweinerei der Passagiere wegmachen und noch dazu für solchen Hungerlohn, als höchstens eben Kerls, die vor Hunger das Angebot annehmen. Aber nun sagt, Bootsmann, wenn dem Schiff ein Unglück zustößt, was ist dann die Folge? Heh!«
Der Bootsmann schwieg verlegen, ebenso wie die anderen, sie wußten nun, wohinaus der Koch wollte.
»Ich will Euch die Frage beantworten,« sagte dieser, »wenn Ihr thut, als wüßtet Ihr es nicht ebensogut wie ich. Beim ersten Anzeichen, daß der Dampfer zu sinken droht, stürmen sie nach den Booten, kappen die Taue und springen hinein, alles dabei über den Haufen stoßend. Mögen der Kapitän und die Offiziere auch brave Leute sein, weder ihre Ermahnungen, noch ihre Drohungen wirken bei diesen Halunken, und springen die Passagiere dann ins Wasser und klammern sich an die Boote, was thun die sogenannten Matrosen dann? Gott verdamme meine Augen, wenn ich Euch das nicht sage, was sie gesehen haben! Mit den Messern haben sie die Hände auf dem Bootsrand abgekappt und mit den Riemen die sich dem Boote Nähernden untergedrückt.«
»So waret Ihr selbst einmal einmal bei einem solchen Schiffsunglück auf einem Passagierdampfer, Koch?« fragte der Bootsmann nach langer Pause, als der Sprecher nicht fortfuhr.
»Ich war´s, und ich wurde mit fortgerissen,« sagte der Koch leise. Vielleicht hat schon mancher von Euch Maaten ein Schiff verloren, im Sturm oder an der Küste, aber was ist das dagegen, wenn ein Passagierschiff auf hoher See gerammt wird und schneller untersinkt, als man bis dreißig zählen kann. Die halbnackten Menschen stürzen an Deck, die Weiber haben ihre Kinder auf den Armen, sie rennen nach den Booten; der Kapitän selbst ruft es ihnen zu, die Matrosen lassen die Boote ins Wasser hinein, sie springen nach, und wie die Passagiere nachwollen, da stoßen die Kerls ab. Hölle und Teufel,« der alte Seemann sprang erregt von seinem Stuhle auf, »so etwas kann man nicht erzählen!«

Er sank zurück und begann erst nach einer Weile wieder mit leiser Stimme:
»Wie gesagt, ich wurde mit fortgerissen. Auch ich war im Boot und wartete, daß die Passagiere nachkommen sollten, aber was thaten die Teufel von Menschen? Sie stießen vom Schiff ab, nicht nur das eine Boot, sondern auch alle anderen – ohne Passagiere, nur zwei Offiziere waren darin; ich schrie, ich wollte aufs Schiff zurück, man hielt mich fest, ich sah, wie sie die über Bord Gesprungenen mißhandelten. Doch was soll ich erzählen, was ich dabei gedacht habe; als wir nach zwei Tagen an der holländischen Küste landeten, war mein schwarzes Haar schneeweiß geworden. Ich entzog mich dem Seegericht, ich verabscheute mich, ich spuckte mich im Spiegel selbst an, ich glaubte vor Scham nicht mehr leben zu können. Mit blutendem Herzen wanderte ich ins Land hinein, ich wollte von der See, auf der ich so Schreckliches erlebt, nichts mehr wissen, ich wollte mein Leben als Tagelöhner fristen, meine Ehre als Seemann gab ich verloren, und –«
Der alte Mann bedeckte seine Augen, er konnte nicht weitersprechen. Dann aber brach er mit einem Mal in ein heiseres Lachen aus:
»Nun kommt das Schönste. Eines Abends saß ich in der Wirtsstube eines kleinen holländischen Dorfes. Da nahm ein Mann die Zeitung vor und las den übrigen Gästen das neueste Schiffsunglück vor. Ich wollte aufspringen und hinauseilen, um meine eigene Schande nicht anhören zu müssen, denn schon hatte ich den Namen meines Schiffes und den meines Kapitäns verstanden, der wie ein Held auf der Kommandobrücke von den Fluten verschlungen worden war, wie wir noch von den Booten aus hatten sehen können. Aber meine Glieder versagten mir den Dienst, wie gelähmt blieb ich auf dem Stuhle sitzen, und da, Himmel und Hölle, hört es, und lacht, lacht, daß Euch die Thränen aus den Augen kommen, da las der Mann einen langen Artikel vor, mit welcher Bravour sich die Matrosen bei dem Untergang betragen hätten, wie sie unzählige Male ihr Leben daran gesetzt hätten, die völlig fassungslosen, zeternden Passagiere ins Boot zu bekommen, wie sie beim Schiff geblieben seien, bis die letzte Mastspitze unter Wasser verschwunden war, wie es ihnen aber doch nicht gelungen, einen einzigen zu retten und so weiter, kurz, vor den Menschen war ich nicht nur ein ehrlicher Kerl, ich mußte ihnen förmlich als ein Held erscheinen.«
»Das ist eine alte Geschichte,« bemerkte der Bootsmann, »das Comptoir, dem das Schiff gehört, wälzt natürlich alle Schuld möglichst von seinen Angestellten, und sind der Kapitän und einige Offiziere ertrunken, so macht es von diesen mehr Geschrei als von hundert Passagieren. Bliebt Ihr auch an Land, Koch?«
»Das eben Gehörte versetzte meinem Entschlusse schon einen gewaltigen Stoß. Ich hatte das Meer lieb, wie ein Kind seine Mutter, ein Jahr im Land, ohne die See zu sehen, wäre mein Tod gewesen. Ich kehrte bald darauf wieder an die Küste zurück und that einen heiligen Schwur, nie wieder auf einem Schiff zu fahren, auf dem andere als richtige Seeleute geheuert würden, überhaupt auf keinem Dampfer mehr, wenigstens so lange nicht, bis sich diese elenden Verhältnisse ändern.«
»Die Konkurrenz ist daran schuld, daß die Schiffscomptoirs so wenig Heuer bezahlen,« meinte einer der Matrosen, »die Passagierschiffe können nur wenig bezahlen, weil die Passagiere nur einen niedrigen Ueberfahrtspreis zahlen wollen.«
»Das ist einfach ein Unsinn oder ein Unfug, dem ein Ziel gesetzt werden muß,« unterbrach ihn der Koch, »welcher Mensch bezahlt wohl nicht lieber zehn Mark mehr und weiß sich dafür unter sicheren Matrosen, die sich lieber die Finger einzeln abbeißen, anstatt daß sie nach dem Riemen greifen, bevor das Boot mit Passagieren besetzt ist, als daß er bei einem Unglück ebensogut unter einer Herde wilder Indianer wäre!«
»Aber, die Todesangst, Koch, die jeden befällt, wenns ans Leben geht, mit der müßt Ihr auch rechnen –«
»Was, Todesangst!« schrie aber der Weißkopf dazwischen. »Seht her, Bootsmann, ich will Euch ein Beispiel geben. Gesetzt den Fall, unser Kapitän, der Weib und Schwester mit an Bord hat, übergebe Euch das Schiff, daß Ihr es nach einem anderen Hafen bringen sollt, wohin er selbst über Land reisen will. Ich sage, er übergiebt Euch das Schiff und seine Ladung, nicht aber seine Angehörigen, die auch an Bord bleiben; aber er denkt in diesem Augenblick nicht an sie. Nun passiert Euch unterwegs auch so ein Unglück, Ihr scheitert und müßt das Schiff verlassen, habt aber in Eurem Boot keinen Platz für die beiden Weiber. Würdet Ihr dann etwa vom Schiffe abstoßen und dann vor Euren Kapitän treten können mit den Worten: Hier sind Eure geretteten Papiere, das Schiff war versichert, also habt Ihr weiter keinen großen Schaden – die beiden Frauen gingen mich nichts an. Könntet Ihr dies, Bootsmann?«
Der Bootsmann wollte eben sagen, daß ihn Gott niemals in eine solche Lage bringen möchte, als an einem Tische nebenan sich ein heftiger Streit entspann.
Zwei fremde Matrosen, anscheinend ein Grieche und ein Neger, hatten Karten gespielt; der Neger hatte immer gewonnen, und der von Wein und Bier sehr erhitzte Grieche hatte ihn als Falschspieler bezeichnet. Wie bei diesen südlichen Völkern gewöhnlich, wurde der an und für sich harmlose Wortwechsel mit großem Geschrei geführt, einige andere Griechen und Farbige nahmen Partei für ihre Kameraden, und im Nu herrschte in der Bierstube ein Spektakel, als wüte ein Handgemenge darin.
Da plötzlich öffnete sich die Hauptthür, und herein trat eine Gruppe von Gestalten, bei deren Anblick teils aus Neugier, teils aus Scheu augenblickliche Stille erfolgte.
»Die Heilsarmee kommt,« rief ein Engländer lachend, »jetzt gebt acht, Jungens, der Weg zum Himmel ist für euch heute abend offen.«
Es waren nur Frauen, welche den ›Schiffsanker‹ aufsuchten, um unter den Matrosen einige verlorene Seelen zu ihrem Gott und Heiland zurückzuführen, alle in eine gleichmäßige, einfache, dunkelblaue Uniform gekleidet und den breitrandigen, schwarzen Strohhut auf dem Kopf, den nur ein rotes Band mit der goldenen Inschrift ›Heilsarmee‹ zierte. Ihre Anführerin trug eine rote Fahne mit weißem Kreuz darauf in der Hand, die nachfolgende eine Pauke und die anderen Tamburins, mit denen sie die gesungenen religiösen Hymnen taktmäßig begleiteten.
Die Heilsarmee erstreckt sich über ganz Amerika und Australien, in Europa ist ihr Hauptsitz England, von wo sie auch ausgegangen ist, und sonst hat sie nur noch in Skandinavien festen Fuß gefaßt; in Deutschland, Frankreich und den übrigen Staaten ist ihr dies kaum in einzelnen Städten gelungen. Sie setzt sich aus Männern und Weibern zusammen, von denen sich erstere Heilssoldaten, letztere Heilsschwestern nennen, stehen unter Kommando von Offizieren beiderlei Geschlechts und sind überhaupt ebenso streng organisiert, wie eine militärische Armee.
Die Heilsarmee hat es sich zur Aufgabe gemacht, ungläubige Menschen in gläubige zu verwandeln und daneben auch auf die Sittlichkeit zu wirken, hauptsächlich aber das Laster der Trunksucht zu bekämpfen.
Ihre Soldaten durchziehen unter klingendem Spiel die Straßen, fliegende Fahnen voran – wie sie überhaupt darauf bedacht sind, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken – schließen dann einen Kreis und halten unter freiem Himmel eine Betversammlung und Predigt ab.
Ebenso gehen sie auch, selbst gegen das Verbot der Polizei, in öffentliche Häuser, wie zum Beispiel Bierstuben, Theater und andere und bemühen sich, die Besucher solcher Lokale von diesen wegzulocken und ihnen für immer abtrünnig zu machen. Da sie aber völlig ohne Schutz dastehen – denn die Organisation ist nur eine Privatsache – so haben sie vielen Spott und heftige Verfolgungen zu erdulden, und nicht zum mindesten die weiblichen Mitglieder. Nicht nur, daß sie mit Worten verhöhnt werden, selbst thätliche Angriffe müssen sie auf den Straßen über sich ergehen lassen, sie werden mit Kot beworfen; wenn sie zum Beten niederknieen, erhalten sie Stöße, daß sie zu Boden fallen, und noch Aergeres geschieht ihnen.
Aber die christliche Religion verbietet ihnen, auch nur an eine Flucht vor Mißhandlungen zu denken, und so halten sie ihren Verfolgern ruhig stand, alles Unrecht mit einem milden Lächeln vergeltend. Wer die Hafenplätze kennt, wie zum Beispiel New-York, London, Sydney und andere, der weiß auch, was sich für ein Gesindel in ihnen aufhält, Männer und Weiber, so tief gesunken, daß die Schilderung ihrer Laster jeder Beschreibung spottet. Gerade mit solchen Leuten verkehren aber die Mitglieder der Heilsarmee, sie beschäftigen sich mit ihnen, wo sie nur können, suchen sie ebenso in den Wirtshäusern, wie in den ärmlichen Wohnungen auf und bemühen sich, ›Seelen zu retten‹, wie sie selbst zu sagen pflegen. Meistens werden die Wohlthaten, die sie den Armen zukommen lassen, mit Undank vergolten, aber sie sind schon zufrieden, wenn sie nur angenommen werden, haben sie dann doch Hoffnung, daß man ihre Predigten auch anhört.
So hatte auch jetzt ein Trupp von Heilsschwestern, durch das wüste Geschrei im Hause herbeigelockt, die Wirtsstube im ›Schiffsanker‹ betreten.
Die Oberin fragte nicht erst, ob es ihr erlaubt sei; ruhig schritt sie nach dem freien Platz inmitten des Zimmers, stellte ihre Fahne aufrecht hin, und sofort bildeten die anderen Schwestern einen Kreis um sie. Ohne weiteres zogen diese, alle noch junge Mädchen, oft sogar aus sehr guter Familie stammend, die Hymnenbücher aus der Tasche und begannen eine geistliche Weise, während sie auf den schellenbesetzten Tamburins trommelten und die Paukenträgerin ihr Instrument taktmäßig schlug.
Die Gäste verhielten sich, wie es ihnen ihre Gemütsstimmung eingab.
Einige waren ruhig sitzen geblieben, darunter der Bootsmann und der Koch der ›Kalliope‹. Andere, denen dieses Schauspiel ein neues war, traten an den Kreis und hörten zu, und wieder andere hatten sich wohl auch zu den Zuschauern gesellt, aber nur, um über das Benehmen der Schwestern Witze zu reißen.
»Seht nur,« sagte der eine, anscheinend ein Spanier, »wie sie beim Singen die Augen schließen! Ob sie so wohl ihren Gott besser sehen können?«
»Nein!« lachte neben ihm ein Engländer. »Dich und deine Galgenphysiognomie wollen sie nicht sehen, sonst könnten sie blind davon werden. Wie das Mädel da das Kalbfell bearbeitet, gerade als hätte es Unterricht bei einem Regimentstambour genommen.«
»Paßt auf!« lachte wieder der Spanier. »Ich weiß einen herrlichen Spaß. Sie sprechen immer vom Teufel, und ich werde ihnen einmal einen Teufel anhängen.«
Er ging zum Wirt und ließ sich Kreide und einen Lappen geben.
Der Bootsmann hatte unterdessen schon verschiedene Male nach einem neuen Glas Bier gerufen, aber die beiden Kellnerinnen hatten jetzt keine Zeit. Die Schwestern spielten und sangen eben eine jener Hymnen, wie sie in England gebräuchlich sind, und sofort hatten die beiden Mädchen herausgefunden, daß es sich darnach tanzen ließe. Partner waren unter den Matrosen gleich gefunden, sie faßten sich, und Paar um Paar walzte um den Tisch herum.

»Verrückte Weibsbilder!« brummte der Bootsmann. »Auf der einen Seite wird gebetet und gesungen, und auf der anderen wird gelacht und getanzt. So etwas ist eben nur in einem englischen oder amerikanischen Hafen möglich.«
»Ich kenne das,« sagte der Koch. »Wenn solche Mädchen begraben werden, und die Leichenkapelle spielt einmal etwas schneller, dann fangen sie noch im Sarge an zu trampeln.«
»Wenn sie wenigstens ihre Arbeit dabei nicht vergessen und mir Bier bringen wollten! Ehe ich an Bord gehe, muß ich noch eins trinken, aber diese Heilsarmee hat alles außer Rand und Band gebracht. Eine ganz hübsche Geschichte, ja, aber für Seeleute paßt sie nicht. Die haben gut predigen, daß man keine Spirituosen trinken soll; aber sie sollten sich einmal so die ganze Nacht den eisigen Sturm um die Ohren sausen lassen, und dann solltet Ihr einmal sehen, mit welchem Behagen sie ein Glas Brandy hintergießen würden.«
Der Bootsmann stand auf, um sich selbst ein Glas Bier zu holen.
Als er mit dem vollen Glas an der Gruppe der Heilsschwestern vorbei mußte, welche eben auf den Knieen lagen und beteten, sah er, wie der Spanier von vorhin einem der Mädchen einen Lappen auf den Rücken drückte, und als er ihn wieder emporhob, war auf dem dunklen Kleide ein gehörnter Teufelskopf zu sehen.
Die meisten der Umstehenden brachen in ein lautes Gelächter aus, während die Knieende, welche laut betete, sich nicht stören ließ, obgleich sie wohl gemerkt hatte, daß eben ein Streich an ihr verübt worden war.
»Hört, Kameraden,« sagte der Spanier, »sie sagt ja gerade, daß sie ihren Schuldigern vergeben will. Dann kann ich ihr ja noch einen Teufel auf die andere Seite setzen.«
Wieder malte er mit der Kreide einen Teufelskopf auf den Lappen.
Der Bootsmann hatte dieser Szene beigewohnt, und in seinem ehrlichen Herzen stieg der Zorn über eine solche Verspottung auf. Er ging auf den Spanier zu und nahm ihm ruhig die Kreide aus der Hand.
»Unterlaßt dies,« sagte er ernst zu dem Spanier, der ihn erst verblüfft anstarrte, »macht meinetwegen solche Kindereien an Bord Eures Schiffes, aber wenn Ihr in einem Lokale seid, wo anständige Seeleute verkehren, so gebe ich es nicht zu!«
Der Spanier stieß einen langen Pfiff aus und sah sich im Kreise um, überall begegnete er gelben, zerfetzten Gesichtern.
»Anständige Seeleute,« sagte er langsam, dann aber brach seine Wut hervor. »Zum Teufel mit Euch! Wer seid Ihr denn eigentlich, daß Ihr es wagt, Euch in meine Geschäfte zu mischen? Verdammt will ich sein, wenn ich mir das gefallen lasse!«
»Verdammt wollt Ihr sein? Dazu kann ich Euch bald verhelfen,« spottete der Bootsmann in ruhigem Tone und setzte das Glas Bier auf den Tisch. »Wenn Ihr etwas von mir wollt, sagt es nur; ich werde Euch keine abschlägige Antwort, aber jedenfalls eine sehr treffende geben.«
»Hund,« brüllte der Spanier, vor Wut zitternd, »ich werde –«
Er erhielt von dem Bootsmann einen Faustschlag, daß er mitten zwischen die Schwestern geschleudert wurde, die jetzt eilends den Raum verließen; solcher Streit war ihre Sache nicht, sie gingen ihm überall aus dem Wege.
»Das habt Ihr erst einmal für Euren Hund,« rief der Bootsmann. »Benehmt Euch höflicher, und ich werde auch höflicher mit Euch verfahren.«
Der Spanier hatte sich schon wieder aufgerafft und stürzte auf den Bootsmann zu. Schreiend flüchteten die Kellnerinnen hinter die Bar, der dicke Wirt suchte seinen behäbigen Körper hinter einem Bierfaß zu verstecken, und auch die deutschen Matrosen schrieen um ihren Kameraden auf, denn in der erhobenen Hand des Spaniers, der mit einem Sprunge vor dem Bootsmann stand, funkelte ein langer Dolch.
Doch dieser wich nicht einen Zoll zurück. Als der Dolch gleich einer blauen Flamme herabfuhr, fing der Deutsche das Handgelenk des Gegners geschickt auf, eine Bewegung, der Arm knackte in der Kugel, und der Spanier wand sich mit ausgerenktem Arm am Boden.
»Nummer eins,« lachte der kampfgeübte Seemann, »hat sonst noch jemand Lust, sich mit dem Bootsmanne der ›Kalliope‹ zu messen?«
Da drängte sich ein grauhaariger Mann hervor, ebenso wie der Besiegte einäugig, und jedenfalls ein Spanier.
»Wie könnt Ihr es wagen, verdammter Deutscher, einen meiner Leute anzufassen. Ich bin Kapitän, versteht Ihr das?«
»Ihr seid ebenso ein einäugiger Spitzbube,« schrie der Bootsmann, den jetzt die Ruhe verließ. »Kommt her! Ihr sollt dem anderen Gesellschaft leisten.«
Plötzlich gellten überall Pfiffe, wie auf Kommando sprangen alle Spanier, Griechen, Farbige und so weiter, auf und rissen verborgene Dolche heraus, um sich auf den Bootsmann zu werfen, aber unterdessen waren die im Zimmer anwesenden Deutschen und Skandinavier auch nicht müßig gewesen. Gleichzeitig knackte es überall, als wenn Stuhlbeine abgebrochen würden, und im nächsten Augenblicke sausten die hölzernen Waffen auf die Schädel der Messerhelden.
»Hinaus mit den Halunken!« brüllte der Bootsmann. Er packte den Spanier, ehe dieser Gebrauch von seinem Dolch machen konnte, und warf ihn, da er näher dem Fenster als der Thür stand, mit einem Schwunge durch die klirrenden Fensterscheiben.
»Hinaus mit ihnen!« brüllten auch die anderen, und im Nu war das Lokal von allen den Gästen gesäubert, die nach dem Messer gegriffen hatten. Nur einige gelbe Gesichter waren zurückgeblieben, und diese besonders streifte des Bootsmanns Blick, als er, den letzten mit einem Fußtritt hinausbefördernd, sagte:
»Weiter fehlte nichts, als daß in einer Matrosenschenke jeder nach dem Messer greifen könnte. Was war das eigentlich für eine Mannschaft?« wandte er sich an den Wirt. »Die scheinen ja alle direkt aus dem Zuchthaus entsprungen zu sein.«
»Die Mannschaft vom ›Friedensengel‹, Kapitän Fonsera,« entgegnete dieser, »das Schiff ladet Korn ein.«
»›Friedensengel‹,« lachte der Bootsmann, »›Höllenteufel‹ sollte es heißen. Aber warum gebt Ihr überhaupt solchem Gesindel Zutritt in Euer Haus, was hier in Sydney als das anständigste gilt? Weißt sie doch einfach von Eurer Thür.«
»Du lieber Gott,« seufzte der Wirt, »ich muß von meinen Einnahmen leben, und gerade die Matrosen vom ›Friedensengel‹ geben ein schönes Geld bei mir aus.«
»Ja, und andere bleiben dafür weg, die nicht mit solchen Leuten verkehren wollen.«
»Nehmt Euch in acht,« sagte der Koch zum Bootsmann, als dieser wieder an seinem alten Platz angelangt war. »Die Matrosen dieser Bark hängen wie die Kletten zusammen, nie habe ich einen ohne den anderen gesehen. Diese Spanier sind rachsüchtige Naturen, ein Menschenleben gilt ihnen verdammt wenig.«
»Gut, daß ich's nun weiß,« lachte der Bootsmann gleichgiltig, »dann brauche ich das nächste Mal meine Faust auch weniger zu schonen. Ich will einen nach dem anderen mit blutigem Kopf heimschicken, daß ihnen Hören und Sehen vergehen soll.«
Es war wieder Stille in dem Zimmer eingetreten, den zurückgebliebenen südländischen Matrosen war es unheimlich geworden, als sie gesehen, wie ihre Kameraden eine solche Lektion erhalten hatten, und, obgleich wahrscheinlich von anderen Schiffen, entfernten sie sich nach und nach stillschweigend. Nur die Engländer, welche auf die Spanier auch nicht gut zu sprechen waren, blieben zurück und schimpften weidlich auf alles dies Gesindel, welches die ganze Seemannschaft in Verruf bringt.
Wehmütig blickte der Wirt jenen nach, er trug ja dabei den größten Schaden, und sein Gesicht nahm erst wieder einen freudigen Ausdruck an, als sich abermals von außen die Thür öffnete. Aber es trat nur eine Negerin mit einem Körbchen ein.
»Hollah, Topsy, willst du tanzen?« rief ein englischer Matrose dem schlanken, hübschen Mädchen zu, das mit schelmischem, etwas kokettem Lächeln sich im Kreise der Seeleute umsah.
»Wenn es die Herren erlauben,« entgegnete sie in fließendem Englisch. »Aber ich muß mich erst umziehen.«

Sie war in ein einfaches, aber anständiges Kattunkleid gehüllt, und die Gäste verstanden deshalb nicht, was sie meinte.
»Gehe da in die Kammer, mein Kind,« sagte wieder der Engländer. »Dort bist du ungestört, und der Wirt erlaubt dir es schon.«
Die Negerin verschwand durch die bezeichnete Thür.
»Bei Gottes Tod!« rief der Bootsmann erstaunt. »War das nicht die tolle Topsy, die ich noch vor vierzehn Tagen in Perth an der Westküste von Australien habe tanzen sehen?«
»Ich kenne sie nicht als Tänzerin,« sagte der Wirt. »Ich habe sie heute abend zum ersten Male gesehen,«
»Stimmt schon,« lachte der Engländer, »es ist wirklich die tolle Topsy, erst gestern ist sie auf unserem Schiffe hier angekommen. Der Boden ist ihr drüben zu heiß geworden, sie führte täglich mehr Streiche aus, als der Tag Stunden hat. Schließlich kam sie aber in Streitigkeiten mit der Polizei, und diese beobachtete sie scharf. Als wir von Perth abfahren wollten, beschwor sie uns hoch und heilig, sie mit nach Sydney zu nehmen, aber der Kapitän schlug es ihr natürlich rundweg ab. Der Kapitän lichtete des Abends die Anker, hatte noch einige Stunden an Deck zu thun, und als ihn dann der Steward zum aufgetragenen Nachtessen rief und er eine Viertelstunde später in die Kajüte kam, da saß bereits Topsy auf seinem Stuhl und ließ eben den letzten Rest des Schinkens hinter ihren weißen Zähnen verschwinden.«
»Ja, es ist ein tolles Mädchen, diese Topsy,« sagte der Bootsmann, »ich kenne sie auch. Und merkwürdig ist es, wie schnell sich verwandte Seelen zu finden wissen. Da haben wir einen Leichtmatrosen an Bord, er heißt Hannes, das ist auch so ein lustiger Vogel. Der sieht die Topsy nur einmal tanzen, und gleich sind die beiden ein Herz und eine Seele. Ich hatte den Bengel schon stark im Verdacht, daß er der Schwarzen wegen in Perth vom Schiff laufen würde, und ich behielt ihn höllisch im Auge. Aber nun glaube ich, er wußte schon, daß Topsy hierherkommen würde, und blieb deshalb ruhig an Bord.«
In diesem Augenblicke wurde die Thür aufgerissen, und ein blutjunger, hübscher Matrose stürzte in das Zimmer.
»Bootsmann,« rief er schon im Thürrahmen und rannte auf den Angerufenen zu, nachdem er schnell einen Blick auf die Gäste geworfen hatte, »Gott sei Dank, daß ich Euch gefunden habe! Helft mir, versteckt mich, oder ich sitze morgen in Eisen, die englische Polizei ist hinter mir her, gleich müssen die Bobbys hier sein!«
»Was hast du denn wieder gemacht, Unglücksmensch?« fragte der Bootsmann.
»Laßt das jetzt, habe einen Policeman, der mich fassen wollte, niedergeschlagen; nur schnell fort mit mir,« drängte der Bursche.
Der Bootsmann warf einen fragenden Blick nach dem Wirt, aber dieser kam kopfschüttelnd hinter seiner Bar hervor und sagte energisch:
»Nichts da! Mit solchen Sachen lasse ich mich nicht ein. Wird er von der Polizei verfolgt, so kann ich ihn nicht in meinem Hause verbergen, sonst muß ich morgen die Schänkstube schließen und bin ein ruinierter Mann.«
»Hannes,« flüsterte der Bootsmann dem Leichtmatrosen zu, »dort in der Kammer ist Topsy, du bist ja gut Freund mit ihr.«
»Hip hip hurrah!« schrie der lustige Bursche und war mit einem Satz an der Thür – sie war verschlossen.
»Topsy, mach' auf,« flüsterte er durchs Schlüsselloch. »Mach' auf, aber schnell!«
»Wer ist draußen?« fragte eine Stimme. »Ich ziehe mich um.«
»Hannes ist's, dein Hannes, schnell, mach' auf, die Polizei verfolgt mich!«
Die Thür öffnete sich, der Bursche drehte sich noch einmal um und rief:
»Good bye, Glück muß man im Unglück haben!«
Dann schlüpfte er durch die schmale Spalte hinein.
Im nächsten Augenblicke ertönten schnelle Schritte draußen auf dem Korridor, und mehrere englische Konstabler traten in die Bierstube.
»Ist hier eben ein Mann hereingekommen?« fragte der erste von ihnen, nach den Gästen zugewendet.
Niemand achtete auf seine Frage, gleichgültig unterhielten sie sich weiter, aber der Wirt trat heran und sagte:
»Nein, niemand, den ich gesehen hatte, ich bin allerdings eben aus dem Keller gekommen. Suchen Sie jemanden?«
»Ja, einen englischen oder deutschen Matrosen, der uns unterwegs entsprungen ist. Er muß unbedingt in diesem Hause sein, ich selbst habe ihn hereinfliehen sehen. Gestehen Sie es, Wirt, Sie halten ihn versteckt!«
»Wie werde ich?« entgegnete der Mann entrüstet. »Durchsucht mein ganzes Haus, meines Wissens ist hier niemand hereingekommen. Habt Ihr jemanden gesehen, Bootsmann?«
»Was kümmert's mich, ob die Polizei jemanden sucht oder nicht!« brummte dieser mürrisch. »Wenn ich nur in Ruhe gelassen werde.«
»So muß ich Ihr Haus durchsuchen lassen,« erklärte der Konstabler bestimmt. »Ich habe ihn hier herein fliehen sehen, das Gebäude ist bereits umstellt, heraus kann er also nicht und ist unbedingt darin. Thut Eure Pflicht, Leute!«
Die Konstabler gingen erst in den Keller, durchsuchten diesen, kamen wieder herauf und stiegen die Treppe empor, um in den Privatzimmern des Wirtes nach dem Flüchtling zu forschen.
Ihr Anführer ließ sich einstweilen nach längerem Nötigen ein Glas Bier aufdrängen und trank es verborgen hinter der Bar.
»Was hat denn der Matrose eigentlich gemacht, daß Sie so scharf hinter ihm her sind?« fragte neugierig der Wirt.
»Eigentlich nichts weiter von Bedeutung. Auf dem Marktplatze standen einige Frauen und feilschten um einen Korb Melonen. Die eine wurde von einer hinzukommenden Freundin angesprochen, drehte sich um und kam nun mit dem Rücken an ein anderes Weib zu stehen. Dieses bemerkte ein Matrose, und aus Schabernack nähte er die beiden alten Frauen mit ein paar Stichen zusammen, das Gedränge machte dies leicht möglich, aber –«
Der Bootsmann und die anderen Gäste hatten die Erzählung des Konstablers mit angehört und brachen in ein lautes Gelächter aus, in das auch der Konstabler schließlich mit einstimmen mußte.
»Wie gesagt,« fuhr er fort, »das hatte ja nichts zu bedeuten, aber ein Mann, der einen hohen Cylinder auf hatte, bemerkte es und bezeichnete den beiden schimpfenden Frauen den Matrosen als Thäter dieses Streiches. Als Belohnung für diese Aussage trieb der junge Bursche dem Mann den Cylinder bis über die Ohren und wollte sich schleunigst entfernen, doch das Zetergeschrei des Herrn rief einige Konstabler herbei, und nun beging der Matrose die Unklugheit, einen davon über den Haufen zu rennen, um sich durch Flucht der Gefangennahme zu entziehen. Nun allerdings kann es ihm übel ergehen, wenn wir ihn bekommen.«
»Ja, wenn,« brummte der Bootsmann vor sich hin und warf einen Blick nach der Thür.
Der Konstabler war ein gewiegter Polizeibeamter, er hatte wohl eine Ahnung, daß die Gäste, wie auch der Wirt, mehr von dem Flüchtling wußten, als sie zugeben wollten, und hatte den Blick des Seemannes aufgefangen. Sofort schritt er nach der Thür und wollte sie öffnen.
»Wer ist darin?« fragte er, als er sie verschlossen fand.
»Eine schwarze Tänzerin, die sich umziehen will,« antwortete der Wirt ruhig, aber das Herz begann ihm doch schneller zu schlagen.
Auch dem Bootsmann stieg das Blut in den Kopf.
»Was ist es für ein Zimmer?«
»Vollkommen kahl, kein Stuhl, kein Bett, nichts ist darin, und die Fenster sind stark vergittert, weil ich früher meinen Vorrat an Spirituosen darin aufbewahrte.«
Der Konstabler überlegte.
»Es ist gleich,« sagte er dann. »Meine Pflicht gebietet, daß ich mich überzeuge.«
Er klopfte mehrere Male an die Thür, anfangs vergeblich, bis er heftig mit dem Fuße dagegentrat.
»Ich komme gleich,« sagte eine helle Stimme, »gedulden Sie sich nur noch einen Augenblick, meine Herren!«
»Ach was,« rief der Konstabler, »ich will dich nicht tanzen sehen! Aufgemacht, vorwärts, die Polizei verlangt es.«
Dem Bootsmann stockte der Atem, als er jetzt einen Schlüssel im Schloß drehen hörte und die Thür etwas öffnen sah – jetzt war sein Hannes geliefert, denn schon steckte der Konstabler den Kopf durch die Spalte und überflog den kahlen Raum.
Aber wunderbar, gleich drehte er wieder um und warf die Thür hinter sich ins Schloß.
»Niemand weiter darin, als eine halbnackte Negerin und ein Haufen Lumpen, die sie ausgezogen hat,« sagte er. »Wenn die Leute den Kerl nicht oben bei Ihnen gefunden haben, so marschiere ich ab.«
Seine Untergebenen mußten aber sehr genau oben suchen, denn es vergingen noch zehn Minuten, ohne daß sie herunterkamen, und der Konstabler wurde schon unruhig.
Da öffnete sich abermals die Gaststubenthür, und ein Haufen englischer Seeleute kam herein, alle stark angetrunken.
»Ist Topsy hier?« brüllten sie. »Die Schwarze wollte heute abend hier tanzen. Wo ist das Mädchen, her mit ihm!«
Der Wirt durfte keine Ausrede machen, wenn er den Konstabler nicht mißtrauisch stimmen wollte, und so sagte er die Wahrheit.
Die Seeleute donnerten gegen die Thür und verlangten, sie solle herauskommen, und als sie nicht gleich eine Antwort bekamen, drohten sie die Thür einzutreten.
»Ich komme gleich, in einer Minute,« erwiderte die Stimme der Negerin.
Wirklich kam sie auch nach einiger Zeit heraus.
Sie hatte nur ein kurzes, bis an die Kniee reichendes Röckchen an, welches mit bunten Federn, Bändern, Glasperlen und so weiter besetzt war. Unterschenkel und Arme waren bloß, und um den Kopf hatte sie einen roten Turban geschlungen.
»Alle Wetter,« lachte einer der Engländer, »du hast dich ja heute verflucht anständig angezogen, Topsy, in Perth war das doch sonst deine Art gar nicht.«
Die Schwarze zeigte lachend die weißen Zähne.
»In Perth war es heißer als hier,« erwiderte sie, »in Sydney muß man sich wärmer anziehen, sonst –«
»Sonst bekommt man wieder die Polizei auf den Hals,« unterbrach sie der Matrose. »Ja, ja, wir kennen das. Los, Topsy, tanz' uns die Hornpipe, oder besser tanze uns einen ordentlichen Step vor und singe ein braves Lied, bei dem wir den Refrain singen können!«
Die Schwarze schwang rasselnd das Tamburin im linken Arm, ließ dann den Daumen der anderen Hand trommelnd über das gespannte Kalbfell gleiten und begann mit ihrer hellen, nicht unangenehm klingenden Stimme einen englischen Gassenhauer zu singen, der langsam anfing und dann mit der schnellen, abgerissenen Stepmelodie endete, wozu sie tanzte.

Der Step ist ein den Engländern und Amerikanern eigentümlicher Tanz und wird hauptsächlich von Seeleuten gepflegt. Man dreht sich dabei nicht, sondern bewegt sich nur auf der Stelle, und zwar, indem man Hacken und Zehen abwechselnd den Boden berühren laßt. Es giebt unzählige Variationen vom Step, je nachdem der Boden ein-, zwei- oder dreimal mit der Fußspitze berührt, mit der Hacke gestampft wird, und je schneller der Tänzer die Bewegungen ausführt. Ein guter Steptänzer, wie man sie besonders unter amerikanischen Matrosen, auch unter Negern findet, schlägt den Takt zu der schnellsten Melodie rhythmisch und in den verschiedensten Variationen so rasch, daß man den Bewegungen der Füße nicht mehr folgen kann.
Topsy war jedenfalls eine Meisterin in diesem Tanz. Die Matrosen konnten den Refrain, nach dem sie tanzte, so schnell singen, wie sie wollten, sie konnten plötzlich halten und langsam fortfahren, stets bearbeiteten die Füße der Negerin taktmäßig den Boden. Graziös neigte sie dabei den schlanken Körper hin und her, das Tamburin über dem Kopf haltend und demselben rasselnde Töne entlockend, und hatte sie sich während des Tanzes absichtlich nach vorwärts bewegt, so sprang sie bei ihrem Gesang mit zierlichen Sätzen wieder zurück.
Der Bootsmann beachtete die Tänzerin nicht viel, ihm war dies Schauspiel etwas Altes, umsomehr aber bebachtete er den Konstabler, der jetzt mit seinen Leuten sprach und sich über ihr erfolgloses Suchen Bericht erstatten ließ.
Schon wollte sich der Polizist entfernen, als er wieder umdrehte und in die Kammer ging, in der sich die Negerin umgezogen hatte, und in der auf jeden Fall Hannes versteckt sein mußte, wahrscheinlich, dachte der Bootsmann, unter den Kleidern Topsys.
Der Konstabler ging also hinein, und verwundert hörte der Bootsmann, wie jener mit einer Frau sprach. Als er wieder herauskam schritt er nach der Bar und sprach noch einmal mit dem Wirt, er sah nur, wie dieser ein etwas verblüfftes Gesicht zog, dann aber mehrere Male bejahend nickte; was beide sprachen, konnte der Bootsmann leider nicht verstehen, denn eben hatte Topsy aufgehört, und ein brüllendes Bravorufen der englischen Matrosen machte jeden anderen Laut unvernehmbar.
Langsam schritt der Konstabler auf Topsy zu, die in dem Tamburin eben den Lohn für ihre Leistungen einsammelte.
»Seit wann bist du denn hier, Topsy?« fragte der Konstabler.
»Seit gestern, Herr,« antwortete Topsy, machte einen Knix und hielt dem Polizeibeamten ebenfalls das Tamburin hin.
»Wer ist denn die andere Schwarze da drinnen?« fragte der Beamte weiter.
Die Gäste horchten auf.
»Ebenfalls eine Tänzerin, die mit mir aus Perth gekommen ist,« entgegnete Topsy unbefangen, machte wieder einen Knix und wollte gehen.
»Topsy,« rief der Konstabler, und als die Gerufene wieder umdrehte, hob er ihr mit der Hand den Kopf in die Höhe, »sag mal, mein Kind, wo – alle Wetter, die färbt ja ab,« unterbrach er sich und griff nach der Negerin.
Diese war aber schneller als er. Klatschend flog ihm das Tamburin ins Gesicht. Die anderen Konstabler sprangen hinzu, aber mit einem Luftsprung setzte die Tänzerin über ihre Köpfe hinweg und stand auf dem Fensterbrett.
Man hörte noch ein helles Lachen, dann war die schwarze Gestalt in dem bunten Kleidchen verschwunden.
An einer Wassertreppe des Hafens von Sydney landete ein Mietsboot und setzte zwei elegant gekleidete Damen ans Ufer, und gleichzeitig fuhr eine Equipage vor, welche die beiden aufnahm.
»Horsestreet Nummer 4,« rief das ältere der jungen Mädchen dem Kutscher zu, und als dieser bei Nennung des Namens verwundert zu zögern schien, gab sie nochmals die Adresse an.
»Jedenfalls so eine Art von barmherzigen Schwestern der inneren Mission,« brummte er, als er seine Rosse umlenkte, und der elenden Vorstadt, in welcher die genannte Straße lag, zufuhr.
Ellen und Miß Hope Stannion waren es, welche in dem Wagen Platz genommen hatten. Die letztere, ein sonst so lustiges, ja ausgelassenes Mädchen, war heute recht niedergeschlagen. Das niedliche Gesichtchen hatte einen so schwermütigen Ausdruck, und der Anblick der bunten, wühlenden und sich drängenden Menschenmenge, die die breiten Straßen der großen, fremden Stadt belebte und ihr sonst immer Ausrufe der Bewunderung und der Freude entlockt hatten, vermochten heute ihr trauriges Auge nicht zu fesseln.
Beide hatten eine Zeit lang stumm nebeneinander gesessen, jede mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt. Es war, als ob Ellen das Schweigen schon öfters hätte brechen wollen, denn sie räusperte sich zu wiederholten Malen, aber ein Blick auf die niedergeschlagenen Züge ihrer jungen Gefährtin, deren sie sich stets wie eine Mutter annahm, ließ nie das richtige Wort über die Lippen kommen.
Endlich raffte sie sich aber mit einem plötzlichen Entschluß auf und sagte in liebreichem Tone:
»Es muß sein, Hope! Ich habe noch nie mit Ihnen darüber gesprochen; da Sie nun aber wissen, wohin unsere Fahrt geht, so ist es jetzt Zeit.«
»Ach,« seufzte das junge Mädchen, »warum haben Sie mich denn überhaupt mitgenommen; ich vermag ja dabei gar nichts zu thun. Wenn alle Ermahnungen und Bitten derjenigen Verwandten, mit denen sie früher in Verkehr gestanden, nichts bei ihr halfen, wie soll sie dann auf mich hören?«
»Aber es ist doch Ihre Pflicht, wenigstens das Möglichste zu versuchen.«
Hope schüttelte traurig den kleinen Kopf.
»Ich kenne sie besser als Sie, Miß Petersen, ich habe viel von ihr hören müssen, als meine Eltern noch lebten, obgleich sie es mir immer verschweigen wollten. Aber durch zufällig erlauschte Gespräche, durch aufgedrungenes Geschwätz der Dienerschaft, wurde ich schon als Kind mit den Verhältnissen meiner Tante bekannt, und nach dem Tode meiner Eltern mußte mich mein Bruder wegen Regelung von Geldangelegenheiten vollkommen über diese Person aufklären, welche alle ihre Verwandten mit solcher Schande befleckt.«
Ellen stellte noch einige Fragen an das junge Mädchen, so zartfühlend wie möglich, bis sie sich vollkommen über die Person orientiert hatte, die sie besuchen wollten.
Mistreß Forbes war von mütterlicher Seite die Tante von Hope Staunton, war aber von der Natur nicht mit den edlen Anlagen ausgestattet worden, wie ihre Schwester, die Mutter Hopes, sondern besaß alle Untugenden, welche dieser fehlten: Eitelkeit, Hoffahrt und einen alles übersteigenden Leichtsinn. Nur eins hatte sie mit ihrer Schwester gemeinsam, aber zu ihrem Unglück, weil es ihre Untugenden noch unterstützte – ihre Schönheit.
Das Mädchen heiratete noch sehr jung einen reichen Engländer, der sich zum Besuch in Amerika aufhielt, und kehrte mit diesem als Mistreß Forbes nach England zurück. Hatte sie unter Aufsicht der strengen Eltern ihrer Putzsucht Zügel anlegen müssen, so ließ sie derselben als junge Frau freien Lauf, denn ihr Gatte war zu verliebt in sie und zu schwach, um ihr gegenüber energisch aufzutreten.
Nach einigen Jahren erkannte der Mann, wie thöricht er gehandelt hatte, als er seiner Gemahlin völlig freien Willen ließ, als er ihren Schmeicheleien traute, mit denen sie ihn über die Summen zu täuschen suchte, welche sie mit der größten Verschwendung vergeudet hatte; er erkannte erst jetzt, daß sie eine Person war, die der strengsten Aufficht bedurfte, daß sie ohne eine starke Hand ein schwankendes Rohr war, welches der Wind bald hierhin, bald dorthin wehte, aber es war schon zu spät – als Ehrenmann forderte er alle die zahllosen Rechnungen ein, die seine Frau in den Jahren hatte anwachsen lassen, bezahlte sie und sah sich an dem Rande seines Ruins.
»Was ist das weiter,« sagte das sorglose Weib, welches die Verzweiflung ihres Gatten nicht begreifen konnte, »das Vermögen, was ich mitbekommen habe, beträgt noch einmal so viel, denke, du hättest die Schulden mit meinem Gelde bezahlt.«
Furbes aber nahm das angebotene Vermögen nicht. Es war nicht das Geld, dessen Verlust ihn so schmerzte, sondern die Erkenntnis des Weibes, an das er sich für immer gefesselt hatte, welches er wohl bisher für etwas putz- und genußsüchtig, aber nie für eine Person gehalten, die ihn hintergehen konnte, ja, die sich sogar unrechter Mittel bediente, wenn sie in den Besitz eines gewünschten Gegenstandes kommen wollte. Die Bezahlung der Rechnungen hatte ihm die Augen darüber geöffnet.
Der getäuschte Ehemann nahm sich mit aller Kraft zusammen, keinen Pfennig vom Vermögen seines Weibes wollte er berühren, mit eigener Kraft wollte er sich wieder emporarbeiten, aber der Tod machte einen Strich durch seinen Plan – nach einigen Tagen wurde er von einem Schlaganfall dahingerafft, als seine Gattin mit ihren gleichgesinnten Freundinnen lustig auf einem Feste tanzte.
Mistreß Forbes war nun Witwe und, nicht einmal mehr die mahnende Stimme ihres Mannes hörend, stürzte sie sich mit toller Freude in die Genüsse des Lebens. Nach einigen Jahren war ihr eigenes Vermögen auch dahin; sie wäre in die bitterste Armut geraten, denn ihre Verwandten wollten bereits nichts mehr mit ihr zu thun haben, als ihre Mutter starb – zu ihrem Glücke, wie sie lachend sagte – aber sie war außer sich vor Zorn, als sie bei der Testamentseröffnung einige Klauseln fand, welche sie im Genusse des Erbteils einschränkten. Die erste Bedingung war, daß sie nur die Zinsen monatlich ausgezahlt bekam, und dann die zweite, daß sie fernerhin weder in England, noch in den Staaten ihres Heimatlandes, Nordamerika, leben dürfe.
Kurz entschlossen zog sie nach Sydney und begann hier bald ein Leben, wie es verworfener eine Straßendirne nicht hätte führen können. Es war auch zwischen ihr und einer solchen kein Unterschied mehr.
Wenn sie jeden Monat ihre Rente empfing, bestehend aus sechzig Pfund Sterling, also zwölfhundert Mark, so löste sie die versetzten Sachen aus dem Pfandhause ein, mietete eine elegante Wohnung und führte nun für einige Tage mit einem gerade begünstigten Liebhaber ein lustiges Leben. Mit seidenen Kleidern geschmückt, fuhr sie als Miß Forbes durch Sydney; Champagnergelage wechselten ab mit üppigen Festlichkeiten, und war das bare Geld alle, so ging es an das Versetzen der Wertsachen, bis gewöhnlich nach acht Tagen auch das letzte wieder im Pfandhaus war. Dann bezog sie wieder, jetzt natürlich von ihrem Geliebten verlassen, ihre elende Wohnung in der Horsestreet und verbrachte während drei Wochen ein Hungerleben, nährte sich durch Betteln und Schwindeln, froh, wenn sie jeden Tag einiges Geld für Branntwein auftreiben konnte. Noch lieber aber war es ihr, wenn sie es gerade so einrichten konnte, daß sie diese schlechte Zeit im Arbeitshause zubringen konnte, um nicht für ihr Unterkommen sorgen zu müssen, und daß dies oft geschah, dafür sorgte die Polizei.
Schon verschiedene Male hatte die Heilsarmee es versucht, diese Frau zu einem vernünftigen Leben zurückzuführen, aber immer wurden ihre Versuche mit Hohnlachen abgewiesen. Nur einmal schien es den Schwestern gelungen zu sein, das erstarrte Herz zu rühren.
Mistreß Forbes, gerade dem Hungertode nahe, schenkte den Bitten der Schwestern Gehör, ließ sich erst in ihr Quartier bringen, wo sie mit Nahrung und allem nötigen versehen wurde, und folgte dann auch in einer Prozession nach einem Bethaus der Heilsarmee, in dem sie ihre Bekehrung öffentlich bekennen sollte.
Sie sprach die Formel, welche ihr vorgesagt wurde, nach, als sie dann aber ein geistliches Lied singen sollte, stimmte sie Gassenhauer an, und die Heilsarmee machte seitdem keinen Versuch mehr, sie für sich zu gewinnen.
»Sie selbst haben mir nie von Ihrer Tante erzählt,« begann nach einer Weile Ellen wieder, »aber ich habe zufällig von dieser Verwandtschaft erfahren. Wissen Sie auch, was mich dazu treibt, diese Forbes zu besuchen?«
Hope verneinte.
»Heute morgen war eine Schwester der Heilsarmee bei mir, und diese kam im Auftrage der Mistreß Forbes. Sie ließ sagen, sie wäre todkrank, und da sie erfahren hätte, daß viele amerikanische Damen in Sidney wären und sie auch eine Amerikanerin sei, so bitte sie wenigstens eine um ihren Besuch. Wenn es wirklich schlimm mit ihr steht, so müssen Sie die erste sein, welche an ihr Bett kommt, wenn auch alle verwandtschaftlichen Bande zerrissen sind, deshalb habe ich Sie mitgenommen.«
»O, glauben Sie nicht alles, was Ihnen diese Frau sagt,« entgegnete Hope, »sie will nur jemanden zu sich locken, um Geld von ihm zu bekommen. Hat Ihnen dies nicht auch die Heilsschwester gesagt?«
»Nein, ihre Regel verbietet es ihnen streng, daß sie etwas über jemanden aussagen, was ihm schaden könnte. Sie glauben also nicht, daß Ihre Tante wirklich sehr krank ist?«
»Es kann ja sein, warum nicht? Aber eine solche Erkrankung bis zum Tode hat sie schon oft geheuchelt, um bei jemandem Mitleid zu erregen. Vor einem halben Jahre war mein Bruder, der Korvettenkapitän, hier, und Mistreß Forbes lockte ihn unter demselben Vorwande zu sich. Vom Sterben war bei ihr nichts zu merken, sie wollte von meinem Bruder zuerst eine große Summe haben, nur geborgt, wie sie sagte, dann handelte sie immer mehr herunter, bis sie endlich nur um einen Penny bat, um sich dafür Branntwein kaufen zu können.«
»Und was that Ihr Bruder?«
»Er hinterließ der Heilsarmee Geld, daß sie für das Weib sorge, ihr selbst gab er nichts in die Hände!«
»Ebenso würde ich handeln; die Schwester, welche mich aufsuchte, sagte mir, sie würde bei der angeblichen Kranken zu finden sein.«
Der Wagen bog in eine enge, schmutzige Straße und hielt vor einem halbverfallenen Hause.
Die Damen stiegen aus und tasteten sich in dem dunklen Flur – es wurde bereits Abend – eine schmale Treppe hinauf, auf dessen Geländer der Staub fingerhoch lag. Noch ehe sie die erste Etage erreicht hatten, öffnete schon ein Mädchen in der Uniform der Heilsarmee die Thür und hieß sie eintreten.
Wenn die Heilsschwester den kleinen, völlig kahlen Raum nicht erst etwas gesäubert hätte, so würden die Eintretenden entsetzt zurückgewichen sein, denn die Kammer starrte gewöhnlich vor Schmutz, aber auch jetzt noch machte sie einen Eindruck, daß die beiden Mädchen nicht wußten, ob sie eher Abscheu als Mitleid für die Bewohnerin eines solchen Raumes fühlen sollten.
Es war wie gesagt, kein Stuhl, kein Tisch darin, nur in der einen Ecke war ein Lager von Stroh hergerichtet, und auf diesem lag, nur mit wenigen Kleidern bedeckt, Mistreß Forbes, eine noch immer sehr reiche Frau.
Den beiden Damen blickte ein verfallenes, verschwommenes Gesicht entgegen, das einst sehr schön gewesen sein mußte, aber man merkte sofort, daß der unmäßige Genuß von spirituösen Getränken diese Züge so aufgedunsen hatte. Die gläsernen Augen waren starr auf die Eintretenden gerichtet, und als sie dieselben erkannte, deckten die zitternden Hände schnell ein Tuch über einen Gegenstand, der neben dem Strohsack lag.

Ehe sie noch mit der angeblichen Kranken sprachen, flüsterte ihnen die Schwester zu:
»Sie ist erst vor einer halben Stunde erwacht und schwatzte seltsames Zeug zusammen, immer sprach sie von Silber und Gold, das auf sie herabregne. Ich fürchte, sie ist sehr betrunken gewesen und leidet jetzt an den Folgen des Rausches.«
Ellen trat an das Lager heran und begann ohne weiteres:
»Sie haben gebeten, daß einige Damen der ›Vesta‹ zu Ihnen kommen möchten, weil Sie, als Amerikanerin, von Ihren Landsleuten Trost im Sterben haben wollten. Wir sind gekommen; wie geht es Ihnen?«
»Ach, Miß,« seufzte das Weib, »herzlich schlecht; seit acht Tagen habe ich keinen Bissen mehr über die Lippen gebracht, zum Arbeiten bin ich zu schwach, und ich habe niemanden, der sich um mich kümmert.«
Ellen sah die Heilsschwester fragend an.
»Wir haben ihr täglich reichliches Essen gebracht,« entgegnete diese, »aber –«
»Soll ich Eure verdammten Wassersuppen hinunterspülen?« fuhr die Todkranke wütend auf. »Ich bin eine reiche Frau und etwas Besseres gewöhnt.«
Sie wandte sich an Ellen und begann in einem langen Wortschwall zu erzählen, wieviel Vermögen sie besitze, und was sie einst alles besessen habe.
»Aber jetzt haben Sie doch nichts, ich sehe es Ihnen an, daß Sie Hunger leiden. Warum verschmähen Sie denn die einfache Kost, anstatt sich mit dieser zu begnügen?«
»Hahaha,« lachte das Weib, »Sie sind also auch so eine, die mir Moral predigen will! Dann gehen Sie zum Teufel, ich will von Ihnen nichts mehr hören!«
Sie wandte das Gesicht der Wand zu und blieb wie tot liegen.
»Nehmen Sie Vernunft an, Mistreß Forbes!« fuhr Ellen unbeirrt fort. »Wir kamen nicht hierher, um Ihnen Vorwürfe zu machen, sondern um Ihnen zu helfen. Sehen Sie denn nicht ein, daß Sie ein ganz elendes Leben führen, während Sie von der Rente, die Sie monatlich erhalten, wunderschön leben können? Raffen Sie sich auf, sagen Sie der schlechten Gesellschaft Lebewohl und verkehren Sie mit solchen, die nur Ihr Bestes im Auge haben! Sagen Sie nur ein Wort, daß Sie ein anderes Dasein anfangen wollen, und augenblicklich soll Ihnen geholfen werden. Sie werden sofort so versorgt, wie es sich für Sie schickt.«
Das Weib drehte sich um und blickte die Sprecherin an.
»Wieviel wollen Sie mir geben?« fragte sie und streckte die Hand aus. »Aber gleich, gleich, gleich! Ich brauche es, ich habe Hunger.«
»Ihr Hunger scheint doch nicht so groß zu sein, wie Sie angeben. Geld bekommen Sie von mir nicht, ich würde es jemandem geben, der für Sie sorgt.«
»Da haben wir es ja,« lachte das Weib gellend auf, »für mich sorgen und immer für mich sorgen! Behalten Sie Ihr Geld und gehen Sie zum Teufel! Sie sind auch nicht besser als die anderen!«
»Sie ist wahnsinnig geworden,« murmelte die Schwester am Fenster mit gefalteten Händen.
»Sie würden sich doch nur Branntwein dafür kaufen, der sie unglücklich macht,« sprach Ellen weiter und schleuderte die Flasche, welche durch Verschieben des Tuches sichtbar geworden war, mit der Fußspitze vom Strohsack fort, »aber ich möchte, daß Sie wieder zum Menschen würden und eine solche Stellung einnehmen, wie Sie sie haben könnten. Zu spät ist es dazu immer noch nicht.«
Wieder heftete das Weib die gläsernen Augen starr auf Ellen. Dann aber brach es wiederum in ein gellendes Lachen aus.
»Ich und eine Stellung einnehmen,« höhnte sie, »ja, allerdings, vielleicht morgen schon können Sie mich in Sammet und Seide fahren sehen. Dann werde ich einmal Ihr Schiff besichtigen, und wenn Sie keinen Champagner darauf haben, so werde ich welchen mitbringen! Hahaha!«
»Erwartet sie ihr Geld?« fragte Ellen die Schwester.
»Das ist es eben, was sie plötzlich so unsinnig gemacht hat. Als sie mir sagte, daß ich Sie zum Besuche auffordern sollte, wußte sie davon noch nichts, inzwischen aber hat sie die Nachricht empfangen, daß es bereits unterwegs ist, und nun ist es wieder vollständig mit ihr aus.«
»Kann man ihr das Geld nicht nehmen?«
Die Schwester schüttelte den Kopf und legte den Finger warnend auf die Lippen, aber schon hatte das Weib die leisen Worte vernommen. Wütend richtete es sich auf und schrie:
»Haha, mir das Geld nehmen? Wagt das hier einmal! Ich bin nicht umsonst nach Australien gegangen. Meine Verwandten wollten mich nicht mehr in ihrer Heimat behalten, sie haben mich selbst von sich gestoßen, und es soll mir gerade eine Wollust sein, ihnen Schande zu machen, Schande, daß man vor dem Namen Forbes ausspucken soll.«
Erschöpft sank sie auf das Lager zurück.
»Sie irren sich, wenn Sie glauben, daß niemand von Ihren Verwandten Teilnahme für Sie hat,« sagte Ellen und winkte Miß Staunton, die bisher im Hintergrunde des Zimmers gestanden, näherzutreten. »Kennen Sie vielleicht diese Dame, welche sie besuchen will?«
Die Frau blickte das junge Mädchen an.
»Es sind die Züge meiner Schwester, aber ich kenne sie nicht. Ich will sie auch gar nicht kennen,« schrie sie dann plötzlich auf, »weg mit der Verfluchten, die sich nur an meinem Elende weiden will, ich habe keine Verwandten mehr, will keine mehr haben. Morgen giebt's Geld, juchhe, morgen bin ich wieder reich.«
Das Weib begann Zotenlieder zu singen, so gemein, daß die drei Mädchen sich nicht anzusehen wagten.
»So ist's recht, Lucy,« ließ sich da eine Stimme im Thürrahmen vernehmen, »immer lustig, wenn man auch gehängt wird. Hast du schon das Geld?«
Herein trat ein junger Kerl, schäbig elegant gekleidet, als hätte er etwa die abgelegten Kleider eines Gentlemans an, den Hut schief auf dem Kopfe und im Knopfloch eine Rose. In dem stark geröteten, aber hübschen Gesicht konnte man lesen, daß er angetrunken war.

»Jimmy!« schrie das Weib, sprang auf und warf sich dem Manne an den Hals, »Gott sei Dank, daß du kommst, schmeiß' die ganze Gesellschaft hinaus, sie wollen mich wieder einmal heilig machen! Hahaha.«
»Gehen Sie, Miß Staunton,« sagte Ellen zu ihrer Gefährtin, »der Wagen wartet noch unten. Fahren Sie nach dem Hafen und begeben Sie sich an Bord! Ich komme bald nach.«
Ellen wollte nicht, daß das junge Mädchen, fast noch ein Kind, Zeuge einer etwaigen, frivolen Scene würde, während sie selbst entschlossen war, noch einmal einen Angriff auf das Herz dieses Weibes zu machen, vielleicht konnte sie durch Geld sogar diesen Mann, wahrscheinlich den Geliebten, für ihre Sache gewinnen.
»Wollen Sie hier bleiben?« fragte aber Hope. »Dann gehe ich auch nicht. »Ich lasse Sie nicht mit diesen Menschen allein.«
»Fürchten Sie nichts für mich, ich bin denselben schon gewachsen,« lächelte Ellen. »Gehen Sie nur, in einer halben Stunde bin ich an Bord.«
Hope warf noch einen Blick auf die beiden, die mitten im Zimmer standen und sich in lächerlicher Weise umschlungen hielten, als liebten sie sich innig, dabei Zoten reißend und in jedem Satze einige Flüche vorbringend, dann ging sie. Für dieses Weib konnte sie kein Gefühl der verwandtschaftlichen Liebe hegen, nicht einmal heucheln, jedes Wort stieß sie von ihm ab, und für Ellen brauchte sie keine Besorgnis zu haben, sie war von deren Ueberlegenheit vollkommen überzeugt.
Wie ein gescheuchtes Reh floh sie die Treppe hinab, nur fort von diesem Ort des Lasters, wo sie ihr eigenes Geschlecht so tief gesunken gesehen hatte, und noch dazu in der Person ihrer eigenen Tante.
Ihr nach folgte die Heilsschwester, welche jetzt hier nichts mehr hielt.
Ellen war schon gesonnen, zu dem Manne zu sprechen, als plötzlich wieder Schritte auf der Treppe hörbar wurden, sich die Thür öffnete und ein Postbote hereintrat.
»Das Geld, das Geld,« schrie die Frau auf und schwang sich mit ihrem Geliebten im Kreise herum, dann aber machte sie sich von ihm frei und trat ans Fenster, zitternd vor Aufregung, um die Summe in Empfang zu nehmen.
Der Postbote mochte schon mehrere Male eine solche Szene in diesem Zimmer erlebt haben, er wunderte sich nicht, daß ein halbnacktes Weib, in Lumpen gekleidet, mit bebenden Händen seine Unterschrift auf die Anweisung kritzelte. Ruhig zählte er einige Kassenscheine auf das Fensterbrett.
Kaum lagen sie vollzählig darauf, so streckten sich drei Hände gleichzeitig nach den Papieren aus, die erste war die von Ellen, welche es sich fest in den Kopf gesetzt hatte, dem Weibe kein Geld in die Hände zu geben, und sollte sie sich gegen die beiden mit dem Revolver verteidigen müssen, sie wollte sich schon für ihre That verantworten.
Aber ehe sie die Hand auf die Scheine gelegt hatte, war die Bewegung schon von dem Weibe bemerkt und vereitelt worden, mit der einen Hand stieß sie das Mädchen fort, mit der anderen griff sie nach den Papieren – und kam dennoch zu spät. Blitzartig zuckte die Hand ihres Geliebten vor, erfaßte die Papiere und ließ sie im nächsten Augenblicke in seiner Brusttasche verschwinden.
Das Weib war erst vor Schreck gelähmt, als die blauen Scheine seinen Augen entrückt waren. Dann aber stürzte es wie eine Pantherin auf den ruhig Dastehenden und versuchte, ihn mit beiden Händen am Halse zu fassen, aber es erhielt einen solchen Stoß, daß es zurücktaumelte und auf den Strohsack fiel.
»Das Geld, mein Geld her, oder ich erwürge dich,« schrie es mit heiserer Stimme, sprang auf und wollte sich mit erneuter Wut auf den frechen Räuber seines Eigentums werfen.
Dieser aber griff kaltblütig in seine Brusttasche und hielt ihm die Kassenscheine hin.
»Kannst du denn keinen Spaß verstehen, Lucy?« lachte er. »Wer von uns das Geld hat, ist doch schließlich ganz egal, Hauptsache ist, daß es möglichst lustig durchgebracht wird.«
Das Weib ließ die blauen Scheine zählend durch die zitternden Finger gleiten und steckte sie dann in sein Brusttuch.
»Das war ein böser Scherz. Jimmy,« sagte es, »der Teufel mag den aushalten. Na, was wollen Sie denn noch hier, Madame, nun möchten Sie wohl auch etwas davon abhaben? Oder darf ich Sie vielleicht dazu einladen, mit uns zu fahren? In einer halben Stunde können Sie mit mir Staat machen.«
Sie machte dabei vor Ellen einen spöttischen Knix.
Diese ganze Szene war so blitzähnlich vor sich gegangen, daß letztere sich noch gar nicht gesammelt hatte. Das Benehmen des Mannes konnte sie nicht begreifen, aber so viel wußte sie jetzt, daß sie sich auf dessen Hilfe nicht verlassen konnte.
»So sind Sie also nicht gewillt, mir das Geld zu übergeben?« begann sie nochmals, sich an das Weib wendend, welches übrigens jetzt, da es aufrecht dastand, noch gar keinen so üblen Eindruck machte, mit etwas Puder und Schminke konnte es sich noch recht gut zu einer allerdings schon verblühenden Schönheit machen.
»Wollen Sie nicht? Es soll Ihr Schade nicht sein!«
Die beiden hatten sie erst gar nicht verstanden, so unfaßbar schien es ihnen, das einmal empfangene Geld wieder herauszugeben. Jetzt aber brachen sie in ein schallendes Gelächter aus.
»Hahaha, gottvoll,« schrie Lucy, »ich glaube, sie phantasiert, das Geld ihr zum Aufheben geben, hahaha!«
»Miß, bemühen Sie sich nicht weiter,« sagte der Mann, einen gutmütigen Ton annehmend. »Fragen Sie in acht Tagen wieder einmal vor. Was dann noch übrig ist, das können Sie meinetwegen für uns aufheben.«
Er ging zur Thür und öffnete dieselbe.
Ellen hielt ihre Rolle hier für verloren, wortlos schritt sie hinaus, ärgerlich, so viel Zeit verloren zu haben. Als sie auf dem Korridor stand, zündete der Mann ein Streichholz an, um ihr die Treppe etwas zu erleuchten.
»Sie fassen die Sache ganz falsch an,« sagte er leise zu dem erstaunt aufhorchenden Mädchen, »mischen Sie sich nicht in solche Dinge, die Sie nicht verstehen. Wilde Tiere kann man nur mit der Peitsche, aber nicht durch sanfte Worte bändigen.«
Die über den Sinn dieser hastig hervorgestoßenen Worte völlig bestürzte Ellen wollte noch etwas fragen, aber schon wurde sie die Treppe hinabgeschoben.
»Seien Sie unbesorgt,« hörte sie noch in ihr Ohr raunen, »sie hat das Geld nicht, wertlose Papiere, weiter nichts. Jetzt aber muß ich zurück, sonst wird meine Braut eifersüchtig.«
Lachend sprang der Mann die Treppe hinauf.
Als das junge Mädchen, von Ellen fortgeschickt, aus dem Hause trat, bemerkte es einen jungen Burschen neben der Equipage stehen, der sich mit dem Kutscher unterhielt. Sie ging auf den Wagen zu, der Kutscher sprang vom Bock und öffnete ihr den Schlag.
»Quaitreppe, Nummer zwei,« sagte sie beim Einsteigen, und der Wagen rollte davon.
Es war inzwischen Abend geworden, der Himmel hatte sich stark mit Wolken überzogen, aber da vorläufig noch kein Regen zu befürchten war, so ließ Hope das Verdeck nicht heraufschlagen, wie es der Besitzer des Wagens wollte.
Einige Straßen waren bereits durchrollt, und eben bog der Wagen in eine sehr einsame Allee ein, als er sich plötzlich stark auf die Seite legte, sodaß Hope fast herausgefallen wäre.
Im Nu hatte der Kutscher gehalten, war vom Bock heruntergesprungen und half dem erschrockenen Mädchen mit der Versicherung aus dem Gefährt, er könne das abgegangene Rad fofort wieder an der Axe befestigen.
Aber sie merkte bald, daß nicht alles in Ordnung sein müsse, denn der Kutscher fluchte heftig, und die herbeigeeilten Leute gingen, nachdem sie den Schaden besehen hatten, achselzuckend weiter: hier müsse ein Schmied geholt werden, meinten sie stets, und auch Hope sah, daß sich der eiserne Reifen vom Rad abgelöst hatte. Der Kutscher erklärte wieder und wieder, er könne nicht begreifen, wie mit einem Male einige Stifte herauskommen konnten; vor einer Stunde wären noch alle drin gewesen; aber das half nichts, schließlich mußte er nach einem Stellmacher senden.
Es blieb also dem Mädchen nichts anderes übrig, als entweder zu warten, bis der Schaden repariert war, oder weiterzugehen, bis es einen anderen Wagen traf, denn augenblicklich war kein solcher zu sehen, und eben wollte Hope das letztere wählen, als durch die Allee eine geschlossene Mietsequipage kam, die auf ihren Wink auch hielt.
Sie stieg ein, gab dieselbe Hafentreppe als Ziel an und fuhr weiter.
Unterdes war es vollständig finster geworden, und die Lampe oben am Kutscherbock verbreitete ein bescheidenes Licht im Innern der schön ausgestatteten Equipage. Das junge Mädchen war von dem eben erlebten Auftritt erschöpft, abgespannt und lehnte sich behaglich in die weichen Polster zurück. Der Regen fiel jetzt in Strömen herab, schlug plätschernd gegen die Fensterscheiben des geschlossenen Wagens und brachte so eine einschläfernde Wirkung hervor. Erst als die Kutsche über holpriges Pflaster rasselte, schlug Hope die müden Augen auf, und entsetzt wollte sie aufschreien, als in demselben Augenblicke sich hastig, aber lautlos die Wagenthür öffnete und eine dunkle Gestalt hereinsprang.
»Schreien Sie nicht, Fräulein, um Gottes willen nicht!« bat die Gestalt, über deren merkwürdigem Aussehen schon das junge Mädchen das Schreien vergaß, und welche es nur verwundert betrachtete.
Es war ein schwarzes Weib, in ein kurzes, nur bis an die Kniee reichendes Röcklein gekleidet, das mit Federn und bunten Läppchen verziert war, und um den Kopf hatte es einen roten Turban gewickelt.

Es war Topsy, die Tänzerin, welche dem nach ihr fahndenden Policeman entschlüpft war.
»Ich wurde verfolgt, bin durch einen Durchgang geflohen und in diese Droschke gesprungen, weil ich keine Gelegenheit zum Entkommen mehr sah,« flüsterte die Schwarze hastig; dann aber, als ein Lichtstrahl das erstaunte Gesicht des Mädchens streifte, nahm auch das ihrige mit einem Male einen überraschten Ausdruck an.
»Hope – Miß Staunton,« flüsterte sie freudig, »ist es denn möglich? Sie erscheinen mir wie ein Engel, Gott sei Dank, daß ich gerade Sie gefunden habe!«
»Aber wer sind Sie denn eigentlich?« brachte das Mädchen endlich hervor.
»Hannes Vogel, wissen Sie noch, der Schiffsjunge von der ›Ariadne‹, der Ihnen immer die Schifflein schnitzte und für den Sie Ihrem Onkel immer Cigarren mausten.«
Mit offenem Munde starrte das junge Mädchen die Negerin an. Blitzartig tauchte ein Bild in ihrer Erinnerung auf. Vor vier Jahren war sie als Kind mit ihrem Onkel von New-York nach England gefahren. Während der Reise schloß sie innige Freundschaft mit einem Schiffsjungen, dessen tausenderlei Kunststückchen immer wieder ihr Interesse erregten, der ihr alles auf dem Schiffe und von der Seemannschaft erklärte, was er selber wußte, und der schließlich so hoch in ihrer Achtung stieg, daß sie ihn für einen zweiten Kolumbus hielt und sie immer froh war, wenn er die Cigarren dankbar annahm, die sie heimlich aus dem gefüllten Kästchen ihres Onkels nahm und die dann ebenso heimlich von dem zukünftigen Seehelden hinter dem Schornsteinmantel geraucht wurden. Als sie dann in Liverpool voneinander Abschied nehmen mußten, da hatte Hope bitterlich geweint, und auch ihrem Christoph Kolumbus waren einige Thränen über die schmutzigen Backen gelaufen; sie hatte ihm als Andenken ein Kreuz aus Korallen geschenkt, und er gab ihr ein Haifischgebiß mit dem Bemerken, der ehemalige Besitzer hätte ihn bald einmal gefressen.
Wie ein Traum schwebte mit einem Male alles dies an dem jungen Mädchen vorüber; was in aller Welt wußte aber die Negerin von jenem Erlebnis?
»So sehen Sie mich doch nicht so komisch an,« bat die Schwarze wieder, »ich bin wirklich Hannes Vogel, der Schiffsjunge von der ›Ariadne‹ und Ihr Korallenkreuz trage ich immer noch auf der Brust.«
In kurzen Worten erzählte nun der verkleidete Leichtmatrose seine Erlebnisse, warum er verhaftet werden sollte, wie er sich als Tänzerin angezogen und dem Konstabler etwas vorgetanzt und vorgesungen habe, und wie er diesem dann abermals entschlüpft sei.
»Ich rannte durch einen dunklen Gang,« fuhr er mit leiser Stimme fort, damit der Kutscher ja nicht merkte, daß er noch einen anderen Passagier bekommen habe, »und sah auf der einen wie auf der anderen Seite der Straße einen Konstabler stehen, dicht hinter mir war auch einer her, und so sprang ich als letzte Zuflucht in den Wagen, der eben vorbeifuhr; gefangen mußte ich doch nun einmal werden, dann, sagte ich mir, soll es auf möglichst bequeme Weise geschehen. Der hinter mir kommende Policeman mußte erst noch um eine Ecke biegen, ehe er mich zu sehen bekam, und da ich wunderbarerweise gerade Sie in diesem Wagen fand, so scheine ich gerettet zu sein. Sie fahren nach dem Hafen? Ich muß auch dorthin, springe rechtzeitig heraus und begebe mich an Bord meines Schiffes.«
Hope hatte sich immer fest auf die Lippen beißen müssen, um bei der Erzählung des drolligen Burschen nicht laut aufzulachen. Aber das hätte ja den Kutscher aufmerksam gemacht, und so kämpfte sie oft mit dem Ersticken bei dem Versuche, ernst zu bleiben.
»Hat denn der Regen nicht die schwarze Farbe abgewaschen?« fragte sie, als die schweren Tropfen immer heftiger gegen die Scheiben klatschten.
»I Gott bewahre, es ist ja Graphit, und der ist waschecht, aber abfärben thut er freilich.«
»Wer waren denn die zwei Herren, die Ihnen jeder ein Goldstück versprachen, wenn Sie die beiden Frauen zusammennähen würden?« fragte Hope.
»Ich kenne sie nicht, der eine war mittelgroß, schlank, mit einem Schnurrbärtchen, und wenn er sprach, so sah man sehr schöne Zähne.«
»Trug er einen hellgrauen Hut und ebensolche Beinkleider?«
»Ja.«
»Haben Sie seinen Stock gesehen?«
»Ach ja, der war sehr auffällig. Oben mitten durch das Holz wand sich eine Schlange, und deren Augen glitzerten, als wäre das Tier lebendig.«
»Dachte ich es mir doch,« sagte Hope und hätte vor Freuden bald in die Hände geklatscht, »es war kein anderer als Sir Williams. Und der andere?«
»Der war etwas kleiner, und das Merkwürdigste an ihm war sein Backenbart. Ich habe die Haare ganz genau gezählt, auf der rechten Seite waren sieben und auf der anderen neun, und die auf der rechten Seite waren viel länger.«
»Genug, genug,« wehrte das junge Mädchen ab, das nur mit Mühe das Lachen unterdrücken konnte, »ich weiß jetzt, wer es war!«
»Woher kennen Sie denn die beiden Herren so genau? Wie kommen Sie eigentlich hierher nach Sidney?«
»Es waren Sir Williams und Sir Hendricks, die mit auf dem ›Amor‹ fahren. Vielleicht haben Sie schon von der ›Vesta‹ gehört?«
»Ei gewiß, auf der fahren die verrückten Mädels, die Hosen anhaben und immer dem ›Amor‹ voraussegeln.«
»Nun,« lächelte Hope, »ich bin auch so ein verrücktes Mädchen.«
»Alle Hagel,« und Hannes kratzte sich hinter den Ohren, »das habe ich nicht gewußt. Na, nichts für ungut, Fräulein, diese Mädchen haben schon verschiedenes gemacht, was allen Seeleuten Respekt eingeflößt hat. Also da fahren Sie auch mit drauf! Als was denn, als Schiffsjunge – Schiffsmädchen wollte ich sagen?«
»Oho,« antwortete Hope stolz, »so etwas giebt es bei uns gar nicht, wir sind alle Matrosen.«
»Was haben Sie denn da als Matrosin an Bord zu thun?« forschte der neugierige Hannes weiter.
»Ich muß alles können, was von einem Matrosen verlangt wird: Steuern, Splissen, Knoten, Segelflicken, Scheuern, Schrubben, Rudern, Aufentern, Schmieren, Segeln, Theeren, Wenden, Kreuzen, Halsen –«
»Halt, halt,« unterbrach der Leichtmatrose das bereits atemlose Mädchen, »aber das kann doch nicht alles eine gleichzeitig machen.«
»Gleichzeitig natürlich nicht,« erwiderte lächelnd Hope, »aber nach und nach kommt jede einmal daran.«
»Aber meine liebste Hope – Miß Stannton,« verbesserte sich kopfschüttelnd der Bursche, »das geht doch nicht. Sehen Sie einmal, ein Matrose kann doch nicht dieselbe Arbeit thun, wie der Schiffsjunge, und dieser nicht dieselbe wie der Kapitän, die Arbeit muß doch eingeteilt werden, sonst geht ja aller Respekt verloren.«
»Das kann ich nicht einsehen,« erklärte das junge Mädchen. »Wenn jede an einem Tage eine bestimmte Arbeit verrichten muß, morgen wieder eine andere, so ist dabei niemand im Vorteil und niemand im Nachteil.«
»Nein,« sagte der Leichtmatrose entschieden, »auf jedem Schiffe muß es Kapitän, Steuermann, Matrosen, Leichtmatrosen und Schiffsjungen geben. Ich will zum Beispiel einmal sagen, es ist doch unmöglich, daß Sie heute Schiffsjunge sind und Prügel von einem Matrosen bekommen, morgen aber sind Sie Kapitän und geben nun dem Matrosen, der wieder Junge geworden ist, die Prügel mit Zinsen zurück. Was sagen Sie zu diesem Beweis?«
Hope mußte sich auf die Finger beißen, daß sie bei dieser seltsamen Beweisführung nicht herausplatzte.
»Darum eben ist es so auf der ›Vesta‹ eingerichtet,« sagte sie endlich, »daß wir alle Matrosen sind und unsere Rollen täglich wechseln mit Ausnahme des Kapitäns, Miß Petersen, die immer das Kommando behält. Hat heute eine das Deck zu scheuern, so muß sie morgen die Takelage bedienen, und Streit kommt bei uns nie vor.«
»Es ist ein Irrtum, verehrte Hope, wenn Sie glauben, es könnten auf einem Schiffe alle Matrosinnen sein. Zum Beispiel also, wer bedient auf der ›Vesta‹ die Royalraa?«
Die Royalraa ist auf einem Vollschiff die sechste, also die oberste und zugleich die dünnste Raa.
»Ich,« entgegnete Hope, »weil ich die leichteste von allen bin.«
»Da haben wir es ja gleich, dann sind Sie eben das Schiffsmädchen, denn auf jedem Segelschiff wird die Royalraa vom Jungen bedient, ebenso wie die Bramraa vom Leichtmatrosen.«
»Oho,« entgegnete aber Hope entrüstet, »ich ein Schiffsjunge oder Schiffsmädchen, wie Sie immer sagen? Morgen kann ich vielleicht erster Steuermann sein!«
»Nun hol' mich aber dieser oder jener, aus Ihnen und der ›Vesta‹ werde ich nicht klug, das muß ja ein merkwürdiges Schiff sein. Aber sagen Sie einmal, können Sie als Matrose auch den Step tanzen?«
»Pst,« flüsterte das junge Mädchen, »ich kann ihn wohl tanzen, aber ich thue es nicht, sonst würde ich ausgelacht. Ich tanze ihn höchstens einmal unten in meiner Kabine.«
»Daran thun Sie recht, üben Sie sich nur ordentlich! Ein richtiger Matrose muß auch Step tanzen können. Wie steht es denn bei Ihnen mit dem Rauchen?«
»Geraucht wird nicht, es ist eigentlich schade. Als ich von New-Iork wegging, nahm ich mir eine ganze Kiste voll Kalkpfeifen mit, aber da keine der anderen Damen damit anfängt, so kann ichs auch nicht,« entgegnete Hope in bedauerndem Tone, »aber ich werde es in der nächsten Versammlung einmal vorschlagen.«
»Giebt's auf der ›Vesta‹ Schnapsrationen?«
»Was?«
»Ob es Schnaps giebt?«
»Schnaps? Nein, wir trinken nie Schnaps, höchstens Wein und Bier.«
»Das ist nichts,« sagte Hannes in wegwerfendem Tone, »jedes gute Schiff giebt seinen Leuten Schnaps, wenn sie recht schwer gearbeitet haben.«
»Dann muß ich es auch einmal vorschlagen,« meinte Hope nachdenkend. »Ueberhaupt wissen Sie, so sehr gefällt es mir auf der ›Vesta‹ auch nicht, es geht nicht so richtig seemännisch zu. Ich habe einmal von einem alten Kapitän gehört, wenn einem eine Arbeit zu schwer wird, und man stößt einen kräftigen Fluch aus, dann geht sie mit einem Male wie von selber. Neulich nun zog ich an einem Tau, das Segel riß es mir aber immer aus der Hand, da dachte ich an den Kapitän und stieß nur so einen ganz kleinen Fluch aus, aber ich denke doch gleich, Miß Petersen, die neben mir stand, will mich auffressen, mit so großen Augen sah sie mich an.«
Hannes stemmte die Arme in die Seiten und wurde von heimlichem Lachen geschüttelt.
»Sie sollten mal auf so ein richtiges, tüchtiges Segelschiff kommen, wo nur fixe Jungen an Bord sind. Dann geht bei der Arbeit nur so alles Hand in Hand, immer unter lustigem Singen, mag es Sonnenschein sein, Regen, Sturm oder Orkan. Beim Einraffen jedes Segels wird ein anderes Lied gesungen, und fällt einer von der Raa herunter, so singt er noch unterwegs sein Abschiedslied. Und wird man von der Wache abgelöst, dann geht's auch noch lange nicht schlafen, ebensowenig giebt es Kartenspielen oder Würfeln oder Lesen. Spiele haben wir, von denen Sie gar keine Ahnung haben.«
»Wir spielen auch,« unterbrach ihn Hope, »Schach oder Dame.«
»Pah, Schach,« sagte Hannes, »das kann jeder. Nein, aber zum Beispiel den »Katzenkönig«. Kennst du das Spiel?«
Der Leichtmatrose kam so in Eifer, daß er das Mädchen schon als Schiffskameraden betrachtete und mit »du« anredete.
»Nein, ich kenne das Spiel nicht,« bedauerte Hope.
»Pass auf, wie es gemacht wird. Einer muß sich bücken und die Augen werden ihm zugehalten. Die anderen nehmen Katzen, das heißt also Tauenden in die Hände und schlagen abwechselnd dem sich Bückenden hinten drauf, der sich nach jedem Schlag umdrehen und denjenigen bezeichnen muß, der ihn geschlagen hat, und das wird so lange fortgesetzt, bis er den Richtigen herausgefunden hat, welcher nachher seine Stelle einnehmen muß. Ich habe einmal siebeuundzwanzig Schläge hintereinander bekommen und konnte dann drei Tage lang weder sitzen, noch liegen.«

»Das muß aber schön sein,« meinte Hope, »dieses Spiel werde ich auch in der nächsten Versammlung vorschlagen!«
»Was meinst du wohl,« sagte sie nach einer kleinen Weile zu dem Leichtmatrosen, »könnte ich wohl auf ein richtiges Segelschiff als Matrose gehen?«
Wieder wollte sich Hannes vor Lachen schütteln.
»Als Schiffsjunge,« sagte er endlich, nachdem er sich wieder beruhigt hatte, »aber sonst nicht. Nein, es geht doch nicht, ein Mädchen kann nicht unter die Matrosen kommen.«
»Aber ich würde ja als Junge gehen! Weißt du es nicht, wie ich es anfange, daß ich irgendwo auf ein anderes Schiff komme? Ich hätte mächtige Lust dazu, so einmal richtig als Matrose zu fahren, Tabak zu rauchen und Schnaps zu trinken. Die Arbeiten kann ich alle machen, davor bin ich nicht bange.«
»Hm,« meinte Hannes nachdenkend, »schade, daß du kein Junge geworden bist, aus dir könnte noch ein fixer Seemann werden. Hast du Papiere?«
»Gar nichts habe ich, ich müßte einfach ausreißen, das thut ihr ja auch immer, wenn euch ein Schiff nicht gefällt.«
»Papiere nützten hier ja auch nichts, du bist bloß ein Mädchen. Na warte einmal, mir fällt vielleicht etwas ein, wie wir die Sache klarieren können.«
Der Leichtmatrose oder die schwarze Tänzerin im leichten Röckchen, lehnte sich mit übereinandergeschlagenen Armen in eine Ecke des Wagens und sann nach.
Das junge Mädchen kam jetzt zum ersten Male aus dem Schwatzen heraus, sie betrachtete die Person, mit welcher sie sich so gut unterhalten hatte, und mit einem Male schoß ihr eine heiße Blutwelle über das Gesicht.
Um Gottes willen, dachte sie, wenn mich jetzt Ellen oder sonst jemand von den Damen sähe, hier allein mit dem jungen Matrosen, in diesem Anzug, Pläne schmiedend, wie ich von der ›Vesta‹ ausreißen könnte! Wenn ich nur erst im Hafen wäre, das dauert ja schrecklich lange, aber ich werde jetzt dem Hannes sagen, daß er aussteigen soll, er kann mich in diesem Kostüm doch nicht bis an Bord begleiten.
»Ich hab's, Hope,« sagte dieser plötzlich und richtete sich aus seiner bequemen Stellung auf, »du weißt, ich habe nämlich einen doppelten Geburtsschein. Einer davon lautet auf Hannes Vogel, und den Namen habe ich angenommen, weil er mir lustiger klang, und der andere lautet auf Johannes Schwarzburg. Ich weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin, zwei Geburtsscheine zu besitzen, ich glaube, meine Mutter – das war auch so eine alte Geheimniskrämerin – hat ihn mir aus Versehen in den Koffer geschoben, als ich nach Hamburg fuhr, um mich dort als Schiffsjungen anmustern zu lassen. Ich könnte jetzt ebenso gut als Johannes Schwarzburg in der Welt herumsegeln, denn meine Eltern hießen weder so, noch Vogel, sie sagten, ich wäre ein angenommenes Kind, den sollst du haben. Willst du – Hope?«
»Lassen Sie das jetzt, wir müssen doch schon am Hafen sein,« sagte das junge Mädchen zerstreut und schlug den blauen Vorhang vom Fenster zurück.
Draußen sah man eine Menge Lichter vorbeitanzen.
»Gewiß sind wir am Hafen, und es wird die höchste Zeit, daß ich mich fortmache,« sagte Hannes und sprang auf. »Nach welcher Treppe wollen Sie?«
»Nach Treppe Nummer zwei.«
»Oho, wir sind schon bei Nummer sieben, da sind Sie schon an fünf vorbeigefahren.«
Das junge Mädchen erschrak und wollte dem Kutscher klopfen, aber der Leichtmatrose hielt ihre Hand fest.
»Lassen Sie mich erst hinaus,« flüsterte er, »von hier aus komme ich gerade auf die ›Kalliope‹.«
Er klinkte leise an der Thür, klinkte wieder und noch mehrere Male, ging dann kopfschüttelnd nach der anderen Seite und versuchte auch hier vergebens, die Thür zu öffnen. Desgleichen machte er umsonst Versuche, die Fenster herunterzulassen.
»Seien Sie nicht besorgt!« beruhigte er das junge Mädchen, das mit angsterfüllten Blicken seinen fruchtlosen Bemühungen zugesehen hatte. »Das müßte ja mit dem Teufel zugehen, wenn Hannes Vogel nicht da wieder herauskäme, wo er hineingekommen ist.«
»Aber ich?« fragte Hope.
»Ich bleibe bei Ihnen, bis Sie sicher an Bord sind, wenn Sie mich auch nicht zu sehen bekommen. Und wenn Ihnen etwas passiert, dann mache ich einen Lärm, daß alle Konstabler von Sydney zusammenlaufen. Sollte ich selbst dabei arretiert werden, so können Sie sich dann für mich verwenden, Sie, die anderen Damen und die Engländer, es ist doch nur eine kleine Strafe zu zahlen. Wo liegt die ›Vesta‹?«
»An Treppe Nummer zwei.«
»Und der ›Amor‹?«
»An Nummer zehn oder elf.«
»Gut, ich bin auf der ›Kalliope‹, Treppe Nummer acht. Nun passen Sie einmal anf, was ich Ihnen sagen werde! Wenn ich jetzt die Fenster zerschlage habe und der Kutscher kommt und fragt, was passiert sei, so sagen Sie ihm, es sei jemand vorbeigerannt und habe die Scheibe zertrümmert, mag er es dann glauben oder nicht. Sofort, wenn ich hinaus bin, ziehen Sie aber den Vorhang wieder vor.«
»Ich springe lieber mit hinaus.«
»Das können Sie nicht, das Fenster ist viel zu klein für Sie mit ihren langen Kleidern. Ich wittere etwas. Sidney ist eine verdammte Stadt. Geben Sie acht, dort kommt eine kleine Anlage, in die werde ich verschwinden. Aber seien Sie versichert, daß ich Sie als Schiffskamerad in Leben und Tod nicht verlassen werde! Good bye, Hope, auf Wiedersehen.«
Ehe das Mädchen nur ahnte, wie er eigentlich aus dem Fenster hinauswollte, klirrten schon die Scheiben, und der Leichtmatrose war verschwunden. Der verwegene Bursche war wie ein Ball mitten durch die entstandene Oeffnung gesprungen.
Hope sah noch, wie drüben in die Anlagen ein dunkler Schatten huschte, dann zog sie, seinem Rate gemäß, den Vorhang vor das Fenster und lehnte sich in die Kissen zurück, sicher erwartend, daß der Kutscher das Klirren der zerbrochenen Scheibe gehört haben und sich nach der Ursache erkundigen würde. Dann wollte Hope sofort aussteigen und sich dem Schutze des ersten Konstablers anvertrauen.
Aber wunderbarerweise hielt der Kutscher nicht. Sollte er das Klirren der Scheibe wirklich nicht gehört haben, oder ...
Die Thüren waren verschlossen, oder doch von innen nicht zu öffnen, sie wollte bloß nach Hafentreppe Nummer zwei, und der Kutscher fuhr immer weiter, das Abenteuer in Konstantinopel, die Verhaftung Ellens in Kairo – dies alles schoß dem Mädchen durch den Kopf, heftig sprang es auf und klopfte an das Fensterchen an der Vorderseite.
Aber der Kutscher hörte nicht – oder wollte nicht darauf achten.
Da steckte sie vorsichtig den Kopf durch die zerbrochene Glasscheibe, daß sie sich nicht verletzte, und rief mehrere Male laut dem Kutscher zu, zu halten.
Dieser hielt auch sofort, stieg vom Bock und öffnete die Thür.
»So, da wären wir an Treppe Nummer zwölf, Fräulein,« sagte er in gemütlichem Tone.
Augenblicklich war Hopes Angst geschwunden, dafür aber erfaßte sie Aerger, daß sie nach einer falschen Stelle gefahren worden war, denn von hier nach Treppe Nummer zwei war fast eine englische Meile Entfernung.
»Habe ich Ihnen nicht gesagt, nach Treppe zwei?«
»Nein, nach Nummer zwölf,« antwortete der Kutscher, »so habe ich wenigstens verstanden. Ich bin ja an Treppe zwei vorübergefahren, und Sie hätten ja nur zu klopfen brauchen, dann würde ich gehalten haben.«
»Das habe ich auch gethan, aber Sie haben nicht darauf geachtet.«
»Ja, es ist schwer, bei diesem Wagengerassel etwas zu verstehen. Oder Sie brauchten auch nur ein Fenster herabzulassen und mich zu rufen.«
»Das habe ich auch versucht, aber die Fenster gingen nicht zu öffnen, ebensowenig die Thür. Wie kommt das übrigens?«
»Nicht?« lachte der Mann. »Sehen Sie doch hier.«
Er klinkte an den Schlössern, und unter seiner Hand bewegten sich allerdings die Riegel hin und her. Hope war somit beruhigt, aber nun kam die Frage, wie sie an Bord der ›Vesta‹ kommen sollte. Mit diesem Wagen wollte sie nicht wieder fahren, sie hatte eine Abneigung gegen ihn bekommen, und einen anderen sah sie nicht in der Nähe.
Da sagte der Kutscher selbst, der ihr Zögern bemerkte:
»Ich rate Ihnen, nicht mit einem Wagen nach Nummer zwei zu fahren, dazu gebrauchen Sie eine Viertelstunde, nehmen Sie aber ein Boot, so sind Sie in fünf Minuten dort, oder wollen Sie auf ein Schiff, so werden Sie auch gleich dahingebracht. Ich bin ein ehrlicher Kerl; habe ich Sie durch meine Schuld zu weit gefahren, so will ich Ihnen auch den besten Rat geben und nicht auf meinen Verdienst sehen. Dort legt gerade ein Mietsboot an, auch noch mit vier Ruderern, haben wahrscheinlich eine ganze Gesellschaft fortgebracht. Gehen Sie nur ruhig dorthin, Fräulein! Das Boot darf auch nicht mehr verlangen, als wenn nur zwei Ruderer darin wären.«
Er winkte nach dem Boote zu, und ein Mann kam herangesprungen, höchlichst erfreut darüber, gleich noch einmal einen Passagier zu finden.
»Wohin wollen Sie, Miß?« fragte er sofort.
Hopes Zögern war jetzt überwunden. Es war in der That das beste, gleich hier ein Boot zu nehmen und sich nach der ›Vesta‹ rudern zu lassen.
»Geben Sie uns noch einen Dollar zu verdienen!« bat der Mann. »Der Regen hat aufgehört, wir bringen Sie trocken an Bord Ihres Schiffes. Wo liegt der Passagierdampfer, Miß?«
»Ich will auf die ›Vesta‹.«
Hove bemerkte mit Genugthuung, wie erstaunt der kräftige Schiffer auf das zarte Mädchen blickte.
»Er hat sicher schon von uns gehört und freut sich, selbst einmal eine Vestalin auf dieses Schiff bringen zu können, wir sind ja sozusagen Kollegen,« dachte Hope.
»Dann sind Sie in fünf Minuten an Bord,« antwortete der Mann, »ich kenne den kürzesten Weg zwischen den Schiffen hindurch nach dort, weil ich ihn heute schon zweimal gefahren bin. Steigen Sie ein, Miß!«
Hope stieg ein und wunderte sich, als sie im Boote saß, daß es eigentlich ganz anders gebaut war, als die gewöhnlichen Mietsboote, eher wie ein schlankes Seeboot, aber im nächsten Moment dachte sie nicht mehr daran.

Der ganze Hafen war voll von Schiffen, einige hatten Lichter ausgesteckt, und auf solchen herrschte Leben, andere lagen wie riesige finstere Ungeheuer verlassen und tot da. Geschickt lenkte der am Steuer Sitzende das Boot zwischen den schwarzen Leibern hindurch, und jedesmal, wenn es zwischen zwei Schiffen hervorkam, blickte Hope nach links, wo sie eine kleine Brigg mit vielen Lichtern sehen konnte.
Das war der ›Amor‹. Hope beschäftigte sich oft und gern in Gedanken mit den Herren dieses Schiffes, sie kannte jetzt schon ziemlich alle persönlich, auch ihre Eigentümlichkeiten, und gar manchmal, wenn Hope in ihrer Kabine lag, mußte sie laut auflachen, brachte sie sich eine oder die andere Handlung oder Rede eines der Herren in Erinnerung. Hauptsächlich war es Charles, der immer wieder ihre Lachsucht erregte, sie schwärmte für diesen Mann mit dem Enthusiasmus eines Backfisches, der in jedem Offizier einen Mars sieht. Dann besaß aber auch Hendricks ihre Neigung, wenn er sich nur nicht einen solch entsetzlichen Backenbart wollte stehen lassen, auch Harrlington, der Lustigkeit mit Besonnenheit verband, der brummige Hastings, auf dessen Freundschaft man sich wie auf Gold verlassen konnte – alle diese Gestalten zogen an den Augen des Mädchens vorüber, und schließlich schloß sich dem Zuge eine schwarze Gestalt in kurzem, bunten Röckchen an.
Hope mußte plötzlich so laut auflachen, daß sie die schweigsamen Ruderer verwundert ansahen, was das Mädchen veranlaßte, verlegen zur Seite zu blicken.
Da bemerkte sie mit einem Mal, daß das Boot immer geradeaus gefahren war, anstatt nach rechts abzubiegen.
»Wohin fahren Sie mich?« rief sie erregt. »Die ›Vesta‹ liegt doch mehr dort.«
Sie deutete mit der Hand nach rechts.
»Stimmt,« antwortete der Steuernde ruhig, »aber wir müssen einen großen Umweg machen, denn ein neues Schiff hat erst vorhin die Durchfahrt versperrt. Thut mir leid, habe es aber nicht wissen können.«
Hope ward dadurch nicht beruhigt, das Boot mußte sich immer weiter von der ›Vesta‹ wie auch vom Lande entfernen. Fast war es, als wollten die Leute dem freien Fahrwasser zustreben, wo auch einige Schiffe verankert lagen; Hope konnte von hier die Lichter erblicken.
Angstvoll wandte sie ihre Augen nach dem ›Amor‹, der jetzt öfters auftauchte, da sich die Zahl der Schiffe zu verringern begann, und was sie da sah, rief ihre Verwunderung hervor.
Auf dem ›Amor‹ waren die Lichter und Lampen mit einem Male alle lebendig geworden, so schien es wenigstens, denn Menschen konnte sie wegen der Nacht und der großen Entfernung nicht erkennen; sie wandelten hin und her, tauchten bald auf, bald unter, und dann war es Hope, als ob sie plötzlich einige dunkle Gegenstände über dem Schiffe verschwinden sähe.
»Sie arbeiten,« murmelte Hope, »sonderbar, in der Nacht und im Hafen! Fast schien es mir, als ob sie die Boote abgenommen hätten. Fahrt mich zurück an Land!« rief sie dann heftig. »Ihr bringt mich ja ganz wo anders hin.«
Die Ruderer beachteten den Befehl gar nicht, mit aller Macht legten sie sich in die Riemen, aber der Steuernde sagte:
»Seien Sie unbesorgt, gleich sind wir an der ›Vesta‹!«
»Das ist nicht wahr!« rief Hope. »Sie fahren ja nach dem freien Wasser, und die ›Vesta‹ liegt in der Nähe der Treppe.«
»Ich versichere Ihnen,« entgegnete der Schiffer, »in fünf Minuten sind –«
»Boot ahoi!« rief da plötzlich lang ausholend eine Stimme durch die Nacht, und gleich darauf ward ein rascher, taktmäßiger Ruderschlag hörbar.
Freudig fuhr Hope auf. Das war Lord Harrlingtons Stimme gewesen, und da sah sie auch schon ein Boot mit sechs Riemen zwischen zwei Schiffen hervorschießen. Ihr Boot lag gerade im Schatten eines dunklen Schiffes, aber das ankommende wurde von einer Schiffslaterne beleuchtet. Eben wollte sie den Schifferruf erwidern, schon brachte sie die Hände vor den Mund, da aber legte sich eine Hand um ihren Hals, das Mädchen wurde hintenüber gerissen, sodaß es vor die Füße des Steuernden zu liegen kam, und erbleichend blickte es in die funkelnden Augen des Mannes.
»Nur ein Laut,« zischte er zwischen den Zähnen hindurch und setzte Hope den Dolch auf die Brust, »und Du bist eine Leiche.«
Sie hielt vor Entsetzen den Atem an. Dieser Mann machte Ernst mit seinen Worten, schon hatte das Messer das Kleid durchdrungen, und sie fühlte den kalten Stahl auf der Brust.
Hastig besprachen sich die Männer in einer Sprache, die Hope nicht verstand, dann lenkten sie das Boot in den Schatten eines Schiffes und drängten es dicht an den Rumpf.
»Boot ahoi!« schallte wieder der Ruf, diesmal aber von der anderen Seite und jetzt erkannte das Mädchen Williams Stimme. »Boot ahoi! James, nichts gefunden?«
James war der Vorname Harrlingtons, das wußte sie, also waren schon zwei Boote unterwegs, sie zu suchen.
»Noch nicht! Haben Sie ihn im Boot?« klang Harrlingtons Stimme durch die Nacht zurück.
»Ich habe ihn. Wo ist Lord Hastings?«
»Er muß gleich kommen.«
»Dann muß er ins Fahrwasser, wo liegt der ›Friedensengel‹?«
»Eins, zwei, drei,« hörte Hope eine Stimme zählen, es war die von Hannes, dem Leichtmatrosen, »das vierte Schiff von rechts.«
»Hast Du sie auch wirklich erkannt?« rief wieder Harrlington.
»Bestimmt,« antwortete Hannes.
Wieder hörte Hope einen raschen Ruderschlag, und abermals sah sie durch die Nacht ein Boot schießen. Den am Steuer Sitzenden erkannte das Mädchen sofort an den riesigen Umrissen – es war Lord Hastings.
»Nach dem ›Friedensengel‹, viertes Schiff von rechts im Fahrwasser, wir suchen hier ab,« rief Harrlington, dessen Boot sie nicht sehen konnte, ihm zu, und Hope fühlte, wie der spitze Stahl schon ihre Haut ritzte; die Hand, die ihn an ihre Brust drückte, bebte.
Hope hatte wieder Hoffnung gefaßt. Hannes hatte sie also abfahren sehen, der Bootsbesatzung mit dem scharfen Blick des Seemanns nicht getraut, nun den ›Amor‹ alarmiert, und alle Boote der Engländer waren hinter ihr her.
Die fünf Insassen des Bootes besprachen sich leise, nahmen Tücher aus einem Kasten und umwickelten die Riemen dort, wo sie sich in den Ausschnitten bewegten. Dann stießen sie leise vom Schiff ab und tauchten vorsichtig die Riemen ins Wasser.
Als sie um das Schiff bogen, sah Hope wieder ein Boot angerudert kommen, und der Steuernde wendete das seinige um.
Aber schon waren sie gesehen worden. »Boot ahoi!« schallte Harrlingtons Stimme über das Wasser. »Halt, wenn Ihr unter ehrlicher Flagge fahrt!«
Wie ein Schatten huschte Hopes Boot zurück und zwischen den Schiffen hindurch, aber da kam schon wieder ein anderes von rechts heran.
»Sie sind es,« jubelte Hannes Stimme. »Pullt, Jungens, pullt, legt Euch hinten über, daß Ihr umfallt.«
Wieder fühlte Hope, wie sich das Messer fest auf ihre Brust drückte, aber sie war nun einmal so; in diesem Moment malte sie sich aus, wie Hannes zwischen den englischen Grafen und Lords saß und sie zum Rudern antrieb, und ein Lächeln huschte über ihre bleichen Züge.
Abermals lag das Boot im Schatten eines großen Kahns und die Männer unterredeten sich hastig; plötzlich wurde dem Mädchen ein Tuch dicht um Gesicht und Kopf gewickelt, am Halse zugeschnürt und die Hände fest zusammengebunden. Im nächsten Augenblick fühlte sich Hope emporgehoben und niedergelegt, jedenfalls an Deck des Fischerfahrzeuges.
Kaum war eine Viertelminute vergangen, als sie unter sich Ruderschlag vernahm und Harrlingtons Stimme hörte:
»Haben wir dich endlich, Mädchenräuber, wo ist die Dame?«
»Was wollt Ihr eigentlich?« entgegnete die knurrende Stimme des Steuermanns, der sie entführt hatte. »Wir kommen eben dort von Bord. Gebt Raum, sage ich Euch, laßt ehrliche Fischer zufrieden!«
Wieder drang ein Ruderschlag an Hopes Ohren.
»Sie sind es!« jubelte abermals Hannes. »Wo ist Hope?«
Es folgte eine Stille. Hope strengte sich verzweifelt an, ihre Bande zu sprengen, aber es gelang ihr nicht, und das Tuch war so fest um ihren Mund gebunden, daß sie nur ein dumpfes Röcheln ausstoßen konnte. Sie fühlte sich dem Ersticken nahe.
»Hund verdammter!« schrie des Leichtmatrosen Stimme, und ein klatschender Schlag wurde gehört. »Wo ist das Mädchen? Du willst mir doch nicht etwa weismachen, Ihr hättet es nicht im Boote gehabt. Wo ist es?«
»Das sollst du mir bezahlen!« brüllte der Räuber.
Ein heftiges Stampfen erfolgte, ein Fall ins Wasser und ein Plätschern, dann lachte Hannes:

»Laßt ihn schwimmen, Jungens – hört, was ist das da oben? Da trommelt etwas an Deck!«
Hope vernahm nur noch, wie die Boote heftig gegen das Fischerboot stießen, hörte, wie die Riemen klappernd zusammenschlugen, ein Stampfen, und das Tuch wurde ihr vom Hals geschnitten.
Tief atmete das Mädchen auf, es sah sich von den englischen Herren umgeben, aber sein erster Blick fiel auf eine schwarze Gestalt in kurzem Röckchen, die neben ihm kniete und die Stricke an den Händen zerschnitt. Dann verlor es das Bewußtsein.
An der Südostküste Australiens liegt eine kleine Insel im Meer, weitab vom Festlande, sodaß man gut einen Tag zu segeln hat, ehe man sie erreicht, zwei Tage aber, ehe man nach dem ersten größeren Hafen, Cooktown, kommt. Sagte ich, sie wäre klein, so meinte ich im Gegensatz zu anderen Inseln, denn es muß schon eine sehr große und genaue Landkarte sein, auf der dieses Eiland im Weltmeere verzeichnet ist, obgleich sich auf ihm eine ganze Kolonie durch Fischerei und eigene Handindustrie ernährt.
Vor vielen, vielen Jahren, so erzählen noch die ältesten der dort hausenden Fischer, soll an dieser Küste ein spanisches Schiff gestrandet sein, die Passagiere sollen nichts weiter als das nackte Leben gerettet und lange Zeit ein Dasein wie Wilde geführt haben, bis wieder nach einigen Jahren ein Schiff landete, dessen Besatzung aus Sträflingen bestand, die von England nach Australien deportiert werden sollten. Unterwegs hatten sie eine Meuterei angezettelt, ihre Wächter überwältigt und beschlossen, sich auf der ersten Insel, welche sie unbewohnt fänden, als Kolonisten niederzulassen.
Da trafen sie auf dieses Eiland.
Sie schafften alles, was sie als notwendig erachteten, an Land und verbrannten dann das Schiff, dessen Planken sie mit dem Blute der Matrosen und Soldaten gerötet hatten, um keinen Zeugen ihrer Greuelthaten mehr zu haben, fest entschlossen, im fremden Land ein neues Leben anzufangen.
Kein Haus, keine Hütte, kein Feuer fanden sie im Innern der Insel, die mit Laubwäldern bedeckt war, aber sie trafen auf Geschöpfe, welche ein Mittelding zwischen Menschen und Affen bildeten, nackt, verwildert, die kleine Tiere im Sprunge fingen und roh verzehrten, oder Stöcke unter die Scharen von Papageien und anderen Vögeln schleuderten und diese erlegten. Der Himmel war ihr Zelt, oder höchstens schliefen sie unter einigen zusammengebogenen Büschen, der weiche Rasen war ihr Bett, sie tranken aus der hohlen Hand, und schon fehlten ihnen für einige Dinge die Begriffe.
Es waren die gestrandeten Passagiere des spanischen Schiffes, Männer, Weiber und Kinder. Mit der Zeit vermischten sich die neuen Ankömmlinge mit den früheren Bewohnern der Insel, es entstanden Häuser, Gärten und Felder. Mit den Booten wurde Fischerei betrieben, und als die Fahrzeuge nicht mehr langten, wurden neue gebaut, denn die Buchten wimmelten von Fischen. Die Wälder lichteten sich, teils weil das Holz zum Häuser- und Bootsbau gebraucht, teils weil der Boden zum Ackerbau benutzt wurde, kurz, es dauerte nicht lange, so war auf der erst unbewohnten, dann von tierähnlichen Menschen bevölkerten Insel eine ansehnliche Kolonie entstanden.
Das alles war aber, wie schon bemerkt, nur eine Sage, die sich unter den Bewohnern fortpflanzte; genauer konnte über die Entstehung der Fischerkolonie niemand etwas bestimmen. Behauptete man, daß sowohl das spanische, wie auch das englische Blut unter den Insulanern vertreten sei, so geschah dies mit Recht, denn die hohen, kräftigen Gestalten der Männer, ihre scharfen Nasen und die energischen Gesichtszüge waren die der Engländer, dagegen das schwarze Haar, und ganz besonders die zarten Figuren, der schlanke und doch üppige Wuchs der Frauen waren Merkmale der Spanier.
Einen Namen hatten sie der Insel nie gegeben, aber die ersten, welche vom Festland herüberkamen, waren entzückt von diesem kleinen Fleckchen Erde, wo alles Ruhe und Frieden atmete, und nannten es Happyland, das würde zu deutsch etwa heißen: das glückselige Land.
Und glücklich konnte man die Insulaner auch wirklich heißen.
Das Dörfchen lag am Ufer der Bucht, idyllisch, von Palmenwäldern eingerahmt. Ein aus dem Innern kommender Bach floß murmelnd zwischen den Hütten hindurch, in denen fleißige Weiber spannen und blühende Kinder spielten, sehnsüchtig der Rückkehr des Vaters wartend, der draußen auf dem Meere mit seinen Genossen fischte und sich schon auf den Augenblick freute, da er Weib und Kind begrüßen konnte. Die zurückgebliebenen Fischer saßen in ihren Kähnen, welche die Bucht bedeckten, und flickten Netze.
Es war nicht mehr alles so, wie es früher gewesen.
Vor einigen Jahren noch hatten sich die Leute damit begnügt, dem Meere nur soviel Beute abzujagen, wie sie für sich und die Ihrigen zum Unterhalt bedurften, seitdem aber erst einmal ein reicher Fischzug nach Cooktown verkauft worden war, fischte man nicht nur für sich selbst, sondern dachte auch daran, möglichst viel fangen und verkaufen zu können.
Ein Unternehmer hatte auf der Insel ein Haus angelegt, wohin die Fische gebracht wurden, nachdem sie ausgeladen worden waren. Dort wurden sie gewogen, bezahlt, in Eis gelegt und dann mittels eines Dampfers nach Cooktown gefahren, von wo aus sie in die großen Städte gingen.
Dadurch hatten die Fischer es zu einer gewissen Wohlhabenheit gebracht, denn der Verdienst war ein guter. Die Hütten verdienten diesen Namen nicht mehr, hatte ihr Aeußeres auch noch das Aussehen von solchen, so herrschte doch in ihrem Innern eine Bequemlichkeit, um die sie mancher reiche Bauer beneidet hätte. – – –
Durch die Dorfstraße schritten zwei Männer.
Der eine von ihnen zeigte den Typus der übrigen Insulaner, er war hoch gewachsen, mit schwarzem Haupthaar und Schnurrbart, wahrend der andere mehr das Aussehen eines Schweden oder Norwegers hatte. Er war bedeutend kleiner als die Bewohner der Insel, dafür aber sehr breitschultrig, und, was das Merkwürdigste war, er hatte lange, braune Locken und blaue Augen, was man sonst bei keinem der Fischer fand.
Die beiden Männer waren so gekleidet wie alle übrigen: hohe Wasserstiefel, lederne Hosen, von den Frauen gestrickte enge Jacken, und auf dem Kopf den Südwester, jenen Wachstuchhut, welcher vorn aufgeschlagen ist, hinten aber weit herunterhängt, um das ablaufende See- und Regenwasser nicht in den Nacken fließen zu lassen.
Der Kleinere sprach lebhaft auf den Größeren ein, der, ein Fischernetz über der Schulter, die lange Kalkpfeife im Mundwinkel, finster zu Boden blickte.
»Warum willst du meine Bitte abschlagen, Harris?« fragte der Blauäugige und legte seinem Genossen freundlich die Hand auf die Schulter. »Wie du mich vor vier Jahren als Bettler aufgenommen hast, heimatlos, freundlos, hungrig, fast nackt, so biete ich dir nun das an, was ich seitdem erworben habe. Nimm alles an, was ich dir geben kann, mein Boot, mein Haus – wende dich nicht so finster ab,« sagte er schnell, als sich der andere halb zur Seite wendete, »ich weiß, du bist noch kein Bettler, aber das Unglück hat dich schwer verfolgt, du besitzest fast nichts mehr als das Stück Land, das dir weder das Meer verschlingen, noch das Feuer verzehren konnte.«
»Laß mich, Björnsen,« sagte Harris dumpf. »Was mich bedrückt, weißt du am wenigsten. Was mache ich mir daraus, daß ich arm geworden bin! Noch habe ich zwei Arme, und mit denen will ich das wieder dem Meere abringen, was es mir genommen hat.«
»Aber du hast kein Boot mehr,« unterbrach ihn Björnsen, »ich bitte dich, betrachte meinen Ewer als den deinigen! Mein Knecht ist alt, er sitzt lieber in der Stube auf der Bank und schürt das Feuer, als daß er dem Sturm Trotz bietet –«
»Soll ich auch noch dein Knecht sein?« murrte der Fischer.
»Du hast mich falsch verstanden, weil du mich nicht ausreden ließest. Ich lasse den Knecht gern zu Hause, er hat schon längst sein Gnadenbrot verdient, aber fahre du mit mir zusammen auf dem Ewer, was wir fangen, teilen wir, und in einigen Wochen hast du genug zusammen, um dir ein neues Fahrzeug zu kaufen.«
»Ich habe dir schon einmal gesagt, ich nehme nichts geschenkt,« herrschte ihn der andere an.
»Du hast mein Geld allerdings ausgeschlagen, ich würde dies an deiner Stelle auch gethan haben, aber was ich dir hiermit anbiete, kannst du annehmen. Arbeite mit mir zusammen, und wir teilen redlich das Verdiente. Willst du?«
»Nein,« brauste Harris auf, »ich nehme weder von dir, noch von sonst jemandem etwas an.«
Der Blauäugige blieb stehen und legte dem Fischer beide Hände auf die Schulter.
»Was hast du gegen mich, Harris?« sagte Björnsen, und sein Gesicht hatte einen traurigen Ausdruck. »Waren wir früher nicht immer die besten Freunde, die vor Freude jubelten, wenn sie sich nach langer Trennung wiedersahen? Was ist zwischen uns getreten? Seit einem halben Jahre gehst du mir aus dem Wege; treffen wir uns, so drehst du um, setze ich mich neben dich, so stehst du auf. Endlich habe ich dich einmal gefaßt, und nun sollst du mir Rede stehen. In der Not zeigt sich der Freund, sagt ein Sprichwort meiner nordischen Heimat, und ich will es hier im Süden bewahrheiten. Komm mit mir, noch einmal, betrachte alles Meine als dein Gut!«
Als der andere schwieg, fuhr er fort:
»Warum arbeitest du im Eishaus für Tagelohn, ein jeder von den Insulanern nimmt dich auf, und wenn er dir auch nicht viel Geld giebt, so bist du doch unter deinen Kameraden!«
»Auch du bist ein Fremder,« stieß, Harris hervor.
Björnsen blieb erstaunt stehen.
»Das sagst du mir, du, der mich erst zum Hierbleiben genötigt hat? Doch ich sehe, du bist schlechter Laune! Komm' in mein Hans, das Mittagsessen wird fertig sein! Ich muß noch einmal an den Hafen, und Nancy wird dich inzwischen aufheitern.«
»Nimmermehr!« rief Harris heftig.
»So zwinge ich dich,« lachte Björnsen. »Was solltest du für einen Grund haben, mein Haus zu verschmähen?«
Er faßte den Freund, der ihn mied, unter den Arm und zog ihn in die Thüre seines Häuschens, vor dem sie sich gerade befanden.
»Hier, Nancy!« rief der junge Fischer und schob den sich Sträubenden in die Stube, »unterhalte ihn gut, und sorge dafür, daß er nicht wieder ausreißt! In zehn Minuten bin ich wieder zurück.«

Vor dem offenen Küchenfeuer saß ein Weib, welches sofort aufstand und dem Eintretenden mit ausgestreckten Händen entgegenging.
War es ihre Schönheit, die Harris blendete, daß er die Augen zu Boden schlagen mußte, oder paßte die Anmut, die Holdseligkeit, die von der Gestalt ausging, nicht zu seiner finsteren Stimmung?
Schwarze Locken umrahmten den Kopf, der einem Raphael zum Modell gedient haben könnte; die dunklen, feuchtglänzenden Augen, so feurig und doch so schwärmerisch, blickten freundlich auf den stumm Dastehenden, der keine der beiden annahm, dieser kleinen, schlanken Kinderhände. Sie trug ein einfaches, graues enganschließendes Kleid, und auf den Locken saß ein Mützchen von derselben Farbe.
»Sei mir herzlich willkommen, Harris,« sagte sie mit wohlklingender Stimme. »Es ist das erste Mal, daß du mich besuchst, seit ich verheiratet bin. Warum bist du nicht früher schon einmal gekommen, waren wir doch Gespielen zusammen? Weißt du noch, wie ich dir immer die Hälfte von meinem Butterbrot geben mußte, wenn du keins bekamst, weil du nicht artig warst?«
Harris achtete nicht auf das fröhliche Lachen. Er strich die Haare aus der Stirn zurück, warf das Netz in einen Winkel der Stube und ließ sich schwer auf einen Stuhl fallen.
Alles in diesem Raum glänzte vor Sauberkeit. Der Tisch, die Stühle, die Diele waren blank gescheuert, an den Wänden hingen Bilder und eine gemütlich tickende Uhr, und über den Kamin lief ein Sims, auf dem allerhand zierliche Nippsachen standen.
Die junge Frau hatte sich dem schweigenden Gast gegenübergesetzt.
»Was hast du nur seit einiger Zeit, Harris?« fragte sie nach einer Pause. »Es ist ein herbes Unglück, was dich betroffen, aber noch hast du Freunde genug, die dir wieder aushelfen. Sieh meinen Mann an, er brennt vor Verlangen, dir das vergelten zu können, was du an ihm gethan. Zu seiner Schande muß ich gestehen, daß er sich fast freute, als er von deinem Verlust hörte. Er konnte die ganze Nacht nicht schlafen, immer erzählte er mir seine Pläne, die er mit dir vorhatte; bald wollte er dir einen neuen Ewer kaufen, bald dir heimlich ein neues Haus bauen lassen und so weiter, und schließlich, als ich ihm sagte, daß er dich doch erst fragen müsse, ob du auch einwilligest, wurde er ordentlich böse auf mich. Und nun schlägst du ihm alles rundweg ab. Er ist sehr unglücklich darüber, er hatte sich so sehr darauf gefreut.«
Sie legte ihre Hand auf die des Mannes.
Harris zuckte zusammen, als berühre ihn glühendes Eisen, aber er beherrschte sich. Langsam senkte er die Augen und betrachtete die zierliche Hand, an deren einem Finger ein Goldreif funkelte.
»Unglücklich ist er, sagst du?« begann er leise. »Bist du glücklich. Nancy?«
»Gott sei Dank, ich bin's,« entgegnete das junge Weib, und seine Augen bezeugten, daß es die Wahrheit sprach, »aber ich meine ja nur so, daß Björnsen unglücklich ist, weil du seine Freundschaftsangebote abschlägst. Nein, wir beide sind die Glücklichsten auf der glücklichen Insel.«
Sie nahm in ihrem Eifer seine Hand und drückte sie, aber mit einem kleinen Schmerzensschrei zog sie dieselbe zurück.
»Du hast mir weh gethan, ihr Männer seid so stark.«
»Entschuldige, Nancy, gieb mir nicht wieder die Hand, dann thue ich dir auch nicht wieder weh,« sagte Harris mit rauher Stimme.
Nancy hatte jedoch schon wieder andere Fragen.
»Du arbeitest jetzt im Eishaus, Harris?«
»Ja.«
»Wieviel bekommst du denn da den Tag?«
»Zwei Schilling.«
»Das ist sehr wenig.«
Der Mann zuckte mit den Achseln.
»Besser als das Gnadenbrot essen,« meinte er dann.
»Wie ist denn der neue Direktor?« fragte Nancy wieder.
»Mister Elidoff? Ein sehr tüchtiger Mann, wenn er auch als Russe hier nicht sehr angesehen ist. Aber er besitzt Kenntnisse im Fischhandel.«
»Du sollst ja recht intim mit ihm verkehren?«
»Ich?« und Harris blickte auf. »Woher weißt du das?«
»Nun, man sagt so, du bist mehrere Male mit ihm im Walde gesehen worden.«
»Allerdings, ich mußte ihn öfters auf seinen Spaziergängen begleiten, weil er von mir Näheres über die hiesigen Fischerverhältnisse erfahren wollte.«
»Er lebt ja äußerst zurückgezogen, man bekommt ihn fast gar nicht zu sehen.«
»Elidoff ist sehr fleißig,« sagte Harris kurz, stand auf und ging nach seinem Netz.
»Du willst schon gehen?« rief das junge Weib überrascht. »Ich hoffte, du würdest bei uns zu Mittag bleiben. Mein Mann würde sich sehr darüber freuen.«
»Thut mir leid, Nancy! Adieu.«
»Und kann ich ihm nicht wenigstens sagen, daß du mit ihm fahren willst? Er geht wahrscheinlich schon in einigen Tagen mit seinem Fischewer in See und bleibt einige Zeit draußen.«
Harris blieb auf der Thürschwelle sinnend stehen. Plötzlich preßte er die Lippen fest zusammen, drehte sich um und murmelte:
»Sage ihm, ich würde ihm morgen früh bestimmten Bescheid geben! Lebewohl!«
Einige Minuten später trat Björnsen ins Zimmer.
»Also du hast ihn nicht halten können?« rief er. »Das ist sehr schade. Ich sah ihn die Dorfstraße entlang gehen, aber so schnell, daß ich ihn nicht einholen konnte, ehe er das Eishaus erreicht hatte. Und in dem mag ich nichts zu thun haben.«
»Warum nur nicht, Björusen, du gingst doch früher immer hin, um mit Mister Jenkins ein Stündchen zu plaudern.«
»Seit der neue Direktor darin ist, habe ich vor dem Hause einen Abscheu bekommen. Drei Tage ist der Russe nun hier, und ebenso lange quäle ich mein Gehirn ab, wo ich diesem Gesicht, dieser richtigen Spitzbubenphysiognomie, schon einmal begegnet bin. Mir ist es, als sehe ich immer ein Unglück vor Augen, wenn ich diesem Mann begegne, obgleich er mir auszuweichen sucht, wo und wie er nur kann. Neulich traf ich ihn einmal allein am Ufer stehen, ich wollte ihn mir recht genau betrachten, sah ihm direkt ins Gesicht, und wie er es merkte, hielt er sich schnell ein Taschentuch vor, als hatte er Zahnschmerzen, und wandte sich ab.«
»Aber trotzdem begreife ich nicht, was du gegen ihn hast. Er ist ein so hübscher, ruhiger Mann, immer sauber gekleidet, nicht so wie der vorige Direktor, dessen Kleidung immer voll Fischschuppen war.«
»Das kam vom Geschäft,« lachte der junge Fischer.
»Dagegen den Mister Jenkins, den kann ich nicht leiden, der stottert, schielt und –«
»Laß mir Mister Jenkins in Ruhe,« rief Björnsen ernst, »das ist ein Ehrenmann durch und durch, auf den lasse ich nichts kommen!«
»Ach geh, du willst schon Streit anfangen, und wir sind erst einen Monat verheiratet,« sagte Nancy und hing sich an den Hals ihres Mannes. »Was gehen uns Elidoff und Jenkins und alle übrigen an?«
»Du hast recht,« erwiderte Björnsen und küßte sein Weibchen zärtlich, »komm' und laß uns noch etwas zusammen schwatzen, bis das Essen fertig ist!«
Er setzte sich auf die Bank und zog Nancy auf seine Kniee.
»Weißt du schon, daß es morgen gerade vier Jahre her sind, seit ich auf die Insel kam?« begann er.
Nancy nickte eifrig.
»Unglücklich kam ich hierher, aber die Insel hat ihren Namen mit Recht, jetzt bin ich der Glücklichste der Sterblichen geworden,« fuhr der Fischer fort.
»Durch was denn?«
Das junge Weib that ganz erstaunt und hob schelmisch den Kopf.
»Durch dich, mein Schatz,« sagte Björnsen zärtlich und drückte einen Kuß auf die dargebotenen Lippen. »Mein Haus, mein Weib – was sollte ich noch mehr verlangen, um glücklich zu sein?«
»Björnsen,« hob das junge Weib an, »nie hast du mir erzählt, wie du in die Nähe dieser Insel kamst, da du doch aus Schweden stammst. Du hast vorhin selbst gesagt, daß du unglücklich hier an Land gebracht wurdest, so erzähle mir deine Geschichte jetzt!«
Der Fischer seufzte tief auf.
»Die Geschichte ist kurz genug, aber sehr traurig. Doch du hast recht, wir sollen keine Geheimnisse voreinander haben, ich wüßte auch keinen Grund, warum ich sie dir nicht erzählen sollte, und da sich der Hauptteil derselben gerade heute vor vier Jahren zutrug, will ich sie dir jetzt mitteilen.«
Nancy schmiegte sich dicht an die Brust ihres Mannes, und dieser begann:
»Wie du weißt, bin ich ein Schwede und war früher nicht Fischer, sondern Landwirt. Ich besaß in meiner Heimat ein kleines Bauerngut und lebte darauf mit meiner Mutter und Schwester, arbeitete von früh bis abends spät, ohne mehr zu erwerben, als wir eben bedurften, aber ich war schon glücklich, wenn ich meine Lieben gesund und munter sah. Da starb die Mutter, und mit ihrem Tode fing mein Unglück an. Ein strenger Winter zerstörte die Frühsaat, ein regenloser Sommer ließ das Getreide nicht aufkommen, kurz, ich hatte Mißernten, und zwar nicht nur einmal, sondern mehrere Jahre hintereinander. Die konnte ich auf meinem Gütchen nicht aushalten, ich wurde gezwungen, Schulden zu machen. Aber immer neue Unglücksschläge kamen hinzu, Feuer, Hagelschlag, sodaß ich schließlich dem Ruine meines Vermögens entgegensah.
»Da wurde bei uns bekannt, daß in Australien gutes Land für einen Spottpreis verkauft würde. Ich erkundigte mich näher und erfuhr auch, daß man sich dort mit wenig Mitteln, aber durch eisernen Fleiß eine schöne Existenz gründen könne. Sofort war mein Entschluß gefaßt. Ich verkaufte mein Gut, raffte alles bare Geld zusammen und verließ mit meiner Schwester mein Heimatland, um auf einem Dampfer nach Australien zu fahren.«
Björnsen seufzte tief auf und fuhr dann fort:
»Wir hatten stets schönes Wetter, unsere Fahrt ging sehr schnell von statten, und ich entsinne mich noch, daß einmal der erste Steuermann mit dem Kapitän einen heftigen Streit hatte, weil er so ungeheuer schnell fahre; ob er vielleicht glaube, er dürfe sich das erlauben, weil das Schiff so außerordentlich hoch versichert worden sei. Eines Abends legten wir uns in der Erwartung in die Koje, am anderen Morgen die Südost-Küste von Australien zu sehen, wohin unser Ziel gerichtet war, aber ach, es kam anders!«
Wieder schwieg der Mann und sah starr vor sich hin, bis ihm Nancy zärtlich die Wange streichelte.
»In der Nacht hörte ich ein heftiges Laufen und Stampfen an Deck, ich glaubte, die Küste wäre in Sicht, und da ich mir den ersten Anblick meines zukünftigen Heimatlandes nicht entgehen lassen wollte, warf ich schnell einige Sachen über und eilte an Deck. Ich konnte gerade noch hören, wie der erste Steuermann nach dem Kapitän schrie, der nirgends zu finden sei, da, Nancy, erschrick nicht ...«
Das junge Weib schmiegte sich fest an die Brust des starken Mannes, der mit entgeisterten Augen vor sich hinstarrte.
»Da geschah plötzlich ein furchtbarer Knall, ich fühlte mich in die Luft geschleudert, und als ich wieder zu mir kam, lag ich im Wasser – von dem großen Schiff war nichts mehr zu sehen, nur Trümmer bedeckten das Meer, und zerstückte Leichname schwammen umher.«

Der Fischer senkte den Kopf und bedeckte die Augen mit seiner Hand.
»Alles, alles fort!« begann er nach einer Weile wieder mit dumpfer Stimme. »Ich klammerte mich an ein Stück Mast und wurde lange, lange Zeit an der Unglücksstätte herumgetrieben, kein anderer Mensch war noch zu sehen, und – auch meine Schwester nicht, ich war der einzige Lebende. Einen ganzen Tag hing ich an dem Holze, der Abend kam und brachte heftigen Wind mit sich, und in der Nacht wühlte ein Sturm die Wogen auf, daß ich bald hoch emporgeschleudert wurde, bald wie in einen Abgrund hinabstürzte. Hundert Male schon hatte ich den Gedanken gefaßt, den Mast fahren zu lassen und mein Grab in den Wellen zu suchen, anstatt mich immer wieder der Hoffnung hinzugeben, aber es war mir, als ob mir stets eine Stimme zuflüsterte: ›Halte fest, Björnsen, halte fest, du wirst nach deinem Glücke gebracht!‹ Ich weiß nicht, wie viele Stunden der Nacht schon verflossen waren, da sah ich plötzlich ein Lichtchen in der Ferne auftauchen. Ich schrie, ich heulte, aber ach, der Sturm übertönte meine Stimme! Und doch kam das Licht immer näher. Mit einem Male tauchte der Mond hinter den Wolken vor, und nun sah ich, wie ein Fischewer bald hoch oben auf den schäumenden Wellen tanzte, bald wie ein Pfeil in die Tiefe stürzte, aber es war eine starke, sichere Hand, die das Schiffchen lenkte. Der Mann hatte sich vor dem Steuer festgebunden und beobachtete aufmerksam den Kompaß, dann wieder das einzige, noch stehende Segel, den hilflosen Mann im Wasser hatte er noch nicht gesehen. Aber Gott lenkte seinen Blick; plötzlich drehte er das Steuer, damals glaubte ich, mit dem Seewesen völlig unbekannt, jetzt müsse er vorbeifahren, während er vorhin direkt auf mich zukam, doch ich hatte mich getäuscht, der Mann machte die kühnsten Versuche, außerhalb des Windes an mich heranzukommen, dadurch wurde ihm der Klüverbaum abgebrochen, aber endlich lag ich an Deck des Ewers.
»Harris nahm mich auf, wie ein Bruder den andern, er gab sich nicht zufrieden, mir das Leben gerettet zu haben, sondern er sorgte auch dafür, daß ich es weiter erhalten konnte. Er kleidete den nackten Fremden, er speiste ihn und ließ ihm sein Haus offen.
»In zwei Jahren war der einstige Bettler so weit, daß er sich einen eigenen Ewer anschaffen konnte, und wieder ein Jahr später, da lernte er dich kennen, Nancy, und vor einem Monat ist aus dem armen Schiffbrüchigen, der mit halb verzweifelndem Herzen hier gelandet wurde, der glücklichste Mensch unter der Sonne geworden!«
»Armer Mann, was hast du gelitten!« sagte Nancy zärtlich und schlug die Arme um seinen Hals. »So hast du niemanden mehr auf der Welt, der Anteil an dir nimmt?«
»Niemanden als dich, Nancy, und Harris; mag sein Benehmen auch noch so sonderbar sein, mag er mir auch noch so geflissentlich aus dem Wege gehen, ich will ihm ein Freund sein, auf den er in der Not zählen kann; nicht Leben, nicht Tod, nicht sein Zorn sollen mich davon abbringen. Wie er einst sein Leben für das meinige hingeben wollte, so bin ich auch jetzt bereit, das meinige für ihn zu opfern!« – – – – – –
Unterdessen schritt Harris die Dorfstraße entlang, bog dann links ab und stieg eine kleine Anhöhe hinauf, auf welcher ein großes, fensterloses Gebäude stand, dessen Mauerwerk, wie auch das Dach mit blendendem Weiß bestrichen waren. Es war dies das sogenannte Eishaus, in welchem die Fische in mit Eis abgekühlten Räumen so lange aufgehoben wurden, bis ein Dampfer kam und sie nach Kooktown brachte. Es war allerdings schwer, hier, dem Aequator nahe, Eis längere Zeit zu halten, aber es mußte sein, und so brachte zweimal wöchentlich ein Dampfer das Eis, und in dem weißen Gebäude, welches die Sonnenstrahlen stark reflektierte, also nicht aufsaugte, hielt es sich ziemlich gut.
Dicht an dieses Gebäude lehnte sich ein kleines, freundliches Häuschen mit grüngestrichenen Fensterkreuzen, an denen sich Weinreben emporrankten; hier wohnten Mister Elidoff, der Stellvertreter des in Kooktown wohnenden Fischhändlers, und Mister Jenkins, sein Buchhalter, welcher von Anfang an hier thätig gewesen war, aber seiner sonderbaren Eigenschaften wegen nicht dazu gepaßt hatte, den erst vor einigen Tagen abgegangenen Direktor zu ersetzen, sodaß ein neuer, Elidoff, vom Prinzipal hergeschickt worden war.
Während des ganzen Weges hatte Harris, kurze Sätze ausstoßend, ab und zu den Kopf geschüttelt, war stehen geblieben und dann wieder mit zögernden Schritten weiter gegangen.
»Was für ein Thor bin ich gewesen,« murmelte er vor sich hin, »mein eigenes Glück zu verscherzen, es dem an den Hals zu werfen, der mir alles zu danken hat! Und doch, mußte es nicht so kommen? Darf ich mich darüber wundern? Nein, ich selbst bin daran schuld, ich war blind. Zwei Gefühle streiten in meinem Herzen, das der Liebe und das des Hasses. Ich hielt Björnsen für meinen Freund, und gerade er hat mir alles geraubt. Doch nein, that er dies wirklich? Wußte er, daß ich Nancy liebte? Wußte Nancy, daß sie mir den Todesstoß gab, als sie dem Fremdling die Hand reichte? Nein, ich war ein Narr, daß ich mich ihr nicht offen erklärte – sie konnte es nicht wissen, sie hielt mich für ihren Freund, ahnte aber nicht, daß die glühendste Leidenschaft mir das Herz zerriß! Und nun, da es zu spät ist, zermartere ich mich mit Eifersucht, ich quäle mich mit dem Gedanken, wie ich mein Glück wiedererlangen kann.«
Seufzend strich sich der Fischer über die braune Stirn.
»Zu spät, zu spät,« murmelte er vor sich hin.
Als er die Anhöhe emporgestiegen, sah er ein bärtiges Gesicht im Fenster des Eishauses auftauchen.
»Was will nur dieser Russe von mir?« dachte er. »Er sucht meine Freundschaft auf jede Weise zu gewinnen, bald mit süßen Schmeichelworten, bald mit Geld. Als der Morgen nach jener Nacht anbrach, die mir meinen Ewer, wie auch mein Haus geraubt hatte, war er der erste, der mir das Geld anbot, mir alles wieder kaufen zu können. Warum zieht er sich so von aller Welt zurück, warum sind ich und Jacko die einzigen im Dorfe, mit denen er verkehrt? Dies ist mir nicht schmeichelhaft, denn Jacko ist der Abschaum der Insulaner, ein verworfenes Subjekt, das einzige, das auf der Insel existiert, die Schande für uns alle. Und gerade mit diesem habe ich ihn mehrere Male im Gespräch gesehen. Da winkt er mir schon wieder, will sehen, was er mir zu sagen hat.«
Statt nach dem Eishaus zu gehen, schritt Harris auf das Wohngebäude zu.
Mister Elidoff empfing ihn in seinem Schreibzimmer.
Er war, wie schon sein Name sagt, ein Russe, wenigstens gab er sich für einen solchen aus, aber ein Menschenkenner hätte ihn eher für einen Italiener gehalten. Das dunkelrote Gesicht war über und über mit einem dichten, schwarzen Barte bedeckt, der fast nur Stirn und Augen freiließ, und diese Augen hatten einen so stechenden Blick wie die der Tiger. Er war unbedingt ein schöner Mann, besonders die edelgebogene Nase machte ihn zu einem solchen, wenn nur nicht die Augen so unruhig gewesen wären. Man mußte immer glauben, daß dieser Mensch ein böses Gewissen habe, das ihm keine Ruhe ließ.
»Harris,« begann Elidoff und schob dem Eintretenden einen Stuhl zu, »wie gefällt Euch die Arbeit im Eishaus?«
»Schlecht! Ich sehne mich zurück nach dem Meere. Habe ich mir genug gespart, um mir ein neues Boot kaufen zu können, verlasse ich Euch wieder.«
»Setzt Euch nur!« sagte der Russe zu dem noch immer an der Thür Stehenden, und als dieser der Aufforderung Folge geleistet hatte, fuhr er fort: »Es wird aber ein Jahr vergehen, ehe Ihr so viel zusammen habt.«
»Das macht nichts, ich kann warten. Ich könnte mir das Geld dazu schneller erwerben, aber ich bin zu stolz, um bei denen, unter welchen ich früher einer der reichsten war, für Lohn zu arbeiten, hier ist dies etwas anderes. Erst vorhin habe ich ein Angebot bekommen, mit jemandem zusammen zu arbeiten, wodurch ich in einigen Wochen genügend Geld in die Hände bekommen würde.«
»Wer war das?«
»Björnsen, der Schwede, über den Ihr Euch bei mir so genau erkundigt habt!«
»Björnsen?« rief Elidoff und trat auf den Fischer zu. »Habt Ihr es angenommen? Sprecht, Mann!«
»Ich wurde so sehr gebeten, daß ich wenigens versprach, morgen früh eine bestimmte Antwort zu geben. Aber ich werde wahrscheinlich nicht annehmen.«
»Was müßtet Ihr denn bei diesem Schweden arbeiten?«
»Wir fahren zusammen auf seinem Ewer ins Meer hinaus und fischen. Sein Knecht ist alt, er will ihn zu Hause lassen und mir so Gelegenheit geben, schnell in den Besitz von Geld zu kommen, denn er will redlich mit mir teilen. Ein edles Angebot, aber ich werde es doch abschlagen.«
Erregt ging der Russe mit großen Schritten im Zimmer auf und ab, die Brauen gerunzelt und die Augen unheimlich rollend. Plötzlich blieb er vor dem Fischer stehen und begann mit leiser, eindringlicher Stimme:
»Ihr liebt Nancy?«
»Herr!« rief Harris und sprang auf, den Sprecher mit finsteren Blicken messend. »Was geht Euch das an?«
»Jacko hat es mir erzählt.«
»Jacko? Wie kommt er dazu, habt Ihr ihn gefragt?«
»Er hat mir das erzählt, was sich das ganze Dorf zuflüstert. Oder glaubt Ihr, auch ich hätte nicht gleich am ersten Tage gemerkt, daß Euch eine heimliche Leidenschaft verzehrt? Eure leidenden Mienen und mehr noch Eure Augen verraten es.«
»Das ganze Dorf flüstert es, sagtet Ihr?« brachte Harris mit bebenden Lippen hervor.
»Ein jeder weiß davon, was Ihr als Euer Geheimnis zu betrachten scheint, und mehr noch, ein jeder sagt, daß Ihr ein rechter Narr seid.«
»Herr!« brauste Harris abermals ans, »wahrt Eure Zunge, wir stehen hier auf freiem Boden, ich bin nicht Euer Sklave, den Ihr beleidigen dürft!«
»Gemach, gemach,« beschwichtigte ihn der Russe lächelnd und drückte den Aufgesprungenen auf deu Stuhl zurück. »Ich will Euch ganz genau erzählen, wie man über Euch im Dorfe spricht. Sie sagen, Ihr seid ein Narr gewesen, daß Ihr dem Manne das Leben gerettet habt, der Euch dann Eure Braut stahl.«
»Kann ich etwas dagegen thun? War es nicht der Wille des Schicksals? Üeberdies ist Nancy nie meine Braut gewesen!«
»Aber die Erwählte Eures Herzens! Und ob Ihr was dagegen thun könnt? Sie lachen Euch aus, sie spotten darüber, daß Ihr Euch das gefallen laßt. Aber Ihr seid vor Liebe blind und merkt nicht, wie sie lachend hinter Eurem Rücken mit dem Finger auf Euch deuten. ›Dem Tölpel geschieht recht‹ sagen sie, ›er ist Nancy gar nicht wert‹«
Des jungen Fischers Brust atmete schwer.

»Ich wäre Nancy nicht wert?« sagte er tonlos. »Mein Gott, kann ich dafür, daß dies alles so gekommen ist? Meine einzige Schuld ist, daß ich ihr nicht früher meine Liebe gestanden habe, und seitdem ich dies erkannt habe, ringe ich Tag und Nacht mit mir, mein heißes Blut zu beherrschen, denn es ist zu spät, Nancy ist für mich verloren.«
»Heißes Blut?« spottete der Russe. »Man sagt von Euch Insulanern, Ihr wäret Abkömmlinge von Spaniern, und das mit Recht, Ihr besitzt das feurige Temperament dieser Nation. Nur Ihr, Harris, macht diese Behauptung zur Unwahrheit, Ihr seid kalt, wie der Fisch, welchen Ihr fangt.«
»Keiner meiner Kameraden würde anders handeln als ich,« entgegnete Harris. »Wenn ihm etwas auf rechtlichem Wege genommen worden ist, so bezwingt er sich wie ein Mann, den Verlust zu vergessen.«
»Oho,« sagte Elidoff höhnisch, »da kenne ich die Insulaner denn doch besser als Ihr, obgleich ich erst drei Tage hier bin. Wie gesagt, Eure Augen sind vor Liebe blind, Eure Ohren sind verschlossen, sonst würdet Ihr hören, was man über Euch spricht, und wie sich jeder andere an Eurer Stelle benehmen würde.«
»Was sagt man davon?«
Der Russe neigte sich bis an das Ohr des Fischers und zischelte:
»Man sagt, wenn ich jemandem das Leben gerettet habe und er vernichtet mein Glück, ich kann es aber nach seinem Tode wiederbekommen, so –«
Der Russe hielt inne.
»Was dann?« flüsterte Harris atemlos.
»Dann darf ich ihm das Leben wieder nehmen.«
Der Fischer stand langsam auf und mußte sich an der Stuhllehne festhalten, so bebten ihm die Glieder vor Aufregung.
»Das also ist es, was die anderen thun würden?« hauchte er, die Augen starr auf den Russen geheftet.
»Ja, das ist es. Und fürwahr, eine schwache, feigherzige Memme ist der, der es nicht thut.«
»Aber ich kann es nicht,« stöhnte der junge Fischer und schlug die schwieligen Hände vor das Gesicht. »Nancy, Nancy, ich möchte Dich besitzen, aber nicht durch Mord.«
Er sank wie gebrochen auf einen Stuhl.
»Nancy war Euch niemals abgeneigt, ebensowenig, wie sie es jetzt ist,« begann der Russe und nahm Harris gegenüber Platz. »Ihr hättet nur um ihre Hand zu werben brauchen, nie würde das Mädchen sie Euch abgeschlagen haben.«
»Ich weiß es,« stöhnte der Mann, »zu spät – zu spät!«
»Nichts ist zu spät, es läßt sich alles wieder einholen. Wenn ihrem Manne jetzt auf der See ein Unglück zustößt, wie es so oft passiert, so würde sie ein halbes Jahr trostlos sein, ein halbes Jahr würde sie um den Verschollenen noch weinen und dann sich langsam wieder beruhigen, bis ein anderer kommt, der um ihre Hand anhält. Es ist nicht das erste Mal, daß sich so etwas auf dieser Insel ereignet.«
Der Fischer hatte noch immer das Gesicht mit den Händen bedeckt, aber der Russe zweifelte nicht daran, daß die vorgemalten Bilder ihre Wirkung verfehlen würden, und fuhr fort:
»Dann kommt Ihr, Harris, und sprecht: Nancy, einmal ist mir jemand zuvorgekommen, aber das zweite Mal soll dies nicht wieder geschehen, sei mein Weib, Nancy! Und sie wird nicht nein sagen, ich bin davon überzeugt. Unterdessen habt Ihr Euch ein hübsches, neues Haus gekauft, fahrt statt eines Ewers deren zwei, aber nicht mehr selbst, sondern habt Eure Leute dazu. Ihr bleibt zu Hause bei Eurer Nancy und –«
Dem Fischer tönte ein Heller Klang in die Ohren, er blickte auf und sah, wie der Russe einen Haufen Goldstücke von einer Hand in die andere spielen ließ.
Er war aufgesprungen, und der seltsame Ausdruck der schwarzen Augen sagte dem Verführer mehr, als er aus Worten hätte verstehen können: Harris war der Seine.
»Behaltet Euer Geld,« stieß er rauh hervor, »ich mag es nicht. Auch will ich nicht wissen, weshalb Ihr den Schweden haßt – genug, Ihr habt mir einen Weg gezeigt, den ich betreten werde, und führt er auch zur Hölle, wenn er mich nur zuerst durch's Paradies bringt.«
»Verschmäht das Geld nicht,« lächelte der Russe, »es ist der beste Freund der Menschen. Doch noch eins, wann geht Björnsen in See?«
»In einigen Tagen habe ich gehört, und,« setzte Harris mit furchtbarem Blick hinzu, »ich werde mit ihm gehen.«
»Haha,« lachte der Russe und reichte ihm die Hand, »bravo, ich wünsche Euch guten Fischfang! Vergeßt also nicht, heute abend.«
»Ich komme,« antwortete der Fischer kurz und verließ das Zimmer.
»Dem Himmel sei Dank,« stöhnte der Russe auf, als er allein war, »bald werde ich nicht mehr jeden Augenblick zu fürchten haben, von dem Schweden erkannt zu werden. Es ist ein Unglück für mich oder auch ein Glück, daß ich jeden Menschen, den ich nur einmal im Leben gesehen habe, sofort wiedererkenne. Auch dieser Bursche erinnert sich, mich schon einmal getroffen zu haben, aber ehe ihm alles klar zum Bewußtsein kommt, wird er nicht mehr zu den Lebenden zählen, dafür sorgt schon der von ihm betrogene Bräutigam. Hahaha!
»Ich brauche vor Harris nicht ängstlich zu sein, dem Burschen will ich schon noch Geld in die Hände spielen, und auch ohnedies weiß er nichts und hat mich selbst als Angeber zu fürchten. Aber ich muß mich von jetzt ab vor ihm in acht nehmen, denn hat er erst einmal die Verbrecherbahn beschritten, so wandelt er darauf schnell vorwärts. Ich weiß es aus eigener Erfahrung.«
Mit großen Schritten durchmaß er das Zimmer.
»Sonderbar, höchst sonderbar! Auf dieser Insel will ich mich endlich verstecken, um meinen Raub bescheiden, aber in Ruhe verzehren zu können, und gleich beim ersten Tritt auf der Insel begegnet mir dieser blonde Schwede.
»So sind doch einige der Katastrophe entgangen? Vielleicht aber auch nur er? Nun, ist er zum Stillschweigen gebracht, so bin ich in Sicherheit. Fremde kommen hierher nicht, und dann ist es endlich einmal Zeit, mir ein Heim zu schaffen, wie ich es mir längst ersehnt habe. Hier lebt es sich wie im Paradiese, die Mädchen sind alle Schönheiten, und durch den Dampfer kann man sich mit allem Komfort versehen lassen, die sonst nur die größten Städte zu bieten vermögen. Glück auf, ich bin nicht mehr weit vom Ziele entfernt!«
Händereibend ging der Russe auf und ab und malte sich in den schönsten Farben die Freuden aus, die ihn hier erwarteten.
Da schallten Rufe aus dem Dorfe, besonders durchdringende Kinderstimmen jubelten laut, und als Mister Elidoff an's Fenster trat, sah er zu seinem Staunen, wie eben ein großes Vollschiff von einem Dampfer, der aber wie eine Brigg aufgetakelt war, in die Bucht geschleppt wurde.
Das Innere des Inselchens zeigte noch die ursprüngliche Beschaffenheit desselben, die Fischer hatten sich damit begnügt, die Küstenstriche fruchtbar zu machen, aber tiefer ins Land waren sie nicht gedrungen. Sie waren keine poetisch veranlagten Naturen, diese Männer; im harten Kampfe mit dem Meere, ihrem Elemente, war ihnen der Sinn für Naturschönheit verloren gegangen. Sie waren zufrieden, wenn sie nach des Tages Arbeit neben Weib und Kind vor ihrem Häuschen sitzen und eine Pfeife schmauchen konnten. Sie dachten nicht daran, Streifzüge in das Innere der Paradiesisch-schönen Insel zu unternehmen.
Nur einige waren unter ihnen, welche daran Genuß fanden, hauptsächlich Frauen, deren kleiner Hausstand ihnen müßige Stunden am Tage gestattete, ebenso trieben sich auch die Kinder öfters in den Wäldern und zerklüfteten Schluchten der Insel umher.
Vom Walde rings umschlossen liegt ein freies Fleckchen, mit üppigem, weichen Rasen bedeckt. Kein gebahnter Weg, nicht einmal ein Waldpfad führt zu diesem Orte, aber doch erkennt man an dem Hügel, welcher sich an der einen Seite jäh erhebt, eine Art von Treppe. In den harten Boden sind Pfähle wagerecht eingegraben, dann ist wieder die Erde weggeschaufelt und der Absatz mit Steinen belegt, oder auch ein zufällig dort liegender Stein als Treppenstufe benutzt worden. Diese Treppe ist sehr unbequem und unsicher, läuft auch im Zickzack, aber für den leichten Schritt der Frauen und den flüchtigen Fuß der Kinder genügt sie vollkommen.
Oben auf dem Hügel kann man nur entweder rechts oder links abbiegen, denn vor dem Spaziergänger befindet sich ein Wald mit so dichtem Unterholz, daß schwerlich jemand durchdringen kann. Rechts dagegen stehen die Bäume auf dem Rücken des Hügels weiter auseinander und gestatten so den Durchgang, während links der Weg ebenfalls durch eine etwa fünf Meter breite, plötzlich abfallende Schlucht gehemmt sein würde, wenn nicht zwei darüber gelegte Baumstämme sie passierbar machten.
Die Insel war früher vulkanisch, und die Schlucht, über welche die zwei Fuß breite Brücke führt, ist so tief, daß kein Mensch beim Sturze in den Grund am Leben bleiben, sondern schon unterwegs an den hervorspringenden Zacken und Kanten des Felsgesteins zerschellen würde.
Es mußten zwei fröhliche Menschen sein, welche sich an einem wunderschönen Nachmittage durch den Wald dieser Lichtung näherten. Eine prächtige Tenorstimme jubelte laut und wurde dabei von einer weiblichen begleitet, aber der Sänger mußte sich in sonderbar übermütiger Laune befinden, denn einmal zwang er seine Stimme bis zu den tiefsten Lagen hinab, dann wieder schraubte er sie bis zu den unglaublichsten Tönen hinauf, und schnappte sie schließlich über, so mußte die Sängerin in helles Lachen ausbrechen.
Immer mehr näherten sich die Stimmen dem lauschigen Orte, immer lauter erklangen sie, bis endlich oben auf der Anhöhe vor der improvisierten Brücke eine männliche und eine weibliche Gestalt erschienen, die zwischen sich einen großen, aus Rohr geflochtenen Korb trugen.
»Bataillon halt!« kommandierte der Mann, vor der Brücke stehen bleibend. »Setzt ab die Trage!«
Er setzte den Korb hin und ließ sich darauf nieder, das Gesicht dem Mädchen zukehrend, das mit einem leichten weißen Gewände und einem breitkrempigen Strohhute bekleidet war.
»Erklären Sie sich für besiegt, Miß Thomson? So schön wie ich kann keiner singen; ich habe einmal mit zehn Tirolern um die Wette gesungen, aber ich habe lauter geschrieen, als alle zehn zusammen.«
»Bei Ihnen giebt also den Ausschlag, wer am lautesten singt?« lachte das Mädchen. »Ich dachte, es käme mehr auf die Anmut der Stimme an.«
»Was nützt mir die Anmut, wenn ich sie nicht hören kann? Nein, brüllen muß man, daß die Aepfel von den Bäumen fallen, das ist die Kunst beim Singen.« »Darüber sind wir eben wieder einmal verschiedener Meinung, Sir Williams. Doch, wollen Sie hier sitzen bleiben und mich stehen lassen?«
»Sie können sich ja einstweilen dort ins Gras setzen, es wird hoffentlich trocken sein, sonst legen Sie Ihr Taschentuch unter. Aber ich wollte Ihnen auch nur angesichts dieser Brücke sagen, daß wir auf dem richtigen Wege sind. Ich habe mich bei den Kindern des Dorfes als Fourier ganz genau erkundigt und folgendes erfahren: Wir kommen an eine Brücke, die in einem unbekannten Stile erbaut ist; das ist jedenfalls diese. Sind wir über selbige gegangen, ohne hinuntergefallen zu sein, so treffen wir rechter Hand auf eine sogenannte Treppe, zu deren Passage man sich vorher gegenseitig mit Seilen festbinden muß, sonst ist man rettungslos verloren. Unten angelangt, öffnet sich unseren entzückten Augen ein weiter Platz, auf dem Gras wächst, und das soll der Ort sein, wo wir uns häuslich niederlassen können.«
»Aber da ist er ja schon vor uns,« entgegnete Miß Thomson lachend.
»Warum haben Sie das nicht eher gesagt?« rief Charles, nahm wieder den Korb von der einen Seite und schritt als erster über den schwankenden Steg.
Nachdem sie auch das Hindernis der Treppe glücklich überwunden, wobei Charles das Mädchen unterstützte, schritten sie nach der Mitte des Platzes, stellten den Korb hin, und Charles ließ sich sofort wieder wuchtig auf den Deckel fallen, daß das Korbgeflecht sich muldenartig bog.
»Sie drücken ja die Butter breit,« rief Betty und wollte ihn herunterziehen.
»Seien Sie unbesorgt, breitgequetschte Butter schmeckt ebensogut wie andere,« beschwichtigte Charles. Er rutschte nach der einen Seite des Korbes und deutete auf die andere. »Hier setzen Sie sich mäuschenstill hin und erzählen mir, warum Sie den armen Chaushilm so gekränkt haben.«
»Ich?« fragte Betty erstaunt und setzte sich ebenfalls auf den Korb. »Ich wüßte nicht, womit ich ihm zu nahe getreten sein sollte.«
»Sie wissen doch, daß der Herzog Sie liebte?«
»Chaushilm liebt jede, die ihn einmal freundlich ansieht.«
»Aber Sie haben ihm auch Schmeicheleien gesagt oder Andeutungen gemacht, wodurch er sich zu Hoffnungen berechtigt glaubte.«
»Ist mir niemals eingefallen,« entgegnete Betty etwas entrüstet. »Sprechen Sie nicht Zeug, welches mißverstanden werden kann!«
»So!« fuhr Charles jedoch mit schulmeisterhafter Miene fort. »Haben Sie nicht damals, als wir in Ceylon auf dem Flusse fuhren, gesagt, daß Sie sich stets freuten, wenn er in Ihrer Nähe wäre, und noch vieles andere mehr?«
Das Mädchen wurde etwas verlegen.
»Das ist allerdings wahr, und ich will Ihnen offen gestehen, warum ich das gesagt habe, obgleich ich mir nichts weiter dabei dachte. Ich wollte nur dem Marquis etwas um den Bart gehen, weil er –«
»Chaushilm hat keinen Bart,« unterbrach sie Charles.
»Nun ja, ich meine, ich wollte ihm etwas schmeicheln, weil er der einzige war, der von uns allen als vorsichtiger Mensch ein Moskitonetz mitgenommen hatte.«
Charles öffnete vor Staunen den Mund.
»Ah so, nun kann ich mir verschiedenes erklären!«
»Und sehen Sie, einer Dame hätte er es auf jeden Fall abgetreten, warum sollte denn nun nicht gerade ich die Betreffende sein? Als die Mücken kamen, brachte er es mir von selbst, und während Sie alle sich mit den Tieren herumschlugen, habe ich ruhig unter meinem Netze die ganze Nacht geschlafen.«
Obgleich Charles innerlich vor Lachen bebte, fuhr er doch in ernstem Tone fort:
»Wissen Sie auch, was der Marquis gethan hat, als er erfuhr, daß Sie nichts weiter von ihm wissen wollten?«
»Nun?«
»Er hat Gift genommen.«
Das Mädchen sprang erschrocken auf.
»Es ist doch nicht wahr!« rief sie. »Sie treiben wie gewöhnlich Scherz.«
Aber Charles nickte ernsthaft mit dem Kopfe.
»Am Morgen nach dem Abend, da Sie ihn in Sydney so schnöde behandelt haben, hörte ich in meiner Koje ein leises Stöhnen,« sagte er. »Neben meiner Kabine liegt die von Chaushilm, und aus der mußte das Winseln kommen. Ich sprang schnell auf, ging hinüber, und da sah ich den Marquis auf dem Sofa liegen, bleich, mit verstörten Gesichtszügen, die Haare zerzaust, und neben ihm stand ein Tischchen mit einem Fläschchen und einem Glase darauf, in dem sich noch der Rest einer hellbraunen Flüssigkeit befand.«
»›Herzog‹ rief ich entsetzt, ›um Gottes willen, was fehlt Ihnen?‹
»Mit mattem Lächeln streckte er mir die Haud eutgegen, die Sprache versagte ihm und er griff sich nur stöhnend an die Stirn. Ich fühlte seinen Puls, er war fiebernd. Eine fürchterliche Ahnung dämmerte in mir auf, ich nahm die Literflasche uom Tische –«
»Ich denke, es war nur ein Fläschchen?« fragte Betty, die atemlos dem Erzähler zugehört.
»Allerdings, ein Literfläschchen. Ich nahm es also vom Tische, entkorkte es, roch hinein, und richtig, meine Ahnung hatte mich nicht betrogen – es war echter Jamaikarum.«
»Und damit wollte er sich vergiften?« fragte das Mädchen mit ungläubiger Miene.
»Ja, er hatte am Abend zuvor fünf Gläser starken Grog getrunken, aber selbst diese ungeheure Dosis hatte nicht vermocht, die eiserne Natur des Herzogs zu vernichten. Noch lebte er, aber ein furchtbarer Schmerz wütete in seinem Gehirn.«
»Sie sind ein entsetzlicher Mensch!« rief Betty und sprang wieder auf. »Jetzt haben Sie mir einen Schreck eingejagt, daß meine Glieder wie gelähmt sind, und der Marquis ist jedenfalls nur betrunken gewesen.«
»Glieder wie gelähmt?« sagte aber der unverwüstliche Charles. »Sie springen ja noch wie ein Lämmchen! Ueberdies wissen Sie doch, daß alle alkoholischen Getränke Gift sind, doppeltes sogar, weil sie die Menschen physisch und moralisch töten. Da hatte ich zum Beispiel einmal einen Diener, der den Wisky nur ans der Theekanne trank, weil er behauptete –«
»Verschonen Sie mich mit Ihren greulichen Geschichten,« unterbrach aber das Mädchen den Herrn an ihrer Seite, der immer mit ernsthafter Miene, wie ein Gelehrter auf dem Katheder sprach. »Sie sind heute wieder einmal anßer Rand und Band. Da Sie aber gerade von Dienern sprechen, so erzählen Sie mir, wie Sie mit Ihrem neuen Diener zufrieden sind? Aber ernsthaft, das bitte ich mir aus. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, ehe die übrigen nachkommen.«
»So ernstlich, als würde ich begraben. Sie meinen also den Leichtmatrosen. Ja, den Jungen hatte ich ins Herz geschlossen, weil er sich damals bei dem Aufsuchen der Miß Staunton so famos betragen hat. Ich kannte ihn übrigens schon von früher her, denn an demselben Tage –«
»Er mußte doch auf Ihren Befehl die beiden Frauen zusammennähen, nicht wahr?« unterbrach ihn Betty lachend.
»Stimmt, es war dieser. In derselben Nacht noch fuhr ich mit ihm an Bord der Jalliope', wo er angemustert hatte, sprach mit dem Kapitän, und da der Junge mit Freuden einwilligte, bei mir zu bleibe, so machte ich ihn frei und ließ seine Sachen nach dem ›Amor‹ bringen. Nun wurde er aber noch von der Polizei verfolgt, und da ich das natürlich nicht auf meinem Diener sitzen lassen konnte, gingen wir sofort an Land, um die Sache gleich zu regeln. Unterwegs bekam der Junge Durst, er behauptete, umfallen zu müssen, wenn er nicht etwas zu trinken bekäme, und da ich einen meiner Diener prinzipiell nicht umfallen lasse, so gingen wir erst einmal in ein Bierhaus.«
»Aber er hatte sich doch zuvor erst gewaschen und umgezogen?«
»I Gott bewahre, er ging immer noch als Topsy angemalt und angezogen. Ich sage Ihnen, die Leute staunten nicht schlecht, als ich mit der Tänzerin durch die Straßen Sidneys schritt und dann am Tisch saß, und dabei wurde der Junge so eifrig im Schwatzen, daß er sich immer in meinen Arm hakte.«
Das Mädchen mußte laut auflachen.
»Als wir aus der Restauration kamen, wurden wir beide sofort arretiert.«
»Arretiert? Beide?«
»Natürlich, alle beide! Wir schritten also vergnügt Arm in Arm zwischen zwei Konstablern her, auf der Polizei legitimierte ich mich, bezahlte die Strafe für meinen Diener, und dann begaben wir uns auf den ›Amor‹.«

»Das ist ja eine köstliche Geschichte! Und wie sind Sie jetzt mit ihm zufrieden?«
»Warten Sie mal ab, nun fängt es ja erst ordentlich an. Unterdessen war es schon spät in der Nacht geworden, einen Platz, wo der Junge schlafen konnte, gab es nicht gleich, und ich machte ihm also in meiner Kabine auf dem Sofa ein Lager zurecht, so sorglich, wie es nur eiue Mutter für ihr Kind machen kann. Am anderen Morgen stehe ich auf, werfe einen Blick auf meinen Schützling und, Herr, du meine Güte, ich denke doch gleich, mich soll vor Schrecken der Schlag rühren! Da ist das Weiße Betttuch mit einem Male pechschwarz geworden, auf dem Kopfkissen ist ein richtiges Schattenbild von den lieblichen Gesichtsumrissen des Jungen gemalt, und dieser selbst reibt sich eben mit meinem feinen Handtuche das Gesicht ab, das aber noch keine Spur von Schwärze verloren hat. Auf meinen entsetzten Blick sagte er gleichgiltig:
»›Sie erlauben doch, ich habe mich etwas gewaschen,‹ und deutete dabei nach dem Waschbecken, das eine schwarze Tunke enthielt, so dick, daß ein Löffel darin stehen konnte. Außerdem riecht es noch so wunderschön in der Kabine, und richtig, auf meine Frage erfahre ich, daß der verflixte Schlingel den ganzen Inhalt meiner Parfümflasche in das Waschbecken gegossen hat, weil er, wie er sagte, kein Wasser gefunden habe. Das ging mir denn doch etwas über die Hutschnur, und ich wollte ihn etwas hart anfassen, aber mit der ruhigsten Miene der Welt sagt er:
»›Na, na, Sie sind auch gerade kein Engel, besehen Sie sich erst einmal im Spiegel, und dann urteilen Sie über andere.‹
»Den Gefallen thue ich ihm auch und muß ihm wirklich recht geben, mein Gesicht sieht nur um eine Schattierung heller aus als das seinige, und wie ich meine weiße Weste suchen will, da schleudert er mir mit der Fußspitze einen schwarzen Lappen zu, gerade, als wenn ich statt durch die Straßen Sydneys einen Spaziergang durch alle Schornsteine der Stadt gemacht hätte. Der Kerl hat sich immer so vertraulich an mich geschmiegt, und da hatten meine Hände und nach und nach mein Gesicht seine Hautfarbe angenommen. In meinem ganzen Leben lasse ich mich nicht wieder in Sidney sehen, höchstens als Neger.
»Nun ging es in die Waschküche. Zwei geschlagene Stunden habe ich mit dem Messer gekratzt, geschabt, mit der Bürste gescheuert, mit dem Lappen gerieben, etwa einen Zentner Schmierseife verbraucht, ehe ich die fingerdicke Kruste von Graphit herunter hatte, die sich mein neuer Diener auf den Leib geschmiert, und als er endlich wieder in schneeweißer Unschuld vor mir stand, da kam die Reihe an mich.«
»Machte das auch soviel Arbeit?« lachte Betty.
»Ich brauchte nur eine Stunde und einen halben Zentner Schmierseife. Endlich aber war das große Werk vollbracht, wir reichten uns mit freudestrahlenden Gesichtern die Hand und beglückwünschten uns als neugeborene Menschen. Hannes zog sich in meiner Kabine an, und ich ging hinaus, um für ihn einen Platz zu suchen, wo er sich einrichten konnte. Als ich wieder zurückkomme, steht er vor dem Spiegel und schmiert sich mit Zinksalbe die Haare voll. Na, denke ich, das willst du ihm schon noch abgewöhnen. Ich nehme meinen Rock vom Haken und werfe ihm denselben mit den Worten zu:
»›Hier, bürste einmal meinen Rock aus!‹
»Was denken Sie, was er thut? Mit der gleichen Schnelligkeit fliegt der Rock zurück, mir ins Gesicht, mein Diener steckt die Hände in die Hosentasche und spricht:
»›Ich bin Leichtmatrose, und als solcher bürste ich keinen Rock aus, das machen Sie sich einmal ruhig selber. Und übrigens, das merken Sie sich, wenn Sie mich mit ›du‹ anreden, so thue ich das auch Ihnen gegenüber. Paßt Ihnen das nicht, dann gehe ich an Bord der ›Kalliope‹ zurück.‹
»Jetzt wurde mir die Geschichte doch etwas zu toll.
»›So,‹ sagte ich, ›du bist Leichtmatrose. Weißt du auch, daß ich hier als Vollmatrose fahre?‹
»›Gewiß,‹ antwortet er.
»›Dann ist dir auch bewußt, daß ein Voller den Leichtmatrosen schlagen darf?‹
»›Das weiß ich auch.‹
»Kaum hatte er das gesagt, da hatte ich ihm auch schon eins ins Genick gegeben.
»Nun kommt aber das Schönste von der ganzen Geschichte. Mein Hannes war ruhig stehen geblieben, die Hände in den Hosentaschen und lachte.
»›Weißt du auch, daß der Leichtmatrose an Bord von englischen Schiffen das Recht hat, den Vollmatrosen wieder zu schlagen?‹ sagte er.
»›Ja. – Wenn es sich dieser gefallen läßt,‹ wollte ich aber nur sagen, denn da hatte ich schon einen an der Backe sitzen, daß es mir grün und blan wurde vor den Augen.
»Im nächsten Augenblicke hatten wir uns beide gepackt, und das erste war, daß ich ihn mit dem Kopf durch meinen Spiegel renne. Darauf nimmt er den Wasserkrug und zerschlägt ihn mir an dem Schädel, ich nehme wieder eine Flasche, er wieder eine Kaffeekanne, innig umschlungen, Kopf an Kopf fahren wir durch das Bild meiner Großmutter, wir stürzen zu Boden, reißen den Waschtisch um, das Waschbecken mit der schwarzen Tunke über uns, und da liegen wir beide wieder als Neger.«
»Ach, Sie übertreiben,« unterbrach ihn das Mädchen, das nicht aus dem Lachen herauskam.
»Durchaus nicht, wenn ich niemals die Wahrheit sage, so ist es doch dieses Mal! Lassen Sie es sich von ihm selbst erzählen. Doch weiter, also wir liegen noch keuchend am Boden, abermals schwarz wie Hottentotten.
»Wieviel zahlen Sie mir monatlich als Diener?' stöhnt Hannes, läßt aber dabei meinen Hals nicht los.
»Nun war es mit mir zu Ende, lachend stehe ich auf, ebenso der Junge.
»›Aber ohne einen schriftlichen Kontrakt thue ich es nicht,‹ meinte wieder Hannes, ›alles muß seine Ordnung haben. Geben Sie Papier und Tinte her.‹
»›Ja, willst du – wollen Sie den Kontrakt aufsetzen?‹ fragte ich.
»›Natürlich! Paßt es Ihnen nicht, so gehe ich an Bord der›Kalliope‹ zurück.‹
»Er setzte dann wirklich auch die Bedingungen auf, nach denen er sich als mein Diener verpflichtet, der Merkwürdigkeit wegen habe ich sie mir abgeschrieben und werde sie Ihnen nachher vorlesen.
»Das erste war, daß mein Diener etwa auf ein Jahr Vorschuß auf seinen Gehalt nahm, und als ich ihn eine Stunde später suchte, erhielt ich den Bescheid, er wäre an Land gefahren, und zwar, wie Lord Harrlington mir lachend mitteilte, mit Glacéhandschuhen und Lackstiefeln, natürlich aus meinem Vorrate. Am Nachmittag wollte der Lord die Anker lichten, weil auch die ›Vesta‹ aus dem Hafen bugsiert wurde, aber Sie entsinnen sich, daß wir Ihnen nicht nachkamen, und warum nicht? Weil Hannes nicht zurück war. Lord Harrlington wollte ohne ihn abfahren, aber ich erklärte bestimmt, wenn mein Diener nicht mitkäme, würde ich ebenfalls an Land bleiben, und so gab mir der Kapitän zwei Stunden Zeit, ihn zu suchen. Ich begab mich sofort an Land und fuhr, von einem sehr richtigen Instinkt geleitet, direkt nach der Polizeiwache. Wen traf ich dort? Natürlich meinen Hannes, der einen Kellner geprügelt, weil dieser ihn etwas grob behandelt hatte. Ich bedurfte meines ganzen Ansehens, ihn abermals loszukaufen. Jetzt hatte der Junge bereits etwa zwei Jahre Vorschuß auf seinen Lohn.«
»Das ist ja großartig!« lachte Betty. »Mit dem muß ich näher bekannt werden. Nun also die Bedingungen!«
Charles holte aus seiner Brusttasche ein Blatt Papier, faltete es bedächtig auseinander und begann vorzulesen:
§ 1. Ich zahle meinem Diener, Hannes Vogel, monatlich drei Pfund Sterling, nebst freier Reise überall hin, wohin ich fahre, freie Kost und freies Logis.
»Das ist nicht mehr als recht,« sagte Betty. »Gewiß,« antwortete Charles, »auch Nummer zwei wird Ihre Zustimmung finden.«
§ 2. Ich darf von meinem Diener nicht verlangen, daß er thut, was er nicht thun will.
»Haha,« lachte Betty, »köstlich! Auf solche Bedingungen sind Sie doch nicht eingegangen?«
»Natürlich, es blieb mir ja nichts anderes übrig. Der Junge drohte immer, an Bord der ›Kalliope‹ zurückgehen zu wollen. Doch hören Sie weiter:
§ 3. Ich stelle meinem Diener alles, was ich habe, zur Verfügung, mit Ausnahme des Geldes.«
»Nun ist's aber genug!« rief das Mädchen.
»Das ist auch alles,« entgegnete Charles kaltblütig und steckte das Papier wieder ein.
»Und das haben Sie unterschrieben?«
»Freilich habe ich es unterschrieben. Aengstigen Sie sich deshalb nicht, Miß Thomson. Hannes ist ein Prachtkerl, ich hätte ihn für alles Geld der Welt nicht laufen lassen.«
»Ist Hannibal von Lord Harrlington nicht auch so ein ähnlicher Diener, der ›nicht thut, was er nicht thun will‹? Ich habe von ihm erzählen gehört.«
»Fast derselbe Schlag, nur munterer.«
»Wo steckt denn Hannes jetzt?«
»Das kann ich Ihnen ebensowenig sagen, wie Sie mir. Jedenfalls ist er bei Miß Staunton und lehrt sie, wie man mit einer Hand die schwierigsten Knoten machen kann, oder aber, wenn die Gesellschaft schon unterwegs ist, so wird er ihr wohl etwas nachtragen. Um mich kümmert er sich gar nicht, kommt er einmal zu mir, so ist es nur darum, weil ihm seine Zigarren ausgegangen sind. Im übrigen bin ich sehr zufrieden mit ihm, sollte ich mich aber nochmals in meinem Leben nach einem neuen Diener umsehen müssen, dann fange ich lieber mit eigener Hand einen Orang-Utan und bändige ihn, als daß ich wieder einen Hannes Nummer Zwei engagiere.«
Charles stand auf, ebenso Miß Thomson.
»Lassen Sie uns wenigstens einstweilen unseren Theetisch herrichten,« begann letztere, »sonst wundern sich die Nachkommenden über unsere Saumseligkeit.«
Das Mädchen öffnete den Korb und packte Tücher, Porzellanschüsseln, Kannen, Tassen und Brot aus, wobei sie von dem Baronet thatkräftig unterstützt wurde.
»Wenn Sie so weiter hantieren,« meinte sie, als unter seinen Händen bereits die zweite Tasse zerbrach, »so werden wir nachher mit den Theetassen zu kurz kommen.«
»Dann trinken wir abwechselnd aus der Theekanne, das macht nichts weiter. Sie haben doch in der Schule gelernt, daß unsere Vorfahren, die Angelsachsen, auch bei ihren Trinkgelagen nur einen Topf benutzt haben! Warum sollen wir es denn nicht auch so machen?«
»Nein, nun wird's aber doch zu viel, Baronet, jetzt laufen Sie mit Ihren lehmigen Stiefeln über das weiße Tischtuch weg,« rief Betty unwillig und betrachtete entrüstet das schöne Linnen, über welches Charles soeben gleichmütig gegangen war, um die Löffelchen auszuteilen, und welches nun mit gelben Erdflecken den Weg bezeichnete, den er zu diesem Zweck genommen hatte.
»Habe ich Ihnen nicht gleich gesagt, Sie sollten kein Tuch mitnehmen?« entgegnete aber Charles. »Zu einem richtigen Picknick, oder Nickpick, wie Hannes sagt, muß man von der Erde essen, aus dem Hut trinken und das Brot mit dem Taschenmesser schneiden, sonst ist es kein Picknick.«
»Haben Sie schon einmal ein solches mitgemacht?« fragte lachend das Mädchen.
»Gewiß, schon unzählige Male. Fragen Sie nur Sir Hendricks, der wird Ihnen vorschwärmen, wie schön das immer gewesen ist. Theetassen haben wir überhaupt niemals mitgenommen, aber stets einen ganzen Wagen voll Bierfässer, und letzten Frühling, im vorigen Jahr, als wir gerade in Richmond hausten, da hat Lord Hastings aus dem nächsten Dorf ein Schaf gestohlen. Wir waren eben beim besten Braten, als die Dorfbewohner mit Knütteln und Dreschflegeln kamen und uns, die sie für Zigeuner hielten, so auf den Leib rückten, daß aus dem Picknick eine förmliche Schlacht wurde.«
»Und das nennen Sie ein lustiges Vergnügen? Ich danke für solche Unterhaltung.«
»Sie sind eben noch nicht hinter den richtigen Geschmack gekommen. Probieren Sie es erst einmal, und Sie werden solche urwüchsige Picknicks allen anderen vorziehen. Nun gehen Sie aber in den Wald, Miß Thomson, und schleppen Sie Brennholz zusammen, während ich die Butterbrote schneiden werde.«
»Wollen wir nicht lieber die Rollen tauschen?« lehnte aber das Mädchen lachend diesen Vorschlag ab. »Sie haben sich bereits mit einem solch großartigen Ungeschick benommen, daß ich es nicht verantworten kann, wenn ich Ihnen auch noch ein Messer in die Hand gebe.«
Aber Charles hatte bereits ein Brot und ein Messer genommen und schickte sich an, sein Werk zu beginnen.
»Oho,« sagte er, »ich bin von allen Herren des ›Amor‹ der geschickteste Brotschneider. Nehmen Sie dort den Laib, wir wollen einmal sehen, wer seines zuerst in Scheiben geschnitten und mit Butter bestrichen hat. Der letzte muß dann das Brennholz sammeln.«
»Gut, ich bin damit einverstanden,« entgegnete Betty und griff ebenfalls nach Messer und Brotlaib. »Da ist Ihr Stück Butter, richten Sie es aber so ein, daß die Butter gerade für das Brot langt. Männer streichen gern zu dick auf.«
»Soll ganz genau abgepaßt werden!« tröstete Charles. »Sind Sie bereit? Eins, zwei, drei, los!«
Das Mädchen hatte von dem großen Brot eben die dritte Scheibe abgeschnitten und bestrichen, als Williams schon rief:
»Ich bin fertig! Sie auch?«
Erstaunt blickte Betty nach dem Platz, wo der Baronet stand, und sah nun, daß er seine Butterbrote zuerst fertig hatte, aber es waren deren nur zwei. Er hatte einfach den Laib mitten durchgeschnitten und die Hälfte des Butterstücks auf je eine Seite gestrichen.

»Wer soll denn diese ungeheuer dicken Brote essen?« fragte das Mädchen. »Sie haben beim Schneiden derselben wohl an einen Bären gedacht?«
»Das nicht. Eins davon bekommt mein Freund Hastings, das andere ich. Wir beide essen immer so, ersparen dabei viel Zeit, und es ist unserer Gesundheit auch sehr zuträglich.«
»Ich möchte einmal einen Tag auf dem ›Amor‹ sein, ich glaube, über das, was man da zu sehen bekommt, könnte man eine Komödie schreiben.«
»Jedenfalls geht es dort viel praktischer zu als auf der ›Vesta‹.«
Charles erklärte nun dem fortwährend lachenden Mädchen in seiner drastischen Weise, wie sie an Bord ihres Schiffes sich in die häuslichen Arbeiten teilten, wenn die Heizer durch den Dienst der Maschine nicht zu diesen herangezogen werden könnten, und schließlich war es ihnen doch gelungen, den improvisierten Theetisch herzustellen. Charles hatte Brennholz gesammelt, und Betty war eben damit beschäftigt, ein Feuer zwischen zwei Steinen anzufachen, als die beiden pustenden und lachenden Leutchen etwas sahen, was sie veranlaßte, in ihren Bemühungen einzuhalten und den erstaunten Blick nach der Brücke zu wenden.
Dieselbe wurde von einem Manne passiert, welcher den schwankenden Baumstämmen nicht zu trauen schien, oder vielleicht auch fürchtete, vom Schwindel befallen zu werden und in die Tiefe zu stürzen, weshalb er es vorzog, den kurzen Weg nach Art der Tiere zurückzulegen. Er lag also auf den Knieen, sich dabei auf die Hände stützend und bewegte sich langsam vorwärts.
Auf der anderen Seite richtete er sich auf und schritt nach der halsbrecherischen Treppe, welche er in gleicher, vorsichtiger Weise, und zwar rückwärts, hinabkletterte.
Verwundert hatten sich unsere beiden Freunde das Benehmen des Fremden angesehen, dessen knochendürre Gestalt mit einem gelbkarrierten Anzug bekleidet war. Seine ängstlichen, unsicheren Bewegungen verrieten, daß er kein Freund von solchen Spaziergängen war, bei denen man den Hals riskieren mußte, sondern daß er lieber zu Hause hinter seinem Schreibtisch blieb.
»Mir wird unheimlich!« flüsterte Charles seiner Begleiterin zu. »Dieser Mensch hat etwas Böses im Sinne. Er schleicht gerade wie ein Indianer auf der Kriegsfährte, sehen Sie nur, wie sorgfältig er unsere Spuren untersucht.«
Der Gelbe versuchte eben, das eine Bein weit nach unten streckend, eine Stufe zu fassen, was ihm nicht gelingen wollte, weil er den einen Stein links übersah, und bei diesem Manöver lag er mit dem Kopf fast auf der Erde. Die beiden hatte er noch nicht bemerkt, ebensowenig das auf dem Rasen ausgebreitete Tischtuch mit dem Geschirr darauf.
»Der Mann ist kurzsichtig,« gab Betty ebenso leise zurück, »er hat ja eine Brille auf. Wir sollten ihm lieber helfen.«
»Thun Sie es nicht,« bat aber Charles. »Ich habe schon Indianer gesehen, die Brillen aufsetzten, wenn sie auf den Kriegspfad gingen. Haben Sie schon von Australnegern gehört? Das wird sicher einer sein.«
»Lassen Sie doch Ihren Unsinn! Jetzt hat er uns gesehen und kommt auf uns zu. Der Mann muß wirklich sehr kurzsichtig sein.«
Der Gelbe zog, als er die beiden vor dem Feuer stehen sah, den Strohhut vom Kopf und näherte sich ihnen mit mehreren Verbeugungen. Unglücklicherweise bemerkte er aber nicht das Tischtuch, sondern nahm seinen Weg gerade über dasselbe hinweg, stolperte erst über die Zuckerdose, trat in den Butternapf und dann in einen Teller mit Brotschnitten. Doch merkte er dies nicht, er mochte glauben, in Lehmboden getreten zu sein und schritt mit verlegenem Gesicht weiter.
»Halt,« rief aber da Charles und trat vor, »das geht nicht, daß Sie Ihre Stiefel mit unseren Butterbroten besohlen.«
Dabei hob er erst das rechte, dann das linke Bein des Ankommenden ungeniert in die Höhe und löste von jeder Sohle eine Brotschnitte ab. Jetzt erst bemerkte der Fremde, was er angerichtet hatte, und sein Gesicht nahm, während er sich von dem freimütigen Charles wie ein Pferd behandeln ließ, dessen Hufe untersucht werden, einen so kläglichen, ängstlichen Ausdruck an, daß Miß Thomson sofort freundlich zu ihm sagte:
»Haben wir nicht die Ehre, Mister Jenkins vor uns zu sehen? Es ist wohl nicht anders möglich, denn den anderen Herrn vom Eishaus, Herrn Elidoff, haben wir bereits gesprochen. Und dieser hat uns von Ihnen erzählt. Wollen Sie an unseren Picknick teilnehmen? Die übrige Gesellschaft muß gleich nachkommen.«
Der Angeredete suchte mit stammelnden Worten nach einer Entschuldigung, und die beiden merkten jetzt, daß der Russe recht gehabt hatte, als er von Mister Jenkins erzählte, daß er stottere, und der Spott, mit dem er den Fehler seines Buchhalters schilderte, hatte damals den Unwillen von Charles erregt.
Endlich hatte dieser herausgebracht, daß Jenkins den Mister Elidoff im Walde gesucht habe, wo er nachmittags gewöhnlich Spaziergänge mache.
»Ich habe leider nicht das Vergnügen gehabt, den Herrn zu sehen,« meinte Charles, »vorhin habe ich allerdings einmal zwischen den Bäumen ein behaartes Gesicht erblickt, aber es für das eines Affen gehalten. Lassen Sie ihn laufen und bleiben Sie hier, Mister Jenkins! Es wird Ihnen auch angenehm sein, eine Stunde zwischen gebildeten Menschen zu verkehren, wo Sie nur auf den Verkehr mit Insulanern angewiesen sind.«
»Ich da–da–danke sehr,« sagte Jenkins, »ich muß Mister Eli–do–do–doff aufsuchen, ich habe eine große Du–Du–Dummheit gemacht.«
Und fort war er schon wieder. Die beiden sahen den gelben Anzug gleich darauf zwischen den Bäumen auf der anderen Seite verschwinden.
»Ehrlich ist er,« meinte Charles, »er sagt uns wenigstens die Wahrheit, daß er eine Dummheit gemacht hat, die er wahrscheinlich seinem Herrn erzählen muß.
Hören Sie, Miß Thomson, seien Sie einmal ganz offen ...«
Charles blieb stecken.
»Nun? Sie wissen doch, daß ich immer offen bin. Mir können Sie wenigstens nicht nachsagen, daß ich Ihnen jemals eine Schmeichelei gesagt habe.«
»Das ist es eben,« rief Charles ärgerlich. »Obwohl ich doch, wie auch Sie heimlich zugeben müssen, der beste, bravste, rechtschaffenste Mensch unter der Sonne bin, behaupten Sie doch immer das Gegenteil.«
»Das habe ich niemals gethan, aber allerdings habe ich auch keine Gelegenheit, an Ihnen einen Vorzug hervorzuheben,« lächelte Betty.
»Das hätten Sie nicht?« sagte Charles entrüstet. »Stehle ich etwa? Haben Sie mich jemals betrunken gesehen?«
»Das sind alles negative Vorzüge!« lachte Betty.
»Kann ich nicht ausgezeichnet Butterbrote schneiden und Feuer anmachen?«
»Auch damit bin ich nicht so sehr zufrieden. Aber warum stellen Sie diese Fragen?«
»Hm,« brummte Charles verlegen, »was meinen Sie wohl, würde ich nicht einen ganz vorzüglichen Ehemann abgeben? Denken Sie einmal, meine Frau würde zum Beispiel ein Dienstmädchen gar nicht brauchen, ich schäle Kartoffeln, putze das Gemüse, koche Essen, mache Feuer an – –«
»Halt,« unterbrach ihn Betty. »Sie kommen schon in die Brüche mit Ihrer Kochkunst. Bei mir müßte erst Feuer angemacht und dann das Essen gekocht werden –«
»Da Sie nun gerade von sich sprechen, was ich gar nicht that, so will ich eine andere Frage stellen,« und Charles trat dicht vor das Mädchen hin, nahm dessen beide Hände fest in die seinigen und wurde plötzlich ernst.
Sie versuchte, sich freizumachen, errötete dann über und über und ließ es willenlos geschehen, daß der junge Mann einen Arm um ihre Taille legte.
»Betty,« flüsterte Charles, den Mund dicht an das Ohr des Mädchens bringend. »Warum wollen wir länger ein solch kindliches Spiel treiben? Sie haben doch längst gemerkt, wie sehr ich Sie liebe, wie ich mich immer nur mit Ihnen beschäftige, bei Ihnen sein möchte –«
»Um Gottes willen, Charles,« hauchte das Mädchen. »Nicht jetzt, da die anderen jeden Augenblick kommen müssen! Wenn wir gesehen werden!«
»Seien Sie ruhig, wir haben nichts gesehen, liebes Fräulein,« sagte da eine Stimme oben auf dem Hügel, und als die beiden Erschrockenen sich umwandten, sahen sie den Diener von Charles, der eben mit Miß Staunton, ebenfalls einen Korb tragend, die Treppe hinabkletterte.

»Verfluchter Bengel,« brummte Charles und bückte sich, um das Feuer anzublasen, während sich das ganz rot gewordene Mädchen mit den Theetassen zu schaffen machte.
»Sie kommen!« rief Hope fröhlich und sprang auf Betty zu. »In fünf Minuten ist die ganze Bande da.«
»Wer?« fragte Miß Thomson erstaunt.
»Nun, ich meine die Herren und Damen,« verbesserte sich das junge Mädchen. »Ist das aber ein schöner Platz!«
»Sehr geeignet zu einem Nickpick« bestätigte Hannes, der sich mit kritischem Blick umsah und dann seinen Korb öffnete.
»Picknick heißt es,« lachte Hope, »ich habe es ihm unterwegs schon zwanzigmal gesagt, aber er bleibt dabei, daß Nickpick richtig ist. Den ganzen Kuchen hat er auch schon aus dem Korbe gegessen,« setzte sie in wehmütigem Tone hinzu.
»In dem anderen ist mehr,« tröstete sie Hannes und fügte dann, zu den anderen beiden gewandt, hinzu: »Uebrigens habe ich mit ihr teilen wollen, aber sie aß nur einige Stückchen.«
»Und du hast – Sie haben die vier riesigen Kuchen allein gegessen, die in dem Korbe waren?« rief Charles erstaunt.
»Pah,« entgegnete sein Diener geringschätzig, »was machen Sie da für ein großes Geschrei! Die Butter habe ich mir auch noch darauf geschmiert, aber sie langte nicht einmal.«
Der Baronet hatte nicht mehr Zeit, den unverschämten Burschen über dessen neuen Streich zur Rechenschaft zu ziehen, aus dem Walde kamen die übrigen Herren und Damen, einige mit Körben beladen, und im nächsten Momente herrschte auf dem sonst so stillen Platze das regste Leben.
Die Szene, welche sich schon beim Herrichten des Theetisches zwischen Charles und Betty abgespielt hatte, wiederholte sich noch an fünf verschiedenen Plätzen, überall flackerten Feuer auf, unter Scherzen und Lachen wurde der Thee bereitet, die Butterbrote geschnitten, gedeckt serviert, bis eine halbe Stunde später alle friedlich nebeneinander saßen und sich unter freiem Himmel auf grünem Rasen die mitgenommenen Lebensmittel köstlich schmecken ließen.
Als dann der Kreis geschlossen und Gesellschaftsspiele arrangiert wurden, brach eine solche Heiterkeit unter den jungen Leutchen aus, die hier, weit, weit von ihrer Heimat entfernt, in Australien nach altenglischer Sitte ein Picknick im Walde veranstalteten, daß selbst die ernsteren von ihnen, wie zum Beispiel John Davids, mit fortgerissen wurden. Lord Hastings war nicht mehr zu erkennen; er hatte sein brummiges Gesicht und Wesen vollkommen abgestreift, und da zeigte es sich mit einem Male, daß er, wenn auch gerade kein Poet wie Marquis Chaushilm, doch ein Knittelversmacher war, der seinesgleichen suchte, und ein allgemeines Händeklatschen brach aus, als Hannes, der Leichtmatrose, plötzlich dasselbe Talent entwickelte und sich nun die beiden in Reimen unterhielten.
Zwei Stunden mochten so verstrichen sein, als ein plötzlicher Windstoß durch die Blätter des Waldes sauste. Aller Augen wandten sich dem Himmel zu, und ebenso schnell sprangen sie erschrocken auf, denn plötzlich hörte man ein Heulen im Walde. Auf den freien Platz fiel ein förmlicher Regen von abgerissenen Blättern nieder, und die Bäume auf dem Hügel, die dem Winde am meisten ausgesetzt waren, bogen sich, daß sie mit den Wipfeln fast den Boden berührten.
Niemand hatte während des Geplauders darauf geachtet, daß am Himmel schwere Wolken aufgezogen waren, daß sich die Temperatur plötzlich abgekühlt hatte, kurz, sich ein Orkan ankündigte, wie er in den tropischen Ländern so schnell auftritt, wenige Stunden wütet und dann ebenso schnell wieder nachläßt, die Gegenden, über die er hingezogen, mit entwurzelten Bäumen und abgedeckten Häusern zurücklassend.
Schnell warfen sie das Geschirr in die Körbe und traten dann eiligst den Rückweg an, um wenigstens an die Küste zu kommen, wo ein solcher Sturm weniger zu fürchten ist, als im Walde, denn leicht kann einen ein stürzender Baum treffen und zu Brei quetschen. – –
Händeringend wanderte Nancy in der kleinen Stube auf und ab, und nur, wenn sie an dem Fenster vorbeikam, blieb sie jedesmal einen Augenblick stehen, lehnte die heiße Stirn an die Scheiben und blickte hinaus auf das Meer, dessen ganze Wildheit entfesselt zu sein schien. Vor wenigen Stunden noch war es glatt wie ein Spiegel gewesen, und nun zischte und brauste es, die schaumgekrönten Wogen kamen mit donnerndem Gebraus gegen die schwache Küste gerannt, als wollten sie die Insel verschlingen, und kehrten jedesmal zurück, um noch größeren Platz zu machen.
Vollkommene Finsternis hätte geherrscht, wenn nicht der Himmel fortgesetzt von zuckenden Blitzen erleuchtet worden wäre; bald zuckten sie links, bald rechts wie feurige Schlangen durch die Luft, gefolgt von krachendem Donner, und deutlich konnte man sehen, wenn der Blitz ins Wasser eingeschlagen hatte, dann spritzte am Horizonte eine hohe Wassersäule auf, und der Donner rollte, daß den Insulanern sich das Haar vor Entsetzen sträubte. Es war glücklicherweise nicht die Zeit, zu der sich alle Fischer draußen beim Fang befanden, nur wenige hatten schon die Fahrt begonnen, und darunter war auch Björnsen, der am Morgen mit Harris die Segel seines Fischewers gehißt und unter dem Abschiedswinken seines Weibes die Bucht verlassen hatte.
Es war nicht das Unwetter, welches der jungen Frau solche Furcht einjagte, weil ihr Mann sich jetzt an Bord eines Fahrzeuges befand, das wie eine Nußschale vom Sturm auf den ungeheuren Meereswogen umhergeschleudert wurde; sie war das Kind eines Fischers, also mit dieser Gefahr vertraut, sie wußte, daß ein beherzter, kräftiger Mann sein Boot wohl gegen den Sturm halten könnte und sich nur hüten müsse, in die Nähe der Küste zu kommen, weil dort das Fahrzeug zerschmettert würde, und Björnsen wie Harris waren Männer, welche sich nun gewiß gegenseitig festgebunden hatten und sich ruhig erzählten, während ihr Schiffchen ohne Segel bald hoch auf einer Woge schwebte, bald sich tief im Wasser barg, sodaß die Wellen selbst bis über ihren halben Leib hinaufschlugen. Nein, das war es nicht. Nancy war das Weib eines Fischers, und deshalb hatte sie keine Sorge um ihren Mann, aber ein unbestimmtes Etwas trieb sie immer wieder an, den Stickrahmen beiseite zu werfen, und, den rastlosen Gang durch das Zimmer aufnehmend, manchmal in Seufzer auszubrechen, um sich dann wieder Vorwürfe über ihre grenzenlose Angst zu machen. Es war ja nicht das erste Mal, daß ihr Geliebter, jetzt ihr Mann, draußen auf dem tobenden Ozean war, und dazu war er jetzt noch von einem kräftigen Manne begleitet, von Harris, während er früher nur mit dem alten, gebrechlichen Knechte gefahren war.
Aber all dieses Einreden half ihr nichts; eine immer stärkere Unruhe bemächtigte sich des jungen Weibes, das schließlich in ein krampfhaftes Schluchzen ausbrach und sich endlich vor einem Stuhle in die Kniee warf, ihr Gesicht in den Händen vergrabend.
Da klopfte es an die Thür, erst leise, dann immer lauter, und als niemand zum Hereinkommen aufforderte, wurde sie geöffnet, und der vom Sturm zerzauste Kopf Jenkins' ward in der Spalte sichtbar.
»Nancy,« rief er, als er das Weib vor dem Stuhle liegen sah, »Nancy, wo ist dein Mann?«
Das Weib richtete sich plötzlich auf; es war etwas in dem Klange dieser Stimme, das ihr Schreckliches zuflüsterte, und als sie in das Gesicht des Fragers blickte, sah sie verstörte Züge, glanzlose Augen, die gespannt an den Lippen des Weibes hingen.
»Er ist auf See,« entgegnete sie.
»Ist er allein?« stieß der Mann hervor. Alles an ihm verriet Angst, er schien kaum warten zu können, bis er Antwort erhalten hatte, man merkte nicht, daß er an einem Sprachfehler litt.
»Nein, Harris ist bei ihm.«
»Harris!« schrie Jenkins auf. »Unglückliche, weißt du nicht, daß Harris deines Mannes größter Feind ist?«
»Harris?« wiederholte die Frau stutzend. »Nie kann ich das glauben. Mein Mann hat keinen besseren Freund als diesen. Was bringt Euch auf eine solche Idee?«
»Ich muß es dir sagen, und wenn dir auch der Schreck den Tod brächte. Ich habe eben Jacko und Mister Elidoff zufällig im Walde belauscht, wie ersterer von dem Russen Geld forderte, um sein Schweigen zu erkaufen.«
»Was geht mich dies alles an?«
»Elidoff hat Harris dafür gewonnen, mit deinem Manne zu fahren und ihn auf hoher See zu morden. Glaub' es mir, glaub' es,« fuhr er eindringlich fort, als Nancy ungläubig den Kopf schüttelte, dabei aber wie geistesabwesend vor sich hinstarrte. »Noch ist es vielleicht Zeit, ihn zu retten.«
»Jenkins!« schrie da Nancy auf, »bedenkt, wie Ihr mich foltert, mit dem, was Ihr mir da sagt! Was sollte Harris dazu verleiten, meinen Mann zu töten, was den Elidoff, einen Mörder zu werben?«
»Harris liebt dich, ich habe es vorhin bestimmt erfahren, und der Russe hat irgend einen Grund, deinen Mann zu fürchten, und so ist also Björnsens Tod beschlossen. Wohin willst du? Du kannst dich draußen nicht aufrecht halten, so wütet der Sturm.«
Aber Nancy war schon fort.
Mit aufgelöstem, fliegenden Haar kämpfte das Weib auf der Landstraße gegen den Sturm an, es klopfte an jede Thür, es bat und beschwor die öffnenden Fischer, mit ihr nach dem Ewer ihres Mannes zu suchen. Kopfschüttelnd betrachteten die Männer Nancy, sie hielten sie für wahnsinnig, daß sie von jemandem verlangte, jetzt auf die See zu gehen. Kein Mensch konnte bei diesem Sturme von der Küste abkommen. Noch bevor die Tollkühnen einige Ruderschläge gemacht hätten, ehe sie das Sturmsegel setzen konnten, hätte das Boot schon zerschmettert auf dem Strande gelegen. Sie waren gern bereit, ihr Leben für einen Kameraden zu wagen, aber das, was Nancy verlangte, war eine Unmöglichkeit.

Und außerdem, sie glaubten nicht, was ihnen das Weib da erzählte, alles wirr durcheinander mengend, Mord, Liebe und Freundschaft.
Verzweifelnd gelangte Nancy an das letzte Haus im Dorfe.
Es war noch nicht so spät am Abend, es herrschte nur eine Finsternis, welche der Nacht glich, und so waren auch die Bewohner des Häuschens noch alle wach. Nancy eilte an den hellerleuchteten Fenstern vorbei, kämpfte gegen den Sturm, bis sie die Thür erreichte, und riß diese auf.
Ihr erster Blick in die Stube belehrte sie, daß diese von einigen jener vornehmen englischen Herren und Damen besetzt war, welche erst vor einigen Tagen in ihren eigenen Schiffen an der Insel gelandet, um sie zu besichtigen. Wahrscheinlich hatten sie sich, von einem Spaziergange kommend, wegen des Sturmes hierhergeflüchtet.
Nancy war diesen eleganten Gestalten immer ausgewichen, jetzt aber schoß es ihr blitzartig durch den Kopf, ob vielleicht diese Leute, welche nur aus Liebhaberei die See befuhren, und deren Geschicklichkeit im Segeln und Rudern, bei den Herren, wie bei den Damen, sie schon mit eigenen Augen beobachtet hatte, ob vielleicht diese sie hinaus auf den wütenden Ozean begleiten würden. Die Fischer hatten recht, in ihren schweren, plumpen Booten konnten sie nicht vom Strande abkommen, aber diese Sportsleute, die beim tollsten Sturm Vergnügungsfahrten unternahmen, besaßen schlanke, scharfgebaute Kutter, mit denen ein Abkommen vom Strande wohl möglich gewesen wäre.
Nancy flehte erst den alten Fischer an, sie in seinem Ewer auf die See zu begleiten. Der Mann schlug es ihr rundweg ab, es sei unmöglich, sagte er, aber ehe noch Nancy ihren Entschluß ausgeführt hatte, kniefällig, die vier anwesenden fremden Herren und Damen um Beistand zu bitten, kam ihr schon jemand zuvor.
Ellen nahm sich zuerst des zitternden Weibes an, und kaum hatten Miß Thomson, Lord Harrlington und Williams, die vor dem Sturme hier Zuflucht gesucht, erfahren, um was es sich handle, als alle sofort beschlossen, in einem ihrer Boote das Ablaufen vom Strande zu wagen.
Schäumend spülten die Wogen über das Deck des kleinen Fahrzeuges, das mit festgezogenen Segeln und festgebundenem Steuer ein Spiel des Sturmes war. Bald steckte es das Vorderteil wie eine Taucherente unter das Wasser, bald verschwand das Heck darunter, und dann wieder neigte es zur Seite, daß die Spitzen der Masten mit dem Kamme in Berührung kamen.
Aber sie sind es gewohnt, diese Leute, welche auf solch' kleinen Ewern das Meer befahren, um Fische zu fangen, mag das Schiffchen auch hüpfen und springen, daß sie auf dem nassen Deck wie auf spiegelglattem Parkett hin- und herrutschen würden, wenn sie sich nicht selbst festbänden. Mag der hölzerne Bau vom Sturm auch bis in den Kiel hinab erschüttert werden, so lange sie keine Küste in der Nähe wissen, so lange sie beim Zucken der Blitze nur das unendliche Meer um sich sehen, so lange fühlen sie sich auch sicher und spotten des heulenden Sturmes.
In ihren wasserdichten, geölten Anzügen, die bis zum Leib hinaufreichenden Wasserstiefeln an den Füßen, den Südwester auf dem Kopf, so klammern sie sich an einen festen Gegenstand oder binden sich auch daran und spähen scharf aus, um beim Anblick des Strandes Maßnahmen zu treffen, daß der Ewer nicht darauf zugetrieben wird.
An Deck dieses Fahrzeuges standen zwei Männer, von denen der eine angebunden war, während sich der andere in dessen Nähe an eine Winde klammerte. Aber der erstere konnte sich nicht selbst an den Strick geschnürt haben, der unten in einem Ring an den Planken endete und die auf dem Rücken liegenden Hände umschlang.
»Harris,« schrie der Gefesselte – mit Mühe konnte er nur das Heulen des Sturmes übertönen – »was es auch sei, warum hast du mich im Schlaf überwältigt und wie einen Verbrecher gebunden? Hast Du einen Scherz mit mir vor?«
»Einen Scherz?« höhnte der andere. »Jawohl, gleich wird es losgehen. Sprich dein letztes Gebet, Björnsen! Du wirst die Insel nicht mehr wiedersehen.«
»Ich verstehe dich nicht! Was hast du mit mir vor? Was habe ich dir gethan, daß du mich hier wie einen Hund anbindest?«
»Es soll dir gleich begreiflich werden, du Räuber meines Glückes, Räuber meiner Braut. In fünf Minuten wird der Blitz in den Ewer schlagen, und wer sich nicht im Boote retten kann, muß eine Beute der Flammen werden.«
»Harris, du bist wahnsinnig geworden, oder, nein, ich sehe es deinen Augen an, du bist betrunken.«
»Allerdings habe ich nur Mut getrunken, ich hätte nicht geglaubt, daß es mir nach ein paar Gläsern Whisky so leicht werden würde. Adieu, Björnsen, in einem Jahr heirate ich Nancy, ich will auch um dich trauern. Adieu!«
Er tastete sich an der Bordwand fort, bis er die nach der Kajüte führende Luke erreichte, in der er verschwand.
Eine Ahnung war jetzt in dem Gefesselten aufgedämmert – er hatte sich einem falschen Freunde anvertraut, einem Manne, der ihn haßte, weil er sein Weib liebte.
Wie ein Verzweifelter riß er an den Stricken, sie gaben nicht nach, der, der sie angezogen hatte, wußte Knoten zu schürzen; er schrie nach Harris, doch dieser hörte ihn nicht. Noch wußte er nicht, was sein Kamerad mit ihm vorhatte.
Eine Minute später sah er den Südwester des Fischers wieder an der Luke auftauchen, er sah, wie er zu dem Boot ging und dasselbe mit Segeln und Riemen ausrüstete.
»Harris,« schrie der Verzweifelte, »um Gottes willen, was hast du mit mir vor? Willst du mich töten, so thue es gleich, aber laß mich nicht gefesselt einsam auf dem Schiffe zurück!«
Mit einem Sprunge stand Harris vor ihm, das Messer in der Hand.

»Töten soll ich dich?« lachte er und hob den Stahl zum Stoß. »Ich hätte allerdings das Recht, denn ich bin es, der dir das Leben geschenkt hat, und du hast mir das meine genommen, langsam, Tropfen für Tropfen; aber wenn ich dir dein Leben wiedernehme, so erhalte ich das meine auch wieder – also habe ich ein Recht dazu.«
»Wer hat dich dieses Entsetzliche gelehrt?« stöhnte Björnsen. »Ich habe dich für meinen Freund gehalten, ich konnte es ja nicht anders glauben; ich habe dir mein Leben anvertraut. Willst du mich aber töten, so thue es gleich und laß mich hier nicht elend und langsam zu Grunde gehen!«
»Wälze nicht die Schuld auf mich! Wohl bin ich dein Freund gewesen, aber du warst es, der den Verrat ausübte; du hast mir, deinem Freunde, die Geliebte geraubt, Nancy, und um sie wiederzuerlangen, mußt du sterben.«
Der Fischer wandte sich ab.
»Stoß' zu,« bat Björnsen, »mach' es kurz mit mir!«
Harris aber steckte das Messer in die Scheide und rief noch einmal zurück:
»Gieb acht, Björnsen, wenn der Blitz ins Schiff schlägt! Du warst ein Thor, daß du dich hast nicht retten können. Hahaha.«
Der Gefesselte sah noch, wie Harris das Boot über Bord ließ und nachstieg – dann war er allein.
»Mein Gott, mein Gott,« stöhnte er, »so muß ich hier elend umkommen! Nancy, mein Weib! Sie betrauert mich als einen Verunglückten, den das Meer verschlungen. Hah, nun durchschaue ich seine Schurkerei, er will mich beiseite schaffen, er liebte Nancy, und als er erkannte, daß sie mir mehr zugethan war als ihm, fing er an, mir aus dem Wege zu gehen, er haßt mich und hat zum Morde seine Zuflucht genommen.«
Wild blickte er um sich. Noch immer zuckten die Blitze, aber der Sturm hatte schon nachgelassen. Er fühlte sich noch nicht verloren, noch hatte er ja den Ewer unter den Füßen und Hoffnung, von einem anderen Schiffe entdeckt und gerettet zu werden.
»Was hatte nur Harris mit dem Blitze gemeint, der in das Schiff einschlagen würde?«
Plötzlich drang dem Gefesselten ein brandiger Geruch in die Nase, er quoll aus der offenstehenden Luke, schon konnte er einen leichten Qualm herausdringen sehen.
»Der Ewer brennt,« schrie Björnsen entsetzt, »er hat Feuer hineingelegt.«
Er betete.
Wohl spülten noch die Wellen über Deck, aber sie erreichten nicht den Rand der mit Planken umgebenen Luke, das Wasser drang also nicht hinein, und das Feuer konnte im Innern des Schiffes wüten, bis die verkohlten Deckplatten unter den Füßen des Gebundenen brachen und er in ein Feuermeer stürzte.
Es war keine Rettung mehr für ihn vorhanden; mit dumpfer Verzweiflung ergab er sich in sein Schicksal.
Da schwang sich über die Bordwand eine helle Gestalt, in triefende Gewänder gehüllt, und stürzte auf den Gefesselten zu. Erst als sie ihm das Messer aus dem Gürtel riß, hob der Mann die Augen auf, und glaubte ihnen nicht trauen zu dürfen.
»Nancy,« jubelte er auf, und schon fühlte er, wie das scharfe Messer an den Stricken sägte und schnitt, bis seine Hände frei waren.
Das Weib fand keine Worte; stumm deutete es nach dem Hinterteil des Schiffes, und der Mann hatte sofort verstanden. Im nächsten Augenblick hatte er sie auf den Armen, stand am Heck und war mit einem Sprunge über Bord, dabei das Tau erfassend, welches mit einem Haken an dem Ewer hing und dessen anderes Ende in der Dunkelheit verschwand.
Als er wieder aus dem Wasser auftauchte, den Arm um Nancy geschlungen, erschütterte ein donnernder Knall die Luft, der Ewer war verschwunden, aber in dem herabfallenden Feuerregen konnte er auf den Wellen ein Boot tanzen sehen, dessen Bemannung die Schwimmenden an dem Tau zu sich heranzog. –
Am nächsten Morgen lag die Sonne wieder freundlich auf dem ruhigen Meer, dessen leichtgekräuselte Oberfläche kaum noch verriet, daß in der Nacht ein Sturm es aufgewühlt habe, und ebenso spiegelte sie sich in dem völlig glatten Wasser der Bucht und wunderte sich, warum die Insulaner heute morgen so aufgeregt waren.
In Gruppen standen die Fischer zusammen und hörten staunend den Bericht der drei Männer und drei Frauen an, die eben aus einem Boote stiegen; sie wollten es kaum glauben, daß eine solche abscheuliche That von einem ihrer Genossen geplant worden sei; sie hatten gestern abend dem aufgeregten Weibe keinen Glauben geschenkt, aber nun bestätigte sich alles.
Jenkins stand in ihrer Mitte und bezeichnete den Russen als den Anstifter des Verbrechens, Harris nur als den Ausführer; dieser war noch nicht wieder auf der Insel gesehen worden; hoffentlich war er eine Beute des Meeres geworden, sonst würde er bei seiner Rückkehr eine solche der Insulaner werden, aber was wurde aus dem Russen? Er mußte der Rache, dem Lynchgericht der Fischer verfallen.
Die grollende Menge wandte sich nach dem Eishaus, man stürmte die Anhöhe hinauf, erbrach die verschlossenen Thüren, durchsuchte das ganze Haus, aber Elidoff war nicht darin zu finden – er hatte schon den Verrat des von ihm angestifteten Verbrechens erfahren und sich ebenfalls durch Flucht den aufgeregten Fischern entzogen.
Doch er konnte nur auf der Insel sein.
Die Küste wurde sofort ringsum bewacht, daß kein Boot mit dem Flüchtling abstoßen konnte, die Leute setzten ihre eigenen Ewer in Bereitschaft, um den Russen, sollte er ein Fahrzeug gefunden haben, verfolgen zu können – ein Dampfer war leider nicht da – sie verteilten sich und drangen ins Innere der Insel und schwuren, nicht eher mit Suchen einzuhalten, als bis sie den Schurken gefunden hatten.
Es war zwar ein schweres Stück, einer Person in den fast undurchdringlichen Wäldern der Insel nachzuspüren, welche außerdem noch mit ihren Schluchten und Höhlen unzählige Verstecke bot, aber schließlich mußte es doch gelingen, den Entflohenen ausfindig zu machen, sei es als Lebenden oder als Toten.
Auch die Herren des ›Amor‹ hatten sich der Menschenjagd angeschlossen und durchstreiften, im Gegensatz zu den Fischern wohlbewaffnet, allein oder zu zweien die Insel.
Noch waren die Verfolger mit der Durchsuchung des Eishauses beschäftigt gewesen, als eben der, dem sie vergeblich nachforschten, Elidoff, sich auf dem Platze befand, wo gestern nachmittag sich eine heitere Gesellschaft vereinigt hatte.
Er war nicht allein, sondern besprach sich mit dem Manne, den der Schwede vor einigen Tagen als den Auswurf, als die Schande der glücklichen Insel bezeichnet hatte, mit Jacko.
Die Züge des Russen drückten eine entsetzliche Angst aus, der starke, stolze Mann war mit einem Male völlig zusammengebrochen, und fast schien es, als wolle er sich dem listig blickenden Fischer zu Füßen werfen, um von ihm etwas zu erflehen, so eindringlich bittend sprach er zu ihm.
»Jacko,« wimmerte er, »ich weiß, du kannst mich retten, du kennst alle Schlupfwinkel der Insel wie kein anderer. Nimm alles, was ich bei mir habe, ich bin reich, ich will auch dich reich machen, aber hilf mir, daß ich nicht in die Hände der Insulaner falle!«
Er riß einen Beutel aus der Brusttasche und drückte ihn dem Burschen in die Hand, der ihn nachdenkend wog und dann einsteckte.

»Ich könnte Euch wohl verbergen und auch sicher von der Insel bringen,« sagte er langsam, »aber die Kleinigkeit genügt mir nicht, ich riskiere mein Leben dabei –«
»Ich gebe dir mehr, Jacko, ich gebe dir alles, was ich besitze,« stöhnte der Russe, »aber ich habe es nicht bei mir.«
»Wo habt Ihr es denn?«
»Einen Teil in Kooktown, das übrige in London; ich verschreibe dir alles.«
»An einer Verschreibung ist mir gar nichts gelegen,« entgegnete höhnisch der Fischer, »denn Ihr seid ein Schurke, der zu allem fähig ist. Aber etwas anderes habe ich mit Euch vor. Ihr seid früher Kapitän gewesen?«
Der Russe sah angstvoll in das braune Gesicht des Mannes, der ihn mit so listigen Augen anblickte.
»Ja, ich wars. Aber wozu das? Woher weißt du es?«
»Ihr seid mir empfohlen wurden, das mag Euch genügen. Gut, es sei denn, ich will Euch retten, aber nur unter der Bedingung, daß Ihr mir willig dahin folgt, wohin ich Euch bringe.«
»Und wohin willst du mich bringen?«
»In Sicherheit, das mag Euch genügen!«
»Ich traue dir nicht,« schrie Elidoff auf, »du verrätst mich, du lieferst mich aus, um dir eine Prämie zu verdienen.«
»Seid nicht so furchtsam!« lachte der Fischer. »Mein Wort als Spitzbube muß Euch genügen; denn eine andere Garantie kann ich Euch nicht geben. Aber glaubt mir, vielleicht seid Ihr noch zu Großem bestimmt. Hört Ihr die Stimmen? Sie kommen schon, um Euch zu fangen. Wartet, wir haben noch Zeit!« sagte er zu dem Russen und hielt ihn fest, als er sich zur Flucht wendete. »Wir gehen nach einem Teil der Insel, wo wir beide uns sicher verstecken können, bis ich Euch dann bei Nacht in einem Boote nach dem Festland hinüberschaffe. Aber erst wollen wir jenen noch ein Hindernis in den Weg legen.«
Damit stieg er die Treppe hinauf, und der Russe sah, wie er sich vor der Brücke auf die Kniee niederließ und etwas an den Baumstämmen machte. Dann kam er wieder herab, und beide verschwanden auf der anderen Seite im dichten Walde.
Williams und sein Diener Hannes waren die gewesen, welche Jacko sprechen gehört hatten.
Beide waren den übrigen weit vorausgeeilt, nahmen sich aber jetzt dafür destomehr Zeit und schlenderten nun gemütlich durch den Wald, sich dabei unterhaltend.
»Ist der Bursche wirklich noch auf der Insel und kann nicht herunter,« sagte der Baronet zu Hannes, »so brauchen wir uns durchaus nicht zu beeilen. Je langsamer wir vordringen, desto sicherer sind wir, an keinem Schlupfwinkel vorüberzugehen. Wo mögen denn nur Lord Harrlington und Björnsen sein, die doch vorhin dicht hinter uns waren?«
»Sie blieben mit einem Male zurück und drangen in den Wald,« entgegnete Hannes, »wahrscheinlich glaubten sie eine Spur gefunden zu haben. Ich möchte nur wissen, wo der Harris geblieben ist, ob er in dem kleinen Boot verschlagen worden oder gar verunglückt ist?«
»Glaube kaum,« meinte Charles, »diese Fischer wissen sich in ihren Booten recht gut auf dem Meere zu halten, und wenn der Sturm auch noch so sehr pfeift. Der Kerl wird schon eines Tages hier auf der Insel landen, um Nancy zu bekommen. Es ist schade, daß wir dann nicht mehr hier sind, wenn ihn die Fischer aufknüpfen.«
»Wie lange bleibt denn der ›Amor‹ noch hier?« fragte Hannes.
»So lange wie die ›Vesta‹« lachte Charles. »Sobald das Vollschiff die Anker lichtet, macht auch der ›Amor‹ Dampf auf und fährt gehorsam hinterher.«
»Da schlage doch der Donner drein,« rief Hannes entrüstet, »ich würde mich schön bedanken, wenn ich nur immer diesen Mädeln nachfahren sollte.«
»Seien Sie still!« mahnte Charles ernst. »Sie haben laut unseres Kontraktes ruhig dahin zu fahren, wohin ich gehe. Ich glaube wahrhaftig,« unterbrach er sich, »wir kommen auf dieselbe Stelle, wo wir gestern gewesen sind. Richtig, da ist ja schon die Brücke.«
Er schlug den Weg nach der Waldblöße ein, als er plötzlich hinter sich eilige Schritte hörte, und als er sich umwandte, eine weibliche Gestalt kommen sah. Es war Nancy.
»Was macht denn die Frau hier,« brummte Charles, »sie scheint ja ganz außer sich zu sein.«
»Hilfe!« schrie das Weib. »Er mordet mich.«

Sie stürzte vorwärts, der Brücke zu; sie bemerkte weder Hannes, noch den Baronet, welche sich beide durch die Büsche arbeiteten, und eben wollte sie den Fuß auf die Baumstämme setzen, als Charles sie erreichte und in den Armen auffing.
»Was ist es denn?« rief er.
Da stürmte schon wieder ein Mann durch den Wald und dicht hinter ihm ein anderer, Lord Harrlington.
»Harris,« dachte nur der Baronet, er ließ das Weib los und sprang dem Ankommenden entgegen, wurde aber durch die Wucht des Läufers zu Boden geschleudert; über ihn weg setzte der Verfolger und war dicht hinter dem Flüchtling, schon wollte er ihn greifen, als dieser die Brücke erreicht hatte.
Da schallte ein vierstimmiger Schrei durch den Wald, erstarrt standen die drei Personen da und sahen nach dem Platz, wo eben noch die Baumstämme gelegen, sie waren in die Tiefe gestürzt und mit ihnen Harris, während auf der anderen Seite der Schlucht Harrlington in die Kniee gesunken war.
Der Lord hatte, als er die Brücke vor seinen Augen hatte verschwinden sehen, seinen Lauf nicht mehr mäßigen können, aber er war mit gewaltigem Satze über die Schlucht gesprungen.
Charles beugte sich über den Rand des Abgrundes und spähte in die Tiefe.
»Tot,« murmelte er, und sich dann zu Nancy wendend, die mit stürmisch wogender Brust dastand, sagte er: »Verzeihen Sie ihm, er ist den Tod gestorben, der Ihnen beschieden war.«
Das Suchen nach Elidoff war vergeblich gewesen. Man vermißte auch Jacko, und da man diesen öfters mit dem Russen im Gespräch gesehen hatte, so wurde vermutet, daß er, der die Insel durch und durch wie kein anderer kannte, jenen ebenfalls gegen ein Versprechen von Gold versteckt hatte.
Man beschränkte sich darauf, die Küste noch sorgsamer zu beobachten, damit der geldsüchtige Fischer nicht noch auch Gelegenheit hatte, den Verbrecher nach dem Festlande hinüberzufahren, als aber am anderen Tage ein Dampfer an der Insel landete, erfuhr man, daß dies leider schon geschehen sei.
Der Kapitän erzählte, er habe am frühen Morgen ein Segelboot in der Ferne bemerkt, und durch das Fernrohr darin Jacko und den Aufseher des Eishauses gesehen, der sich, wie er geglaubt hatte, wegen irgend eines Geschäfts von dem Fischer nach Kooktown bringen ließ.
Eine unerträgliche Hitze herrschte in dem Felsenkessel, die Sonne brannte furchtbar sengend auf die nur mit leichten Kappen bedeckten Köpfe der Arbeiter, die mit Hacken und Meißel an den Wänden hämmerten und pochten, um Steine loszusprengen, welche dann auf Wagen in die Mitte des Thales geschafft wurden, wo sie von anderen eine rohe, quadratische Form erhielten.
Aber trotzdem, daß die Leute von Schweiß trieften und sich kaum noch aufrecht halten konnten, fuhren sie ununterbrochen in ihrer Arbeit fort, denn jedesmal, wenn sie auch nur einen Augenblick den erschlafften Arm sinken ließen, ertönte ein rauher Mahnruf aus dem Munde eines der Beamten, welche die Arbeiter streng beobachteten und die Macht hatten, ihre Leute wie die Sklaven zu behandeln, wie die mit Gewehren bewaffneten Posten, welche fortwährend auf- und abpatrouillierten, zeigten.
Hätte man nicht gewußt, daß dieses ein Steinbruch war, in dem Verbrecher mit Zwangsarbeit beschäftigt wurden, so hätte man dies erfahren, wenn man den Ausgang des Thales passierte. Hier standen nicht nur einige Posten, sondern ein ganzes Haus war mit ihnen besetzt, jederzeit bereit, bei einem Signalschuß den Eingang zu verbarrikadieren und auf die Reihen der etwaigen ungehorsamen Sträflinge ein verderbenbringendes Feuer zu eröffnen, ohne Rücksicht, ob es die Schuldigen oder Unschuldige vernichte.
Aber schon seit vier Jahren wurde hier von morgens früh bis abends spät die Hacke geschwungen, klang der Meißel an den himmelhoch emporstrebenden Felswänden, und noch nie war eine Gewaltthat der Sträflinge vorgekommen, denn sie wußten, wie scharf sie bewacht wurden, und welche furchtbaren Strafen dessen harrten, der es wagen wollte, ungehorsam gegen einen Vorgesetzten zu sein. Schon wenn einmal zwei beim Unterhalten ertappt wurden, rief ein Pfiff des Aufsehers einen Angestellten herbei, und sofort waren die Sprecher mit einer Kette an den Händen zusammengefesselt, für Wochen, Monate oder Jahre, je nachdem sie sich verhielten, sodaß sie nun vielleicht für ihr ganzes Leben zusammen arbeiten, essen und schlafen mußten, bis der Tod den einen von dem anderen wieder frei machte.
Der Steinbruch von Hughenden ist es.
Hughenden selbst ist ein blühendes Städtchen am Normanfluß, aber dieser Steinbruch liegt einige hundert Meilen weiter westlich, mitten in einer öden, wasserarmen Gegend, welche nur vom ›Busch‹, dem Australien eigentümlichen, übermannshohen, buschartigen Gestrüpp, bedeckt ist.
Mit der nächsten Stadt, also Hughenden, steht er zwar durch eine Eisenbahn in Verbindung, aber diese versorgt nur die dort angestellten Leute und beschäftigten Sträflinge, die schwersten Verbrecher Australiens, mit Wasser und Lebensmitteln, bringt neue Gefangene hin und nimmt ab und zu die vorrätigen Steine mit. Sonst ist der Steinbruch vollkommen von der Welt abgesondert, die eingelieferten Verbrecher sind meist Sträflinge auf Lebenszeit oder doch auf viele Jahre und kommen fast gar nicht mehr in Berührung mit der anderen Welt.
Das Gebäude, welches ihre Zellen enthält, steht im Thalkessel selbst; bei Sonnenaufgang fangen sie an mit ihrer schweren Arbeit, welche des Mittags nur für eine Stunde unterbrochen wird, und des Abends sinken sie ermüdet nieder auf die harte Lagerstätte, froh, wenn sie wenigstens nicht aneinander geschlossen sind.
Diejenigen, welche die Steine in der Mitte des Thales zuhauten, hatten die leichteste Arbeit, in der glühenden Sonne allerdings immer noch beschwerlich genug, aber sie waren doch immer noch besser daran, als die, welche die Hacke an der weißen Felswand unermüdlich schwingen mußten, welche die Sonnenstrahlen reflektierte, oder gar jene, welche die Steine auf den Schultern über das Geröll tragen, dann auf Wagen laden und abermals auf den Schultern nach dem Werkplatz schleppen mußten. Die ersteren waren einesteils solche, welche eine gute Empfehlung mitbekommen, anderenteils solche, die durch gute Führung sich die Gunst der Beamten zu erringen gewußt hatten, die letzteren dagegen solche, welche schon durch ihr Verbrechen den Unwillen der Aufseher erregten, und betrugen sie sich nicht ausgezeichnet, so konnten sie sicher sein, während ihrer ganzen Strafzeit sich mit dem Befördern der mächtigen Steine befassen zu müssen.
Stumm meißelten, hackten und schleppten die Sträflinge, deren Haare kurz geschoren waren, und die bartlosen Gesichter neigten sich finster auf die Arbeit, um nicht den verhaßten Anblick ihrer Peiniger, wie sie die Beamten nannten, haben zu müssen. Sie alle waren gleichmäßig in graue Leinwand gekleidet, welche mit den schwarzen Stempeln der betreffenden Strafanstalt über und über bedeckt waren.
Keuchend schleppte ein Mann auf der Schulter einen Steinblock über das Geröll, ließ ihn neben einem Meißelarbeiter niedergleiten und fiel selbst erschöpft zu Boden. Seine Augen flogen unstät empor – keiner der Beamten konnte ihn in diesem Augenblick sehen.
»Pst,« flüsterte er, den Blick starr auf den Meißelnden gerichtet, »Snatcher, kennst du mich noch?«
Der Angeredete, ein Mann von etwa vierzig Jahren, arbeitete ruhig weiter, aber seine Augen nahmen einen so sonderbaren Ausdruck an, daß der Frager wußte, er sollte eine Antwort erhalten.
»Ich kenne dich wohl noch,« murmelte er zwischen den zusammengebissenen Zähnen durch.
»Seit wann bist du denn hier, Thomas?«
»Seit einer Woche, habe mich nicht so schnell erwischen lassen, wie du.«
»Ich bin unschuldig hier, das weißt du,« murmelte der Meißelnde.
»Das sagt jeder,« lachte der am Boden Liegende leise, aber er erhob sich plötzlich, denn ein Beamter näherte sich seinem Platze.
Er ging nach dem Wagen und fuhr davon, um einen anderen Stein zu holen.
»Nummer 207,« sagte der Beamte zu dem am Blocke Arbeitenden, der vorhin mit Snatcher angeredet wurde, »es sollte mir leid thun, wenn ich Ihnen eine andere Arbeit geben müßte. Und vor allen Dingen hüten Sie sich, mit dem zu sprechen, der eben bei Ihnen war; wir beobachten den Burschen.«
Der Beamte wandte sich um und schritt weiter.
Nach einer Viertelstunde kam der Steinträger wieder und ließ sich wie vorhin erschöpft neben dem Steinblock zu Boden fallen.
»Snatcher,« klang es wieder zischend in die Ohren des ersten Sträflings, »wie lange willst du noch hier arbeiten?«
Der Angeredete antwortete nicht, ruhig meißelte er weiter.
»Snatcher,« klang es weiter, »ich komme von Sydney.«
Der Verbrecher ließ mit einem Male den Hammer müßiger arbeiten, und sein Gesicht nahm einen gespannten Ausdruck an.
»Ich soll dir Grüße von Weib und Kind bringen, hörst du mich nun?«
»Wie geht es ihnen?« flüsterte jener zurück.
»Sie warten auf dich.«
»Was soll ich dagegen thun?« klang es schmerzlich zurück.
»Entfliehe!« flüsterte ihm der Verführer zu.
»Es geht nicht.«
»Brich aus!«
»Nimmermehr, und wenn ich auch Gelegenheit dazu hätte. Warum bist du hier, Thomas?«
»Wegen eines albernen Mädchens. Brich aus mit uns heute nacht, Snatcher, wir sind schon alle einig, nur du fehlst uns.«
»Nimmermehr,« flüsterte Snatcher wieder, aber so bestimmt, als ob er jeder Ueberredung von vornherein begegnen wollte. »Ich bin unschuldig und werde mich meiner Strafe nicht durch Flucht entziehen.«
Wieder stand der Steinträger plötzlich auf, denn ein Beamter, aber ein anderer als vorhin, ging vorüber und warf auf ihn einen mißtrauischen Blick.
Thomas fuhr nach einem Platz, wo eine Menge Steine umherlagen, suchte sich den größten aus und versuchte ihn fortzuwälzen. Aber das schwere Gewicht spottete aller Anstrengung.
Ein lauter Fluch entschlüpfte seinem Munde, einer der Felsarbeiter sah den Mann, der sich hilfesuchend umblickte, beider Augen begegneten sich, und sofort warf jener seine Hacke hin und sprang seinem Kameraden zur Unterstützung.
Eine solche gegenseitige Hilfeleistung war im Steinbruch erlaubt, wurde sogar befohlen.
»Nicht so schnell,« keuchte Thomas, als der andere, ein gelbhäutiger Bursche, sich mit aller Kraft gegen den Stein lehnte, »nicht so schnell, ich habe dir viel zu sagen, Manzo.«
Mit mäßiger Austrengung beschäftigten sie sich mit dem Koloß, thaten aber dabei, als bemühten sie sich mit aller Macht, den Stein fortzuwälzen.
»Snatcher will nicht?« flüsterte der Gelbe.
»Nein, er ist ein Dummkopf.«
»Wir müssen ihn haben; seine Zelle grenzt an die Wachtstube. Nur er kann in dieselbe eindringen.«
»Es ist gefährlich,« sagte Thomas und brachte den Block zum ersten Male zum Stürzen.
»Nichts ist es,« entgegnete Manzo, »heute abend fahren die meisten Beamten nach Hughenden, nur wenige bleiben zurück, ich kenne das.«
»Dann muß es geschehen,« keuchte Thomas, »aber wie?«
»Laß dich mit ihm fesseln.«
»Warum gerade ich?«
»Ich kann nicht in seine Nähe kommen und mit ihm sprechen.«
»Wenn er aber in meine Zelle kommt?«
»Kann er nicht, seine ist die größere, deine viel kleiner.«
»Gut, was soll ich dann machen?«
»Um sieben Uhr geht der Zug ab,« flüsterte Manzo seinem Kameraden zu, »um acht Uhr wird die Wache abgelöst. Hier hast du den Dietrich, den ich mir gemacht habe.«
Er steckte ihm ein kleines Eisen zu.
»Weiter?« fragte Thomas, als sie den Stein auf den Wagen hoben.
»Du öffnest die Thür schon vorher, tritt die Wache heraus, ist niemand in der Stube und du wirfst die Thür zu und schließest sie ab. Das andere weißt du.«
»Ich bin aber an Snatcher gefesselt.«
»Sei nicht so thöricht,« zischte der andere durch die Zähne, »du befreist dich eben von ihm.«
»Ich werde ihn vorher noch überreden.«
»Thue das, aber traue ihm nicht, bis du ihn sicher hast! Sonst müssen wir nochmals acht Tage warten und vielleicht haben wir nie wieder so eine günstige Gelegenheit wie heute. Laß dich lieber fesseln!«

Krachend fiel der Stein auf den Wagen, und Thomas zog denselben fort, während Manzo an seine Arbeit zurückging.
Auf einen Wink Thomas' kam Snatcher herbei, um den Stein nach dessen Platz hin zu wälzen, denn dieser war noch für ihn bestimmt. Wahrend dieser Gelegenheit hatte der Verbrecher die beste Gelegenheit, mit Snatcher zu sprechen.
»So willst du nicht helfen, wenn wir heute abend ausbrechen?«
»Nein.«
»Dein Weib, deine Kinder sind in großer Not; sie hungern.«
Snatcher zuckte zusammen, aber er blieb standhaft.
»Zum dritten Male, nein, ich verlasse diesen Ort nicht eher, als bis ich meine Strafe hinter mir habe, oder bis meine Unschuld an den Tag gebracht ist.«
»Darauf wirst du lange warten können,« höhnte Thomas, aber so laut, daß alle umstehenden Sträflinge erschrocken aufsahen und am meisten Snatcher selbst.
»Willst du mich unglücklich machen?« flüsterte er.
»Ich möchte dein Kamerad werden,« rief Thomas fest.
Da sah Snatcher schon, wie von mehreren Seiten Beamte herbeigeeilt kamen.
»Nummer 207 und 326,« sagte einer von ihnen.
Er pfiff, und sofort kam aus der Wachtstube, die sich noch innerhalb des Thales befand, ein Zellenschließer mit einer langen Handkette.
»Ihr habt beide gesprochen?«
»Natürlich haben wir das,« antwortete Thomas höhnisch. »Paßt Euch das vielleicht nicht?«
Im Nu waren den beiden an je eine Hand die Schelle angelegt, so daß sie nun zusammen arbeiten mußten.
»An die Karre mit dir, 207,« sagte der Beamte barsch zu Snatcher, »ich habe heute schon einmal Rücksicht mit dir genommen, das zweite Mal nicht.«
Snatcher mußte nun an der Seite des aufgedrungenen Kameraden die schwere Arbeit des Steinschleppens verrichten, und beide wurden scharf von den Beamten bewacht, daß es Thomas, um einen Argwohn zu vermeiden, unterließ, fernerhin mit Snatcher zu sprechen.
Dagegen fand unter den übrigen Sträflingen eine heimliche Verständigung statt. Vielsagende Blicke wurden gewechselt, jedesmal, wenn die Beamten am weitesten entfernt waren, entstand ein Zischeln unter ihnen und besonders Nummer 325, 327, 328 und 329, welche erst vor einigen Tagen zugleich mit Thomas angekommen, waren es, die auf jede Weise sich mit den anderen zu verständigen suchten, unter ihnen auch Manzo. Das alles geschah aber unbemerkbar, daß die Beamten nichts davon wahrnahmen, wie sie überhaupt gerade heute etwas nachlässig im Dienste waren.
»Kennen alle nun das Zeichen?« flüsterte Manzo einem anderen Sträfling in einem unbewachten Moment zu.
»Alle,« klang es zurück.
»Gut, sobald ich gefangen werde, dann her über die Beamten und Soldaten, und nieder mit ihnen! Die Waffenkammer ist dann schon in unseren Händen, zurück können sie nicht.«
Er ging zu anderen und flüsterte dasselbe.
Jeden Abend erwarteten die Sträflinge, wie auch die Beamten, das Pfeifen der heranbrausenden Lokomotive, welche die Wagen mit Wasser und Nahrungsmitteln brachte. Das war stets das Zeichen, daß es sieben Uhr war, daß also die Arbeit eingestellt wurde. Einige Minuten vergingen noch, bis die Vorräte ausgeladen worden waren, dann wurden die Sträflinge nach den Zellen gebracht und die Beamten zogen sich nach ihren, außerhalb des Thales bei der Eisenbahnstation liegenden Wohnungen zurück.
Heute aber bedeutete der Pfiff für letztere noch etwas ganz Besonderes, denn einmal in der Woche durfte die eine Hälfte von ihnen nach Hughenden fahren, und nun war endlich dieser lang ersehnte Tag erschienen.
Daher kam es auch, daß sie sich kurz vor dem Arbeitsschlusse nicht mehr so mit den Gefangenen beschäftigten, wie es ihnen ihre Pflicht eigentlich vorschrieb.
Da warfen alle Sträflinge gleichzeitig Hacke, Meißel und Schaufel weg, der Ruf des Aufsehers zum Einstellen der Arbeit war ertönt, fast gleichzeitig mit dem Pfiff der heranbrausenden Lokomotive, welche man von hier aus wohl hören, aber nicht sehen konnte.
Die Gefangenen wurden in ihre Einzelzellen gebracht, nur die Zusammengefesselten kamen in geräumigere, dann eilten die Beamten nach ihren Wohnungen und fuhren einige Minuten später mit dem Zuge ab, während die Zurückgebliebenen Vorbereitungen zu der eine Stunde später vorzunehmenden Austeilung des Abendbrotes an die Sträflinge trafen.
Die Zelle, welche der Wachtstube am nächsten lag, mußte einst zu anderen Zwecken, als zum Aufenthalte von Sträflingen gedient haben, denn ihre Thür öffnete sich nicht, wie die der anderen, nach dem Freien, sondern, um zu ihr zu gelangen, mußte man erst durch die Wachtstube gehen.
Diese Zelle war die größte, obgleich immer noch klein genug. Sonst nahm sie Snatcher allein ein, jetzt aber hatte er einen Mitgefangenen bekommen, und das ist in einer Gegend, wo die Luft in einem geschlossenen Raume schon bei einem Bewohner bald drückend heiß wird, schon an und für sich eine harte Strafe.
»Warum hast du mir das angethan?« seufzte Snatcher und ließ sich auf die Bettstatt fallen, das einzige Möbel, welches in dem völlig nackten Raume stand. »Mein Stand bei den Beamten war ein so guter, und jetzt ist das alles vorbei.«
»Jammere nicht so, Mensch!« fuhr ihn Thomas an. »Es ist zu deinem Glück, daß alles so gekommen ist. Sei vernünftig, und in zwei Stunden bist du ein freier Mann!«
»So wollt Ihr wirklich ausbrechen?«
»Gewiß wollen wir, alles ist schon vorbereitet. Wenn auch einige der Sträflinge daran glauben müssen, das soll uns nicht davon abhalten. Lieber den Tod, als noch acht Tage länger hier wie ein Hund leben. Doch sprich, Snatcher, so bist du wirklich damals unschuldig eingesperrt worden? Wir wollten es alle nicht glauben.«
Thomas setzte sich neben seinen Mitgefangenen.
»Und doch ist es so. Es war allerdings mein Messer, welches bei der Leiche gefunden wurde, und mein Tuch, welches von ihrem Blute getränkt war, aber ich wußte damals und weiß auch jetzt noch nicht, wie beides dahin gekommen ist.«
»Zerbrich dir nicht den Kopf darüber!« tröstete ihn der andere. »Es giebt eben andere, die die Sache schlauer anfangen. Ich habe bisher auch immer für andere gearbeitet, die das Fett abschöpften, aber nun will ich einmal auf eigene Faust arbeiten.«
»Ich verstehe nicht, was du meinst.«
»Ja,« lachte Thomas, »die Zeiten sind eben andere geworden. Wie lange bist du denn nun schon hier, fünfzehn Jahre?«
»Achtzehn Jahre, und ein Jahr habe ich in Untersuchung gesessen, das ist gar nicht mitgerechnet worden. Sieben Jahre noch, dann habe ich es hinter mir.«
»Daß du ein Narr wärest,« brummte Thomas unwillig. »Also, als wir uns vor neunzehn Jahren und länger kennen lernten, da hielten wir uns beide für ehrliche Menschen –«
»Ich bin's auch geblieben,« rief Snatcher.
»Ich nicht,« meinte Thomas kurz. »Mit dem Ehrlichsein kommt man heutzutage nicht mehr weit, aber mit der Spitzbüberei auch nicht, wenn man nicht auf den richtigen Weg kommt. Darauf kam ich gleich von vornherein nicht. Zehn Jahre quäle ich mich nun so ab, ebenso wie meine vier Genossen, die mit mir gefaßt worden sind, wir rauben, morden, stehlen, bohren Schiffe an, sprengen sie in die Luft und so weiter und dann bekommen wir einige Dollars Prozente, wie sie sagen, und damit basta, das übrige geht in die sogenannte Kasse, in die Unfallkasse, sagen wir immer. Passiert uns dann einmal etwas, das heißt, werden wir gefangen genommen, dann können wir versichert sein, daß wir bald wieder herausgeholt werden, mit Gewalt oder mit List.«
Verwundert hatte ihm Snatcher zugehört.
»So würdest du auch von hier wieder befreit werden?« fragte er endlich.
»Auf jeden Fall,« versicherte der andere. »Und zwar geschieht es gewöhnlich so, es kommt ein Mann, ein Offizier oder so etwas Aehnliches, legitimiert sich, bringt Papiere mit und verlangt, Nummer so und so soll nach irgend einer Stadt zum Verhör gebracht werden. Die hier könnten noch soviele Boten abschicken oder telegraphieren – nichts versagt. Wir werden also mit Soldaten auf den Weg gebracht und unterwegs so sicher befreit, wie zweimal zwei vier ist.«
Kopfschüttelnd saß Snatcher da.
»Aber warum wartest du denn nicht ab, bis man dich oder euch befreit?«
»Fällt mir gar nicht ein! Kaum sind wir befreit, so werden wir wieder auf ein Schiff oder sonstwohin gesteckt und müssen dann ebenso wie früher arbeiten. Manzo und wir anderen haben aber nun ausgemacht, von hier auszubrechen und einmal unser Glück auf eigene Faust zu probieren; mehr als gehangen können wir nicht werden. Alle übrigen sind damit einverstanden, nur du Mucker widersetzt dich. Und gerade um dich thut es mir leid, weil wir zwei alte Schiffskameraden sind, die sich in jungen Jahren so manchmal den Wind um die Nase haben pfeifen lassen.«
»Was hast du denn begangen, daß man dich hierhergebracht hat?« fragte Snatcher.
»Wir fünf sind alle wegen Mädchenraubes aufgebracht worden.«
»Mädchenraub? Mit so etwas müßt ihr euch auch abgeben?«
»Natürlich, der spielt sogar eine Hauptrolle bei uns. So zum Beispiel waren wir jetzt seit ungefähr einem halben Jahre hinter Weibern her, die zum Vergnügen als Matrosen in der Welt herumsegeln. Aber, verstehst du wohl, nicht so wie wir; es sind alles feine, reiche Amerikanerinnen, aus deinem Heimatlande. Da hatten wir auch richtig vor vierzehn Tagen ein Mädchen gepackt und wollten es eben an Bord bringen, da kommen uns solche verdammte Engländer auf die Fährte, fassen uns und liefern uns auch gleich der Polizei aus. Das Mädchen, es hieß Hope – Hope Staunton, ihr Name wurde mehrere Male gerufen –«
»Staunton,« unterbrach ihn Snatcher nachdenkend, »der Name erinnert mich an meine Heimat, dort hieß ein reicher Pflanzer so. Du weißt doch, daß ich aus Louisiana stamme?«
»Ach was, aus Louisiana?« rief Thomas erstaunt. »Dann ist es leicht möglich, daß du auch die Kapitänin des Damenschiffes kennst. Sie heißt Petersen – Ellen Petersen.«
»Gewiß kenne ich den Namen Petersen,« und Snatcher sprang vor Freude auf. »Auf der Plantage dieses Mannes bin ich erzogen worden, mit seinem Sohne habe ich gespielt, habe ihn reiten gelehrt und bin noch bei der Hochzeit dieses Sohnes gewesen. Lebt dies Kind noch?«
»Er lebt nicht mehr, aber die Petersen hat noch einmal geheiratet und von dem jetzigen Manne, also jetzt Ellens Stiefvater, werden seltsame Dinge gemunkelt. Einige der Aelteren wollen ihn noch recht gut gekannt haben, als auch sie sich schon als Verbrecher herumtrieben, und als unser Kapitän einmal recht betrunken war, behauptete er sogar, der Stiefvater wisse mehr von unserer Bande, als er und wir alle zusammen. Aber das sind natürlich alles nur Gerüchte, denn offen herauszusprechen wagt bei uns niemand. Gewiß aber ist, daß Mister Flexan, oder aber, wie er früher geheißen haben soll, Jonathan Hemmings –«
Der Erzähler hätte beinahe laut aufgeschrieen, mit solch eisernem Griff faßte der neben ihm sitzende Sträfling seinen Arm.
»Wie hieß er? Sag' noch einmal den Namen,« brachte Snatcher mit vor Erregung heiserer Stimme hervor.
»Zum Teufel, laß' mich los!« stöhnte Thomas und entwand sich mit Mühe der starken Hand seines Kameraden. »Was ist denn mit dir? Jonathan Hemmings hieß er.«
»Jonathan Hemmings? Lebte er in Ausstralien?«
Dies alles stieß der Gefangene atemlos hervor; seine Augen hingen an den Lippen des Gefragten, und seine Glieder zitterten vor Aufregung.
»Das glaube ich bestimmt; zuletzt ist es so vor achtzehn Jahren in Melbourne gesehen worden. Gleich darauf tauchte er in den amerikanischen Staaten als reicher Mann auf und freite um die Hand der verwitweten Mistreß Petersen.«
»Wie sah er aus? Kennst du ihn?«
»Nein, aber seine Beschreibung habe ich oft hören müssen. Er soll sehr schön gewesen sein.«
»Das war er! War er groß und hatte graue Augen?«
»Stimmt, auch das ward von ihm gesagt.«
»Aber ein besonderes Zeichen? Hatte er kein Merkmal?« drängte Snatcher.
»Nicht daß ich wüßte. Doch ja,« unterbrach sich Thomas, »der Kapitän erzählte einmal, er hätte Handschuhe getragen, und als er vom Boden etwas aufheben wollte, da habe sich der kleine Finger vom linken Handschuh umgestülpt.«
»Er ist es,« jubelte Snatcher, sprang auf und wollte der Thür zueilen; er hatte ganz vergessen, daß er an seinen Kameraden gefesselt war.
»Mensch, was hast du vor?« fragte der uufreiwillig Emporgerissene.
»Frei will ich sein, und frei kann ich sein,« rief Snatcher und bemühte sich, nach der Thür zu gelangen, »der Mörder, für den ich unschuldig büßen muß, lebt, und ich kenne ihn jetzt, weiß, wo er lebt. Laß mich los, Thomas, ich will den Beamten sprechen.«
Aber Thomas faßte ihn und zog ihn mit aller Gewalt auf das Bett zurück.
»Armer Kerl,« sagte er, als es ihm gelungen war, den sich verzweifelt Wehrenden zu bändigen, »armer Kerl, du dauerst mich! Glaube mir, ich weiß es besser als du, wie es jetzt draußen in der Welt aussieht. Du würdest nicht weit kommen, dann wärest du schon wieder unschädlich gemacht.«
»Er ist aber der Mörder und nicht ich,« rief Snatcher außer sich, »ich will vor ihn treten, und wenn er mir, da ich achtzehn Jahre lang für ihn gelitten habe, offen ins Auge sehen kann, dann will ich freiwillig zurückkehren.«
»Der, den du als einen Mörder bezeichnen willst, ist ein reicher Mann und, was noch mehr ist, ein mächtiger, listiger Mann. Soviel ich von ihm erfahren habe, stehen ihm Mittel zu Gebote, von denen wir beide keine Ahnung haben, du noch viel weniger, als ich. Es kostete ihm nur ein Wort, so hätte er dich für immer stumm gemacht. Sei lieber froh, daß er deinen Aufenthaltsort gar nicht kennt, denn sonst, verlaß' dich darauf, würdest du nicht mehr zu den Lebenden zählen!«
Sprachlos starrte der Unglückliche seinen Gefährten an.
»Aber was soll ich denn thun?« brachte er endlich hervor. »Meine Frau, meine Kinder, die ich als kleine Würmer verlassen habe! Endlich sehe ich einen Weg, wie ich meine Unschuld beweisen und zu den Meinigen zurückkehren kann, und du schneidest mir gleich wieder jede Hoffnung ab!«
»Im Gegenteil, ich bringe dir diese erst. Sieh, eine halbe Stunde noch, und wir alle hier sind keine Sträflinge mehr, wir sind freie Männer. Vereinige dich mit uns, brich mit uns aus, weg über die Leichen unserer Peiniger, und auch du bist frei und kannst deine Nachforschungen auf eigene Faust fortsetzen!«
Niedergeschlagen hatte Snatcher dem mit leiser Stimme Redenden zugehört.
»Aber, dann bin ich ja ein Verbrecher geworden, was ich jetzt noch nicht bin. Was nützt mir es, wenn ich den Mörder entlarvt habe und dann selbst wegen einer Mordthat, die ich wirklich begangen, verurteilt werde?«
Lange betrachtete Thomas seinen Mitgefangenen, und sein Gesicht nahm einen traurigen Ausdruck an. In dem steinernen Herzen des Verbrechers mußten noch nicht alle guten Gefühle ausgerottet sein, sie schienen wenigstens jetzt einmal aus langem Schlafe zu erwachen.

»Snatcher,« begann er, »du hast recht, mein Vorschlag war ein unsinniger. Bleibe du hier in der Zelle. Du sollst keine Hand aufheben gegen die Beamten! Laß mich und die anderen die blutige That vollbringen. Ich scheue nichts mehr, aber doch wünschte ich, ich hätte niemals diesen Weg betreten, der ja schließlich einmal zum Galgen führen muß; und ebenso will ich nicht, daß du zum Verbrecher werdest.«
»Wohin soll ich mich wenden, wenn ihr euch befreit habt? Wird man mich nicht ebenso wie euch, gleich den wilden Raubtieren hetzen, um uns wieder unschädlich zu machen?«
»Für mich fürchte ich nichts, im Gegenteil, ich freue mich auf die Hetzjagd. Aber du?«
Thomas sah lange vor sich hin.
»Das beste wird sein,« begann er dann, »du versuchst, in die Nahe dieser Petersen zu kommen. Gelingt es dir nicht, bei den Mädchen Schutz zu finden, so begiebst du dich zu den Herren, die ihnen immer nachfolgen. Es sind dies alle ehrliche Kerle, die manchmal auch krumm gerade sein lassen, so wie ich es liebe. Aber ich habe allen Grund zu glauben, daß dich die Kapitänin nicht abweist, denke viel eher, sie nimmt jeden mit Freuden auf, der ihr etwas von ihrem Stiefvater erzählen kann. Wie du die beiden Schiffe ›Amor‹ und ›Vesta‹ findest, das ist deine Sache, du bist kein Kind mehr, und ich habe andere Sachen zu thun.«
Die Klänge eines Glöckchens erschallten. Thomas fuhr erschrocken zusammen.
»Zehn Minuten vor acht Uhr,« flüsterte er, »gleich wird die Wache abgelöst und die Suppe an die Sträflinge verteilt, und ich habe noch keine Vorbereitungen getroffen. Nun sei vernünftig, Snatcher, mische dich nicht in mein Unternehmen!«
Er zog einen Dietrich aus der Tasche und arbeitete damit an den Schlössern der Handschellen. Beide Sträflinge waren frei. Dann steckte er das Werkzeug behutsam in das Schloß der Thür und drehte etwas. Als er merkte, daß er den Riegel faßte, blieb er lautlos stehen und horchte.
Nach einigen Minuten vernahm er, wie die entferntesten Zellen aufgeschlossen und die Sträflinge mit barschem Tone aufgefordert wurden, herauszutreten: die Kerker wurden von den Beamten untersucht und dann an die in Reih' und Glied stehenden Gefangenen Suppe und Brot verteilt, während alle Soldaten, auch die sonst in der Wachtstube befindlichen, mit geladenen Gewehren vor dem Eingange standen und alles beobachteten.
Jetzt verließ der letzte Beamte die Wachtstube, leise drehte Thomas den Dietrich und befand sich im nächsten Augenblicke in dem Raume, wo an den Wänden Gewehre und Säbel hingen.
Schon näherte sich der Schließer der letzten Zelle, deren Eingang durch die Wachtstube ging, als er in seiner Beschäftigung innehielt und seine Aufmerksamkeit nach dem Ende des Korridors lenkte, wo in der Reihe der aufgestellten Sträflinge ein Drängen entstand.
»Was haben Sie da in der Tasche?« fragte der visitierende Beamte einen Kerl mit gelbem Gesichte.
»Nichts habe ich darin! Wenn Sie's nicht glauben, sehen Sie selber nach,« lautete die freche Antwort.
»Arme hoch!« kommandierte der Beamte.
Dem Befehl ward keine Folge geleistet.
»Arme hoch!«
Der Gelbe rührte sich nicht, sondern betrachtete den vor ihm stehenden Mann mit funkelnden Augen.
»Nummer 326,« rief der Beamte, und sofort kam ein Schließer, um dem Ungehorsamen Handschellen anzulegen, aber mit einem Sprunge brach der Sträfling durch die Reihen der Beamten und stand auf einem hohen Felsblocke, in den Händen einen zentnerschweren Stein.
»Wollen Sie herunterkommen!« rief der Beamte.
»Den Teufel will ich! Nein!« brüllte Manzo und hob den Stein zum Wurf. »Komm herauf, verdammter Hund, daß ich dir den Hirnkasten zerschmettern kann.«

Schon standen unten zwei Soldaten mit angeschlagenen Gewehren.
»Kommen Sie herunter!« befahl nochmals der Beamte, und als der Sträfling noch immer nicht gehorchte, erklang das Kommando:
»Legt das Gewehr an!«
»Verflucht,« schrie Manzo, warf den Stein weg und sprang vom Felsen herab, mitten unter die Beamten, welche herbeigeeilt waren, »da habt Ihr mich.«
Aber Manzo war noch nicht willens, sich ohne weiteres die Hände fesseln zu lassen, er schlug um sich und biß wie ein wildes Tier in die Hände, die seinen Arm gepackt hatten, und plötzlich ließen die Beamten erstarrt im Griffe nach.
Ein gellendes Geheul, Gepfeife und Gejohle erfüllte die Luft, einige Schüsse knallten, einige Sträflinge stürzten zu Boden, aber ehe sich noch die überraschten Beamten erholt hatten, fielen schon schmetternde Schläge auf ihre Köpfe; die letzten, welche diese Szene überlebten, sahen noch, wie die am Ausgang postierten Soldaten, welche nicht zu schießen gewagt, weil sie ebensogut die zwischen den Gefangenen befindlichen Beamten hätten treffen können, wie diese Soldaten mit den Sträflingen um die Gewehre rangen, wie sie vergeblich versuchten, in die Wachtstube einzudringen, um sich dort verbarrikadieren zu können.
Ab und zu knallte noch ein Schuß; schmetternd sausten die Spitzhacken auf die Schädel; röchelnd wälzten sich die Getroffenen auf dem Boden, das Felsgestein mit ihrem Blute rötend, einer der Beamten sah noch, wie die Wachtstube aufgerissen wurde und die Sträflinge hineinstürmten, dann fiel auch er als Opfer seines Berufes.
Der Morgen dämmerte eben im Osten, und der von der Sonne vergoldete Horizont teilte seine Farbe der Landschaft mit; ein frischer Wind machte das hohe Gras der australischen Steppe leise hin- und herschwanken, als auf dem Schienenstrang, der mitten durch die unbewohnte Wildnis führte, ein Eisenbahnzug daherbrauste. Gestern abend hatte er Townsville verlassen, vor einigen Stunden die Station erreicht, von welcher der Strang nach Hughenden abzweigt, und fuhr nun weiter nach dem Norden, nach Burketown, hielt aber noch zweimal an Zwischenstationen, also etwa aller fünf Stunden.
In einem Coupé erster Klasse saßen vier Damen und zwei Herren. Sie waren aber erst hier zusammengekommen, denn es war ein Salonwagen, welcher das Durchgehen gestattete, und da sie sich einen guten Morgen gewünscht, so mußte man annehmen, daß sie die Nacht im Schlafwagen verbracht hatten.
Miß Petersen, Thomson, Murray und Lind waren die Damen, welche sich auf der Fahrt über die Nordwestspitze Australiens befanden, und die beiden Herren waren Lord Harrlington und Sir Williams, welche sich als Begleiter der Damen angeboten und, wie gewöhnlich, nach langem Ueberlegen angenommen worden waren. Es befand sich noch ein dritter Begleiter bei der Gesellschaft, aber er war noch nicht erschienen.
Miß Petersen hatte eine Freundin gehabt, welche sich nach Australien verheiratet hatte und nun mit ihrem Manne auf einer Farm am Flinders, einem in den Golf von Karpentaria mündenden Flusse lebte. Ein Brief würde ebenso lange, vielleicht länger gebraucht haben, um die weite Entfernung zurückzulegen, und so war die rasch entschlossene Ellen jetzt auf der Reise, diese Freundin zu besuchen und zugleich auch die Gelegenheit auszuspähen, ob die Farm die ganze Gesellschaft, alle Herren und Damen der beiden Schiffe, für einige Tage zu beherbergen vermöchte. Wenn dies möglich wäre, so sollten die anderen nachkommen, und dann sollten von der Farm aus Jagdausflüge unternommen werden, wie man sie in der Nähe von Städten und an der Küste nicht geboten bekam. Die Farm lag mitten im Busch, nur von Wiesenplätzen eingerahmt, auf denen unzählige Schaf-, Rinder- und Pferdeherden weideten; verließ man aber dieselben, so betrat man sofort die Wildnis, in der es, wie Miß Turner ihrer jagdlustigen Freundin oft geschrieben, von Känguruhs, Oppossums, Emus, (australischen Strauße), und so weiter wimmelte.
Es war das erste Mal, daß sich ihnen hier der Anblick der australischen Wildnis bot, die ebenso eigentümlich ist, wie alles, was dieses Land hervorbringt. Die Wälder bestehen meist aus Gummibäumen mit hohen und starken Stämmen, aber die Blätter spenden keinen Schatten, und man wandelt zwischen ihnen wie durch Säulengänge. Der ›Busch‹ verdient eher die Bezeichnung eines Waldes, denn die Vegetation erreicht hier oft doppelte Manneshöhe, ist aber oft so dicht, daß man sich kaum hindurchdrängen kann. Diesen beiden, dem Walde und dem Busche, folgen dann wieder unabsehbare Steppen, die hauptsächlichen Tummelplätze der Känguruhs und Emus.
Die kleine Gesellschaft betrachtete lange Zeit schweigend die verschiedenen Landschaftsbilder, durch welche der Zug mit unveränderter Schnelle brauste; es herrschte bei allen jene Abspannung, welche man nach einer Nacht empfindet, die man in einem rüttelnden Eisenbahnwagen oder schwankenden Schiff mit dem Vorsatz verbracht hat, zu schlafen, ohne dabei Ruhe finden zu können.
Ellen zog die Uhr, warf einen Blick darauf und sagte, mit Mühe ein Gähnen unterdrückend:
»Noch zwei Stunden, ehe wir die nächste Station erreichen.«
»Dort wollen wir aussteigen?« fragte Charles.
»Ja. In dieser Station bekommen wir Fuhrwerk, welches uns nach der nächsten Farm bringt, und dort werden wir hoffentlich Wagen und Pferde bekommen können, um nach Blackskin, der Farm meiner Freundin, weiterreisen zu können. Die erste Fahrt beträgt zwei Stunden, die letztere aber fünf Stunden.«
»Und Sie sagen, wir erreichen die nächste Station schon in zwei Stunden?« fragte Charles nochmals.
»Ja. Ist das nicht entsetzlich lange?«
»Mein Gott!« rief Charles, »dann ist es aber die höchste Zeit, daß ich ihn wecke, sonst ist er dann noch nicht angezogen, wenn wir aussteigen.«
Lachend sahen die Zurückbleibenden Charles nach, der durch den Seitengang nach dem hinteren Teil des Wagens schritt.
»Wodurch hat eigentlich die Farm des Mister Turner den seltsamen Namen Blackskin erhalten?« fragte Harrlington Ellen, »das heißt soviel wie Schwarzhaut.«
»In der Nähe dieser Farm,« erklärte Ellen, »sind zahlreiche Stämme von Australnegern seßhaft, und das mag den Farmer bewogen haben, seinem Besitztum den Namen zu geben, denn natürlich treiben sich die faulen, arbeitsscheuen Schwarzen immer auf der Farm herum oder halten sich wenigstens in ihrer Nähe auf, um Brot und Tabak zu erbetteln.«
»Aber man lebt in Frieden mit ihnen?«
»Gewiß! Die Schwarzen in dieser Gegend sind alle friedlich, sie fallen höchstens durch ihr Stehlen lästig; so lange sie aber eine Art von Tribut an Brot, Tabak und so weiter erhalten, unterlassen sie auch dies.«
»Ich finde es unrecht, wenn man sie durch derartige Geschenke im Betteln bestärkt,« meinte Miß Murray.
»Darüber giebt es verschiedene Ansichten, und ich würde mich der von Mister Turner und meiner Freundin anschließen, nämlich den Schwarzen die wöchentlichen Lieferungen zu geben,« erklärte Ellen. »Die Australneger, so verkommen, oder vielmehr auf so niedriger Stufe sie auch stehen mögen, sind doch immerhin Herren dieses Landes. Bevor die Europäer ihren Boden betraten, lieferte ihnen die Natur alles, was sie zum Leben brauchten, seit aber Weiße das Gebiet eingenommen haben, ziehen sich die Jagdtiere immer mehr in das unwirtliche, gebirgige und wasserarme Innere zurück; den fruchtbaren Boden, auf dem früher ihre Früchte in Unmasse gediehen, haben ihnen die Ansiedler genommen; den Begriff Arbeit kennen diese Leute überhaupt nicht, und so finde ich es nicht Unrecht, wenn man ihnen einen kleinen Betrag der Bodenerzeugnisse abgiebt.«
»Bravo, das war gut gesprochen,« rief eine tiefe Stimme im Thürrahmen, »wenn wir nach Amerika kommen, zetteln wir unter den Indianern einen Aufstand an und werfen uns als Häuptlinge auf. Sie halten aufrührerische Reden, und ich schwinge den Tomahawk.«
»Guten Morgen, Lord Hastings,« lachte Ellen. »Dann müssen Sie aber zeitiger aufstehen, sonst verschlafen Sie alles.«
Und ernsthaft fuhr sie dann fort:
»So lange die umwohnenden Schwarzen von Mister Turner die bescheidenen Geschenke bekommen, halten sie Ruhe, lassen sich auch nicht mit Buschrähndschern und jenen Eingeborenen ein, welche aus den Bergen kommen und, wie Lord Hastings sagt, aufrührerische Reden unter ihnen halten wollen. Wenn sie zum Beispiel mit den Buschrähndschern gemeinschaftliche Sache machen wollten, so wäre dies letzteren von großem Vorteile, so aber lassen sich die Schwarzen durch Geschenke dazu bewegen, mit ihrem Instinkt die Verfolger auf die Spur jener zu leiten.«
»So unnütz sind diese Australneger überhaupt nicht auf der Welt, wie Sie meinen, Miß Petersen,« sagte Charles. »Ich habe zum Beispiel einmal einen gesehen, der konnte brennende Talglichtchen hinunterschlucken, ohne daß –«
Der Sprecher wurde unterbrochen; die Lokomotive stieß kurz hintereinander drei scharfe Pfiffe aus, über den Wagendächern lief es hin und her. Die Räder brummten, die Axen knirschten, als ob mit aller Gewalt gebremst würde, und ehe die Reisenden noch einen klaren Gedanken fassen konnten, erhielten sie einen furchtbaren Stoß, daß sie alle vornüberschossen.
Ein jeder erwartete den zweiten Stoß, vielleicht auch das Zersplittern des Wagens, das Angstgeschrei der Passagiere, aber nichts dergleichen geschah – doch der Zug stand.
»Was war das?« rief Ellen zuerst.
»Beinahe hätte es ein Unglück gegeben,« antwortete Charles, »aber es sollte diesmal nicht sein. Es war gut, daß ich auf Sie fiel, Miß Thomson, sonst hätte ich mir einige Knochen zerbrochen.«
Da wurden schon vom Schaffner die Thüren aufgerissen und die Passagiere aufgefordert, auszusteigen. Jetzt sah man, daß es nur dem scharfen Blick des Lokomotivführers zu danken war, daß ein weiteres Unglück verhütet wurde. Er hatte schon von weitem gesehen, daß der Schienenstrang aufgerissen war, hatte den Zug gebremst, aber nicht verhindern können, daß die Maschine noch die gefährliche Stelle erreichte und in den Sand lief.

Nun saß sie fest, die Räder bis zur Hälfte in der Erde.
»Wie lange dauert es, ehe die Fahrt fortgesetzt werden kann?« fragte Lord Harrlington den Zugführer, der zuerst zu den Passagieren des Salonwagens kam, um ihnen Aufschluß über den Fall zu geben.
»Wir sind in einer sehr unangenehmen Lage,« sagte er bedauernd, »die Schienen müssen von frevelnden Händen abgehoben worden sein. Wir allein können die Maschine nicht wieder frei bringen, ich habe deshalb sofort einen Läufer nach Hughenden abgesandt, welcher einen Zug mit Hilfspersonal herbeiholen soll.«
»Wann wird dieser Zug kommen?«
»Von hier bis nach Hughenden sind es etwa achtzig Meilen, die läuft der Bote in zwanzig Stunden. Morgen um diese Zeit wird der Zug hier sein, und die Maschine kann frei gemacht werden und, wenn sie noch tauglich ist, weiterfahren. Sonst muß uns die neue Lokomotive schieben.«
Ratlos sahen sich die Reisenden an.
»Ja, ja,« lachte Charles, »wir sind hier in Australien und nicht in England. Achtzig Meilen wollen gelaufen sein.«
»Wie weit ist es von hier nach der nächsten Station vor uns?« fragte Harrlington den Zugführer weiter.
»Vierzig Meilen, aber von dort können wir keine Hilfe bekommen.«
»Und wann passiert hier der nächste Zug?«
»Uebermorgen um diese Zeit; sind wir aber noch nicht frei, so könnten Sie höchstens mit ihm zurückfahren. Uebrigens stelle ich Ihnen einstweilen alles zur Verfügung, was die Salonwagen des Zuges Ihnen bieten können, Betten, Lebensmittel und so weiter.«
Aergerlich stampfte Ellen mit dem Fuße.
»Wie weit ist es von hier nach der nächsten Farm?« fragte sie.
»Auch ungefähr zwanzig Meilen, sie liegt so ziemlich westlich von hier.«
»Wem gehört sie?«
»Einem gewissen Graves; von der nächsten Station aus führt direkt ein Weg nach dieser Farm hin, und für Wagen ist dort immer gesorgt.«
»Von Graves,« rief Ellen erfreut und wandte sich dann ihrer Gesellschaft zu, »das ist ja eben die Farm, wohin wir zuerst wollen. Natürlich brechen wir sogleich zu Fuß nach dort auf. In fünf bis sechs Stunden können wir sie erreicht haben.«
Das Mädchen blickte Lord Harrlington an, weil es von ihm einen Widerspruch erwartete, aber sonderbarerweise unterließ er es diesmal, ja, er war sogar sofort einverstanden. Harrlington hatte ein für allemal beschlossen, dem Mädchen nie mehr zu widersprechen, weil eine Gegenrede doch stets vergeblich war, und ganz besonders, wenn Lord Hastings und Sir Williams dabei waren, die am liebsten durch Dick und Dünn marschierten. Die einzige, welche ihm vielleicht beigestanden hätte, wäre Johanna gewesen, aber die kleinere Stimmenzahl würde jetzt, wie gewöhnlich, unterliegen.
Aber jemand sollte doch eine Gegenrede erheben, nämlich der Zugführer.
»Machen Sie einen solchen Versuch ja nicht, meine Herrschaften,« sagte er. »Warten Sie geduldig ab, bis wir Hilfe haben. Dringen Sie nicht in den Busch ein, ohne einen schwarzen Führer, sonst wissen Sie schon nach einer halben Stunde nicht mehr, wo Sie sind.«
»Oho,« lachte Ellen, »wir sind keine Stadtkinder. Ich bin in Wald und Prärie aufgewachsen und verlaufe mich nicht gleich, wenn ich keinen gepflasterten Weg vor mir habe.«
Der Zugführer warf einen prüfenden Blick auf die Sprecherin und sagte dann ernst:
»Trotz alledem lassen Sie sich davon abraten. Auch ich bin Amerikaner und kenne die Wälder und Steppen meiner Heimat, aber das ist hier etwas ganz anderes. Zu den zwanzig Meilen brauchen Sie nicht fünf bis sechs Stunden, sondern acht, denn der Weg durch den Busch ist äußerst beschwerlich. Außerdem würden Sie bald Wassermangel leiden müssen.«
»Giebt es hier keinen Bach oder Fluß?«
»Ein Bach fließt allerdings zwischen hier und der Farm, aber es ist sehr die Frage, ob Sie ihn finden werden, denn er macht große Krümmungen.«
»Wir werden ihn finden,« erklärte Ellen bestimmt. »Außerdem nehmen wir unsere Decken, Wasserflaschen und Lebensmittel mit. Wollen Sie die Güte haben und unser Gepäck an der nächsten Station abgeben, von wo wir es in kürzester Zeit abholen lassen werden.«
Der Zugführer sah, daß mit dieser Dame nichts anzufangen war, aber er hielt es für eine Tollkühnheit, ohne Führer im Busch vorzudringen, und nahm deshalb zu einem anderen Mittel Zuflucht.
»Außerdem,« fügte er hinzu, »können Sie sehen, daß diese Schienenstränge nicht durch ein Naturereignis, sondern durch Menschenhände in böser Absicht zerstört worden sind, und zwar bin ich fest überzeugt, daß es Buschrähndscher gewesen sind. Wir können von großem Glück sagen, daß die Sache so gut abgelaufen ist.«
»Was sollte die Buschrähndscher bewogen haben, den Zug zum Entgleisen zu bringen?«
»Ich vermute, daß sie ihn plündern wollten, aber durch irgend etwas verscheucht worden sind. Vielleicht haben sie auch erfahren, daß wir das nicht bei uns hatten, was sie erwarteten, und sich deshalb nach einer ausgiebigeren Beute umgesehen.«
»Oder die Buschrähndscher haben erfahren, daß ich im Zuge war, und sind davongelaufen,« meinte Charles.
»Jedenfalls ist aber die Gegend hier nicht geheuer, deshalb bitte ich Sie nochmals darum, unterlassen Sie es, durch den Busch nach der Farm vorzudringen,« schloß der Beamte.
»Wenn die Sache allerdings so steht,« lachte Ellen, »wenn unser Spaziergang vielleicht gefährlich verlaufen könnte, dann muß ich erst mit meinen Gefährten einen Kriegsrat abhalten. Wer von den Herren ist mit mir einverstanden, den Weg nach der Farm zu machen?«
Sie blickte im Kreise umher.
Lord Hastings nickte mit dem Kopfe, Charles blinzelte mit den Augen, und Harrlington musterte angelegentlich die versunkene Lokomotive. Da jetzt auch die drei Damen erklärten, lieber die sechs Stunden zu laufen, als vierundzwanzig Stunden oder noch länger hier zu warten, ohne vorwärtszukommen, so betrachtete Ellen ihren Vorschlag als angenommen.
Sie füllten die Flaschen mit Wasser und packten diese, ebenso wie einige Eßvorräte in Plaids, welche sie auf den Rücken schnallten, ließen sich genau die Richtung angeben und schritten dann ohne weiteres dem angrenzenden Busche zu, durch welchen nur der Weg für den Schienenstrang gehauen war. Sie waren alle mit Revolvern und Messern bewaffnet, wohl ausgeruht und getrauten sich daher, da es jetzt erst fünf Uhr morgens war, gegen Mittag die Farm zu erreichen, und dann sogleich auf Wagen oder Pferden den Weg nach der befreundeten Farm fortzusetzen, wo sie schon abends ankommen würden.
Kopfschüttelnd blickte der Zugführer den Abgehenden nach, die sich so ohne weiteres in eine Wildnis begaben, welche nicht einmal der in Australien geborene Farmer ohne Jagdgewehr, Hunde und sichere Führung betritt.
Rüstig drangen die Abenteurer durch den Busch, voran Lord Harrlington und Ellen, bald brachen sie die Zweige beiseite, bald umgingen sie dichtes Unterholz, immer dabei die Sonne im Rücken behaltend.
Nach einem langen Umweg zog Harrlington einen Taschenkompaß hervor und beobachtete die Nadel.
»Suchen Sie die Richtung?« fragte Ellen lachend.
»Allerdings, wir können leicht von ihr abkommen, wenn wir die Sonne nicht sehen.«
»Aber nicht ich, ich traue meinem Instinkt mehr als allen Kompassen. Sie können mir die Augen verbinden, und ich will Ihnen doch immer sagen, wo Nord, Ost, Süd und West ist.«
»Miß Petersen hat einen Indianer als Schullehrer gehabt,« meinte Charles. »Da sehen Sie, meine Herrschaften, jetzt steht sie still und lauscht, gleich wird sie das Ohr an die Erde legen.«
»Still,« sagte aber Ellen, »ich höre etwas, wahrscheinlich ist es eine Kuhglocke.«
»Obwohl wir erst eine Stunde gegangen sind?« fragte Jessy zweifelnd.
»Nein,« erklärte Charles, »wir werden gleich an einen Bach kommen, aber keine Kühe mit Glocken finden.«
»Woher wollen Sie das wissen?«
In der That konnte man jetzt deutlich das Läuten eines Glöckchens vernehmen, und schon begann sich der Busch zu lichten. Gleich mußte man an eine Lichtung, vielleicht sogar an eine Farm kommen.
Als die Wanderer ins Freie traten, sahen sie wirklich einen Bach zu ihren Füßen fließen, aber von einer Ansiedelung keine Spur, ebensowenig von Rinderherden, und doch dauerte das Glockengeläute noch fort,
»Da sitzt Ihre Kuh und läutet,« sagte Charles und deutete auf einen großen Vogel, der am Ufer des Baches saß, und an dessen Schnabel- und Halsbewegungen man sehen konnte, daß er der Urheber dieser seltsamen Töne war.
»Waren Sie schon einmal in Australien, daß Sie das so genau wußten?« fragte ihn Miß Thomson.
»Das nicht, aber ich war vor einigen Jahren in der Schule, und da habe ich gelernt, daß es in Australien einen Glockenvogel giebt, der an den Bächen lebt und solche Töne von sich giebt. Außerdem soll er,« Charles zog seinen Revolver hervor, »sehr gut schmecken, wenn man ihn gebraten hat.«
Der Schuß knallte, und der Vogel fiel auf die Seite.
»So,« sagte Charles und hob das Tier auf, »es wäre der Anfang zum Frühstück; ich habe meinen Teil dazu geliefert. Nun fangen Sie jeder noch ein Känguruh, und wir können das Braten beginnen.«
Sie sprangen über den Bach, schritten über die Lichtung und drangen wieder in den Busch ein. Immer wilder wurde die Gegend, immer schwerer das Gehen in dem dichten Unterholz, aber niemandem fiel es ein, einen mutlosen Seufzer auszustoßen, waren sie doch etwa erst drei Stunden marschiert, und es war noch früher Morgen.
Als es Miß Murray gelang, noch einen rebhuhnartigen Vogel zu schießen, wurde allgemein beschlossen, für eine Stunde eine Frühstückspause eintreten zu lassen, und bald hatten die Herren an einem freien Platze ein Feuer angefacht, während die Mädchen sich mit dem Bereiten der Vögel beschäftigten.
Als sie dann alle um das Feuer saßen und sich das geröstete Fleisch und Brot trefflich schmecken ließen, herrschte wieder die animierteste Stimmung.
Mit neuem Mut ging es dann weiter, der Busch lichtete sich immer mehr, bis sie an einen Wiesenplatz kamen, der nur mit wenigen Gummibäumen besetzt war. Auch wurde der Weg unebener, und die Gegend artete schließlich in ein Hügelland aus.
»Das ist ja herrlich,« rief Ellen freudig, »ich habe mir ganz Australien öde vorgestellt, und hier wechseln immer saftige Wiesen mit Wäldern ab.«
Sie erstiegen den ersten Hügel, über den sie der Weg führte, weil die Wiesenfläche vom Busch eingerahmt war, und Lord Harrlington, oben zuerst ankommend, wollte eben den Abstieg beginnen, als er sich plötzlich umdrehte, zurückwinkte und sich auf den Boden warf.
Alle hatten den Wink verstanden und folgten seinem Beispiel, dann krochen sie langsam vorwärts, bis sie an der Seite des Lords, gerade auf dem Gipfel des Berges lagen, und was sie da sahen, erregte allerdings ihre Verwunderung.
Aus dem Gummiwald zur Rechten hüpften dunkle Gestalten, sprangen in langen Sätzen über die Wiese und verschwanden in dem gegenüberliegenden Busch. Deutlich konnte man sehen, wie jede immer in die Fußspuren ihres Vorgängers zu treten bemüht war. Zwanzig Männer waren auf diese Weise schon vor ihren Augen vorübergehüpft, aber noch immer kamen neue aus dem Walde hervor.
Die Entfernung war so gering, daß sie die Männer, ja selbst deren Gesichter, deutlich erkennen konnten.
Die Schwarzen waren fast nackt, nur um die Lenden trugen sie Schurze, und ihre Körper waren zwar mager, aber sehnig. Sie führten lange, hölzerne Wurfspieße, Keulen und winklig gebogene, flache Hölzer, sogenannte Bumerangs, mit denen die Eingeborenen Australiens geschickt zu schleudern verstehen, mit sich.
»Australneger,« flüsterte Harrlington, »sie befinden sich auf keinem friedlichen Wege, sonst würden sie sich nicht so vorsichtig bewegen. Da, jetzt kehren sie wieder um.«

Plötzlich hielt der ganze Zug, alle machten kehrt und rannten mit der größten Schnelligkeit zurück – es mußte sie irgend etwas erschreckt haben.
Dann kam einer hervor, größer und stärker gebaut als die übrigen, und schlich sich wie eine Schlange über den Rasen, blieb am Rande des Busches liegen, untersuchte dort etwas und kroch dann langsam an der Grenze der Wiese und des Busches weiter, die Augen dicht auf den Boden geheftet.
»Er sucht nach einer Spur,« flüsterte Ellen.
Jetzt drehte sich der Schwarze halb um und winkte zurück, worauf alle wieder aus dem Walde kamen, auf dem Bauche schleichend, und sich um den ersten sammelten, der wahrscheinlich ihr Häuptling war. Zuletzt lagen wohl vierzig Mann um diesen herum und hörten einer Erklärung zu.
»Möchte wohl wissen, was sie thun würden, wenn sie uns hier oben liegen und sich beobachtet wüßten,« meinte Charles. »Mir juckt es ordentlich in den Fingern, einmal am Revolver zu drücken.«
»Um Himmels willen,« bat Miß Murray, »machen Sie keine Dummheit! Die scheinen auf dem Kriegspfade zu sein.«
»Nun, wir sind Ihnen so ziemlich an Stärke gewachsen, jeder Revolver hat sechs Kugeln, und wir sind sieben.«
»Aber wir bekommen sie dann auf die Fährte und müssen entweder hastig fliehen oder sorgfältig jede Spur verwischen,« sagte Ellen. »Unterdrücken Sie einmal Ihr Gelüst, und schießen Sie nachher, wenn es niemand mehr hört!«
Der Häuptling verschwand im Busch und mit ihm die Hälfte seiner Leute, während die anderen über die Wiese zurück in den Gummiwald gingen.
»Hoffentlich treffen wir nicht mehr mit ihnen zusammen,« sagte Harrlington und stand auf, als der letzte sich seinen Blicken entzogen hatte. »Vorteil für uns kann eine Begegnung mit ihnen nie haben, sehr leicht aber Nachteile.«
Sie gingen den Hügel hinunter und drangen, nachdem sie immer in westlicher Richtung lange Zeit über Grasflächen geschritten waren, wieder in den Busch, der aber hier nicht dicht war.
Bergauf, bergab ging es, immer durch Wälder von Gummi- oder Pfefferminzbäumen, über Wiesen und Steppen; die Stunden verstrichen, und Ellen behauptete fest, daß sie bald in die Nähe der Farm kommen müßten. Hätte sie sich in der Richtung jemals getäuscht, sagte sie, so wolle sie augenblicklich nach diesem Ausflug nach New-York zurückfahren. Natürlich könnten sie etwas unterhalb oder oberhalb die Farm erreichen, aber eine solche sei groß, die Wiesen erstreckten sich meilenweit, und überall herrschte auf ihnen Leben, also sei nicht zu befürchten, daß sie an der Ansiedelung vorbeilaufen würden.
Als sie wieder nach Passierung eines Waldes eine weite, etwas hügelige Grasfläche erreichten, blieb Lord Hastings plötzlich stehen, sah nach der Uhr und sagte:
»Ich schlage vor, wir lagern uns hier für eine oder zwei Stunden. Es ist jetzt zwölf Uhr, also sind wir sieben Stunden fast ununterbrochen gelaufen, und ob wir nun zum Mittagsessen oder später in die Farm von Mister Graves kommen, kann uns doch gleichgiltig sein.«
Niemand widersprach ihm, alle waren mit dem Vorschlag einverstanden, denn die Wanderung durch die Wildnis war für alle, die das Gehen nicht mehr gewohnt waren, und besonders für die Damen, sehr ermüdend gewesen, obgleich sie es nicht hatten eingestehen wollen. Jetzt aber warfen sie sich ohne weiteres in den Schatten eines Pfefferminzbaumes, um hier die heißesten Stunden des Tages zu verträumen.
Es wurde noch geplaudert, Pläne wurden entworfen, wie man von der Farm aus Jagdausflüge machen wollte, dann folgten alle dem Beispiele Lord Hastings, der schon seit langem keinen Laut von sich gab, das heißt, sie legten sich bequem hin und bedeckten sich das Gesicht mit den Taschentüchern, um nicht von den Mücken belästigt zu werden. .
Eine halbe Stunde mochten sie so gelegen haben; nichts unterbrach die Stille, die überall herrschte, als Miß Murray plötzlich das Tuch vom Gesicht riß und aufmerksam lauschte.
Es war ihr immer schon gewesen, als hätte sie ein leises Geräusch gehört, und je länger sie so ruhig dalag, desto deutlicher klang es an ihr Ohr.
Fast klang es wie das Murmeln eines Baches, der über Steine dahinplätschert, und da sie gerade an Wasser dachte, so bemerkte sie, daß sie eigentlich recht durstig war. Sie richtete sich auf, schnürte das Plaid auf und entnahm ihm die Wasserflasche.
Aber ach, das Wasser war fast lauwarm geworden und schmeckte so fade, daß sich nach seinem Genuß der Durst nur steigerte.
Aber könnte es nicht sein, dachte Jessy, daß hier in der Nähe eine Quelle fließt? Das Land ist hügelig, und der Zugführer sagte, wir würden auf einen Bach stoßen, und den, welchen wir gleich anfangs trafen, hat er jedenfalls nicht gemeint. Auch liegt die Farm an einem Flusse, und dieser hat jedenfalls Zuflüsse.
Wieder lauschte sie angestrengt, und deutlicher als vorhin vernahm sie das Murmeln eines Baches.
Jessy warf einen Blick auf die Herren und Damen; sie lagen alle so still da, als wenn sie schliefen, und wahrscheinlich war es so – sie hätte vor Durst nicht mehr schlafen können. Leise stand sie auf, nahm die Flasche und schlich sich auf den Zehenspitzen, um die Schläfer nicht zu stören, dahin, wo sie das Rauschen des Wassers vernahm. –
Als Harrlington aus dem Schlafe erwachte, wußte er nicht, wie lange sie so gelegen hatten, aber die Uhr belehrte ihn, daß bereits über zwei Stunden verflossen waren.
»Auf!« rief er und sprang vom Rasen empor, »die größte Hitze ist vorüber, und in der Farm können wir uns noch genügend ausruhen.«
Die anderen waren bald ermuntert und auf den Beinen, nur bei Lord Hastings hatte es seine Schwierigkeiten. Er gähnte und streckte sich noch am Boden, als Johanna plötzlich ausrief:
»Wo ist denn Miß Murray?«
Ihr Plaid war noch an derselben Stelle, wo sie gelegen hatte, aber sie selbst war nicht zu sehen.
»Sie wird etwas spazieren gegangen sein, suchen Sie sie, meine Damen, während ich das Plaid schnüren werde,« sagte Charles und bückte sich wieder, um die zerstreuten Sachen zusammenzulesen. Schon wollten die drei Mädchen sich wirklich im Walde zerstreuen, als Charles wieder rief:
»Halt, die Wasserflasche fehlt; mir ist, als hätte ich vorhin im Traum das Plätschern eines Baches gehört.«
Alle stimmten ihm sofort bei, daß auch sie ein ähnliches Geräusch gehört hätten.
»Nun, dann können wir sie leicht finden, sie wird Durst gehabt haben und kurz, ehe wir aufgestanden sind, dem Plätschern nachgegangen sein. Still jetzt, damit wir es wieder hören und uns darnach richten können.«
Sie blieben ruhig stehen, und Charles deutete nach der Richtung, die von einem Hügel verdeckt wurde.
»Von dort kommt es, und dort wird Miß Murray sein.«
Lord Hastings war sofort erregt aufgesprungen, als er hörte, daß Miß Murray fehlte, und als erster stürmte er der bezeichneten Richtung zu. Allen voran erkletterte er den Hügel und stieg ihn auf der anderen Seite wieder hinunter, doch als auch die anderen oben angelangt waren, erschraken sie über das Gesicht Lord Hastings', der an einem kleinen Wasserfall stand und – sprachlos Miß Murrays Wasserflasche in den Händen hielt.

Im Nu stand Ellen neben ihm.
»Wo ist Jessy, haben Sie sie schon gesehen?«
Verneinend schüttelte der Lord den Kopf, aber da schrie Johanna plötzlich auf und deutete auf einige Büsche, die neben dem Wasserfall auf dem steinigen Boden, ihr Dasein fristeten.
»Sehen Sie hier!« rief sie. »Die Zweige sind abgeknickt, abgerissen, an mehreren Stellen zugleich, als hätte sich jemand mit Gewalt daran festgeklammert.«
»Sie kann doch unmöglich ins Wasser gefallen sein,« sagte Hastings kleinlaut, »es ist ja viel zu flach, als daß jemand fortgespült werden könnte.«
»Daran ist nicht zu denken,« meinte Ellen, »die Zweige sind übrigens auf der anderen Seite abgerissen. Wenn nur der Boden nicht so steinig wäre.«
Ein Ruf von Charles rief alle nach einer anderen Stelle.
Der Baronet stand vor einer kleinen Felsplatte und deutete stumm mit der Hand auf diese. Sie gab die Lösung des Rätsels: auf ihr konnte man deutlich den nassen Abdruck eines großen, nackten, männlichen Fußes erkennen, die Sonne hatte noch nicht Zeit gehabt, das Wasser zu trocknen.
»Australneger!« sagte Harrlington leise, und sich dann zusammennehmend, fuhr er fort, »Miß Murray ist von Schwarzen entführt worden, sehr lange kann es nicht her sein, sonst wäre das Wasser vollständig verdunstet; aber eine Stunde mag immerhin verstrichen sein, denn die Luft ist hier bei der Quelle kühler und feuchter. Wir wollen uns schnell verteilen und suchen, ob wir sonst etwas finden, was uns über den Verbleib von Miß Murray Aufschluß giebt.«
Alle folgten seiner Anweisung, sie suchten die ganze Umgebung ab, aber keine Spur war zu bemerken, daß hier vor kurzer Zeit Leute gewesen wären. Nur einmal noch fand Ellen die Zehenabdrücke eines nackten Fußes im weichen Lehmboden.
Charles behauptete zwar, es wäre ein anderer Fuß als der vorige, die Zehen wären viel kleiner, aber das konnte jetzt auch nichts mehr nützen. Thatsache war: Jessy war von einem oder mehreren Australnegern geraubt worden.
Lord Hastings wollte erst gleich die Verfolgung aufnehmen, sah dann aber die Thorheit dieses Unternehmens ein. Es wurde vielmehr beschlossen, jetzt so schnell, als es ihre Füße erlaubten, nach Mister Graves Farm zu eilen, wo der mit den Sitten der Eingeborenen vertraute Besitzer gewiß sich und seine Leute ihnen zur Verfügung stellen würde, und der außerdem vielleicht Hunde oder die mit gleichem Instinkt begabten Eingeborenen auf die Spur Jessys leiten konnte.«
Sie merkten sich noch genau, wo der Wasserfall lag, und setzten dann eiligst den Weg fort, ohne ein Wort mehr zu sprechen.