
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
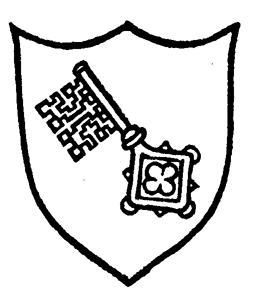
Wer zum erstenmal nach Soest kommt, könnte sich einbilden, es habe vor langer Zeit einmal, etwa um 1400 oder 1500, ein Unglücklicher, ein Vergewaltigter oder Entehrter, die Stadt durch einen Fluch erstarren lassen, daß sie seitdem unverändert blieb, daß nichts hinzuwuchs, der Wandel der Jahrhunderte mit den Bedürfnissen und Erfindungen nicht zum Ausdruck kam; Gott habe zwar den Fluch des Unglücklichen gehört, ihn aber durch die Gnadengabe der Schönheit ausgeglichen. Der Bann habe nicht gehindert, daß die Häuser langsam ein wenig verwitterten, manche ganz verschwanden, daß in manchen Straßen Gras wuchs, von bemalten Mauern der Glanz wich, von bunten Figuren die Farben abblätterten; nicht ganz ist sie es mehr, die ehrenwerte Stadt, deren Recht friedlich erobernd bis ans Meer drang und die mit mächtigen Fürsten wetteiferte; aber besonders deutlich kann man sich hier vorstellen, wie eine deutsche blühende mittelalterliche Stadt aussah, bevor die Festlichkeit der Renaissance und die Phantastik des Barock eindrangen. Die Befestigungen sind anderswo viel besser erhalten als in Soest, wo von 36 Türmen nur noch einer und von den Toren nur das mit Erkern geschmückte Osthofentor erhalten ist, das erst in der Reformationszeit entstanden ist; es ist mehr das Innere der Stadt im ganzen, das durch den Gegensatz seiner stolzen Kirchen zu dem bäuerlichen Charakter der Häuser so fremdartig wirkt. Klar sieht man, wie die Regelmäßigkeit der Anlage durch die eigenwillige Lust und Laune der Bewohner so weit aufgehoben wurde, daß man oft wie in einem Labyrinth verirrt nicht aus und ein weiß. Vom Markt, dem Mittelpunkt des Ortes, erstrecken sich nach allen Seiten in die Runde Straßen, die von der schützenden Mauer aufgefangen und durch die Tore ins Freie geleitet werden; dazwischen aber entstand ein Netz kleiner verbindender Straßen, die sich biegen, je nachdem die Bürger ihre Häuser und Äcker anlegten. Aus dem Holz der Eichen, unter denen die alten Sachsen sich gern ansiedelten, waren die Häuser errichtet, Fachwerkbauten, deren Gerüst mit Lehm ausgefüllt war. Es sind bäuerliche Häuser mit spitzem oder gedrücktem Giebel, mutwillig bald so, bald so gegen die Straße gestellt; zwischen den kleineren treten auch höhere mit mehreren Stockwerken hervor, etwa mit geschnitzten Rosetten geschmückt. Sieht man ab von den vulgären Spuren der Neuzeit, die hauptsächlich auf das Bahnhofsviertel beschränkt sind, so spürt man den Geist altwestfälischer Bauern, wie sie sich in heidnischer Zeit am großen Teiche ansiedelten, in dessen dunkler Fläche sich noch jetzt Büsche und Häuser spiegeln. Lange saßen sie in dörflicher Namenlosigkeit an ihrem Wasser, nur zuweilen im Wetterleuchten der Geschichte aufleuchtend. Ein ehrfürchtig geschonter Mauerrest soll das letzte Trümmerstück einer vom großen Sachsenherzog Wittekind errichteten Burg sein; auf ihn wird auch ein Kruzifix, bekannt als der große Gott von Soest, zurückgeführt, indem es als Patengeschenk galt, das Karl der Große seinem überwundenen Feinde bei der Taufe gegeben hatte, und das im 18. Jahrhundert gestohlen wurde. Nach anderen ist die Mauer älteren Ursprungs und stammt aus der Zeit der Merowinger. Der Merowingerkönig Dagobert schenkte die Höfe am Teich dem heiligen Kunibert, Erzbischof von Köln, der die Peterskirche, Olde Kerke genannt, gegründet haben soll, und als Mönche von Corbie die Gebeine des heiligen Vitus nach Corvey geleiteten, kamen sie durch Susat – d. i. Soest – und wurden dort von einer großen Volksmenge andächtig begrüßt. Dann aber erhielt Susat selbst den Leib eines Heiligen durch die Fürsorge des Erzbischofs Bruno, eines Bruders des Kaisers Otto des Großen, dem der Mangel eines Klosters an dem abgeschiedenen Orte auffiel. Es war der Leichnam des heiligen Patroklus, den er durch die Freundschaft des Bischofs von Troyes erhalten hatte, und den er, da Köln reichlich versorgt war, als die Seele einer neuzugründenden Münsterkirche nach Soest bringen ließ. Der heilige Patroklus, der ritterliche Gallier, wurde nunmehr zum Patron von Soest und die Patrokluskirche zum Wahrzeichen der Stadt, wenn es auch noch lange währte, bis ihr Turm gewaltig sich über der anmutigen Vorhalle erhob. Es gibt verschiedene Darstellungen des heiligen Patroklus, von denen die schönste sich auf einem im 14. Jahrhundert vom Goldschmied Ziegefried verfertigten vergoldeten Schrein befindet, der durch die Pietät- und Verständnislosigkeit der herabgekommenen Soester des 19. Jahrhunderts, die ihn als altes Silber verkaufen wollten, nach Berlin verschlagen ist. Der heilige Krieger steht dort breitbeinig, unerschütterlich und mit einem höchst individuellen, reizvoll häßlichen Gesicht, in dem sich Kindlichkeit und stolzes Bewußtsein mischen. Überall ist er mit einem Schilde abgebildet, das der Reichsadler schmückt, so daß man ihn für einen Roland halten könnte, und in der Tat ist er auch zu einem ähnlichen Sinnbild für Soest geworden. Er war der Stadtheilige, der Sankt Peter, den Heiligen des Erzstifts und der Olde Kerke verdrängte, der Inbegriff der städtischen Würde, des städtischen Rechts und namentlich der städtischen Wehrhaftigkeit, wie denn auch die Patrokluskirche zugleich Rüstkammer und Befestigung war. Auf dem Stadtsiegel jedoch erhielt sich der heilige Petrus, und als er später verschwand, sein absonderlich zackiger Schlüssel. Erst zweihundert Jahre nachdem Erzbischof Otto das Parroklusmünster gestiftet hatte, wurde es durch Erzbischof Rainold von Dassel, den berühmten Kanzler Barbarossas, geweiht. Noch waren die Erzbischöfe ihrer treuen Stadt treue Beförderer und Beschützer, denen dankbares Gedächtnis bewahrt wurde, am meisten dem Nachfolger Rainolds, Philipp von Hainsberg. Er ließ die erweiterte Stadt durch Mauern befestigen, vielleicht damit sie in der Zeit, wo die wilden Kämpfe um die Lehen Heinrichs des Löwen das ganze Sachsenland durchtobten, gesichert sei. Er schenkte den Bürgern auf ihre Bitte die verfallene Wittekindsburg, an deren Stelle sie ein Hospital errichten wollten, damit, wie es in der Schenkungsurkunde heißt, die Höhle des Gewürms, das Nest der Störche, Dohlen und Krähen ein Zufluchtsort der Armen und Schwachen werde. Bis in die neuere Zeit war das Hohe Hospital Mittelpunkt des Soester Armenwesens; jetzt stehen Häuser und Gärten auf dem Gebiet und dazwischen ein Rest der alten sagenhaften Wittekindsmauer.
Inzwischen, zu einer Zeit, als Lübeck noch nicht gegründet war, hatten die Soester schon denkwürdige Taten verrichtet. Was für ein abenteuernder Drang führte die binnenländischen Bauern, die an einem nicht schiffbaren Bach wohnten, an die Küste und auf das nördliche Meer? Schleswig, das hernach von den Wenden zerstört wurde und dessen Hafen versumpfte, war damals ein blühender Ort und wurde der Ausgangspunkt für die Fahrten. Das Andenken an die altertümliche Zeit erhielt sich noch lange, als sie schon fast vergessen war, in dem Namen der Schleswickbrüder, einer Soester Kaufmannsgesellschaft. Soest, Dortmund, Münster, Salzwedel und Bardewik, lauter Binnenstädte, gründeten die sächsische Kolonie Wisby auf Gotland, welche so bedeutungsvoll für den norddeutschen Handel und die Entstehung der Hanse wurde. Zu der Peterskiste in der Marienkirche von Wisby, wo das Geld der Kolonie verschlossen war, gab es vier Schlüssel, die von vier Städten verwahrt werden. Dhen enen sal achterwaren dhe oldermann van godlande, dhen anderen dhe van lubike, dhen dherden there van sosat, dhen verden dhere van dhortmunde.
Die besondere Gabe Soests war sein Recht, das es in einem Buche, der Skrae, gesammelt und aufgezeichnet hatte und weitverbreitete. Trotz des nordischen Wortes Skrae, welches Schrift bedeutet, ist das Rechtsbuch in lateinischer Sprache verfaßt; es wurde ins Deutsche übersetzt und der Gemeinde jährlich vorgelesen. In der Skrae finden sich die wichtigsten Punkte germanischer Rechtsauffassung: der Schutz freier Personen vor schimpflichen Leibesstrafen, der Schutz vor willkürlicher Verhaftung, die Heiligkeit des Hauses, weitgehende Rücksichtnahme auf die augenblickliche Lage des Angeklagten, die Findung und Weisung des Urteils durch Schöffen, wozu jeder Freie gewählt werden konnte, die Eidesbekräftigung als höchstes Beweismittel, so daß unbescholtene Personen durch die Bürgschaft ihres Wortes die Anklage gegen einen, der nicht auf frischer Tat ertappt oder durch Augenzeugen unwiderleglich überführt war, aufheben konnten. Seitdem im 16. Jahrhundert die Skrae einmal gestohlen und zehn Jahre lang verschwunden gewesen war, wurde sie an einer Kette aufbewahrt.
Daß Männer mit so frühentwickeltem Rechtsbewußtsein auch das Bewußtsein ihrer Kraft und den Drang nach Freiheit hatten, ist selbstverständlich. In Eintracht mit ihren erzbischöflichen Oberherren erwarben sie ein Privileg ums andere, schlossen sie in weiter Ferne selbständig Verträge und fühlten sie sich, ohne in besondere Verbindung mit dem Kaiser zu treten, als Reichsangehörige. Es gab bei ihnen, wie sich von selbst versteht, Reiche und Arme, durch Geburt und Begabung unterschiedene Leute; aber es bildete sich nie ein herrschender Patrizierstand aus wie in den hansischen Seestädten und vielen andern. Einen Waffenadel scheint es in Soest nicht gegeben zu haben; die Grundlage einer freien, ungebeugten bäuerlichen Bevölkerung blieb immer bemerkbar. Zu dem aus dem hansischen Großhandel hervorgegangenen Patriziat gehörten die Lo, die Lünen, die Bockum-Dolffs, Dael, Klepping, später kamen die Krackerügge, zur Megede, Sybel auf, alte Kleinbürger waren die Duncker, Juckenack, Kerstin. Die ältesten Geschlechter, bischöfliche Ministerialen, die Timonen, die Brausteiner, verschwanden schon im 13. Jahrhundert infolge der Ermordung Engelbrechts I., welche für die Einzelkräfte in Westfalen eine Befreiung bedeutete.
Die Stellung der Kölner Erzbischöfe war dadurch, daß sie nach dem Sturz Heinrichs des Löwen das Herzogtum Westfalen an sich brachten, sehr verstärkt worden; sie waren unter den Reichsständen des Niederrheins und Westfalens der mächtigste, und viele unter ihnen erfüllte das Bewußtsein mit einer die Nachbarn beängstigenden Herrschsucht. Engelbrecht I. hatte staatsmännische Tendenzen, wie sie erst in viel späterer Zeit allgemein wurden und sich verwirklichen konnten. Er strebte danach, seinen zerstreuten Besitz zusammenzufassen und zum Zweck besserer Übersicht und Ordnung die verschiedenen rechtlichen Beziehungen, in denen er zu seinen Nachbarn stand, in eine möglichst gleichmäßige Abhängigkeit ihrerseits zu verwandeln. Diese Absicht machte ihn verhaßt in einer Zeit, in welcher ein solches Vorgehen revolutionär war, und wo jugendliche Kraft so allgemein war, daß Unordnung als natürlich, Ordnung als der ideale Ausnahmezustand aufgefaßt wurde; es läßt sich daneben auch denken, daß gerade das Vornehme, Hochgreifende und Strenge in Engelbrechts Charakter die Abneigung des ungezähmten Adels, der ihn umgab, verstärkte, weil sie sich von ihm verachtet glaubten. Später erzählte man sich, wenn einer anstatt Geleites oder Schutzbriefes einen Handschuh des Erzbischofs habe vorweisen können, habe das zu seiner Sicherheit genügt, so gefürchtet sei Engelbrecht gewesen. Obwohl dies den Städten erwünscht sein mußte, waren doch auch sie ihm abgeneigt, weil er sie, ungeachtet der Freiheiten und Privilegien, die sie sich erworben hatten, wieder in die frühere Abhängigkeit zu stürzen suchte. Als der Erzbischof von einer Verschwörung Kunde bekommen hatte, die sich durch ganz Westfalen verbreiten und auch Städte umfassen sollte, beschied er eine Tagung nach Soest, wo sich neben vielen anderen Dynasten auch derjenige einfand, der ihm als sein Mörder bezeichnet worden war, Friedrich, Graf von Isenburg, der Bruder der Bischöfe von Münster und von Osnabrück, die Engelbrecht selbst befördert hatte. Er teilte den versammelten Herren mit, was ihm offenbart worden war, und zerriß am Ende den Brief, der die Bezichtigung enthielt, vielleicht, weil ihm ritterliche Furchtlosigkeit angeboren war, vielleicht auch, weil er durch eine so großartige Wendung seine Feinde zu entwaffnen dachte. Dazu jedoch war der Haß zu begründet und saß die Erbitterung zu fest in den Gemütern. Das las wohl der Erzbischof aus den Mienen der Geladenen ab und begriff, daß sein Wagnis, da es ihm die Feinde nicht versöhnen konnte, sein Schicksal besiegelte. Bevor er aufbrach, um in Schwelm eine Kirche zu weihen, beichtete er in der Bonifaziuskapelle dem Bischof Konrad von Minden, und man sah ihn das Heiligtum mit feuchten Augen verlassen. Es war der 1. November des Jahres 1225. Gegen Abend, als er in die Nähe von Schwelm gekommen war, brachen seine Mörder aus dem Hinterhalt hervor, angeführt und angefeuert durch den Grafen von Isenburg, und töteten den sich tapfer Wehrenden.
Der Tod des Erzbischofs war für Soests Entwicklung günstig; denn es konnte nun auf dem Wege zu immer größerer Unabhängigkeit fortschreiten.
Im ganzen hingen die Soester in der damaligen Zeit ihrem Herrn noch treu an, der ihnen nicht so gefährlich war wie den Kölnern, wo er seinen Sitz hatte, und es konnte in der denkwürdigen Schlacht bei Worringen geschehen, daß sie auf seiten des Erzbischofs, die Kölner auf seiten seiner Feinde fochten. In dieser Schlacht traten, wie in einem schrecklich-schönen Schauspiel, alle Dynasten und streitbaren Kräfte auf, nach ritterlicher Art sich im Kampfe messend. Ausgangspunkt des Zwistes war ein Streit über das Erbe des söhnelos verstorbenen Herzogs Walram von Limburg zwischen dem Gatten von dessen verstorbener Tochter Reinold von Jülich und dem nächsten Agnaten Adolf VII., Grafen von Berg. Dieser hatte seine Ansprüche einem wegen seines hohen Sinnes berühmten Herrn, dem Herzog von Brabant, Johann dem Siegreichen, abgetreten, dessen Herz höher schlug, wenn er in die Schlacht ritt, und der nun gegen den von Jülich in die Schranken trat. Dieser gewann die angesehenste Macht für sich, nämlich den Erzbischof von Köln, Siegfried von Westerburg, ferner dessen Bruder, Grafen von Westerburg, den Grafen Adolf von Nassau, den späteren Kaiser, einen außerordentlich starken und tapferen Mann, den Grafen Heinrich von Luxemburg, den Vater des gleichnamigen Kaisers, den Ritter von Falkenberg, den schönsten Mann seiner Zeit, und die Bürger von Soest. Mit dem Herzog von Brabant kämpften Graf Simon von Teklenburg, Otto von Waldeck, Robert von Virneburg und die Herren von Reiferstein und Windeck. Die Stadt Köln stellte 1000 Streiter, welche zusammen mit den bäuerlichen Bergischen Fußknechten von einem Weltgeistlichen namens Dodde unter dem Rufe: »Berge romerike!« in die Schlacht geführt wurden. Obwohl die größere Zahl auf der Seite des Erzbischofs war, unterlag er; er selbst und Adolf von Nassau wurden gefangen, der Graf von Luxemburg, der von Falkenberg und des Erzbischofs Bruder fielen. Heinrich von Luxemburg suchte in der Schlacht den Herzog von Brabant, seinen persönlichen Feind, auf, um ihn zu töten und war dabei, ihn vom Pferde zu reißen, als ein Ritter, der seinen Herrn in Gefahr sah, dem Luxemburger seinen Speer unter die Rüstung stieß, daß er starb. »Unglücklicher,« rief Herzog Johann aus, »was hast du getan! Du hast den tapfersten Ritter getötet, der verdient hätte, ewig zu leben!« Ebenso großartig zeigte sich der Brabanter gegen Adolf von Nassau. Als der Graf vor den Herzog geführt wurde und dieser ihn fragte, wer er sei, antwortete der Gefangene: »Ich bin Adolf von Nassau, zwar nit ein großer Herr, aber der begehrt, große Sachen zu vollbringen«; worauf der Herzog ihn freiließ und als Freund behandelte. Die Kölner betätigten ihre Zufriedenheit mit dem Ausgange der Schlacht, indem sie dem Herzog von Brabant das Bürgerrecht schenkten und ein Haus in der Stadt, welches noch lange das Freihaus von Brabant hieß.
Nachdem der Erzbischof aus der Gefangenschaft entlassen war, nahm er Rache an dem Grafen Adolf von Berg, der arglos genug war, kölnisches Gebiet zu betreten. Nach der Überlieferung hätte der Erzbischof den Unglücklichen mit Honig bestreichen lassen und ihn so, in einen Käfig gesperrt, den Bienen preisgegeben; nach anderen hätte der Herzog von Brabant ihn befreit, doch sei er bald danach körperlich und geistig zerrüttet gestorben. Der Brabanter selbst fiel im Tournier bei der Vermählungsfeier der Tochter Eduards II. von England, nachdem er in 70 Turnieren Sieger gewesen war, Adolf von Nassau fiel als Kaiser in der Schlacht bei Göllheim. In der Schlacht bei Worringen, die einen so durchaus ritterlichen Charakter hatte, soll doch das bürgerlich-bäuerliche Fußvolk den Ausschlag gegeben haben.
Soest begann wie andere Städte sich durch Bündnisse zu kräftigen; seine natürlichen Genossen waren Paderborn, Münster, Dortmund und Lippstadt. Etwa um 1300 hatte die Stadt der Engern, wie man sie nannte, bereits einen außerordentlichen Wohlstand und eine hohe kulturelle Blüte erreicht. Die Straßen waren früher als z. B. in Augsburg gepflastert, es gab Ärzte, deren einer schon um die Mitte des 13. Jahrhunderts ein stattliches Haus in der Nähe des Münsters besaß, es gab eine Apotheke, die Malerei wurde gepflegt und die Kirchen wurden geschmückt. Im Vergleich zu Münster ist Soest allerdings eine schlichte Stadt, aber darum keine kunstlose. Die öffentlichen Gebäude, Kirchen und Rathaus, wirken durch Masse und großartige Formen imposant; der Turm des Münsters mit seiner reichen, durch Ecktürmchen gezierten Helmpyramide ist von herrschender Gewalt. Von der abseits gelegenen Kirche Maria in der Wiese wurde im Mittelalter nur der Unterbau der Türme vollendet; das Paar, das wir heute sehen, hat nicht die sichere Hand eines alten Baumeisters, sondern die neuere Zeit ergänzt. In einigen Kirchen sind altromanische feierliche Wandgemälde aufgedeckt worden, in der Wiesenkirche fesseln wundervolle Glasgemälde. Besonders schön ist dasjenige, welches den Stammbaum Christi aus der Wurzel Jesse darstellt, einer schlanken, goldgelben Pflanze vergleichbar, die im braunen Mantel der Maria wie in einer kostbar glühenden Frucht gipfelt. Der Eindruck der Stadt im ganzen ist licht: weiß sind die meisten der dunkelumrandeten, mit roten Ziegeln bedachten Fachwerkhäuser, grünlich schimmert der Sandstein, aus dem die Steinbauten, namentlich die Kirchen, errichtet sind. Der überall sichtbare Turm des Münsters ist mit Blei gedeckt.
Die kraftvolle und selbstbewußte Stadt, die ein weites, fruchtbares Gebiet mit vielen Dörfern, die sie rings umgebende Börde, unumschränkt beherrschte, trat doch kaum jemals nach außen oder innen so gebieterisch und herausfordernd hervor, wie das andere wohl taten, und das mag mit ihrem bäuerlich-demokratischen Charakter zusammenhängen. In Soest waren die Zünfte, wenigstens die vornehmen, nicht vom Rate ausgeschlossen, und der Rat, der sich lange Zeit nicht selbst ergänzte, hing mehr als anderswo mit Bürgerschaft und Gemeinheit zusammen. Dieser Umstand mag eine gemäßigte Haltung, einen langsamen Schritt bedingt haben. Friedliches Wesen wurde der Stadt durch zwei glückliche Umstände ermöglicht, daß nämlich der Erzbischof von Köln durch die Kölner beschäftigt war, und daß die Grafen von Arnsberg, wie es scheint, keine erobernden Naturen waren. Die Grafen von Arnsberg hätten die erbliche Reichsvogtei über Soest, die sie besaßen, für sich ausnützen und erweitern können, anstatt dessen verkauften sie sie an Soest als ewiges Lehen. Zwar geriet Soest darüber mit dem Erzbischof in Streit und mußte sie ihm wirklich abtreten; aber da er versprechen mußte, die Richter aus der Bürgerschaft von Soest zu wählen und zwei beigeordnete Ratsherren zu dulden, war der Gewinn doch auf seiten der Stadt. Ihre tatsächlich erreichte Unabhängigkeit wurde so groß, daß sie das Bewußtsein einer Reichsstadt hatte, was sie doch rechtlich nicht erhärten konnte. Es mußte also ein Zusammenstoß mit dem Oberherrn erfolgen, wenn einmal ein Erzbischof zur Regierung kam, der den tatsächlichen Zustand einem geschriebenen oder überlieferten Recht anpassen wollte. Eine solche Entwicklung bereitete sich am Ende des 14. Jahrhunderts auf dem Gebiete der Gerichtsbarkeit vor.
In das Zwielicht der Sage gehüllt, ehrwürdig und grauenvoll zugleich, erscheint der Nachwelt die heilige Feme. Man betrachtete sie als eine Stiftung Kaiser Karls des Großen und des Papstes Leo III., und so viel ist gewiß, daß ihre Entstehung auf die alten Grafengerichte zurückzuführen ist, die nach dem Untergange des karolingischen Reichs als solche allmählich verschwanden, aber in seltsam verwandelbarer Form erstanden. Drei Schöffen des Femgerichts hatten das Recht, einen auf frischer Tat ertappten Verbrecher sofort zu töten, indem sie ihn mit einer Weide an den nächsten Baum hängten. War der Spruch vollzogen, so steckten sie ein Messer in den Baum zum Zeichen, daß hier mit Recht gerichtet, nicht gemordet war. Wenn ein Angeklagter nach dreimaliger Vorladung nicht erschien, war sein Leben verfallen. Nur durch die Freischöffen konnte eine Klage vorgebracht werden. Seit dem 13. Jahrhundert fingen die Freischöffen an, sich als ein Stand abzusondern und selbst zu ergänzen. Später tauchte die Behauptung auf und wurde geglaubt, Freigerichte seien nur in Westfalen, auf der sogenannten Roten Erde zulässig. Kaiser Karl V. und mehr noch Sigismund begünstigten die Entwicklung des heimlichen Gerichts, das sich als Reichsgericht fühlte; Sigismund wurde selbst Freischöffe. Nach der Meinung der Eingeweihten war »dit hilge recht dat hogeste recht in dem hilgen Romischen riche«, ja in der Welt. Die Freigrafen nannten sich gern »von Reiches Gnaden«, sie waren der Meinung, daß »alle grafschaften unde frystoele von dem Romischen koenige und dem heiligen riche zu lene gont«. Es ging sogar das Gerede, daß der Erbfreigraf von Dortmund dem Kaiser bei der Krönung in Aachen einen auf das heimliche Gericht bezüglichen Eid abnehme. Oberster Stuhlherr der Feme war der Erzbischof von Köln als Nachfolger der Herzöge von Sachsen. In den vier Bistümern von Köln, Minden, Paderborn und Osnabrück gab es über 400 Freistühle. Ihre Bedeutung stieg dadurch, daß Karl IV. ihnen die Handhabung des Landfriedens anvertraute.
Auch Soest war im Besitz einer Stuhlherrschaft und des Rechts, Freigrafen zu setzen. Als nun die Stadt ihren Freistuhl, der sich weit draußen in der Börde befand, an die Elverichsporte unmittelbar vor dem Tore verlegte, wurde der damalige Erzbischof, Friedrich von Saarwerden, bei Kaiser Wenzel vorstellig und bewirkte, daß derselbe nicht nur das bereits Bewilligte als unredlich erschlichen bezeichnete, sondern erklärte, weder Soest noch eine andere Stadt in Westfalen dürfe überhaupt einen Freistuhl haben. Er ging in seiner Launenhaftigkeit so weit, der Stadt die hohe Gerichtsbarkeit ab- und dem Erzbischof zuzusprechen. Ein so folgenschwerer Eingriff bewog die Stadt zu einem außerordentlichen Schritt, nämlich in Verbindung mit einem Schutzherrn zu treten, dem Grafen Adolf IV. von der Mark, der zugleich erster Herzog von Kleve war. Auf diesen damals jugendlichen Herrn bezieht sich ein Vers, der uns seinen Charakter als den eines Ritters ohne Makel überliefert hat:
»Syn neyn was neyn gerechtig – Syn ja was ja vollmechtig – Hey was Synes ja gedechtig – Gyn grondt syn mondt eindrechtig – Prinz aller Prinzen Spiegell – Syn wordt dat was syn sigell – Syn modes stolz & kregell – Der fromen fürsten regell.«
Damals hatte er vielleicht diesen Ruf noch nicht erworben, vielleicht verhieß ihn nur, was sich Redliches und Großes in den Mienen und im Wesen verkündet; was ihn aber besonders den Soestern empfahl, war wohl sein mehr oder weniger feindliches Verhältnis zum Erzbischof von Köln. Es wurde eine »sonderliche Freundschaft« zwischen Soest und Kleve geschlossen, so daß der Herzog die Stadt zu schätzen versprach, ohne sich verdächtige Rechte auszubedingen. Durch die Absetzung des Kaisers Wenzel, womit auch seine willkürlichen Bestimmungen über die Freigrafschaften fielen, wurde zunächst noch einmal ein Ausgleich geschaffen; erst als im Jahre 1414 Graf Dietrich von Mörs zum Erzbischof gewählt wurde, verdichtete sich wieder die Gefahr. Graf Dietrich von Mörs war, als er zur Regierung kam, jung, schön, unternehmend und ruhmbegierig, dabei aber unsicher, ohne Folgerichtigkeit und Kraft. Die Stadt Soest, sehr auf ihrer Hut, trat ihm zuerst entgegen, indem sie sich für mehrere kleinere Städte verwendete, die der Erzbischof einer neuen Steuer unterwerfen wollte. Dadurch gereizt, stellte Dietrich alle Beschwerden zusammen, die er Soest vorwerfen konnte; denn er hatte seit Jahren in Urkunden und Schriften seinen Ansprüchen und den Übergriffen der Stadt nachgespürt. Noch ist die umfangreiche Rolle vorhanden, welche die sämtlichen Klagepunkte des Oberherrn aufführt nebst den Bußen, die die Angeklagte zur Entschädigung zu zahlen habe, eine so ungeheure Summe, daß sie ihren Wohlstand für immer untergraben hätte. Es handelte sich dabei hauptsächlich um die Gerichtsbarkeit, die Soest an manchen Orten ausübte, wo sie dem Erzbischof nach seiner Meinung zustand. Bei den fließenden Verhältnissen des Mittelalters war es nicht leicht, unfehlbar jedem das Seine zu erteilen; aber im Grunde kam es weniger auf die Rechte im einzelnen an als darauf, ob Soest die Kraft hatte, denjenigen Grad von Unabhängigkeit rechtmäßig zu machen, den es im Laufe der Jahre tatsächlich erreicht hatte. Beide Teile waren willens, die Entscheidung auf die Waffen abzustellen, aber es vergingen mehrere Jahre mit Vermittelungs- und Sühneversuchen; denn auch damals suchte jeder dem andern die Schuld an der Entfesselung eines Krieges aufzubürden. Der Erzbischof wollte die Angelegenheit vor ein Schiedsgericht bringen, von dem Soest wußte, daß es zu seinen Gunsten entscheiden würde, schließlich lud er die Stadt vor des Königs Gericht und machte damit den Fall zur Reichssache. Auf die Vorladung durch Herzog Bernhard von Sachsen-Lauenburg, dem Kaiser Friedrich III. die Entscheidung übertragen hatte, erschien Soest nicht, sondern protestierte und appellierte an den schismatischen Papst Eugen IV. Inzwischen hatten die Streitenden gerüstet; Soest hatte die sonderbare Freundschaft mit dem Herzog von Kleve erneuert und noch dazu das sogenannte pactum ducale abgeschlossen, das bis auf Friedrich den Großen die Grundlage seiner Verfassung geblieben ist. Herzog Adolf von Kleve, der Kriege sein Leben lang vermieden hatte, übertrug nun in hohem Alter die Schutzherrschaft seinem jungen Sohn Johann, der sich damals als Gast am Hofe seines Oheims Philipp von Burgund befand; der Herzog war nämlich mit einer Burgunderin verheiratet. Von der dort üblichen Mode, die Gewänder mit Glöckchen zu besetzen, wurde der junge Prinz spottweise Jehanneken mit den Bellen genannt. Außerdem hatte Soest noch die Bundesgenossenschaft der Städte Münster, Paderborn und Köln, die in ähnlichen Beziehungen zum Erzbischof standen, und konnte etwa noch auf Unterstützung von Burgund rechnen; denn durch die Verwandtschaft zwischen Kleve und Burgund war dies mit seinem Gegner Frankreich in die Fehde hinein gezogen. Eine überwältigende Reihe glänzender Namen war auf Dietrichs Seite: die Bischöfe von Utrecht, Münster, Minden und Hildesheim, die Kurfürsten von der Pfalz, von Brandenburg, von Sachsen, Herzog Wilhelm von Sachsen und sein Bruder und Herzog Wilhelm von Braunschweig, die Grafen und Herren von Nassau, von Sain, von Isenburg, von Waldeck, von Katzenellenbogen, von Hanau, von Rietberg, von Pyrmont, von Runkel, von Westerburg und, seltsam und traurig zu sagen, die freie Stadt Dortmund. Schließlich erklärte der Kaiser den Krieg gegen Soest als Reichssache und warnte alle, der geächteten Stadt beizustehen.
Am 30. Juni 1444 richtete Soest den klassischen Absagebrief an den Erzbischof, der so gelautet haben soll: »Wettet biscope Dietrich von Mörs, dar wy den vesten Junker Johann von Cleve lever hebbet als Juve, und werde Juve hiemit abgesagt.« Darauf ritt Johann, vermutlich luftig läutend mir seinen Glöckchen, an der Spitze von 2400 Mann in Soest ein, beschwor, wie es üblich war, zunächst der Stadt Freiheiten und Privilegien und empfing dann von den Herren von Soest die Erbhuldigung. Der ältere Bürgermeister band einen seidenen Beutel mit 100 Mark Silber an seinen Gürtel und beschenkte ihn mit Wein, jedoch als man in das Patroklusmünster ging, um die Messe zu hören, verschloß der Klerus zum Zeichen der Feindschaft das Gitter des hohen Chors. Erst die Drohung des Rats, er werde die gesamte Geistlichkeit aus der Stadt vertreiben, setzte es durch, daß ein Gottesdienst gehalten werden konnte.
Die Erzbischöflichen fühlten sich ihres Sieges gewiß und verlachten Jehanneken, den sie für einen Fant ansahen, wie sie an weichlichen Höfen mit Damen spielen. Ein Vers ging um wie an einen Wächter gerichtet: »Lyk ut, daget icht? (Lug aus, tagt es etwa?) Kommt dat Kind von Gente nicht?« Doch schien es ihnen notwendig, so tapfer hielten sich die Gegner, zu deren Führern auch die beiden ehrbaren jungen Helden Johann de Rode und Johann von der Broke, Bürgermeister von Soest gehörten, noch eine Hilfstruppe zu werben, deren allzu bekannte Furchtbarkeit in der Tat die Bedrohten erschreckte, das waren die böhmischen Hussiten. Ihre Verwendung durch den Erzbischof mag damals einen Eindruck gemacht haben wie Frankreichs Verwendung von schwarzen Afrikanern gegen Europäer. Zu Beginn seiner Regierung war Dietrich von Mörs dem Kaiser Sigismund in seinem Kampfe gegen die Hussiten zugezogen; allerdings war er ruhmlos zurückgekehrt, hatte aber damals Beziehungen angeknüpft, die er jetzt auszunützen dachte. Die Nachricht, daß ein Heer von 30 000 böhmischen Ketzern herannahe, verbreitete Entsetzen im Reich; ein Angriff der Hussiten bedeutete ein Erdbeben, eine Sündflut, eine unabwendbare greuelvolle Verwüstung, wie sie im frühen Mittelalter mir den Hunnen oder Ungarn hereinbrach. Die städtischen Bundesgenossen Soests gaben ihre Sache verloren, Münster, Paderborn sagten ab, wie wenn ein Blitz sie gelähmt hätte; einzig das nahgelegene Lippstadt blieb treu und erwartete, wenn auch bebend, das Schreckensschicksal. Ein Glück war es, daß das Kind von Gent ein furchtloser Ritter und seinem Wort treu wie sein Vater war. Wo die Not ihn erforderte, da war er, wo das Grauen die Gemüter wanken machte, tauchte er hilfreich auf. Er schlug sich durch nach Lippstadt, und als die Belagerer, ohne etwas ausgerichtet zu haben, nach Soest aufbrachen, um alle Kraft auf einen Hauptschlag zu wenden, erschien er in Soest und vereinigte seinen Mut mit dem der Bürgerschaft. Nach der Überlieferung war es ein Heer von 50-60 000 Mann, das sich vor Soest lagerte, wovon die Hälfte Hussiten waren, genug, um die ehrenwerte Stadt Soest in Grund und Boden zu zerstören, wenn sie in des Feindes Hände fiel. Am 30. Juli 1447 um 3 Uhr, ungefähr drei Wochen nach ihrer Ankunft, begannen die Belagerer den wohlvorbereiteten Sturm; aber er wurde von einer entschlossenen Bevölkerung abgewehrt. Alle, auch die Frauen, waren auf den Wällen; in der Kirche knieten und beteten die, welche nicht kämpfen konnten. Alte und Kinder, und die Gebeine des heiligen Soldaten Patroklus wurden unter Bittgesängen durch die Straßen getragen. Als dieser Sturm abgeschlagen war und noch ein Versuch mißglückte, war der Krieg verloren. Die große Zahl der Krieger selbst machte sie denen, für die sie kämpften, ebenso furchtbar wie den Bekämpften; die verwüstete Börde konnte sie nicht mehr ernähren, und den Sold aufzubringen wurde mit jedem Tage schwerer. Der Erzbischof hatte schon vor dem Sturm das Heer verlassen, um den drohenden Forderungen der Hussiten auszuweichen, nun blieb nichts übrig, als sie zu entlassen. Es war wohl der größte Augenblick im Leben der Stadt Soest, als die Bürger von der unerstürmten Mauer herab die Würger abziehen, langsam, langsam in der blauen Ferne sich verlieren und etwa noch einmal von weither die Waffen aufblitzen sahen, die ihr Blut vergießen sollten; als sie die Pfeile sammelten, die zahllos drinnen und draußen von dem schweren Kampfe zeugten, und die sie aufbewahrten ihrer Not und ihrem Siege zu ewigem Gedächtnis. Vielleicht war das, was sie geleistet harten, über ihre Kraft gegangen; die Waffe fiel aus ihrer Hand und sie ergriffen sie nicht wieder. Schon im Beginn des 16. Jahrhunderts reimte die Chronik wehmütig an die Zeit der Soester Fehde gedenkend: »Dei olden hebt ere vriheit in eren gehat – Averst in düsser tid verd sei matt.«
Immerhin sind aus dem Zeitalter der Reformation noch Züge alter Kraft und Roheit überliefert. Wie fast überall wurde auch in Soest die reformatorische Bewegung durch die mittlere Bürgerschaft getragen, während die Reichen und Vornehmen zunächst beim Alten bleiben wollten. Unter ihnen herrschte aber keine Einigkeit; es waren hauptsächlich zwei Patrizier, welche die Reformation zu fördern suchten, Johann Rubeck und Johann von Holtum. Es begab sich nun, während die Glaubensstreitigkeiten im Gange waren, daß es beim Trunk im Weinhause etwas ungebührlich zuging und daß sich unter denen, die das Ärgernis erregt hatten, fünf Eidgesellen, d. h. zum Schutze des Evangeliums Verschworene, befanden. Von ihnen der angesehenste war der reiche Gerber Johann Schachtrop, ein starker, fester Mann, der sich zu sicher im Bewußtsein seiner Stellung, seiner Tüchtigkeit und Aufrichtigkeit fühlte, als daß er an Flucht gedacht hätte. Auch war das Vorgefallene an sich belanglos; aber der katholische Rat ergriff den Anlaß, um die Andersgläubigen zu schrecken, und verhaftete die fünf Männer, unterwarf sie der Tortur und erreichte dadurch, daß die Angeklagten bekannten, was verlangt wurde, nämlich, daß sie einen Mordplan gegen die Katholiken im Sinne gehabt hätten. Als sie zum Tode durch Enthauptung verurteilt worden waren, fanden sie sich mit Ruhe in ihr Geschick, ja, es wollte jeder der erste im Martyrium sein. Man ließ Johann Schachtrop den Vortritt, und die versammelte Volksmenge erwartete bebend vor Teilnahme und Entrüstung das jetzt so verehrte Haupt fallen zu sehen. Da ereignete sich etwas Außerordentliches: der Scharfrichter tat einen Fehlhieb, indem er den Gerbermeister in den Rücken, nicht in den Hals traf. Nach altem Herkommen erwirkte ein Fehlschlag dem Opfer Gnade; es bemächtigte sich der Zuschauer vermehrte Erregung und neue Hoffnung. Schachtrop sprang auf, um seine Befreiung zu erzwingen, versuchte, obwohl seine Hände gebunden waren, dem Henker das Schwert aus der Hand zu winden, löste mit den Zähnen den Strick, der ihn fesselte, und entriß, schwer verwundet wie er war, im fürchterlichen Kampfe dem Nachrichter die Waffe. Die Teilnahme des Volks zeigte sich so deutlich, daß die Gerichtsherren nicht den Mut hatten, die Exekution fortzusetzen; vielmehr ließen sie Schachtrop frei und die vier übrigen einstweilen ins Gefängnis zurückführen. Der gerettete Meister, der das eroberte Schwert nicht aus der Hand ließ, wurde in sein Haus getragen, wo er am folgenden Tage an seiner Wunde starb. Unter allgemeiner Trauer wurde er begraben und das Richtschwert, seinem letzten Wunsche gemäß, ihm auf die Bahre gelegt. Die Todesurteile der anderen wurden in Verbannung verwandelt.
Nachdem das Anwachsen des Protestantismus verschiedene katholische Ratsherren verscheucht hatte, wurde Johann Rubeck Bürgermeister und Johann von Holtum weltlicher Richter. Der letztere heiratete eine ehemalige Nonne, die als Jungfer Stine oder »große Begine« bekannt war. Daß er, wie berichtet wird, von Aldegrever sich mit seinem schönen Weibe nackt habe abkonterfeien lassen, erregt die Vermutung, es sei vielleicht ein Funke von dem wiederläuferischen Brande nach Soest verweht und habe dort hie und da gezündet. Die Bevölkerung im allgemeinen wurde nicht davon berührt, der Goldschmied Johann Dusenschuer von Münster, der nach Soest ging, um dort Anhänger und Hilfe zu gewinnen, wurde ergriffen und enthauptet.
Es ist nicht selten, daß Künstler sich Bewegungen hingaben, die erstarrtes Gesetz, getragen von pharisäischer Selbstüberhebung, lockern wollen; so scheint es, daß Aldegreven, der zu den Führern der Reformation in Soest gehörte, den Wiedertäufern nicht abgeneigt war. Aus seinem Bildnis Jan van Leydens, den er vor seinem Tode malte, spricht eine große Auffassung der dargestellten Persönlichkeit. Aldegreven, der letzte große Künstlername, der in Soest erklungen ist, war in Paderborn geboren und hatte revolutionäre Gesinnung und Überzeugungstreue von seinem Vater, einem Paderborner Holzschuhmacher, geerbt. Dieser, obwohl alt und lahm, hatte die Kühnheit, als der Bischof 16 protestantische Bürger hinrichten ließ, vorzutreten und zu verlangen, daß man ihn auch töte, da er so schuldig sei wie jene. Die leidenschaftliche Teilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten, der Bürgersinn, der den Sohn beseelte, zeigt in ihm noch einmal einen Künstler städtischer Blütezeit.
Die Freiheit und das protestantische Bekenntnis, die Soest sich gerettet hatte, sondert es in jeder Beziehung auch äußerlich von den katholischen Städten Westfalens, wie Münster und Paderborn. Während diese über den ehrenfesten Stolz der Hanse barocken Purpur warfen, wuchs die fruchtbare grüne Börde in Soest hinein. Einem Greise gleich, der nach kräftig durchstürmtem Leben wohlig müde vor seinem Hause auf der Bank sitzt und in das Abendrot blinzelt, der Kindheit gedenkend, wie er die Kinder auf dem Markte spielen sieht, so verlor Soest den Unternehmungsgeist und den Drang ins Weite, und es wurde wieder wie vor 1000 Jahren, als die Bauern auf einsamen Höfen am Teiche saßen. Doch nicht ganz so; denn die hatten das Leben vor sich, das nun gelebt war, und mir dessen letzten versteinerten Früchten ein verknöcherter Magistrat ziellos spielte.
Das Beispiel Soests lehrt, daß ein Erschlaffen der Kraft die erste Ursache des Niedergangs der mittelalterlichen Städtekultur war und daß diese Erschlaffung mit den äußeren Umständen übereinstimmte, welche das Aufkommen neuer Mächte und Verhältnisse begünstigten. Auch die Dynastie der Herzöge von Kleve, die mit so glänzenden, ritterlichen Figuren begonnen harre, verfiel jammervoll im Wahnsinn; der Kampf um ihr reiches Erbe eröffnete mit Blut und Grauen den Dreißigjährigen Krieg. Soest wurde wenig von den Stürmen der Geschichte berührt; schon hatte der Fluch oder Segen es getroffen und in ein unsichtbares Gehege eingesponnen. Die Herzöge von Kleve tasteten seine Freiheit und Rechte, die zu bewahren sie gelobt hatten, nicht an und, was viel verwunderlicher ist, auch die neuen Herren, die Kurfürsten von Brandenburg, bequemten sich dem alten pactum ducale des Kindes von Gent. Noch immer, wenn auch die Bevölkerung von 5000 und 6000 auf 400 Einwohner zusammengeschmolzen war, bestanden Rat und Bürgermeister in früherer Zahl und wurden ebenso viele Beamte der verschiedenen Verwaltungszweige wie früher gewählt. Der Großrichter saß noch immer »wie ein griesgrimmender Löwe« auf dem Gerichtsstuhl vor den vier Bänken, es gab bis zum Jahre 1750 Freigrafen und Freischöffen, die nach uralter Formel mir schrecklichen Leibesstrafen bedroht wurden, falls sie die geheime Losung der Feme verrieten. Zu Pfingsten ritt der Freigraf nach dem Kloster zu Welver, frühstückte bei der Äbtissin und rief, zu Pferde das Schwert schwingend, daß er aus Vollmacht kaiserlicher Majestät und der ehrenwerten Stadt Soest das adlige Stift befreie, und daß niemand sich daran vergreifen solle, so lieb ihm sein Leib und Leben, Gut und Blut sei. Die preußische Regierung war einmal einen Augenblick lang geneigt, darin eine Schmälerung der landesherrlichen Hoheit zu sehen, ließ sich aber leicht überzeugen, daß es gar nichts zu bedeuten habe. Daß die kurfürstliche und später königlich preußische Regierung, die es so sehr liebte, durchzugreifen und gleichzumachen, sich die Mühe nahm, um diesen westfälischen Brocken einen Umweg zu machen, erklärt sich zum Teil aus der Rechtschaffenheit der hohen preußischen Beamten, die das anerkannte Recht der Stadt nicht antasten zu dürfen glaubten. Dazu kam aber noch ein anderes, daß nämlich sich Soest auf die Reichsfreiheit zu berufen pflegte, die es eigentlich gar nicht besaß, und daß die Hohenzollern jede Einmischung des Kaisers, wozu es in einem solchen Falle leicht hätte kommen können, vermeiden wollten. Kaum hatte Friedrich der Große die Befreiung seiner Staaten von allen etwaigen kaiserlichen Ansprüchen erlangt, als er mit energischem Griff der Soester Selbstregierung ein Ende machte. Erst die Franzosen aber hoben die Herrschaft der Stadt über die umgebende Börde auf, die bis dahin unbeanstandet von Preußen gedauert hatte, so daß nun der Kreislauf des Lebens von Soest beendet war und die hohen Türme als letztes Zeichen sagenhafter städtischer Größe über wogende Fluren und Äcker ragen.