
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Mehrere glückliche Jahre verstrichen. Elisabeth war zu einem hübschen jungen Mädchen herangewachsen; aber sie liebte Jan nach wie vor und hatte ihn beständig zur Seite.
Eines Morgens, als Jan wie gewöhnlich auf die Veranda hinaustrat, um Herrn Pixley zum Frühstück zu holen, fand er den Schaukelstuhl leer, in dem sein Herr sonst immer mit einer Zeitung saß, und keine freundliche Stimme rief: »Schon gut, Jan; sage ihnen, daß ich komme.«
Langsam ging der Hund ins große Eßzimmer, aber Elisabeth und ihre Mutter waren auch nicht auf ihren gewohnten Plätzen zu finden. Ganz verdutzt ging er über den Korridor die breite Treppe hinauf und dann nach Herrn Pixleys Zimmer, aus dem der Laut mehrerer Stimmen zu ihm drang. Durch die halbgeöffnete Tür sah er zwei fremde Herren, die mit Elisabeth und ihrer Mutter sprachen. Auf dem Bett lag Herr Pixley sehr blaß und still.
»Die einzige Möglichkeit, ihn zu retten, wäre eine Operation durch Dr. Corey in London,« sagte einer der Herren zu Frau Pixley, und der andere nickte zustimmend.
»Er könnte sie auch in Neuyork machen. Wir könnten ja nach London kabeln und ihn ersuchen, sofort nach Neuyork abzureisen, und wir würden die Reise dorthin auch sofort antreten,« fügte der zweite der Herren hinzu, sich an Elisabeth wendend, die mit sorgenvoller Miene die Herren betrachtete.
»Glauben Sie, daß mein Vater die Reise überstehen kann?« fragte sie dann.
»Es ist weniger gefahrvoll, die Reise zu unternehmen als hier zu warten, bis Dr. Corey ankommt,« erklärten die beiden Arzte.
Jan bemerkte, daß Elisabeths Augen voll Tränen standen, und er ging leise zu ihr hin und schob seine Schnauze in ihre Hand. Sie blickte zu ihm nieder und versuchte zu lächeln, aber ihre Lippen zuckten, und sie eilte rasch aus dem Zimmer. Frau Pixley folgte ihr, und als Jan zu ihnen kam, hielt Frau Pixley die weinende Elisabeth in den Armen und bemühte sich, sie zu trösten, obwohl sie selbst kaum die Tränen zurückhalten konnte.
Nach einiger Zeit unterhielten sie sich mit gedämpfter Stimme. Jan drängte sich zwischen ihre Stühle und wünschte sehr, er könnte begreifen, um was es sich handle. Er wäre wohl ebenso trostlos gewesen, wie sie es waren, wenn er gewußt hätte, daß Herrn Pixleys Leben nur durch den berühmten englischen Chirurgen gerettet werden könne, und daß, selbst wenn die Operation gelingen würde, Elisabeth und ihre Eltern monatelang von Hause abwesend sein müßten. Aber Jan war ja nur ein Hund und verstand die fremde Sprache nicht.
Von jener Stunde an war in dem großen Haushalt ein großes Durcheinander. Die Dienstboten eilten umher, Koffer wurden in Elisabeths Zimmer gebracht, Kleider aus den Schränken genommen und in die leeren Koffer gepackt. Dann und wann blickte Jan in einen der Koffer und sah Elisabeth mit verwunderten Augen an. Sie bemerkte seinen besorgten Blick und hörte mit der Arbeit auf, um ihn zu streicheln. Dann wandte sie sich plötzlich an ihre Mutter und sagte: »O, Mutter, was wird mit Jan geschehen?«
»Es ist ausgeschlossen, ihn mitzunehmen,« war die Antwort, denn wir werden in einem Hotel wohnen und dort wäre er eine Last mehr für uns, und für ihn selbst wäre es nicht gut. Auch werden wir möglicherweise nach London müssen, so bald dein Vater nach der Operation die Reise aushalten kann. Dr. Corey kann nicht lange in Neuyork bleiben.«
»Die Dienstboten werden hoffentlich gut gegen Jan sein,« sagte seine junge Herrin, »aber ich würde mich beruhigter fühlen, wenn der alte Johann und Marie noch hier wären. Sie liebten Jan und Jan hatte sie gern.«
»Die neuen Dienstboten scheinen ganz ordentlich zu sein,« erwiderte Frau Pixley. »Sie wissen, wie sehr wir an Jan hängen, und ich werde ihnen den Auftrag geben, ihn gut zu versorgen.«
»Er ist ein solch lieber Kerl und macht gar keine Mühe; ich meine, jedermann müßte ihn lieb haben,« sagte Elisabeth, indem sie zärtlich des Hundes lange, seidenweiche Ohren zupfte und er mit seinen treuen Augen in die ihren schaute.
Am Mittag des folgenden Tages waren die Koffer fertig gepackt und wurden abgeholt. Dann sah Jan, wie Herr Pixley in ein Auto getragen wurde, in dem Frau Pixley einige Kissen zurechtgelegt hatte. Elisabeth kam langsam die Stufen herab mit Jan an der Seite. Sie nahm seinen Kopf zwischen die Hände und sah ihn lange und bedeutungsvoll an.
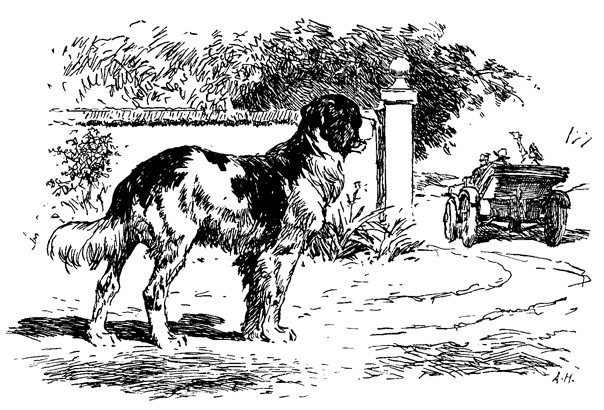
»Lebewohl, Jan. Ich werde wiederkommen.«
Das sagte sie stets, wenn sie auf kurze Zeit fortging. Deshalb wedelte Jan mit dem Schwanze und berührte ihre geröteten Wangen mit der Spitze seiner Zunge. Er sah das Auto fortfahren, zwischen den Orangenbäumen entlang, die zu beiden Seiten der Fahrstraße standen; dann verschwand es hinter einer Biegung der Straße. Nun wartete Jan, bis es an einer gewissen Ecke wieder zum Vorschein kommen würde. Er wußte, daß Elisabeth sich an jener Stelle umdrehen und ihm zurufen würde. Mit gespitzten Ohren und erwartungsvollen Augen sah er das Auto an der Stelle erscheinen, sah seine geliebte Herrin ihm zuwinken und hörte, wie sie rief: »Lebewohl, Jan! Sei ein guter Hund!«
»Wau, wau,« antwortete er wie sonst, wenn er ihr Lebewohl erwiderte. Dann war das Auto zwischen den Bäumen verschwunden.
Es war Sommer und sehr heiß, und deshalb entschloß sich Jan, im Ozean zu baden. Es war gar lustig, gegen die hohen Wogen anzukämpfen, während weiße Seemöwen schreiend über ihn hinflogen, weil sie fürchteten, er würde die Fische erbeuten, die sie selbst fangen und fressen wollten. Nachdem er sich im Wasser abgekühlt hatte, kehrte er auf die Veranda zurück und legte sich an einer Stelle nieder, von wo aus er den Fahrweg übersehen konnte. Es war nämlich seine Gewohnheit, seiner Herrschaft entgegenzulaufen, sie zu bewillkommnen, wenn sie von ihren Spazierfahrten heimkehrte. Er war glücklich und zufrieden, wie er so dalag, als plötzlich die neue Haushälterin mit einem Besen aus dem Hause kam.
»Mach, daß du fortkommst, du schmutziges Tier!« schrie sie, den Besen über seinem Kopfe schwingend. »Diese Veranda ist heute gescheuert worden.«
Jan sprang verwundert auf. Niemals hatte jemand so zu ihm gesprochen. Die frühere Haushälterin, die ihre Stelle verlassen hatte, war seine Freundin gewesen. Wenn die Familie abends ausgegangen war, hatte Jan ihr in ihrer Stube Gesellschaft geleistet und sie hatte stets ein Stück Kuchen für ihn gehabt. Ihr Mann, der Johann, war der frühere Stallknecht gewesen.
Der Besen drohte nun ganz in seiner Nähe. Er sah das zornige Gesicht der Frau und ging die Stufen hinab. – »Bis Elisabeth wiederkommt, bleibe ich besser im Stall,« dachte er und ging nach der Hinterseite des Hauses.

Aber Johann, welcher die schönen Pferde der Familie Pixley versorgt hatte, bis verschiedene Autos die Remisen füllten, hatte seine Stelle verlassen und war jetzt bei Leuten, die noch Pferde hielten; er war Jans treuer Freund gewesen. Der neue Knecht, Wilhelm Leavitt, hatte keine Freundschaft mit Jan geschlossen; aber es gab im Stall verschiedene nette, dunkle Plätze, wo Jan öfters während der heißen Tageszeit sein Schläfchen hielt, ohne daß Wilhelm es wußte. Als nun Jan zu seinem Lieblingsplätzchen unter der alten Familienkutsche hinging, wurde er von Wilhelm gesehen. – »Fort von hier!« schrie dieser wütend.
Der Hund stand still. Wilhelm kam herbei, hob die Hand und warf einen schweren Schraubenschlüssel nach ihm. Er traf ihn aber nicht, und Jan eilte hinaus in den Garten, wo die Bäume dichten Schatten gaben. Unter einem Pfefferbaum mit herabhängenden Zweigen grub Jan ein großes Loch in der kühlen, feuchten Erde, legte sich hinein und seufzte dann erleichtert auf. Er schloß die Augen und war bald eingeschlafen.
Durch einen heftigen Fußtritt wurde er geweckt und sah den Gärtner, der fluchend vor ihm stand. Jan sprang auf und lief davon, blieb aber bald stehen und beobachtete den Mann, der das Loch unter dem Baume zuschüttete.
Als derselbe die Arbeit getan hatte, bemerkte er den Hund und warf einen Stein nach ihm, der Jan über dem Auge traf und eine Wunde verursachte, die sofort zu bluten anfing. Halb toll vor Schmerz lief Jan, bis er einen Platz im Orangenhain, weit weg vom Hause, gefunden hatte. Hier kauerte er sich wimmernd nieder. Sein Herz klopfte und eine namenlose Angst erfaßte ihn, gerade wie an jenem Tage, als seine Mutter so geheult hatte, weil er vom Hospiz fortgeführt wurde.
»Wenn nur Elisabeth bald zurückkäme,« dachte er. »Dann wird alles wieder in Ordnung kommen und die Dienstboten werden nicht mehr böse mit mir sein.«
Die Aufregung, zum erstenmal in seinem Leben mißhandelt zu sein, und der Schmerz des geschwollenen Auges machten ihn fieberkrank. Aber er hielt sich den ganzen Tag über versteckt und durstete lieber, als daß er sich weiterer Mißhandlung ausgesetzt hätte, während er immer auf das Geräusch herannahender Räder und auf Elisabeths Stimme horchte, die ihn rufen würde.
Die Sonne ging unter und noch war die Familie nicht zurückgekehrt. Es wurde sehr still und dunkel, und Jan kroch nach der Rückseite des Hauses, wo abends stets Futter und Wasser für ihn hingestellt wurden. Er schlich dahin wie ein Dieb und war bereit, jeden Augenblick wieder in den Orangenhain zu flüchten, im Fall er Schritte hören sollte.
Seine beiden Schüsseln waren am gewohnten Ort, aber beide waren leer. Seine Zunge war so heiß, daß er beide Schüsseln beleckte. Dann ging er nach der Vorderseite des Hauses und hielt die Schnauze unter einen Wasserhahn und beleckte denselben, um einen Tropfen Wasser zu bekommen. Aber die Röhre war trocken. Jan blickte nach dem Meere hin, über dem der Mond silberhell schien; das Wasser glitzerte, aber er wußte, daß er Salzwasser nicht trinken könne, und dasselbe anzuschauen machte ihn nur durstiger. Endlich, nicht fähig, sich länger zu beherrschen, ging er an den Strand und leckte das salzige Wasser auf, das ihm in der Kehle brannte. Dann stürzte er sich in die Brandung und schwamm eine Strecke weit hinaus. Aber die Wellen brachen sich über seinem Kopfe und das Wasser brannte in seiner Wunde, daß er vor Schmerz heulte. Als er das Ufer wieder erreicht hatte, raste er nach dem Olivenhain zurück, wo er sich stöhnend niederlegte. Sein Durst wurde immer ärger. Er erhob sich und ging wieder zum Stall; er hoffte, die Türe würde offen stehen, wie er es oft in warmen Nächten bemerkt hatte. Im Stall war ein Wassertrog, in dem sich stets Wasser für Elisabeths Reitpferd befand, das sie behalten hatte, obgleich die Familie nur Autos benutzte. Aber die Tür war geschlossen, und Jan ging nach seinem Versteck zurück.
Am nächsten Morgen ging Jan, fast wahnsinnig vor Durst, abermals zum Stall. Als er ihn fast erreicht hatte, hörte er laufendes Wasser und, alles andere vergessend, stürzte er aus den Trog zu, in welchen kühles, klares Wasser aus dem Hahn floß. Wilhelm war auch dort, aber der Hund stellte sich auf die Hinterbeine und steckte die Schnauze in das Wasser, das er gierig aufleckte.
»Geh da weg!« hörte er Wilhelm befehlen.
Aber Jan trank gierig weiter. Dann spürte er den schneidenden Schlag einer Peitsche, jedoch er hob den Kopf nicht auf. Nichts konnte ihn vom Wasser fortbringen. Die Peitschenhiebe trafen ihn rasch und schwer auf den Rücken; bei jedem Schlag zuckte er zusammen, aber er trank weiter, bis der entsetzliche Durst gelöscht war. Dann erst ließ er seine Füße von der Kante des Troges auf den Boden sinken und wandte den großen Kopf; ein Auge war zugeschwollen, aber aus dem andern blickten Haß und Trotz. Er fletschte die Zähne, und aus seiner Kehle drang ein bösartiges Knurren.
Ein junger Mann, den Jan nicht kannte, kam von der Rückseite des Hauses herbei. Der Hund sah ihn und Wilhelm an, bereit, mit beiden den Kampf aufzunehmen. Als Jan auf sie zuging, zog sich Wilhelm zurück. Jan knurrte wieder.
»Glaubst du, daß er toll ist, Shorty?« fragte Wilhelm beunruhigt.
Jan verstand die Worte nicht, aber er begriff, daß der Mann sich aus irgend einem Grunde vor ihm fürchtete. Er knurrte noch heftiger und stellte sich drohend vor ihn hin.

»Er würde kein Wasser trinken, wenn er toll wäre,« erwiderte Shorty. »Aber warum hast du ihn nicht in Ruhe gelassen? Er tat dir nichts, bis du ihn schlugst.«
»Ich hasse die Hunde, wie du weißt,« antwortete Wilhelm ärgerlich. »Es war mir stets ein Ärgernis, zu sehen, wie die Herrschaft so vernarrt in diesen da waren. Wir alle mußten bereitstehen und den Hund bedienen, als ob er der König von England wäre. Nun da die Familie fort ist, wird er schon einen Unterschied merken.«
Shorty ging langsam auf Jan zu, hielt ihm eine Hand hin und sagte: »Du bist doch nicht toll, alter Kerl.«
Aber der Hund wich ihm aus, und seine Schnauze zuckte als Warnung: wenn diese Männer ihn fürderhin belästigten, würde er sich wehren. Abermals knurrend verließ er den Stall; aber er hatte ein Bewußtsein seiner eigenen Macht bekommen: durch Knurren und Zähnefletschen konnte er Leute zwingen, ihn in Ruhe zu lassen.
In der nächsten Nacht strich er umher. Er entdeckte die Abfalleimer und füllte aus ihnen seinen Hunger; er lernte sich während des Tages verstecken und nachts sein Futter suchen wie ein wildes Tier. Wenn ihm einer der Dienstboten begegnete, stellte er sich ihm entgegen mit gesträubtem Haar. Nur ein Blick in seine blutunterlaufenen Augen und auf seine großen weißen Zähne genügte, daß jeder, Mann, Frau oder Kind, ihm aus dem Wege ging.
In der Eile der Abreise hatte Elisabeth vergessen, Jans Haare scheren zu lassen; vielleicht hatte sie auch der Dienerschaft den Befehl gegeben. Jetzt machten ihm die langen Haare heiß; sie waren lästig und die Flöhe darin trieben ihn fast zur Verzweiflung. Tag und Nacht biß und kratzte er sich und riß ganze Büschel der zottigen Haare aus, so daß bald wunde, blutende Stellen seinen Körper bedeckten. Von Tag zu Tag wurde er wilder und unbändiger. Er haßte jetzt alle Menschen: die Mönche, die ihn verkauft hatten, Herrn Pixley, der ihn vom Hospiz weggenommen und Elisabeth, die ihn verlassen hatte; vor allem aber die Dienstboten, die ihn mißhandelten.
»Ich wollte, ich könnte den Hospizhunden sagen, sie möchten niemals mehr Menschen retten, die sich im Schnee verirrt haben,« dachte er, als er im Dunklen lag. »Wenn Wilhelm den Weg im Schnee verloren hätte und ich ihn fände, würde ich ihn mit den Zähnen an der Gurgel packen, statt daß ich ihn rettete.«
So kam es, daß der sanftmütige Prinz Jan, dessen Herz voll Liebe und Vertrauen gewesen war, und der jedem helfen wollte, ein wildes Tier wurde, das alle Menschen haßte, selbst diejenigen, die er einstmals geliebt hatte und für die er früher gern in den Tod gegangen wäre.