
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Warum läßt mich Benedict ohne Nachricht? Was mag geschehen sein? Welch unerwartetes Hindernis konnte einen so wohlvorbereiteten Plan zum Scheitern bringen?« So fragte sich Arthur Sidney, indem er auf der schmalen Felsenplatte hin und her schritt, um sich die frosterstarrten Glieder zu wärmen.
O mein Gott! Wie lange lebte er nun schon nur diesem einzigen Gedanken, dieser einzigen Hoffnung! Er hatte sich ihr mit der rückhaltlosesten Hingabe, mit der äußersten Entsagung ganz verschrieben. Liebe, Familie, Freundschaft, sein ganzes menschliches Gefühl hatte er als Opfer dargebracht, um diese einzige Flamme zu speisen. Seinen Verstand, die Kraft seines unbeugsamen Willens, der eine Welt aus den Angeln zu heben sich vermaß – alles diente nur der einen großen Sache, die nun in der Stunde der Erfüllung selbst, an irgendeinem sinnlosen Hindernis zunichte werden sollte. »Gestern war es der wahnsinnige Sturm, heute mag es irgendein alberner Zufall sein, den ich noch nicht kenne: ein Schlüssel, der sich im Schlosse sperrt; ein bestochener Soldat, dem nachträgliche Bedenken aufsteigen, die mit der bloßen Verdoppelung der Summe, ja mit noch weniger beschwichtigt werden könnten. Ach, wer kennt nicht die tausend dummen Widerstände, mit denen sich die Materie gegen die Herrschaft des Geistes auflehnt!«
Inmitten dieses stummen Monologes, den er mit fiebernden Gesten begleitete, blieb er plötzlich mit auf der Brust gekreuzten Armen in tiefem Sinnen stehen. »Wie aber, wenn auch der Zufall einen zielbewußten Willen hätte?«
»Wohlan denn«, fuhr er zu sich selber fort, »so werde ich mir diesen Willen unterwerfen!«
Während Sidney sich also seinen inneren Betrachtungen überließ, wälzten Jack und Saunders, die nicht eben nachdenklicher Natur waren, ihren Kautabak von einer Backe in die andere und wieder zurück und ließen jene zerstreuten Blicke, denen jedoch nichts entgeht, über das Meer schweifen, mit denen der Matrose, selbst außerhalb dessen Bereiches, das Element betrachtet, mit dem sein Leben aufs innigste verbunden ist.
Der Sturm hatte sich ganz gelegt. Das in den Sand festgerannte, durch das Seil gehaltene Boot schaukelte seinen Kiel im besänftigten Wellenspiel.
»Saunders, klettere auf diesen Felsen hinauf und halte Ausschau! Jack mag indessen zu unserm Boot hinuntersteigen und das Wasser auspumpen, das sich während der Nacht darin angesammelt hat.« Die Matrosen trennten sich, um Sidneys Befehle auszuführen. Der eine kletterte hinauf, der andere hinunter.
Auf den ersten Blick mochte es unmöglich erscheinen, von dieser Stelle aus den Felsgrat zu erreichen; aber die nähere Betrachtung zeigte, daß das Riff nicht völlig senkrecht abfiel. Einige Vorsprünge bildeten untereinander eine Art Geländer. Von Zeit zu Zeit fanden sich Ruhepunkte, die von der geschäftigen Hand der Natur selbst mit Vorbedacht angebracht schienen; und an den unnahbarsten Stellen boten Gestrüpp und Baumwurzeln eine Handhabe. Es dauerte auch gar nicht lange, so hatte Saunders seinen Aufstieg beendigt. Aber die Landschaft, die sich dort oben vor seinen Blicken ausdehnte, war weit und breit verödet, und Saunders gab Sidney durch Zeichen zu verstehen, daß er nichts entdecken könne.
Am Strand unten hatte Jack in Kürze das Boot von Wasser befreit. Trotz der heftigen Stöße hatte es keinerlei Schaden gelitten. Wenn der Kaiser jetzt noch kommen wollte, so war noch nichts verloren.
Aber der Tag verging, ohne daß irgendein menschliches Wesen sich zeigte. Die Qualen, die Sidney während dieser trostlosen Wartezeit durchlitt, lassen sich nicht beschreiben. Gegen Mittag sagte er zu sich selber: »Heute abend werden sie sicher kommen. Wahrscheinlich ließ der nächtliche Sturm sie vermuten, daß ich mit meinem Boot nicht würde landen können. Der Aufruhr der Elemente war zu furchtbar. Ja, gewiß, so verhält es sich! Wie dumm von mir, daran nicht früher zu denken. Wahrhaftig nur ein Wahnsinniger wie ich konnte sich in diesem Unwetter aufs Meer hinauswagen.« Dieser tröstliche Gedanke stärkte ihn bis zum Abend. Ja, er beruhigte sich soweit, um ein Biskuit und etwas Rum zu sich zu nehmen, was Jack ihm aus dem Boot heraufholte.
Saunders hatte auf seinem Posten nichts entdeckt. Die ›Belle-Jenny‹ ihrerseits war über das lange Ausbleiben des Bootes unruhig geworden, fuhr näher an die Insel heran und suchte die Küste in allen Richtungen ab, indem sie ein Signal nach dem anderen gab.
»Ungeachtet meiner furchtbaren Besorgnis,« sagte Sidney zu sich selber, »hat Benedict gut daran getan, mir keinen Boten hierher zu senden. Dieses Kommen und Gehen könnte Verdacht erregen. Denn auf dieser verdammten Insel herrscht die peinlichste Wachsamkeit. Das geringste Versehen vermöchte diese letzte Rettung gefährden.«
Die Stunden vergingen für Sidney in einem so aufreibenden Wechsel von tödlicher Sorge und leidenschaftlicher Erwartung, daß sich die Haare an seinen Schläfen weiß färbten.
Der Abend brach an. Die Sonne versank Zoll um Zoll am Rand des Horizontes. Sie fiel zwischen den verschiedenen Wolkenschichten hindurch wie eine Bombe durch die Stockwerke eines Hauses. Ihr blutroter Abglanz spiegelte sich im mannigfaltigen Wellenspiel und erlosch dann jählings. Die Nacht war mit der in den Tropen eigentümlichen Schnelligkeit hereingebrochen. Die lichtlosen Stunden, die jetzt folgten, wurden Sidney zu qualvollen Ewigkeiten. Wir müssen darauf verzichten, diese Nacht zu schildern. Erwartung, Sorge, Wut, Verzweiflung, Überlegungen der widersprechendsten Art tobten in seiner unglücklichen Seele wie auf einem Schlachtfeld in fürchterlichem Kampf bis zum folgenden Morgen. Plötzlich durchbohrte ein Gedanke wie ein kalter Stahl sein Herz: »Wie«, stöhnte er auf, »sollte mir der Kaiser mißtrauen! Ach, er hätte ein Recht darauf: denn auch ich bin ein Engländer!« rief er mit bitterem Auflachen, das an Wahnsinn grenzte. »Oder sollte seine Krankheit sich verschlimmert haben?« Bei diesem Gedanken begann er, alle Vorsicht vergessend und auf die Gefahr hin, zehnmal ins Meer hinabzustürzen, mit Armen, Händen und Füßen am Felsen emporzuklettern. Seine Nägel krallten sich in den glatten Boden. Blut strömte von seinen Händen. Er achtete dessen nicht. In wenigen Minuten hatte er den Felsen erklommen und rannte mit letzten Kräften in der Richtung von Longwood davon.
Die Umgebung der Residenz bot einen ungewohnten Anblick. Der Sturm der verwichenen Nacht hatte weit und breit alle Bäume geknickt und entwurzelt. Sie lagen mit zerzausten Kronen und aufgereckten Stämmen am Boden. Ein Unaussprechliches von Trauer und schicksalhafter Notwendigkeit lagerte über dem bescheidenen Gebäude, das von heimlicher Geschäftigkeit und schweigender Erregung erfüllt schien. Die Posten, an ihre Gewehre gelehnt, schienen der Wachsamkeit müde zu sein. Sie vergaßen, den Vorübergehenden ihr »Qui vive?« zuzurufen. Gleichgültig verharrten sie auf ihren Plätzen und versahen ihren Dienst so lässig, als hätte nur militärische Gewohnheit und nicht das Gebot der Vorsicht sie hierher beordert. Offiziere gingen vorüber, ohne ihnen ihre Saumseligkeit vorzuwerfen. Die Bewohner der Insel kamen und gingen ungehindert, und Sidney passierte den innersten Wachbezirk, ohne daß ein Mensch seiner achtete.
So gelangte er bis nach Longwood.
Männer und Frauen hemmten ihre Schritte und flüsterten mit verstörter Miene halblaut miteinander. Sie betraten mit behutsamen Schritten das Haus und kehrten bald darauf noch blasser und mit geröteten Augen wieder zurück.
Sir Arthur Sidney, dem sich das Herz in banger Ahnung zusammenkrampfte, folgte mit wankenden Schritten und wie trunken vom Wein seines Schmerzes. Er tastete sich die Mauer entlang und schloß sich dem schweigenden Menschenzuge an, ohne zu wissen, was er tat.
Nach wenigen Schritten bot sich seinen Augen ein Bild von herzzerreißender Majestät: Auf seinen Kriegermantel gebettet, nicht wie ein des Lebens lediger Körper, sondern wie ein Soldat, der sich zur Siegesfeier des kommenden Tages ausruht, lag Napoleon in der Uniform der Gardejäger auf seinem Prunkbett.

Seine Brust war mit Orden und glänzenden Insignien ganz bedeckt. Sein braver Degen lag wie ein guter Freund an seiner Seite ausgestreckt und träumte den ersten Traum der Ewigkeit. Ein wunderbarer Ausdruck reiner Verklärung lag über den marmorblassen Zügen, an die der Todeskrampf nicht zu rühren gewagt hatte. Alles, was der Rausch des Sieges oder der Schmerz über eine Niederlage oder die Mühsal der Gedanken und Leiden an irdischen Vergänglichkeitsspuren auf einem menschlichen Antlitz sonst zurückläßt, war aus diesen Zügen ausgelöscht.
Hier lag nicht der Leichnam eines Menschen – hier lag die Statue eines Gottes. Unter der Berührung des Todes offenbarte die sterbliche Hülle ihr ewig Teil. Das Gefängnis war zum Tempel, das Trauergemach in einen Olymp verwandelt. Christus am Kreuz, Prometheus an den Felsen seiner Qual geheftet, hatten nicht schönere, edlere Züge aufzuweisen.
Große kaiserliche Seele! Was durftest du erblicken in den ersten Stunden deiner ewigen Herrlichkeit? Wer grüßte dich zuerst und führte dich vor das Angesicht Gottes? War es Alexander, Carolus Magnus, Julius Caesar? Oder war es dein vielgeliebter Lannes, der im Sterben nichts als deinen Namen rief; oder Duroc; oder ein armer, unbekannter Grenadier deiner Garde, der seinen Tod für reichlich bezahlt hielt, wenn du seinen Namen wußtest?
Bei diesem Anblick wurde Sidney von einem jähen Wirbel der Gefühle gepackt, und die Flügel des Wahnsinns schlugen mit dumpfem Rauschen um seine Schläfen. Er versuchte ein paar schwankende Schritte – sank neben dem Bett seines Helden in die Knie und küßte die eiskalte Hand, die das Zepter der Welt geführt hatte. Man ließ ihn gewähren; denn ein Kuß vermag keinen Toten aufzuerwecken. Nur als er, keiner Zeit mehr bewußt, ganz in seinem Schmerz versank, stieß man ihn mit einem Gewehrkolben an und bedeutete ihm, anderen Platz zu machen.
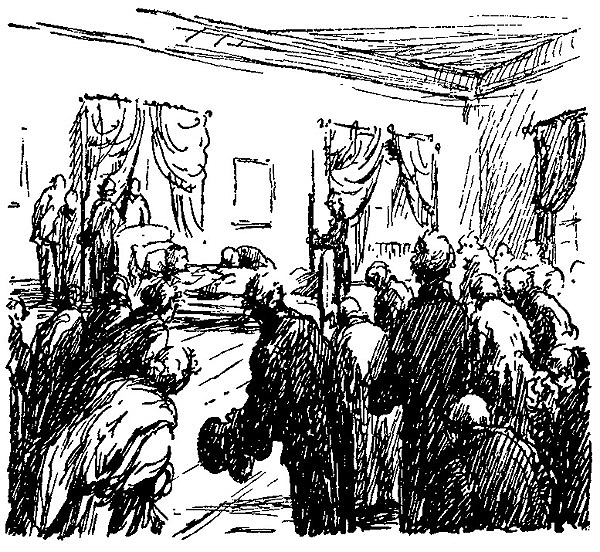
Mit geisterblassen Zügen und völlig vernichtet schleppte er sich mühsam hinaus. In einer Minute war er um zwanzig Jahre gealtert und glich eher einem Geist als einem Wesen von Fleisch und Blut. Seine verstörten Blicke irrten bald verschwommen umher, bald hefteten sie sich mit kindischem Eigensinn auf einen belanglosen Gegenstand. Sein Kaiser war tot – wie kam es, daß er, Sidney, noch atmete? Er begriff nicht, daß die Sonne noch immer die Welt erhellte; daß die Berge an ihrem Platz verharrten; daß die Natur weiter am Werk verblieb. Er fühlte sich so schwach, wie nach einer langen Krankheit. Das Licht zwang ihn, die Augen niederzuschlagen; die Luft verursachte ihm Schwindel. Seine während so langer Zeit auf ein einziges Ziel gespannten Kräfte rissen plötzlich entzwei. Sein starker, unermüdlicher Wille hatte den Pol verloren und bebte wie ein richtungslos gewordener Kompaß. Ein ungeheurer Zusammenbruch hatte sich in seinem innersten Wesen vollzogen.
Sein Körper trieb ihn wie in unbestimmter Erinnerung zum Landhaus seiner Freunde. Er stieß die Gartenpforte auf, trat in den Vorplatz des Hauses ein und ließ sich, unfähig eines einzigen Wortes, auf einen Stuhl fallen. Edith, die in ihren schwarzen Trauerkleidern noch weißer als sonst erschien, kam ihm schweigend entgegen und drückte seine Hand.
Bei diesem stummen Zeichen der Teilnahme brach aus Sidneys Augen die Tränenflut, die nur des erlösenden Winkes gewartet hatte, und strömte zwischen den Fingern der Hand hindurch, die er vor sein Gesicht hielt. Jetzt trat auch Benedict herzu und erklärte seinem Freund, warum er ihn vergeblich hatte warten lassen: Durch allerlei Anzeichen aufmerksam gemacht, hatte die Behörde ihn ausgeforscht und festgehalten. Der Tod des Kaisers aber und das Fehlen eines vollgültigen Beweises hatten seine sofortige Freilassung bewirkt.
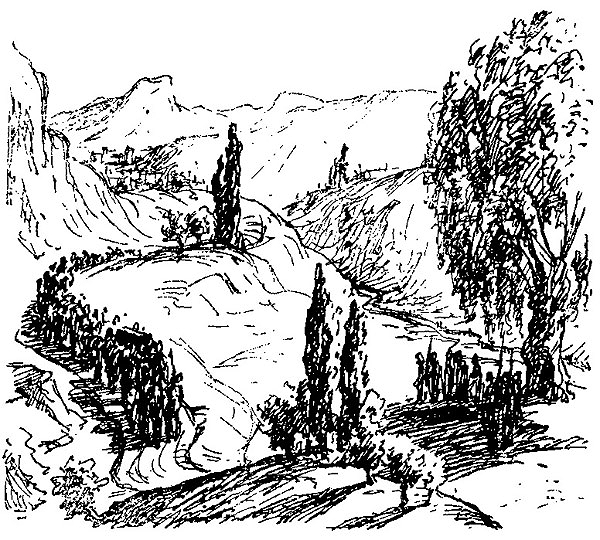
Sidney hörte diese Worte kaum; sie hatten jetzt keinen Sinn mehr für ihn.
Zwei Tage verweilte er noch auf der Insel, und um seinen Schmerz bis zur Neige auszukosten, folgte er dem Leichenzug in das Tal des Fermain. Am Pic de Diane entspringt dieser kleine Fluß, an dessen Ufer sich die Trauerweiden neigen, die dem Kaiser teuer waren und deren geheiligte Blätter seither über die ganze Welt hin verstreut wurden. Er sah den Sarg, von englischen Soldaten getragen, sich in die gemauerte Gruft senken und verließ den Ort erst, als der schmale, lange Stein über das schwarze Loch gewälzt war.
Durch den schonungslosen Anblick aller dieser traurigen Einzelheiten wollte sich Sidney die Wirklichkeit seines Unglücks um so fester einprägen. Denn er fürchtete, über kurz oder lang an den Tod des Kaisers nicht mehr glauben zu können. Schon fühlte er, wie ein Phantom sich in seiner Seele aufrichtete, obgleich er seinen Helden auf dem Totenbett gesehen und seine erkaltete Hand geküßt hatte. Das trügerische Wunschgebilde mußte mit den Erinnerungen an das Leichenbegängnis und an den Anblick des Grabes beschworen werden.
Als er den Hügel von Hutsgate hinaufstieg, wandte er sich ein letztes Mal nach dem neuen, weißen Steine um, auf den die Zweige der Trauerweiden ihre zarten Schatten warfen, und er sprach zu sich selber:
»Mit diesem kaiserlichen Leichnam ist meine Seele eingescharrt worden.«
In diesem Augenblick trat ein Mann in Trauerkleidern auf ihn zu, und ihm ein Papier reichend, sagte er in englischer, mit französischem Anklang gefärbter Sprache:
»Nehmen Sie dieses im Auftrag dessen entgegen, der nicht mehr ist!«
Sidney erbrach den schwarzgesiegelten Brief. Er enthielt eine kleine Strähne feinen, seidenweichen Haares und einen Zettel, auf dem diese Worte geschrieben standen:
»Seien Sie getrost, es geschieht nichts gegen den Willen Gottes.
N.«
Als Sidney aufblickte, war der Mann, der ihm den Brief überreicht hatte, verschwunden. Er ließ sich an einem Abhang des Hügels nieder und versank in tiefes Sinnen. Aber als er sich wieder erhob, war seine Miene ruhiger denn zuvor. Eine Veränderung war mit ihm vorgegangen.
Er suchte Benedict auf und sagte zu ihm: »Kannst du mir verzeihen, o mein Bruder, daß ich dich um einer Schimäre willen deinem Glück entrissen habe? Hiermit entbinde ich dich deines Schwures.« Und er zog ein vergilbtes Papier aus seiner Brusttasche, zerriß es und ließ es vor Benedicts Füßen zu Boden fallen.
»Kehre nach Europa zurück; du bist frei! Nichts fesselt dich mehr an unseren unseligen, geheimen Bund. Folge dem Zug deines Herzens, werde glücklich und nimm von mir diesen Rat: Versuche niemals in das Gewebe der Geschicke einzugreifen! Stärkere Hände als die unsrigen wirken seine Fäden, und was uns böse erscheinen mag, ist vielleicht nur höchste Gerechtigkeit. Mich aber hat der Atem des Schicksals aus dem Gleis geworfen, und ich finde in meine Bahn nicht mehr zurück. Zu einer einzigen Sache war ich tauglich; sie schlug fehl – jetzt ist es mit mir zu Ende. Ob man mich heute, morgen oder erst viel später in die Grube legt – es bleibt sich gleich; denn ich bin schon tot. Gedanken, Gefühle, Willenskräfte, nichts ist mir geblieben – alles ist verflogen . . .
Und Sie, meine teure Edith, mögen Sie Ihrem Leben ein würdiges Ziel finden. Vielleicht ist es schon gefunden?« Bei diesen Worten blickte Sir Arthur Sidney forschend auf Edith, die sanft errötete. »Schenken Sie Ihr Herz einem Manne, einem Kind, einem Hund, einer Blume – gleichviel. Niemals aber einer Idee – denn das ist gefährlich.«
Nach dieser Rede drückte Sidney seinem Freunde beide Hände und wandte sich dem dunkeln Felsenriffe zu, wo Jack und Saunders, die schon ihren ganzen Tabaksvorrat zu Ende gekaut hatten, einer tödlichen Langeweile anheimgefallen waren.
*
Arundell und Edith waren jetzt allein auf der Insel zurückgeblieben, und obgleich man Sankt Helena kaum als einen freundlichen Aufenthalt bezeichnen kann, hatten sie es mit ihrer Abreise gar nicht so eilig. Edith, die ihr Gatte mit eigenen Händen dem Wellengrabe überliefert hatte, fühlte sich nicht sonderlich von Europa angezogen, und Benedict, der sich einredete, immer noch heftig in Miß Amabel verliebt zu sein, befand sich merkwürdigerweise sehr wohl in dem kleinen Landhaus, das selbst einem Weinhändler aus der City Londons zu gering gewesen wäre. Aber Ediths Gegenwart machte es ihm zum angenehmsten Aufenthalt. Die junge Frau stellte ihrerseits mit Verwunderung fest, daß keine übermächtige Sehnsucht sie zu Volmerange zog; und alle beide überboten sich in widerstrebenden Anstrengungen, ihre auf der Flucht befindlichen Liebesgefühle in ihren Herzen festzuhalten.
Schon wollte es Benedict nicht mehr recht gelingen, die reizenden Züge seiner Braut in der Erinnerung wiederzufinden. Immer mischte sich etwas von Edith dazwischen; bald war es der sanft verschleierte Blick, bald ihr süßes, wehmütiges Lächeln: die beiden Gesichter waren hoffnungslos in eines verschmolzen. Nicht anders erging es Edith. Wenn sie in ihren Träumen Volmerange beschwor, so erschien nicht selten Benedict. Und nach einiger Zeit wollte sich Volmerange überhaupt nicht mehr zeigen. Ja, Edith gelangte sogar zu der Überlegung, daß ein Mann, der seine Frau so kurzerhand zu ertränken imstande war, vielleicht doch nicht so ganz als das Ideal eines Gatten bezeichnet werden konnte.
Dies alles verhinderte jedoch nicht, daß das junge Paar in seinen Gesprächen sich gegenseitig des großen Glückes versicherte, das seiner bei der Rückkehr in London wartete. Benedict würde nun schließlich doch mit seiner angebeteten Amabel zum Traualtar schreiten und Edith mit ihrem gefährlichen Gatten versöhnt werden.
Diese Gespräche, die in der Regel heiter begannen, endeten jedoch meistens in sehr melancholischer Tonart. Benedict fand den Gedanken einer Versöhnung Ediths mit Volmerange widerwärtig; und Edith war von den Liebesfreuden nur mäßig entzückt, die ihres Freundes an Miß Amabel Vivians Seite harrten.
Mit solcherlei Gedanken vertrieben sie sich die Zeit auf Sankt Helena, und nur wenige Schritte von ihrem Hause entfernt neigte sich trauernd die Weide über dem erlauchtesten Grabe der Welt – wenn man schon bei Gräbern von einem Unterschiede sprechen darf. Das eigentümliche Spiel ihrer Gefühle war ihnen wichtiger als die große Wendung in der Weltgeschichte, die der Tod auf dieser Insel herbeigeführt hatte. Und selbst wenn sie des Abends in das Fermain-Tal zum Grabe des Titanen pilgerten, wo der Fluß leise um den weißen Stein rauschte und der Wind in den Blättern des schwermütigen Baumes spielte, so war doch ihr Sinn dem eigenen Schicksal zugewandt. Eine Locke, die sich auf Ediths Nacken ringelte und mit ihrem kräftigen Kastanienbraun die rosig zarte Haut reizend betonte, verdrängte in Benedicts Kopf alle jene Gedanken, die sich beim Anblick der Ruhestätte des größten aller Kriegsherren ganz unwillkürlich hätten einstellen müssen. Und wiederum trockneten seine bewundernden Blicke rasch die Tränen in Ediths Augen, die das Andenken des erhabenen Gefangenen hervorgelockt hatte.

Anfänglich wollten sie ihre Rückkehr nach England brieflich ankündigen. Aber dann änderten sie ihren Vorsatz; denn es schien ihnen geraten, ganz unverhofft und im Schutze der allgemeinen Trauer um den Kaiser einzutreffen. Dieser Entschluß gründete sich aber auch auf eine »philosophische« Überlegung: es ließe sich nämlich bei einer Überraschung viel sicherer auf den wahren Stand der Herzen schließen. Edith würde leichter erkennen, ob Volmeranges Reue stark und echt, Benedict, ob der verwaiste Platz in Europa so treu wie in Afrika behütet geblieben oder schon wieder neu besetzt wäre.
Aber wenn die Dinge sich nun anders entwickelt hätten! Wenn Miß Amabel Vivian, durch das unaufgeklärte Verschwinden ihres Bräutigams ernstlich gekränkt, diesem ihre Liebe entzogen hätte, und Volmerange es durchaus nicht bereute, seine Gemahlin in die Themse geworfen zu haben! Was dann? Unsere beiden »Tartüffs wider Willen« wagten es nicht, sich vor ihrem innersten Gewissenstribunal einzugestehen, daß ihnen nichts willkommener sein könnte. Denn dann bliebe ihnen nichts anderes übrig, als sich eingestandenermaßen weiter zu lieben, wie sie es bisher uneingestanden getan hatten.
Ein, zwei Schiffe, die von Kalkutta nach London fuhren, ließen sie unbenutzt passieren.
Beim dritten endlich stiegen sie an Bord. Es war ein feiner, in Teckholz gebauter, kupferbeschlagener und gebolzter Segler, der sie in sechs Wochen nach Cadix brachte. Von dort aus setzten sie ihre Reise zu Lande fort und besuchten Andalusien, Sevilla, Granada und Cordova unter dem bequemen Decknamen von Mr. und Mrs. Smith. Alles hielt sie für verheiratet; etliche Lästerzungen nannten sie beim Anblick ihres trauten Vereins sogar ein Liebespaar auf der Hochzeitsreise. Ihre Kissen allein kannten die Wahrheit. Sie waren Hals über Kopf ineinander verliebt; aber der Engel der Keuschheit begleitete sie auf allen ihren Wegen. Nur hatten sie es mit ihrer Rückkehr nicht eilig und gemeinsam Moscheen und Kathedralen, Alcazars und Paläste, Opern und Stierkämpfe besuchend, waren sie alles in allem vier Monate unterwegs und landeten eben zu Beginn der Wintersaison in Paris.
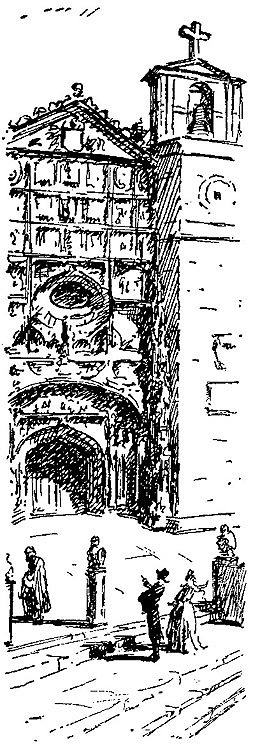
Als ihnen gar kein Vorwand mehr geblieben war, um ihre Ankunft noch länger zu verzögern, und als gewissenhafte Leute, die sie waren, sagten sie eines Abends zueinander: »Wäre es jetzt nicht an der Zeit, nach London zurückzukehren und nachzuprüfen, ob man uns liebt und verziehen hat; oder ob wir verflucht und schon ersetzt sind?«
Der Gedanke, ihr »Liebstes auf Erden« wiederzufinden, erfüllte sie aber mit solcher Betrübnis, daß sie nahe daran waren, sich weinend in die Arme zu sinken, um sich nie mehr zu lassen.
Indessen begann aber auch ihre äußere Lage peinlich zu werden. Sir Benedict Arundell konnte sich nicht auf ewige Zeiten Mr. Smith nennen, und Lady Edith Harley, Gräfin von Volmerange, mußte den prosaischen und vulgären Namen Smith auch endlich abstreifen.
Am folgenden Morgen also bestellten sie Postpferde bis Calais, und schon wenige Stunden später standen sie auf der Hafenmole in Erwartung des Postschiffes.