
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Sankt Helena«, seufzte Edith, und ihre Augen füllten sich mit Tränen.
»Ja«, antwortete Sidney, der gespannt die Wirkung dieses magischen Namens in Ediths Zügen beobachtete.
»Welch grauenvoller Aufenthalt!« fuhr diese mit zusammengepreßten Händen fort.
»Grauenvoll in der Tat«, bestätigte Sir Arthur Sidney, den Blick noch immer auf Edith geheftet.
»Es hieße schon Grausamkeit, einen Verbrecher hierher zu verbannen!«
»Man hat den Genius hierher verbannt«, mischte sich jetzt Benedict Arundell in das Gespräch.
»Welche Schande für unsere Nation!« sprach Sidney in tiefem Sinnen wie zu sich selber. »Aber – Geduld . . .« Hier brach er ab, als fürchte er, schon zuviel verraten zu haben, und seine Miene gewann den gewohnten Gleichmut wieder.
Nach kurzer Zeit erhielt Kapitän Peppercul den Befehl, ein Boot bereitzuhalten, und Sidney begab sich in Begleitung von Edith und Benedict Arundell in seine Kabine zurück.
Dort angelangt, ergriff er Ediths Hand und sagte im Beisein Benedicts:
»Sie haben freiwillig Ihre Opferfreudigkeit und Klugheit in den Dienst der großen Aufgabe gestellt, für die ich lebe. Sie haben gelobt, mir blindlings zu vertrauen; ja, mit geschlossenen Augen den Weg zu gehen, den ich Ihnen anweisen würde – und sollte er in einen Abgrund führen.«
»Das habe ich gelobt; mein Leben gehört Ihnen«, sagte die junge Frau.
»Wohlan,« fuhr Arthur Sidney fort, »es geht in diesem Augenblick freilich noch nicht um das Äußerste. Aber die Stunde ist gekommen, Ihre Verkleidung abzulegen. Begeben Sie sich jetzt in Ihre Kabine, Sie werden dort alles Nötige vorfinden.«
Edith erhob sich und verließ die Freunde.
Als Sir Arthur Sidney mit Benedict allein geblieben war, kreuzte er, wie um die Bewegung seines Herzens zu beschwichtigen, die Arme über der Brust. Dann streckte er sie dem Freunde entgegen mit den Worten:
»Mein Bruder, vielleicht werden wir uns in diesem Leben nicht wiedersehen. Umarme mich!«
Einen Augenblick lang hielten sich die Freunde umschlungen.
»Wenn alles bereit sein wird,« sagte Sidney, indem er Benedict an die Schiffsbrüstung führte, »so fälle den kleinen Baum, den du dort oben auf dem Grat des schwarzen Felsens erblickst. Ich werde mich indessen auf die Insel Tristan d'Acuna oder an die Mündung des Coancaflusses an der afrikanischen Küste begeben, um unser Boot zu zimmern. In zwei Monaten denke ich damit fertig zu werden. So lange wird die ›Belle-Jenny‹ in diesen Gewässern kreuzen. Dann muß der große Schlag fallen.«
»Die Geschichte wird staunen,« sagte Benedict, »und nie . . .« Er brach ab, denn Edith war eingetreten.
In stummer Bewunderung standen die beiden Freunde vor ihrer Schönheit. Die männliche Tracht hatte bis zu diesem Tage Benedict, der seinem Kummer nachhing, und Sidney, den sein großer Gedanke ganz in Anspruch nahm, die liebenswürdigen Reize Ediths verborgen gehalten. Im Laufe der Wochen hatte sich ihr Kummer wenn auch nicht beschwichtigt, so doch gemildert, und die Spuren des schrecklichen Erlebnisses zeigten sich nur noch in der Blässe ihrer Wangen und in einem leichten bläulichen Schimmer an beiden Schläfen, der aber die Anmut des holden Geschöpfes eher noch reizvoller hervorhob, indem er gewissermaßen die schöne Seele offenbarte.
Sie war mit der größten Einfachheit gekleidet. Ein weißes, von einem zierlichen Blumenmuster durchwirktes Musselinkleid schmiegte sich um die junge, biegsame Gestalt und bauschte sich auf den Hüften in duftigen Falten. Ein mit rosa Bändern gezierter Manilastrohhut umrahmte gefällig das süße Oval ihres Gesichtes. Über die schlanken Schultern war ein chinesisches Tuch gelegt.
Vor Sidneys und Benedicts bewundernden Blicken stieg eine dunkle Röte in ihre Wangen. Die Frau in ihr erwachte zu neuem Leben.
»Wie schön Sie sind!« konnte Sidney sich nicht enthalten zu sagen. »Sie werden jetzt mit Benedict an Land gehen als seine Schwester oder Gemahlin – besser als seine Gemahlin. Und diesen Titel werden Sie von heute an führen müssen. In Jamestown werden Sie eine Stadtwohnung und in möglichster Nähe von Longwood ein Landhaus beziehen. Benedict wird Ihnen später mitteilen, was weiter zu tun ist.«
»Wie Sie befehlen,« sagte Edith, die der Gedanke, als Benedicts Frau zu gelten und allein mit einem schönen jungen Mann unter einem Dache zu verweilen, in Verwirrung brachte. Aber mit der Demut ihrer reinen Seele fühlte sie, daß sie das Recht verloren hatte, eine solche Lage als unpassend zu empfinden, und daß der Mätresse Xavers solche Bedenken schlecht anstünden.
»Und jetzt,« sagte Sidney, indem er Edith bei der Hand ergriff und sie Benedict Arundell zuführte, »wird uns das junge Paar verlassen. Das Boot steht schon bereit.« Und mit dem heiteren Lächeln, das ihm so gut anstand, sagte er zu Benedict gewandt: »Du wirst mir zugeben, daß ich dir den Verlust, den ich verschuldet habe, in nicht minder schöner Gestalt ersetze.«
Bei diesen vielleicht etwas ungeschickten Worten erblaßte Benedict, aber er faßte sich schnell; denn er wußte, daß sein Freund ihn nicht verhöhnen wollte. Und Edith betrachtend, mußte er stillschweigend einräumen, daß sie an Schönheit nicht hinter Miß Amabel Vivian zurückstand.
Edith empfand ein gewisses Wohlbehagen, sich wieder in Frauenkleidern zeigen zu dürfen. Die schneeweißen Stoffwolken, der anmutige Strohhut, die Bandschleifen – alles dies erheiterte sie wider Willen, und der Gedanke, festes Land zu betreten, wirkte wie eine Erlösung auf sie. Nach der einsamen, langen Meerfahrt gewann selbst der unwirtliche, karge Boden vor ihren Augen einen besonderen Reiz.
Als sie im Boot an Benedicts Seite Platz nahm, stahl sich zum erstenmal ein Gefühl des Wohlbehagens in ihr Herz, und ihr sonst so trauriges Antlitz erhellte sich. Das Meer war ziemlich ruhig, und von sechs kräftigen Armen gerudert, trieb das Boot blitzschnell dem Lande zu.
Man legte an. Benedict half Edith beim Aussteigen, und Jack und Saunders luden die Kisten mit den von Arthur Sidney für den jungen Haushalt notwendig befundenen Gegenständen auf die Schultern der dunklen armen Teufel, die bei der Ankunft des Schiffes an den Strand geeilt waren.
Saunders hatte bald ein passendes Haus in der Stadt ausfindig gemacht, das die jungen Leute, nachdem sie den Stadthäuptern einen durch Sidneys Fürsorge vollgültigen Ausweis vorgelegt hatten, als Mr. und Mrs. Smith bezogen. Der Legende zufolge, die Jack in der Stadt verbreitete, war Mrs. Smith mit ihrem Gatten auf einer Reise nach Indien begriffen, wo dieser ausgedehnte Indigo- und Opium-Pflanzungen besaß. Jedoch hatte die Meerfahrt die zarte junge Frau so sehr angegriffen, daß man am erstbesten Ort haltmachen mußte, um Mrs. Smith einen zwei- bis dreimonatigen Erholungsaufenthalt zu ermöglichen.

Noch am selben Abend stach Sir Arthur Sidney wieder in See; bald war die ›Belle-Jenny‹ in den blauen Tiefen des Horizontes verschwunden. An ein Fenster seiner neuen Behausung gelehnt, verfolgte Benedict das Fahrzeug mit den Blicken, bis es so winzig geworden war, daß es sich hinter einem Möwenflügel hätte verbergen können.
Das Haus des vermeintlichen Ehepaares hätte ebensogut in Chelsea oder Ramsgate stehen können; denn es wies alle Eigentümlichkeiten des englischen Geschmackes auf, den weder Entfernung noch Klima zu wandeln imstande sind.
Die Mauern waren aus denselben gelben Backsteinen aufgeführt, die dem fremden Besucher in London auffallen, und die innere Einrichtung entsprach bis ins kleinste einem Bürgerhaus in der Gegend von Temple-Bar oder der Trinitätskirche. Das einzige Zugeständnis an das fremde Klima bestand in einer blaugestreiften Markise, die sich über die Eingangstür spannte, und den Matten aus Philippinenstroh, welche die wollenen Teppiche ersetzen sollten.
Der Garten war steil und dürftig. Einzig eine Tamarindenallee, deren Blätterwerk sich wie ein einziges, graugrünes Spitzengewebe ausbreitete, warf einen dürftigen Schatten auf den pulverigen Sand, in dem ein paar erschöpfte Blumenstengel sproßten, denen ein malayischer Gärtner eine nicht eben erfolgreiche Pflege angedeihen ließ.
Es war für Sir Benedict Arundell und für Miß Edith ein eigentümliches Gefühl, sich am Abend desselben Tages bei Tische wiederzufinden. Sie saßen sich schweigend gegenüber, während ein Diener ihnen aufwartete. Diese in einer wirklichen Ehe sehr natürliche Lage aber erstaunte, erschreckte und beglückte sie vielleicht ohne ihr Wissen.
Aber die Verkettung von Umständen, die sie in diese unwahrscheinliche Lage gebracht hatte, wie sie desgleichen wohl nie erlebt wurde, seitdem die Erde ihre vorgeschriebene Bahn um die Sonne zieht, war in der Tat noch wunderlicher, als es die beiden zu dieser Stunde ahnen konnten. Denn Arundell und Miß Edith wußten nicht, daß der eine Gatte ohne Frau, die andere eine Gattin ohne ihren Mann war. Benedict hatte die Sankt-Margarethen-Kirche nie betreten, und an dem dunkeln Portal waren sich nur die beiden blassen Bräute begegnet. Sie wußten nichts anderes, als daß sie beide mehr denn zweitausend Meilen von ihrer Heimat entfernt waren, und zufolge einer kühlen Berechnung und im Dienste einer großen, unbekannten Sache auf dieser traurigen kleinen Insel nun Tag und Nacht unter demselben Dache leben sollten – beide jung und schön und ohne Liebe.
Nach beendigter Mahlzeit besichtigten sie das Haus in allen seinen Einzelheiten, wobei es sich zeigte, daß nur ein einziges Schlafzimmer vorhanden war. Edith errötete in ihrer ausgeprägt englischen Schamhaftigkeit. Benedict aber, der auf der Schwelle stehen geblieben war, erriet die Verlegenheit seiner angeblichen Gattin und sagte: »Ich werde für mich in dem oberen Zimmer eine Hängematte anbringen lassen«, worauf Edith beruhigt lächelte und wie zum Zeichen der Besitzergreifung ihren Schal auf das Bett warf.
Dann begaben sich die beiden in den Garten hinunter und promenierten in der Tamarindenallee mit dem tiefen Wohlbehagen von Menschen, die drei Monate lang in den engen Grenzen eines Schiffsdecks gefangengehalten waren. Edith hatte ihren Arm in den Arundells gelegt. Denn durch die lange Meerfahrt des Gehens entwöhnt, fühlte sie sich unsicher auf den Füßen. Welch ein seltsames Bild hätte dieses durch den abendlichen Garten vertraut wandelnde Paar für Amabel und Volmerange abgegeben!
So vergingen mehrere Tage. Edith gewöhnte sich daran, in Benedict einen Bruder zu sehen, und dieser begrüßte sie freudig als seine Schwester. Und doch zog ein stärkerer Trieb, als sie sich bewußt wurden, eines zum andern, und sie verbrachten fast den ganzen Tag gemeinsam.
Auf diese Weise konnte es nicht ausbleiben, daß sie sich gegenseitig ihr Herz ausschütteten. Benedict erzählte von seiner Liebe zu Amabel und dem merkwürdigen Geschick, das ihn von ihr getrennt hatte; und Edith berichtete von ihrer Trauung in der düsteren Sankt-Margarethen-Kirche.
»Wie, so war es Ihr Wagen, der beim Portal den unsrigen kreuzte?«
»Ja«, seufzte die junge Frau.
»Seltsames Zusammentreffen! Die bis ins letzte vorbereitete Heirat durfte nicht zustande kommen; die Menschen, die füreinander bestimmt schienen, wurden auseinandergerissen. Die Paare lösen sich – und werden neugebildet, über Wunsch und Willen hinweg! Und wir, die wir uns nicht lieben – denn unser Herz ist schon vergeben –, wir befinden uns nun ungestört und frei im selben Haus, viele tausend Meilen von dem Wesen entfernt, das wir lieben und vielleicht niemals wiedersehen werden.«
»Sie haben recht,« sagte die junge Frau träumerisch, »das Schicksal hat sonderbare Einfälle.«
Von diesem Tage an war den vermeintlichen Gatten einer jener Gesprächsstoffe gegeben, wie er der keimenden Zuneigung tausend Gelegenheiten zu halben Geständnissen und scheuem Rückzug gibt, je nachdem der Augenblick es mit sich bringt. Benedict sprach von Amabel und ihrer Schönheit in Worten, die sich ebensogut auf Edith beziehen konnten. Er schilderte seine Sehnsucht und malte seine Leidenschaft mit brennenden Farben. Die junge Frau lauschte mit reger Teilnahme dieser flammenden Beredsamkeit, und da sich diese scheinbar auf eine andere Person bezog, wurde sie von keinerlei Bedenken beunruhigt. Sie antwortete ihrerseits mit Liebesbezeugungen für Volmerange, dessen Zorn sie als um so berechtigter darstellte, als sie es ihm gegenüber an Aufrichtigkeit hatte fehlen lassen. Bei diesen doppelsinnigen Bekenntnissen trat die Empfindsamkeit eines jeden, seine Zartheit, seine Stärke und seine Hingabe klar zutage. Jedes entfaltete ohne Scheu die Schätze seines ganzen Wesens, im Schutze der Namen Amabel und Volmerange trieben sie die tiefsinnigste Metaphysik der Liebe. Ihre ihnen selbst noch unbewußte Leidenschaft genoß eine Art von Maskenfreiheit, und unmerklich nahm Edith Amabels, Benedict Volmeranges Platz in ihren Herzen ein.
Zu ihrer Rechtfertigung muß gesagt werden, daß sie sich selber dieses Austausches noch nicht bewußt waren und sich um so williger ihrer gegenseitigen Anziehung hingaben, als sie diese für völlig gefahrlos hielten. Allen Ernstes glaubten sie sich nicht zu lieben. Und hätte man Benedict gefragt, ob Amabel die Königin seines Herzens sei, so hätte er mit aufrichtigem Empfinden sein »Ja« ausgesprochen; genau wie Edith ihre unerschütterte Liebe zu Volmerange bekannt hätte.
Wie in einem Zauber vergingen so die Wochen. Wenn sich die beiden des Abends trennten, so reichten sie sich geschwisterlich die Hand, und seufzend verließen sie einander in unerklärlicher Melancholie. Einmal sagte Benedict lächelnd zu Edith: »Mrs. Smith, kraft meiner eheherrlichen Rechte wünsche ich Ihnen einen Kuß auf die Stirne zu geben.«
Die junge Frau neigte ohne ein Wort der Erwiderung ihre Stirn Benedicts Lippen, die sich halb auf die seidenweiche Haut, halb auf die duftenden Haare preßten. Aber mit der Miene eines scheuen Rehes entglitt sie ihm schnell und schloß die Türe hinter sich zu.
In dieser Nacht schlief Benedict nicht sehr gut. Aber alles dieses hinderte nicht, daß Sir Arthur Sidneys Befehle aufs Wort befolgt wurden. So nahe dem erlauchten Gefängnis, als es die britische Behörde überhaupt zulassen wollte, wurde eine Villa gemietet, und die vermeintliche Mrs. Smith, der die Luft von Jamestown nicht zusagte, zog sich gesundheitshalber dorthin zurück. Benedict verweilte noch einige Tage unter geschäftlichen Vorwänden in der Stadt. Auf seine Anweisungen hin unternahm Edith tagtäglich zur selben Stunde und in Begleitung einer Mulattin Spaziergänge in der Umgebung, die sich bis Longwood ausdehnten. »Versäumen Sie ja nicht, immer ein Veilchensträußchen in der Hand oder auf dem Hute bei sich zu tragen«, hatte Benedict ihr eingeschärft. Da der Garten ihres Landhauses große Rabatten voll dieser Blumen aufzuweisen hatte, ließ sich dieser Wunsch leicht ausführen. Aber viele Tage blieben ihre Gänge erfolglos. Der kranke, sehr geschwächte Gefangene verließ das Haus nicht.
Ungeduldig, den Erfolg dieser Promenaden zu erfahren, und vielleicht auch von anderen Beweggründen getrieben, war Benedict nun auch in das Landhaus übergesiedelt. Nach jedem ihrer Spaziergänge forschte er Edith leidenschaftlich aus. Aber ihre Antwort blieb immer dieselbe: »Ich sah nur den Adler, der in den Lüften schwebt, und den Albatros, der das Wasser mit einem Flügel schneidet.«
Eines Tages endlich sah sich Edith bei einer Wegbiegung plötzlich dem kaiserlichen Gefangenen, der sich nur mit Mühe vorwärts bewegte und von seinen Getreuen in angemessener Distanz begleitet wurde, von Angesicht zu Angesicht gegenüber. In der Ferne konnte man die rotuniformierten Posten erblicken. Marmorblässe bedeckte die abgemagerten Züge, die von Leiden ausgemeißelt die edle Schönheit ihrer jungen Jahre zurückgewonnen hatten. Er sah Edith mit jenem Lächeln an, dessen Zauber sich kein Sterblicher je entziehen konnte, und näherte sich ihr grüßend. Edith, die vielleicht vor dem ungebrochenen Glanz der kaiserlichen Majestät ihre Fassung bewahrt hätte, verfärbte sich beim Anblick des entthronten Gottes und schien einer Ohnmacht nahe.
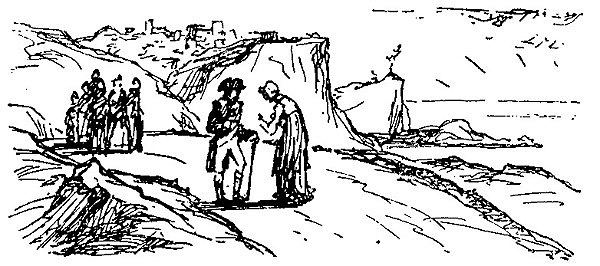
Der Heros trat auf sie zu und sagte, gleich einem Unsterblichen, der sich zu einem Menschen herabläßt, mit ernster, milder Stimme: »Beruhigen Sie sich, Madame,« und den Veilchenstrauß bemerkend, den sie in Händen hielt, fuhr er fort: »Schon lange habe ich keine so frischen mehr gesehen!«
Edith verneigte sich und streckte ihm unwillkürlich die Blumen entgegen.
Der Cäsar nahm sie, atmete den Duft ein und sagte: »Sie duften süß – aber nicht so süß wie Frankreichs Veilchen.« Und er gab der jungen Frau den Strauß zurück. Dann grüßte er sie mit königlicher Würde und setzte seinen einsamen Weg fort.
Geblendet von der majestätischen Vision, kehrte Edith nach Hause zurück und antwortete auf Benedicts Fragen:
»Ich habe ihn endlich gesehen.«
»Was hat er gesprochen? Wiederholen Sie mir jede Silbe.«
»Er hat gesagt, als ich ihm die Blumen reichte: ›Sie duften süß – aber nicht so süß wie Frankreichs Veilchen.‹«
Benedict erblaßte, so sehr bewegten ihn die schlichten Worte. Ohne irgendeine Erklärung nahm er ein Fernrohr und ein Beil und begab sich damit zu dem Felsen, auf dem der Baum wuchs, den Sir Arthur Sidney ihm bezeichnet hatte.
Dort angelangt, legte er das Fernrohr an. Ein kleiner, kaum wahrnehmbarer Punkt schwamm im endlosen Blau des Ozeans. War es eine Möwe oder eine Schaumflocke?
»Es ist gut«, sagte Benedict, und er legte das Beil an die Wurzel des Baumes. Mit zwei, drei Schlägen war der Stamm gefällt und rollte vom Gipfel des Felsens hinab ins Meer.