
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
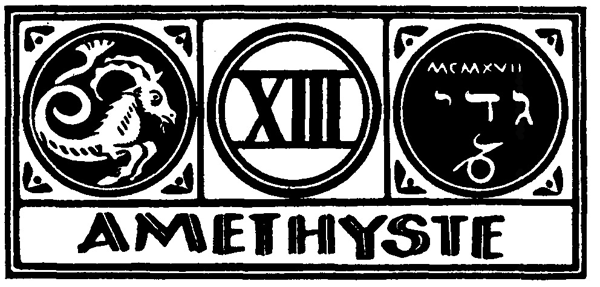
»Eine der ältesten dieser Zauberformeln gibt ein Mittel, wie man plötzliche Liebe in ebenso plötzlichen Haß verkehrt, so zwar, daß gleich nach der ersten Liebesnacht das bisher glühende Empfinden eines der beiden Teile in kälteste Abneigung sich verwandelt. Hierzu dient der Aban-la-râme, wörtlich übersetzt »Stein der Nicht-Liebe«, unser Amethyst.«
Houston G. Brady. Traktat über magische Formeln auf Sumero-Assyrischen Inschriften
Drei Monate war er im Westen. Reden – reden –
Am Tage vor Weihnachten kam er zurück – nachmittags zur Teezeit. Niemand war an der Bahn.
Er fuhr nach Hause. Er packte seinen Kram aus, wusch sich. Warm war es, weich das Licht. Heimlich.
Aber nirgend Blumen. Und allein war er. Ging mit langen Schritten durch die weiten Zimmer.
Rossius mochte doch kommen – wie war noch die Nummer?
Frank Braun nahm das Höhrrohr. »Ich bin zurück in Neuyork!« rief er. »Können Sie herkommen?«
Aber der andere konnte nicht. Bis wenigstens zehn Uhr habe er auf der Zeitung zu tun. Gut, so wolle man sich dann treffen – bei Lüchows.
Er ging zum Schreibtisch. Setzte sich, schlürfte seinen Tee. Hübsch geordnet lag in großen Stößen seine Post da – er hatte sich nichts nachschicken lassen die Zeit über. Alles hatte Rossius erledigt, ihm nur Bericht erstattet und dann und wann einmal Bescheid erbeten.
Aber dort, unter der Zigarettendose, lagen ein paar geschlossene Briefe. Frauenschriften. Die waren nicht geöffnet.
Er nahm sie, einen um den andern. Eine Rechnung seiner Maniküre. Eine Bitte um ein Autogramm. Um ein Bild –
Ah, ein Brief seiner Mutter. Geöffnet vom englischen Zensor, wieder verklebt. Er riß den Umschlag auf – er war leer.
Noch ein Brief – Ivys Hand.
Er zögerte – das war das erste Lebenszeichen, das er bekam in all der Zeit.
Der Brief war nach Los Angeles geschickt, nachgesandt von dort. Er selbst hatte an sie geschrieben – dreimal, viermal.
Wo steckte sie nur?
Damals hatte er sie zuletzt gesehn, an dem Septembertage, in der gläsernen Stadt von Oakhurst –
Er war durch den Park gegangen, zur Villa. Hatte sich angezogen, war nach Neuport gefahren zu des Professors Vortrag. Hatte mit dem gesessen nachher, lange geplaudert. Zurück dann nach Oakhurst.
Er traf Ivys Zofe: – das Fräulein sei zu Bett, schlafe. Aber als er aufstand am nächsten Tage, sehr spät, war Ivy fort. Zur Stadt gefahren, mit der Zofe. Und keine Zeile für ihn.
Er fuhr auch nach Neuyork. Er wartete einen Tag und noch einen – hörte nichts. Er rief an, erfuhr dann, daß Ivy – mit ihrer Mutter – nach Boston wäre.
Wieder ein paar Tage später bekam er einen Brief von ihrem Vater. Ivy sei krank, nervenleidend – sie würde in Boston bleiben einstweilen. Aber sie würde ihm schreiben.
Da reiste er nach den Weststaaten, machte den Kreislauf, den Tewes für ihn ausgearbeitet hatte im Auftrag des Komitees. Hampelte, pampelte – jeden Abend.
– Noch immer zögerte er. Wie eine kleine Angst war es. Es waren die ersten Worte von ihr.
Was fürchtete er denn? Liebte er sie etwa – die kleine Ivy?
Etwas verband sie ihm.
Er riß den Umschlag auf – entfaltete ihren Brief. Zwei Zeilen nur – zwei arme Zeilen.
»Geh zurück zu deiner Mätresse.«
Und ihr Name. Dann: »Ich werde meinen Schwur halten.«
Nichts mehr – kein Wort. Langsam zerriß er den Brief.
Das war zu Ende. Ausgeträumt.
Dennoch – er verstand es nicht. Warum denn – weshalb nur?
Hatte er sich nicht gefügt ihrer Laune? Nicht getan – was sie verlangte?
War er gegangen? Nein – sie ging, sie!
Er nahm einen Briefbogen, schrieb. Sie solle doch wenigstens ihre Gründe sagen! Ihm erklären, wieso –?
Rasch schrieb er, heiß, verlangend. Ein Wünschen war das, ein Sehnen –
Das Papier deckte sich mit Worten. Die schrieen –
Er las seinen Brief durch, gab ihn in den Umschlag. Schrieb die Adresse, klebte die Marke auf. Schellte dem alten Diener.
Zerriß dann den Brief. »Räum den Tee ab,« sagte er, als Fred kam.
Wozu Erklärungen? So war es nun einmal – so. Und ihren Schwur würde sie halten.
Nur: allein war er – allein.
Lotte –? Nichts, nichts von ihr in all der Zeit.
Ja – Fred? Was wollte er noch?
Ob er ein Bad machen solle? Den Frack bereit legen? Der Herr Doktor sei doch gewiß eingeladen heute abend –
Eingeladen? – Ja, ja, er möge nur alles zurecht machen.
* * *
Die fünfte Avenue hinauf. Dick im Pelz – durch nassen Dezemberwind.
Acht Uhr vorbei – leer die Straßen an diesem Abend. Hier und dort an der Ecke ein Mensch, mit Kistchen und Körbchen – auf den Autobus wartend. Und die schellenden Kerle der Heilsarmee – roter Kapuzenrock, weißer Vollbart, brauner Sammeltopf für die milden Gaben zur Weihnachtsspeisung der Armen. Es war ein gutes Geschäft, dreißig Prozent bekam jeder Weihnachtsmann von allem, was er einnahm.
Er trat bei Sherrys ein. Legte ab, ging in die Halle. Kein Mensch dort – kein Gast in den weiten Speisesälen.
Eine Dame kam auf ihn zu. Stark und groß, hoher Pelzkragen, dicht verschleiert. Streckte ihm die Hand hin, bot ihm guten Abend.
Ah – Emmaldine Farstin!
»Mit wem sind Sie hier?« fragte sie.
»Ganz allein,« erwiderte er.
»Ich auch,« rief sie. »Da wollen wir zusammen speisen, wenns Ihnen recht ist.«
Er half ihr aus dem Pelz. Sie gingen hinein, wählten einen Tisch – bestellten.
»Allein also, Doktor!« lachte die Diva. »Allein zu Weihnachten.« Sie stieß mit ihm an. »Prosit! Auf gute Freundschaft!«
»Also wieder gut?« fragte er.
Sie nickte. »Ja – es ist am Ende das beste. Man muß sich abfinden mit allen Dingen – und den Menschen auch. Muß sie nehmen, wie sie eben sind. Nur: Distanz halten – so weit es unbedingt nötig ist für unser Seelenheil.« Sie lachte; schluckte ihre Austern. »So – über den Tisch herüber – sind Sie ganz amüsant, ganz lieb – und durchaus ungefährlich! Und darum – Freundschaft – nicht? Es ist Geschmackssache am Ende: meine Psyche sexualis ist Gourmet und Gourmand auch. Austern und Kaviar – und Irish Stew nachher und Schweinebraten – wies grade kommt. Aber sie bedankt sich nun einmal für Ihre Leckerbissen!«
»Meine?« fragte er erstaunt. »Welche sind das?«
»Red Ducks!« lachte sie. »Blutenten – auf Knickerbockerart!«
»Was für Zeug?« fragte er wieder. »Ich habe keine Ahnung, was Sie meinen.«
»Ach, tun Sie doch nicht so!« rief die Diva. Sie nahm die Speisekarte auf, suchte herum. »Da – die Dinger meine ich, Red Ducks – das Leibgericht aller Schlemmer in diesem Lande! Haben Sie es nie versucht?«
Doch, gewiß – man hatte es ihm ein paarmal vorgesetzt. Scheußlich fand ers. Hatte einen Bissen gekostet und keinen zweiten mehr. Man nahm eine Ente, briet sie leicht an. Gab die halbrohen Bruststücke auf den Teller, tat den Rest in eine große silberne Presse. Drehte und quetschte, preßte das Blut darüber aus.
»Was zum Kuckuck habe ich damit zu tun?« fragte er.
»Lassen wirs doch!« sagte die Diva. »Ich will mich nicht streiten mit Ihnen – heute erst recht nicht. Jeder hat sein eigenes kleines Pläsierchen – wie ihn der Herrgott erschaffen hat. Ich will nett sein zu Ihnen, Doktor – hübsch in Distanz – aber nett und lieb. Grade heute – wo alles zusammenkriecht, während Ihnen Ihre Teufelslaune wieder einmal so ein kleines Ganzalleinsein beschert hat. – Bitter nicht?«
Wovon sprach sie eigentlich, was wollte sie nur? »Was ist bitter?« forschte er.
Sie streckte ihm die Hand hinüber. »Herrgott – warum denn nur so eingekapselt? Können wir zwei nicht ruhig über alles miteinander reden – und sehr offen? Wie zwei alte Auguren – die sich verstehn, wenn sie nur mit den Augen zwinkern? Weshalb den Begriffsstutzigen spielen? Es ist doch bitter, daß Ihr Turteltäubchen weggeflogen ist, was?«
»Mein Täubchen?« sagte er. »Meinen Sie Fräulein Jefferson?«
Sie lachte: »Natürlich! Wen sonst? Sie sind allein – und am Weihnachtsbaum Ihres Exbräutchens hängt ein englisches Vogelbauer!«
»Wer sagt das?« fragte er.
»Wer das sagt?« rief sie. »In allen Abendzeitungen stehts. Mit den Bildern. In dieser Stunde verlobt sich – dreißig Blocks weiter hinauf – die kleine Ivy mit dem Herzog von Stratford. Sie hättens sich denken können. Doktor – hätten warten müssen – bis nach der Hochzeit!«
Er wurde ungeduldig. »Herrgott – was hätte ich mir denken können?« rief er heftig.
Sie sah ihm ins Auge. »Was? Nun, daß das Püppchen da nicht mittun würde, wo – selbst ich mich herzlichst bedankte. Das! Nun wissen Sies.« Sie lachte hart auf, wandte sich wieder ihren Austern zu.
Aber er wußte gar nichts. Was hatte er denn Ivy getan? – Und was dieser Frau?
Wer war sie denn? – Die größte Diva der Erde, die Frau, die die schönste Stimme hatte durch Jahrhunderte. Ja! Sehr klug dazu, sehr gebildet – o, eine Künstlerin in jeder Fingerspitze. Sie sang nicht nur, schrieb auch, komponierte. Und verstand zu sammeln – ihre alten Bilder schlugen die Sammlung von manchem Multimillionär. Aber zugleich war diese Frau Anbeterin aller Lüste. War Sappho und Katharina zugleich. Ihre erotische Bibliothek war viele Tausende wert – sie war stolz darauf, manches zu besitzen, das selbst im Hayn nicht stand. Und man wußte, daß sie die Männer zu Dutzenden nahm – und die Frauen auch. Daß einer der Chorführer der Oper in ihrem festen Solde stand, daß er immer frische Ware anbringen mußte, Nacht um Nacht. Sie dachte nicht daran, es zu leugnen. Sie stand über aller Gesellschaft: in königlicher Verschwendung tobte ihre – Psyche Sexualis.
Sie aber – Emmaldine Farstin – bedankte sich herzlich für ihn?!
Die? – Die! Was war denn nur?
Aber es war ja lächerlich! Sie machte sich lustig über ihn – und er war dumm genug, darauf hereinzufallen.
So lächelte er. »Sie haben vollkommen recht!« sagte er. »Man sollte in sich gehn und sich bessern, tugendhaft werden .. Ich werde mirs ernsthaft überlegen.«
Sie antwortete: »Verschwenden Sie nur Ihre Zeit nicht. Da hilft nichts mehr, wenn man, wie Sie, so eingelebt ist – in Sodom!«
›Da ist sie wieder,‹ dachte er. Nun gut – mochte sie ihren Willen haben.
Er nickte: »Ja, ja!«
»Ich nenne es Sodom,« fuhr die Diva fort, »denn darauf kommts hinaus am letzten Ende. Ich habs gut durchstudiert, dieses große Kapitel der Liebe – mit meiner Formel löst man am Ende alle Rätsel, so unverständlich sie anfangs scheinen mögen. Darüber könnte ich Ihnen lange Vorträge halten.«
»Tun Sies doch,« sagte er. »Ich komme vom Westen – habe durch drei Monate nur Bürger gesehen und Bauern – Geschöpfe, die mit Menschen in Ihrem Sinne nur sehr entfernte Ähnlichkeit haben. Reden Sie also – ich höre sehr gern zu.«
»Danke!« lachte die Diva. »Wenn ich Katzenjammer habe – das habe ich manchmal, wenn mich das alles anwidert – dann bin ich höchst keusch eine Zeitlang. Und studiere so herum – dazu sind meine Bücher da und meine Bilder. Das macht mir wieder Appetit. Da habe ich eines Tages meine Formel gefunden – eine höchst einfache, höchst abgeleierte. Aber nie so gesehn, wie ich sie fasse.«
»Und wie heißt diese Formel?« fragte er.
»In jedem Mensch steckt ein Tier,« erwiderte sie. »Das und nichts mehr. Das ist so binsenwahr, so abgegriffen, daß es schon lächerlich klingt und albern. Aber Sie kommen auf höchst erstaunliche Ergebnisse, wenn Sie ein wenig tiefer schürfen. Ein Tier – manchmal auch viele Tiere – und die wieder in den ergötzlichsten Mischungen. Es gibt kein Tier in der ganzen Naturgeschichte, das nicht in irgendeinem Menschen drinsteckt.«
Er sagte: »Das ist nicht ganz –«
Sie unterbrach ihn rasch. »Nicht ganz neu – natürlich nicht! Ich sagte Ihnen ja, daß es durchaus alter Kohl sei. Aber warten Sie nur ab. Die Sexualpsyche ist überhaupt nichts anders als solch ein Tier – und dies Tier sucht seinesgleichen. Nun nehmen Sie die Lehre von der Seelenwanderung, an die viele hundert Millionen Menschen glauben. Sie hat ein großes, dickes Loch. Nämlich: die Seele, immer dieselbe, wandelt durch eine unendliche Reihe von Leibern – eine Seele, wohlgemerkt, die immer sie selbst ist und sein muß, dieselbe im Frosch und im Löwen, im Kaiser und Bettler, in der Nonne und der Hure. Wäre das richtig, so müßten, untereinander, alle Froschseelen verschieden sein, wie alle Löwenseelen. Das sind sie aber nur in sehr geringem Maße – im großen und ganzen sind alle Hundeseelen einander ebenso gleich, wie alle Wanzenseelen und Hasenseelen – und sind zugleich sehr verschieden von allen andern. Also ist nicht die Seele an sich das Ursprüngliche, sondern eben die Froschseele und die Bettlerseele, die Löwenseele und Karpfenseele. Haben Sie es? – Je höher aber das Geschöpf steht – um so mehr Seelen finden in ihm Platz. Zwei Seelen, meinte Goethe, wohnten in seiner Brust – wenn Sie ihn aber lesen, so finden Sie, daß es nicht zwei waren, sondern zweihundert – wenigstens!«
»Was nennen Sie – Seele?« warf er ein.
»Das, was es ist!« sagte sie. »Das – Geschlecht! Zwei Triebe bestimmen die Handlungen jeden Geschöpfes: der Erhaltungstrieb und der Fortpflanzungstrieb. Das ist ein höchst absurder Begriff, denn nie denkt irgendein Wesen an die Fortpflanzung – der Geschlechtstrieb ist es – recht und schlecht. Wenn wir nun aber überhaupt Leib und Seele unterscheiden, so ist es klar, daß der Körper es ist, der sich erhalten will, trinken, fressen, leben, gesund bleiben. Dann aber bleibt dem andern Ding – der Seele – nur der Geschlechtstrieb. Der Körper ist sehr sterblich, geht zugrunde nach kurzer Zeit – sein Trieb, der ihm nur allein dient, ist also so klein und jämmerlich, wie er selbst. Die Seele aber ist unsterblich – und so ist ihre Emanation – ihr Trieb! Ist unsterblich wie sie – erbaut alle Welten. Das ist die Bestimmung dieser Erde – voll zu werden und immer voller von Geschöpfen – damit die Seelen immer neue Leiber finden, sich häuslich darin einzurichten für eine kleine Weile.«
»Wenn das die Bestimmung ist,« meinte er, »dann entziehn Sie sich ihr sehr erfolgreich. Bringen zwar viele Opfer Ihrem Seelentriebe, aber tun gar nichts für die Fortpflanzung!«
Sehr ernsthaft sagte sie: »Glauben Sie, Doktor? Das ist wohl wahr: die Zeit, um ein einziges Kind zu kriegen, deucht mich viel zu lange, um darum solange auf das zu verzichten, was mein Leben ist. Dennoch bilde ich mir ein, mehr für diese Bestimmung zu tun als manche tausend Frauen zusammen.«
»Wie das?« fragte er.
Sie sagte: »Gehen Sie doch in die Oper, wenn ich singe – wenn der Caruso singt! Aber werfen Sie keinen Blick auf die Bühne, schaun Sie nur das Publikum an. Beobachten Sie die Augen der Leute, diese Augen – da erwacht die Geilheit aller Tiere. Sie sagen nichts, sie verstehn nichts – fühlen nur und wissen nicht was. Aber ihre Brunst flammt auf und füllt weithin das Theater. Und sie fahren nach Hause, und liegen beieinander, und zeugen Kinder: meine Kinder, Carusos Kinder!«
Sie lachte laut auf: »Da sagen die Leute: ›O diese Stimme! Der Farstin Stimme! Göttlich, himmlisch! – Und Caruso – über alles Denken herrlich – o, eine Offenbarung!‹ Aber bei ihm empfinden die Weiber: ›Die Augen schließen, niederlegen, empfangen.‹ Und die Männer bei mir: ›Ein Weib nun, ein Weib!‹ – Nur wissen Sie, fühlen sies nicht so gewählt, wie ichs ausdrücke. Fühlens, wie eben Bürgerpack fühlt: recht gemein, deutlich, vulgär. Das ist ihre große Offenbarung! – Und der Witz dabei ist, daß es dennoch eine Offenbarung ist, eine ganz rechte, die ihre Seelen weckt.«
»Dann, Diva, Göttliche,« sagte er, »dann ist Ihr Gesang nichts anders – als Kanthariden!«
»Ganz richtig!« nickte sie. »Ist Sellerie für den Bräutigam und Spargel für das Bräutchen. Ist Sekt oder ein ausgeschnittenes Kleid, ein zotiges Buch, ein wilder Tanz – ein Hundepaar, das sich auf offener Gasse vergnügt. – Gar nichts anders – ich bin mir völlig klar darüber. Geschlecht ists – Geschlecht! Und da ich glaube, daß mancher Tiere Seelen aus mir schreien, wenn ich mich prostituiere auf der Bühne und im Konzertsaal, so werden manche Sehnsüchte wach da unten. Oft hab ich daran gedacht, wenn ich in der Kulisse auf mein Stichwort wartete, während Caruso sang. Bald ist er ein Stier, bald ein Affe – nun ein Eber und nun ein Nachtigallenmännchen. Und die kleinen grauen Nachtigallenseelchen da unten recken die Köpfchen, die Kühe unterbrechen ihr Wiederkäuen, die Äffinnen verdrehn die Augen und die Säue schwitzen vor geiler Lust.«
»Und nichts Menschliches?« fragte er. »Nichts?«
Sie seufzte: »Selten nur, unendlich selten! – Gibts doch so viel millionenmal mehr Tiere auf der Welt als Menschen. Und deren Seelen müssen ja wandern, wie die andern auch – stecken also zum größten Teile eben in Tieren. Da hälts schwer, so etwas zu finden: eine Menschenseele in einem Menschenleib!« Sie nahm ihre Dose aus der Tasche, bot ihm an, brannte selbst eine Zigarette an. »Wir müssen uns trösten,« fuhr sie fort, »die ganze Welt ist Sodom und wir leben darin. Tiere sind wir und müssen Tiere suchen – so war es vom Ei der Leda an.«
Er nahm es auf. »Die hatte eine Schwanenseele – darum kam Zeus als Schwan zu ihr hin.«
Sie nickte. »Und zu Europa als Stier, weil die eine Kuh war. Den hübschen Bub aber, den Ganymed, dessen junge Träume in alle Wolken flogen – den holte er sich als Adler. Alle Götter machten es so in allen Ländern und zu aller Zeit. Zu Gunnlod, der Riesentochter, kam Odin als Wurm, und die Heilige Jungfrau besuchte ein Täuberich. Ich weiß nicht, wie Lokis Riesenweib aussah, aber es muß eine seltsame Bestie gewesen sein, wenn er mit ihr den Fenriswolf zeugen konnte und die Weltenschlange. Und solche Mischwesen liefen überall herum: Früchte der Umarmung zwischen Gott oder Mensch und Tier – Sodom von Anbeginn in jeder Religion! Sagen – Phantasien – Hirngespinste – ja! Aber sie beweisen doch, wie sehr sich der Menschheit Gedanken immer wieder damit beschäftigten. Voll von solchen Flickwesen ist die indische, die ägyptische und babylonische Götterwelt – und die unsere nicht minder: lesen Sie nur die Offenbarung St. Johannis! Hellas hatte die Zentaurn und Faune, Sirenen und Melusinen, echte Sodomskinder, wie den Minotaurus, den Pasiphae ihrem Stier gebar. Glauben Sie, daß alle die Wundergeschichten, die überall leben, wo es Menschen gibt, nur aus den Fingern gesogen seien? Sie waren nur möglich, weil – von Urzeiten an – der Mensch sich dem Tiere vermischte. – Sie waren doch einmal Jurist, Doktor – sagen Sie mir: sind heutzutage solche Akte so selten?«
Er schüttelte den Kopf. »Sie kommen überall vor, in allen Ländern, und jeden Tag. Nur brauchen sich die Gerichte selten genug damit zu beschäftigen – weil sie stets in aller Heimlichkeit begangen und selten genug ans Licht gezerrt werden. Gottseidank!«
»Ich habe mir einiges ausgeschnitten,« sagte sie, »das ich gelegentlich in der Zeitung fand. In Chicago hielten sich sieben Chinesen ein Schwein – als Frau. Sie mästeten es dabei, fraßen es später auf – aus lauter Liebe vermutlich. In Berlin kannte ich einen Regierungsrat, der steckte seiner armen Frau Hühnerfedern in die Frisur – ließ sie laut gackern. Lebte seine Hahnenseele aus, krähte dabei wie ein Chantecler so stolz. Und ich weiß, daß Professor Harriman von Baltimore seit Jahren mit einer Äffin lebt – aus wissenschaftlichen Gründen, wie er angibt, um die Psyche des Tieres zu erforschen.«
»Gott ja!« lachte er. »Kein kalabrischer Ziegenhirt, keiner in den Pyrenäen oder der Pampa, der nicht unter seinen Geißen eine Geliebte habe! Gewohnheit macht Liebe – das ists. Man muß es komisch nehmen, wie Friedrich II. es tat. Wird ihm da ein Urteil vorgelegt – und das Dokument existiert noch – in dem ein Husar zum Tode verdammt ist, weil er sich mit seiner Stute vergangen hat. Da kritzelte der König an den Rand: ›Der Kerl wird zur Infanterie versetzt!‹«
Sie sagte: »Der wußte Bescheid, der König. Wissen Sie, was sein Freund Voltaire von ihm erzählt? Daß er seine Windhunde –«
»Ich weiß!« unterbrach er sie. »Aber das ist kein Kronzeuge – Voltaire!«
»Ganz recht,« nickte sie, »außerdem liegt die Hündin gewiß nicht in seiner Rasse Art. Das ist vielmehr der wilde Hengst – ein königliches Tier überall.«
Sie deklamierte:
»Zu Berlin im alten Schlosse
Sehen wir in Stein gemetzt,
Wie ein Weib mit einem Rosse
Sodomitisch sich ergötzt.
Und man sagt, daß diese Dame
Die erlauchte Ahnfrau ward
Unseres Fürstenstamms –«
»Heine!« rief er. »Glauben Sie den Dichtern nicht zu viel! Genau dasselbe – und sehr viel positiver – erzählt Alfred de Musset von seiner Freundin Georges Sand.«
»Und die war aus Wettiner Stamm,« entgegnete sie. »War eine Urenkelin des Marschalls Moritz von Sachsen, Königsblut – das edle Roß in Dresden wie in Berlin! – Glauben? Was heißt das: glauben? Ich kann es mir sehr gut vorstellen, daß die wilde Georges Sand dem frisierten Dichter einen Hengst vorzog! Eine Kuh liebte durch lange Jahre der König Wiswamitra, jede Rokokomarquise mußte ihr Fanfreluchehündchen haben. Vom goldenen Esel des Apulejus angefangen durch Tausend und Eine Nacht, Boccaccio und die Königin von Navarra ist überall Titanias Ohrenträger ein sehr begehrter Geliebter. Als Nelson starb, vertrat ein großer Neufundländer seine Stelle bei der schönen Lady Hamilton – und die englische Mode der weißen Angorakater hat hier in Neuyork auch manche begeisterte Freundin. Was wollen Sie – mehr wie ein Haus kenne ich in dieser Stadt, wo man für gutes Geld kaufen kann, was das Herz begehrt: Mädchen und Knaben und Ziegen und Enten und Esel – alles, alles! – Warum soll ich nicht glauben, was ich sah mit eigenen Augen?«
»Gut, gut,« rief er, »das mag alles sein. Aber Sie müssen mir zugeben, daß trotz alledem das verschwindende Ausnahmen sind, daß im großen und ganzen der Menschen Liebestrieb sich keineswegs irgendeinem Viehzeug zuwendet!«
Die Diva wiegte den Kopf hin und her. »Ja – und auch nein!« sagte sie. »Ich bin mir noch nicht ganz klar darüber. Das Gegebene wäre – das Einfachste – daß die Katzenseele im Menschenleibe den Kater suchen müsse. Den Kater – wie er da ist – mit Schweif und Pfoten und Schnurrbart. Da aber wird der Vorgang komplizierter: nicht den Kater – die Kater seele sucht sie, die allein. Und sehr unbewußt dazu, sehr instinktmäßig. Kein bißchen hilft ihr das Menschenhirn dazu, führt sie im Gegenteil auf Irrwege, wo es nur eben kann. So zwar, daß in vielen Millionen Fällen die arme Seele überhaupt nicht weiß, was sie eigentlich sucht, durch ein langes Körperleben im Dunkeln tappt, sich sehnt und sehnt und niemals weiß, wonach! – Findet sie aber durch Zufall in einem andern Menschen eine Seele ihresgleichen – dann ist sie glücklich – und weiß nicht warum. Sonst aber gibt sie, die Äffin, sich einem Fuchs oder Schwan oder Meerschwein hin. – Jeden Tag sehen Sie das, in allen Ehren, ringsherum! Und das ist das Köstlichste bei der ganzen Geschichte, daß solche Ehen und solche Lieben – bloß weil menschliche Leiber dabei sind – als normal gelten und als sehr natürlich, ob sie gleich wider alle Natur sind und recht eigentlich sodomitisch. Das aber, was die Menschlein sodomitisch nennen – wenn gleiche Seelen einander suchen und finden – das wieder ist das einzig Natürliche!«
Sie stand auf, ließ sich von ihm in den Pelz helfen. »Ich danke Ihnen, Doktor,« schloß sie, »daß Sie mir so hübsch zugehört haben. Denken Sie mal darüber nach, wenn Sie Zeit haben – es regt an. Mir hats Appetit gemacht – ich freue mich schon auf das Vögelchen, das unter meinem Christbaum auf mich wartet: ich denke, es soll ein paar Federn lassen in der Heiligen Nacht!«
Sie gingen hinaus in die Halle, warteten einen Augenblick, während der Page ihr Auto heranpfiff.
Noch einmal begann sie: »Manche Tierseelen wohnen in mir, das ist gewiß. Alles liebe ich, das groß ist und stark und wild und schön. Den Stier und den Hengst, den Adler und Schwan und Wolf.«
Sie schwieg; es war, als ob sie einen Einwurf erwarte – einen ganzen bestimmten.
Er zögerte. Sagte es dann doch, gezwungen fast, langsam genug. »Das alles bin ich also nicht?«
Da flammte ihr Blick. Da rief sie – und es war, als ob sie ihn anspeien wollte: »Nein! Nein! Du hast einer Wanze Seele, oder eines Flohs! Bist eine Mücke – eine Spinne vielleicht, eine Fledermaus! Bist alles – was saugt – das bist du!«
Triumphierend strahlte ihr Auge. »Auf Wiederschaun!« nickte sie. Ließ ihn stehn, schritt rasch hinaus.
* * *
Er stand da, blickte ihr nach mit offenem Munde. Fühlte gut, daß er ungeheuer blöd aussah in dieser Minute –
So wie damals, als er zum erstenmal in Hamburg war, ein Student. Er ging in den Alsterpavillon, wollte Zeitungen lesen; man sagte ihm, daß die nur im obern Stock seien. So stieg er die Treppe hinauf. Aber kaum hatte er die letzte Stufe genommen, da sprangen ein paar auf ihn zu – Gäste, Kellner, Hausknechte. Und es klatschte ihm schallend ins Gesicht, Ohrfeigen, gute Faustschläge – er flog die Treppe herunter im Handumdrehn. Riß auf dem Wege eine künstliche Palme mit und eine Küchenfrau, schlug unten ein Marmortischchen um und ein paar Stühle. Suchte seine Knochen zusammen, hob sich mühsam auf, stand da – mit offenem Maul –
Genau wie jetzt.
Dann kamen die Gäste und die Kellner – ein großer Auflauf rund herum. Ein Irrtum sei es, eine leidige Verwechslung. Ein anderer, der ihm sprechend ähnlich sähe –
Ja, irgend etwas hatte der andere angestellt – er verstand nicht recht, was. Aber er hatte die Ohrfeigen dafür bekommen. Sehr kräftige Ohrfeigen.
Sie klopften ihn ab, bemühten sich um ihn, redeten auf ihn ein. Er möge doch entschuldigen –
Dann lachte einer. Alle lachten – er auch. Es war doch komisch am Ende.
Aber seine Ohrfeigen hatte er weg. Die brannten gut.
Gerade wie jetzt.
Nur daß keiner kam und um Entschuldigung bat. Und daß keiner ein befreiendes Lachen anschlug.
Kein Irrtum, keine Verwechslung. Ihn meinte sie, ihn und keinen andern. Und ihn spie sie an, mitten ins Gesicht –
Der Page kam mit seinem Pelz. Langsam ging er auf die Straße.
Ein Autobus hielt an der Ecke, er stieg ein. Bemerkte dann erst, daß er die Straße hinauffuhr und nicht hinunter.
Zwei Herren nur im Gefährt. Aber der eine sprach ihn an – Dr. Samuel Cohn. Er trug Paketchen, wie jeder Mensch an diesem Abend.
»Wieder zurück?« rief der Arzt. »Da wird sich Ihre Braut freuen!«
Frank Braun nickte – gut, gut – der hatte die Abendblätter noch nicht gelesen – würde ihm also keine Fragen stellen. »Wo sind Sie heute abend?« fragte er rasch.
Der Arzt sagte: »Bei Ihrer alten Freundin. Sie hat nur ein paar Leute da, Professor von Kachele, Tewes, mich – noch zwei oder drei. Soll ich Grüße bestellen?«
»Ja – ja,« nickte er. »Grüßen Sie alle Bekannten. – Wie gehts Frau van Neß?«
»Besser nun, wirklich besser!« erwiderte Dr. Cohn. »Ich hatte sie ein paar Monate nach Saratoga geschickt, das hat ein wenig geholfen. Immerhin – sie ist halt sehr blutarm.«
Er stand auf, reichte ihm die Hand. »Ich muß aussteigen – hinüber zur Parkavenue. Fröhliche Feiertage!«
Auch der andere Herr stieg aus, ließ seine Zeitung liegen.
Frank Braun nahm sie auf, suchte herum. Da stand es – da waren die Bilder. Über die ganze Seite hin Ivys Bild. Auf der andern Seite ihre Eltern; dann der Herzog, blendend sah er aus, in Felduniform – wirklich ein junger Held. Ah, da war auch sein Bild – oben in der Ecke – ein kleines Medaillon, halbdollargroß.
Er zerknüllte das Blatt, warf es zu Boden.
Der Zentralpark – links. Nun mußte das Jeffersonhaus kommen, auf der andern Seite –
Überall Vorhänge vor den erleuchteten Scheiben. Dennoch feierlich – Weihnachtsfest, Verlobungsfest: unter allen Fenstern hingen kleine runde Kränze. Stechpalmen mit roten Beeren und roten Schleifen.
Er stieg aus an dieser Ecke. Blieb stehn, schaute hinauf einen kleinen Augenblick lang. Seufzte, rasch nur und leicht. Schlug den Kragen hoch, grub die Hände tief in die Taschen. Pfiff ein Studentenlied, stapfte zurück über nassen Asphalt.
Bitter? – Die Farstin irrte sich. Mochten die in dem mächtigen Steinhause so glücklich werden, wie sie nur konnten – Ivy, ihr Herzog, ihr Vater und ihre Mutter. Und der Generalkonsul auch – der war sicher dort oben zur Verlobungsfeier.
Allein war er – wieder einmal, wie die Diva sagte. Aber auch: frei – wieder einmal! Frei und allein – war es nicht dasselbe am Ende? – Er, der einzige Mensch in der Riesenstadt in dieser Nacht.
Keiner würde ein gutes Wort zu ihm sagen, heute am Christabend. Seine Mutter – gewiß war ihr Weihnachtsgruß in dem Umschlag gewesen. Aber der englische Zensor hatte sich die Zigarre damit angesteckt –
So brauchte er keinem dankbar zu sein. Sein Christgeschenk waren die Ohrfeigen, die ihm die Diva ins Gesicht spie.
Schade, daß er keinen Stock hatte! Es juckte ihn in der Hand, ein paar gute Lufthiebe zu schlagen –
Oder ein Pferd! – Jetzt durch den leeren Park!
Das hätte schon Ivy tun können – ihm zum Andenken die irische Fuchsstute schenken, die er am liebsten ritt. Eine Paßgängerin war sie, freilich – aber sie sprang, sprang! Was konnte ihr daran liegen – sie ritt sie doch nicht und hatte bessere Tiere, ein Dutzend und mehr.
Statt dessen: ihr Brief! Keinen Gruß – nicht einmal eine Anrede. Ein Weihnachtsgeschenk wie das der Sängerin: klatschende Ohrfeigen.
* * *
Ein Schaufenster noch hell erleuchtet: Cartier. Er blieb stehn, blickte durch die Scheiben. Eine Dame kaufte – einen Ring, eine Uhr – was es eben war.
Die Dame zahlte, nahm ihr Schächtelchen. Kam heraus, schritt dicht vorbei an ihm.
Das – das war – Dolores! War die Goyita –
Sie blieb stehen – erkannte ihn. Zuckte zusammen, schrie auf, hob ihre Röcke. Lief, floh über die Straße. Riß die Tür eines Taxameters auf, sprang hinein.
Weg –
Schnell, schnell – ehe er recht wußte, was geschah.
Noch eine Ohrfeige, dachte er. Das war sein drittes Christgeschenk.
Er trat zurück, zu dem Schaufenster hin – da war ein Spiegel an der Seite. Er starrte hinein.
›Wie ein Aussätziger bin ich,‹ dachte er. ›Wie ein Pestkranker.‹
Drinnen löschten sie das Licht – da ging er weiter. Aber die Spiegelfratze lief vor ihm her. Rückwärts – daß sie ihn immer anstarrte.
Angst sah er – und Gier.
Aber er wußte nicht, was er begehrte, und wußte nicht, wovor er sich fürchtete.
War er denn nicht froh gewesen, allein zu sein – frei zu sein von allem? Eben noch?
Er schritt, schritt weiter.
Wind und Regen. Und sein Schritt, sein tönender Schritt auf den Steinen. Klapp und Klapp.
Unionsquare – ein wirres Durcheinander. Zerbrochene Gitter, tiefe Löcher und mächtige Steinhaufen. Holzbuden, Plankenzäune, Laternenpfähle dazwischen und kahle Bäume. Ein paar zerschlagene Bänke – ein Denkmal dann. Ratten.
Ein Singen durch den nassen Wind. Irgendwoher aus einem Erdloch am Bau der neuen Untergrundbahn. Klänge der Kindheit, Traumklänge –
»O Tannenbaum, o Tannenbaum – –«
Nein, nicht die Worte – die Melodie nur.
Er blieb stehn, lauschte. Ah, das alte Kampflied der Iren in diesem Lande!
»Old Germany! Old Germany!
When do you set old Ireland free?«
Aber wie aus einem Grabe klang es.
* * *
Lüchows. Weiß gedeckte Tische, leere Stühle. Nirgend ein Gast.
Dann kam der junge Rossius auf ihn zu, schüttelte ihm die Hand. »Sie lassen lange auf sich warten, Doktor!« rief er. »Seit zwei Stunden sitz ich da.«
»Ists schon so spät?« sagte er. »Entschuldigen Sie. Setzen wir uns – erzählen Sie mir, was Neuyork inzwischen gemacht hat.«
Der andere druckste herum. Seufzte sehr vernehmlich, zog dann die Uhr heraus.
»Nun, was ist?« fragte Frank Braun.
»Ich bin nämlich eingeladen,« sagte Rossius. »Um zwölf Uhr – habe fest versprochen, pünktlich zu sein. Nun ists schon –«
»Ein neues Fräulein Braut?« lachte er. »Nun, sie wird warten können.«
Der andere sagte: »Es ist kein neues Fräulein Braut – ich habe überhaupt keine Braut mehr – weder alte noch neue. Ich bin eingeladen – Sie wissen ja, Herr Doktor.«
Er besann sich einen Augenblick. »Ah – bei Aimée, nicht wahr? Haben Sie auch ein hübsches Geschenk für sie?«
Der Sekretär griff in die Tasche, zog ein Manuskript heraus, reichte es ihm hin.
Da stand: »Die Perlenschnur. Ein Sonettenzyklus.« Und darunter: »Für Aimée B.«
»Also ihre Perlen haben Sie bedichtet!« rief er. »Warum nicht ihre Füße? Perlen haben viele Frauen, aber solche Füße nur Aimée Breitauer.«
»Die habe ich besungen – oft genug,« entgegnete Ernst Rossius. »Ihre Füße und Augen und Lippen – alles! Sie hat schon über vierzig Gedichte von mir – will sie herausgeben, wenn es genug sind für einen Band. Auf feinstem Japanpapier – in silbergraues Leder gebunden!«
Soviel Jugend, soviel Glück aus diesen blauen Augen –
»Laufen Sie,« rief er, »rennen Sie, fliegen Sie!«
»Auf morgen!« rief Ernst Rossius. Lief, war verschwunden im Augenblick.
Er setzte sich, bestellte sein Bier. Im nächsten Saale ragte ein gewaltiger Christbaum hoch zur Decke hinauf; von hinten her klangen die leisen Weihnachtslieder der Musikkapelle. Alles war richtig da, so wie es sich gehörte zur Christzeit.
Nur – kein Wachsgeruch, kein Duft von verbrannten Tannenzweigen. Glühbirnen hingen in diesem Baum.
Und die Lieder, die deutschen Lieder, die durch die Räume wehten, machten ihn krank. Er winkte dem Kellner, gab ihm Geld für die Kapelle – still sein möge sie. Aber der Kellner meinte, es sei schon Mitternacht, da würden die Musiker ohnehin nach Hause gehn.
Er saß da und wartete. Einer mochte: doch kommen von den vielen Gästen, die hier verkehrten. Einer konnte doch auch allein sein in dieser Nacht –
Wie er –
Niemand kam.
Die Musiker gingen. Dann die Leute von der Bar und die Kellner – einer um den andern.
Nur der eine blieb – der ihn bediente. Der wartete. Klebte an der Wand – lang, dünn und schmal – ein großes, vorwurfsvolles Ausrufungszeichen!
Frank Braun dachte: der hat eine Frau. Hat Kinder – die auch warten.
Auf ihn wartete niemand.
Er zahlte, schickte den Kellner fort. Blieb sitzen, starrte auf sein Glas, das er nicht berührte –
Saß da.
Manchmal kam der Hausknecht vorbei. Frank Braun winkte ihn heran, gab ihm Zigaretten und ein paar Dollarnoten. Winkte ihm, still zu sein, als er anheben wollte zu sprechen.
Dick war er, rot im Gesicht. Der hat schon gefeiert, dachte er, früh am Abend.
Und er saß da, blickte vor sich hin.
Dann stand er auf, ging ans Telephon. Rein mechanisch – willenlos fast.
Rief ihre Nummer – hörte ihre Stimme.
»Lotte –« sprach er.
Und er hörte: »Komm –«
Nichts sonst.
* * *
Aber er ging nicht.
Zurück an seinen Platz – setzte sich wieder vor sein schales Bier.
Saß da –
Nein – nein – er wollte nicht hin zu ihr. Fürchtete sich.
Drei Geschenke hatte er bekommen zu diesem Christfeste – drei, und das war genug. Von Ivy. Von der Farstin. Von der Tänzerin. Drei Geschenke. Und alle von gleicher Art.
Warum nur? Warum?
Und er saß – saß – durch die fröhliche Nacht –
Kroch nach Hause in der Dämmerung. Fiel in sein Bett.
* * *
Nein, er ging nicht zu Lotte van Neß. Blieb zu Hause einen Tag um den andern, arbeitete mit seinem Sekretär. Fühlte sich matt und müde und ausgeleert. Schlief viel, alle Nächte durch – stundenlang, auch mitten am Tage.
Er lag auf dem Diwan, spielte Schach mit Rossius eines Nachmittags, als ihr Auto vorfuhr. Sie ließ sich nicht melden, trat gleich ins Zimmer. War da.
Blieb, legte den Pelz ab. Setzte sich.
Keine Erklärung, keine Szene. Als ob sie gestern erst dagewesen sei, so tat sie. Als ob es so sein müsse und nicht anders.
Sie plauderte, sprach mit seinem Sekretär, schaute der Schachpartie zu, die langsam weiterging. Er sprach kein Wort.
Er hob den Turm, mit dem er eben ziehen wollte. Vergaß ihn niederzusetzen, hielt ihn fest in der Hand. Hörte zu, was sie sprach; vergaß dann, zuzuhören – blickte hinüber zu ihr – lange.
Vergaß endlich, sie anzusehen. Sank zurück – träumte, dämmerte so hin.
Schlief endlich.
Rote Schleier – immer nur rot. Rote Rosenblätter – roter Regen – blutendes Rot.
Und Angst, Angst – solch rasende Angst –
Da schrie er – erwachte von seinem eigenen Schrei. Sprang auf mit einem Satz. Tat ein paar Schritte, blieb stehn. Starrte um sich.
Allein war er – niemand im Raum außer ihm.
Aber ihr Duft ringsum, weich, süß – Jicky.
Was war denn geschehn? Was hatte sie gemacht? Blut sah er – soviel Blut –
Etwas preßte seine Hand –
Ein Messer – ja doch – ein kleines Messerchen.
Sie hatte es – und er riß es ihr fort. Das war es –
Er öffnete die Finger. Da fiel es auf den Teppich hin, ihm zu Füßen –
Kein Messer – die Schachfigur –
Draußen brüllte es – wieder fuhr er zusammen. Nein – ein Autotuten.
Dann ein Schreiten im Flur. Sein Sekretär kam zurück.
»Wo ist sie?« flüsterte er. »Wo ist – Frau van Neß?«
Der antwortete: »Ich habe sie eben zum Auto gebracht. Sie wollte Sie nicht aufwecken – so fest schliefen Sie.« Er hob die Schachfigur auf. »Wollen wir weiterspielen, Doktor? Sie sind am Zug.«
Frank Braun antwortete nicht. Blickte den andern an, lauernd, mißtrauisch –
Dann fühlte er einen leichten Schmerz. An der Schulter – unter der Achsel. Nein – tiefer im Rücken wars. Nein, nein – mitten auf der Brust –
Er riß Jacke herunter und Weste, Schuhe, Hosen und Hemd. Blickte herum an seinem Leib, suchte –
Fand nichts. Betastete sich sorgfältig von oben herab.
Die Wunde, wo war die Wunde?
Er lief hinüber ins Badezimmer. Stellte sich vor den großen Spiegel. Bog den Kopf herum, suchte am Rücken.
Nichts – nichts. Er schloß die Augen. Wo denn tat es weh?
Aber er fühlte nichts mehr.
Sein Sekretär kam ihm nach. »Was ist los, Doktor?« meinte er. »Was haben Sie denn?«
Er sagte: »Ich bin – gestochen. Irgendein Insekt hat mich gebissen. So helfen Sie mir doch suchen!«
Rossius drehte noch ein paar Lichter an, strahlend hell war das Badezimmer. Suchte herum, schüttelte den Kopf. Sagte dann: »Sie haben geträumt, Doktor.«
Nun fühlte er es wieder. Kein Schmerz – ein kribbelndes Jucken nur. Und nicht an einer Stelle – überall hin über die Haut. Klebrig – kalt dabei.
Er zitterte, klapperte mit den Zähnen. »Meine Kleider!« stotterte er. »Es ist kalt hier.«
»Kalt?« sagte Rossius. »Zwanzig Grad wenigstens!«
Sie gingen zurück und er zog sich an. Konnte er dem Jungen trauen? – Ach, der würde ihn verraten – jeden Augenblick! Nicht um Geld – gewiß nicht, aber um jeden Kuß von geschminkten Lippen.
Vorsichtig fragte er: »Wie lange schlief ich?«
»Eine gute Stunde!« erwiderte der andere.
Frank Braun schwieg eine Weile. Setzte sich, rückte seine Figur. Gab sich Mühe, recht gleichgültig zu sein, begann endlich: »Sie waren doch draußen, nicht? Ich habe Sie doch hinausgehn sehn, als Frau van Neß da war? – Haben Sie die Briefe besorgt?«
»Nein,« antwortete der Sekretär, »da liegen sie noch. Ich war gar nicht vor der Tür, wir haben beide dagesessen und leise geplaudert – um Sie nicht zu stören.«
Er schrie ihn an: »Sie lügen! – Sie lügen! Sie haben mich allein gelassen mit – mit –« Seine Stimme überschlug sich, seine Hände verkrampften sich. Ah – an die Kehle fahren wollte er ihm, würgen, würgen –
Sein Sekretär stand auf – aschfahl im Gesicht.
Nicht eine Silbe sprach er.
Frank Braun starrte ihn an – hilflos, fassungslos, flehend.
Der andere verstand ihn gut. Setzte sich wieder, zog den Läufer.
Und sie spielten weiter. Stumm, schweigend.
Eine Partie. Noch eine –
* * *
Sie gingen aus, spät genug. Broadway hinunter. Schlenderten so hin.
Ernst Rossius sprach. Erzählte von seines Lebens großem Abenteuer – von der schönen Aimée.
Er hörte hin, mit halbem Ohr, blickte zugleich ringsum auf das hastige Treiben.
Tenderloin. Manhattans Rippenstück.
Die Theater leerten sich. Pelze und Zylinder. Bunte Abendmäntel und Brillanten. Autos, Tausende von Autos.
Dirnen? Wenn welche da liefen – man hätte sie nicht herausfinden können. Sah doch jede Dame wie eine Straßendirne aus – geschminkt, dick gepudert, gemalt die Lippen, Augen und Ohren. Überdeckt mit buntem Schmuck.
Und gemalt auch die Bengel, die zuletzt kamen aus den Theatern, auf und ab schalanzten unter den hellen Schaufenstern. Chorherren, Arm in Arm, Affen, auf Ragtime dressiert, krank und verfault. Ausschußware jämmerlicher Qualität – die Broadway beherrschte um diese Zeit. Und die ihre Liebhaber fand – dennoch.
Dann, weiter unten, die Matrosen. Stramme Jungen, sonnverbrannt. Kräftig, gesund, reingewaschen. Auf und nieder – wie die Chorjüngelchen. Käuflich wie sie – nur billiger.
Weiber auch – nur Jüdinnen in dieser Gegend, die hinüberkamen von der Ostseite, langsam die deutschen Dirnen hier verdrängten. Die liefen jetzt oben herum – so um die achtzigste Straße.
Jede Gegend der Stadt, jede Vorstadt auch, trug ihren Charakter: in der Nacht brach er durch – Negerweiber dort – Griechenbengel an anderer Stelle. Irische Viertel, italienische, ungarische. Alle Nationen mochte man durchkosten in dieser Stadt. Konnte sich Armenierinnen einhandeln, Kubanerinnen, Böhminnen. Französinnen, Engländerinnen, soviel man haben wollte, Mädchen aus Kanada, aus Syrien und Rumänien –
Welch ein Markt! – Billig, billig! Ein Dollar aufwärts das Stück!
O ja, die Farstin hatte schon recht: jedes Laster konnte man hier kaufen – wie die roten Äpfel an den Obstständen der Straßenecken.
›Die Äpfel schmecken nicht,‹ dachte Frank Braun. ›Fad sind sie alle und schal – wie lauwarmes Wasser. Wie ihre Sünden auch – das Klima macht es!‹
Sie nahmen ein Taxi, fuhren hinauf zum Hotel Plaza, tranken Sekt im Grillraum, schauten dem Tanzen zu. Ins Biltmore dann, zum Maxim und zum Ritz. Überall dasselbe: Foxtrott, Lame Duck, Hesitation, Ragtime – immer wieder. Synkopiert alles – sogar den Feuerzauber synkopieren diese Kapellen.
Das tanzte ohne Unterbrechung. Zwei Kapellen überall – im Augenblick setzte die eine ein, wenn die andere zu Ende war. Das tanzte, tanzte – ohne Empfindung, ohne irgendein Gefühl. Nur ein Schreiten war es, nur ein Drehn – ein Bewegen, das schwitzen machte. Ein Bewegen, immer bewußt, immer kontrolliert – immer aufmerksam lauernd auf den nächsten Schlag der Synkope.
Immer unfrei, nie ein berauschtes Blut, nie ein Fleisch, das sich austoben mochte in Schleifen und Springen. Wie ein Sonntagsschulmeister saß irgendwo, dürr und neidisch, die Synkope, klopfte mit hartem Lineal alle Kinder auf die Finger, die nicht mäuschenstill und kerzengerade dasaßen. Hielt sie fest an der Strippe, wie gezähmte Affen, die die Peitsche fürchten.
Pfaffenmoral im Tanzsaal: Synkope!
Hinunter fuhren die beiden zum »Nachtasyl«. Deutsch wieder alles in diesem Bumms, dessen kluge Wirtin aus polterndem Radaupatriotismus dicke Stangen Goldes schmolz. Nationallieder, eins ums andere – da brüllte das ganze Lokal. Operettenkram dazwischen, dann Strophen auf Hindenburg und Mackensen und den Kaiser, auf die gemeinen Engländer und die italienische Lumpenbagasch. Und das trunkene Publikum lachte und weinte und jauchzte abwechselnd, fand sehr ergreifend, was eben ergreifen sollte, und komisch, was komisch sein sollte. Wirkte mit an allen Tischen, trank Wein und Bier und Sekt, küßte die deutschen und jüdischen Mädel, die ihm auf den Knien herumlagen und saßen.
Franz, der Klavierspieler, zerhämmerte sein Instrument, kämpfte verzweifelt, seine Kunst gegen diese Gäste durchzusetzen. Nie gelang es ihm, immer mußte er ein Stück abbrechen und die Melodie spielen, die die andern brüllten. Die meinten, daß ›noch die Tage der Rosen – Ro – sän – wären‹ und schrien es hinaus mit krachender Energie, daß nur ja keiner wagen solle, daran zu zweifeln.
– »Wohin nun?« fragte Frank Braun.
Ernst Rossius zog die Uhr. »Sechs schon! Ich habe grade Zeit, nach Hause zu fahren und ein Bad zu nehmen. Dann muß ich zur Redaktion.«
Nach Hause also.
Er ging die Stufen hinauf, schloß die Haustüre auf. Durch den Flur dann zu seinen Zimmern. Blieb stehn, stutzte – etwas bewegte sich da drinnen. Und ein Lichtschein drang durch die Ritzen. Er lauschte angestrengt. Ein leises Geräusch – als ob jemand auf und nieder gehe.
Fred? – Aber nein – unten vom Treppenloch her hörte er sein röchelndes Schnarchen.
Leise steckte er den Schlüssel ein. Drehte um, riß die Türe auf mit einem Ruck.
Vor ihm stand Lotte.
Und ein Duften rings – so viele glühende Rosen.