
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
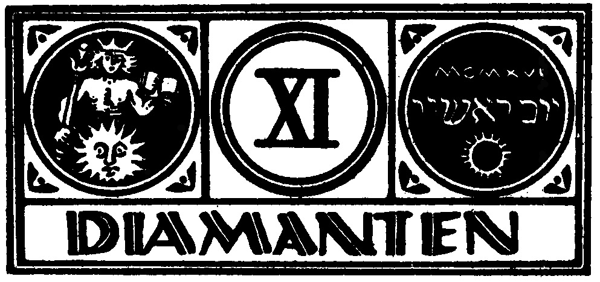
Und darum prangte an des Fürsten Hand,
Groß wie ein Taubenei, der
Diamant,
Daß seiner Strahlen sonnenreiner Glanz
Die harten Herzen träfe, die im Kranz
Rings schlugen um das alte Minareh,
Daß er sie schmelze, wie der Berge Schnee
Die Sonne. Eng sie eine. Solche Macht
Gab Allah seinem Stein – –
Nisami.
Sie wußte gut, was sie tat, die kleine Ivy Jefferson, legte ihr Netzchen klug genug. Sie erfuhr bald, daß eine spanische Tänzerin bei ihm gewesen sei und daß die van Neß ihn mit der erwischt habe. Sie wußte längst, was er auf dem Feste der Monddamen getrieben hatte und daß er nun in Aimée Breitauers berühmtem Buche stand. Irgend etwas mußte er auch mit der Farstin gehabt haben – das hatte ihr Direktor André gesteckt.
Sie hatte versucht, ihn ziehn zu lassen – hatte das brav durchgeführt ein paar Wochen lang – aber dann hatte sie doch wieder angerufen, als sie keinen fand, der ihr besser gefiel. »Thrill« brauchte sie, wie ihre Mutter, wie alle die Frauen ihrer Gesellschaft, und etwas war in diesem Deutschen, das ihre Nasenflügel beben machte.
Liebe? O je – eine Laune wars. Sie wollte eben – und war gewohnt, ihren Willen zu haben, seit sie denken konnte. So einfach war diese Logik: sie war erwachsen, war in der Gesellschaft, hatte ihren ›Beau‹ nun seit anderthalb Jahren. Jetzt würde sie heiraten. Ihn natürlich. Der ihr mehr sagte als die andern. Den sie dazu andern Frauen nicht gönnen mochte. Vielleicht fand sie, was sie suchte – o sie wußte nicht, was. Vielleicht fand sies – um so besser dann. Und sonst – ließ man sich scheiden – nichts war einfacher. Sie konnte jeden Tag haben, wen sie wollte, sie, Howard J. Jeffersons einziges Kind.
Er sah es gut. Vermied es, wo es nur anging, allein mit ihr zu sein. Wich ihr stets aus, wurde sehr erfinderisch in Ausreden und Entschuldigungen.
»Du bist der schlecht erzogenste Beau in Neuyork!« sagte sie.
»Such dir einen andern!« lachte er.
Sie pfiff – sie konnte prächtig pfeifen, wie ein Gassenbub. Daß er ihr den Willen nicht tat, nie und nimmer, das war eines, das sie reizte. Vieles noch. Manches, das sie wußte – manches auch, das sie nicht wußte. Aber sie würde es schon erfahren – das würde sie.
Noch einen Grund hatte er, jedes Alleinsein mit ihr zu vermeiden. Keinen Grund eigentlich, ein Empfinden nur – einen ängstlichen Instinkt. Etwas war geschehn an dem Nachmittag, als die Goyita ihn besuchte. Er fürchtete sich, ohne sich dessen recht bewußt zu sein, in einem Raume allein zu sein mit einer Frau – welche immer es war. Ausreiten ja – im Auto fahren ja – zum Luncheon irgendwo oder ins Theater. Da waren Leute rings herum – da war er sicher. Aber schon im Garten allein zu wandeln mit der blonden Ivy war ihm unbehaglich. Eine unbestimmte Angst, daß etwas geschehn könne – eine Furcht vor ihr – vor sich selbst – er wußte es nicht.
Sie merkte es wohl. Und ihr Spiel war, jede Gelegenheit zu greifen, wo immer sie ihn für sich haben konnte. Ihre Mutter half ihr, verschwand stets, wenn es nur eben ging, ließ sie allein – dafür half ihr Ivy mit ihrem Beau, dem Generalkonsul. Eine Zeitlang versuchte sie es, sich möglichst bloßzustellen mit ihm. Sie küßte ihn, wenn eben die Mutter hereintrat oder wenn einer kam von der Dienerschaft. Dann auch vor Fremden. Aber er tat, als ob es eine Kinderei sei, das törichte Getue eines Spielkätzchens. Einmal wurde die Mutter deutlich genug. »Wenn einer so oft ins Haus kommt wie Sie,« sagte sie, »und stets mit der Tochter zusammensteckt, dann erwartet man, daß er um ihre Hand fragt.«
Er sah sie an, lachte dann zu Ivy hinüber. »So?« machte er. Und kein Wort mehr.
»Ja!« unterstrich Frau Alice. »Allerdings. Das ist so Sitte bei uns.«
»Bei mir nicht,« erwiderte er.
»Sie verlangen wohl, daß wir Sie bitten sollen?« rief sie. Ihre Entrüstung war ehrlich und nicht gemacht; sie stand beleidigt auf vom Frühstückstisch.
»Ganz und gar nicht!« rief er ihr nach. Ivy nahm sich kaum die Mühe zu warten, bis die Mutter zur Tür hinaus war. »Und was würdest du antworten?« fragte sie. »Willst du mich zur Frau?«
Er tat, als ob es nur ein Scherz sei. »Nein!« sagte er. »Du taugst so wenig dazu, wie ich mich zum Ehemann eigne.« Er stand rasch auf. »Mach dich fertig, Ivy, das Auto wartet, wir wollten doch ausfahren heute nachmittag.«
Sie ließ ihn nicht aus diesmal. »Aber zu Mätresse möchtest du mich?« begann sie wieder.
»Nein,« lachte er, »auch nicht.« Er versuchte, es ins Lächerliche zu ziehn. »Was würden deine Eltern dazu sagen?! Komm nun, laß doch die Dummheiten.«
Sie blieb ruhig sitzen, wiegte ihr Köpfchen hin und her. Das war ihr Lieblingswort: ›Mätresse‹. Immerfort kokettierte sie damit, sprach nie anders von Frau van Neß als von ›seiner Mätresse‹. Sagte: ›Ich hab heute deine Mätresse gesehn – auf der fünften Avenue.‹ Oder, wenn er kam: ›Kommst du von deiner Mätresse?‹ Wenn er ging: ›Grüß deine Mätresse!‹
»Sie hält dich fest, deine Mätresse,« überlegte sie. »Sie will dich nicht loslassen, das ists. Du darfst nicht tun, was du willst, mußt tanzen, wie sie die Fäden zieht – ihr Püppchen bist du.«
»Dummes Geschwätz!« rief er.
Sie hob sich langsam, trat zu ihm hin. »Ich weiß, was ich sage,« beharrte sie. »Ich habe mirs gut ausgedacht. Alles, was du tust – deine ganze Arbeit – tust du nur, weil sie es so will. Und sie will es nur – damit du immer etwas zu schaffen hast – nie mehr dein eigener Herr bist, keine Zeit mehr hast, für dich zu denken und an dich. Sieh, ich mag schon keine Zeitungen mehr in die Hand nehmen – überall dieses gräßliche Geschrei für das Sternenbanner. Und wie sie für Amerika plärren – so schreist du für Deutschland, just so. Merkst gar nicht, daß es genau so dumm ist? Ich pfeif auf das Vaterland! Zehnmal lieber als irgendwo in den Staaten wäre ich in Paris oder London – vermutlich auch in Berlin oder Wien, wenn ich die Städte kennen würde. Für die Massen ist das Vaterland und all die andern Phrasen – nicht für uns.«
Sie sagte: »Für uns? – Das Leben!«
Noch immer mochte er sie nicht ernst nehmen. »Sag doch mal, Ivy,« fragte er wieder. »Woher hast du all die Weisheit?«
»Gelesen,« antwortete sie ruhig. »In einem Buch, das wir im College hatten. Vergessen – dann ists mir wieder eingefallen. Und ich hab drüber nachgedacht. Unten und oben – an den Grenzen – braucht man all das Zeug nicht: das Gerede von Vaterland und Moral und Staat und was es ist. Der Hobo, der Landstreicher, der Bettler weiß nichts davon. Der steht drunter – wir stehen drüber, wir!«
»Ihr?« rief er. »Wer seid denn: ihr?«
Aber sie hatte ihre Antwort: »Wir – sind die, die das Geld haben. Nicht alle – nein, nur die davon, die zugleich wissen, daß das alle Macht bedeutet. Und daß Macht zugleich Recht und Vaterland und Religion und Moral ist. In dem Buch – es war so ein Leitfaden durch die Philosophie über Plato und Aristoteles und Kant und Spencer und Buckle und wie sie alle heißen – stand auch ein Satz von Speinosä –«
»Spinoza!« rief er, »sprichs wenigstens richtig aus!
»Es ist mir völlig gleichgültig, wie er heißt!« sagte sie. »Der Satz hieß: ›Jeder hat soviel Recht, als er Macht hat!‹ Und der Mann mußte Linsen schleifen, hatte kein Geld und also keine Macht und darum gar kein Recht. Deshalb wurde er verbrannt!«
Frank Braun lachte: »Na – verbrannt wurde er nicht gerade. Sag mal, wie dick war denn eigentlich euer Lehrbuch der Philosophie?«
Sie zeigte: »So dick! – Über zweihundert Seiten! Du kannst drauf wetten, daß keine von uns es ganz gelesen hat!«
Er nickte: »Natürlich nicht!«
»Lach nur,« fuhr sie fort, »es bleibt drum doch recht, was ich sage. Wir – können tun, was wir wollen. Jedermann in Neuyork weiß, daß die van Neß deine Mätresse ist, und doch werden alle Türen ihr aufstehn. Und die Pierpont, die Fox, die Gordon, die Breitauer und all die andern – was? Ganz Amerika trieft von Moral – und sie feiern lustig ihre Feste. Sie dürfen es, weil sie drüber stehn mit ihrem Geld. So ists überall! Ma's Freund, der Generalkonsul, hat mir gesagt, daß die englischen, russischen, belgischen, rumänischen Herrscherfamilien alles Deutsche sind, Männer wie Frauen! Hohenzollern, Koburger, Holsteiner, Wittelsbacher, Hessen – er hat mirs aufschreiben müssen, und ich habs hübsch auswendig gelernt für dich. Die speien auf ihr deutsches Blut, auf das deutsche Vaterland! Und doch, wenn der Krieg aus ist, werden sie in Deutschland selbst genau so geehrt werden wie vor dem Kriege und wie überall sonst in der Welt. Sie können sichs eben leisten: haben Geld und Macht und Namen und Einfluß – da darf man tun, was man will.«
»Meinetwegen,« rief er, »aber wie paßts auf mich? Ich heiße weder Gould noch Rockefeller noch Koburg und Hohenzollern, hab kein Geld und keine Macht. Also kann ichs mir nicht leisten und muß mit der Masse gehn, nicht?«
»Nein,« sagte sie heftig, »nein! Es ist nicht das Geld allein – es gibt auch noch andere Menschen, die da stehn, wo wir sind. Nur, weil sie sich eben selbst dahin gestellt haben, darum nur! Das ist nicht leicht, glaub ich, und es ist gefährlich – jeden Augenblick können sie herabstürzen – was uns ja auch geschehn mag – wenn auch nicht ganz so leicht. Ich bilde mir ein, du gehörst dazu!«
So etwas hatte er auch einmal geträumt. Von einer Kulturnation – die über den Völkern stand. Freilich, mit Geld hatte das nichts zu schaffen, war sehr europäisch gedacht und gar nicht amerikanisch. Aber wars nicht im Grunde doch dasselbe? Kams nicht bei ihm – wie bei ihr – nur auf das eigene Hinausheben an? – Denn drüber stand der Pittsburger nicht, trotz seiner paar tausend Millionen, Herr Andrew Carnegie, den die böse Höllenangst plagte und der dem lieben Gott so gerne ein kleinstes Himmelsplätzchen abhandeln wollte, darum »gute Werke« tat und Millionen stiftete. So wenig, wie der bürgerliche Professor, ob er gleich »Speinosä« nicht nur richtig aussprach, sondern auch auswendig kannte, und alle die andern dazu.
Bildung oder Begabung, Geld, Geburt, Einfluß, Namen – irgend etwas nur. Aber der Wille mußte dabei sein und das Bewußtsein: über der Masse zu stehn, ihre Rechte brechen zu dürfen. Das Gefühl der Macht – einerlei, was diese Macht gab.
Sie hatte schon recht: er lief nun mit der Masse. Dachte, tat, genau das, was sie alle taten, drüben wie hüben. Und Lotte van Neß war es, die ihn eingespannt hatte ins Geschirr – auch das war wahr.
Sie unterbrach sein Schweigen nicht, wartete lauernd.
»Ich weiß nicht –« murmelte er.
Da fragte sie: »Sags doch – würdest du das alles tun und getan haben – aus dir heraus?«
Er wiederholte: »Ich weiß nicht. Vielleicht. Wenn sies nicht gewesen wäre, würde mich vermutlich ein andrer eingespannt haben. Und ich würde am Karren ziehn, grade wie jetzt.''
Sie schüttelte den Kopf. »Nein – du wärest längst ausgebrochen! Und es ist sehr klug, wie sie es macht, dich zu halten. Wenn sie dich geheiratet hätte – wärst du längst fort von ihr. So ist sie nur deine Mätresse – läßt dir alle Freiheit. Das wenigstens bildest du dir ein. In Wahrheit aber tust du nur, was sie will und nichts sonst. Selbst zu mir kommst du nur, weil sie dich schickt.«
»Mich schickt?« lachte er. »Sie hats nie getan.«
»Nie?« forschte Ivy. »Wirklich nie?«
Er dachte nach – freilich, das erstemal war es Lotte gewesen, die mit dem Tewes darauf bestanden hatte, daß er Besuch machte bei den Jeffersons. ›Gib der Kleinen die ersten Küsse!‹ hatte sie gesagt – war es nicht so?
»Einmal, ganz im Anfang!« sagte er zögernd. »Aber später hat sie kaum je deinen Namen erwähnt!«
Ivy Jefferson nickte: »O gewiß nicht – sie hat Instinkt, deine Mätresse, kennt dich ja auch lange genug. Immer muß es so aussehn, als ob du tun und lassen könntest, was dir nur beliebte. Nie darfst du merken, daß du nur tust, was sie will!« Sie nahm eine weiße Nelke vom Tisch, brach den Stengel ab, steckte die Blume ihm an. »Der neue Butler ist so unaufmerksam, vergißt stets Knopflochblumen zurecht zu machen. Der alte war viel besser. – Schade! Ich habe ihn wegschicken müssen.«
»Du?« lachte er. »Weshalb denn?«
»O, es war der beste Butler, den wir je hatten – vielleicht wirst du ihn bald wiedersehn –«
»In Frau van Neß' Haus,« sagte sie. »Ich habe ihn entlassen müssen, ihn und den zweiten Chauffeur – weil sie beide im Dienste deiner Mätresse standen. Sie berichteten ihr haarklein alles, was hier im Hause geschah.«
»Das ist nicht wahr!« fuhr er auf.
Sie lächelte. »Doch!« sagte sie ruhig. »Ich habe drei Telephongespräche überhört. Nun begreifst du wohl, warum sie nicht nötig hatte, dich zu fragen nach Ivy Jefferson?«
Er gab keine Antwort.
»Sie hatte sehr recht, deine Mätresse,« fuhr sie fort, »sie ist klug, man kann viel von ihr lernen. Ich hab noch mehr gelernt, du! Meinst du, ich wüßte nicht, warum du in diesem Hause bist?«
»Weil du mir gefällst,« erwiderte er schnell. »Weils eine Erholung ist für mich, mit dir herumzuspielen.«
»Vielleicht,« sagte sie, »ein bißchen! Aber das ist nicht der Grund – das ist nur etwas, das dir die Arbeit hier leichter macht. Glaub du nur nicht, daß mein Vater so dumm ist, wie ihr – du und meine Mutter – es euch einbildet. Er ließ mich gestern nach Wallstreet kommen in sein Büro – das tut er immer, wenn er ganz ernst mit mir reden will. Er sprach lange mit mir – glaub mir – er durchschaut dein Spiel ganz genau. Er weiß, daß du mir nur den Hof machst, meinen Beau spielst – und schlecht genug dazu! – weil du denkst, durch mich Einfluß zu haben auf Papa. Weil du annimmst – mit Recht vielleicht – daß er nichts tut, was ich nicht wünschen möchte. Darum! – Ists so? Leugne doch!«
Er kniff die Lippen zurück. »Es ist so,« sagte er.
Er schüttelte den Kopf: »Kein Aber!«
»Setz dich,« sagte sie. »Ich bin noch nicht zu Ende. Mein Vater hatte fünf Millionen, als er Teilhaber wurde in der Bank. Heute ist er allein der Herr und hat zwanzigmal so viel. Und – was mehr wert ist – sein Trust kontrolliert den ganzen Mittelwesten. Denk nicht, daß das alles nur Glück sei, und daß kein Verstand dazu gehöre. Die Leute da in Wallstreet erscheinen euch dumm – weil sie ungebildet sind. Und die Bessern von ihnen fühlen das gut, fühlen sich verängstigt, sind scheu, wenn sie mit euch zusammen sind, weil sie kein kleinstes Wörtchen mitreden können über Kunst und Musik, über Nationalökonomie, Philosophie und tausend andere Dinge. Aber ihr unterschätzt sie – und du auch! Sie wissen schon, was sie wollen!«
»Was wollen sie?« rief er.
Sie zog die Lippen hoch: »O – im allgemeinen: Geld verdienen. Und diesmal, im besondern, die neue englische Kriegsanleihe durchsetzen. Deshalb rief mich mein Vater nach Wallstreet.«
Er gab sich Mühe, sehr ruhig zu bleiben. Streckte ihr die Hand hin, sagte: »Leb wohl dann, kleine Ivy. Viel Glück wünsche ich dir und einen besseren Beau. Du begreifst wohl, daß ich keinen Schritt mehr in euer Haus setzen werde, wenn die Firma Jefferson die Anleihe zeichnet.«
Sie nahm die Hand nicht. »Morgen früh ist die Versammlung im Morganhause. Wenn mein Vater zeichnet, so wird es sein ganzer Trust tun – bis zum Mittag sind die tausend Millionen da, die London wünscht. Wenn ers nicht tut, wird es Monate dauern, bis die Anleihe mühsam abgesetzt ist – und ihr Kurs wird sehr herabgehn. Es ist ein recht gutes Geschäft für das Haus Jefferson – und mein Vater will zeichnen. Er wird es nicht tun, wenn –«
»Wenn?« wiederholte er.
Sie zupfte die Blätter von einer Nelke, knipste sie mit leichtem Finger von ihrem Kleide. »Die Deutschen sind gescheit,« sagte sie, »wie deine Mätresse. Sie haben wohl gewußt, warum sie dich in dies Haus sandten. Sie dachten: der ist der Köder – und die kleine Ivy beißt an. Sie haben sehr richtig gerechnet. Der Jeffersontrust ist der einzige rein amerikanische, der nicht mitmacht – für England – noch nicht! Da hast du mehr erreicht, als mit all deinem Reden und Schreiben. Aber nun sollt ihr Deutschen auch den Preis zahlen.«
»Das ist –« zischte er.
Sie nickte, lächelte. »Geschäft!« rief sie. »Nenns Erpressung – wie du willst. Aber warte noch, ehe du antwortest. Du hast die Blätter gelesen, du weißt, daß General Villa vor drei Tagen in Texas eingefallen ist, die Stadt Columbus verbrannt hat! Du warst unten bei ihm in Mexiko – du und andere: ihr Deutschen habts angestiftet!«
»Nein! Nein!« rief er. »Kein Deutscher hat seine Hand dabei im Spiele!«
»Darauf kommts nicht an!« erwiderte sie. »Wahr oder nicht – hier glauben sie, daß es so ist. Glaubst du, ich schelte dich darum? Ich gönns diesem Schreipack, wenn sie selbst mal ein bißchen merken würden, was Krieg ist; ich wünschte nur, daß der Villa zehnmal so stark wäre als er ist. Und wenn dus angestiftet hast – so find ichs sehr nett von dir! Aber davon will ich nicht reden. Ich weiß, mit wem du zusammengesteckt hast in Torreon – Oberst Pearlstone heißt er, Villas Adjutant, ein Neuyorker Jude.«
»Woher hast du das?« fragte er tonlos.
Sie wiegte den Kopf. »Mein Vater hat mirs gestern gesagt. Der hats aus Washington – von der japanischen Botschaft. Begreifst du nun?«
»Ah –« machte er.
Sie lachte: »Du sitzt morgen in den Tombs, wenn ich will! Und dann in Atlanta – zwanzig Jahre und mehr. Ich meine nur: es wäre doch möglich?«
»O ja!« nickte er. »Durchaus. Alles ist möglich in diesem Lande und zu dieser Zeit!«
Sie wartete einen kleinen Augenblick. Sagte dann: »Nicht? Ich denke, das ist das einzig Nette bei uns in Amerika. So ists möglich – und anders auch.«
»Wie anders?« fragte er. »Hast du noch mehr Überraschungen?«
»Nein,« sagte sie, »genug für heute. Ich meine nur, anders wäre es auch möglich. Daß du morgen deinen Namen nicht einzeichnest in das Empfangsbuch der Tombs – so wenig wie mein Vater den seinen in die Liste der englischen Anleihe. Ganz wie du magst! Willst du den Preis zahlen?«
Er verstand sie gut. Fragte dennoch: »Was meinst du, Ivy? Was ist dein Preis?«
Sie lachte wieder. »Du natürlich! Willst du dich mit mir verloben heute abend?« Sie stand auf, trat hin zu ihm. »Überleg dirs – aber nicht allzu lange. Ich spiele anders als deine kluge Mätresse. Ganz offen lege ich meine Karten hin – doch sinds schöne Trümpfe, was?«
Prächtige Trumpfkarten – das mußte er zugeben! Und er hatte nichts in der Hand –
Er suchte Zeit zu gewinnen. »Ich will darüber nachdenken,« begann er. »Werde dir morgen Antwort geben.«
Aber sie schüttelte langsam den Kopf. »Morgen? O nein! Willst wohl mit deiner Mätresse drüber sprechen?«
Er fand nichts andres; sagte: »Ja, das möchte ich.«
Viel Hohn klang aus ihrer hellen Stimme. Aber nicht beißend, gutmütig fast. »Freilich – wir müssen ihre Erlaubnis einholen. Aber das können wir schnell haben: sie soll herkommen!« Sie wandte sich, lief mit raschen Sprüngen durch den Raum.
Er folgte ihr. »Was willst du tun?« rief er. Sie stand schon am Telephon: »Plaza 376!« rief sie.
Er hörte, wie sie mit einem Diener sprach, dann mit Lottes Zofe. Wie sie Frau van Neß verlangte. Er wollte ihr das Hörrohr aus der Hand nehmen, wollte sagen, daß er –
Dann dachte er: ›Vielleicht ists gut, daß sie kommt, vielleicht findet sie einen Ausweg.‹
»Ist da Frau van Neß?« sagte die Kleine. »Hier ist Ivy Jefferson. – O bitte, verzeihen Sie die Störung. – Er ist hier – ja! – Ihr – Ihr Gelie –«
Sie sagte es doch nicht. »Ihr Freund ist hier – Herr Frank Braun. – Ja! – Er läßt Sie bitten, sofort hierher zu fahren. – Nein – ich kann es nicht am Telephon sagen! – Nein, nein, er kann nicht selber kommen, jetzt nicht! – Es ist wirklich sehr wichtig. – Für ihn auch. – O, danke sehr, also in zwanzig Minuten.«
Sie hing das Hörrohr an. »Sie kommt!« rief sie. »Du hast es gehört.«
Ihre Augen leuchteten. Sie ging mit raschen Schritten auf und nieder im Zimmer. Er setzte sich, grub den Kopf in beide Hände. Suchte. Fand nichts.
Sie sprachen kein Wort miteinander. Warteten.
Dann meldete ein Diener Frau van Neß. Er sprang auf.
Ivy Jefferson ging ihr entgegen, nahm ihre Hand, führte sie zu einem Sessel. »Wie lieb, daß Sie kommen!« rief sie. »Er will sich mit mir verloben, sehn Sie – und er meint, er brauche dazu Ihre gütige Erlaubnis. Ich finde es sehr begreiflich, sehr nett von ihm, daß er meint, nichts tun zu dürfen ohne das Einverständnis seiner – seiner –«
Sie zauderte, schwankte – aber nur einen kleinen Augenblick. Sie mußte diese Genugtuung haben, mußte es ihr sagen, mitten ins Gesicht.
»Seiner Mätresse,« fuhr sie fort. »Nicht wahr, Frau van Neß, Sie sind ja doch seine Mätresse?« Aber sie sagte es nicht scharf, nicht beleidigend. Sprach es lieb und weich, sanft schmeichelnd und klingend.
Sie wartete nicht auf ihre Antwort. Sie sprach schnell, klar und offen, sagte kein Wörtchen zu viel. Daß sie ihn haben wolle – weil sie ihn eben wolle. Es sei ihr Wunsch und ihre Laune – und sie müsse ihn haben. Daß sie gut wisse – und ihr Vater auch – wozu er geschickt sei in das Jeffersonhaus. Daß sie ihn fest in der Hand hielte heute – mit der Mexikogeschichte, mit der Anleihe – mit noch ein paar Sachen. Und noch etwas am Ende: nicht nur seinetwegen habe sie sie hergebeten. Auch sie, Ivy Jefferson, habe noch etwas mit ihr zu sprechen. Wenn Frau van Neß Ja sagen würde und Amen – und es sei ja sicher, daß sie das tun würde – dann wäre er ihr Verlobter, der ihr gehöre. Und sie wolle ihn für sich, allein für sich – wohl verstanden. Da sei es selbstverständlich, daß er seine frühere Mätresse nicht mehr sehn würde, nicht mehr in ihr Haus kommen. Daß es zu Ende sei – einmal und für immer –
Ganz weich klang es, zart und süß, wie ein Vogelflöten: »Ich möchte, daß Sie das gut verstehn, nicht wahr?«
Lotte van Neß stand auf. Sehr bleich war sie. Sie sprach kein Wort, nickte nur.
Ein kleines Schweigen dann, das Ivy Jefferson brach. Nicht mehr so sicher wie vorher, ein wenig zitternd klang ihre Stimme. »Es scheint, daß sie einverstanden ist – deine Mä –« Aber sie unterbrach sich schnell. »Nein, sie ist es ja nicht mehr – seit diesem Augenblick nicht mehr – ich bitte vielmals um Verzeihung! Frau van Neß ist einverstanden! – Darf ich dem Diener schellen, Sie hinauszugeleiten, gnädige Frau?«
Die blasse Frau sagte: »Haben Sie es so eilig? Ein Wort nur, Fräulein Ivy, von seiner – frühern – Mätresse. Sie sollten wissen – wissen –« sie zauderte, suchte nach einem Wort. Fuhr dann fort. »Sollten wissen, daß Ihr Verlobter etwas braucht, das Sie ihm vermutlich nicht geben können.«
Die blonde Ivy zog die Lippen hoch. »Man weiß nicht genau, wieviel Geld Sie haben, Frau van Neß! Auch mein Vater kann es nicht genau sagen – es mag sein, daß Sie mehr haben als wir. – Heute! Aber Sie verdienen nichts in dieser Zeit – und mein Vater wohl. Viel. Sehr viel. Ehe der Krieg zu Ende ist – sind wir viel reicher. Sie mögen sich beruhigen, Frau van Neß, ich glaube nicht, daß der Mann, den ich nehme, irgend etwas nicht hat, das er braucht.«
Ein rasches Lächeln zuckte um Lottes Mund. »Sie mißverstehn mich,« sagte sie. »Kaufen können Sie es nicht!«
»Was ist es denn?« fragte die Blonde.
Aber Lotte van Neß schüttelte den Kopf. »Ich kanns nicht sagen.«
Da wandte Ivy sich an ihn: »Weißt dus?«
Er warf einen langen Blick auf Lotte Lewi, fragend und bittend. Aber sie schwieg, sah ihn nicht an. »Ich weiß nicht, was sie meint,« antwortete er.
»Nun« fragte Ivy.
Lotte van Neß sagte: »Nein – er weiß es nicht. Wird es wissen – zu irgendeiner Zeit. Und wenn Sie ihm nicht geben können, was ihm das Leben gibt – dann weiß er, wo ers haben kann. Dann – wird er zurückkehren – zu mir!«
Die kleine Ivy antwortete nicht, sie drückte schnell auf den Knopf. Aber die andere wartete den Diener nicht ab, grüßte, leicht nickend, schritt hinaus.
Er sah ihr nach. ›Da geht die Mutter!‹ fühlte er.
Der Diener kam. »Bitten Sie Herrn und Frau Jefferson herzukommen,« befahl Ivy.
Dann wandte sie sich an ihn. »Darauf laß ichs ankommen,« sagte sie nachdenklich. »Etwas – das du brauchst? Das sie dir geben kann und ich nicht? Aber sie sagt nicht was – und du weißt es nicht? Entweder lügt sie – oder –«
Ihre Augen wurden groß, glitten über ihn, langsam und suchend. Griffen sein Gesicht, den ganzen Leib dann, als ob sie ihn ausziehn wollten. Verlangend, gierig fast.
»Oder –« wiederholte sie flüsternd, wie zu sich selbst, »oder –«
Sie stampfte mit dem Fuß auf, warf den Kopf zurück, atmete rasch und heftig, daß die Nüstern flogen. »Ich wills sagen,« rief sie, »ich wills sagen! Ich will alles sagen dürfen – du! – Dazu will ich dich!«
»Was denn?« fragte er. »Sags doch!«
»Ich will viel sagen,« begann sie. »Aber ich weiß die Worte nicht. Du mußt es mich lehren – nicht jetzt, nein! Ich weiß, daß ihr mehr wißt in der alten Welt, in Europa und Asien – als wir hier. Ihr habt mehr Bildung: Kultur schreien sie in den Blättern und sind neidisch auf euch! In allem mehr – und in der Liebe – auch! Die Liebe ist eine Kunst – das las ich einmal in einem französischen Buch. Ich will sie lernen, diese Kunst, so gut können – wie die van Neß auch! – Dazu will ich dich.«
Sie trat dicht zu ihm, legte auf seine Hand leis die ihre. Die zitterte und war feucht.
»Sag mir,« flüsterte sie, »meinte vielleicht deine – meinte Frau van Neß, daß du – irgend etwas besonders liebst – in der Liebe? Daß sie etwas wüßte – und könne – das ich nicht kann und nicht lernen könne? Sprich doch! Antworte doch!«
»Ich weiß nicht, was sie meint,« sagte er.
Ihre Finger schoben sich um seine Hand, ihre Augen glühten in seine Augen. »Du sollst es sagen,« verlangte sie, »du sollst keine Scham haben – vor mir.«
Aber er schüttelte den Kopf. »Mein Wort – ich weiß es nicht.«
Sie seufzte, schwieg eine kleine Sekunde. Sprach dann, fester und gewisser. »Und doch glaube ich nicht, daß sie log. Nur – sie dreht es um – das denk ich. Nicht du brauchst etwas – das sie nur dir geben könnte: sie ist es – sie, die von dir etwas nimmt! Das ists!«
Er riß sich los – starrte sie an. Biß die Zähne übereinander, stieß hervor: »Das – das dachte ich – mehr als einmal! Wie kommst du darauf?«
Sie nahm seine Hände von neuem, streichelte sie rasch und nervös. »Meinst du, ich hätte nicht gemerkt, wie du warst all die Zeit über? Sehr gesund oft – stark und blühend – und dann wieder so müde und leer und matt. Und Frau van Neß? Wo ich sie traf, habe ich sie beobachtet, in der Oper, in Carnegiehall bei den Konzerten. Wenn du kräftig aussahst, dann war sie sehr bleich und blaß – sah aus manchmal wie der Tod selbst. Und sie wurde frisch und blühte auf – immer dann, wenn du elend warst! Ich hab mirs notiert – seit einem Jahre fast – in einem Kalender: ich will dir die Daten zeigen, wenn du magst. Sag mir, was habt –«
Sie unterbrach sich – man hörte Schritte im Nebenzimmer.
»Jetzt nicht,« rief sie. »Vater kommt und die Mutter! Jetzt nicht. Aber das ist es – o ganz gewiß! Sie trank deine Kraft – und darum trieb sie dich hinein in den wirbelnden Strudel: daß dus nicht merken solltest – keine Zeit fändest, nachzudenken – über das, was sie tat mit dir!«
»Aber was denn?« rief er. »Wie denn und wann denn?«
Sie lachte auf. »Wie – was – das weiß ich nicht. Aber wann – das kann ich dir gut sagen: schliefst du nie bei ihr?«
Die Türe ging auf – da warf sie die Arme um seinen Hals. Sprang hoch an ihm, hing sich fest, küßte ihn. Riß sich los, lief den Eltern entgegen. »Du sollst die Anleihe nicht zeichnen, Vater!« rief sie. »Ich hab mich verlobt mit ihm.«
* * *
Er kam nicht zur Besinnung an diesem Nachmittag. Er mußte bleiben zum Tee, dann fuhr ihn Ivy nach Hause. Er ging langsam die Stiegen hinauf, fürchtete das: ›Endlich!‹ das ihn empfangen würde. Dieses ewige: ›Endlich‹ und das ›Nun aber schnell!‹
Zwei ›Endlich‹ schallten ihm entgegen, und der Sekretär gab noch ein ›Gottseidank‹ zu. Zog ihn ins Schlafzimmer – da stand sein Diener bereit, ihm beim Ankleiden zu helfen.
»Nun aber schnell, nicht wahr?« rief er. »Ich weiß schon! Zum Bazar – ja – ja! Könnt ihr mir nicht einen Abend Ruhe lassen!«
»Aber Doktor,« hielt ihm Rossius vor, »heute ist Sonntag! Der große Tag! Die Botschafter sind eigens aus Washington hergekommen.«
»Schon recht!« seufzte er. »Gib den Frack, Fred.«
– Viele Tausende drängten sich um den gewaltigen Bau des Madisonsquare-Gartens. Die Tore wären längst geschlossen; ein paar hundert Schutzleute hielten Ordnung: zehn Menschen kamen heraus – da ließen sie zehn andere hinein. Zehn – aber zehntausend warteten – und noch zehntausend. Standen da, geduldig, in strömendem Regen – durch die Stunden –
Heute, wie gestern – und morgen – durch sechzehn Tage hindurch. Warteten, lauschten auf ein Geräusch, das herausdrang durch die dicken Mauern. Wie artige Kinder. Da drinnen war Weihnacht – war der Himmel. Da drinnen war – Deutschland!
Sie fuhren von hinten herum, hämmerten an eine kleine Seitenpforte. Zogen ihre Karten aus den Taschen und die bunten Schleifen. Gaben einem Schutzmann eine Dollarnote, schmuggelten schnell ein Dutzend Menschen mit hinein.
Durch die Keller und dann hinauf in die Budenstadt des riesigen Zirkus.
Nürnberg – das der Kinderbilderbogen. Und es sah so aus – echter schon, wie das Nürnberg der ›Meistersinger‹ im Opernhause.
»Sie müssen Punkt halb acht von der Galerie sprechen,« erinnerte ihn der Sekretär. »Dann um dreiviertelneun im großen Saale! Und um –«
»Ich weiß,« unterbrach er ihn. »Versuchen Sie inzwischen jemanden von der Botschaft zu erwischen. Sagen Sie, der Jeffersontrust würde die neue englische Anleihe nicht zeichnen!«
Vereine zogen auf, mit Fahnen und Bannern. Die mußte er begrüßen von der Galerie herunter. Kein Mensch verstand ein Wort in all dem Lärm – aber man wußte: da stand einer und redete. Das war völlig genug.
Tewes stürzte vorbei, gab ihm rasch die Hand. »Haben Sie Dr. Hertling nicht gesehn?« rief er. »Er soll im Empfangssaal sprechen, wir suchen ihn.«
»Nein!« erwiderte er. »Es ist ein Blödsinn, dies ganze Gerede hier – man kann gerade so gut: la – la – la schreien.«
»Tun Sies doch,« lachte der Journalist, »nur machen Sie hübsch große Gesten dabei, das ist die Hauptsache! Aber ein Blödsinn ists ganz und gar nicht! Dreitausend Leute kommen heute her, nur um den Botschafter zu sehn. Andere wollen Professor Södering sehn, andere Dr. Cohn. Na, und Ihretwegen wird wohl auch ein halbes Dutzend hergekommen sein. Wir wollen über eine Million machen auf unserm Bazar – so müssen wir das Tamtam schlagen! – Da ist mein Mann – warten Sie, ich bin gleich wieder da!«
Frank Braun lehnte über die Galerie, schaute hinunter in dies Meer von klingenden Farben. Das wehte und wellte, das schob und drängte, das tönte und schrie. Bunte Wogen unter dem gewaltigen Tuchhimmel, der in weichen gelben Fluten das alles überspannte.
Da, vor dem Stadttore die mächtigen Automobile. Gleich sechs Stück nebeneinander, jedes zu gewinnen auf ein Halbdollarlos.
Dicht beim Tore die Puppenbude, in der die Schwestern des deutschen Hospitals verkauften. Links davon die Stände des »Arion«, des »Liederkranz«, des »Deutschen Vereins«. Und die Buden des »Heinebundes«, des »Sprachvereins«, der »Vereinigten Bäcker« – dicht an dicht hatte ein Verein neben dem andern sein Zelt aufgeschlagen.
– Er sah hinunter. Dort, neben den violetten Damen des Waffelstandes, war Lotte Lewis Bude. Er erkannte sie gut – Nürnberger Spielzeug verkaufte sie. Drei junge Damen halfen ihr – und sie hatte drei gewählt, die rotblondes Haar hatten, wie sie selbst. Seidenkleider von einem milchigen Stahlblau – duftige, nilgrüne Tücher darüber.
Ein Holzpferdchen verkaufte sie und den Karren dazu. Redete der dicken Dame, die vor ihr stand, noch eine Puppenküche auf, nahm nun einen Hampelmann. Sie zog unten an der Schnur – und der Hampelmann hampelte und strampelte erstaunlich gut. Die dicke Dame konnte nicht widerstehn, sie kaufte den Hampelmann noch dazu. Sie versuchte ihn gleich, aber wie sie sich auch abmühte, es kam nur ein armseliges Zappeln heraus.
›Lotte kanns besser!‹ dachte er. ›Sie versteht sich auf Hampelmänner – ob sie nun aus Holz sind oder aus Fleisch!‹ Es zuckte in ihm, er hatte ein Empfinden, als ob auch er Beine und Arme stracks aufklappen müßte – wie sie die Schnur zog.
Er kannte den Takt, wußte schon, wie es gemacht würde – ein närrisches Hopsen, so wie das des schwindsüchtigen Komikers, den er einmal zu Bonn gesehn hatte in einem Bumslokal –
* * *
Da saß er mit den Studenten, ganz vorne in der ersten Reihe. Sie warfen den Tänzerinnen Blumen hinauf und schickten Wien den Soubretten, die schauderhafte Lieder plärrten. Dann kam der Damenimitator – der war der elendste von allen. Er sang und tanzte, arbeitete mächtig für das bißchen Brot. Zum Schluß aber kam er als Hampelmann.
Sang ein scheußliches Lied mit sieben langen Strophen, stets einen Kehrreim dazu. Der lautete:
»Seht den kleinen Hampelmann,
Wie er hampeln, strampeln kann!
Und die Damen und die Herrn
Hampeln, pampeln, strampeln gern!
Frauchen zieht am Hampelmann
Und das Männchen strampelt dann,
Rampelt, pampelt Tag und Nacht,
Wie ihn Frauchen hampeln macht!«
Dann kam die Hampelei. Er sprang auf, warf rechts und links die Beine auseinander, riß zugleich die Arme in die Höhe. Fiel herunter, sprang von neuem auf – wieder und wieder. Grölte dazu die geistreichen Hampelverse. Sieben Strophen hindurch – und immer von neuem dies Gehopse. Aber man sah die Überanstrengung des schwindsüchtigen Männchens – dem Publikum gefiel die Nummer gar nicht.
Doch Frank Braun klatschte. »Er soll tanzen, bis er umfällt!« rief er. Winkte der alten Blumenfrau, griff in ihren Korb, warf bunte Sträußchen auf das Podium. Und die Korpsbrüder folgten seinem Beispiel, warfen Blumen, schrien und klatschten.
Da hampelte der Kerl von neuem. Seine Augen strahlten über den Erfolg – und doch lag eine starre Angst darin, ob ers aushalten möchte. Aber er hopste, sprang und sang.
Neuer Beifall, mehr Blumen. Geschrei und Gejohle. Da capo und Bis!
Das Männchen sprang. Der Schweiß rann ihm in Bächen herab, grub lange Rinnen durch Schminke und Puder. Seine Sprünge wurden matter und schwächer; dann biß es sich auf die Lippen, riß sich zusammen, schnellte von neuem hoch. Das war sein großer Tag, sein starker Erfolg – ah, es mußte aushalten.
Vielleicht begriff die Menge. Vielleicht auch machte sie nur mit, weil es ein wilder Spaß war, ein Radau und Fez. Alle klatschten nun, das ganze Publikum brüllte und schrie.
Hampeln mußte die Schwindsucht da oben, hampeln. Die Kehle war so ausgeschrien, daß kaum ein heiseres Krächzen noch herauskam, doch hörte man gut das Rasseln und Röcheln der halben Lungen. Aber die Musik ging weiter, schnell, schnell, warf ihm die dünnen Beinchen hoch.
Er stand unter der ersten Sufitte, verbeugte sich tief, dankte, machte Gesten mit den Händen, daß es nun nicht mehr ginge. Und sog doch diesen Jubel ein, strahlend glücklich, voll von schwellendem Stolz.
Nein, nein, sie ließen ihn nicht aus. Diese Grausamkeit, die von Frank Braun ausging, kroch in alle Hirne, schlug in Flammen heraus, verlangte rasend das jämmerliche Opfer. Alles heulte und brüllte, die Studenten warfen Geld hin zur Musik – daß sie von neuem einsetzte. Und der Kapellmeister schwang den Taktstock.
Nun war es nichts Menschliches mehr, das da oben sprang. Eine lahme Puppe wars, ein Hampelmann, dem die Strippe zerriß. Noch immer öffnete sich, schloß sich der Mund, aber zu einem Atemholen nur, zu einem elenden Japsen, zu einem Kampf nur mit einem krächzenden Husten. Dann hing das Maul offen – da fiel ihm das Gebiß heraus. Er griff es schnell, klemmte es fest in der Hand.
»Er löst sich auf!« lachte Frank Braun.
Der Schwindsüchtige kroch zurück in die Kulissen klammerte sich fest, schlotternd und zitternd. Doch die Menge schrie weiter und johlte.
Eine Soubrette trat auf, die Musik setzte ihr Lied ein. Aber man ließ sie nicht singen. Man schrie sie an, warf allen möglichen Kram nach ihr. Sie hielt aus, so gut es ging, da schleuderte einer der Studenten den leeren Blumenkorb hinauf. Nun riß sie aus.
Und das Publikum schrie nach dem Männchen. Alle kreischten den Kehrreim:
»Seht den kleinen Hampelmann,
Wie er hampeln, strampeln kann –«
Noch einmal kam es heraus, noch einmal sprang das Männchen. Zappelte, hopste. Fiel dann. Stand auf, überschlug sich, schwankte, rollte über den Boden. Knickte ein, schrie auf, preßte beide Hände vor den Mund. Stürmte in die Kulissen.
Immer noch klatschten sie. Wurden ruhig endlich. Ließen die Soubrette ihre Zoten grölen.
Die Studenten gingen. Aber einer blieb zurück, der kam erst später nach in die Weinstube.
»Ich war hinten,« sagte er. »Der Kerl hat einen Blutsturz bekommen.«
Ein anderer fragte: »Na, was hast du angeordnet? Bist doch Mediziner!«
»Nichts!« erwiderte der. »Es waren schon zwei Ärzte da.«
Einen Augenblick schwiegen sie. Da machte der lange Ballus seinen behäbigen alten Witz: »Daraus kann man wiederum ersehn, daß man nicht zu viel hampeln soll.«
Frank Braun rief: »Trinkt doch – was kümmert euch der Clown! Er hat seine Pflicht erfüllt in dem Leben da: hat mir Spaß gemacht dreiviertel Stunden lang!«
So lachte er, das war seine wilde Geste. Und doch: Lüge wars! – Er hatte bebend dagesessen all die Zeit über, zitternd, ächzend, sich windend in den Schmerzen des springenden Männchens. Hatte gelitten, ah, all diese Qualen –
Aber hochmütig die Maske, wüst und frech –
* * *
Damals hatte er die Schnur gezogen. Hatte den Hampelmann hopsen lassen, nach seiner Laune, bis das Spielzeug zerbrach.
Was lag an dem! Ein Damenimitator, tantig und verschnitten, einer, der nie herauskam aus dem Schlamm der Gosse, ein Ausgespieener, Schwindsüchtiger, sehr Pervertierter. Einer, dem nur drei Tore offen standen in diesem Leben – zum Krankenhause, Zuchthause, Irrenhause. Der eben deshalb sich rettete mitten ins Rampenlicht, aus seinen elenden Gebresten einen Kuchen formte, ihn dem Publikum vorsetzte für zehn Pfennig Eintrittsgeld. Und der, einmal nur, einmal diesen Groschen wert war – in der Nacht, als er sich hinaushampelte aus seinem Jammerleben, als er selbst zum Hampelmann wurde mit Seele und Leib, alle Strampelglorie, allen Hampelruhm in sich hineinfraß, bis die Strippe riß.
Und den er liebte – grade darum!
Nun hampelte er selber. Und das liebe Publikum johlte und schrie, ließ ihn nicht herunter von der Bühne. Heraus, heraus, wieder heraus: Bis und Da capo! Gestern, morgen und alle Tage.
Unten stand sie, die die Schnur zog. Die ihn hopsen ließ, immer von neuem, hampeln und pampeln vor dem Publikum.
O es war schon ein Unterschied. Er hatte das Männchen zu Tode gezappelt, roh und brutal. Aber schnell, schnell – dreiviertel Stunden nur dauerte der ganze Spaß. Die aber seine Schnur zog, war eine Frau. Die ließ ihn ruhn, wenn er zusammenbrach in den Kulissen, die pflegte ihn gut, wenn er hinsank, leer, jammervoll, müde, ausgepumpt. Bis er wieder gesund war und stark, bis er von neuem Arme und Beine warf, wie sie zog. Höher springen und noch höher.
Durch die Monate – durch die Jahre nun –
Bis auch seine Strippe einmal reißen würde!
Da unten stand sie – in ihrer Spielzeugbude.
Wickelte den Hampelmann in Papier, reichte ihn der dicken Dame, die ihn gekauft hatte –
Was? Hatte nicht Ivy Jefferson ihn gekauft – vor ein paar Stunden erst?
Er wischte den Schweiß von der Stirne, seufzte tief.
»Sie sind heiß, Doktor,« sagte einer, »kommen Sie, wir wollen ein Glas Wein trinken.«
Er wandte sich um – ah, der Tewes stand wieder neben ihm.
Sie gingen über die Galerien, angerufen jeden Augenblick. Kauften Lose auf Kissen und Uhren, auf Pelze und Häuser und Hunde, auf Leuchter und Europareisen, auf Schinken und Bierseidel und Bilder und Broschen, auf Lampen und Badewannen, auf Ferienaufenthalte und Hindenburgpostkarten, auf –
Da war nichts, das nicht verlost wurde. Sogar eine Südseeinsel hatte jemand gestiftet.
»Das ist der einzige Schwindel beim Bazar, glaub ich!« sagte der Tewes. »Die Insel werden die Engländer längst im Sack haben – und der glückliche Gewinner muß mit dem Photo zufrieden sein!«
Sie kamen zu den Ständen der befreundeten Völker. Da waren die Buden der Ungarn, Kroaten und Slovaken, hübsche Frauen standen drin, bunt genug in den farbigen Nationaltrachten. Bulgarische Bauerndirnen in ihren Früchteständen, dalekarlische Mädchen in den schwedischen Buden. Türken natürlich, die verkauften Süßigkeiten, hatten ein mächtiges Kaffeezelt, ein Kamel sogar: darauf konnte man reiten – zehn Schritte hin und zehn zurück. Viele irische Buden auch und jüdische.
Ein Musikchor zog vorbei; die schmetternden Trompeten fraßen seine Worte. Da zogen die Ehrengäste des Tages zur Tribüne hinauf, wo der Botschafter reden sollte. Dr. Cohn an der Spitze, mit ihm der Graf. Und zwischen beiden Herrn die Präsidentin des Bazars in kostbarem Brokatkleide mit vielen Rosen rings herum. Ihre guten blauen Augen sahen verwundert ringsum, verschüchtert und doch stolz, sprachen: »Herrgott, was macht ihr bloß mit mir!« Aber sie stapfte tapfer mit durch all den Lärm, stützte sich kokett auf ihren Stock, der war lang, goldknöpfig und beschleift, wie ein Schäferstab von Trianon.
»Halb neun!« rief der Journalist. »Sie müssen zum blauen Saale.«
»Ja, ja!« antwortete er. »Ich laufe schon.«
* * *
Hier hatte Loritz, der Bariton, sein Reich. Vier große Konzerte gab er jeden Tag. Schlag drei begann das erste, Punkt elf war das letzte zu Ende. Und in jedem hatte er drei gute Namen und einen ganz großen obendrein. Redner zwischendurch, lebende Bilder und Balletts.
Als man den Madisonsquare-Garten mietete für den Bazar, fand der Sänger diesen Saal. »Den übernehme ich!« rief er. »Allein das Reinemachen wird Ihnen Tausende kosten!« warnte der Besitzer. Aber Loritz antwortete: »Keinen Kupfercent! Wir sind eh' beim großen Aufwaschen, da kommts auf den Saal nicht an.« – Er setzte eine kleine Notiz in die deutschen Blätter: deutsche Frauen, die zu arm seien, um mit Geld bei dem großen Werke zu helfen, sollten sich melden – bei Herrn Augias, Bureauzimmer 23, im Madisonsquare-Garten. Und die armen deutschen Frauen kamen, viele Hunderte gleich am ersten Tage. Der Bariton band eine Schürze vor, wie sie, nahm eine feste Schaufel, kommandierte sein Schipperregiment – vierzehn mächtige Fuhren Dreck trugen sie hinaus. Jeden Morgen kamen die Kehrfrauen wieder, hielten alle die Räume sauber und rein: das war ihre Arbeit fürs Vaterland.
Frank Braun trat in den Saal. Oben auf dem Podium stand Kreisler, der beste, der deutscheste Geiger der Welt. Eben setzte er den Bogen ab, wandte sich zum Abgehn, blieb stehn, festgehalten vom rasenden Jubel der Menge. Er, Fritz Kreisler, den jeder in Amerika vergötterte, einerlei, welchen Blutes er war. Aber die da unten, die Deutschen, hatten noch bessern Grund dazu.
Der da, der Kreisler aus Wien, war im Kriege gewesen als Dragonerleutnant. War in Polen vom Pferd geschossen worden und lange geschleift, kam herüber als Invalide. Ein Held war er ihnen, einer dazu, der auch in diesem Lande weitergekämpft hatte. Nicht mit der Fiedel nur, auch mit alledem, was er erworben hatte mit seiner Geige. Drüben hatte er dem Russen gestanden – hier stand er einem just so gefährlichen Gegner: Charles Schwab und dem Morgantrust. Die Bethlehem-Aktien stiegen, stiegen jeden Tag, von siebzig auf über sechshundert – diese Blutaktien, die den Tod hinüberspieen nach Europa, die den Alliierten den schon wankenden Arm stählten und ein Tränenmeer schufen von der Nordsee zum Bosporus.
Das kroch in des Geigers Träume, das ließ ihm keine Ruhe mehr. Da hob er sein Geld von der Bank, er, der Künstler. Der Spieler – mit der Geige – mit dem Säbel – mit dem Goldbeutel nun. Nahm alles, was er hatte, durch die Jahre zusammengespielt auf seinen Triumphzügen durch die Welt. Spielte in Bethlehem-Aktien, wettete auf fallenden Markt. Lief als Bär in dieser hohen Zeit aller Bullen, kämpfte gegen Wallstreet – er, ganz allein. Sie schien ihm schon blank und gut, seine Waffe – eine ganze, große Million wars!
Und war doch nur eine jämmerliche, armselige Lumpenmillion – ein elender Schmarrn gegen das Rüstzeug der Morgan und Schwab! Eine Million – die zu nichts zerrann in kaum acht Tagen. Und so wachte er auf nach der einen Woche: ein Bettler, der nichts hatte als seine Geige – und eine halbe Million Schulden obendrein.
Wallstreet lachte. Wallstreet war großmütig, Wallstreet bildete ein Syndikat, ihn zu halten. Bezahlte seine Schulden schlankweg, setzte ihm auch ein Monatsgehalt aus, daß er bescheiden leben konnte. Nur freilich mußte er von nun an für das Syndikat spielen, fünf Jahre lang, bis alle Schulden abgezahlt waren und die Zinsen dazu.
Alles unterschrieb der Geiger, gab sich ganz in die Hände des Syndikats. Und nur um eines kämpfte er und nur eines setzte er durch: wo es sich handelte um ein Konzert für Österreich, für Deutschland oder Ungarn – da durfte er mitwirken, durfte umsonst spielen.
Und da spielte er, freier noch, herrlicher noch wie sonst, wuchs hoch hinaus über sich, gab seine ganze große Künstlerseele. Wie er sein Blut gegeben hatte und sein Gold.
Das war das letzte, war das einzige, das ihm noch blieb – und er gab es – immer wieder und wieder.
– Jetzt schwiegen sie unten, als er die Fiedel ansetzte.
Und er spielte. Spielte: »Gott erhalte –«
Die gewaltige Hymne aller Deutschen und Österreicher. Abgeschrien, abgeleiert, jeden Tag und jede Stunde, zur billigsten Münze geworden in jeder letzten Silbe. Und doch von ihm, ohne alle Worte, emporgehoben über alles Irdische, weit hinaus getragen in die blauen Sphären – über die Zeit.
Kein Fiedeln war es, kein Singen seiner süßen Geige. War ein ewiges, unendliches Gebet.
– Keiner wagte zu klatschen. Sie saßen da, still und stumm – weinten, weinten.
* * *
Eine sang. Frank Braun sprach. Die kleine Herma Lindt, – Wienerin, braune Samtaugen, braunes Samtkleid – saß wie ein Bub am Flügel, spielte den Donauwalzer –
Was war das alles? Nach dieser Geige Gebet!
Langsam ging er aus dem Saal hinaus. – Zwei Frauen kamen vorbei – rothaarig, in Stahlblau und Nilgrün.
Lotte van Neß wars mit einer ihrer Damen. Er folgte ihnen, sah, wie sie in das türkische Kaffeezelt traten. Wartete ein wenig, schlich vorbei, setzte sich, etwas entfernt, an einen Tisch.
Sie sahen ihn nicht, sprachen miteinander, tranken ihren Kaffee, kauften von jedem, der vorüberkam.
Er starrte hinüber –
Dann kam Dr. Cohn, setzte sich zu ihm, stürzte schnaufend ein großes Glas Wasser hinunter.
»Was haben Sie denn da eingekauft?« fragte er. »Ihr Frackschoß hängt herunter wie ein Mehlsack.«
Der Arzt zog mühsam einen schwarzen Kasten aus der Tasche. »Das?!« rief er. »Ach, das schleppe ich nun schon vier Tage mit mir herum. Ich habs Frau van Neß mitgebracht und vergesse es immer wieder!«
Er legte den Kasten auf den Tisch. »Was ists denn?« fragte Frank Braun. »Darf man sehn?«
Dr. Cohn öffnete den Kasten. »Ein Bistouri,« rief er, »ein sehr hübsches dazu – nirgends in der Welt bekommen Sie etwas, das besser schneidet.«
Frank Braun sah hin – ein vollständiges, medizinisches Besteck lag vor ihm. »Was will denn Frau van Neß damit?« forschte er.
»Berufsgeheimnis!« lachte der Arzt. »Aber Ihnen kann ichs ja sagen – sie braucht es für ihre Hühneraugen, Verehrtester!«
Frank Braun rief: »Aber Lo –« Er zerbiß das Wort in der Mitte. Starrte wie gebannt auf die blanken Messer. O, er kannte sie gut, ihre weißen, gepflegten Füße. Ringe trug sie auf den Zehen, viele bunte Steine, wenn es so ihre Laune war –
Aber Hühneraugen?! Lächerlich! – Sie, Lotte Lewi!
Der Arzt klappte seinen Kasten zu, reichte ihn ihm hinüber. »Tun Sie mir den Gefallen, geben Sies ihr, wenn Sie sie sehn. Sonst vergeß ichs heute zum fünften Male.«
»Geben Sies ihr selbst,« gab er zurück. »Da sitzt sie – nein, eben steht sie auf, zahlt grade. Nun kommt sie her.«
Dr. Cohn sprang auf. »Das trifft sich, gnädige Frau! Hier ist Ihr Bistouri.«
Sie nahm den Kasten, seufzte leicht auf, lächelte. »Ein wenig spät, lieber Doktor. Wer weiß, ob ich es je noch brauchen kann.« Sie wandte sich ihrer Freundin zu. »Darf ich Ihnen unsern Präsidenten vorstellen? – Dr. Cohn!«
Die beiden begrüßten einander, reichten sich die Hände, gingen langsam weiter.
Und Lotte setzte sich still an seinen Tisch, ohne ein Wort. Stellte den Kasten vor sich hin.
Keines sprach. Das Lächeln fror ein auf ihren Lippen, schlohweiß lagen ihre Hände über dem schwarzen Kasten, wie die eines Marmorbildes.
›Eine Tote,‹ dachte er, ›eine Tote.‹ Und er fühlte: so lieb hatte er sie, so sehr lieb.
Etwas krampfte sich ihm in der Brust. Tränen stiegen ihm in die Augen, tropften hinaus, liefen über die Wangen, still, langsam. Unaufhörlich doch. So lieb hatte er sie, so sehr lieb –
Sie stand auf. Strich leise über seine Stirn mit der kühlen Hand. »Leb wohl,« sprach sie. Wandte sich.
Da fiel sein Blick auf den Kasten. »Du vergißt dein Bistouri!« rief er.
Sie nickte, dankte. Nahm es.
»Später vielleicht –« sagte sie.
Ging dann –
* * *
Er nahm sein Tuch, wischte das Gesicht. Schlürfte den dicken, süßen Kaffee.
Nun sah er sie nicht mehr. Nun konnte er klarer denken.
Messerchen, viele gute Messerchen, blank und scharf. Die besten der Welt – zum Stechen und Schneiden!
Zum Hühneraugenschneiden hatte sie dem Arzte gesagt – sie, die ihr Lebtag nie eins hatte!
Wozu wollte sie das Besteck?
Und was hatte sie dem Arzt geantwortet – was denn? Zu spät sei es nun –
Er lachte hell auf. Zu spät! – Zu spät? Weil an diesem selben Tage die kleine Ivy Jefferson –?
O gewiß – die hatte den Hampelmann gekauft! Ihn!
Er rieb sich die Augen, starrte auf den Tisch. Für ihn hatte sie das Bistouri verlangt – da war kein Zweifel mehr! Hatte er nicht oft auf ihrem Nachttische solche Messerchen liegen sehn?
Und das kleine, blanke – das sie ihm mitgab nach Mexiko?
Das blutig war an dem Tage des Mescalrausches?
Da schlief er fest auf seinem Diwan, träumte absurde Träume. Aber das Messerchen ward blutig!
Was sagte die blonde Ivy? – Wie und was – das wisse sie nicht. Aber wann – ja! Wenn er schliefe bei ihr – dann!
Und hatte Lotte nicht die Tänzerin gleich mitgenommen in ihr Haus? Warum denn? Tat die, was ihr Lotte van Neß befahl – während er schlief? War sie ihr Werkzeug nur?
Wozu –?
Einerlei – was es auch war! Dies eine stand sicher fest: etwas war geschehn mit ihn – und war wieder geschehn – während er schlief! Und es hing irgendwie zusammen mit kleinen scharfen Messerchen – und mit rotem Blut. Und nicht minder mit dieser merkwürdigen Krankheit, die ihn immer wieder anfiel, diesem schleichenden Leiden, über das alle Ärzte unwissend den Kopf schüttelten. Das ihn aussaugte und leertrank!
Sie trank ihn aus – sie, Lotte Lewi, seine Geliebte!
So lieb hatte er sie – und nie fühlte er es so wie grade jetzt. So lieb hatte er sie – ah, er wollte das alles nicht glauben –
Und doch mußte es so sein – es war nicht möglich anders.
* * *
Er stand auf, trat noch einmal an die Galerie. Da stand sie in ihrer Bude mit ihren drei Damen – nilgrün die Tücher über milchigem Stahlblau. Und das Rot der Haare – welch ein Klang! – Holzpferdchen verkaufte sie, bunte Kühe, Puppenküchen, Kanonen, die mit Erbsen schossen. Keine Hampelmänner? – Nein, er sah keine mehr in ihrem Stand. Ausverkauft!
Er stieg die Treppe hinab in den Riesensaal, ließ sich schieben, wie ihn der Menschenstrom führte. Eine Hand legte sich auf seinen Arm – es war die Präsidentin.
»Führen Sie mich,« sagte sie, »ich muß zum Journalhaus.«
»Wo ist das?« fragte er.
Sie wies auf den breiten Weg, der sanft hinunterführte. »Dorthin – im Untergrundstock.«
Sie stützte sich fest auf ihn, er merkte gut, daß nur ein starker Wille diese Frau aufrechthielt. Durch manche Monate vorbereitende Arbeiten Tag um Tag, immer in Frauenvereinen, achtzig und mehr. Immer lächeln, immer freundlich sein, ach so liebenswürdig – nur so ging es! Und hier nun, zwölf Stunden am Tage, treppauf und treppab –
Ihre guten Augen irrten über die Menge. »Es ist eine hohe Ehre, Präsidentin zu sein,« sagte sie. »Aber glauben Sie mir, Doktor, es ist nicht so leicht.«
Er nickte. O nein, es war nicht so leicht, für Deutschland zu arbeiten in diesem Lande, das wußte er gut. Drückend wob sich die stickige Ausdünstung der Zehntausende durch die Räume, drang in Mund und Nasen, dieser dicke Dunst aus Schweiß und Staub.
›Die Masse frißt uns ein,‹ dachte er, ›die Masse verdaut uns. Nur Nährstoff sind wir und sonst nichts. Und wir rühren uns nicht – werden nur bewegt: peristaltisch.‹
– Sie waren im untern Stockwerk, das unter der Straße lag. Da war der mächtige Jahrmarktsrummel. Puppentheater und Ringelspiele, Schießbuden, große Bierzelte. In langen Reihen die Stände der Seeleute: Raritätenkabinette, Kasperltheater, Buden, in denen man ›Dicke Berthas‹ bewundern konnte, Unterseeboote, Zeppeline und Äroplane aller Arten. Hölzerne Rolande und Hindenburge zum Benageln, Buden mit Seeschlangen und Meerweibchen, Affentheater und Flohzirkusse: deutsche Kirmeß! Verschwiegene Weinzelte – denen geschickte Schiffsingenieure auf unbegreiflicher Weise sogar ein wenig Ventilation verschafft hatten, Pfefferkuchenstände, Kegelbahnen, Kaffeehäuser mit holländischen Waffeln, Wiener Kipfeln und Berliner Pfannekuchen.
Sie kamen zu dem Hause, das das »Deutsche Journal« gestiftet hatte. Hier wars aufgebaut und völlig eingerichtet – man konnte es gewinnen auf ein Dollarlos. Und natürlich den Grund und Boden dazu – der lag drüben an der Neujersey-Küste.
Die Frau Präsidentin machte ihren Besuch. Und die Damen und Herren der Redaktion eilten heraus, sie zu empfangen –
* * *
Er ging allein weiter. Trat ein in den hübschen Biedermeier-Garten, den die Breitauer führte.
Hier gabs nur Sekt und nichts sonst. Da saßen die Honoratioren und die sehr Reichen, das Volk drängte vorbei, blieb neugierig stehn an der Rosenhecke – flüsterte, zeigte mit den Fingern hinein: ›Sieh, da sitzt der –!‹
Aimée Breitauer stand in der Mitte unter dem Lindenbaum. Sie spielte die Wirtin, und ihr Kostüm war echt, wie das ihrer zwölf Schenkdamen.
Der Botschafter saß da, drückte sich bescheiden in eine Ecke. Aber draußen, hinter der Rosenhecke, hatte ihn doch einer erspäht.
»Da sitzt der Graf!« schrie er.
Der Graf – das war Deutschlands Symbol in diesem Lande. Das war des Kaisers Gesandter und des Kaisers Freund, das war die Heimat, war Deutschland selbst.
»Hoch!« schrien sie. »Hoch und hoch!« Ließen Deutschland leben und den Kaiser und den Grafen. Sangen die ›Wacht am Rhein‹, sangen ›Deutschland über alles‹ und das Preußenlied. Gaben nicht nach, bis er auf den Stuhl stieg und eine Ansprache hielt.
Jubelten wieder und jauchzten.
– Neben ihm zischte es: »Es ist eine Schande, wie ers treibt!«
Frank Braun wandte sich um. Eine Frau von reifer, üppiger Schönheit – ah, die Thistlehill wars.
»Was ist eine Schande?« fragte er.
»Sehn Sie doch,« zischte sie, »da sitzt sie wieder an seinem Tisch. Überall schleppt Euer Botschafter sie mit sich herum, seine Mätresse, die Black. Dies Miststück – das sich mit Brillanten behängt, seit sie einen Millionär geheiratet hat! Eine Dirne ist sie – haben Sie noch nicht mit ihr geschlafen, nein? Mein Mann hat sie gehabt, jeder hat sie gehabt hier im Garten!«
Sie schrie es heraus, daß man es möglichst weit hören sollte durch den Lärm.
»Schweigen Sie doch!« fuhr er sie an.
Aber Aimée Breitauer drehte sich um, klopfte ihr gemütlich auf die nackte Schulter. »Nun, nun,« lachte sie, »und dich vielleicht nicht, Kindchen? Warum denn eifersüchtig?!«
Sie ließ sie stehn, wandte sich zu Frank Braun: »Nun, wie gefällt dir mein Kleid?«
Er beschaute sie von oben bis unten. »Der Teufel mag wissen, wie dus anstellst, Aimée! Die älteste deiner Damen ist zehn Jahre jünger als du – und du siehst zehn Jahre jünger aus als die jüngste. Und dein Kleid – gib deiner Schneiderin einen Kuß von mir!«
Sie lehnte sich an ihn, sagte: »Es ist sehr bequem, mein Kleid – und es hat ein Geheimnis!«
»Schon wieder eins?« lachte er. »Es scheint, daß alle deine Kleider Geheimnisse haben – die freilich immer nur die Bequemlichkeitsfrage lösen. Aber was, Aimée, kannst du hier anfangen – mit bequemen Kleidern?!«
Sie zwinkerte ihm zu. »Komm mit,« flüsterte sie, »ich will dir was zeigen.«
Sie zog ihn hinter den kleinen Springbrunn, der über Schwertlilien sprang. Vorbei an einer kleinen Jasminlaube, deutete mit der Hand auf die Gaisblattwand.
»Siehst du was?« fragte sie. »Nein, nein, natürlich nicht. Keiner kanns sehn. Mein Gärtner ist so geschickt wie meine Schneiderin.« Sie nahm seine Hand, führte sie hinein in das grüne Laub. »Faß zu!« rief sie. »Zieh hoch – aber vorsichtig!«
Er fühlte eine Klinke in der Hand, zog sie langsam auf. Da öffnete sich leise eine schmale Tür.
»Genug!« flüsterte sie. »Schau durch den Spalt.«
Er lugte hindurch, wie sie verlangte.
Ein kleines Zimmer. Teppiche auf dem Boden – Spiegel rings an den Wänden. In einer Ecke ein kleiner Lederkoffer, ein paar Hocker noch. Auf dem schmalen Diwan saß sein Sekretär, Ernst Rossius. Vornübergebeugt, schreibend.
Sehr behutsam schloß sie die Tür. »Ich hab ihn eingesperrt,« lachte sie, »er muß mir ein Gedicht machen. Da ist er gut verwahrt, bis ich Zeit finde, mein Dessert zu essen. Ich freu mich schon drauf – es ist ein netter Junge!«