
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
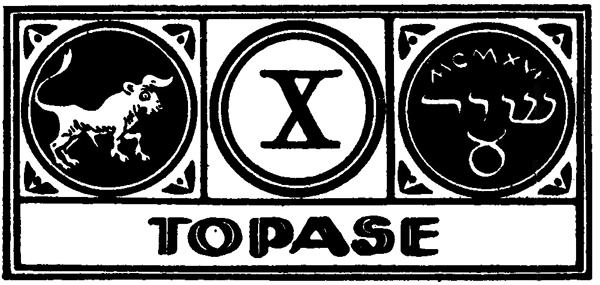
»Col favor della musa o del Demonio
Entro e mi caccio in mezzo al Pandemonio.«
Gius. Giusti.
Manche, die an den Augen leiden, können wohl sehen, aber nicht erkennen, denn ein milchiger Ausfluß trübt den klaren Blick. Diesen Ausfluß aus den Augen aber hemmt der Topas. Und darum ist er des Matthäus Stein, denn dem ward gegeben zu erleuchten seine Gemeinde, deren Herz verdunkelt ward, und zu heilen die, welche Augen haben zu sehen und sehen nicht.«
Andreas, Bischof von Cäsarea (X. Jahrh.)
Drei saßen vor ihm, zwei Männer und eine Frau.
Paul Conchas, der stärkste Mann der Welt, Kanonenkönig, seit einem Vierteljahrhundert berühmt auf allen Varietés der Welt. Fünfzig bald, doch gewachsen wie der junge Mars – auf dem Vorhang der Dresdener Hofoper mag die Nachwelt seine Beine bewundern. Neben ihm sein Clown Fritz Neuhof aus Berlin, häßlich und grotesk – der den Athleten begleitete durch die Welt, die Pausen ausfüllte mit bizarren Scherzen, während sich der andere verschnaufte. Und eine Frau – schwedisch, schlank und blond.
»Haben Sie die Adressen aufgeschrieben?« fragte Frank Braun.
Sein Sekretär kam herüber. »Hier sind sie.«
Frank Braun reichte das Blatt dem Athleten. »Hier sind sie,« wiederholte er. »Wenn Sies riskieren wollen –«
»Aber klar!« sagte Conchas. »Nächste Woche schwimmt sie.«
»Wann war die Gerichtsverhandlung gegen Ihre Freundin?« fragte Frank Braun. »Was bekam sie?«
»Dreitausend Dollar Geldstrafe – vorgestern – es ist ein Wunder, daß die Schweine sie nicht eingesperrt haben!« antwortete der Artist.
»Ich werde sehen, daß ich das Geld für Sie auftreibe,« sagte er. »Wieviel brauchen Sie für die neue Sache?«
Paul Conchas erwiderte: »Nichts. Lassen Sie nur. Ich zahle alles schon selbst, das ist einfacher. Meine beiden Jungs sind an der Front drüben – die tun mehr als ich.«
Es galt wieder einmal den Versuch, Gummi hinüberzuschaffen – an dem es so sehr mangelte in Deutschland. Viermal schon war auf norwegischem Dampfer Anna Bergen hinübergefahren, des Kanonenkönigs Freundin, nun beim fünften Male war es mißglückt. Die amerikanischen Zollbehörden hatten vor der Abfahrt ihr Gepäck untersucht – zwanzig große Koffer – hatten den Gummi gefunden und sie festgenommen. Die Yankees ließen alle Ware nur heraus, wenn sie richtig deklariert war, aber sie gaben dann sofort den englischen Herrn Bescheid, die sie prompt herunterholten in Kirkwall. Deklarierte man aber die Ware nicht – so verging man sich gegen die Gesetze der Staaten, war ein Urkundenfälscher und wurde eingesperrt. Nicht ein Tag verging, ohne daß die Gerichte – zum höheren Ruhme Englands – Deutsche ins Gefängnis und Zuchthaus steckten.
»Mir wundert man bloß, daß ein Deutscher in dem Land noch spucken darf!« rief Neuhof.
Frank Braun wandte sich an die blonde Frau. »Wissen Sie, daß Sie diesmal bestimmt eingesteckt werden, wenn die Geschichte herauskommt?« fragte er. »Wollen Sie doch fahren?«
Die Schwedin nickte. »Ich weiß. – Ich fahre.«
»Natierlich fährt se!« rief der Berliner. »Wat den Paul seine Anna jekonnt hat, kann die Karin schon lange! Da kann se mal richtig zeigen, det se Sympathie fier Deutschland hat – det is bessa, als blos Stanniol sammeln.«
Der Sekretär sagte: »Wir haben auch noch was für Sie.« Er brachte ein Zigarrenkästchen heran, bis oben hin gefüllt mit flachgestrichenem Stanniolpapier.
»Wird akzeptiert mit bestem Dank von die Witwen und Waisen!« sagte Neuhof. »Wat jlauben Se – von unsa letzte Tournee haben wir eene janze kleene Tonne mitjebracht. Beinah siebzig Kilo.«
Das war ein Gedanke der deutschen Artisten, Stanniol zu sammeln von den Zigaretten, Zigarren, Bonbons und Schokoladen. Das Völkchen vom Varieté und vom Vaudeville, alle die Fratelli Salvini, Sisters Harrison, die Valière, Dixon, Korsakoff, die Parterreakrobaten, Tänzerinnen, Kraftmenschen, Trapezkünstler, die mit ihren guten deutschen Namen Huber und Maier und Klein und Schulze hießen, sie sammelten Stanniol. Schleppten es zusammen aus allen Städten des Landes, klaubten es auf in Lokalen und auf den Straßen, bettelten es jedem ab, der ein Stückchen hatte. Trugen es hin nach Neuyork, da kam es an die große Sammelstelle an Bord der ›Vaterland‹. O nein, es machte nicht viel aus, brachte nur achtundsechzig Cent fürs Pfund – und es war erstaunlich, wieviele der kleinen Papierchen auf ein Pfund gingen. Aber dennoch verdienten sie jeden Monat ein paar hundert Dollar fürs Rote Kreuz damit. Und dann – die Freude der Arbeit: immer, den ganzen Tag über und bis spät in die Nacht, wenn sie vor dem Schlafen ihr Stanniol glätteten, dachten sie an die Heimat, der sie halfen.
Ernst Rossius legte die Zeitungen auf den Tisch, die eben der alte Diener brachte.
»Neues Geschwätz über Friedensgerüchte,« sagte er.
»Wenns nur wahr wäre!« rief der Kanonenmann. »Jetzt wäre der gute Augenblick. – Im Osten stehen wir tief in Rußland, halten im Westen Belgien und Nordfrankreich, im Süden Serbien, Montenegro, Albanien. Die Engländer sind in Mesopotamien zurückgetrieben, haben die Dardanellen räumen müssen, werden im Sudan bedrängt und haben in Irland einen hübschen Hexenkessel. Die Mohammedaner haben die Katzelmacher aus Tripolis hinausgejagt, die Österreicher haben das Trentino reingefegt und brechen in Italien ein. Der Kronprinz schiebt sich in jeder Nacht näher heran an Verdun. Und immer halten wir uns in Afrika. Jetzt wäre der Augenblick da, jetzt!« Seine Stimme hob sich, die Augen leuchteten. Aber dann schlug er mit der Faust auf den Tisch, seufzte tief auf. »Und ich wette – es wird nichts daraus! Unsere Prachtjungen mögen zu Millionen ihr Blut verspritzen – das idiotische Gesindel, das bei uns Diplomatie spielt – wird sicher den rechten Moment verpassen. Und wenn sie auch Frieden machen würden – so würde es doch nur erbärmliche Flickarbeit werden. Serbien, Montenegro würden wiederhergestellt – die Belgier bekämen ihr Land zurück –«
Da sprang der Berliner auf. »Wat?« schrie er. »Jarnischt kriegen se! Det bißchen, wat se noch haben, det kenn se behalten! – Da kenn se Bollen druff ziehn, damit se weenen kennen!«
»Ja, wenn du Reichskanzler wärst!« rief Paul Conchas. »Aber so geben wir nicht nur alles zurück, wir zahlen noch zu obendrein: alle unsere Kolonien, dann Südtirol, Elsaß und Lothringen, Istrien, Triest, Dalmatien, Galizien, die Bukowina, unsere polnischen Fetzen – viel mehr noch, warts nur ab, Junge! – Aufhängen lassen sollte der Kaiser unser ganzes elendes Diplomatenpack, das sich seit zwanzig Jahren überall in der Welt um den Löffel balbieren läßt.«
»Det wird er ooch machen!« schrie Neuhof. »Paß nur mal uff! Ick bin en Sozialdemokrat – wähle nur Fritze Zubeil, wenn ick jerade mal bei Muttern bin. Aber dem Kaiser jebe ick allen Kredit! Herr Jott – wenn man weeß – wat se mit den forn Jeschrei jemacht haben überall in alle fünf Erdteile, wo wir nur hinjekommen sind, all die Zeit ieber! Man hätte schwören mögen, det er der beliebteste Mann wäre in der janzen Welt! – Und nu? Nu malen sen jeden Tag in die Blätter als eene Art Mißjeburt zwischen Varrickten und Schwervabrecher, eener von den man nich weiß, ob er aus em Zuchthaus oder em Irrenhaus ausjewischt is! Und nennen ihn in ihre Unterschriften nur nen lausigen Affen, tollen Hund, Massenmörder, Säuglingsschlächter und lauter sone liebliche Beiwörter. – Und det allens nur, weil der Mann det schaißliche Pech hat, ausjerechnet en Deutscher zu sein. Wenn ick nur wißte, wat wir se eijentlich alle jetan haben.«
»Neidisch sind sie auf uns,« rief Paul Conchas. »Weil wir bessere Köpfe haben, weil wir fleißig sind und arbeiten können. Was ist denn das ganze sogenannte internationale Artistentum? Deutsch alles, was nur einigermaßen 'ne Nummer ist. Und so ists bei den Kaufleuten, Ingenieuren, Chemikern, beim Militär, der Marine, der Industrie, der Verwaltung und der Kunst – wir sind an der Spitze – überall. Nur die Politik: da gibts keine größeren Esel, als wir sie hinausschicken. Hol mich der Henker – der Kaiser sollte –«
Aber der Berliner unterbrach ihn. »Reg dir bloß nich uff, Paule, sonst ärjert dir wieder dein Magen, vastehste! Un denn biste so unjenießbar, wie det Bier, det se uns jetzt hier als Pilsner andrehn wollen.« Er sprang auf, streckte Frank Braun die Hand hinüber. »Verlassen Se sich auf uns, Doktor, die Sache wird jemacht. Un scheenen Dank ooch für det Silberpapier.«
Frank Braun geleitete sie zur Türe, kam zurück. »Noch jemand da?« fragte er.
Der Sekretär nickte. »Einer wartet noch, ich werde ihn gleich hereinholen.«
Frank Braun setzte sich, stützte die Arme auf, ließ den Kopf schwer auf den Tisch fallen. So jammervoll müde war er heute, so elend leer und ausgesogen. ›Ich bin kein Mensch mehr,‹ dachte er. ›Eine aufgeblasene Schweinsblase bin ich. Ich tue dick und groß, mache schönen Lärm, wo ich aufschlage. Und bin hohl, leer, so leer –‹
Sehr abgerissen sah der Mann aus, den Rossius hereinführte. Pockennarbig, stiernackig, fast ohne Hals. Krummbeinig dazu, angeklebt die schmalzigen, schwarzen Haare. Und er roch nach Stall und nach Whisky. Er grüßte nicht, kam gleich auf ihn zu, unsicher und scheu. Hielt ihm eine schmutzige Karte hin.
Tewes' Visitenkarte. ›Vielleicht können Sie dem Mann helfen,‹ stand darauf.
»Nehmen Sie Platz,« sagte er. »Was wünschen Sie?«
Aber der Mann setzte sich nicht. Er drehte seine Mütze in der Hand. »Ich bin Deserteur,« sagte er dann. »Si vous voulez mich outkicken, tun Sies de seguido.«
Frank Braun legte die Karte vor sich auf den Tisch. »Wenn der Herr Sie zu mir schickt, hats schon seinen Grund,« sagte er. »Erzählen Sie – wann kamen Sie herüber – und wie?«
»Nicht heuer – sure!« antwortete der Mann. »Hay doce años, daß ich gemuhvt bin.«
Vor zwölf Jahren – vom Ulanenregiment aus St. Avold, dicht an der Grenze. Mit zwei andern zugleich, die ihm vorerzählt hatten, wie dumm das alles sei. Daß es doch keinen Krieg mehr geben würde in diesem zwanzigsten Jahrhundert in Europa, und daß die Heere nur da seien, um das Volk niederzuhalten und zu nichts sonst. – Aber nach vierzehn Tagen schon stak er wieder in einer neuen Uniform, war Fremdenlegionär geworden in einer wilden Rauschnacht, wachte erst wieder auf in dem Zuge, der ihn nach Marseille brachte. Zwei Jahre lang trug er den Tornister in Algerien, bis er Gelegenheit fand, von neuem zu desertieren; er entwich nach Marokko, kam nach Spanien und endlich hinüber nach Argentinien. War dort Pferdeknecht auf einem Rancho. Dann, als der Krieg ausbrach, litt es ihn nicht mehr in der Pampa, er verdang sich in Buenos Aires als Heizer, auf einem Dampfer, der hinauffuhr nach Neuyork.
»Und nun sitzen Sie hier fest – und kommen nicht rüber, was?« fragte Frank Braun. Diese Geschichte war ihm nicht neu, die hatte er schon manchmal gehört – so oder anders. Von allen Weltteilen waren sie zusammengeströmt nach Neuyork, von Ostasien und allen Ländern Amerikas, von Australien und den Inseln des Pazifik. Von Afrika auch, von Spanien und Portugal, von England selbst. Und saßen hier fest – kamen nicht weiter – dafür sorgte der Yankee. Selbst die Sprache des Mannes kannte er, dieses eigentümlich steife Deutsch, bunt durchsetzt mit spanischen, englischen, französischen Brocken.
»Nicht rüber, Señor?« rief der Schwarze. »Ich war déjà thrice in Europe in diesem Jahr. Nur nach Deutschland – that can't be done, vamos!«
Pferdeknecht war er sein ganzes Leben lang. Im Stalle aufgewachsen auf einem fränkischen Rittergut. Später Ulan, in der Legion Bursche beim Regimentsarzt, dessen Pferde er zu warten hatte, und durch all die Jahre nun Gaucho in der Pampa. Dann, in Neuyork, als er nach wochenlangem Herumlaufen sah, daß es keine Möglichkeit gab, nach Deutschland zu kommen, faßte er den Entschluß, Krieg zu führen auf eigene Faust. Pferdeknechte – das war es, was man brauchte in dieser Zeit, Wärter für die ungeheuren Transporte von Gäulen und Maultieren, die nach England, Frankreich, Italien gingen. Nur der letzte Auswurf fand sich dazu bereit, da konnte man nicht lange nach Ausweisen und Papieren fragen. Und er, schwarz und sonnverbrannt, mit seinem unmöglichen Sprachgemisch, konnte dem Engländer als Franzose, diesem als Spanier gelten. Da fand er bald seinen Platz, fuhr mit einem Transport nach Cherbourg, mit dem zweiten nach Saloniki.
Ernst Rossius fuhr ihn an: »Also Pferde haben Sie unsern Feinden auch noch gebracht?!«
Da grinste der Mann, wiegte sich auf den krummen Beinen. Sein Maul zog sich zu einem langen Lachen, zeigte zwischen häßlichen Lücken ein paar schwarze Zahnstummel. Er legte die Mütze auf den Tisch, wandte sich an den Sekretär.
Viel Freude hätten die Alliierten an diesen Pferden nicht gehabt. Ob er wisse, was Mallëin sei? Nein? Nun, das sei der Bazillenkram, der die Rotzkrankheit übertrage. Woher er es bekommen habe? In Neuyork bekomme man alles für Geld. Und das Zeug habe er den Tieren in die Nüstern geschmiert, jedem einzelnen – ach, er hoffe, daß sie noch manches andere angesteckt hätten.
Nun, beim dritten Male hatten sie ihn ertappt. Er sollte Pferde begleiten – nach Portsmouth diesmal – zweitausend Stück. Da mußte er früh anfangen mit der Arbeit, schon im Neuyorker Hafen. Siebenundzwanzig Tiere hatte er schon vergiftet, als ihn der kanadische Offizier abfaßte. Er floh, sprang die Treppen hinauf auf Deck, und der andere ihm nach. Der schoß, traf ihn in den linken Unterarm, dicht über der Hand – ach, nur ein Streifschuß, eine Fleischwunde und nichts mehr. Er sprang über Bord, schwamm durch den Hafen, rettete sich an Land.
»Wann geschah das?« fragte Frank Braun.
Heute nacht. Aber es sei noch nicht alles. Er sei herumgelaufen, bis seine Kleider getrocknet seien, habe vorher den blutenden Arm abgewaschen, verbunden mit seinem Taschentuch. Und dies Tuch sei wohl schmutzig gewesen, in Berührung gekommen mit dem Rotzgifte. Nun –
Er streifte mühsam den Ärmel zurück, zeigte seinen Arm. Bläulichrot, grüngrau bis zum tiefen Schwarz schien das gräßlich aufgeschwollene Fleisch, strahlenförmig zogen sich von der kleinen Wunde dicke blaue Lymphstränge nach allen Seiten.
Darum sei er hier. Zu einem beliebigen Arzt könne er nicht – der würde ihn sofort verhaften lassen. Und es sei höchste Zeit – er kenne das. Einem Gehilfen des Regimentsarztes in Sidi bel Abbas sei es passiert – der sei eingegangen, trotz aller Hilfe, nach wenigen Wochen.
Frank Braun überlegte ein paar Augenblicke, ging dann zum Telephon. Sprach lange, setzte sich wieder, schrieb eine Adresse auf. Gab das Zettelchen seinem Sekretär.
»Nehmen Sie ein Taxicab,« sagte er, »bringen Sie den Mann dorthin.« Er wandte sich an den Pferdeknecht. »Der Arzt ist ein Jude. Geben Sie beliebigen Namen und Adresse an; sonst wird er Sie nach nichts fragen. Er wird Sie in seiner Klinik behalten, bis Sie wieder gesund sind.«
»Well, nous verrons, carajo!« sagte der Mann. »Là, der Arm muß runter, dann could I be saved – peutêtre! Vamos! Um mich wär es nicht schade – je m'en fiche – wenn ich nur den Franzosen und Englischen noch ein few tausend potros verpoisenen könnte! Hasto luego, Monsieur – darf ich noch eine favor asken? Là, im Rock eingenäht sind meine Ersparnisse, mas als five hundert Dollars. Pagen Sie le Docteur damit, wenn er den dinero will – nicht das entierro, da whistle ich drauf – und le reste geben Sie dem Roten Kreuz! Für den Fall, daß ich deie – bien compris! Au revoir, Caballero – und munchisimas gracias!«
Frank Braun wollte aufstehn, dem Pferdemann die Hand zu reichen. Aber seine Beine zitterten, er sank zurück in seinen Stuhl. »Entschuldigen Sie bitte,« sagte er, »ich bin auch nicht ganz wohl.«
Der Sekretär sprang zu ihm hin, griff ihn unter die Schultern. »Kommen Sie zum Sofa, Doktor, strecken Sie sich ein wenig aus.«
Er wies die Hilfe zurück. Richtete sich allein auf, mit großer Willensanstrengung. Zog sich hoch am Tische, faßte die Stuhllehne, schwankte zum Diwan.
»Soll ich Fred Bescheid sagen, daß er Ihnen was zum Luncheon besorgt?« fragte Rossius. »Nein? So ruhn Sie sich aus, Doktor, bleiben Sie still liegen ein paar Stunden. Vergessen Sie nicht, daß Sie heute abend im Kaufmännischen Verein sprechen sollen, da müssen Sie wieder frisch sein. Ich komme um neun Uhr, Sie abzuholen.«
Er warf ihm eine schwere Decke über, rückte ein Tabouret heran. Holte ein Glas Wasser und stellte es hin, legte daneben die kleine Schachtel mit den Strychninpillen. »Vielleicht wollen Sie eine nehmen,« meinte er. »Manchmal hats etwas geholfen.«
Frank Braun nickte. Er wollte ihm sagen, daß er das Telephon abstellen solle, aber er konnte die Lippen nicht voneinander bringen: es war ihm, als ob sein Hirn nicht mehr imstande sei, einen Befehl auszugeben. Und er dachte, es sei schon gleich, denn seine Glieder würden ja doch die Order nicht ausführen können.
Er hörte die beiden gehn, hörte eine Türe öffnen und schließen. Und noch eine –
* * *
Nun war es still. Ihn fror, die Zähne schlugen aufeinander, klapperten. Er wollte sie fest aneinander pressen, das ging nicht. Dann versuchte er einen Rhythmus herauszuhören, aber es war keiner da, das klappte, klapperte, schneller und langsamer, setzte aus und begann wieder. Er wollte einen Schluck Wasser nehmen, aber konnte den Arm nicht ausstrecken.
Das Telephon klingelte, schrie. Wieder und noch einmal. Bohrte sich in seine Ohren, heulte grausam in sein Hirn. Er zog die Decke hoch, barg den Kopf hinein, steckte die Finger in die Ohrhöhlen. Aber es half nichts. Das schellte, bellte und gellte, gab nicht Ruhe, schlug ihn mit tausend sägenden Messern. Riß ihn hoch.
Er stand auf den Beinen, taumelte durch das Zimmer, fiel auf den Sessel, griff das Hörrohr. Lotte – ja! Warum er sie habe warten lassen? – Er habe das Schellen nicht gehört. – Aber seit einer Viertelstunde – Nein, nein, er habe es wirklich nicht gehört – Aber – Nein – nichts! – Seine Hand zitterte, seine Stimme weinte.
Ob er krank sei? Nein! – Doch, doch, sie höre es! – Ja also – ein bißchen nur. – Sie sei noch draußen in Atlantic City – sie würde den nächsten Zug nehmen, zur Stadt fahren. Ob er spreche, heute abend? – Ja, er würde sprechen. – Dann erwarte sie ihn zum Tee. – Ja, ja, er würde schon kommen.
Er hing das Höhrrohr ein, ein kalter Schweiß brach ihm aus allen Poren. Er ließ die Arme lang herunterhängen, den Kopf auf die Brust fallen. Er fühlte: jetzt würde er hinuntersinken von dem Stuhle. Dann würde er am Boden liegen, würde vergessen, nichts mehr wissen –
Wieder war es ein Geräusch, das ihn hielt. Ein Türöffnen, ein leises Schreiten –
Er sah Fred, den alten Diener vor sich stehn, stumm, gefühllos. Er wollte ihn bitten, anflehen, ihm zu helfen, ihn zu Bett zu führen –
Den? Ja, was denn – den – Warum war er nur da? Hatte er ihm geschellt?
Er sagte: »Mach mir ein Bad! Heiß, sehr heiß.«
Er lächelte. Warum denn ein Bad? O, irgend etwas – es war gleich. Nur ein Befehl für diesen Holzbesen – um ihn fortzuhaben.
Fred sagte: »Ja, Herr.« Er ging durch das Zimmer, nahm einen silbernen Teller vom Gesims, legte eine Karte darauf. Kam zurück, reichte ihm die Karte. »Diese Dame wünscht Sie zu sehn.«
Er nahm die Karte, warf einen Blick hin – aber er konnte die Buchstaben nicht lesen. Er hörte die Blechstimme: ›Eine Dame –‹ Aber er wußte nicht, was das sollte.
Er dachte: ›Geh, du Tier, geh. Warum quälst du mich?‹
Und er nickte. Sagte: »Ja.« Murmelte er: »Mein Bad –«
Er sah den Alten gehn, hörte wieder die Schritte auf den Teppichen. Dann ein Sprechen – und wieder Schritte. Eine Frau stand vor ihm, tief verschleiert.
»Wer bist du?'« flüsterte er. Er dachte: ›Lotte. – Und warum wieder der schwarze Schleier? Dein Mann ist lange tot, dein Vater auch –‹
Um wen trug sie Trauer?
Um ihn –? Aber er lebte doch – noch lebte er ja.
»Wer bist du?« flüsterte er wieder. Nun hörte er ihre Stimme. Was sagte sie nur –?
Spanisch – ja! Sie schlug den Schleier zurück. Jetzt sah er sie gut. Die Tänzerin, die Goyita – Dolores Echevarria. Die dunklen Saphire ihrer Augen leuchteten.
Ob er krank sei? fragte sie. Er nickte; ja, ein wenig; müde sei er.
Sie erzählte. Von Sonora komme sie; sei in Neuyork seit vorgestern, mit ihrem Wolfe und mit ihrem Leierkastenmann. Sie habe versprochen, ihm die Mescalfrüchte zu bringen; hier sei sie. Und hier sei auch der Mescal. Sie öffnete ihre Tasche, nahm ein Tüchlein heraus, knüpfte es auf, zeigte ihm die eingetrockneten Kaktusknöpfe.
Er richtete sich hoch im Augenblick. »Das muß helfen,« sagte er. »Gleich, gleich!«
Er nahm das Tüchlein mit zitternder Hand. Steckte die elektrische Schnur in den Stechkontakt. »Wasser!« rief er. »Fred, Wasser!«
Der Alte kam, füllte den kleinen Teekessel. »Ihr Bad ist fertig, Herr,« meldete er. »Haben Sie sonst noch Befehle für mich?«
Er sah ihn an, schüttelte den Kopf. »Nein, nein! Geh!«
Und der Alte ging.
Er wollte die Teekanne nehmen, mußte sie wieder hinstellen, so zitterte sein Arm. Er stützte sich auf die Stuhllehne, atmete hastig.
Die Tänzerin folgte seinen Bewegungen. »Was wollen Sie machen?« fragte sie.
»Tee kochen,« antwortete er. »Von den Peyotefrüchten. Vielleicht hilft es.«
Sie nahm den Kessel, setzte ihn auf die heiße Platte. »Lassen Sie mich machen,« rief sie. Gab die gelben Früchte in die Teekanne.
Er sagte: »Danke. – Ich will ein Bad nehmen. Mich dann niederlegen. Den Tee trinken.«
Die Goyita nickte. »Ja, gehn Sie! Ihr Tee wird fertig sein.«
Er ging ins Badezimmer, entkleidete sich, keuchend, stöhnend. Er hielt die Hand ins Wasser – das war glühheiß. Stieg doch hinein, streckte sich aus – glaubte zu verbrühen in dieser Hitze.
Gewöhnte sich dann an die Glut. Lag im Wasser, rührte sich nicht. Schlief nicht, wachte nicht, dachte nicht. Nichts war, nichts –
Außer ihm nichts, in ihm nichts. Nichts.
Dann fror ihn. Er stieg aus der Wanne, rieb sich ab. Zog den Schlafanzug an und den Kimono darüber. Ging zurück durch die Räume.
Am Diwan auf dem Tischchen stand die Teekanne. Eine Tasse daneben.
Er setzte sich, goß den dunklen Absud in die Tasse. Hob sie an den Mund, trank.
Dann hörte er eine Stimme. »Wie schmeckt es?«
Er blickte auf – sie war noch da, die Goyita. Saß dort hinten im Sessel ohne Hut, ohne Handschuhe.
»Schlecht!« antwortete er. »Sehr bitter.«
»Sie haben lange gebadet,« fuhr sie fort. »Ich bekam schon Angst um Sie. Wollte Ihrem Diener schellen. – Glauben Sie, daß der Mescaltee Ihnen helfen wird?«
Er zuckte die Achseln. »Vielleicht! Ich weiß nicht.«
»Man erzählt Wunderdinge davon in Mexiko,« sprach sie. »Wissen Sie etwas davon?«
»Es berauscht,« erwiderte er. »Ein seltsamer Rausch – ganz verschieden von allen andern. Ich habe sie alle versucht – früher einmal – Opium, Haschisch und Muscarin, Digitalin, Kawa-Kawa, Ganga und Kokain und vieles noch. Keines wirkt wie Mescal. Ein seltsamer Rausch – Farben, viele Farben.«
»Ich möchte es wohl versuchen,« sagte die Goyita. »Ist es schädlich?«
Er lächelte mühsam. »Schädlich? Nein, schädlich ists nicht. Morphinist kann man leicht werden, Schnapssäufer, Äthertrinker, Haschischesser – aber an Mescal kann man sich nicht gewöhnen. Das wissen Sie ja selbst, wie schwer es zu bekommen ist!«
Sie erhob sich, nahm eine Tasse, kam zu ihm hin. »Schenken Sie ein,« sagte sie.
Er goß ihr die Tasse hoch voll. »Fürchten Sie sich nicht?« fragte er. »Sie werden berauscht sein, bewußtlos daliegen für ein paar Stunden. Sie sind in fremdem Hause – bei einem Fremden –«
Die Tänzerin sah ihn lange an mit großen Saphiraugen: »O nein,« sagte sie ernst, »ich habe keine Furcht. Sie – sind ein Deutscher.«
Er dachte: ›Das?! Aber freilich – du brauchst keine Angst zu haben! Ich bin so schwach und so elend – und ich werde berauscht sein – wie du. So bist du sicher!‹
Er sagte: »Schließen Sie die Türe ab.«
Sie tat, wie er geheißen. Kam zurück, nahm die Tasse aus seiner Hand, leerte sie.
»Noch eine!« sagte er. Füllte beide Tassen von neuem.
Sie tranken.
Etwas verband ihn dieser Frau –
Sie lächelte: »Was nun? Ich bin sehr neugierig.«
Er sank zurück auf den Diwan, völlig erschöpft von all der Anstrengung. Sie sah es wohl, schob ihm freundlich die Kissen zurecht unter Nacken und Kopf.
»Ists so recht?« fragte sie.
Er nickte. »Danke!« flüsterte er. »Legen Sie sich auf den großen Sessel – dort auf den ledernen. Nehmen Sie Kissen. Dann – knöpfen Sie die Bluse auf – es ist gut, wenn Sie frei atmen können und wenn nichts drückt auf Ihrem Herzen, öffnen Sie auch Ihr Mieder – oder ziehn Sies aus.«
»Ich trage keins,« sagte die Frau.
Er sah – verschleiert nur, wie durch Nebel, wie sie nestelte an ihrem Kleide. Wie sie zu dem Ledersessel ging, Kissen hineinwarf, sich ausstreckte.
»Kennen Sie eine Copla der Rumba?« flüsterte er. »Bitte singen Sie mir den Rhythmus – bis Sie – schlafen.«
Sie sang, leise, sehr leise:
»La Rumbita que yo bailo,
La de Rumba, Rumba, Rumba,
Es muchissimo más dulce
Que unos labios de mujer!
Ay, ay, ay! Co, co, co.«
Eintönig, immer dieselben Worte. Denselben Rhythmus. Er suchte das Bild zu fassen, wie sie vor Villa tanzte und den Generalen. Aber er fand es nicht – sah nur Villas Affenfratze – und das adlernasige Gesicht seines Adjutanten. Dann der Tänzerin Kopf: saphirblaue Cabochonaugen in Weiß. Schwarz rund herum.
Nun schlief er –
* * *
Sonne, Sonne und der Weg am Strand. Grade über ihm stand die Sonne, hoch im Mittag, als er im Sande saß unter den kahlen Dünen. Das Meer strahlte und der Sand leuchtete. Manchmal zog ein Bauer vorbei, oben hängend auf dem vollbepackten Maultier. Still, langsam, ohne einen Laut. Tauchte auf in der Ferne, kam heran, verschwand wieder. Nirgend ein Schatten, nirgend. Gerade über ihm stand die Sonne im Mittag.
Dann erhob er sich, ging der Stadt zu.
Etwas war mit ihm – um ihn. Alles war still, alles war leuchtend klar um ihn her. Nur Sand und Meer und Sonne. Er blieb stehn, sah ringsum, schritt weiter.
Dann fand er es. Ein langer Schatten lief vor ihm her. Sein Schatten.
* * *
Rot und Gelb. Rot und Gelb. Überall Rot und Gelb in der Stadt. Heute war Festtag und große Corrida – Miurastiere, Belmonte, Gaona und Joselito – da wehten die Fahnen in den Landesfarben. Überall durch die Stadt – Rot und Gelb. Ein guter Wind blies vom Meere her aus Südwest – und nach Nordost wehten alle die Flaggen, die breite Straße hinauf, die er ging. Wehten, wie er ging, wie alle die Menschen da gingen, ins Land hinein, dorthin wo der Stierzirkus lag. Wie ein gewaltiger Magnet war es, der alles zu sich hinzog.
Keiner kam ihm entgegen, keiner. Alles zog hinauf diese breite Straße. Und mit ihnen zogen die Fahnen, Rot und Gelb – zur Corrida hin.
Aber eine, eine zog nicht mit. Er sah sie gut, eine große und alte, ausgefranst an den Enden. Sie hing nicht herunter von ihrem Mast, war nicht festgewickelt in ihren Leinen. Nein, sie wehte gut, wehte wie alle anderen Fahnen. Aber sie wehte – gegen den Wind.
Niemand sah es, niemand achtete darauf. Zur Corrida zogen die Fahnen und Menschen –
* * *
Das wußte er wohl: er lag da und träumte. Er hatte Mescal genommen, einen starken Absud, zwei große Tassen voll. Lag auf dem breiten Diwan in seiner Wohnung, in Neuyork in. der dreiundzwanzigsten Straße. Auf seinem Guanacofell. All dessen war er sich sehr bewußt.
Und er wußte auch: es ist ganz unmöglich, daß die Fahne gegen den Wind weht. Wie es unmöglich ist, einen Schatten zu werfen zur Mittagszeit.
Und dennoch warf er den langen Schatten. Und dennoch wehte die Rotgelbe gegen den Wind.
In Puerto Santa Maria, als er zum Stierkampf ging.
* * *
Einer saß neben ihm auf den Steinbänken, ein sehr Dicker. Ein gewaltig Dicker, ein ungeheuer Dicker, einer, der Platz nahm für drei, der überschwappte vorn und hinten und nach beiden Seiten.
»Wasser!« schnappte der Dicke. Und der Gallego goß ihm ein hohes Glas voll.
»Mehr!« keuchte der Dicke. Wieder eines und noch eins.
Fünfzehn Gläser trank der Dicke und zwanzig. »Mehr!« stöhnte er, »mehr!«
Unten machte Joselito seine Veronicas, der Bruder des kleinen Gallo.
»Olé!« jauchzte die Menge, wenn der Sevillaner das Scharlachtuch dicht vorbeizog vor des Stieres Augen, mit der linken sein Horn griff, niederkniete vor dem Tiere. »Olé!«
Aber der Dicke jappte: »Mehr!« Füllte sich an, schwemmte sich auf, wuchs nach allen Seiten. »Mehr!«
* * *
Der starke Veneno hing auf der Schindmähre, die der Stier traf. Zwei lagen schon im Sand – das war die dritte, die er auf die Hörner nahm. Der gepanzerte Picador kugelte herunter, plump, ungeschickt – bumm, auf den Schädel, wie immer. Kroch heraus unter dem Gaul her, erhob sich, watschelte davon. Aber der Stier bohrte die Hörner in des Pferdes Leib, riß die Eingeweide heraus. Wandte sich dann, raste hinüber nach der andern Seite – zu dem schwarzen Klepper, den Catilino ritt.
Da schrie ein Weib auf der Schattenseite. Sprang auf in der Loge, nahm den Schleier ab, warf ihr Tuch zu Boden. Schrie, kreischte, sprang die Stufen hinab – und über die Brüstung in den Sand. Lief hinüber, stand in der Sonne, schrie, schrie. Und begann sich auszukleiden.
Einer rief: »Sie ist wahnsinnig!«
»Greift sie! Holt sie heraus!« johlte die Menge. Die Toreros liefen auf sie zu.
Aber die Frau riß sich die Kleider vom Leibe, Röcke, Hemd. Stand da, nackt auf dem gelben Sand. Nur die Schuhe hatte sie an und lange rote Strümpfe.
Ein Banderillo sprang zu ihr hin, hing ihr seinen Mantel um. Dann ließ sie sich abführen, ging ruhig mit ihm zu den Planken hin. Blieb stehn einen Augenblick, stutzte, sah wie die rotröckigen Chulos des Catilino Mähre vor den Stier zerrten.
Da schrie sie wieder. Riß sich los, lief hinüber. Stellte sich dicht vor den elenden Gaul, als ob sie ihn schützen wolle. Breitete die Arme weit aus.
Floh doch in Todesangst, als der Schwarze von Miura die Hörner senkte. Rannte gellend durch die Arena.
Aber sie kam nicht weit. Stolperte, fiel – da nahm sie der Stier.
Warf sie hoch, stieß ihr die Hörner in den Leib. Ihre Eingeweide flossen in den Sand – wie die der Pferde.
Die Toreros schwenkten ihre Mäntel, lenkten den Stier ab im Augenblick. Und der Sevillaner tötete ihn schnell, recht und schlecht – wie die Klinge traf.
Die Krankenwärter kamen mit der Bahre. Legten die nackte Frau darauf, hüllten sie ein, trugen sie hinaus –
Unter dem gelbroten Tuche her schrie es, schrie es.
»Eine Verrückte!« gröhlten die Leute. »Eine Wahnsinnige!«
Aber der Dicke ächzte: »Mehr! Mehr!«
Trank immer noch Wasser. Nein, er trank nicht – er atmete Wasser.
* * *
Er saß in den Felsen am Strand mit dem kleinen Maler. Der sagte: »Gauguin hatte schuld und sonst keiner. Der war der schlechtere Mann und war eifersüchtig auf den Holländer. Und als er zu ihm kam nach Arles, ward van Gogh vergiftet durch des andern Wahnsinn. Da schnitt er sich die Ohren ab und ging ins Dirnenhaus und gab sie ab – mit einem schönen Gruß für Herrn Gauguin.«
»Warum schnitt er sich die Ohren ab?« fragte er.
Der Maler sagte: »Er schnitt sie sich ab – das ist Geschichte. Jeder weiß es. Die ganze Welt weiß es. Die Ohren hat der Picasso.«
»Wo hat er sie her?« forschte er.
»Ich weiß nicht,« rief der Maler, »das ist doch ganz gleichgültig. Er hat sie – das ist das Erbe van Goghs. Man könnte sagen, die Augen müßten es sein – oder die Hand – aber das ist ganz falsch. Man muß die Zeit hören – um seiner Zeit Maler zu sein. So wird der Picasso nichts mit dem Erbe anfangen können – obwohl er aus Malaga ist. Oder gerade darum.« Er rückte nahe heran, senkte seine Stimme, schaute ringsum, ob niemand hören könne.
Sie saßen ganz einsam in den Felsen, vor dem Meer in der Sonne.
»Ich wills Ihnen sagen,« flüsterte der Kleine. »Malen – das ist wie Torieren: da liegt das Geheimnis! Und nie, solange die Welt steht – ist ein guter Maler aus Malaga gekommen – noch ein guter Torero. Wer stammt aus Malaga? Die Larita, die Paco Madrid – lauter Brutos! Rohe Kerle, Espadas und sonst nichts – das hat keinen Schimmer von der Kunst! Das ist tapfer und geht drauf los – bringt im besten Falle eine wildwüste Estocada zustande. Aber Veronicas, ohne die Füße zu rühren, Quites mit Niederknien, Naturales über einem Arm, alles was Kunst ist in der Faëna – keine Ahnung. Gaona hat seine Goaneras erfunden – Joselito – Herrgott – diese Molinetes! – Belmonte – welche Mediaveronicas! Und der alte Gallo ist das gewaltige Genie! Ein Mensch ist er – ein Mensch! Hat den höchsten Mut und die unerreichteste Kunst heute – und läuft morgen weg vor dem Stier wie ein altes Weib, macht die infamsten Gemeinheiten! Wie neulich in Irun! Warum? Weil ihm ein schwarzer Hund über den Sand lief. – Bei mir ists der Schlips. Man siehts ihnen nie an, wenn man sie kauft – aber man merkts, wenn man arbeitet – der macht tapfer – und feige der andere. Weg mit ihm! Und dann lieber gleich die Leinwand zerschneiden. Aber der gute Schlips macht unendlich sicher – da kann man alles, alles! Ich habe den beiden Gallos ihre Schliche abgelauscht – denen und dem Belmonte!«
Er stand auf, schob seine Boina über den Kopf. »Das Meer wird schwarz,« sagte er. »Die Sonne wird grün. Wir wollen schwimmen.«
Sie schwammen weit hinaus, leicht und schnell, die Strömung trug sie.
»Können Sie das Land noch sehn?« fragte der Maler.
Er schüttelte den Kopf. »Die Wellen gehn hoch,« antwortete er. »Wir wollen zurück.« Sie wandten um.
Aber das Meer zog sie hinaus. Sie mußten treten, treten.
Und das Meer wurde dick, schleimig, fest. Er merkte, wie er zurückblieb, mehr mit jedem Stoße, sah, wie der andere weit vorausschwamm dem Lande zu.
»Warten Sie doch!« rief er.
Doch der andere erwiderte: »Nein! – Ich desertiere.«
Da schrie er durch die schwarzen Wogen: »Feigling!«
Der mit der Boina stand am Strande. Lachte: »Qué quiere? – Ich habe more travailliert für das Vaterland als Sie! – Plus que dreitausend horses!«
Und er sah, daß es der Pferdemann war, der in den Felsen verschwand. Nicht der Maler.
* * *
Das Schwarze war Tinte. Oder – nicht eigentlich Tinte. War ein schwarzfärbender, schleimiger Stoff, der sich löste im Wasser – und übel roch wie tote Fische. Darin mußte er schwimmen.
Dann hörte er ein Stöhnen und Keuchen und Japsen. Er wandte den Kopf – da schwamm der Dicke hinter ihm. Bleich, fleischfarben, eine ungeheure, schwappende Masse. Er konnte das Gesicht kaum erkennen, sah nur die kleinen, gierigen Augen, kreisrund, sah das große Maul – wie ein entsetzliches Loch, das sich füllte mit Wasser. Von dem Dicken strömte das schleimige Schwarz aus – irgendwo hatte er eine giftige Drüse, die ihren eklen Inhalt ausleerte ins Meer.
Nun begriff er auch, warum er nicht weiterkam. Die zähen Tinten hielten ihn fest und zugleich strömte das Meer in dies scheußliche Maulloch – das zog ihn zurück.
Der Dicke war es – da war kein Zweifel. Das Gesicht, das er sah, war ganz menschlich – kahl der Schädel und plattgedrückt. Keine Stirne, keine Nase und kein Kinn. Aber die kleinen, runden Augen und das entsetzliche Loch.
Der Dicke war es. Aber seine Finger wuchsen und seine Zehen wuchsen, während Arme und Beine sich hineinschoben in den Leib. Und der Hals blähte sich noch mehr auf und Kopf und Leib wurden eins – ein bleicher Schlauch, ein gewaltiger Sack, der Wasser schluckte. Die Finger und Zehen krochen ins Meer hinaus, wuchsen, wurden lang, lang, viele Meter lang. Breit dazu und dick wie starke Mannsarme, aber weich und ohne Knochen. Und mit Warzen bedeckt, überall.
Er dachte: darum ist der Maler weggeschwommen! Das ist ein Krake, der Dicke, ein großer Polyp! Aussaugen will er mich –
* * *
Angst hatte er eigentlich nicht – er lag ja auf seinem Diwan – träumte. Träumte von einem Dicken, der ein Polyp war, und wußte gut, daß er nur träumte. Ja, er wußte auch, woher dies Bild kam: in der alten Nummer irgendeiner Zeitschrift hatte ers gesehen, in der »Jugend« oder im »Simplizissimus« vor ein paar Tagen erst. Der dicke John Bull, der den Kraken spielte, die saugenden Fangarme ausstreckte über alle Länder und Meere. Er erinnerte sich gut, daß er die Zeichnung herzlich schlecht fand und sich dazu ärgerte über den Zeichner, der die alte Walze zum hundertsten Male abdrehte.
Billig war es, sehr billig. Ein guter Witz, als zum ersten Male ein Künstler den Gedanken hatte, für Napoleon vielleicht oder den fünften Karl oder sonst einen, der die Welt erobern wollte. Heute wars abgebraucht, war längst Klischee seit hundert Jahren und mehr.
Es stimmte – freilich stimmte es. Aber gerade darum wars schlecht, weil es immer stimmte. So wie Herz sich auf Schmerz reimte – wie grün die Farbe der Hoffnung war und die schöne Frauenstimme wie eine Nachtigall sang. Wie Rouge et Noir: Spiel bedeutete, und zwei mal zwei vier war.
Konvention –
Genial einmal. Abgeschmackt längst. Unerträglich am Ende.
Und er dachte: an dem allein ist nur eins schuld. Dieser gräßliche, schauderhafte gesunde Menschenverstand. Der und die Natur – die zumeist.
Jeden Herbst fielen die Blätter von den Bäumen, die wurden kahl. Dann schneite es und alles wurde weiß. Und im April oder Mai war alles wieder grün. Wo man hinsah, brachen Blätter heraus und Blüten –
Warum denn immer nur Blüten und grüne Blätter? Dasselbe, und ewig dasselbe durch die Jahrtausende und jedes Jahr und jedes einzelne Jahr – immer und ewig dasselbe. Gar nicht anders möglich war es, als daß diese elend verkitschte, stocklangweilige Natur das Menschengesindel auch verkitschen mußte. Das stellte sich ans Klavier, riß das Maul auf und sang was von Glocken, die läuten sollten, und daß nun der Lenz da sei.
Zum Erbrechen war es.
Warum hatte denn nicht ein einziges Mal so ein Apfelbaum einen besonderen Gedanken? Warum trieb er nicht einmal Korkenzieher statt der ewigen grünen Blätter, eingemachte Heringe statt der weißen Blüten? Gott, es mochte ja sein, was es nur wollte, Stachelschweine, Tintenfässer, Biergläser, Teetassen, alte Stiefel oder Zahnbürsten! Aber nein, nein, grüne Blätter mußten es sein! Flieder am Fliederbusch, Kirschen am Kirschbaum, Johannisbeeren am Johannisbeerstrauch. Und jedes Kanin bekam Kaninchen. Jede Katz ihre Kätzchen, jede Kuh ihre Kälber. Warum nicht – ein einziges Mal nur, zur kleinen Abwechslung – irgend was andres – und wenns auch ein blecherner Nachttopf gewesen wäre!
Und nun kroch diese niederträchtige Konvention gar in seine Träume hinein.
Er dachte: dazu brauchts keinen Mescal –
* * *
Furcht? Nein – recht eigentlich nicht. Es stimmte – gewiß – er war Deutscher. Und der Engländer verfolgte ihn – wie jeden andern im ganzen Lande – das konnte er alle Tage sehn. Wozu waren denn die Detektive da, die vor der Haustüre lungerten?
Es stimmte – sehr gut stimmte es. Ausgesogen war er – müde, krank und leer – und etwas war da, das ihn aussog., Er schwamm, schwamm in dem schwarzen Schlamm – schwamm und kam nicht weiter.
Nie würde er nach Hause kommen – nie wieder ans Land!
Und doch sah er das – sah das Land – nahe genug.
Dann teilte er sich; war – zwei. Eines lag auf dem Diwan und träumte. Und sah gut das andere sich elend abmühn in dem schwarzen Wasser. Sah es die Arme weit hinauswerfen und mit den Beinen stoßen gegen die ziehende Strömung. Und ob auch das eine gut wußte, daß es träumte, so wußte doch das andere nicht weniger gut, daß alles sehr wirklich war ringsherum. Daß der scheußliche Dicke näher kam und näher, daß die weichen Polypenarme weit sich reckten, bleich und weich sich hinausschoben durch die schleimigen Tinten.
Er schloß die Augen, schrie auf, trat, trat in jämmerlicher Angst.
Er kam weiter, dem Ufer zu – ah, nun fühlte er Boden unter den Füßen.
Er stand; wandte sich. So nahe war nun das Tier, daß alle die Arme herumspielten um seinen Leib. Und ob er gleich auf dem Strande stand, würde er doch nie die Felsen erreichen können, die die Flut nun bespülte.
Er suchte irgendeinen Stein – einen Stock – sich damit zu wehren.
Da fühlte er etwas in seiner Hand – klein und glatt.
Lottes Messer –
Er öffnete es – da wuchs es – wie die Saugarme des Dicken. Und er hieb um sich, schlug, traf mit scharfem Schlage einen Arm. Schnitt ihn durch – da ringelte das Ding im Wasser, wie eine große Schlange. Noch einmal holte er aus, und wieder, hieb die Arme herunter – wie durch Butter schnitt sein gutes Messer.
Rotes Blut mischte sich mit dem schwarzen Meer. Dazwischen schwammen die bleichen Fleischarme.
Er lief. Fiel nieder, dicht an dem Felsen, auf einem kleinen Fleckchen Sandes, eben breit genug, um sich auszustrecken.
Da lag er. Sah auf das Meer.
Sah den Dicken – der grinste. Schlürfte Wasser, viel Wasser – schwappte, tauchte unter. Aber in der blutigen Tinte schwammen die weißen Arme – sanken unter, tauchten auf – als ob sie ein eigenes Leben hätten. Kamen näher und näher dem Strande zu.
Einer hob sich – reckte sich. Schwarz floß das Wasser herunter über den weißen Leib – aber er sah, daß es Haare waren, nasse Wellen tiefschwarzer Haare. Und kein Arm war es: war ein Weib, ein nacktes Weib.
Noch eines da hinten – noch eines – wieder eines. Zu nackten Weibern wurden die weißen Saugarme.
Die kamen heran, krochen auf ihn zu. Still – still – ohne jedes Geräusch. Näher, näher –
Er versuchte aufzustehn, versuchte zu schrein. Er riß den Mund weit auf –
Aber kein Laut kam heraus. Nichts.
Hilflos lag er. Lautlos. Regungslos.
Nur ein Atmen. Nur ein Klopfen im Herzen. – Da schloß er die Augen.
Und er fühlte, wie sie ihn berührten. Naß, kalt – mitten auf die Brust. Ein Schmerz, stechend – aber sehr rasch, für einen Augenblick nur.
Und ein langes Saugen und Schlürfen.
Sie tranken ihn aus – sie tranken ihn aus.
* * *
Es tat nicht weh – nein. Wohlig war es. Weich und wohlig. Und es war, als ob auch er sauge – wie die Weiber. Als ob auch er tränke – wie sie. Er fühlte den Blutgeschmack auf der Zunge. Süßlich –
Fühlte auch, wie sich seine Adern füllten mit Blut. Wie er stark wurde und gesund.
Und doch tranken sie – ihn – sie, die Weiber.
Die abgetrennten Ausflüsse des Dicken, diese Saugarme, die eigenes Leben gewannen, selbst Wesen wurden, diese Saktis des gräßlichen Shiwa-Moloch. Sie sogen sein Blut – und er träumte nur. In sterbendem Röcheln, in letztem Todesschweiß.
Träumte – daß er Blut sauge –
Dick und voll sich tränke. Einschlafen darüber. Wieder träume:
* * *
Im Garten war es, hinter seiner Mutter Haus. Schulferien – seine Base Daisy war zu Besuch. Mit der spielte er am frühen Morgen unter den Kastanienbäumen. Sie hatten einen sehr großen Zinnteller, füllten ihn mit Wasser, stellten ihn in die Sonne – da kam die zahme Dohle und badete. Duckte sich, spritzte das Wasser mit den Flügeln, pickte mit dem scharfen Schnabel auf das glitzernde Metall. Sie hatten auch ein Meerschwein, das hieß ›Enkel‹, und zwei Igel – die mußten auch baden.
Dann rief eine Stimme – scharf und hell: »Dé–si–rée!«
Das war Tante Ida, Daisys Mutter. Nun war es aus mit dem Spiel. Nun mußte sie hinauf, mußte die Feder nehmen. Sich hinsetzen und einen französischen Aufsatz über Mahomet schreiben oder einen englischen über die Jungfrau von Orleans. Und dann Klavierübungen machen – drei Stunden wenigstens. Und noch eine Stunde – vierhändig mit der Mama.
Sie war gut zwei Jahre jünger als er. Und so viel wußte sie und konnte sie – das kam, weil ihre Mutter ein Wunderkind aus ihr machen wollte.
Freilich, mit der Armbrust schoß sie immer daneben. Konnte auch keine Kröte auf die Hand nehmen, wußte nicht einmal, was ein Splick war! Und vor toten Spatzen fürchtete sie sich nur dann nicht, wenn sie in Zeitungspapier eingewickelt waren.
Daisy ging, und er saß allein, überlegte lange. Mit den Kröten – das war ein sehr schwerer Fall! Die Igel fingen sie, warfen sie mit den Pfötchen auf den Rücken, bissen ihnen den Bauch auf und fraßen die Eier heraus. Ließen sie dann liegen. Nun fürchtete er sich gewiß nicht vor einer Kröte – aber eine, die auf dem Rücken lag, der man aus dem offenen Bauche Eier und Eingeweide herausgefressen hatte – das war doch was anders. Zertreten konnte man sie kaum – und totmachen mußte man sie doch! Den Kopf abschneiden mit einer scharfen Schere – das war sicher die schnellste Erlösung für die verstümmelten Tiere, die ja doch zu Tode sich quälen mußten. Er hatte es einmal getan – es war schrecklich schwer. Man mußte die Augen dabei zumachen – und dann schnitt man daneben.
Was konnte man nur tun? Er mochte die Kröten sehr gern, wegen ihrer goldenen Augen. Mochte die Igel auch sehr gerne – wegen ihres klugen Köpfchens und der kleinen Pfötchen und des Stachelfells. Und weil sie Junge kriegten, die gerade aussahen, wie stachliche Kastanien.
Freilich die Igel waren unverbesserlich, hörten nie, was man ihnen auch sagte. Sie brachen in die Küche ein und fraßen die Eier. Sie nagten jede Birne an, die herunterfiel vom Baum, und fraßen auch stets ihre eigenen Kinder auf.
Eines mußte man abschaffen – die Kröten oder die Igel. Aber die Igel waren so schrecklich komisch. Und sie konnten doch am Ende nichts dafür, wenn sie so furchtbar gern frische Kröteneier aßen. Er aß am liebsten die unreifen Stachelbeeren, die er hinten im Klostergarten stehlen mußte – das war auch verboten.
Er löste die Frage nicht. Er ging auf die Veranda, da wartete das Frühstück auf ihn.
Tante Henriette schenkte ihm den Kaffee ein, die war auch auf Besuch. Die zwiebelmustrige Kaffeekanne sah genau so aus wie Tante Henriette, dick, rund, halslos und in blauweißem Kleid. Und so freundlich und gut tat sie, genau wie Tante Henriette. Aber er dachte: es ist alles Schwindel. In seiner Tasse schwamm eine dicke Haut – die konnte er nicht ausstehn. Er fischte sie heraus – aber die Tante Henriette tat sie wieder hinein. Das sei das Beste – sagte sie. Und er solle Gott danken, wenn er stets in seinem Leben so schönen Milchkaffee bekomme.
Was wußte sie davon, Tante Henriette? Seinetwegen mochte sie sich den Bauch dick vollstopfen mit Haut und noch runder werden als sie schon war. Ihm – schmeckte es nicht! Und die Kaffeekanne war ein hinterlistiges Ding, das ihm in aller Güte hinterrücks die alten Lappen in die Tasse warf.
Er rührte herum; da fragte Tante Henriette, wann er endlich an die Arbeit gehn wolle? »Mangelhaft« stände in seinem Zeugnis, er habe große Lücken in der Mathematik auszufüllen –
Er stand auf. Schlich rasch in den Garten, als die Tante grade ihr Strickzeug nahm. Die Tasse ließ er unberührt, nur sein Schinkenbrot nahm er mit.
Sie ist gemein, die runde Tante Henriette, dachte er. Gemein und hinterlistig, wie die dumme Kaffeekanne, die sie mitgebracht hatte.
Schulferien! – Und dabei mußte die Daisy französische Aufsätze schreiben über Mahomet! Und er sollte Lücken ausfüllen in der Mathematik! Und die alten Igel fraßen die Eier aus den lebendigen Kröten –
Er seufzte sehr tief. O – das war ein Leben –
* * *
Wie die arme Kröte lag er da, auf dem Rücken an dem Felsen. Nun war es kein Igel, der seine scharfen Zähnchen ihm in den Leib schlug. Es war die Kaffeekanne, die saugte mit ihrer kurzen Schnute. Und die war nichts anders, als eben die Tante Henriette – die trank, die schlürfte – davon wurde sie ja so dick und rund.
Und sie hatte auch die Kröten ausgesogen, am Wegesrand – da hatte er den Igeln Unrecht getan – das war nun klar! Sie – oder der dicke Polyp, der über Nacht aus dem Meer über die Klostermauer kroch, hinein in den Garten.
Oder vielleicht dessen Arme? – Die nackten Weiber?
Einerlei, wer es war. Er war die Kröte. Die eine und die andern auch. Alle. Lag da mit offenem Leibe – starrte hilflos in die Sonne mit goldgrünen Augen –
* * *
Dann krochen die Spuckmäuse um ihn her. Die schwarzen, die der Mann ausspie in dem Pullmanwagen der Union Pacific, zwischen Saltlake City und Denver. Die sprangen heraus aus dem Spucknapf, saßen um ihn, piepsten, pfiffen.
Kicherten, zwitscherten auch, sangen –
So ein Mäuselied. Von dem Mäuserich, der über Wasser reisen wollte im Pißpott. Nach Rotterdam fahren. Aber er kam nie hin, weil er aus Beverland war, und das liegt in Deutschland.
– Sie steckten die Schwänze in seinen offenen Krötenleib. Leckten sie ab.
Aber es schmeckte ihnen nicht – gar nicht.
Sie ließen ihn liegen.
Die Nonnen kamen durch den Garten, die fanden die arme Kröte. Schoben sie mit spitzen Fingern auf ein großes Kastanienblatt, deckten ein anderes darüber, trugen sie fort, schritten durch den Garten, langsam und betend, zum Kreuzhof. Da sollte sie begraben werden.
Er dachte: wie gut wird es sein, da zu liegen. Dicht beim Wasser, wo das grüne Fröschlein hinabsprang zum Himmel. Bei der vierten Säule, unter all den weißen Rosen.
– Im Kreuzhof stand er, mitten zwischen den Nonnen. Aber die sahen ihn nicht, so beschäftigt waren sie mit Beten und Singen. Und er dachte: nun werden sie die leeren Blätter begraben – und werden nicht wissen, daß kein Krötlein drin ist –
Da sah er, daß es gar nicht die rheinischen Nonnen waren, nicht die Äbtissin Beata, nicht die Dalwigk, nicht die süße Metternich und die kleine Romberg mit dem Stumpfnäschen.
Es war die Pierpont und die de Fox. Und die dürren Chorweiber André's. Die schrien ein Lied, scheußlich, in synkopiertem Ragtime und englisch zerkautem Latein, warfen Rosen herab von den Galerien. Aber nicht weiße, sehr rote Rosen waren es –
Blutrote Rosen – Blut – –
Blut regnet herab, traufte über ihn, viel rotes Blut. Da kroch seine Zunge heraus aus den Lippen, wie einst auf der Mensur. Er leckte, schlürfte – Blut, warmes Blut –
Durstig war er – sehr durstig –
Trank – trank –
So gesund trank er sich, so stark und gesund.
* * *
Der Doktor Samuel Cohn stand da. Der sagte: »Nehmen Sie Hämatogen. Doktor Hommels Hämatogen. Das ist konzentriertes Blut, Ochsenblut. Die Wirkung ist eine verblüffend gute. Ein Eßlöffel Hämatogen hält mehr –«
Er starrte ihn an, verständnislos erst und verwirrt. Dann begriff er. »Nein, Doktor,« sagte er. »Nein! Es muß rot sein und warm und frisch. Muß Menschenblut sein. Und fließen muß es, fließen!«
Aber der Arzt schüttelte den Kopf, sehr bedenklich und vorwurfsvoll: »Das ist ein fester Strick für das Netz, in dem Sie stecken! Aus Hämatogen kann man keine Stricke drehn. Dr. Hommels Hämatogen ist in allen Apotheken erhältlich. Es –«
* * *
Er hörte nicht hin – und der Arzt sah es wohl. Da unterbrach er sich, zuckte die Achseln, ging. Ein Flüstern war an der Türe und ein schweres Schieben und Riegeln. Einer stand da in einer blauen Uniform, mit Silberknöpfen, aber ohne Mütze. Der ließ den Arzt hinaus.
Und einen andern hinein. Das war der Journalist, war der Tewes. »Wie fühlen Sie sich, Doktor?« fragte der.
Wie er sich fühlte? Welche Frage! Ausgezeichnet, stark, kräftig, sehr gesund.
»Wünschen Sie Tee?« fragte er den Redakteur.
»Tee – hier Tee?« gab der andere zurück.
Er sah sich um – nein, er war nicht in seinem Zimmer. Das war eine Zelle, eng, sehr klein – mit dumpfer, feuchter Luft. Ohne Fenster und dunkel genug – nur aus einer Ecke glühte eine elektrische Birne. Er saß auf einer Pritsche – und die Hände waren ihm zusammengeschlossen.
Er kannte den Raum gut. Hier hatte er den kranken Burade besucht, den vom Norddeutschen Lloyd. Der mit falschen Pässen ein paar Leute hinübergebracht hatte nach Deutschland, den sie zur Strafe dafür auf sieben Jahre nach Atlanta geschickt hatten, ins Staatszuchthaus.
Aber – ja doch – er selbst saß ja hier – gottweiß wie lange schon. In diesem elenden, schmutzigen Loch, in den ›Tombs‹, dem Neuyorker Gerichtsgefängnis –
»Ich habe die Zeitungen mitgebracht,« sagte der Redakteur, legte ein großes Bündel auf die Pritsche. »Alles Ausschnitte über die Verhandlung. Die ganze Presse ist einmütig in ihrem Lobe über die Geschworenen, die Sie verurteilt haben und damit das Vaterland gerettet.«
»Sind Sie auch verurteilt?« fragte er.
Der Journalist lachte: »Ich? Wie kann man mich verurteilen?! Ich bin doch Amerikaner!« Er öffnete das Bündel, griff ein paar von den Ausschnitten. »Ich komme soeben von Ihren Anwälten – die haben ein Telegramm aus Washington erhalten. Das Bundesgericht hat die Berufung verworfen – hat das Urteil der Geschworenen bestätigt in allen hundertundsiebzehn Punkten.«
›So – so,‹ dachte er, ›hundertundsiebzehn Punkte!‹
Der Journalist fuhr fort: »Die Exekution soll heute abend stattfinden. Da meine ich, es wäre gut, wenn Sie die Kollegen empfangen wollen, die Reporter und Photographen – das würde Sie vielleicht ein wenig zerstreuen. Sie sind der interessanteste Mensch in ganz Neuyork heute, Doktor, über sechzig Preßleute warten draußen. Darf ich sie hereinlassen?«
»Einen Augenblick,« sagte er. Er griff nach den Zeitungsausschnitten, starrte hinein. O, jetzt erinnerte er sich gut der ganzen Sache, wie er die Schlußrede des Gerichtspräsidenten da vor sich sah. Der war kurzatmig, jappte nach Luft, spie aus nach jedem Satze –
Hundertundsiebzehn Verbrechen hatte er begangen, große und kleine, wies grade traf. Manche nur einmal, manche in stetem Rückfalle und wieder in schönster Idealkonkurrenz mit den andern –
Und der Richter hatte gesagt: »Es scheint fast, als ob das ganze Leben dieses Menschen in unserm freien und gastfreien Lande nichts anders war als ein ständiges Nichtachten und Mitfüßentreten der Gesetze. Als ob dieses unendlich niedrige, vertierte, vom Satan besessene – mit einem Worte: dieses deutsche Hirn – nichts mehr denken konnte als Mord, Raub, Diebstahl, Verbrechen jeder Art.«
Da standen sie in der Zeitung, aufgezählt, alle hintereinander, seine hundertundsiebzehn Schandtaten – eine große Seite voll.
Urkundenfälschung – das war nur ein Punkt, aber in fast tausend einzelnen Fällen. Falsche Pässe, falsche Papiere, falsche Deklarationen für Konterbande, Schmuggelware nach Deutschland. Beleidigung der Landesfahne dann – er war sitzen geblieben auf seiner Bank am Madison Square, als ein vorbeiziehender Leierkastenmann das Lied vom Star-Spangled-Banner auf seiner Drehorgel gedudelt hatte. ›Weiße Sklaverei‹ – Mädchenhandel, weil er ›zum Zwecke der Unzucht eine amerikanische Bürgerin in einen fremden Staat verschleppt hatte‹. – O ja, es stimmte schon! Er war mit Lotte van Neß von Neuyork hinübergefahren nach ihrem Landhaus in Neujersey – genau vierzig Minuten weit mit dem Auto.
Dann Landesverrat – er hatte den Villa aufgehetzt, hatte ihm Waffen geliefert: ganze fünf Revolver! Er allein hatte die Japaner veranlaßt, gegen die Staaten Stellung zu nehmen – man bewies es genau! Beleidigung des Präsidenten, den er in seinen Reden einen Lakai der Engländer genannt hatte. Und Verunglimpfung Englands selbst, des heiligen Mutterlandes – das war viel schlimmer.
Verletzung der öffentlichen Sittlichkeit – er hatte am Strande gebadet, nur mit einer Schwimmhose bekleidet, ohne Brusttrikot. Ein Detektiv hatte es beobachtet durch ein Fernglas – der konnte es beschwören. Und Blasphemie, Gotteslästerung! Weil er behauptet hatte, daß der Stamm Levi in der Wüste eine schwarzweißrote Fahne habe. Die Fahnen aber der Stämme Israels in der Wüste seien eine göttliche Einrichtung, und es sei eine niederträchtige Beleidigung, zu behaupten, daß einer von ihnen die Mörderfahne Deutschlands geführt habe. Nichts davon stände in der Bibel: es sei eine tieferbärmliche, gemeinverlogene, deutsche Fälschung.
Und dann – die Sache mit der rotgelben Fahne. Es sei völlig ausgeschlossen, daß eine Fahne gegen den Wind wehen könne, das widerspreche den einfachsten Naturgesetzen – nur ein Deutscher könne einem amerikanischen Gerichtshofe mit solch albernen Ausreden kommen. Es sei gar keine Frage, daß es sich um eine flaggentelegraphische Nachricht gehandelt habe, irgendeine infame Spioniererei, die er auf diesem Wege seinen kindermörderischen Landsleuten übermittelt habe. Wie er denn auch, unter Umgehung des Postregals und unter Nichtachtung der Hoheitsrechte des Staates, zugestandenermaßen mehrmals Briefe durch nach Europa reisende neutrale Passagiere nach Deutschland habe schaffen lassen. In dieselbe Rubrik aber falle das Werfen eines langen, schwarzen Schattens genau zur Mittagszeit, das – naturgesetzlich ganz unmöglich und darum allein schon für jeden anständigen Menschen zu verdammen – keinen anderen Zwecken habe dienen können, als nur verbrecherische Nachrichten auf geheime Weise seinen Mitverschwörern zu übermitteln.
Und die Kröten! Die er lebendig aufgebissen habe, um ihnen mittels Schlürfens die Eier aus dem Leibe zu entfernen. Das sei eine entsetzlich Tierquälerei, eine wahrhaft teuflische Grausamkeit, eine echt deutsche Barbarei. Geradezu lächerlich seien seine Ausreden. Habe einer der Geschworenen je einen Igel Eier aus lebenden Krötenleibern essen sehn? Natürlich nicht! Noch dummer seien die Vermutungen des Angeklagten, daß es vielleicht die Kaffeekanne gewesen sei, oder seine Tante Henriette, oder gar der geheimnisvolle Dicke. Das alles sei regelrechter Wahnsinn! Wenn aber der Verbrecher sich einbilde, daß der Gerichtshof auf solch albernes Simulieren hereinfalle, auch nur eine Sekunde ihm Glauben schenke, wenn er versuche den Irrenhäusler zu spielen, so irre er sich sehr. Er sei bei ganz gesundem Verstande – soweit das bei einem Deutschen überhaupt möglich sei. Weder Igeln noch Tanten noch Kaffeekannen sei solch eine furchtbare Grausamkeit zuzutrauen – wohl aber ihm, der die Verbrechernatur in ihrer ganzen entsetzlichen Verruchtheit offenbare. Es sei das wahre Musterbeispiel deutscher Kultur!
Und endlich der gräßliche Lustmord an dem dicken alten Herrn – und seinen Töchtern, die er aufgeschnitten und ausgesogen habe. Die Aussage des Beschuldigten, daß er von der Familie am Meeresstrande angefallen und selbst ausgesaugt worden sei, sei wohl das Frechste, was sich jemals ein Angeklagter vor Gericht geleistet habe. Er ausgesaugt? Ja, wo denn? Er stehe doch da in voller blühender Gesundheit! Während die Familie des dicken Herrn und dieser selbst nirgend aufzufinden gewesen sei. Und dazu bestehe die Möglichkeit, daß diese Familie amerikanisch gewesen sei – oder englisch. So lange die Erde sich drehe, sei ein solches Verbrechen noch nicht vorgekommen – es sei einem Deutschen vorbehalten geblieben.
Dazu komme –
Er ließ die Hände sinken, legte das Blatt neben sich auf die Pritsche. Was noch, was noch? – Was sollte er antworten auf solche Beschuldigungen?
Tonlos fragte er den Redakteur: »Wozu bin ich verurteilt?«
Der sah ihn groß an. »Das wissen Sie nicht? – Zum Tode natürlich!«
Er wiederholte: »Zum Tode – natürlich! Zum elektrischen Stuhl!«
Aber der Tewes lachte. »Sie haben Ihr Gedächtnis verloren, Doktor. Keine Spur von elektrischem Stuhl! Sie sind zu derselben Todesart verurteilt, mit der Sie den dicken Herrn umgebracht haben. Erinnern Sie sich, mit welch puritanischer, echt amerikanischer Würde der Vorsitzende es aussprach, daß man zur alten Einfachheit dieses heiligen Landes zurückkehren, den verbrechentriefenden Bindestrichdeutschen hier ein warnendes Beispiel geben müsse?! Zurück von den modernen Sophistereien zu dem alten starren Bibelglauben: Auge um Auge, Zahn um Zahn! Sie werden ausgesogen werden auf elektro-mechanischem Wege, mittels einer zu diesem Zweck eigens konstruierten Schröpfkopfmaschine. Schauen Sie doch die Zeitungen an – überall ist schon die Maschine abgebildet – sie beruht auf dem alten Baunscheidtschen System.«
Er schüttelte unwillig den Kopf. »Unsinn! Der elektrische Stuhl ist die Todesart. So ist das Gesetz des Staates Neuyork!«
Tewes griff die Zeitungen auf, hielt sie ihm unter die Nase. »Lesen Sie, lesen Sie, wenn Sie mir nicht glauben wollen. Man hat das Gesetz umgeändert, hat ein neues geschaffen, eigens für Ihren Fall. Vorgestern ist die Bill durchgegangen in dem Kongreß des Staates, lesen Sie doch!«
Er sah in die Blätter – so war es, wirklich, so war es. Er nickte, seufzte dann, sagte: »Man macht schnell Gesetze in Albany!«
Der Journalist meinte: »Ja, ja – das muß man uns Amerikanern lassen: Gesetze machen können wir.«
– Dann hörte man Stimmen an der Türe und ein Rütteln und Schieben an den Schlössern und Riegeln. »Die Kollegen sinds,« rief Tewes. »Die Photographen und Reporter. Empfangen Sie sie – tun Sie mir den Gefallen. Ihnen kanns ja doch gleichgültig sein, was Sie tun in diesen letzten Stunden!«
Er sagte: »Gleich, gleich! Nur – entschuldigen Sie bitte – ich kann mit den engen Handschellen nicht schreiben. Nehmen Sie die Feder – ich möchte ein paar Zeilen diktieren – an meine Mutter –«
Aber der Redakteur schüttelte den Kopf. »Verlorene Zeit – verlorene Mühe, Doktor – wir werden doch den Brief nie hinüber bekommen. Ich will alle Zeitungsausschnitte über Prozeß und Hinrichtung hübsch sammeln und in ein Album kleben – das kann man ihr später übermitteln. Da hat die alte Dame eine hübsche Erinnerung.« Er sprang auf – plötzlich – lief zur Tür.
»Es sind nicht die Journalisten, Doktor!« rief er. »Es sind – es sind –«
Da faßte ihn die Angst. »Wer ist es? Wer?« fragte er.
Und Tewes antwortete: »Die – die Leute – die Sie holen wollen!«
»Schon?« schrie er. »Schon? Jetzt schon?« Er hörte den Lärm, unterschied auch die einzelnen Stimmen. Etwas war nicht in Ordnung am Schloß, man stieß und trat, als ob man die Türe sprengen wolle, er hörte ein Stöhnen in den Angeln. Noch hielt sie – o noch hielt sie!
Er wollte aufspringen, sich gegen die Tür stemmen, aber er kam nicht hoch. Er wollte schreien – und die Lippen gaben keinen Laut. Er schlotterte durch den ganzen Leib, zitterte jämmerlich, preßte die Hände fest zusammen.
»Heilige Jungfrau,« flüsterte er. »Allersüßeste Jungfrau! Mutter Gottes –«
Etwas betete in ihm:
»Quando corpus morietur,
Fac ut animae donetur
Tui Nati visio.«
Zu leisem Singen wurde das stammelnde Beten. Aus ihm kam es, aber er hörte, wie es rings im Räume erklang, in ihm und um ihm.
»Post virtutem Nati tui
Ora, ut electi sui
Ad patriam veniant!«
»Zurück,« flüsterte er, »zurück! In das Vaterland, heim – in meiner Mutter Haus. Zu meiner Mutter Maria –«
Da krachte ein heller Beilschlag auf das Schloß. Noch einer und ein dritter. Der Angstschweiß troff ihm von den Schläfen. Er starrte auf die wankende Türe. Riß dann, riß an den Handfesseln, mit unmenschlicher Kraft – die fielen klirrend herab –
Und er griff das Messer, das ihm zur Seite lag.
»Mögen sie kommen!« knirschte er. »Mögen sie kommen! Einer geht mit auf den Weg – einer – und mehr vielleicht!«
Da heulten die Angeln, da krachte die alte Tür, fiel schwer ins Zimmer. Da sprang er auf –
Ein rasches Knipsen – helles Licht überall. Das blendete –
Lotte van Neß stand vor ihm und Ernst Rossius. Hinter ihnen der alte Diener. Der hob still das Tabouret auf, das umgestürzt war, sammelte die Scherben der Teekanne und der Tassen.
Frank Braun ließ die Arme sinken – etwas fiel aus seinen Fingern; Fred nahm es auf vom Teppich, legte es auf das Tischchen. Lottes Messerchen war es.
Sie sah es wohl. Sie streckte die Hand aus, aber griff es nicht. Sie starrte ihn an, mit offenen Lippen, wandte den Blick ab, sah sich um rings im Raume. Und sah, lang ausgestreckt über den Ledersessel hin, die Frau liegen. Über der Armlehne lag ihr Kopf, tief herunter hing der linke Arm. Ihr Kleid war offen über der Brust.
Im Augenblick war Lotte bei ihr, bog sich über die Schlafende. Schrie auf – schrill und gell. Kam zurück zum Diwan, nahm das Messer auf, hob es hoch.
»Ich wußte es!« rief sie. »Ich wußte es.«
Frank Braun griff in den Ärmel seines Kimonos, zog ein Taschentuch heraus, wischte den Schweiß von Hals und Gesicht. »Was, Lotte, was?« fragte er.
Aber sie antwortete nicht. Sie stand wieder bei der Schlafenden, schob ihr das Kleid zurecht. »Heben Sie sie auf!« befahl sie. »Tragen Sie sie hinaus! In mein Auto!«
Rossius richtete die Tänzerin auf, stellte ihre Füße auf den Boden. Zog sie dann hoch, mit des Dieners Hilfe. Die Goyita stand, schwankend, taumelnd – aber sie stand. Schlug die blauen Augen weit auf, murmelte ein paar unverständliche Worte. Drohte umzusinken, schloß wieder die Lider, ließ sich willenlos hinausführen von den beiden.
Lotte van Neß trat auf ihn zu. Ihre Lippen bewegten sich; sie wollte etwas sagen und fand die Worte nicht. Nervös spielten ihre schmalen Finger mit dem Messerchen.
»Du,« flüsterte sie, »du –«
Aber sie kam nicht weiter. Ein heftiges Schluchzen riß ihre Brust, wilde Tränen brachen aus ihren Augen.
Er machte eine Bewegung hin zu ihr. »Was ist es, Lotte?«
Sie schüttelte den Kopf. Drehte sich scharf um, ging hinaus, ohne ein Wort.
Er lauschte. Er hörte ihren Tritt. Hörte von der Straße her Stimmen. Und das Schnaufen des abfahrenden Autos.
Was war denn geschehn?
Dann kam sein Sekretär zurück – lief gleich zu dem heftig schreienden Telephon.
»Ja! Ja!« rief er. »Wir kommen gleich! Sind schon fertig, ja! – In zehn Minuten steht der Doktor auf der Bühne. – Ganz sicher, ja!«
Er hing das Hörrohr ein. Rief dem alten Diener, der eben eintrat, zu, daß er gleich ein Taxicab holen solle. Wandte sich dann an Frank Braun.
»Es ist höchste Zeit, Doktor!« sagte er. »Neun Uhr vorbei! Sie müssen sich anziehn – wie fühlen Sie sich?«
Wie er sich fühlte? – Er machte ein paar Schritte, prüfte seine Muskeln. Herrgott, so wohl, wie seit Monden nicht!
Er entkleidete sich im Augenblick, sprang unter die kalte Dusche, während der junge Rossius den Frack zurecht legte, Hemd, Schleife, Lackschuhe. »Das war eine nette Geschichte,« lachte er. »Frau van Neß wird schön eifersüchtig sein! Eine fremde Dame hier bei Ihnen zu finden – schlafend, mit offenem Kleide dazu. – War sie denn hübsch? Ich hab kaum ihr Gesicht gesehen in all der Aufregung.«
Frank Braun antwortete nicht, rieb sich ab. griff das Hemd. »Warum zum Kuckuck habt ihr die Türe eingeschlagen?« fragte er.
»Warum?« antwortete der Sekretär. »Weil sie verschlossen war! – Warten Sie – da hinten fehlt das Knöpfchen! So hier ist der Kragen! – Über eine halbe Stunde haben wir vor der Türe gestanden, haben gerufen, geschrien, gebrüllt, mit Händen und Füßen gestoßen und getrampelt! Und keine Antwort – nur zuweilen ein Ächzen und Stöhnen und Seufzen. Wir dachten, es sei Ihnen gottweißwas geschehn!«
»Ich habe geschlafen,« sagte Frank Braun. »All die Zeit über, seit Sie fort waren. Geschlafen – und dummes Zeug geträumt. – Wie kam denn Frau van Neß her?«
»Ihr Auto fuhr vor, grade als ich ins Haus trat,« erwiderte Rossius. »Ich dachte, sie käme auch her, Sie abzuholen. – Hier ist die Weste! Und vergessen Sie nicht die Hosenknöpfe zuzumachen – neulich stand einer offen! Das macht sich schlecht beim Reden!«
Er half ihm in den Frack, dann in den Mantel. »Schnell, schnell!« rief er, »das Taxi wartet schon unten!«
* * *
Gesteckt voll war der mächtige Saal im Terrace-Garten: sie sangen grade, zweitausendstimmig, das Lied von Prinz Eugen.
»Einlage!« sagte der Vorsitzende, der an der Saaltür ihn empfing. »Zu Ehren unserer österreichischen Kollegen! – Kommen Sie, Doktor, es ist höchste Zeit!«
Er führte ihn an den Honoratiorentisch, vorne unter die Bühne, dicht bei der schmetternden Musik. Frank Braun schüttelte die Hände der Herrn, die da saßen, Ehrengäste spielen mußten in dieser Zeit, Abend für Abend fast, in Frack und weißer Binde. Den Konsuln, den Präsidenten der großen Vereine, den Hapag- und Lloydkapitänen der großen Dampfer.
»Auf Ihr Wohl, meine Herrn!« rief er, leerte ein großes Glas Gespritzten.
So jung fühlte er sich, so leicht und froh. Und er sang mit ihnen schallend hinaus in den weiten Saal:
»Prinz Eugenius, wohl auf der Rechten,
Tat als wie ein Löwe fechten,
Als General und Feldmarschall.
Prinz Ludewig ritt auf und nieder:
›Halt euch brav, ihr deutschen Brüder,
Greift den Feind nur herzhaft an!‹«
Die letzten Töne verklangen, der Vorsitzende erhob sich, ihn zu begrüßen. Ja so, nun mußte er gleich reden. Er besann sich, legte sich die ersten Sätze zurecht.
»Bitte, Kapitän,« wandte er sich an seinen Nachbar, »reichen Sie mir mal Ihr Programm. Ich muß doch wissen, worüber ich reden soll.«
»Ja, eigentlich schon!« schmunzelte der Kapitän, nahm den Zettel auf. »Da stehts: ›Wir und das Vaterland.‹«
Ja gewiß, das war es. Der Verein hatte das Thema ausgesucht, ihn besonders darum gebeten. Er hatte sich auch vorbereitet, gestern erst, wenigstens eine halbe Stunde lang. Aber er hatte den Faden gründlich vergessen, wußte nichts mehr, als nur die Worte, mit denen er schließen wollte – ein paar Verse von Grabbe.
›Da muß ich hin,‹ dachte er. ›Irgendwie muß ich dahin kommen.‹ O, es würde schon gehn.
Er stieg auf die Bühne, er nickte, dankte nach allen Seiten für das Klatschen. Er begann.
Froh war ihm und leicht. Und zum ersten Male freute er sich, daß er da stand vor Tausenden, und daß er sprach.
Er redete sehr rasch heute, viel schneller als gewöhnlich. Zu hastig fast, ohne Pausen, Satz schlagend an Satz. Aber auch einfacher, ohne Phrasen, sehr leicht und natürlich. Und doch fühlte er gut, wie die Menschen mit ihm gingen, wie sie jedes Wort gierig eintranken.
Sonst rang er mit dem Tiere da unten, dem vielköpfigen. Bändigte es, zwang es unter seinen Willen. Hielt es mit allen Nerven in seinem Bann.
Heute war es ein anderes. Er kämpfte nicht. Er wartete keine Wirkungen ab, verzichtete, ohne es doch zu wollen, auf alle Rednerkniffe. Ließ jede Kunst beiseite, überlegte nichts.
Heut war es, als ob das, was er sprach, nicht aus ihm komme. Als ob er nur der Mund sei, nur die eine Stimme der tausend Menschen. O ja, das war es: er war die Stimme ihrer Seele. Das machte: heute glaubte er an das, was er sprach.
Glaubte an die Heimat, glaubte an seiner Mutter Haus, glaubte an das Vaterland. Glaubte fest daran, daß sie alle – er und die da unten, Brüder seien und Schwestern – eines Blutes alle – deutschen Blutes –
Und er hob, zum ersten Male in seiner Rede, hoch seine Stimme, als er die Schlußworte sprach, zitternd in heißgläubiger Begeisterung. Als er seines deutschen Volkes Seele schallend hinaus jauchzte in den Saal:
»O, kein Donner an dem Himmel und kein Laut auf Erden, quoll er von schönster, süßester Lippe, gleicht an Macht dem Worte: Vaterland!«
Das glaubte er in diesem Augenblicke. Glaubte es innig und stark. Hob noch einmal seine Stimme, jubelte: »Vaterland!« – Und ein drittes Mal: »Vaterland!«
Und die Frauen und Männer da unten glaubten wie er, fühlten wie er. Standen auf – schrien, jauchzten das heilige Wort: »Vaterland!«
* * *
Rasch ging er ab in die Kulissen, wo Rossius wartete mit seinem Mantel. Fort nun, rasch weg. Sie gingen durch den Hinterausgang auf die Straße.
»Wo wollen Sie hin, Doktor?« fragte der Sekretär.
Er überlegte. »Wir könnten nachtmahlen – vielleicht bei –«
Aber er unterbrach sich. »Nein – nein. Ich habe noch etwas vor. – Auf morgen also!« Er reichte dem andern die Hand, ging langsam über die Straße zum Droschkenstand.
Stieg ein. »Parkavenue, Ecke dreiundfünfzigste Straße!« rief er dem Chauffeur zu.
Das war Lotte Lewis Haus. – Er mußte sie sehn in dieser Nacht.
* * *
Er wartete in der Bibliothek. Ging auf und nieder mit langen Schritten.
Endlich kam sie, grüßte leichthin, winkte ihm, Platz zu nehmen.
»Nun?« fragte er.
»Nun?« sagte sie. »Was – nun? Soll ich dir Erklärungen geben?«
Er trommelte mit den Fingern auf dem Tisch. »Wie du willst, Lotte. Jedenfalls gibt es da nichts, das ich vor dir verhehlen möchte. Willst du mir sagen, wie du so plötzlich ankamst.«
Sie lachte auf. »Das könntest du dir leicht selbst beantworten. Ich erwartete dich um sechs, und du kamst nicht. Ich wußte, daß du krank warst – so klingelte ich an gegen sieben. Über dreiviertel Stunden habe ich mit dem Hörrohr gesessen – das Telephonfräulein hat für mich getan, was es konnte. Du hattest das Telephon abgestellt.«
»Nein,« sagte er, »es war nicht abgestellt. Ich schlief, ich habe nichts gehört.«
»Dann mußt du sehr fest geschlafen haben, mein Freund!« rief sie. »Ununterbrochen hat es geschellt bei dir. Übrigens hast du mir heute mittag dasselbe gesagt.«
Er nickte. »Ja, Lotte, das weiß ich. Ich log – heute mittag. Ich lag da und war sehr müde. Und das Schellen quälte mich –. Als ich mit dir sprach, hatte ich nur ein Gefühl: so schnell wie möglich fertig zu sein. So sagte ich nur: ja und nein – wollte keine Fragen haben und keine langen Antworten geben. Da log ich – das kürzte das Gespräch ab.«
»Und jetzt?« fragte sie.
»Jetzt ist's die Wahrheit,« erwiderte er. »Ich habe nichts gehört. Ich schlief.«
Sie seufzte leicht. »Mag sein – ich glaube schon, daß es so war. Also du antwortetest nicht – da wurde ich unruhig. Wartete wieder – rief wieder an. Endlich bestellte ich mein Auto – fuhr zu dir. Vor der Tür fand ich deinen Sekretär – er half die Zimmertür aufbrechen – die du verschlossen hattest. Den Rest weißt du.«
»Wo ist das Mädchen?« fragte er.
Sie hob die Hand. »Hinten liegt sie, im Fremdenzimmer. Meine Zofe wacht bei ihr – sie schläft immer noch. Eben ging der Arzt fort – er sagt, sie müsse ein sehr starkes Rauschgift genommen haben – aber er wisse nicht, was.«
Er nickte. »Ja, ja, Mescal nahm sie. Zwei große Tassen voll – grade wie ich.« – Er erzählte ihr, daß es die spanische Tänzerin sei, von der er ihr gesprochen habe. Die von dem Fieberschiff, die er in Torreon wiedergetroffen habe, bei Pancho Villa. Erzählte ihr die kleine Episode, wie er vergebens versucht habe, Mescalknöpfe zu bekommen, wie die Goyita versprochen habe, ihm welche zu besorgen. Heute mittag sei sie gekommen – ganz unerwartet – eben als er das Telephongespräch beendet habe. Sie habe ihm die Kaktusfrüchte mitgebracht – er habe geglaubt, daß ihm die vielleicht helfen würden. – Übrigens habe er sich darin nicht geirrt: er fühle sich so gesund wie selten.
Lotte van Neß lachte laut. »So prachtvoll gesund!« rief sie. »Das glaube ich. Darum also kochtest du das Zeug und trankst es. Und gabst der Señorita gleich mit davon – vermutlich war sie neugierig, es zu kosten, was?«
»Es ist wirklich so,« antwortete er, »genau so. Sie hatte so viel reden hören vom Mescalrausch da unten in Mexiko, wollte es versuchen. Und, weiß Gott, Lotte – sie hatte mehr Vertrauen zu mir als du.«
Sie spottete: »O, ein felsenfestes Vertrauen! Das du völlig rechtfertigtest! – Ich weiß, ich weiß!«
Er wurde ärgerlich, stand auf, machte ein paar Schritte. »Ich gebe dir mein Wort, Lotte, ich habe sie nicht berührt.«
»Du lügst!« rief sie rasch.
Er blieb vor ihr stehn, wiederholte ernst: »Lotte, ich habe sie nicht angerührt.«
»Dann öffnete sie selbst ihr Kleid!«, höhnte sie.
»Ja!« erwiderte er. »Ehe wir einschliefen – auf dem Diwan ich, sie auf dem Sessel – sagte ich ihr, daß sie Hals und Brust frei machen solle, um leichter atmen zu können. Sie tat es. Ob du es nun glaubst oder nicht: ich bin nicht aufgestanden von meinem Diwan, habe sie nicht angerührt all die Zeit über. Nicht einmal die Hand gab ich ihr, als sie eintrat.«
Aber Lotte schüttelte den Kopf. »Und doch lügst du!« Sie trat an den Tisch, suchte herum, nahm das kleine Messerchen, reichte es ihm. Er öffnete es – die Klinge zeigte dicke, dunkle Flecke.
»Schmutzig ists,« sagte er. »Was solls?«
»Blutflecke!« sprach sie. »Siehst du nun, wie du lügst!'
Er sog die Luft ein, hielt mühsam an sich.
»Der Teufel hole deinen albernen Zauberfaxen!« rief er, warf im Bogen das Messer in das Kaminfeuer. »Heute belügt dich das Ding zum zweitenmal! Ich will dir was sagen, Lotte, auf dem Nachtfest der Monddamen betrog ich dich. Nahm die Breitauer. Oder: sie nahm mich – wie du willst! Einerlei: dein Messerchen blieb blitzblank – da schworst du auf meine Unschuld. Und doch, so wahr ich vor dir stehe, nahm ich sie.«
»Was gehts mich an!« rief sie. Wegwerfend, gleichgültig.
Aber er hörte nicht hin. »Und genau umgekehrt ists heute,« fuhr er fort. »Diesmal bin ich wirklich unschuldig – aber dein Messerchen ist blutbefleckt. Da bist du eifersüchtig.«
Sie nahm es auf. »Eifersüchtig?! Weißt du denn, was das ist, du? Ich weiß es – du hast michs gelehrt durch fünfzehn lange Jahre. Wenn man nicht schläft – im Bette sitzt – eine Nacht – noch eine Nacht – viele Nächte. Immer nur – immer nur denkt – an –«
Sie setzte sich, grub den Kopf in die Hände, stöhnte. Hob sich wieder mit einem Ruck, warf den Kopf zurück. »Eifersüchtig? O ja – auf alles, was du tust! Aber nicht mehr auf irgendeine Frau in der Welt als auf das Glas, das du an die Lippen führst, das Hemd, das du anziehst – das Bad, in das du steigst! Und nur eines gibts, eines nur – von dem ich will, daß es mein sei – eins nur!« Sie krampfte die Finger in die weiche Lehne, bog den Rumpf weit vor. Sagte: »Du nahmst – von einer andern – heute – was du nur nehmen solltest – von mir.«
Er stand vor ihr, senkte die Stimme. »Sieh, Lotte,« begann er, »warum sollte ich lügen? Ich sagte dir von der andern, das willst du nicht glauben. Die Spanierin nahm ich – nicht.«
Sie fuhr empor. »Wer spricht davon?« rief sie. »Daß du sie nicht nahmst, glaub mir – das weiß ich besser als du selbst!«
Er begriff nicht. »Wieso?« fragte er.
Sie zog die Lippen hinab, zuckte verächtlich die Achseln. »Es war eine Laune – ich ließ sie untersuchen von meinem Arzt. Seine Feststellung ist: Virgo intacta!«
Er starrte sie an, völlig verständnislos. »Ja – aber, Lotte – was denn noch? Was log ich dir dann? Und was – willst du noch?«
Sie strich mit der Hand über die Stirne. »Ob du sie nahmst – oder nicht – was liegt daran? Ob du jede nimmst – die dir über den Weg läuft – was machts mir aus? Schweig, schweig – du hast es getan – tust es heute noch. Tus nur, tus – es schmerzt mich, wenn ichs höre, o ja – immer noch. Aber du hast mich gewöhnt an solchen Schmerz, du! Das geht vorüber; ich küsse dich lachend, und du merkst nicht einmal, wie weh mir ist: so hast du mich gemacht. Dies aber – dies ist ein anderes!«
»Was denn, Lotte?« bat er.
Bitter genug klang es. »Zwei gute Augen hast du – die so klar sehn – und doch bist du blind. Das Messerchen da, das im Feuer glüht – das log nicht, das nicht! Das sprach die Wahrheit – erzählte mir alles, was du getan.«
Sie erhob sich schnell, trat dicht zu ihm hin. »Schau,« begann sie wieder, »ich will dir sagen, was es ist. Das Höchste, was ein Weib tun kann für den Mann, den sie liebt, eine Mutter für ihr einzig Kind, ein Heiland für die leidende Menschheit – das lehrtest du mich tun – das Allerherrlichste, das ewig Göttliche! – Und nun gehst du her – und nimmst das von irgendeiner – der ersten Besten grade, die deinen Weg kreuzt. Von einer dazu, die nicht einmal weiß, was geschah! Und die – wenn sie es wüßte – dich anspein würde! Das ist es.«
Er hörte jedes Wort – und verstand nichts. »Sag es noch einmal, Lotte,« bat er. »Etwas deutlicher –«
Aber sie schüttelte müde den Kopf. »Nein, nein, es nutzt nichts. Du wirst es doch nicht begreifen. Ein andermal vielleicht.«
Er nahm ihre Hand, streichelte sie. »Versuch es doch! Grade heute. Sonst bin ich müde oft, abgespannt, schwach – wie ausgeleert Hirn und Adern. Aber heute bin ich so klar und frisch – fühl mich stark und gesund.«
Da riß sie sich los, trat rasch zurück. Ein Ächzen faßte ihre Brust, ein Keuchen und Stocken. »Stark?« rief sie. »Gesund? – Wovon?!«
Er sagte: »Ich denke, der Absud hat mir geholfen. Der Mescal, mein ich.«
Wild klang ihr Schluchzen, hysterisch und gell. »Der Mescal?!« schrie sie. »Blut – Blut!«
Sie schritt an ihm vorbei, dicke Tränen fielen über die bleichen Wangen. Aber ihr Mund lachte, lachte: »Du Narr, du Narr – du dreimal blinder Narr!«
Sie ließ ihn stehn, verschwand in der Tür.