
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
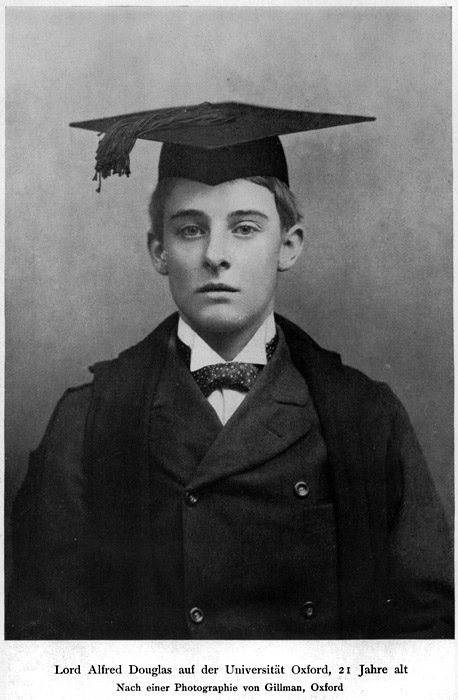
In meinem zehnten Jahr schickte man mich in eine Privatschule – ein Internat – das Lambrook hieß. Mein Bruder Drumlanrig (wir nannten ihn immer »Francie«), der vier Jahre älter war als ich, absolvierte dort damals sein viertes und letztes Jahr, ehe er nach Harrow kam. Da Percy später zur Marine gehen sollte, wurde er in eine Schule nach Portsmouth geschickt.
Lambrook war ein sehr »vornehmes« Internat, das heißt, in dem Sinne, daß es hauptsächlich Kinder des Hochadels zu seinen Schülern zählte. Darunter waren zwei Enkelkinder der Königin Viktoria, Prinz Viktor und Prinz Albert von Schleswig-Holstein, die die Königin öfter von Windsor aus besuchte; bei diesen Gelegenheiten verweilte sie meistens eine oder zwei Stunden auf unserem Kricketspielplatz. Aber als ich ungefähr ein Jahr dort war, gab es irgendeinen Skandal, hinter dessen Ursachen ich erst viele Jahre später kam, und die Schule wurde beinahe aufgelöst. Man schickte mich in ein anderes Internat, das Wixenford hieß und von einem Mr. Arnold geleitet wurde. Mein jüngerer Bruder Sholto kam gleich mit mir zusammen dorthin. Meine Erinnerungen an Wixenford sind lange nicht so angenehm wie die an Lambrook. Heute noch hege ich einen kleinen Groll gegen diese Schule, weil ich meiner Meinung nach um den Preis für Griechisch und Lateinisch »gebracht« wurde, einen Preis, den ich entschieden, wenn es nach den besten Noten gegangen wäre, errungen hätte, der aber aus irgendeinem mir unbekannten Grund Leveson, dem jetzigen Lord Granville, gegeben wurde.
Ich will aber damit nicht sagen, daß ich darum unfreundliche Gefühle gegen ihn hegte. Im Gegenteil, wir verstanden uns sehr gut. Seine Mutter, Lady Granville, und meine Mutter waren innig befreundet, und ich kann mich noch sehr gut an seinen Vater, den berühmten Lord Granville, erinnern und an den achttägigen Besuch, den meine Mutter und ich einmal auf Walmer Schloß machten. Leveson war damals weit und breit bekannt als »der Junge, der ein Zweiundeinhalbschillingstück verschluckte«. Diese »Heldentat« vollbrachte er eines Tages aus Versehen, während er vor einem bewundernden Kreis junger Kameraden seine »Jongleurkunststücke« ausführte, und mehrere Tage lang wurden die schlimmsten Befürchtungen seinetwegen gehegt. Aber es hat ihm nichts geschadet. Er war ein blonder Junge mit einem fast wächsernen Gesicht und glich auch etwas einer Puppe. Doch mein Busenfreund in Wixenford war ein Junge namens Shepherd. Er war ein Amerikaner, und seine Art zu sprechen faszinierte mich. Er pflegte mich »junger Hund« zu nennen, und Mr. Arnold, der etwas sarkastisch veranlagt war und diesen Sarkasmus gern an seinen Schülern übte, sagte eines Tages, als er zufällig von diesem Namen erfuhr: »Was für ein Hund? Wohl ein Windhund?« Und von dem Tage an nannte er mich, wenn er mich ärgern wollte, und das kam ziemlich häufig vor, »Windhund«. Das versetzte mich stets in eine solche Wut, daß ich manchmal vor Zorn darüber weinte. Warum ich es nicht vertragen konnte, von meinem Lehrer ein Windhund genannt zu werden, während es mich förmlich beseligte, wenn mein Herzensfreund »Junger Hund« zu mir sagte, gehört zu den Geheimnissen der Kindheit, die nie mehr gelöst werden können.
In meinen kindlichen Augen war Mr. Arnold – obgleich er keineswegs ein unfreundlicher Mann war – ein höchst beängstigendes Wesen. Er war sehr groß, hatte einen schwarzen Bart und starke Ähnlichkeit mit dem Bild des Nikolas im Struwwelpeter, und es schien mir, als ob er es besonders »auf mich abgesehen« hätte – obgleich ich hinzufügen muß, daß niemand in dieser Schule schlecht behandelt wurde und der Rohrstock so gut wie unbekannt war. Ich kann mich nur an zwei Jungen erinnern, die einmal »Schläge« bekamen (mit einer Birkenrute), aber das war das einzige Mal während der ganzen Zeit, die ich da war. Worin das Verbrechen dieser Jungen bestand, weiß ich nicht, jedenfalls muß man es als etwas sehr Schlimmes betrachtet haben. Mich hat Mr. Arnold immer nur mit Worten gestraft, aber da ich äußerst empfindlich und (leider muß ich es eingestehen!) zu Hause von meiner Mutter furchtbar verwöhnt worden war, litt ich sehr darunter. Als Kind galt ich für außergewöhnlich hübsch und hatte ein einschmeichelndes Wesen, so daß meine Mutter mir nicht widerstehen konnte oder wollte. Die Folge davon war natürlich, daß ich es in der Schule um so schwerer hatte.
Gerade deswegen ärgere ich mich stets, wenn ich ein verwöhntes Kind sehe. Lieber soll ein Kind allzu streng behandelt als verzogen werden. Die Erfahrung zeigt ja, daß das Leid gut für die Seele ist. Dieser Gedanke liegt meinem Gedicht In Excelsis zugrunde, das ich im Gefängnis in Stunden höchster seelischer Qual niederschrieb – jener Qual, die man leidet, wenn man von den Menschen, für die man sich aufgeopfert hat, ungerecht behandelt und mit Undank belohnt wird.
Unserem Heim fehlte der Vater. Daß unsere Mutter mich so verwöhnte, hätte mir nicht geschadet, wenn mein Vater ein richtiger Vater gewesen wäre und nur halb so viel Interesse für seine Kinder gehabt hätte wie für seine Hunde und Pferde. Wir bekamen ihn aber kaum zu Gesicht, und als er zum erstenmal in seinem Leben seine väterliche Autorität auszuüben versuchte, und zwar in einer sehr verletzenden Weise (ich meine damals, als er mir plötzlich befahl, mit Oscar Wilde zu brechen), trotzte ich ihm, worauf er rücksichtslos mein ganzes Leben zerstörte. Während meiner Kindheit und Jugend lastete der Schatten meines Vaters auf mir, denn obgleich ich ihn liebte und sogar eine maßlose Bewunderung für seine eingebildete heroischen Eigenschaften empfand, sah ich doch ganz gut, wie brutal er gegen meine Mutter war, und zwar schon lange, ehe sie sich gezwungen sah, sich von ihm scheiden zu lassen. Diesen Entschluß faßte sie erst, als ich sechzehn Jahre alt war.
Ich muß hier die Erklärung einschalten, daß meine Mutter sich niemals wieder verheiratete und auch nie eine derartige Absicht hegte, als sie sich scheiden ließ. Ich muß diese Tatsache erwähnen, weil sie jetzt Katholikin ist und die katholische Kirche bekanntlich die Ehescheidung nicht anerkennt, oder um mich genauer auszudrücken, den Geschiedenen eine Wiederverheiratung nicht gestattet. Mein Vater hingegen heiratete noch einmal; seine zweite Ehe wurde innerhalb sechs Monaten für ungültig erklärt.
Als ich mit etwa vierzehn Jahren Wixenford verließ, kam ich nach Winchester in die Schule. Es war mein brennender Wunsch gewesen, nach Eton zu kommen (hauptsächlich weil mein Busenfreund Shepherd dorthin geschickt wurde). Meine Mutter und ich waren uns auch schon darüber einig, als mein Vater im letzten Augenblick sich dagegen aussprach und kategorisch erklärte, daß keiner seiner Söhne zum »Citybummler« gemacht werden sollte, wie er sich ausdrückte, um seine eigentümliche Auffassung über die Erziehungsmethoden dieser weltberühmten Schule und deren Ergebnisse zu äußern! Das sah meinem Vater ähnlich. Persönliche Erfahrung über Eton oder eine sonstige Schule besaß er nicht, da er selber auf dem Schulschiff Britannia erzogen worden war, weil er zur Marine gehen sollte; aber wenn er einmal ein Vorurteil gegen etwas gefaßt hatte, war er durch keine Macht der Welt davon abzubringen.
Als ich nach Winchester kam, befand sich die Schule in einem Übergangsstadium. Kurz vor meiner Zeit war das Internat noch wegen der dort herrschenden Brutalität bekannt. Ich erlebte sogar noch das letzte Jahr, in dem jene Zustände erlaubt waren, die ohne Übertreibung sehr viel Ähnlichkeit hatten mit denen, die in »Tom Browns Schulzeit« beschrieben worden sind. In Winchester gab es einen Jungen, der zu dem Flashman des soeben erwähnten Buchs sehr gut als Vorbild gedient haben konnte. Ich weiß noch sehr gut, wie ich mir überlegte, daß meine Eltern wohl ohne Verstand gewesen sein mußten, mich in eine solche Hölle zu schicken. Es widerstrebt mir zwar, Nachteiliges über meine alte Schule zu sagen, aber sie war offengestanden ein wahrer Sündenpfuhl. Die ersten achtzehn Monate, die ich dort verbrachte, sind mir jetzt noch wie ein Albdrücken, wenn ich daran zurückdenke. Nachher hatte ich mich an die Zustände so gewöhnt und mich dem dort herrschenden moralischen oder vielmehr unmoralischen Niveau so angepaßt, daß das ganze anfing, mir Spaß zu machen. Als ich dorthin kam, war ich ein sehr empfindsamer, verträumter Junge mit einer leidenschaftlichen Liebe für alles Reine und Ideale. Von meiner Mutter hatte ich gelernt, das Schöne, Wahre, Reine von ganzer Seele zu lieben, außerdem besaß ich von Natur einen ausgeprägten Sinn für alles Erhabene; mit acht Jahren schon zog ich Romeo und Julia und Heinrich IV. allen Kindermärchen vor, sogar auch denen meines noch heute geliebten Andersen; ich schwärmte für Musik und war von klein auf gewöhnt, in Häusern zu leben, in denen meine Augen auf schönen Bildern, herrlichen Gobelins ruhten und jene vollkommene Harmonie herrschte, die der gute Geschmack mit sich bringt. Als ich Winchester verließ, war ich weder besser noch schlechter als meine Kameraden – das heißt, ich war moralisch vollkommen verdorben, zu jeder Gemeinheit fähig. Natürlich will ich damit nicht sagen, daß ich oder meine Schulkameraden alles vergessen hatten, was wenigstens einige von uns zu Hause gelernt hatten, aber unser Wissen war um alle jene Dinge bereichert worden, die man in unseren vielgelobten englischen Internaten lernt. Da diese Offenheit die meisten Engländer wahrscheinlich in Zorn geraten läßt, will ich lieber nichts mehr darüber sagen. Wenn jemand gern wissen möchte, was ich über protestantische Internate in England denke, so möchte ich ihn auf die Schriften von W. G. Ward aufmerksam machen und auf »W. G. Ward und die Oxforder Bewegung«, von seinem Sohn geschrieben, dem kürzlich verstorbenen Wilfred Ward. »Ideal«-Ward hatte auch die Schule in Winchester besucht und sprach wie ich aus eigener Erfahrung. Als mein Sohn Raymond neun Jahre alt wurde, war ich mir ganz klar, daß ich ihn lieber tot als in einem protestantischen Internat sehen mochte, und obgleich ich deswegen einen schweren Kampf mit meinem Schwiegervater, Oberst Custance, ausfechten mußte, habe ich meinen Jungen doch vor dem Schicksal seines Vaters bewahrt. Er besuchte eine katholische Schule und ist infolgedessen mit fünfundzwanzig Jahren noch ebenso unverdorben wie ich, als ich nach Winchester kam.
Mein bester Freund in Winchester war Encombe, mit dem ich nachher in Oxford zusammenwohnte. Wie fast alle die wenigen Freunde, die mir treu blieben, nachdem ich aus der Gesellschaft ausgestoßen war, ist auch dieser Freund tot. Die Vorsehung hat es anscheinend nie gewollt, daß ich einen im weltlichen Sinn »mächtigen« Freund behielt. Wenn Encombe nicht so früh gestorben wäre, hätte sich mein Schicksal sicher ganz anders gestaltet. Dasselbe gilt für meinen Freund George Wyndham, der sich erst in den letzten Monaten seines Lebens mit mir befreundete, nachdem er mich zwanzig Jahre lang vollkommen mißverstanden und falsch beurteilt hatte. Der beste Beweis für den wertvollen Charakter Wyndhams ist die Tatsache, daß er erst mein Freund wurde, als ich nach dem Verleumdungsprozeß Ransome, den ich verlor (davon werde ich später ausführlich berichten), für vollkommen »erledigt« galt. Gerade weil ich in den Augen der Welt »erledigt« war, eilte er mir zu Hilfe, obgleich er sich damals im Grunde genommen nichts aus mir machte. Wäre er schon früher mein Freund gewesen, hätte er es nie fertiggebracht, mich in der Not im Stich zu lassen wie so viele andere, auch aus seiner und meiner eigenen Familie, die sich doch nicht damit entschuldigen konnten, daß ich ihnen gleichgültig gewesen sei. Ich bin oftmals in Versuchung gekommen, die Engländer im Gegensatz zu den Schotten als die feigsten, treulosesten Menschen, die es überhaupt auf der ganzen Welt gibt, zu bezeichnen. Ich habe auch wirklich allen Grund, so zu denken, denn ein englischer Freund nach dem anderen hat mich im Stich gelassen, verraten und verkauft, wenn sie alles aus mir herausgezogen hatten, was sie konnten. Habe ich aber dieses Stadium der Verbitterung erreicht, was von Zeit zu Zeit noch vorkommt, so steigen Erinnerungen an Encombe und George Wyndham in mir auf, und um ihretwillen nehme ich alles zurück, was ich über die Engländer gesagt habe.
Ich besitze noch eine Menge Briefe von George Wyndham. Ich bot sie zwar dem Verlag an, der eine Sammlung seiner Briefe herausbrachte, aber man schien keinen Gebrauch davon machen zu wollen. Das ist ganz amüsant, da sie in hundert oder vielleicht schon in fünfzig Jahren einen viel größeren Wert haben werden als alle seine anderen Briefe zusammen, gerade weil sie an mich geschrieben waren. Wenn jemand jetzt einwendet, daß eine solche Äußerung unglaublich arrogant klingt, so kann ich nur antworten, daß ein Mann in meinem Alter das Recht hat, in seiner Biographie die Wahrheit über sich zu sagen. Er ist dazu nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet.
Ich kann diese Erinnerungen an meine Kindheit und Schulzeit nicht beenden, ohne meinen Großonkel, den hochgeborenen Percy Wyndham (Georges Vater), und seine Frau, meine Großtante Madeline Wyndham, zu erwähnen, an die ich stets mit Dankbarkeit und Verehrung denke. So viele Menschen haben bereits von Tante Madeline, vom Zauber ihrer Persönlichkeit, von ihrer Wohltätigkeit, ihrer Güte, ihrer außerordentlichen Begabung gesprochen, daß mir eigentlich nichts mehr zu sagen übrigbleibt. Onkel Percy war in seiner Art ebenso bezaubernd. Obgleich er meistens allen Leuten Furcht einflößte, war er meiner Meinung nach der gütigste und liebenswürdigste Mensch, der je gelebt hat. Er besaß auch hohe Intelligenz und großen Scharfsinn und hatte einen unfehlbaren Blick für Heuchelei oder Schwindel. Dabei war er sehr bescheiden und sogar schüchtern; wenn es in seinem Schloß Clouds einmal vorkam, daß er seine Gefühle angesichts irgendwelcher »moderner« Anschauungen nicht beherrschen konnte, zog er sich einfach in sein Arbeitszimmer zurück und schloß die Tür hinter sich. Er besaß sehr viel Lebensweisheit und jenen vollendeten Geschmack, der sich nicht von bloßen vorübergehenden Moden blenden läßt. Als ich die Zeitschrift »The Academy« leitete und er mir schrieb, wie er diese Zeitschrift liebe, weil sie für »viele jener ihm teueren Ideale einträte, die er schon für tot und auf ewig aus der modernen Gesellschaft verschwunden geglaubt hatte«, war ich auf dieses Lob stolzer als auf irgendein anderes, das ich während meiner ganzen journalistischen Karriere erhielt. Der Beifall Onkel Percys entschädigte mich vollauf für die Mißbilligung mancher degenerierten Mitglieder seiner Familie, zu denen eine Dame gehört, die mir einmal sagte, als ich ihr Onkel Percys Brief zitierte: »Ach, der gute arme Onkel Percy versteht nicht viel von Literatur«, und dann hinzufügte, anscheinend um mich vollends zu zerschmettern, daß ›Mr. Asquith »The Academy« gar nicht billige!‹ Ich versicherte ihr, daß dies nur schmeichelhaft für mich sein könne, aber ich zweifle, ob sie an meinen Ernst glaubte, obwohl es mein voller Ernst war. Ich habe niemals den Beifall oder die Unterstützung der Familie Asquith gesucht oder erstrebt. Wenn ich es gewollt hätte, wäre es mir ein leichtes gewesen, sie zu gewinnen. Als ich »The Academy« ungefähr neun Monate geleitet hatte, lud mich meine Cousine Lady Grey of Falloden (damals Lady Temlant und nachher Lady Glenconner) zu einem Abendessen ein, zu dem sie auch ihren Schwager Asquith (den verstorbenen Lord Oxford und Asquith) gebeten hatte, und forderte mich auf, alle Mitarbeiter der »Academy« mitzubringen. Asquith war damals Premierminister, und ich mißbilligte aufs heftigste die Art, wie er angeblich die Interessen der Nation wahrnahm, besonders seine Unterrichts- und Gewerbevorlagen, zu deren Vereitelung ich viel beitrug. Darum sagte ich meiner Cousine, daß ich keinen Wert darauf legte, mit Mr. Asquith zusammenzukommen, und das geplante Abendessen fiel ins Wasser.
Dies alles gehört jedoch einem viel späteren Zeitabschnitt meines Lebens an, und ich muß in meinem nächsten Kapitel zu der Zeit zurückkehren, von der ich eben abgeschweift bin.