
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Bei der Ansicht, daß es nur eine vorläufige Kenntnis sein soll, welche Se. Königliche Hoheit der Kronprinz durch mich von der Kriegskunst erhalten, und daß Höchstdieselben dadurch in den Stand gesetzt werden sollen, die neuere Kriegsgeschichte zu verstehen, kommt es mir vorzüglich darauf an, dem Prinzen eine deutliche Vorstellung vom Kriege zu geben, und zwar auf einem Wege, der nicht zu weitläufig ist und des Prinzen Kräfte nicht zu sehr in Anspruch nimmt.
Bei dem Studium einer Wissenschaft, die man aus dem Grunde erlernen will, wird erfordert, daß man derselben seine Kräfte eine Zeitlang vorzugsweise widmet, und dies scheint bei dem Kronprinzen noch zu früh zu sein.
Ich habe aus diesen Rücksichten den folgenden Weg gewählt, der mir der natürlichen Ideenreihe eines jungen Manne am nächsten zu liegen schien.
Mein höchstes Bestreben wird dabei sein, einmal, dem Prinzen immer verständlich zu bleiben, weil sonst bei dem aufmerksamsten Schüler sehr bald Langeweile, Zerstreuung und Ekel vor dem Gegenstande eintritt; zweitens, ihm keine falschen Vorstellungen in irgend einer Sache zu geben, wodurch einem ausführlichen Unterrichte oder seinem eigenen Studium Schwierigkeiten in den Weg gelegt würden.
Um des ersten Zweckes willen werde ich den Gegenstand stets an den natürlichen Menschenverstand so nahe als möglich anzuknüpfen suchen und mich darüber oft von dem wissenschaftlichen Geiste und von den Formen der Schule entfernen.
Ich lege nun Ew. Hochwohlgeboren den flüchtig entworfenen Plan vor und bitte, meine Ansicht, wo sie nicht mit der Ihrigen übereinstimmt, gütigst berichtigen zu wollen.
Außer einer vorläufigen Kenntnis der Waffen- und Truppenarten sind es doch vorzüglich die sogenannte angewandte oder höhere Taktik und die Strategie, von welchen man einige Begriffe haben muß, um die Kriegsgeschichte zu verstehen. Die Taktik oder Gefechtslehre ist eigentlich die Hauptsache, teils weil die Gefechte entscheiden, teils weil in ihr am meisten zu lehren ist. Die Strategie oder die Lehre von der Kombination der einzelnen Gefechte zum Zwecke des Feldzuges ist mehr ein Gegenstand der natürlichen und gereiften Urteilskraft; doch müssen die darin vorkommenden Gegenstände wenigstens deutlich gemacht und in ihrem Zusammenhange gezeigt werden.
Die Feldfortifikation erhält in einem solchen übersichtlichen Kursus am zweckmäßigsten ihre Stelle bei der Lehre von der Verteidigung in der Taktik, die permanente Fortifikation in oder hinter der Strategie.
Die Taktik selbst hat zwei verschiedene Arten von Gegenständen. Die einen können verstanden werden, ohne Begriffe von dem strategischen Zusammenhange des Ganzen zu haben; dahin gehört die Stellung und Fechtart aller kleineren Teile von der Kompagnie und Eskadron bis zur Brigade von allen Waffen, in allen Terrainarten. Die andern hängen mit strategischen Vorstellungen zusammen; dahin gehört das Verhalten ganzer Korps und Armeen im Gefechte, Vorposten, kleiner Krieg usw., weil hier die Begriffe Position, Schlacht, Marsch u. s. w. eintreten, die ohne Vorstellungen vom Zusammenhange des ganzen Feldzuges nicht verstanden werden können.
Ich werde daher beide Arten von Gegenständen trennen, mit einer ganz oberflächlichen Darstellung des Krieges den Anfang machen, dann die Taktik oder das Verhalten im Gefechte der kleineren Teile folgen lassen und bei der bloßen Aufstellung (Schlachtordnung) ganzer Korps und Armeen stehen bleiben, um erst noch einmal zur Übersicht des Feldzuges zurückzukehren und den Zusammenhang der Dinge genauer anzugeben; dann werde ich die übrigen Kapitel von der Taktik folgen lassen.
Die Strategie endlich werde ich wieder mit der Vorstellung von dem Laufe eines Feldzuges beginnen, um die Gegenstände unter diesem neuen Gesichtspunkte zu betrachten.
Hieraus entspringt nun folgende Ordnung:
Waffen.
Pulver, Musketen, Büchsen, Kanonen mit ihrem Zubehör.
Artillerie.
Begriff von Schuß- und Wurfladungen.
Bedienung des Geschützes.
Organisation einer Batterie.
Kosten des Geschützes und der Munition.
Wirkung des Geschützes; – Schußweiten; – Wahrscheinlichkeit des Treffens.
Andere Truppenarten.
Kavallerie, – leichte, schwere.
Infanterie desgl.
Formation; – Bestimmung; – Charakter.
Angewandte oder höhere Taktik.
Ein allgemeiner Begriff vom Kriege, – Gefechte.
Stellung und Fechtart kleiner Truppenabteilungen.
Eine Kompagnie Infanterie mit und ohne Artillerie in allen Arten von Terrain.
Eine Eskadron Kavallerie ebenso.
Beide zusammen.
Immer in den verschiedenen Terrainarten.
Schlachtordnung eines Korps von mehreren Brigaden.
Schlachtordnung einer Armee von mehreren Korps.
Die beiden letzten Titel ohne Beziehung aufs Terrain, weil sonst der Begriff von Position eintritt.
Genauere Darstellung eines Feldzuges.
Organisation der Armee bei Eröffnung des Feldzuges.
Während sie marschiert und Stellungen nimmt, bedarf sie der Sicherheitsanstalten, Vorposten, Patrouillen, Rekognoszierungen. – Detachements. – Kleiner Krieg.
Wenn die Armee Stellungen wählt, so bedürfen sie solcher Anordnungen, daß die Armee sich in denselben verteidigen kann. Taktische Defensive. – Verschanzungen.
Angriff des Feindes in solchen Stellungen. – Verhalten im Gefechte selbst. – Schlacht. – Rückzug. – Verfolgen.
Märsche. – Flußverteidigungen; – Flußübergänge. – Postierungen. – Kantonierungen.
Strategie.
Übersicht eines Feldzuges und eines ganzen Krieges in strategischer Hinsicht.
Was den Erfolg im Kriege bestimmt.
Operationsplan.
Operationsplan. – Einrichtung der Verpflegung.
Angriffskrieg.
Verteidigungskrieg.
Positionen; – Postierungen; – Schlachten; – Märsche; – Flußverteidigungen und Übergänge.
Kantonierungen. – Winterquartiere.
Gebirgskrieg.
Kriegssystem etc. etc.
Die permanente Fortifikation und der Belagerungskrieg gehen der Strategie entweder voran oder machen den Beschluß des Ganzen.
Diese Grundsätze, obgleich das Resultat längeren Nachdenkens und eines fortgesetzten Studiums der Kriegsgeschichte, sind gleichwohl nur ganz flüchtig aufgesetzt und dulden in Rücksicht auf ihre Form durchaus keine strenge Kritik. Übrigens sind von den zahlreichen Gegenständen nur die wichtigsten herausgehoben, weil es wesentlich auf eine gewisse Kürze ankam. Es können daher diese Grundsätze Ew. Königlichen Hoheit nicht sowohl eine vollständige Belehrung gewähren, als sie vielmehr Veranlassung zu eigenem Nachdenken werden und bei diesem Nachdenken zum Leitfaden dienen sollen.
I. Grundsätze für den Krieg überhaupt.
1. Die Theorie des Krieges beschäftigt sich zwar vorzüglich damit, wie man auf den entscheidenden Punkt ein Übergewicht von physischen Kräften und Vorteilen erhalten könne; allein wenn dieses nicht möglich ist, so lehrt die Theorie auch auf die moralischen Größen rechnen: auf die wahrscheinlichen Fehler des Feindes, auf den Eindruck, welchen ein kühnes Unternehmen macht u. s. w., ja auf unsere eigene Verzweiflung. Dieses alles liegt gar nicht außer dem Gebiete der Kriegskunst und ihrer Theorie, denn diese ist nichts als ein vernünftiges Nachdenken über alle Lagen, in welche man im Kriege kommen kann. Die gefährlichsten dieser Lagen muß man sich am häufigsten denken und am besten darüber mit sich einig werden. Das führt zu heroischen Entschlüssen aus Gründen der Vernunft.
Wer Ew. Königlichen Hoheit die Sache je anders vorstellt, ist ein Pedant, der Ihnen durch seine Ansichten nur schädlich werden kann. Sie werden in großen Momenten des Lebens, im Getümmel der Schlacht, einst deutlich fühlen, daß nur eine solche Ansicht da aushelfen kann, wo Hilfe am nötigsten ist und wo eine trockene Zahlenpedanterie uns im Stiche läßt. –
2. Natürlich sucht man im Kriege immer die Wahrscheinlichkeit des Erfolges auf seine Seite zu bekommen, sei es, indem man auf physische oder auf moralische Vorteile zählt. Allein dieses ist nicht immer möglich; man muß oft etwas gegen die Wahrscheinlichkeit des Gelingens unternehmen, wenn man nämlich nichts Besseres tun kann. Wollten wir hier verzweifeln, so hörte unsere vernünftige Überlegung gerade da auf, wo sie am notwendigsten wird, da, wo sich alles gegen uns verschworen zu haben scheint.
Wenn man also auch die Wahrscheinlichkeit des Erfolges gegen sich hat, so muß man das Unternehmen darum nicht für unmöglich oder unvernünftig halten; vernünftig ist es immer, wenn wir nichts Besseres zu tun wissen und bei den wenigen Mitteln, die wir haben, alles so gut als möglich einrichten.
Damit es in einem solchen Falle nicht an Ruhe und Festigkeit fehle, die im Kriege immer am ersten in Gefahr kommen, und die in einer solchen Lage so schwer zu bewahren sind, ohne welche man aber mit den glänzendsten Eigenschaften des Geistes nichts leistet, muß man sich mit dem Gedanken eines ehrenvollen Unterganges vertraut machen, ihn immerfort bei sich nähren, sich ganz daran gewöhnen. Seien Sie überzeugt, gnädigster Herr, daß ohne diesen festen Entschluß sich im glücklichsten Kriege nichts Großes leisten läßt, geschweige denn im unglücklichen.
Friedrich II. hat dieser Gedanke gewiß während seiner ersten schlesischen Kriege oft beschäftigt; weil er vertraut damit war, unternahm er an jenem denkwürdigen 5. Dezember den Angriff bei Leuthen, nicht weil er herausgerechnet hatte, daß er mit der schiefen Schlachtordnung die Österreicher höchstwahrscheinlich schlagen würde.
3. Bei allen Operationen, welche Sie in einem bestimmten Falle wählen, bei allen Maßregeln, die Sie ergreifen können, bleibt Ihnen immer die Wahl zwischen der kühnsten und der vorsichtigsten. Einige Leute meinen, die Theorie rate immer das Vorsichtigste. Das ist falsch. Wenn die Theorie Rat erteilt, so liegt es in der Natur des Krieges, daß sie das Entscheidendste, also das Kühnste raten wird; aber sie überläßt es dem Feldherrn, nach dem Maßstabe seines eigenen Mutes, seines Unternehmungsgeistes, seines Selbstvertrauens zu wählen. Wählen Sie also nach dem Maße dieser inneren Kraft, aber vergessen Sie nicht, daß kein Feldherr groß geworden ist ohne Kühnheit.
II. Taktik oder Gefechtslehre.
Der Krieg besteht aus einer Kombination von vielen einzelnen Gefechten. Wenn nun diese Kombination auch weise oder unvernünftig sein kann und davon der Erfolg zum großen Teile abhängt, so ist doch zunächst das Gefecht selbst noch wichtiger; denn nur die Kombination von glücklichen Gefechten gibt gute Erfolge. Das Wichtigste im Kriege bleibt also immer die Kunst, seinen Gegner im Gefechte zu besiegen. Hierauf können Ew. Königliche Hoheit nicht Aufmerksamkeit und Nachdenken genug verwenden. Folgende Grundsätze halte ich für die wichtigsten.
1. Allgemeine Grundsätze.
A. Für die Verteidigung.
1. Seine Truppen bei der Verteidigung so lange als möglich verdeckt zu halten. Da man, nur den Moment ausgenommen, in welchem man selbst angreift, immer angegriffen werden kann, also zur Verteidigung bereit sein muß, so muß man sich auch immer so verdeckt als möglich aufstellen.
2. Nicht alle seine Truppen gleich ins Gefecht zu bringen. Begeht man diesen Fehler, so hört alle Weisheit in der Führung des Gefechts auf; nur mit disponibeln Truppen kann man dem Gefechte eine andere Wendung geben.
3. Sich wenig oder gar nicht um die Größe seiner Front zu bekümmern, da sie an sich etwas Gleichgültiges ist, und die Tiefe der Stellung (nämlich die Anzahl der Korps, welche man hintereinander aufstellt) durch die Ausdehnung der Front beschränkt wird. Truppen, die man hinter seiner Front hat, sind disponibel; sie können sowohl gebraucht werden, um das Gefecht auf dem nämlichen Punkte zu erneuern, als auch um mit demselben auf andern, danebenliegenden Punkten zu erscheinen. Dieser Punkt folgt aus dem vorigen.
4. Da der Feind oft zugleich überflügelt und umfaßt, während er einen Teil der Front angreift, so sind die hintenstehenden Korps geeignet, dem zu begegnen, also den Mangel einer Anlehnung an Terrainhindernisse zu ersetzen. Sie sind dazu mehr geeignet, als wenn sie mit in der Linie ständen und die Front verlängerten, denn der Feind würde sie in diesem Falle selbst leicht umgehen. Auch dieser Punkt bestimmt den zweiten näher.
5. Hat man viele Truppen, die man zurückstellt, so muß nur ein Teil gerade hinter der Front stehen; den andern stellt man seitwärts zurück.
Von dieser letzteren Stellung aus kann man die feindlichen Kolonnen, welche uns umgehen, selbst wieder in die Flanke nehmen.
6. Ein Hauptgrundsatz ist: sich nie ganz passiv zu verhalten, sondern den Feind, selbst während er uns angreift, von vorn und von der Seite anzufallen. Man verteidigt sich also aus einer gewissen Linie, nur um den Feind zu veranlassen, seine Kräfte zum Angriff derselben zu entwickeln, und geht dann mit andern, zurückgehaltenen Truppen zum Angriff über. Wie Ew. Königliche Hoheit einmal selbst ganz vortrefflich gesagt haben, soll die Verschanzungskunst dem Verteidiger nicht dienen, sich wie hinter einem Walle mit mehr Sicherheit zu wehren, sondern den Feind mit mehr Erfolg anzugreifen, – eben dies gilt von jeder passiven Defensive; sie ist immer nur das Mittel, den Feind in der Gegend, welche man sich ausersehen, in der man seine Truppen disponiert, die man für sich eingerichtet hat, mit Vorteil anzufallen.
7. Dieser Angriff in der Verteidigung kann in dem Augenblick stattfinden, wo der Feind uns wirklich angreift, oder während er im Marsch gegen uns begriffen ist. Er kann auch so geschehen, daß man seine Truppen, wenn der Feind sich zum Angriff anschickt, zurücknimmt, ihn dadurch in ein fremdes Terrain hineinzieht und dann von allen Seiten über ihn herfällt. Für alle diese Dispositionsarten ist die tiefe Aufstellung, nämlich die Aufstellung, in welcher man nur zwei Drittel oder die Hälfte seiner Armee oder noch weniger in Front hat und das übrige gerade und seitwärts dahinter womöglich versteckt aufstellt, sehr passend; darum ist diese Aufstellungsart von unendlicher Wichtigkeit.
8. Wenn man also zwei Divisionen hat, so werden sie besser hinter- als nebeneinander stehen; von drei Divisionen würde wenigstens eine zurückzustellen sein; bei vier wahrscheinlich zwei, bei fünf wenigstens zwei, in manchen Fällen wohl drei u. s. w.
9. Auf den Punkten, wo man passiv bleibt, muß man sich der Verschanzungskunst bedienen, aber in lauter einzelnen geschlossenen Werken von starken Profilen.
10. Bei dem Plan, welchen man sich für das Gefecht entwirft, muß man einen großen Zweck im Auge haben, z. B. den Angriff einer großen feindlichen Kolonne und den vollkommenen Sieg über dieselbe. Wählt man einen kleinen Zweck, während der Feind einen großen verfolgt, so kommt man offenbar zu kurz. Man spielt mit Talern gegen Pfennige.
11. Hat man sich in seinem Verteidigungsplane einen großen Zweck (die Vernichtung einer feindlichen Kolonne etc.) vorgesetzt, so muß man diesen mit der höchsten Energie, mit dem Aufwande aller Kräfte verfolgen. In den meisten Fällen wird der Angreifende seinem Zwecke auf einem andern Punkte nachgehen; während wir auf seinen rechten Flügel fallen, wird er suchen, mit seinem linken entscheidende Vorteile zu erringen. Lassen wir nun früher nach als der Feind, verfolgen wir unsere Absicht mit weniger Energie als er, so wird er seinen Zweck ganz erreichen, seinen Vorteil ganz erkämpfen, während wir den unsrigen nur halb erlangen. So gewinnt der Feind das Übergewicht, so wird der Sieg sein, und wir müssen auch den halb errungenen Vorteil fahren lassen. Lesen Ew. Königliche Hoheit die Geschichte der Schlachten von Regensburg und Wagram mit Aufmerksamkeit, so wird Ihnen dies als wahr und wichtig erscheinen.
In beiden griff der Kaiser Napoleon mit seinem rechten Flügel an und suchte mit dem linken zu widerstehen. Eben das tat der Erzherzog Karl. Aber jener tat es mit aller Entschlossenheit und Energie, dieser war unentschlossen und blieb immer auf dem halben Wege stehen. Was er mit dem siegreichen Teile seiner Armee erfocht, waren unbedeutende Vorteile, was der Kaiser Napoleon in derselben Zeit auf dem entgegengesetzten Punkte errang, war entscheidend.
12. Lassen Sie mich die beiden letzten Grundsätze noch einmal zusammenfassen, so geben sie durch ihre Verbindung ein Produkt, welches unter allen Ursachen des Sieges in der heutigen Kriegskunst als die erste angesehen werden muß, nämlich: einen großen, entscheidenden Zweck mit Energie und Beharrlichkeit zu verfolgen.
13. Die Gefahr im Falle des Nichtgelingens wächst dadurch, das ist wahr; aber die Vorsicht auf Unkosten des Zweckes zu vermehren, ist keine Kunst, sondern eine falsche Vorsicht, die wie bereits gesagt, der Natur des Krieges entgegen ist; für große Zwecke muß man Großes wagen. Die rechte Vorsicht besteht darin, daß, wenn man etwas im Kriege wagt, man die Mittel zur Erreichung des Zweckes sorgfältig wähle und anwende und keins aus Trägheit oder Leichtsinn verabsäume. Dieser Art war die Vorsicht des Kaisers Napoleon, der nie große Zwecke aus Vorsicht furchtsam und mit halben Schritten verfolgt hat.
Denken Sie, gnädigster Herr, an die wenigen Defensivschlachten, die in der Geschichte als gewonnen ausgezeichnet sind, so werden Sie finden, daß die schönsten darunter in dem Geiste der hier gegebenen Grundsätze geführt wurden, denn eben das Studium der Kriegsgeschichte hat diese Grundsätze an die Hand gegeben.
Bei Minden erschien der Herzog Ferdinand plötzlich auf einem Schlachtfelde, auf welchem der Feind ihn nicht erwartet hatte, und ging zum Angriff über, während er bei Tannhausen hinter Schanzen sich passiv wehrte.
Bei Roßbach warf sich Friedrich II. auf einem Punkt und in einem Augenblick dem Feinde entgegen, wo sein Angriff nicht erwartet wurde.
Bei Liegnitz trafen die Österreicher in der Nacht den König in einer ganz andern Stellung, als sie ihn tags vorher gesehen hatten; er fiel mit der ganzen Armee über eine Kolonne der feindlichen her und schlug diese, ehe die andern zum Gefechte kommen konnten.
Bei Hohenlinden hatte Moreau fünf Divisionen in seiner Front und vier in seinem Rücken und seitwärts hinter sich. Er umging den Feind und fiel auf seine rechte Flügelkolonne, ehe diese noch ihren Angriff ausführen konnte.
Bei Regensburg verteidigte sich der Marschall Davoust passiv, während Napoleon mit dem rechten Flügel das fünfte und sechste Armeekorps angreift und total schlägt.
Bei Wagram waren die Österreicher zwar die eigentlichen Verteidiger, doch kann man, da sie am zweiten Tage mit dem größten Teil ihrer Macht den Kaiser angriffen, auch diesen als den Verteidiger betrachten. Mit seinem rechten Flügel greift er den österreichischen linken an, umgeht und schlägt ihn, während er sich um seinen ganz schwachen linken Flügel (derselbe bestand aus einer einzigen Division) an der Donau nicht bekümmert, aber durch starke Reserven (tiefe Aufstellung) verhindert, daß der Sieg des österreichischen rechten Flügels Einfluß auf den Sieg bekommt, den er am Rußbach erficht. Mit diesen Reserven nimmt er Aderklaa wieder.
Nicht alle obigen Grundsätze sind in jeder der angeführten Schlachten deutlich enthalten, aber alle zeigen doch eine aktive Verteidigung.
Die Beweglichkeit der preußischen Armee unter Friedrich II. war ihm ein Mittel zum Siege, auf welches wir jetzt nicht mehr rechnen können, da die andern Armeen ebenso beweglich sind als wir. Andrerseits war das Umgehen in jener Zeit weniger allgemein und daher die tiefe Aufstellung weniger dringend.
B. Für den Angriff.
1. Man sucht einen Punkt der feindlichen Stellung, d. i. einen Teil seiner Truppen (eine Division, ein Korps), mit großer Überlegenheit anzufallen, während man die übrigen in Ungewißheit erhält, d. h. sie beschäftigt. Nur dadurch kann man bei gleicher oder kleinerer Macht mit Überlegenheit, also mit Wahrscheinlichkeit des Erfolges, fechten. Ist man sehr schwach, so muß man nur sehr wenig Truppen zur Beschäftigung des Feindes auf andern Punkten verwenden, damit man auf dem entscheidenden Punkte so stark als möglich sei. Unstreitig hat Friedrich II. die Schlacht von Leuthen nur gewonnen, weil er die kleine Armee auf einem Flecke hatte und im Verhältnis zum Feinde sehr konzentriert war.
2. Den Hauptstoß richtet man gegen einen feindlichen Flügel, indem man ihn von vorn und von der Seite angreift oder auch ganz umgeht und von hinten kommt. Nur wenn man im Siegen den Feind von seiner Rückzugslinie abdrängt, gewinnt man große Erfolge.
3. Wenn man auch stark ist, so wählt man doch oft nur einen Punkt, auf welchen man den Hauptstoß richten will, und gibt diesem dafür um so mehr Stärke; denn eine Armee förmlich einzuschließen, ist in den wenigsten Fällen möglich oder würde eine ungeheure physische oder moralische Überlegenheit voraussetzen. Von den Rückzugslinien abdrängen kann man aber den Feind auch von einem Punkte seiner Flanke aus, und das gewährt meistens schon große Erfolge.
4. Überhaupt ist die Gewißheit (hohe Wahrscheinlichkeit) des Sieges, d. h. die Gewißheit, den Feind vom Schlachtfelde zu vertreiben, die Hauptsache. Darauf muß die Anlage der Schlacht gerichtet sein, denn es ist leicht, einen gewonnenen, nicht entschiedenen Sieg durch Energie im Verfolgen entscheidend zu machen.
5. Man sucht den Feind auf dem Flügel, auf welchem man ihn mit der Hauptstärke angreift, konzentrisch anzufallen, d. h. so, daß seine Truppen sich von allen Seiten bekämpft sehen. Gesetzt auch, der Feind hat hier Truppen genug, um nach allen Seiten Front zu machen, so werden die Truppen unter solchen Umständen doch leichter mutlos, sie leiden mehr, kommen in Unordnung u. s. w., kurz, man hat die Hoffnung, sie eher zum Weichen zu bringen.
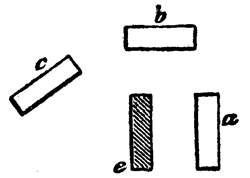
6. Dieses Umfassen des Feindes nötigt den Angreifenden, seine Kräfte in der Front mehr zu entwickeln als der Verteidiger.
Wenn die Korps a b c den Teil e der feindlichen Armee konzentrisch anfallen sollen, so müssen sie sich natürlich nebeneinander befinden. Aber nie muß diese Entwickelung unserer Kräfte in der Front so groß sein, daß man nicht bedeutende Reserven behielte. Das würde der größte Fehler sein, und wenn der Gegner einigermaßen gegen das Umgehen vorbereitet ist, zur Niederlage führen.
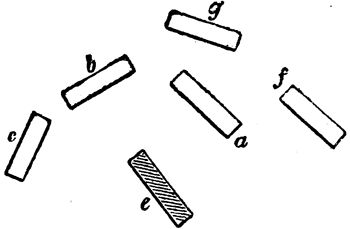
Wenn a b c Korps sind, die den Teil e angreifen, so müssen f g Korps sein, die zur Reserve zurückgehalten werden. Mit dieser tiefen Aufstellung ist man imstande, dem angegriffenen Punkte unaufhörlich mit neuen Angriffen zuzusetzen und, wenn unsere Truppen auf dem entgegengesetzten Ende geschlagen werden, so ist man nicht gleich genötigt, hier die Sache aufzugeben, weil man etwas hat, womit man dem Feind entgegengehen kann. So die Franzosen in der Schlacht bei Wagram. Der linke Flügel, der sich dem österreichischen rechten gegenüber an der Donau befand, war äußerst schwach und wurde auch total geschlagen. Selbst ihr Zentrum bei Aderklaa war nicht sehr stark und wurde von den Österreichern am ersten Tage der Schlacht zum Weichen gebracht, Aber das alles tat nichts, weil der Kaiser auf seinem rechten Flügel, mit welchem er den österreichischen linken in Front und Flanke angriff, eine solche Tiefe hatte, daß er mit einer gewaltigen Kolonne Kavallerie und reitender Artillerie den Österreichern nach Aderklaa entgegenrückte und sie hier, wenn auch nicht schlagen, doch zum Stehen bringen konnte.
7. Wie bei der Verteidigung, muß man auch beim Angriff denjenigen Teil der feindlichen Armee zum Gegenstande seines Anfalls nehmen, dessen Niederlage entscheidende Vorteile gibt.
8. Wie bei der Verteidigung, muß man hier nicht eher loslassen, als bis man seinen Zweck erreicht hat, oder gar keine Mittel mehr übrig sind. Ist der Verteidiger auch aktiv, greift er uns aus andern Punkten an, so können wir den Sieg nicht anders erhalten, als wenn wir ihn an Energie und Kühnheit überbieten. Ist er passiv, so wird man ohnehin keine große Gefahr laufen.
9. Lange, zusammenhängende Truppenlinien vermeide man ganz, sie würden nur zu Parallelangriffen führen, die jetzt nicht mehr zweckmäßig sind.
Die einzelnen Divisionen machen ihre Angriffe für sich, obgleich nach höheren Bestimmungen und also in Übereinstimmung. Nun ist aber eine Division (8 - 10 000 Mann) nie in ein Treffen formiert, sondern in zwei oder drei oder gar vier; daraus folgt schon, daß keine lange, zusammenhängende Linie mehr vorkommen kann.
10. Die Übereinstimmung der Divisionen und Armeekorps in ihren Angriffen muß nicht dadurch erhalten werden, daß man sie von einem Punkte aus zu leiten sucht, so daß sie, obgleich voneinander entfernt und vielleicht selbst durch den Feind voneinander getrennt, dennoch immer in Verbindung bleiben, sich genau nacheinander richten u. s. w. Dies ist die fehlerhafte, die schlechte Art, das Zusammenwirken hervorzubringen, die tausend Zufällen unterworfen ist, bei der nie etwas Großes ausgerichtet werden kann, und bei der man also gewiß sein kann, von einem kräftigen Gegner tüchtig geschlagen zu werden.
Die wahre Art ist, jedem einzelnen Korps- oder Divisionskommandanten die Hauptrichtung seines Marsches anzugeben, den Feind zum Ziel und den Sieg über den Feind zum Zweck zu setzen.
Jeder Befehlshaber einer Kolonne hat also den Befehl, den Feind anzugreifen, wo er ihn findet, und das mit allen Kräften. Er darf nicht für den Erfolg verantwortlich gemacht werden; denn das führt zur Unentschlossenheit; sondern er ist nur dafür verantwortlich, daß seine Korps mit allen Kräften und Aufopferungen Teil an dem Gefechte nehmen.
11. Ein gut organisiertes selbständiges Korps kann dem überlegensten Angriff eine Zeitlang (einige Stunden) widerstehen und also nicht im Augenblick vernichtet werden; wenn es sich daher auch wirklich zu früh mit dem Feinde eingelassen hat, so wird sein Gefecht, gesetzt auch, es würde geschlagen, doch für das Ganze nicht verloren gehen; der Feind wird seine Kraft an diesem einen Korps entwickeln und brechen und den übrigen eine vorteilhafte Gelegenheit zum Anfall geben.
Wie ein Korps dazu organisiert sein müsse, davon in der Folge.
Man wird also des Zusammenwirkens der Kräfte dadurch gewiß, daß jedes Korps eine gewisse Selbständigkeit hat, und daß jedes den Feind aufsucht und mit aller Aufopferung angreift.
12. Einer der wichtigsten Grundsätze für den Angriffskrieg ist die Überraschung des Feindes. Je mehr der Angriff überfallsweise geschehen kann, um so glücklicher wird man sein. Die Überraschung, welche der Verteidiger durch die Verstecktheit seiner Maßregeln, durch die verdeckte Aufstellung seiner Truppen hervorbringen kann, kann der Angreifende nur durch den unvermuteten Anmarsch gewinnen.
Diese Erscheinung ist aber in den neueren Kriegen sehr selten. Der Grund liegt teils in den besseren Sicherheitsanstalten, die man jetzt hat, teils in der schnellen Führung des Krieges, so daß selten ein langer Stillstand in den Operationen eintritt, welcher den einen einschläferte und dem andern Gelegenheit gäbe, ihn plötzlich anzufallen.
Unter diesen Umständen kann man außer den eigentlichen nächtlichen Überfällen (wie bei Hochkirch), die immer möglich bleiben, den Feind nur noch dadurch überraschen, daß man einen Marsch seitwärts oder rückwärts tut und dann plötzlich wieder gegen den Feind anrückt; ferner, wenn man entfernt steht, daß man durch eine ganz ungewöhnliche Anstrengung und Tätigkeit schneller da ist, als der Feind uns erwartet hat.
13. Der eigentliche Überfall (nächtlich wie bei Hochkirch) ist der beste, um mit einer ganz kleinen Armee noch etwas zu unternehmen; aber er ist für den Angreifenden, welcher die Gegend weniger kennt als der Verteidigende, mehr Zufällen unterworfen. Je weniger genau man die Gegend und die Anordnungen des Feindes kennt, um so größer werden diese Zufälle, daher dergleichen Angriffe in manchen Lagen nur als ein Mittel der Verzweiflung zu betrachten sind.
14. Bei diesen Angriffen muß man alles noch viel einfacher einrichten und noch konzentrierter sein als bei Tage.
2. Grundsätze für den Gebrauch der Truppen.
1. Kann man die Feuerwaffen nicht entbehren (und wenn man sie entbehren könnte, warum führt man sie mit?), so muß mit ihnen das Gefecht eröffnet werden, und die Kavallerie muß erst gebraucht werden, wenn der Feind durch Infanterie und Artillerie schon viel gelitten hat. Daraus folgt:
a) daß man die Kavallerie hinter die Infanterie stellen muß,
b) daß man sich nicht zu leicht bewegen lassen muß, das Gefecht mit ihr anzufangen. Nur in Fällen, wo Unordnungen des Feindes, schneller Rückzug desselben Hoffnung auf den Erfolg geben, muß man kühn mit der Reiterei auf ihn losgehen.
2. Artillerie ist in ihrem Feuer viel wirksamer als Infanterie. Eine Batterie von acht Sechspfündern nimmt noch nicht den dritten Teil der Front eines Bataillons ein, hat nicht den achten Teil der Menschen, die ein Bataillon stark ist, und leistet gewiß zwei- bis dreimal so viel in der Wirkung des Feuers. Dagegen hat Artillerie den Nachteil, nicht so beweglich zu sein wie die Infanterie. Im allgemeinen gilt dies selbst von der leichtesten reitenden Artillerie, denn sie kann nicht wie die Infanterie in jedem Boden gebraucht werden. Man muß also die Artillerie von Beginn an auf den wichtigsten Punkten zusammenhalten, weil sie nicht wie die Infanterie im Fortschreiten des Gefechts sich gegen diese Punkte hin konzentrieren kann. Eine große Batterie von zwanzig bis dreißig Geschützen entscheidet meistens für den Punkt, auf welchem sie sich befindet.
3. Aus den angegebenen und anderen, in die Augen fallenden Eigentümlichkeiten ergeben sich für den Gebrauch der einzelnen Waffen folgende Regeln:
a) Man fängt das Gefecht mit der Artillerie an, und zwar von Hause aus mit dem größten Teile derselben; nur bei großen Truppenmassen gehört auch reitende und auch Fußartillerie zur Reserve. Man braucht die Artillerie dabei in größeren Massen auf einem Punkte. Zwanzig bis dreißig Kanonen verteidigen den Hauptpunkt in einer großen Batterie oder beschießen den Teil der feindlichen Stellung, welchen man anfallen will.
b) Hierauf fängt man mit leichter Infanterie an, – sei es mit Schützen, Jägern oder Füsilieren – hauptsächlich, um nicht gleich anfangs zu viel Kräfte ins Spiel zu bringen; man will erst versuchen, was man vor sich hat (denn das kann man selten ordentlich übersehen), man will sehen, wie sich das Gefecht wendet etc.
Kann man mit dieser Feuerlinie dem Feinde das Gleichgewicht halten, und ist man nicht eilig, so hat man unrecht, sich mit Anwendung der übrigen Kräfte zu übereilen: man ermüde den Feind mit diesem Gefecht so sehr als möglich.
c) Bringt der Feind so viele Truppen ins Gefecht, daß unsere Feuerlinie weichen muß, oder dürfen wir nicht länger zögern, so ziehen wir eine volle Infanterielinie heran, die sich auf 100 bis 200 Schritte vom Feinde entwickelt und schießt oder auch auf ihn eindringt, wie es eben gehen will.
d) Dies ist die Hauptbestimmung der Infanterie; hat man sich aber so tief gestellt, daß man nun noch eine Infanterielinie in Kolonnen zur Reserve hat, so ist man auf diesem Punkte ziemlich Herr des Gefechtes. Diese zweite Infanterielinie muß man womöglich nur in Kolonnen zur Entscheidung gebrauchen.
e) Die Kavallerie hält bei dem Gefechte so nahe hinter den fechtenden Truppen, als es ohne großen Verlust geschehen kann, nämlich außer dem Kartätschen- und Musketenfeuer. Sie muß aber bei der Hand sein, damit man jeden Erfolg, der sich im Gefecht zeigt, schnell benutzen könne.
4. Indem man diese Regeln mehr oder weniger genau befolgt, behält man folgenden Grundsatz, den ich nicht genug als wichtig hervorheben kann, im Auge, nämlich: Seine Kräfte nicht sämtlich mit einemmal auf gut Glück ins Spiel zu bringen, weil man damit alle Mittel, dasselbe zu leiten, aus den Händen gibt; seinen Gegner womöglich mit wenigen Kräften zu ermüden und sich für den letzten entscheidenden Augenblick eine entscheidende Masse zu bewahren. Wird diese entscheidende Reserve einmal darangesetzt, so muß sie mit der höchsten Kühnheit geleitet werden.
5. Eine Schlachtordnung, d. h. eine Aufstellungsart der Truppen vor und in dem Gefecht muß für den ganzen Feldzug oder den ganzen Krieg eingeführt sein. Diese Schlachtordnung vertritt in allen Fällen, wo es an aller Zeit zu einer speziellen Disposition fehlt, deren Stelle. Sie muß daher vorzüglich auf die Verteidigung berechnet sein. Diese Schlachtordnung wird die Fechtart in der Armee auf einen gewissen Modus bringen, was sehr notwendig und heilsam ist, weil ein großer Teil der Untergenerale und andern Offiziere, die sich an der Spitze kleinerer Abteilungen befinden, ohne besondere Kenntnis in der Taktik, auch wohl ohne vorzügliche Anlagen für den Krieg sein wird.
Es entsteht also daraus ein gewisser Methodismus, der da an die Stelle der Kunst tritt, wo diese fehlt. Meiner Überzeugung nach ist das in den französischen Armeen im höchsten Grade der Fall.
6. Nach dem, was ich über den Gebrauch der Waffen gesagt habe, würde diese Schlachtordnung für eine Brigade ungefähr folgende sein:
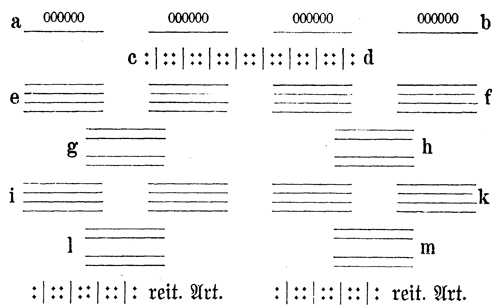
a b ist die Linie der leichten Infanterie, welche das Gefecht eröffnet und im durchschnittenen Terrain gewissermaßen als Avantgarde dient; dann kommt die Artillerie c d, um auf vorteilhaften Punkten aufgestellt zu werden. Solange sie noch nicht postiert ist, bleibt sie hinter der ersten Infanterielinie. e f ist die erste Infanterielinie, welche bestimmt ist, aufzumarschieren und zu feuern, hier 4 Bataillone; g h ein paar Kavallerieregimenter; i k ist die zweite Infanterielinie, die zur Reserve, zur Entscheidung des Gefechtes bestimmt ist; l m ihre Kavallerie.
Nach eben diesen Grundsätzen wird einem starken Korps eine ähnliche Aufstellung gegeben. Übrigens ist es nicht wesentlich, ob die Schlachtordnung gerade so oder ein wenig anders ist, wenn nur die oben angegebenen Grundsätze darin befolgt werden. So z. B. kann die Kavallerie g h bei der gewöhnlichen Aufstellung mit in der Linie l m bleiben, und man nimmt sie nur dann vor, wenn sie sich in dieser Stellung zu weit zurück befinden würde.
7. Die Armee besteht aus mehreren solcher selbständigen Korps, die ihren General und Generalstab haben. Sie werden neben- und hintereinander aufgestellt, wie dies in den allgemeinen Grundsätzen für das Gefecht angegeben ist. Eins ist hier noch zu bemerken, daß man nämlich, wenn man nicht ganz schwach an Kavallerie ist, sich eine besondere Kavalleriereserve bildet, die natürlich hinten aufgestellt wird und folgende Bestimmungen hat:
a) wenn der Feind im Rückzuge vom Schlachtfelde begriffen ist, auf ihn einzudringen und die Kavallerie, welche er zur Deckung seines Rückzuges anwendet, anzugreifen. Schlägt man in diesem Augenblick die feindliche Kavallerie, so werden unvermeidlich große Erfolge eintreten, wenn die feindliche Infanterie nicht Wunder der Tapferkeit tut. Kleine Kavalleriehaufen würden hier den Zweck nicht erreichen.
b) wenn der Feind, auch ungeschlagen, auf einem Rückmarsch begriffen ist, oder wenn er sich nach einer verlorenen Schlacht am folgenden Tage weiter zurückzieht, ihn schneller zu verfolgen. Kavallerie marschiert schneller als Infanterie, und macht auf die sich zurückziehenden Truppen einen imponierenden Eindruck. Das Verfolgen aber ist im Kriege nächst dem Schlagen das Wichtigste.
c) wenn man den Feind im großen (strategisch) umgehen will und sich wegen des Umweges einer Waffe bedienen muß, die schneller marschiert, so nimmt man diese Kavalleriereserve dazu.
Damit dieses Korps mehr Selbständigkeit erhalte, muß ihm reitende Artillerie mitgegeben werden; denn die Verbindung mehrerer Waffen gibt eine größere Stärke.
8. Die Schlachtordnung der Truppen bezog sich auf das Gefecht; es war ihre Aufstellung dazu.
Die Ordnung im Marsche ist dem Wesentlichen nach folgende:
a) Jedes selbständige Korps (sei es nun eine Brigade oder eine Division) hat seine eigene Avant- und Arrieregarde und formiert seine eigene Kolonne; das hindert aber nicht, daß mehrere Korps auf einer Straße hintereinander marschieren und also im großen gewissermaßen eine Kolonne bilden.
b) Die Korps marschieren nach der Reihenfolge der allgemeinen Schlachtordnung, d. h. wie sie nach dieser neben- und hintereinander zu stehen kommen, so marschieren sie auch.
c) Die Ordnung in den Korps selbst bleibt immer unverändert folgende: die leichte Infanterie macht die Avant- und Arrieregarde; Kavallerie ist ihr beigegeben; dann folgt die Infanterie, dann die Artillerie, zuletzt die übrige Kavallerie.
Diese Ordnung bleibt, man mag sich gegen den Feind bewegen, wo sie an sich die natürliche Ordnung ist, oder mit ihm parallel, wo eigentlich das, was in der Aufstellung hintereinander stehen sollte, nebeneinander marschieren müßte. Kommt man zum Aufmarsch, so kann es nie in dem Grade an Zeit fehlen, daß man die Kavallerie und das zweite Treffen rechts oder links herausziehen könnte.
3. Grundsätze für den Gebrauch des Terrains.
1. Das Terrain (der Boden, die Gegend) gibt im Kriege zwei Vorteile.
Der erste ist, daß es Hindernisse des Zugangs bildet, die dem Feinde das Vordringen auf diesem Punkte entweder unmöglich machen oder ihn nötigen, langsamer zu marschieren, in Kolonnen zu bleiben etc.
Der zweite ist, daß die Hindernisse uns erlauben, unsere Truppen verdeckt aufzustellen.
Beide Vorteile sind sehr wichtig, aber der zweite scheint mir wichtiger als der erste; wenigstens ist es gewiß, daß man ihn häufiger genießt, weil die ebenste Gegend in den meisten Fällen noch erlaubt, sich mehr oder weniger verdeckt zu stellen.
Früher kannte man nur den ersten dieser beiden Vorteile und machte wenig Gebrauch von dem zweiten. Jetzt hat die Beweglichkeit aller Armeen bewirkt, daß man jenen weniger benützen kann, und eben darum muß man sich des zweiten um so häufiger bedienen. Der erste dieser beiden Vorteile ist allein bei der Verteidigung wirksam, der andere bei dem Angriff und der Verteidigung.
2. Das Terrain, als Zugangshindernis betrachtet, kommt vorzüglich in folgenden Punkten vor: a) als Flankenanlehnung, b) als Frontverstärkung.
3. Um die Flanken daran zu lehnen, muß es ganz undurchdringlich sein, wie z. B. etwa ein großer Strom, ein See, ein undurchdringlicher Morast. Alle diese Gegenstände finden sich aber selten, darum ist eine vollkommen sichere Anlehnung der Flanken etwas Seltenes, und zwar jetzt noch mehr als sonst, weil man sich mehr bewegt, nicht so lange in einer Stellung bleibt, folglich mehr Stellungen auf dem Kriegstheater benützen muß.
Ist das Hindernis des Zugangs nicht ganz undurchdringlich, so ist es eigentlich kein Stützpunkt für die Flanke, sondern ein bloßer Verstärkungspunkt. Dann müssen Truppen dahinter aufgestellt werden, und in bezug auf diese wird es dann wieder ein Zugangshindernis.
Es ist zwar immer noch vorteilhaft, seine Flanke auf diese Art zu sichern, weil man dann weniger Truppen auf diesem Punkte braucht; aber man muß sich vor zwei Dingen hüten: erstens, sich ganz auf eine solche Festigkeit seiner Flanke zu verlassen und also keine starke Reserve hinter sich zu haben; zweitens, sich auf beiden Flügeln mit solchen Hindernissen zu umgeben, denn da sie nicht vollkommen sichern, so machen sie das Gefecht auf den Flanken auch nicht unmöglich; dies gestaltet sich aber leicht zu einer höchst nachteiligen Defensive, denn die Hindernisse erlauben uns selbst nicht mit Leichtigkeit auf einem Flügel zur aktiven Verteidigung vorzubrechen, und so wird man sich in der ungünstigsten aller Formen, mit zurückgebliebenen Flanken a d, c b, verteidigen müssen.
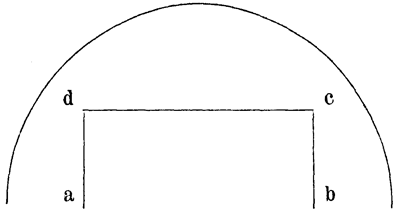
4. Die eben angestellten Betrachtungen führen wieder auf die tiefe Aufstellung. Je weniger man seine Flanke sicher anlehnen kann, um so mehr muß man hinter sich Korps haben, die den umgehenden Teil des Feindes umgehen können.
5. Alle Arten von Terrain, die man nicht in Front passieren kann, alle Ortschaften, alle Einhegungen der Grundstücke durch Hecken und Gräben, alle sumpfigen Wiesen, endlich alle Berge, die mit einiger Mühe erstiegen werden müssen, gehören zu den Terrainhindernissen dieser Art, nämlich zu solchen, die zwar passiert werden können, aber nur mit Anstrengung und langsam, die also den dahinter aufgestellten Truppen eine größere Stärke in dem Gefechte geben. Wälder sind nur dann hierher zu rechnen, wenn sie sehr verwachsen und sumpfig sind. Ein gewöhnlicher hoher Wald ist ebenso leicht zu passieren als die Ebene. In Rücksicht der Wälder aber darf man einen Punkt nicht übersehen, daß sie nämlich den Feind verbergen. Stellt man sich hinein, so findet dieser Nachteil für beide Teile statt; sehr gefährlich aber und also ein großer Fehler ist es, sie vor der Front oder auf den Flanken zu lassen: dies darf durchaus nur geschehen, wenn der Durchgang auf wenige Wege beschränkt ist. Verhaue, die man zu diesem Behufe anlegt, helfen nicht viel, sie werden leicht weggeräumt.
6. Aus diesem allen folgt, daß man sich dieser Terrainhindernisse auf einer Flanke zu bedienen suchen wird, um hier mit wenigen Truppen einen verhältnismäßig starken Widerstand zu leisten, während man auf der andern Flanke seine beabsichtigte Offensive ausführt. Sehr zweckmäßig ist es, mit diesen Hindernissen den Gebrauch der Schanzen zu verbinden, weil dann, wenn der Feind das Hindernis passiert hat, das Feuer der Schanzen die schwachen Truppen gegen einen zu überlegenen Anfall und ein zu plötzliches Zurückwerfen sichert.
7. Auf der Front ist da, wo man sich verteidigen will, jedes Hindernis von großem Werte.
Alle Berge, auf die man sich stellt, werden aus dieser Rücksicht allein besetzt; denn auf die Wirkung der Waffen hat das Höherstehen oft gar keinen, meistens keinen wichtigen Einfluß. Wenn wir oben stehen und der Feind, indem er sich uns nähert, mühsam steigen muß, so rückt er nur langsam vor, kommt auseinander, langt mit erschöpften Kräften an, Vorteile, die bei gleicher Bravheit und Stärke entscheidend werden. Besonders muß man nicht übersehen, daß der schnelle Anlauf im vollen Laufe moralisch so wirksam ist. Der vordringende Soldat betäubt sich dadurch selbst gegen die Gefahr, der stehende verliert die Gegenwart des Geistes. Seine vorderste Infanterie und Artillerie auf Berge zu stellen, ist also immer sehr vorteilhaft.
Ist die Böschung des Berges so steil, oder sein Abhang so wellenförmig und ungleich, daß man ihn nicht wirksam beschießen kann, was gar oft der Fall ist, so stellt man seine erste Linie nicht an den Rand des Berges, sondern besetzt diesen höchstens mit Schützen und stellt die volle Linie so, daß der Feind in dem Augenblick, wenn er auf die Höhe heraufkommt und sich wieder sammelt, in das wirksamste Feuer gerät.
Alle andern Zugangshindernisse, als: kleine Flüsse, Bäche, Hohlwege etc. dienen dazu, die Front des Feindes zu brechen; er muß sich diesseits wieder formieren, und das hält ihn auf. Darum müssen sie in unser wirksamstes Feuer genommen werden. Dies wirksamste Feuer ist der Kartätschenschuß (400 bis 600 Schritte), wenn viel Artillerie da; der Flintenschuß 150 bis 200 Schritte), wenn wenig Artillerie auf diesem Punkte vorhanden ist.
8. Es ist mithin ein Gesetz, alle Hindernisse des Zuganges, welche unsere Front verstärken sollen, in unser wirksamstes Feuer zu nehmen. Aber eins ist wichtig zu bemerken, daß man nie den ganzen Widerstand auf das bloße Feuern beschränke, sondern immer einen bedeutenden Teil seiner Truppen (1/3 bis 1/2) zum Anfall mit dem Bajonett bereit halte. Ist man also ganz schwach, so muß man bloß die Feuerlinie (Schützen und Kanonen) so nahe stellen, daß sie das Hindernis beschießen, die übrigen Truppen aber in Kolonnen, womöglich verdeckt, 600 bis 800 Schritte weiter zurück aufstellen.
9. Eine andere Art, die Zugangshindernisse vor der Front zu benützen, ist die, sie etwas weiter vor der Front liegen zu lassen, nämlich unter dem wirksamen Kanonenschuß (1000 bis 2000 Schritte), und, wenn der Feind mit seinen Kolonnen übergeht, diese von allen Seiten anzufallen. (Bei Minden tat der Herzog Ferdinand ein Ähnliches.) Auf diese Weise dient das Terrainhindernis der Absicht, sich aktiv zu verteidigen, und diese aktive Verteidigung, von der wir schon früher gesprochen haben, findet dann auf der Front statt.
10. In dem bisher Gesagten sind die Hindernisse des Bodens und der Gegend vorzüglich als zusammenhängende Linien für größere Stellungen betrachtet worden. Es ist aber nötig, noch etwas über einzelne Punkte zu sagen.
Einzelne isolierte Punkte können überhaupt nur durch Schanzen oder bei einem starken Terrainhindernis verteidigt werden. Von den ersten ist hier nicht die Rede. Terrainhindernisse, die isoliert gehalten werden sollen, können nur sein:
a) isolierte steile Höhen.
Hier sind Schanzen gleichfalls unentbehrlich, weil der Feind hier immer in einer mehr oder weniger großen Front gegen den Verteidiger anrücken kann, dieser also am Ende immer im Rücken genommen werden wird, weil man fast nie so stark ist, nach allen Seiten Front zu machen.
b) Defileen.
Unter diesem Ausdruck versteht man jeden engen Weg, auf dem der Feind nur auf einem Punkte anrücken kann. Brücken, Dämme, steile Felsschluchten gehören hierher.
In betreff aller dieser Fälle ist zu bemerken, daß entweder der Angreifende sie durchaus nicht umgehen kann, wie z. B. Brücken über große Ströme; in diesem Falle kann der Verteidiger dreist seine ganze Mannschaft verwenden, um den Punkt des Überganges so wirksam als möglich zu beschießen; oder man ist gegen das Umgehen nicht absolut gesichert, wie bei Brücken über kleine Flüsse und bei den meisten Gebirgsdefileen; dann ist es notwendig, einen bedeutenden Teil (1/3 bis 1/2) seiner Truppen zum geschlossenen Anfall zurückzubehalten.
c) Ortschaften, Dörfer, kleine Städte etc.
Sind die Truppen sehr brav, führen sie den Krieg mit Enthusiasmus, so ist in den Häusern eine Verteidigung weniger gegen viele möglich, wie es keine andere gibt. Ist man aber des einzelnen Mannes nicht gewiß, so ist es besser, die Häuser, Gärten etc. nur mit Schützen, die Eingänge mit Kanonen zu besetzen, und den größten Teil der Truppen (1/2 bis 3/4) in geschlossenen Kolonnen entweder in dem Orte oder auch hinter demselben verdeckt aufzustellen, um damit über den Feind herzufallen, wenn er eindringt.
11. Diese isolierten Posten dienen den großen Operationen teils als Vorposten, bei welchen es meistens nicht auf eine absolute Verteidigung ankommt, sondern auf ein bloßes Aufhalten des Feindes, teils auf Punkten, die in den Kombinationen, welche man für die Armee entworfen hat, wichtig werden. Auch ist es oft nötig, einen entlegenen Punkt festzuhalten, um Zeit zur Entwickelung der aktiven Verteidigungsmaßregeln zu haben, die man sich vorgesetzt hat. Ist aber der Punkt entlegen, so wird er dadurch von selbst isoliert.
12. Es ist nur noch nötig, zwei Bemerkungen über die isolierten Punkte zu machen, die erste, daß man hinter diesen Punkten Truppen zur Aufnahme des zurückgeworfenen Detachements bereithalten müsse, die zweite, daß der, welcher eine solche Verteidigung in die Reihe seiner Kombinationen aufnimmt, nie zu viel darauf rechnen dürfe, wenn auch das Terrainhindernis nicht so stark ist; daß dagegen der, welchem die Verteidigung aufgegeben ist, auch unter den schlechtesten Umständen den Zweck zu erreichen sich vorsetzen müsse. Hierzu ist ein Geist der Entschlossenheit und Aufopferung nötig, der nur in dem Ehrgeiz und dem Enthusiasmus seine Quelle findet; deshalb müssen hierzu Leute ausgewählt werden, denen es nicht an diesen edlen Seelenkräften fehlt.
13. Was die Benützung des Terrains als Deckungsmittel für unsere Aufstellung und unsern Anmarsch betrifft, so bedarf das keiner weitläufigen Auseinandersetzung.
Man stellt sich nicht auf den Berg, welchen man verteidigen will (wie bisher so oft geschah), sondern dahinter; man stellt sich nicht vor den Wald, sondern hinein oder dahinter; das letztere nur, wenn man den Wald oder das Gehölz dennoch übersehen kann. Man behält seine Truppen in Kolonnen, um sie leichter verdeckt aufstellen zu können; man benützt Dörfer, kleine Gehölze, alle Wölbungen des Terrains, um seine Truppen dahinter zu verstecken; man wählt beim Anrücken die am meisten durchschnittene Gegend u. s. w.
Es gibt fast keine Gegend in angebauten Ländern, die so leicht zu übersehen wäre, daß bei einer geschickten Benützung der Hindernisse nicht ein großer Teil der Truppen des Verteidigers unentdeckt bleiben sollte. Für den Angreifenden hat die Deckung seines Marsches schon mehr Schwierigkeiten, weil er den Wegen folgen muß.
Es versteht sich von selbst, daß, wenn man das Terrain zum Verstecken seiner Truppen benützt, man dies in Übereinstimmung mit den Zwecken und den Kombinationen tun muß, die man sich vorgesetzt hat; dahin gehört also vor allen Dingen, daß man die Schlachtordnung nicht ganz auseinanderreißt, wenn man sich auch kleine Abweichungen davon erlaubt.
14. Fassen wir das bisher über das Terrain Gesagte zusammen, so ergibt sich für den Verteidiger, d. h. für die Wahl der Stellungen folgendes als das Wichtigste:
a) Anlehnung einer oder beider Flanken;
b) freie Aussicht auf Front und Flanken;
c) Hindernisse des Zugangs auf der Front;
d) verdeckte Aufstellung der Truppen. – Hierzu kommt noch
e) im Rücken ein durchschnittenes Terrain, weil das im Falle eines Unglücks das Verfolgen erschwert; aber keine zu nahen Defiléen (wie bei Friedland), weil dies Aufenthalt und Verwirrung verursacht.
15. Es wäre pedantisch, zu glauben, diese Vorteile ließen sich sämtlich bei jeder Stellung, die man im Kriege bezieht, erreichen. Nicht alle Stellungen sind von gleicher Wichtigkeit: sie sind aber um so wichtiger, je wahrscheinlicher es ist, daß man darin angegriffen wird. Nur bei den wichtigsten sucht man diese Vorteile womöglich sämtlich zu erreichen, bei den andern mehr oder weniger.
16. Die Rücksichten, welche der Angreifende auf das Terrain zu nehmen hat, vereinigen sich vorzüglich in den zwei Hauptpunkten: nicht ein zu schwieriges Terrain zum Angriffspunkte zu wählen, von der andern Seite aber womöglich durch die Gegend anzurücken, in der uns der Feind am wenigsten übersehen kann.
17. Ich schließe diese Bemerkungen über den Gebrauch des Terrains mit einem Grundsatz, der für die Verteidigung von der höchsten Wichtigkeit und als Schlußstein der ganzen Lehre von der Verteidigung zu betrachten ist, nämlich: Nie alles von der Stärke des Terrains zu erwarten, sich folglich nie durch ein starkes Terrain zur passiven Defensive verleiten zu lassen. Denn ist das Terrain wirklich so stark, daß es dem Angreifenden unmöglich wird, uns zu vertreiben, so wird er es umgehen, was immer möglich ist, und dann ist das stärkste Terrain überflüssig; wir werden unter ganz andern Umständen, in einer ganz andern Gegend zur Schlacht gezwungen, und es ist so gut, als hätten wir jenes Terrain gar nicht in unsere Kombination mit aufgenommen. Ist das Terrain aber nicht von einer solchen Stärke, ist ein Angriff in demselben noch möglich, so können die Vorteile dieses Terrains nie die Nachteile einer passiven Verteidigung aufwiegen. Alle Terrainhindernisse müssen also nur zu einer teilweisen Verteidigung benützt werden, um mit wenigen Truppen einen verhältnismäßig großen Widerstand zu leisten und Zeit für die Offensive zu gewinnen, durch welche man nach anderen Punkten den wahren Sieg zu erhalten sucht.
III. Strategie.
Sie ist die Verbindung der einzelnen Gefechte, aus denen der Krieg besteht, zum Zweck des Feldzuges und des Krieges.
Weiß man zu fechten, weiß man zu siegen, so ist wenig mehr übrig; denn glückliche Erfolge zu verbinden, ist leicht, weil es lediglich Sache geübter Urteilskraft ist und nicht mehr wie die Leitung des Gefechtes auf besonderem Wissen beruht.
Die wenigen Grundsätze, welche hier vorkommen und vorzüglich auf der Verfassung der Staaten und Armeen beruhen, werden sich daher im wesentlichen sehr kurz zusammenfassen lassen.
1. Allgemeine Grundsätze.
1. Es gibt beim Kriegführen drei Hauptzwecke:
a) die feindliche bewaffnete Macht zu besiegen und anfzureiben;
b) sich in Besitz der toten Streitkräfte und der andern Quellen der feindlichen Armee zu setzen, und
c) die öffentliche Meinung zu gewinnen.
2. Um den ersten Zweck zu erreichen, richtet man seine Hauptoperation immer gegen die feindliche Hauptarmee oder doch gegen einen sehr bedeutenden Teil der feindlichen Macht; denn nur wenn man diese geschlagen hat, kann man den beiden andern Zwecken mit Erfolg nachgehen.
3. Um die feindlichen toten Kräfte zu erobern, richtet man seine Operationen gegen diejenigen Punkte, auf welchen diese Kräfte am meisten konzentriert sind: Hauptstädte, Niederlagen, große Festungen. Auf dem Wege zu ihnen wird man die feindliche Hauptmacht oder einen beträchtlichen Teil der feindlichen Armee antreffen.
4. Die öffentliche Meinung endlich gewinnt man durch große Siege und durch den Besitz der Hauptstadt.
5. Der erste und wichtigste Grundsatz, den man zur Erreichung jener Zwecke sich vorsetzen muß, ist der: alle Kräfte, die uns gegeben sind, mit der höchsten Anstrengung aufzubieten. In jeder Mäßigung, welche man hierin zeigt, liegt ein Zurückbleiben hinter dem Ziele. Wäre auch der Erfolg an sich ziemlich wahrscheinlich, so ist es doch höchst unweise, nicht die höchste Anstrengung anzuwenden, um seiner ganz gewiß zu werden; denn diese Anstrengung kann nie einen nachteiligen Erfolg haben. Gesetzt, das Land würde dadurch noch so sehr gedrückt, so entsteht daraus kein Nachteil, denn der Druck wird um so schneller aufhören.
Von unendlichem Werte ist der moralische Eindruck, den kräftige Anstalten hervorbringen; jeder ist von dem Erfolge überzeugt: dies ist das beste Mittel, den Geist der Nation zu heben.
6. Der zweite Grundsatz ist: seine Macht da, wo die Hauptschläge geschehen sollen, so viel als immer möglich zu konzentrieren, sich auf andern Punkten Nachteilen auszusetzen, um auf dem Hauptpunkte des Erfolges um so gewisser zu sein. Dieser Erfolg hebt alle andern Nachteile wieder auf.
7. Der dritte Grundsatz ist: keine Zeit zu verlieren. Wenn uns nicht aus dem Zögern besonders wichtige Vorteile entspringen, so ist es wichtig, so schnell als möglich ans Werk zu gehen. Durch die Schnelligkeit werden viele Maßregeln des Feindes im Keime erstickt, und die öffentliche Meinung für uns gewonnen.
Die Überraschung spielt in der Strategie eine viel wichtigere Rolle als in der Taktik; sie ist das wirksamste Prinzip zum Siege. Alexander, Hannibal, Cäsar, Gustav Adolph, Friedrich II., Napoleon verdanken ihrer Schnelligkeit die schönsten Strahlen ihres Ruhmes.
8. Endlich ist der vierte Grundsatz: die Erfolge, welche wir erringen, mit der höchsten Energie zu benützen.
Das Verfolgen des geschlagenen Feindes verschafft allein die Früchte des Sieges.
9. Der erste dieser Grundsätze ist die Grundlage der drei andern. Man kann bei ihnen das Höchste wagen, ohne alles auf das Spiel zu setzen, wenn man den ersten Grundsatz befolgt hat. Er gibt das Mittel, immer neue Kräfte hinter uns zu bilden, und mit neuen Kräften macht man jeden Unglücksfall wieder gut.
Hierin liegt diejenige Vorsicht, welche man weise nennen kann, nicht darin, daß man furchtsamen Schrittes vorwärtsschreitet.
10. Kleine Staaten können in der jetzigen Zeit keine Eroberungskriege führen, aber für den Verteidigungskrieg sind auch ihre Mittel sehr groß. Darum bin ich fest überzeugt: wer alle seine Kräfte aufbietet, um mit immer neuen Massen aufzutreten, wer alle ersinnlichen Mittel der Vorbereitung trifft, wer seine Kräfte auf dem Hauptpunkte zusammenhält, wer so ausgerüstet mit Entschlossenheit und Energie einen großen Zweck verfolgt, der hat alles getan, was sich im großen für die strategische Leitung des Krieges tun läßt, und wird, wenn er dabei nicht ganz unglücklich im Gefechte ist, unausbleiblich in dem Maße siegreich sein, als sein Gegner hinter dieser Anstrengung und Energie zurückbleibt.
11. Bei diesen Grundsätzen kommt am Ende auf die Form, in welcher die Operationen geführt werden, wenig an. Indessen will ich versuchen, das Wichtigste davon mit wenigen Worten klar zu machen.
In der Taktik sucht man den Feind immer zu umfassen, nämlich den Teil, gegen welchen man seinen Hauptangriff gerichtet hat, teils weil die konzentrische Wirkung der Streitkräfte vorteilhafter ist als die parallele, teils weil man nur so den Feind vom Rückzugspunkte abdrängen kann.
Wenden wir, was sich dort auf den Feind und die Stellung bezieht, hier auf seine Kriegstheater (also auch auf seine Verpflegung) an, so werden die einzelnen Kolonnen oder Armeen, welche den Feind umfassen sollen, in den meisten Fällen so weit voneinander entfernt sein, daß sie nicht an einem und demselben Gefecht teilnehmen können. Der Gegner wird sich in der Mitte befinden und sich gegen die einzelnen Korps wenden können, um diese mit einer und derselben Armee einzeln zu schlagen. Friedrichs II. Feldzüge geben davon Beispiele, besonders die von 1757 und 1758.
Da nun das Gefecht die Hauptsache, das Entscheidende ist, so wird der konzentrisch Verfahrende, wenn er nicht eine ganz entscheidende Übermacht hat, mit den Schlachten alle Vorteile verlieren, welche ihm das Umfassen gewährt haben würde; denn die Einwirkung auf die Verpflegung wirkt nur sehr langsam, der Sieg in der Schlacht sehr schnell.
In der Strategie ist also der, welcher sich zwischen dem Feinde befindet, besser daran als der, welcher seinen Gegner umgibt, besonders bei gleichen oder gar schwächeren Kräften.
Um den Feind von seinem Rückzugspunkte abzuschneiden, ist ein strategisches Umgehen und Umfassen allerdings sehr wirksam; da man diesen Zweck aber auch allenfalls durch das taktische Umgehen erreichen kann, so wird das strategische Umgehen immer nur dann ratsam sein, wenn man (physisch und moralisch) so überlegen ist, daß man auf dem Hauptpunkte stark genug bleibt und mithin das detachierte Korps entbehren kann.
Napoleon hat sich auf das strategische Umgehen nie eingelassen, wiewohl er doch physisch und moralisch so oft, ja fast immer überlegen war.
Friedrich II. tat es nur ein einziges Mal: im Angriff auf Böhmen 1757. Allerdings veranlaßte er dadurch, daß die erste Schlacht von den Österreichern erst bei Prag geliefert werden konnte; allein was half ihm die Eroberung Böhmens bis Prag ohne entscheidenden Sieg? Die Schlacht von Kolin zwang ihn, sie wieder aufzugeben, ein Beweis, daß Schlachten alles entscheiden. Bei Prag war er offenbar in Gefahr, von der ganzen österreichischen Macht angefallen zu werden, ehe Schwerin herankam. Dieser Gefahr hätte er sich nicht ausgesetzt, wenn er mit der ganzen Macht durch Sachsen gezogen wäre. Bei Budin an der Eger wäre dann vielleicht die erste Schlacht geliefert worden, und diese wäre ebenso entscheidend gewesen wie die von Prag. Die Dislokation der preußischen Armee während des Winters in Schlesien und Sachsen hatte unstreitig zu diesem konzentrischen Einmarsch Veranlassung gegeben, und es ist wichtig, zu bemerken, daß Bestimmungsgründe dieser Art in den meisten Fällen dringender sind als die Vorteile in der Form der Aufstellung, denn die Leichtigkeit der Operationen befördert die Schnelligkeit, und die Friktion, welche die ungeheure Maschine einer bewaffneten Macht hat, ist schon so groß, daß man sie nicht ohne Not vermehren muß.
12. Durch den Grundsatz, welchen wir eben angeführt haben, sich auf dem Hauptpunkte möglichst zu konzentrieren, wird man ohnehin von dem Gedanken eines strategischen Umfassens abgezogen, und die Aufstellung unserer Streitkräfte ergibt sich daraus schon von selbst. Darum durfte ich sagen, daß die Form dieser Aufstellung wenig Wert hat. Einen Fall indessen gibt es doch, in welchem die strategische Wirkung in des Feindes Flanke zu großen, einer Schlacht ähnlichen Erfolgen führt, nämlich: wenn der Feind in einem armen Lande mit großer Mühe Magazine aufgehäuft hat, von deren Erhaltung seine Operationen durchaus abhängen. In diesem Falle kann es sogar ratsam werden, mit der Hauptmacht nicht der feindlichen entgegenzugehen, sondern auf die feindliche Basis vorzudringen. Es sind aber hierzu zwei Bedingungen erforderlich:
a) daß der Feind von seiner Basis so weit entfernt sei, daß er dadurch zu einem bedeutenden Rückzuge gezwungen werde, und
b) daß wir in der Richtung, welche seine Hauptmacht genommen hat, ihm durch Hindernisse der Natur und Kunst mit wenigen Truppen das Vorrücken so erschweren können, daß er hier nicht Eroberungen machen kann, die ihm den Verlust seiner Basis ersetzen.
13. Die Verpflegung der Truppen ist eine notwendige Bedingung des Kriegführens und hat deshalb einen großen Einfluß auf die Operationen, vorzüglich dadurch, daß sie das Konzentrieren der Massen nur bis auf einen gewissen Grad erlaubt, und daß sie bei der Wahl der Operationslinie das Kriegstheater mitbestimmt.
14. Die Verpflegung der Truppen geschieht da, wo die Provinz es irgend erlaubt, auf Kosten derselben durch Requisitionen.
Bei der jetzigen Kriegsart nehmen die Armeen einen beträchtlich größeren Raum ein als ehemals. Die Bildung eigener selbständiger Korps hat dies möglich gemacht, ohne sich gegen denjenigen in Nachteil zu stellen, welcher auf die alte Art (70 000 bis 100 000 Mann) auf einen Fleck konzentriert steht; denn ein einzelnes Korps, welches so organisiert ist, wie dies jetzt der Fall ist, kann es mit einem zwei- und dreifach überlegenen Feinde eine Zeitlang aufnehmen; die übrigen kommen dann herbei, und wenn dieses Korps auch wirklich schon geschlagen ist, so hat es nicht umsonst gefochten, wie schon bei einer andern Gelegenheit bemerkt worden ist.
Es rücken also jetzt die einzelnen Divisionen und Korps, voneinander getrennt, neben- und hintereinander ins Feld, nur so weit zusammengehalten, daß sie, wenn sie zu einer Armee gehören, noch an der nämlichen Schlacht Anteil nehmen können.
Dies macht die augenblickliche Verpflegung ohne Magazine möglich. Die Einrichtung der Korps selbst mit ihrem Generalstabe und ihrer Verpflegungsbehörde erleichtert sie.
15. Da, wo nicht wichtigere Gründe entscheiden (z. B. die Stellung der feindlichen Hauptarmee), wählt man die fruchtbarsten Provinzen zu seinen Operationen, denn die Leichtigkeit der Verpflegung befördert die Schnelligkeit der Unternehmungen. Wichtiger als die Verpflegung kann nur die Stellung der feindlichen Hauptarmee sein, die man aufsucht, die Lage der Hauptstadt oder des Waffenplatzes, die man erobern will. Alle andern Gründe, z. B. die vorteilhafte Form der Aufstellung der Streitkräfte, von der wir schon gesprochen haben, sind in der Regel viel weniger wichtig.
16. Trotz dieser neuen Verpflegungsart ist man weit entfernt, aller Magazine entbehren zu können, und ein weiser Feldherr wird, wenn auch die Kräfte der Provinz ganz hinreichen, doch nicht unterlassen, für unvorhergesehene Fälle, und um auf einzelnen Punkten sich mehr zusammenhalten zu können, Magazine hinter sich anzulegen. Diese Vorsicht gehört zu denjenigen Maßregeln, die nicht auf Unkosten des Zweckes getroffen werden.
2. Verteidigung.
1. In der Politik heißt Verteidigungskrieg ein solcher Krieg, den man für seine Unabhängigkeit führt; in der Strategie heißt Verteidigungskrieg derjenige Feldzug, in welchem man sich beschränkt, den Feind in dem Kriegstheater zu bekämpfen, das man sich für diesen Zweck zubereitet hat. Ob man in diesem Kriegstheater die Schlachten offensiv oder defensiv liefert, ändert darin nichts.
2. Man wählt die strategische Defensive hauptsächlich, wenn der Feind überlegen ist. Natürlich gewähren Festungen und verschanzte Lager, welche als Hauptvorbereitungen auf einem Kriegstheater zu betrachten sind, große Vorteile, zu denen auch noch die Kenntnis der Gegend und der Besitz guter Karten zu rechnen sind. Mit diesen Vorteilen wird eine kleinere Armee oder eine Armee, die auf einen kleineren Staat und geringere Hilfsquellen basiert ist, eher imstande sein, dem Gegner zu widerstehen als ohne diese Hilfsmittel.
Nächstdem gibt es noch folgende zwei Gründe, die zur Wahl eines Defensivkrieges bestimmen können.
Erstens, wenn die unser Kriegstheater umgebenden Provinzen die Operationen der Verpflegung wegen außerordentlich erschweren. In diesem Falle entzieht man sich dem Nachteil, und der Feind muß sich demselben unterwerfen. Dies ist z. B. jetzt (1812) der Fall der russischen Armee.
Zweitens, wenn der Feind uns im Kriegführen überlegen ist. In einem vorbereiteten Kriegstheater, welches wir kennen, wo alle Nebenumstände zu unserem Vorteil sind, ist der Krieg leichter zu führen; es werden nicht so viele Fehler begangen. In diesem Falle, nämlich wenn die Unzuverlässigkeit unserer Truppen und Generale uns zum Verteidigungskrieg veranlaßt, verbindet man mit der strategischen Defensive gern die taktische, d. h. man liefert die Schlachten in vorbereiteten Stellungen und zwar gleichfalls, weil man dabei weniger Fehlern ausgesetzt ist.
3. In dem Verteidigungskriege muß ebensogut wie in dem Angriffskriege ein großer Zweck verfolgt werden. Dieser kann kein anderer sein, als die feindliche Armee aufzureiben, sei es durch eine Schlacht oder dadurch, daß man ihre Subsistenz bis aufs äußerste erschwert, sie dadurch in eine schlechte Verfassung bringt und zum Rückzuge nötigt, wobei sie notwendig großen Verlusten ausgesetzt sein muß. Wellingtons Feldzug in den Jahren 1810 und 1811 gibt davon ein Beispiel.
Der Verteidigungskrieg besteht also nicht in einem müßigen Abwarten der Begebenheiten; abwarten muß man nur, wenn man sichtbaren und entscheidenden Nutzen davon hat. Höchst gefährlich ist für den Verteidiger jene Gewitterstille, die großen Schlägen vorhergeht, zu welchen der Angreifende neue Kräfte sammelt.
Hätten die Österreicher nach der Schlacht von Aspern sich dreimal so sehr verstärkt wie der Kaiser von Frankreich, was sie allerdings konnten, so war die Zeit der Ruhe, welche bis zur Schlacht von Wagram eintrat, ihnen nützlich, aber nur unter dieser Bedingung; da sie es nicht taten, so ging ihnen diese Zeit verloren, und es wäre weiser gewesen, Napoleons nachteilige Lage zu benützen, um die Vorteile der Schlacht von Aspern zu ernten.
4. Die Festungen sind bestimmt, einen bedeutenden Teil der feindlichen Armee durch die Belagerung zu beschäftigen. Dieser Zeitpunkt muß also benützt werden, um den übrigen Teil zu schlagen. Man muß mithin seine Schlachten hinter seinen Festungen, nicht vor denselben liefern. Man muß aber nicht müßig zusehen, daß sie genommen werden, wie Bennigsen tat, während Danzig belagert wurde.
5. Große Ströme, d. h. solche, über welche man nur mit vielen Umständen eine Brücke schlagen kann, wie die Donau von Wien an und der Niederrhein, geben eine natürliche Verteidigungslinie; nicht, indem man sich längs des Stromes gleichmäßig verteilt, um das Übergehen absolut zu verhindern, was gefährlich ist, sondern indem man ihn beobachtet und da, wo der Feind übergegangen ist, in dem Augenblick, wo er noch nicht alle Kräfte an sich gezogen hat und noch auf ein enges Terrain nahe am Flusse eingeschränkt ist, von allen Seiten über ihn herfällt. Die Schlacht von Aspern gibt davon ein Beispiel. Bei der Schlacht von Wagram hatten die Österreicher den Franzosen ganz ohne Not zu viel Terrain überlassen, so daß die eigentümlichen Nachteile des Flußüberganges dadurch aufgehoben wurden.
6. Gebirge sind das zweite Terrainhindernis, welches eine gute Verteidigungslinie gewährt, indem man entweder sie vor sich liegen läßt und nur mit leichten Truppen besetzt, um sie gewissermaßen wie einen Fluß zu betrachten, über welchen der Feind setzen muß, und sobald er aus den Pässen mit einzelnen Kolonnen vordringt, über eine derselben mit der ganzen Macht herzufallen, oder indem man sich selbst hineinstellt. In dem letzteren Falle darf man die einzelnen Pässe nur mit kleinen Korps verteidigen, und ein bedeutender Teil der Armee (1/3 bis 1/2) muß zur Reserve bleiben, um eine der durchgedrungenen Kolonnen mit Übermacht anzufallen. Man muß aber diese große Reserve nicht vereinzeln, um das Durchdringen aller Kolonnen absolut zu verhindern, sondern sich von Hause aus vorsetzen, mit derselben auf diejenigen Kolonnen zu fallen, welche man für die stärksten hält. Schlägt man auf diese Weise einen bedeutenden Teil der angreifenden Armee, so werden die andern durchgedrungenen Kolonnen sich von selbst wieder zurückziehen.
Die Formation der meisten Gebirge ist von der Art, daß sich in der Mitte derselben mehr oder weniger hohe Ebenen befinden (Plateaus), während die nach der Ebene zu gelegene Seite von steilen Tälern durchbrochen ist, welche die Eingänge bilden. Der Verteidiger findet also im Gebirge eine Gegend, in der er sich schnell rechts und links bewegen kann, während die angreifenden Kolonnen durch steile, unzugängliche Rücken voneinander getrennt sind. Nur wenn das Gebirge von dieser Art ist, bietet es Gelegenheit zu einer guten Defensive. Ist es in seinem ganzen Innern rauh und unzugänglich, so daß die Korps des Verteidigers sich zerstreut und ohne Zusammenhang befinden, so ist die Verteidigung desselben mit der Hauptmacht eine gefährliche Maßregel, denn unter diesen Umständen sind alle Vorteile für den Angreifenden, der einzelne Punkte mit großer Überlegenheit anfallen kann; denn kein Paß, kein einzelner Punkt ist so stark, daß er durch eine überlegene Macht nicht bald genommen werden könnte.
7. In Rücksicht auf den Gebirgskrieg ist überhaupt zu bemerken, daß in demselben alles von der Geschicklichkeit der Untergeordneten, der Offiziere, noch mehr aber von dem Geiste der Soldaten überhaupt abhängt. Große Manövrierfähigkeit ist hier nicht erforderlich, aber kriegerischer Geist und Herz für die Sache, denn mehr oder weniger ist sich hier ein jeder selbst überlassen; daher kommt es, daß besonders Nationalbewaffnungen ihre Rechnung im Gebirgskriege finden, denn sie entbehren das eine, während sie das andere im höchsten Grade besitzen.
8. Endlich ist in Rücksicht auf die strategische Defensive zu bemerken, daß sie, weil sie an sich stärker ist als die Offensive, nur dazu dienen soll, die ersten großen Erfolge zu erfechten, und daß, wenn dieser Zweck erreicht ist und der Frieden nicht unmittelbar darauf erfolgt, die weiteren Erfolge nur durch die Offensive erreicht werden können; denn wer immer defensiv bleiben will, setzt sich dem großen Nachteil aus, immer auf eigene Kosten den Krieg zu führen. Dies hält ein jeder Staat nur eine gewisse Zeit aus, und er würde also, wenn er sich den Stößen seines Gegners aussetzte, ohne je wieder zu stoßen, höchstwahrscheinlich am Ende ermatten und unterliegen. Man muß mit der Defensive anfangen, damit man um so sicherer mit der Offensive endigen könne.
3. Angriff.
1. Der strategische Angriff verfolgt den Zweck des Krieges unmittelbar, denn er ist unmittelbar auf die Zerstörung der feindlichen Streitkräfte gerichtet, während die strategische Verteidigung diesen Zweck zum Teil nur mittelbar zu erreichen sucht. Daher kommt es, daß die Grundsätze des Angriffs schon in den allgemeinen Grundsätzen der Strategie enthalten sind. Nur zwei Gegenstände bedürfen einer besonderen Erwähnung.
2. Der erste ist die fortwährende Ergänzung der Truppen und Waffen. Dem Verteidiger wird dieses bei der Nähe seiner Hilfsquellen verhältnismäßig leichter. Der Angreifende, obgleich er in den meisten Fällen über einen größeren Staat zu gebieten hat, muß seine Kräfte mehr oder weniger aus der Entfernung und also mit Schwierigkeit heranziehen. Damit es ihm nun nie an Kräften fehle, muß er solche Einrichtungen treffen, daß die Aushebung von Rekruten und der Transport der Waffen dem Bedürfnis ihres Gebrauches lange vorhergehen. Die Straßen seiner Operationslinien müssen unaufhörlich mit anrückender Mannschaft und zugeführten Bedürfnissen bedeckt sein; auf diesen Straßen müssen Militärstationen errichtet werden, welche den schnellen Transport befördern.
3. Auch in den glücklichsten Fällen und bei der höchsten moralischen und physischen Überlegenheit muß der Angreifende die Möglichkeit großer Unglücksfälle im Auge behalten. Deshalb muß er sich auf seinen Operationslinien solche Punkte schaffen, wohin er sich mit einer geschlagenen Armee wenden kann. Dies sind Festungen mit verschanzten Lagern, oder auch verschanzte Lager allein.
Große Ströme sind das beste Mittel, den verfolgenden Feind eine Zeitlang aufzuhalten. Man muß also die Übergänge über dieselben durch Brückenköpfe, die von einer Reihe starker Redouten umgeben werden, sichern.
Zur Besetzung dieser Punkte, zur Besetzung der wichtigsten Städte und der Festungen müssen mehr oder weniger Truppen zurückgelassen werden, je nachdem feindliche Einfälle oder die Einwohner der Provinz mehr oder weniger zu fürchten sind. Diese bilden mit den heranrückenden Verstärkungen neue Korps, welche bei glücklichem Erfolge der Armee nachgehen, im Unglücksfall aber in den befestigten Punkten aufgestellt werden, um den Rückzug zu sichern.
Napoleon hat sich in diesen Anordnungen im Rücken seiner Armee immer außerordentlich vorsichtig gezeigt und darum bei seinen kühnsten Operationen weniger gewagt, als es das Ansehen hatte.
IV. Über die Befolgung der gegebenen Grundsätze im Kriege.
Die Grundsätze der Kriegskunst sind an sich höchst einfach, liegen dem gesunden Menschenverstande ganz nahe, und wenn sie in der Taktik etwas mehr als in der Strategie auf einem besonderen Wissen beruhen, so ist doch auch dies Wissen von so geringem Umfange, daß es sich kaum mit einer andern Wissenschaft an Mannigfaltigkeit und Ausdehnung vergleichen läßt. Gelehrsamkeit und tiefe Wissenschaft sind also hier durchaus nicht erforderlich, selbst nicht einmal große Eigenschaften des Verstandes. Würde außer einer geübten Urteilskraft eine besondere Eigenschaft des Verstandes erfordert, so geht aus allem hervor, daß es List oder Schlauheit wäre. Es ist lange Zeit gerade das Gegenteil behauptet worden, aber nur aus einer falschen Ehrfurcht für die Sache und aus Eitelkeit der Schriftsteller, die darüber geschrieben haben. Ein vorurteilsloses Nachdenken muß uns davon überzeugen; die Erfahrung aber hat uns diese Überzeugung noch stärker aufgedrängt. Noch in dem Revolutionskriege haben sich gar viele Leute als geschickte Feldherren, oft als Feldherren der ersten Größe gezeigt, die keine militärische Bildung genossen hatten. Von Condé, Wallenstein, Suwarow und vielen andern ist es wenigstens sehr zweifelhaft.
Das Kriegführen selbst ist sehr schwer, das leidet keinen Zweifel; allein die Schwierigkeit liegt nicht darin, daß besondere Gelehrsamkeit oder großes Genie erfordert würde, die wahren Grundsätze des Kriegführens einzusehen; dies vermag jeder gut organisierte Kopf, der ohne Vorurteil und mit der Sache nicht durchaus unbekannt ist. Sogar die Anwendung dieser Grundsätze auf der Karte und dem Papier hat keine Schwierigkeit, und einen guten Operationsplan entworfen zu haben, ist noch kein großes Meisterstück. Die große Schwierigkeit besteht aber darin:
den Grundsätzen, welche man sich gemacht hat in der Ausführung treu zu bleiben.
Auf diese Schwierigkeit aufmerksam zu machen, ist der Zweck dieser Schlußbemerkung, und Ew. Königlichen Hoheit davon ein deutliches, klares Bild zu geben, sehe ich als das Wichtigste von allem an, was ich durch diesen Aufsatz habe erreichen wollen.
Das ganze Kriegführen gleicht der Wirkung einer zusammengesetzten Maschine mit ungeheurer Friktion, so daß Kombinationen, die man mit Leichtigkeit auf dem Papier entwirft, sich nur mit großen Anstrengungen ausführen lassen.
So sieht sich der freie Wille, der Geist des Feldherrn in seinen Bewegungen alle Augenblicke gehemmt, und es wird eine eigene Kraft der Seele und des Verstandes erfordert, um diesen Widerstand zu überwinden. In dieser Friktion geht mancher gute Gedanke zugrunde, und man muß einfacher und schlichter einrichten, was kombinierter eine größere Wirkung getan hätte.
Die Ursachen dieser Friktion erschöpfend aufzuzählen, ist vielleicht nicht möglich, aber die hauptsächlichsten sind folgende:
1. Man weiß stets viel weniger von dem Stande und den Maßregeln des Feindes, als man bei den Entwürfen vorausgesetzt; unzählige Zweifel entstehen dann in dem Augenblick der Ausführung eines Entschlusses, veranlaßt durch die Gefahren, denen man ausgesetzt, wenn man sich in der gemachten Voraussetzung sehr betrogen hätte. Ein Gefühl der Ängstlichkeit, das überhaupt den Menschen bei der Ausführung großer Dinge leicht ergreift, bemächtigt sich dann unser, und von dieser Ängstlichkeit zur Unentschlossenheit, von dieser zu halben Maßregeln ist ein kleiner, unmerklicher Schritt.
2. Nicht allein ungewiß über die Stärke des Feindes ist man, sondern das Gerücht (alle Nachrichten, die wir durch Vorposten, durch Spione oder zufällig über ihn erhalten) vergrößert seine Zahl. Der große Haufen der Menschen ist furchtsamer Natur, und daher entsteht ein regelmäßiges Übertreiben der Gefahr. Alle Einwirkungen auf den Feldherrn vereinigen sich also darin, ihm eine falsche Vorstellung von der Stärke des Feindes, welchen er vor sich hat, zu geben; und hierin liegt ein neuer Quell der Unentschlossenheit.
Man kann sich diese Ungewißheit nicht groß genug denken, es ist daher wichtig, sich darauf vorzubereiten.
Hat man alles vorher ruhig überlegt, hat man den wahrscheinlichsten Fall ohne Vorurteil gesucht und gefunden, so muß man nicht gleich bereit sein, die frühere Meinung aufzugeben, sondern die Nachrichten, welche einlaufen, einer sorgfältigen Kritik unterwerfen, mehrere miteinander vergleichen, nach neuen ausschicken u. s. w. Sehr häufig widerlegen sich dadurch die falschen Nachrichten auf der Stelle, oft werden sich die ersten bestätigen; in beiden Fällen wird man also Gewißheit erhalten und danach seinen Entschluß fassen können. Fehlt es an dieser Gewißheit, so muß man sich sagen, daß im Kriege nichts ohne Wagen ausgeführt werden kann; daß die Natur des Krieges durchaus nicht erlaubt, jederzeit zu sehen, wo man hinschreitet; daß das Wahrscheinliche doch immer wahrscheinlich bleibt, wenn es auch nicht gleich sinnlich in die Augen fällt; und daß man bei sonst vernünftigen Einrichtungen selbst durch einen Irrtum nicht gleich zugrunde gerichtet werden kann.
3. Die Ungewißheit über den jedesmaligen Zustand der Dinge betrifft nicht bloß den Feind, sondern auch die eigene Armee. Diese kann selten so zusammengehalten werden, daß man in jedem Augenblick alle Teile derselben klar überschaut. Ist man nun zur Ängstlichkeit geneigt, so werden neue Zweifel entstehen. Man will abwarten, und ein Aufenthalt in der Wirkung des Ganzen ist die unvermeidliche Folge.
Man muß also das Vertrauen zu seinen eigenen allgemeinen Einrichtungen haben, daß sie der erwarteten Wirkung entsprechen werden. Vorzüglich gehört hierher das Vertrauen zu seinen Unterfeldherren; durchaus muß man also Leute dazu wählen, auf die man sich verlassen kann, und jede andere Rücksicht dieser nachsetzen. Hat man seine Einrichtungen zweckmäßig getroffen, hat man dabei auf die möglichen Unglücksfälle Rücksicht genommen und sich also so eingerichtet, daß man, wenn sie während der Ausführung eintreten, nicht gleich zugrunde gerichtet wird, so muß man mutig durch die Nacht der Ungewißheit fortschreiten.
4. Will man den Krieg mit großer Anstrengung der Kräfte führen, so werden die Unterbefehlshaber und auch die Truppen (besonders wenn diese nicht kriegsgewohnt sind) oft Schwierigkeiten begegnen, die sie als unüberwindlich darstellen. Sie werden den Marsch zu weit, die Anstrengung zu groß, die Verpflegung unmöglich finden. Will man allen diesen Diffikultäten, wie Friedrich II. sie nannte, Gehör geben, so wird man bald ganz unterliegen und, anstatt mit Kraft und Energie zu handeln, schwach und untätig sein.
Dem allen zu widerstehen, ist ein Vertrauen in die eigene Einsicht und Überzeugung erforderlich, welches in dem Augenblicke gewöhnlich das Ansehen des Eigensinns hat, aber diejenige Kraft des Verstandes und Charakters ist, die wir Festigkeit nennen.
5. Alle Wirkungen, auf welche man im Kriege rechnet, finden nie so präzis statt, wie der sie sich denkt, welcher den Krieg nicht selbst mit Aufmerksamkeit beobachtet hat und daran gewöhnt ist.
Oft irrt man sich in dem Marsche einer Kolonne um viele Stunden, ohne daß man sagen könnte, woran der Aufenthalt gelegen; oft treten Hindernisse ein, die sich nicht vorher berechnen ließen; oft denkt man mit der Armee bis zu einem Punkte zu kommen und muß mehrere Stunden vorher Halt machen; oft leistet ein Posten, den wir ausgestellt, viel weniger, als wir erwarten konnten, ein feindlicher hingegen viel mehr; oft reichen die Kräfte einer Provinz nicht so weit, als wir glaubten, usw.
Aller solcher Aufenthalt ist nicht anders als durch sehr große Anstrengungen gut zu machen, die der Feldherr nur durch eine Strenge erhalten wird, die an Härte grenzt. Nur dadurch, nur wenn er gewiß ist, daß das Mögliche immer geleistet wird, darf er sicher sein, daß diese kleinen Schwierigkeiten nicht einen großen Einfluß auf die Operationen gewinnen, daß er nicht zu weit hinter einem Ziele zurückbleibt, welches er hätte erreichen können.
6. Man darf als sicher annehmen, daß nie eine Armee sich in dem Zustande befindet, worin der, welcher in der Stube ihren Operationen folgt, sie voraussetzt. Ist er für diese Armee gestimmt, so wird er sie um ein Drittel bis zur Hälfte stärker und besser voraussetzen, als sie ist. Es ist ziemlich natürlich, daß sich der Feldherr beim ersten Entwurf seiner Operationen in demselben Falle befindet, daß er seine Armee in der Folge zusammenschmelzen sieht, wie er es sich nicht gedacht hat, seine Kavallerie und Artillerie unbrauchbar werden u. s. w. Was also dem Beobachter und dem Feldherrn bei der Eröffnung des Feldzuges möglich und leicht scheint, wird in der Ausführung oft schwer und unmöglich. Ist nun der Feldherr ein Mann, der mit Kühnheit und Stärke des Willens von einem hohen Ehrgeiz getrieben, seine Zwecke dennoch verfolgt, so wird er sie erreichen, während ein gewöhnlicher Mensch in dem Zustande der Armee hinreichende Entschuldigung zu finden glaubt, um nachzulassen.
Massena zeigte in Genua und Portugal, welchen Einfluß die Willenskraft des Feldherrn auf seine Truppen hat; dort waren die außerordentlichen Anstrengungen, zu welchen die Stärke seines Charakters, man kann sagen, seine Härte, die Menschen trieb, mit Erfolg gekrönt; hier in Portugal ist er wenigstens viel später gewichen als ein anderer.
In den meisten Fällen befindet sich die feindliche Armee in einem ähnlichen Zustande; man denke an Wallenstein und Gustav Adolph bei Nürnberg, an Napoleon und Bennigsen nach der Schlacht bei Eylau. Den Zustand des Feindes sieht man nicht, den eigenen hat man vor Augen; daher wirkt der letztere auf gewöhnliche Menschen stärker als der erstere, weil bei gewöhnlichen Menschen die sinnlichen Eindrücke stärker sind als die Sprache des Verstandes.
7. Die Verpflegung der Truppen bietet, wie sie auch geschehen möge (durch Magazine oder Requisitionen), immer solche Schwierigkeiten, daß sie eine sehr entscheidende Stimme bei der Wahl der Maßregeln hat. Sie ist oft der wirksamsten Kombination entgegen und nötigt, der Nahrung nachzugehen, wo man dem Siege, dem glänzenden Erfolge nachgehen möchte. Durch sie vorzüglich bekommt die ganze Maschine die Schwerfälligkeit, durch welche ihre Wirkungen so weit hinter dem Fluge großer Entwürfe zurückbleiben.
Ein General, der von seinen Truppen die äußersten Anstrengungen, die höchsten Entbehrungen mit tyrannischer Gewalt fordert, eine Armee, die in langen Kriegen an diese Opfer gewöhnt ist – wie viel werden sie vor ihren Gegnern voraus haben, wie viel schneller werden sie trotz aller Hindernisse ihr Ziel verfolgen! Bei gleich guten Entwürfen wie verschieden der Erfolg!
8. Überhaupt und für alle diese Fälle kann man folgende Wahrheit nicht scharf genug im Auge behalten.
Die sinnlich anschaulichen Vorstellungen, welche man in der Ausführung erhält, sind lebendiger als die, welche man sich früher durch reife Überlegung verschafft hat. Sie sind aber nur der erste Anschein der Dinge, und dieser trifft, wie wir wissen, selten mit dem Wesen genau zusammen. Man ist also in Gefahr, die reife Überlegung dem ersten Anschein aufzuopfern.
Daß dieser erste Anschein in der Regel zur Furcht und übergroßen Vorsicht hinwirkt, liegt in der natürlichen Furchtsamkeit des Menschen, die alles einseitig betrachtet.
Dagegen muß man sich also waffnen und ein festes Vertrauen in die Resultate seiner eigenen früheren reifen Überlegung setzen, um sich dadurch gegen die schwächenden Eindrücke des Augenblicks zu stärken.
Bei dieser Schwierigkeit der Ausführung kommt es also auf die Sicherheit und Festigkeit der eigenen Überzeugung an. Darum ist das Studium der Kriegsgeschichte so wichtig, weil man durch dasselbe die Dinge selbst kennen lernt, den Hergang selbst sieht. Die Grundsätze, welche man durch einen theoretischen Unterricht erhalten kann, sind nur geeignet, dies Studium zu erleichtern und auf das Wichtigste in der Kriegsgeschichte aufmerksam zu machen.
Ew. Königliche Hoheit müssen sich also mit diesen Grundsätzen in der Absicht bekannt machen, sie beim Lesen der Kriegsgeschichte zu prüfen, zu sehen, wo sie mit dem Hergange der Dinge übereinstimmen, und wo sie von demselben berichtigt oder gar widerlegt werden.
Nächstdem ist aber das Studium der Kriegsgeschichte beim Mangel eigener Erfahrungen allein geeignet, eine anschauliche Vorstellung von dem zu geben, was wir die Friktion der ganzen Maschine genannt haben.
Freilich muß man nicht bei den Hauptresultaten stehen bleiben, noch weniger sich an das Räsonnement der Geschichtsschreiber halten, sondern so viel als möglich ins Detail gehen. Denn die Geschichtsschreiber haben selten die höchste Wahrheit in der Darstellung zum Zweck; gewöhnlich wollen sie die Taten ihrer Armee verschönern oder auch die Übereinstimmung der Ereignisse mit den vermeintlichen Regeln beweisen. Sie machen die Geschichte, anstatt sie zu schreiben. Viel Geschichte ist für den obengenannten Zweck nicht nötig. Die detaillierte Kenntnis von ein paar einzelnen Gefechten ist nützlicher als die allgemeine Kenntnis vieler Feldzüge. Es ist deshalb nützlicher, mehr einzelne Relationen und Tagebücher zu lesen als eigentliche Geschichtsbücher. Ein Muster einer solchen Relation, das nicht übertroffen werden kann, ist die Beschreibung der Verteidigung von Menin im Jahre 1794 in den Denkwürdigkeiten des Generals von Scharnhorst. Diese Erzählung, besonders die Erzählung des Ausfalles und des Durchschlagens der Besatzung wird Ew. Königlichen Hoheit einen Maßstab an die Hand geben, wie man Kriegsgeschichte schreiben muß.
Kein Gefecht in der Welt hat mir so wie dieses die Überzeugung gegeben, daß man im Kriege bis zum letzten Augenblick nicht an dem Erfolge verzweifeln darf, und daß die Wirkung guter Grundsätze, die überhaupt nie so regelmäßig vor sich gehen kann, wie man es sich denkt, auch in den unglücklichsten Fällen, wenn man ihren Einfluß schon ganz verloren glaubt, unerwartet wieder zum Vorschein kommt.
Irgend ein großes Gefühl muß die großen Kräfte des Feldherrn beleben, sei es der Ehrgeiz wie in Cäsar, der Haß des Feindes wie in Hannibal, der Stolz eines glorreichen Unterganges wie in Friedrich dem Großen.
Öffnen Sie Ihr Herz einer solchen Empfindung! Seien Sie kühn und verschlagen in Ihren Entwürfen, fest und beharrlich in der Ausführung, entschlossen, einen glorreichen Untergang zu finden, und das Schicksal wird die Strahlenkrone auf Ihr jugendliches Haupt drücken, die eine Zierde des Fürsten ist, deren Licht das Bild Ihrer Züge in die Brust der spätesten Enkel tragen wird!
Daß die Bestimmungsgründe für die Einteilung und Stärke der verschiedenen Abteilungen einer Truppe, welche aus der Elementartaktik fließen, keine große Schärfe haben und viel Willkür zulassen, muß man schon vermuten, wenn man die zahlreichen Formationsarten sieht, die in der Wirklichkeit vorkommen; aber es bedarf keines großen Nachdenkens, um sich zu überzeugen, daß diese Gründe keine genauere Bestimmung liefern können. Was gewöhnlich in dieser Sache vorgebracht wird, wie z. B. wenn ein Kavallerieoffizier demonstriert, daß ein Kavallerieregiment niemals zu stark sein könne, weil es sonst nicht imstande sei, etwas auszurichten, verdient keine ernsthafte Erwähnung. So ist es schon bei den kleinen Teilen, mit welchen die Elementartaktik es zu tun hat, nämlich den Kompagnien, Schwadronen, Bataillonen und Regimentern; viel schlimmer aber noch bei den größeren Abteilungen, bis zu welchen die Elementartaktik gar nicht hinreicht, und wo die höhere Taktik oder die Lehre von der Anordnung eines Gefechtes es mit der Strategie zu tun hat. Mit diesen Abteilungen wollen wir uns hier beschäftigen; es sind die Brigaden, Divisionen, Korps und die Armeen.
Beschäftigen wir uns zuerst einen Augenblick mit den Vernunftgründen (der Philosophie) der Sache. Wozu sind überhaupt die Massen in Teile geordnet? Offenbar, weil einer nur einer gewissen Anzahl unmittelbar befehlen kann. Der Feldherr kann nicht von 50 000 Soldaten jeden auf seinen Fleck stellen und erhalten und ihm befehlen, was er tun und lassen soll, was, wenn es denkbar wäre, offenbar das Beste sein würde; denn keiner der unzähligen Unterbefehlshaber tut etwas hinzu (wenigstens wäre dies eine Anomalie), jeder aber, der eine mehr, der andere weniger, benimmt dem Befehl etwas von seiner ursprünglichen Kraft und der Idee etwas von ihrer ursprünglichen Präzision. Außerdem braucht, wenn mehrere untergeordnete Einteilungen stattfinden, der Befehl beträchtlich mehr Zeit, um sein Ziel zu erreichen. Hieraus folgt dann, daß die Einteilungen und Untereinteilungen, aus welchen eine Stufenleiter des Befehls entsteht, ein notwendiges Übel sind. Hier hört unsere Philosophie auf, und wir kommen in die Taktik und Strategie hinein.
Eine ganz isolierte Masse, die gegen den Feind wie ein großes oder kleines selbständiges Ganzes hingestellt wird, hat drei wesentliche Teile, ohne welche sie kaum gedacht werden kann, nämlich einen Teil, welchen sie vorschiebt, einen, welchen sie für unvorhergesehene Fälle zurückstellt, und den Hauptteil zwischen beiden:
a ·
b ·
c ·
Soll also diese Einteilung des größeren Ganzen auf Selbständigkeit gerichtet sein, so muß dasselbe niemals weniger als drei Teile haben, wenn die permanente Einteilung mit jenem konstanten Bedürfnis zusammenfallen soll, wie es doch natürlich die Absicht sein muß. Aber es ist nicht schwer, zu bemerken, daß selbst diese drei Teile noch keine sehr natürliche Ordnung geben; denn niemand wird gern seinen vorgeschobenen und seinen zurückgehaltenen Teil so stark wie den Haupteil machen wollen. Es wird also schon natürlicher sein, sich die Hauptmacht aus wenigstens zwei Teilen bestehend zu denken und also das Ganze aus vier, in der Ordnung:
| a · | ||
| b · | c · | |
| d · |
Aber wir sind hier offenbar noch nicht auf dem Punkt des Allernatürlichsten. Da alle taktischen und strategischen Kraftäußerungen trotz aller jetzigen Tiefe sich immer linienartig zeigen, so entsteht das Bedürfnis eines rechten Flügels, eines linken Flügels und eines Zentrums von selbst, es dürfte also wohl fünf als die natürlichste Zahl der Teile angesehen werden können, in der Form:
| a · | ||
| b · | c · | d · |
| e · |
Diese Anordnung erlaubt schon einen, ja im Notfalle zwei Teile der Hauptmacht rechts oder links zu entsenden. Wer wie ich ein Freund starker Reserven ist, wird nun den zurückgestellten Teil vielleicht im Verhältnis zum Ganzen zu schwach finden und deswegen einen neuen Teil hinzufügen, um 1/3 in Reserve zu haben. Dann gibt die ganze Einteilung die Ordnung:
| a · | ||||
| b · | c · | d · | ||
| e · | f · |
Ist von einer ganz großen Masse, von einer beträchtlichen Armee die Rede, so hat die Strategie zu bemerken, daß sich diese fast beständig in dem Falle befindet, rechts und links Teile zu entsenden, daß man also bei dieser deswegen füglich zwei Teile mehr annehmen kann und dann die folgende strategische Figur bekommen würde:
| a · | ||||||||
| b · | c · | d · | e · | f · | ||||
| g · | h · |
Es wäre also dadurch ermittelt, daß man ein Ganzes nicht unter drei, nicht über acht Teile groß machen sollte. Hiermit scheint indessen noch sehr wenig bestimmt, denn welch eine Zahl von verschiedenen Kombinationen ergibt sich, wenn man bedenkt, daß man eine Armee einteilen könnte in 3 x 3 x 3, wenn man Korps, Divisionen und Brigaden auf diese Zahl fixieren wollte, was 27 Brigaden gäbe, oder in jedes andere mögliche Produkt der zugelassenen Faktoren.
Es bleiben uns aber noch einige wichtige Rücksichten übrig.
Wir haben uns nicht auf die Stärke der Bataillone und Regimenter eingelassen, weil wir das der Elementartaktik überlassen wollten; aus dem, was wir bisher gesagt haben, würde bloß folgen, daß wir die Brigaden nicht schwächer als zu 3 Bataillonen gemacht wissen wollten. Hierauf müssen wir nun allerdings auch beharren und werden darin wohl keinem Widerspruch begegnen; schwerer aber ist es, die größte Stärke zu begrenzen, welche die Brigaden haben können. In der Regel wird die Brigade als eine solche Abteilung angesehen, die noch von einem Manne unmittelbar, nämlich durch den Bereich seiner Stimme geführt werden könne und müsse. Halten wir uns daran, so wird sie freilich nicht über 4000 bis 5000 Mann stark sein, und also je nach der Stärke der Bataillone aus 6 oder 8 derselben bestehen dürfen. Aber wir müssen hier zugleich einen andern Gegenstand als ein neues Element in diese Untersuchung einführen. Dieses Element ist die Verbindung der Waffen. Daß diese Verbindung auf der Stufenleiter der Abteilungen früher eintreten müsse als bei der Armee, darüber ist jetzt in Europa nur eine Stimme. Die einen wollen sie aber nur bei Korps, d. h. Massen von 20 000 bis 30 000 Mann, die andern schon bei Divisionen, d. h. Massen von 8000 bis 12 000 Mann. Wir wollen uns auf diese Streitfrage vorderhand nicht einlassen, sondern nur bemerken, was wohl kein Mensch bestreiten wird, nämlich: daß hauptsächlich die Verbindung der drei Waffen die Selbständigkeit einer Abteilung konstituiert und daß also für Abteilungen, die bestimmt sind, sich im Kriege häufig isoliert zu finden, diese Verbindung wenigstens sehr wünschenswert bleibt.
Allein es ist nicht bloß die Verbindung aller drei Waffen in Betracht zu ziehen, sondern auch die von zwei, nämlich der Artillerie und Infanterie. Diese tritt aber nach dem allgemein herrschenden Gebrauch schon sehr viel früher ein, wiewohl in der neueren Zeit die Artilleristen, durch das Beispiel der Kavalleristen angefeuert, wieder ihre eigene kleine Armee zu bilden nicht übel Miene machen. Sie haben sich indessen bis jetzt gefallen lassen müssen, unter die Brigaden verteilt zu werden. Diese Verbindung von Artillerie und Infanterie konstituiert also den Begriff der Brigade auf eine andere Weise, und es kommt dann nur auf die Frage an, wie groß der Haufen Infanterie sein soll, mit dem man zuerst eine Artillerieabteilung auf eine permanente Art verbinden soll.
Der Einfluß dieser Rücksicht ist viel bestimmter, als man auf den ersten Anblick glauben sollte, denn die Anzahl der Geschütze, welche man auf je 1000 Mann mit ins Feld nehmen kann, hängt selten von unserer Willkür ab, sondern bestimmt sich aus mancherlei andern, zum Teil sehr entfernt liegenden Ursachen, dagegen hat die Anzahl der Geschütze, die sich in eine Batterie vereinigen lassen, viel mehr genügende taktische Gründe als irgend eine andere ähnliche Bestimmung; daher kommt es, daß man nicht fragt: wieviel Geschütze soll diese Masse Infanterie (z. B. eine Brigade) haben?, sondern: welche Masse Infanterie soll mit einer Batterie zusammengetan werden? Hat man z. B. 3 Geschütze auf 1000 Mann bei der Armee, und rechnet man davon eine zu den Reservebatterien, so bleiben 2 bei den Truppen zu verteilen, was bei einer Batterie von 8 Geschützen eine Masse von 4000 Mann Infanterie gäbe. Da die hier genannten Verhältnisse die am meisten gebräuchlichen sind, so zeigt dies, daß wir mit unserer Berechnung ungefähr auf dasselbe Resultat kommen. Hiermit wollen wir es genug sein lassen in bezug auf Bestimmung der Größe einer Brigade, die demzufolge aus drei- bis fünftausend Mann bestehen würde.
Obgleich hierdurch das Feld der Einteilung auf der einen Seite begrenzt worden ist, und es auf der andern Seite durch die Stärke der Armee als ein Gegebenes schon begrenzt war, so bleiben doch immer noch eine große Anzahl möglicher Kombinationen übrig, und es würde zu früh sein, den Grundsatz der möglichst geringsten Anzahl von Teilen nach aller Strenge darüber schalten zu lassen; wir haben noch einige Rücksichten von allgemeiner Art zu nehmen und müssen auch den besonderen Rücksichten des individuellen Falles ihre Rechte bewahren.
Zuerst müssen wir bemerken, daß die größeren Teile auch wieder mehr Glieder haben müssen als die kleinen, weil sie gelenkiger sein müssen (wie schon oben berührt ist), und daß die kleinen mit zu viel Gliedern nicht gut fertig werden können.
Wenn man eine Armee aus zwei Hauptteilen zusammensetzt, deren jeder seinen besonderen Befehlshaber hat Die Befehlshaberschaft ist der eigentliche Einteilungsgrund. Wenn ein Feldmarschall 100 000 Mann kommandiert, wovon 50 000 Mann unter einen besonderen General gestellt sind, während der Feldmarschall die andern 50 000, in fünf Divisionen geteilt, unmittelbar anführt, ein Fall, der oft vorkommt, so ist das Ganze eigentlich nicht in zwei Teile geteilt, sondern gleich in sechs, von denen nur einer fünfmal so groß ist als die andern., so heißt das so viel als man will den Oberbefehlshaber neutralisieren. Dies wird jeder, der die Sache kennt, ohne weitere Auseinandersetzungen verstehen. Nicht viel besser ist es, wenn die Armee in drei Teile geteilt wird, denn es lassen sich ohne ein unaufhörliches Zerreißen dieser drei Glieder, wodurch man die Befehlshaber derselben sehr schnell verstimmen wird, keine gewandten Bewegungen und passenden Gefechtsanordnungen ausführen.
Je größer die Zahl der Teile ist, um so größer wird die Macht des Oberbefehls und die Gewandtheit der ganzen Masse. Man hat also Veranlassung, hier so weit zu gehen, als es die Möglichkeit gestattet. Da man in einem großen Hauptquartier, wie das der Armeeführung ist, viel mehr Mittel besitzt, Befehle in Ausführung zu bringen als bei dem beschränkteren Generalstabe eines Korps oder einer Division, so ist nach allgemeinen Gründen eine Armee am besten in nicht weniger als acht Teile einzuteilen. Man kann diese Zahl, wenn die übrigen Umstände dazu veranlassen, auf neun oder zehn steigen lassen. Bei mehr als zehn Teilen aber wird schon eine Schwierigkeit eintreten, die Befehle immer mit der gehörigen Schnelligkeit und Vollständigkeit zu erteilen, denn man muß nicht vergessen, daß es hier nicht auf das bloße Befehlen ankommt, weil sonst eine Armee ebenso viele Divisionen haben könnte, wie eine Kompagnie Köpfe hat, sondern daß viele Anordnungen und Untersuchungen damit verbunden sind, und daß es leichter ist, diese für sechs oder acht Divisionen zu veranstalten als für zwölf oder fünfzehn.
Dagegen kann eine Division, wenn sie an absoluter Stärke klein ist und also vorauszusetzen ist, daß sie der Teil eines Korps ist, sich immer mit einer kleineren Zahl von Teilen als dem angegebenen Normalsatz behelfen: ganz füglich mit vier, zur Not mit drei; – sechs und acht würden ihr beschwerlich werden, weil sie weniger Mittel hat, die Befehle schnell genug an so viele Teile gelangen zu lassen.
Diese Revision unserer eigenen Normalsätze gibt uns das Resultat, daß die Armee nicht unter fünf Teile haben soll und bis zu zehn gehen kann; daß die Division nicht über fünf haben soll und bis zu vier heruntersteigen kann. Zwischen beiden nun liegen die Korps, und sowohl ihre Stärke als die Frage, ob sie überhaupt existieren sollen, hängt von dem Resultat der beiden andern Kombinationen ab.
200 000 Mann in zehn Divisionen und die Division in fünf Brigaden geteilt, gäbe der Brigade eine Stärke von viertausend Mann. Man könnte also bei einer solchen Macht noch mit Divisionen ausreichen.
Man könnte aber freilich diese Macht auch in fünf Korps, das Korps in vier Divisionen, die Division in vier Brigaden teilen; dann würde jede Brigade 2500 Mann stark sein.
Mir scheint die erstere Einteilung die vorzüglichere, denn erstens hat sie eine Stufe weniger in der Ordnungsleiter, der Befehl kommt also schneller an u. s. w. Zweitens sind fünf Glieder für eine Armee zu wenig, sie ist damit zu ungelenk; dasselbe gilt für ein in vier Divisionen geteiltes Korps, und 2500 Mann bilden eine schwache Brigade, deren man auf diese Weise achtzig hat, statt daß die andere Einteilung nur fünfzig gibt, also einfacher ist. Diesen Vorteil opfert man auf, um statt zehn Generalen nur fünfen unmittelbar zu befehlen.
So weit reichen die allgemeinen Betrachtungen. Unendlich wichtig sind aber die Bestimmungen, welche der individuelle Fall erfordern kann.
Zehn Divisionen lassen sich mit Leichtigkeit in der Ebene kommandieren; in weitläufigen Gebirgsstellungen kann es ganz unmöglich werden.
Ein großer Strom, der die Armee teilt, nötigt, auf der einen Seite desselben einen besonderen Befehlshaber zu bestellen. Gegen das Gewicht aller dieser besonderen Fälle vermag die allgemeine Regel nichts; jedoch ist zu bemerken, daß mit dem Eintreten solcher Ursachen auch größtenteils die Nachteile verschwinden, die manche Einteilungsarten sonst hervorbringen. Freilich kann auch hier Mißbrauch entstehen, wenn z. B. zur Befriedigung irgend eines unzeitigen Ehrgeizes und aus Schwäche gegen persönliche Rücksichten schlechte Einteilungen gemacht werden. Wie weit aber auch die Bedürfnisse der individuellen Fälle reichen mögen, in der Regel bleiben, wie uns die Erfahrung lehrt, die Einteilungen doch von allgemeinen Gründen abhängig.
NB. Nach dieser Einteilung ist dieser erste Teil auszuarbeiten.
I. Einleitung. Feststellung der Grenze zwischen den Begriffen Strategie und Taktik.
II. Allgemeine Theorie des Gefechts (Gefecht – Quartiere – Lager. – Märsche).
III. Gefechte; bestimmte Abteilungen ohne alle Anwendung. (Formation – Schlachtordnung – Elementartaktik).
A. Die einzelnen Waffen.
B. Vereinigte Waffen bei Angriff und Verteidigung.
1. Theorie der Waffenvereinigung.
a) Infanterie und Artillerie.
b) Infanterie und Kavallerie.
c) Kavallerie und Artillerie.
d) Alle drei vereinigt.
2. Bestimmte Abteilungen, die dadurch gebildet werden.
IV. Gefechte in Verbindung mit Gegend und Boden.
A. Über den Einfluß des Terrains auf das Gefecht im allgemeinen.
1. Bei der Verteidigung.
2. Beim Angriff.
NB. Wenn die Betrachtung hier den logischen Faden verläßt, so geschieht es aus praktischen Rücksichten. Das Terrain muß so früh als möglich in Betracht gezogen werden und man kann dies nicht, ohne sich gleich das Gefecht unter einer der beiden Formen von Angriff oder Verteidigung zu denken, daher die Verschmelzung beider Gegenstände.
B. Allgemeine Theorie der Verteidigung.
C. Allgemeine Theorie des Angriffs.
D. Verteidigungsgefechte bestimmter Abteilungen. 1. Eines kleinen Haufens, 2. einer Brigade, 3. einer Division, 4. eines Korps, 5. einer Armee.
E. Angriffsgefechte bestimmter Abteilungen.
1. Eines kleinen Haufens, 2. einer Brigade, 3. einer Division, 4. eines Korps, 5. einer Armee.
V. Gefechte mit bestimmten Zwecken.
A. Verteidigung.
1. Sicherheitsanstalten.
a) Wachen, b) Patrouillen, c) Soutiens, d) kleine Posten, e) Vorpostenketten, f) Verbindungsposten, g) Avantgarden, h) Arrieregarden, i) vorgeschobene Korps, k) Seitendeckung beim Marsch, l) Nachrichtendetachements, m) Beobachtungsdetachements, n) Rekognoszierungen.
2. Bedeckungen.
a) von einzelnen Posten, b) von Wagenkolonnen, c) von Fouragierungen.
3. Postierungen. Verschiedenheit der Zwecke.
a) Im Gebirge.
b) An Flüssen.
c) An Morästen.
d) In Wäldern.
4. Schlachten. Verschiedenheit der Zwecke. Vernichtung feindlicher Streitkraft. – Besitz einer Gegend. – Das bloße moralische Gewicht. – Die Waffenehre.
a) Verteidigungsschlacht ohne Vorbereitung.
b) In einer eingerichteten Stellung.
c) In einer verschanzten Stellung.
5. Rückzüge.
a) Der einzelne Rückzug (Abzug) im Angesicht des Feindes.
aa) Vor einem Gefecht, ab) im Lauf desselben, ac) nach einem Gefecht.
b) Strategischer Rückzug, d. h. mehrere aufeinanderfolgende einzelne Rückzüge in ihren taktischen Anordnungen.
B. Der Angriff.
1. Nach den Objekten der Verteidigung eingeteilt und abgehandelt.
2. Nach ihm eigentümlichen Objekten.
a) Überfall.
b) Durchschlagen.
VI. Von den Lagern und Quartieren.
Leitfaden zur Bearbeitung der Taktik oder Gefechtslehre.
I. Allgemeine Theorie der Gefechte.
Zweck der Gefechte.
1. Was ist der Zweck des Gefechtes?
a) Vernichtung der feindlichen Streitkräfte.
b) Besitz irgend eines Gegenstandes.
c) Der bloße Sieg als Waffenehre.
d) Mehrere oder alle drei zusammengenommen.
Theorie des Sieges.
2. Alle diese vier Gegenstände werden nur durch den Sieg erreicht.
3. Sieg ist der Abzug des Feindes vom Kampfplatz.
4. Der Feind ist dazu bewogen:
a) wenn er zu viel verloren hat,
aa. also die Übermacht fürchtet, ab. oder findet, daß der Zweck ihm zu viel kosten würde;
b) wenn er in seiner Ordnung, also in der Wirksamkeit des Ganzen, zu sehr gestört ist;
c) wenn er mit dem Terrain in Nachteil gerät, also zu viel Verluste bei Fortsetzung des Gefechts fürchtet; (Hierin ist also der Verlust der Stellung mit inbegriffen.)
d) wenn die Form in der Aufstellung der Streitkräfte von zu großen Nachteilen begleitet ist;
e) wenn er überrascht oder gar überfallen wird, also nicht Zeit hat, seine Anordnungen zu treffen, feine Maßregeln gehörig zu entwickeln;
f) wenn er gewahr wird, daß sein Gegner ihm in der Zahl sehr überlegen ist;
g) wenn er gewahr wird, daß sein Gegner ihm an moralischen Kräften zu sehr überlegen ist.
5. In allen diesen Fällen kann ein Feldherr vermocht werden, das Gefecht aufzugeben, weil er keine Hoffnung auf eine günstigere Wendung hat, sondern Schlimmeres befürchtet, als schon eingetreten ist.
6. Ohne einen dieser Gründe wäre ein Rückzug nicht motiviert, kann also nicht der Entschluß des Feldherrn oder Befehlshabers sein.
7. Aber der Rückzug kann ohne seinen Willen faktisch geschehen:
a) wenn die Truppen aus Mangel an Mut oder gutem Willen davongehen,
b) wenn der Schrecken sie vertreibt.
8. Unter diesen Umständen kann gegen den Willen des Befehlshabers und selbst bei vorteilhaften Resultaten, welche aus den übrigen von a bis f berührten Verhältnissen hervorgehen mögen, der Sieg des Gegners anerkannt werden.
9. Dieser Fall kann und muß bei kleinen Haufen oft vorkommen. Die geringe Dauer des ganzen Aktes läßt da dem Befehlshaber oft kaum Zeit, einen Entschluß zu fassen.
10a. Bei großen Massen aber kann sich dieser Fall nur bei den Teilen ereignen, nicht leicht beim Ganzen. Indem aber mehrere Teile dem Gegner diesen zu leichten Sieg einräumen, kann für das Ganze in den von a bis e genannten Verhältnissen ein nachteiliges Resultat entstehen, und so der Entschluß des Feldherrn zum Abzug dadurch bedingt werden.
10b. Die unter a b c und d genannten nachteiligen Verhältnisse zeigen sich bei großen Massen dem Feldherrn nicht in den arithmetischen Summen aller einzelnen Nachteile, welche stattgefunden haben, denn so vollkommen ist die Übersicht niemals, sondern sie zeigen sich da, wo diese Nachteile, im engen Raum zusammengedrängt, eine beträchtliche Masse bilden, was entweder bei der Hauptmasse der Truppen oder einem bedeutenden Teile derselben der Fall sein kann. Nach dieser Haupterscheinung des ganzen Aktes richtet sich daran der Entschluß.
11. Endlich kann der Feldherr noch durch Gründe, die nicht im Gefecht liegen, sondern als äußerlich betrachtet werden müssen, z. B. Nachrichten, welche den Zweck aufheben oder die strategischen Verhältnisse merklich ändern, zum Aufgeben des Gefechts und also zum Rückzug bewogen werden. Dies würde ein Abbrechen des Gefechts sein und gehört nicht hierher, weil es kein taktischer, sondern ein strategischer Akt ist.
12. Das Aufgeben eines Gefechts ist also die Anerkennung der augenblicklichen Überlegenheit des Gegners, sie sei physisch oder moralisch, und das Nachgeben in seinen Willen. Darin liegt die erste moralische Kraft des Sieges.
13. Da man ein Gefecht nicht anders aufgeben kann, als wenn man den Kampfplatz verläßt, so ist der Abzug vom Schlachtfelde das Zeichen dieser Anerkennung, gewissermaßen das Senken des Paniers.
14. Aber das Merkmal des Sieges entscheidet noch nichts über seine Größe, Wichtigkeit und seinen Glanz. Diese drei Dinge fallen oft zusammen, sind aber keineswegs identisch.
15. Die Größe des Sieges hängt von der Größe der Massen, über die er erfochten wird, sowie von der Größe der Trophäen ab. Eroberte Geschütze, Gefangene, genommenes Gepäck, Tote, Verwundete gehören dahin. Über einen kleinen Haufen kann man also keinen großen Sieg erfechten.
16. Die Wichtigkeit des Sieges hängt von der Wichtigkeit des Zwecks ab, der erreicht wird. Die Einnahme einer wichtigen Stellung kann einen an sich unbedeutenden Sieg sehr wichtig machen.
17. Der Glanz des Sieges besteht in der relativen Größe, welche die Trophäen zur siegenden Armee haben.
18. Es gibt also Siege von verschiedener Art, besonders aber von sehr vielen Abstufungen. Streng genommen kann kein Gefecht ohne Entscheidung, folglich ohne Sieg bleiben, aber der Sprachgebrauch und die Natur der Sache verlangen, daß man nur solche Gefechtsresultate als Siege betrachtet, denen beträchtliche Anstrengungen vorhergegangen sind.
19. Wenn der Feind nur so viel tut, als nötig ist, um unsere ernstliche Absicht zu erforschen, und sobald ihm diese kund ist, nachgibt, so kann man das keinen Sieg nennen; tut er mehr, so kann das nur geschehen, um wirklich Sieger zu werden, und in diesem Fall ist er also, wenn er das Gefecht aufgibt, als besiegt zu betrachten.
20. Da ein Gefecht nur aufgegeben werden kann, wenn einer der beiden Teile oder beide die im Kontakt begriffenen Truppen etwas zurücknehmen, so kann man eigentlich niemals sagen, daß beide das Schlachtfeld behauptet hätten. Insofern man aber, wie die Natur der Sache und der Sprachgebrauch verlangen, unter Schlachtfeld nur die Stellung der Hauptmassen versteht, weil nur beim Rückzug der Hauptmassen die ersten Folgen des Sieges eintreten, so kann es allerdings Schlachten geben, welche ganz unentschieden bleiben.
Das Mittel zum Siege ist das Gefecht.
21. Das Mittel zum Siege ist das Gefecht. Da die in Nr. 4 von a bis g genannten Gegenstände den Sieg bedingen, so ist auch das Gefecht auf diese Gegenstände als seine näheren Zwecke gerichtet.
22. Wir müssen das Gefecht nun nach seinen verschiedenen Richtungen kennen lernen.
Was ist ein einzelnes Gefecht?
23. Materiell läßt sich jedes Gefecht in so viele einzelne Gefechte auflösen, als Fechtende da sind. Der einzelne erscheint aber als eigene Größe nur, wenn er einzeln, d. h. selbständig ficht.
24. Von dem einzelnen Fechten steigen die Einheiten mit den Befehlsabteilungen hinauf zu neuen Einheiten.
25. Diese Einheiten sind durch Zweck und Plan verbunden, aber nicht so eng, daß die Glieder nicht eine gewisse Selbständigkeit behielten. Diese wird immer größer, je weiter die Ordnung hinaufsteigt. Wie diese Lösung der Glieder entsteht, werden wir erst später zeigen können. (Nr. 97 u. ff.)
26. Es besteht also jedes Gesamtgefecht aus einer großen Menge einzelner Gefechte in absteigender Ordnung der Glieder bis zum letzten selbständig handelnden Gliede.
27. Es besteht aber auch ein Gesamtgefecht aus einzelnen aufeinanderfolgenden Gefechten.
28. Alle einzelnen Gefechte nennen wir Teilgefechte und das Ganze Gesamtgefecht; den Begriff des Gesamtgefechts aber knüpfen wir an die Bedingung des persönlichen Befehls, so daß nur dasjenige zu einem Gefechte gehört, was von einem Willen geleitet wird. (Bei Kordonstellungen können die Grenzen beider nie bestimmt werden.)
29. Was hier von der Theorie des Gefechts gesagt wird, soll sich sowohl auf das Gesamtgefecht als auf die Teilgefechte beziehen.
Prinzip des Gefechts.
30. Jeder Kampf ist eine Äußerung der Feindschaft, die instinktmäßig in denselben übergeht.
31. Dieser Instinkt zum Anfall und zur Vernichtung seines Feindes ist das eigentliche Element des Krieges.
32. Auch beim rohesten Menschen bleibt dieser Feindschaftstrieb nicht bloßer Instinkt; der überlegende Verstand tritt hinzu, und es wird aus dem unabsichtlichen Instinkt eine Handlung der Absicht.
33. Auf diese Weise werden die Gemütskräfte dem Verstande untergeordnet.
34. Niemals aber kann man sie als ganz eliminiert betrachten und die bloße Verstandesabsicht an ihre Stelle setzen; denn wären sie wirklich in der Verstandesabsicht ganz untergegangen, so würden sie sich im Kampf selbst wieder entzünden.
35. Da unsere Kriege nicht Äußerungen der Feindschaft einzelner gegen einzelne sind, so scheint das Gefecht aller eigentlichen Feindschaft zu entbehren und also ein rein verstandesmäßiges Handeln zu sein.
36. So ist es aber keineswegs. Teils fehlt es nie an dem Kollektivhaß der beiden Parteien, der sich dann in dem einzelnen mehr oder weniger wirksam zeigt, so daß er von der gehaßten und befeindeten Partei auch den einzelnen Mann haßt und befeindet; teils entzündet sich bei dem einzelnen im Kampfe selbst mehr oder weniger ein wirkliches Feindschaftsgefühl.
37. Ruhmbegierde, Ehrgeiz, Eigennutz, und esprit de corps vertreten mit andern Gemütskräften die Feindschaft, wo diese nicht vorhanden ist.
38. Es wird also in einem Gefechte selten oder nie der bloße Wille des Befehlshabers, der bloße vorgeschriebene Zweck das einzige Motiv des Handelns in den Fechtenden, sondern es wird immer ein sehr merklicher Teil der Gemütskräfte wirksam sein.
39. Diese Wirksamkeit wird dadurch erhöht, daß der Kampf sich in der Region der Gefahr bewegt, in welcher alle Gemütskräfte mehr gelten.
40. Aber auch die Intelligenz, welche den Kampf leitet, kann nie eine bloße Verstandeskraft und der Kampf also nie Gegenstand bloßer Berechnung sein,
a) weil er ein Stoß lebendiger physischer und moralischer Kräfte gegeneinander ist, die nur allgemeinen Schätzungen, aber keinen bestimmten Berechnungen unterworfen werden können;
b) weil die Gemütskräfte, welche ins Spiel kommen, den Kampf zum Gegenstand einer Begeisterung und dadurch eines höheren Urteils machen können.
41. Der Kampf kann also ein Akt des Talents und des Genius sein im Gegensatz zum berechnenden Verstande.
42. Die Gemütskräfte und der Genius nun, welche sich im Kampfe zeigen, müssen als eigene moralische Größen betrachtet werden, die in ihrer großen Ungleichheit und Elastizität unaufhörlich über die Linie des berechnenden Verstandes hinausspielen.
43. Es ist die Aufgabe der Kriegskunst, in der Theorie und in der Ausführung diese Kräfte zu berücksichtigen.
44. Je stärker sie ausgenutzt werden können, um so kräftiger und erfolgreicher wird der Kampf sein.
45. Alle Erfindungen der Kunst, als Waffen, Organisation, eingeübte Taktik und die Grundsätze für den Gebrauch der Truppen im Gefechte sind Beschränkungen des natürlichen Instinkts, der auf Umwegen zu einem wirksameren Gebrauche seiner Kräfte geführt werden soll. Aber die Gemütskräfte lassen sich nicht so zuschneiden, und indem man sie zu sehr zum Instrument machen will, raubt man ihnen Schwung und Kraft. Es muß ihnen also überall, sowohl zwischen den Bestimmungen der Theorie als in ihren stehenden Einrichtungen, durchaus ein gewisser Spielraum gelassen werden. Dazu gehört für die Theorie ein hoher Standpunkt und große Umsicht, für die Ausführung ein großer Takt des Urteils.
Zwei Gefechtsarten: Handgefecht und Feuergefecht.
46. Von allen Waffen, die der menschliche Verstand erfunden hat, sind diejenigen, welche die Kämpfer einander am nächsten bringen, dem rohen Faustkampfe am ähnlichsten sind, die natürlichsten, welche dem Instinkt am meisten zusagen. Der Dolch, die Streitaxt sind es mehr als die Lanze, der Wurfspieß, die Schleuder.
47. Die Waffen, mit welchen der Feind schon in der Entfernung bekämpft wird, sind mehr Instrumente des Verstandes; sie lassen die Gemütskräfte und den eigentlichen Kampfinstinkt fast ganz ruhen, und zwar um so mehr, je größer die Entfernung ist, in der sie wirken. Bei der Schleuder kann man sich noch einen gewissen Ingrimm denken, mit dem sie geworfen wird, weniger schon beim Büchsenschuß, noch weniger beim Kanonenschuß.
48. Obgleich auch hier Übergänge stattfinden, so zerfallen doch alle neueren Waffen in zwei Hauptgattungen, nämlich in die Hieb- und Stoßwaffen und in die Feuerwaffen, jene zum Handgefecht, diese zum Gefecht aus der Ferne.
49. Es entstehen daher zwei Fechtarten: das Handgefecht und das Feuergefecht.
50. Beide haben die Vernichtung des Gegners zum Zweck.
51. Im Handgefecht ist diese eine ganz unzweifelhafte; im Feuergefecht nur eine mehr oder weniger wahrscheinliche. Aus diesem Unterschiede folgt eine sehr verschiedene Bedeutung beider Gefechtsformen.
52. Weil im Handgefecht die Vernichtung ganz unzweifelhaft ist, so wirkt auch das geringste Übergewicht der Vorteile oder des Mutes entscheidend, und es sucht der, welcher sich im Nachteil befindet oder schwächeren Mutes ist, sich der Gefahr durch die Flucht zu entziehen.
53. Dies tritt bei allen Handgefechten zwischen mehreren so regelmäßig und gewöhnlich auch so früh ein, daß die eigentliche Vernichtungskraft dieses Gefechtes dadurch sehr geschwächt wird und seine Hauptwirkung mehr im Vertreiben als im Vernichten des Feindes besteht.
54. Sieht man also auf die Wirksamkeit, welche das Handgefecht in der Praxis hat, so muß man seinen Zweck nicht in die Vernichtung, sondern in die Vertreibung des Feindes setzen. Die Vernichtung wird zum Mittel.
55. So wie im Handgefecht ursprünglich die Vernichtung des Feindes der Zweck war, so ist im Feuergefecht ursprünglich die Vertreibung des Feindes der Zweck, und die Vernichtung nur Mittel dazu. Man beschießt den Feind, um ihn zu verjagen und sich das Handgefecht zu ersparen, wozu man sich nicht ausgerüstet fühlt.
56. Aber die Gefahr, welche das Feuergefecht bringt, ist keine ganz unvermeidliche, sondern nur eine mehr oder weniger wahrscheinliche; sie ist also für den sinnlichen Eindruck des einzelnen nicht so groß, sondern wird es erst durch die Dauer und die summarische Wirkung, die keinen so sinnlichen, also keinen so unmittelbar wirksamen Eindruck macht. Darum ist nicht durchaus notwendig, daß einer der beiden Teile sich ihr entzieht. Hieraus folgt, daß die Vertreibung des einen nicht sogleich und in vielen Fällen gar nicht erfolgt.
57. Ist dies der Fall, so muß in der Regel am Schlusse des Feuergefechts das Handgefecht zur Vertreibung gebraucht werden.
58. Dagegen wächst die Vernichtungswirkung des Feuergefechts durch die Dauer ebensosehr, wie sie beim Handgefecht durch die schnelle Entscheidung verloren geht.
59. Daher kommt es, daß der generelle Zweck des Feuergefechts nicht mehr in die Vertreibung, sondern in die unmittelbare Wirkung des angewendeten Mittels, nämlich in die Vernichtung oder Schwächung der feindlichen Streitkräfte gesetzt wird.
60. Hat das Handgefecht den Zweck der Vertreibung, das Feuergefecht den der Zerstörung der feindlichen Streitkraft, so ist jenes als das eigentliche Instrument der Entscheidung, dieses als das der Vorbereitung zu betrachten.
61. Beiden bleibt aber darum doch einige Wirksamkeit des andern Prinzips. Das Handgefecht ist nicht ohne zerstörende Kraft, das Feuergefecht nicht ohne vertreibende.
62. Die zerstörende Kraft des Handgefechts ist in den meisten Fällen höchst unbedeutend, sehr oft ist sie völlig Null; sie würde daher kaum noch in Betracht kommen, wenn sie nicht in einigen Fällen durch die Gefangenen sehr stiege.
63. Es ist aber wohl zu beachten, daß diese Fälle meistens erst eintreten, wenn das Feuergefecht schon gewirkt hat.
64. Das Handgefecht ohne Feuergefecht würde also bei dem jetzigen Verhältnis der Waffen eine sehr unbedeutende Vernichtungskraft haben.
65. Die Vernichtungskraft des Feuergefechts kann durch die Dauer bis aufs äußerste, d. h. bis zur Erschütterung oder Erschöpfung des Mutes, gesteigert werden.
66. Die Folge davon ist, daß bei weitem der größte Anteil an der Vernichtung feindlicher Streitkräfte dem Feuergefecht zukommt.
67. Durch die im Feuergefecht entstehende Schwächung des Feindes wird entweder
a) sein Rückzug selbst motiviert, oder
b) dem Handgefecht vorgearbeitet werden.
68. Durch die beim Handgefecht beabsichtigte Vertreibung des Feindes kann ein eigentlicher Sieg erlangt werden, weil Vertreiben vom Kampfplatz Sieg ist. Ist das Ganze nur klein, so kann ein solcher Sieg es ganz umfassen und über den Erfolg entscheiden.
69. Wo aber das Handgefecht nur zwischen Teilen des Ganzen stattfand, oder wo mehrere successive Handgefechte das Gesamtgefecht ausmachen, kann der Erfolg im einzelnen nur als ein Sieg im Teilgefechte betrachtet werden.
70. Wäre die besiegte Abteilung ein bedeutender Teil des Ganzen, so könnte dieses dadurch mit fortgerissen werden und also aus dem Siege über den Teil unmittelbar ein Sieg über das Ganze folgen.
71. Wenn der Erfolg des Handgefechts auch nicht ein Sieg über das Ganze des Gegners ist, so gewährt er doch immer einen der folgenden Vorteile:
a) Gewinn an Terrain;
b) Brechung der moralischen Kraft;
c) Zerstörung der Ordnung beim Gegner;
d) Zerstörung physischer Streitkraft.
72. Für das Teilgefecht ist also das Feuergefecht als ein Zerstörungsakt, das Handgefecht als ein Entscheidungsakt zu betrachten. Wie es für das Gesamtgefecht angesehen werden muß, werden wir später betrachten.
Beziehungen beider Gefechtsformen auf Angriff und Verteidigung.
73. Das Gefecht besteht ferner aus Angriff und Verteidigung.
74. Der Angriff ist die positive Absicht, die Verteidigung die negative. Jener will den Gegner vertreiben, diese will sich bloß erhalten.
75. Aber das Erhalten ist kein bloßes Aushalten, kein Leiden, sondern es hängt von einer aktiven Rückwirkung ab. Diese Rückwirkung besteht in der Vernichtung der angreifenden Streitkraft. Also ist nur der Zweck, nicht das Mittel als negativ zu betrachten.
76. Da aber aus der Behauptung der Stellung bei der Verteidigung von selbst folgt, daß der Gegner weichen muß, so ist trotz des negativen Zwecks auch für den Verteidiger der Abzug, also das Weichen des Gegners das Siegeszeichen.
77. Ursprünglich ist wegen des gleichen Zwecks das Handgefecht das Element des Angriffs.
78. Da aber das Handgefecht ein so schwaches Zerstörungsprinzip in sich hat, so würde der Angreifende, welcher sich desselben ganz allein bedienen wollte, in den meisten Fällen kaum als ein Fechtender zu betrachten und in jedem Falle das Spiel sehr ungleich sein.
79. Nur bei kleinen Haufen oder bei bloßer Reiterei kann das Handgefecht den ganzen Angriff ausmachen. Je größer die Massen werden, je mehr Artillerie und Infanterie ins Spiel kommen, um so weniger reicht es zu.
80. Es muß also auch der Angriff so viel von dem Feuergefecht in sich aufnehmen, als nötig ist.
81. In diesem, nämlich im Feuergefecht, sind beide Teile in Beziehung auf die Gefechtsart als einander gleich zu betrachten. Je größer also das Verhältnis desselben zum Handgefecht wird, um so mehr nimmt die ursprüngliche Ungleichheit zwischen Angriff und Verteidigung ab. Was nun noch für das Handgefecht, zu dem der Angreifende zuletzt schreiten muß, an Nachteilen übrig bleibt, muß durch die eigentümlichen Vorteile desselben und durch Überlegenheit ausgeglichen werden.
82. Das Feuergefecht ist das natürliche Element des Verteidigers.
83. Wo der glückliche Erfolg (Abzug des Angreifenden) schon durch dasselbe bewirkt wird, bedarf es der Handgefechte nicht.
84. Wo jener Erfolg nicht erreicht wird und der Angreifende zum Handgefecht übergeht, muß auch der Verteidiger sich desselben bedienen.
85. Überhaupt schließt die Verteidigung das Handgefecht auf keine Weise aus, wenn die Vorteile desselben größer erscheinen als die des Feuergefechts.
Vorteilhafte Bedingungen in beiden Gefechtsarten.
86. Wir müssen nun die Natur beider Gefechte im allgemeinen genauer betrachten, um die Dinge kennen zu lernen, welche darin die Überlegenheit geben.
87. Das Feuergefecht.
a) Die Überlegenheit im Gebrauch der Waffen (sie liegt in der Organisation und dem Werte der Truppen).
b) Überlegenheit in der Formation und der niederen Taktik als feststehenden Dispositionen. (S. Methodismus S. 713, § 5.)
Bei der Verwendung ausgebildeter Streitkräfte im Gefecht können diese Dinge nicht in Betracht kommen, da sie mit den Streitkräften schon gegeben sind. Aber sie können und müssen selbst als Gegenstand der Gefechtslehre im ausgedehntesten Sinne betrachtet werden.
c) Die Zahl.
d) Die Form der Aufstellung, soweit sie nicht schon in b enthalten ist.
e) Das Terrain.
88. Da wir hier nur den Gebrauch ausgebildeter Streitkräfte abhandeln, so gehören a und b nicht hierher, sondern sind nur als ein Gegebenes gewissermaßen faktisch in Betracht zu ziehen.
89a. Überlegenheit der Zahl.
Wenn zwei ungleiche Massen Infanterie oder Artillerie parallel in gleichem Raume gegeneinander aufgestellt sind, so würde, wenn alle Schüsse Zielschüsse auf die einzelnen Individuen wären, die Zahl der Treffer sich verhalten wie die Zahl der Schießenden. Ebenso würden sich die Treffer verhalten, wenn nach einer vollen Scheibe geschossen würde, also wenn das Ziel nicht mehr der einzelne Mann, sondern ein Bataillon, eine Linie u. s. w. wäre. So sind die Schüsse im Kriege, sogar bei den Schützengefechten, der großen Mehrheit nach wirklich anzusehen. Nun ist aber die Scheibe nicht voll, sondern sie besteht aus Menschen und Zwischenräumen. Diese letzteren nehmen in dem Maße ab, als die Zahl der Fechtenden auf demselben Raum zunimmt. Folglich wird die Wirkung eines Feuergefechts zwischen Truppenkörpern von ungleicher Zahl zusammengesetzt sein aus der Zahl der Schießenden und der Zahl der feindlichen Truppen, auf welche geschossen wird, d. h. mit andern Worten: die Überlegenheit in der Zahl gibt im Feuergefecht keine überlegene Wirkung, weil man das, was man durch die Menge seiner Schüsse gewinnt, dadurch, daß die feindlichen um so viel besser treffen, wieder verliert.
Angenommen, 50 Mann befänden sich in demselben Raum einem Bataillon von 500 gegenüber. Es sollen von den 50 Schüssen 30 in die Scheibe gehen, d. h. in den Quadratraum, den das feindliche Bataillon einnimmt, so werden von den feindlichen 500 Schüssen 300 in den Raum gehen, den unsere 50 Mann einnehmen. Nun stehen aber die 500 Mann zehnmal so dicht als die 50, es treffen also von unsern Kugeln zehnmal so viel als von den feindlichen, und mithin werden von unsern 50 Schüssen gerade so viele Feinde wie von den feindlichen 500 Schüssen Unsrige getroffen.
Wenngleich dies Resultat in der Wirklichkeit nicht genau zutreffen wird und im allgemeinen ein kleiner Vorteil für die Überlegenheit der Zahl bleiben mag, so ist doch gewiß, daß es im wesentlichen zutrifft: daß nämlich die einseitige Wirkung, d. i. der Erfolg im Feuergefecht, weit entfernt, mit der Überlegenheit der Zahl genau Schritt halten, kaum durch sie gesteigert wird.
Dies Resultat ist von einer durchgreifenden Wichtigkeit, denn es macht die Basis derjenigen Ökonomie der Kräfte im vorbereitenden Zerstörungsakte aus, welche als eines der sichersten Mittel zum Siege betrachtet werden kann.
89b. Man glaube nicht, daß dieses Resultat zu einem Absurdum führen könne, und daß z. B. 2 Mann (die kleinste Zahl, welche einen längeren Raum einnehmen kann, der hier als Scheibe gedacht ist) dann ebensoviel leisten müßten als 2000, vorausgesetzt, daß die 2 Mann so weit auseinander ständen, wie die 2000. Wenn jene 2000 immer gerade vor sich hinschössen, so würde dies allerdings der Fall sein. Wenn aber die Zahl des Schwächeren so gering ist, daß der Stärkere sein Feuer konzentriert auf die einzelnen Leute richtet, so muß natürlich eine große Verschiedenheit der Wirkung eintreten; denn nun findet die gemachte Voraussetzung bloßer Scheibenschüsse nicht mehr statt. Ebenso würde eine zu schwache Feuerlinie den Gegner gar nicht dazu vermögen, das Feuergefecht anzunehmen, sondern gleich von ihm vertrieben werden. Man sieht also, daß man die obige Folgerung nicht zu weit treiben darf, aber sie bleibt darum doch sehr wichtig. Hundertmal hat man gesehen, daß eine Feuerlinie einer doppelt so starken feindlichen das Gleichgewicht gehalten hat, und es ist leicht einzusehen, welche Folgen dies in der Ökonomie der Kräfte hat.
89c. Man kann also sagen, daß jeder der beiden Teile es in seiner Gewalt hat, die gegenseitige, d. i. die Gesamtwirkung des Feuers zu verstärken oder zu schwächen, je nachdem er mehr Streiter in die Feuerlinie bringt oder nicht.
90. Die Form der Aufstellung kann sein:
a) In paralleler Front und in gleicher Ausdehnung; dann ist sie gleichmäßig von beiden Seiten.
b) In paralleler Front und in größerer Ausdehnung; dann ist sie vorteilhaft. (Dies ist begreiflicherweise wegen der Schußweite sehr beschränkt.)
c) Umfassend. Dann ist sie vorteilhaft wegen der doppelten Wirkung der Schüsse, und weil die größere Ausdehnung von selbst daraus folgt.
Die Gegensätze von b und c ergeben sich von selbst als Nachteile.
91. Das Terrain wirkt im Feuergefecht vorteilhaft:
a) Durch Deckung, wie eine Brustwehr.
b) Durch Verbergung gegen den Feind, also als Hindernis beim Zielen.
c) Als Hindernis des Zuganges, durch welches der Feind in unserem Feuer lange aufgehalten, auch selbst am Feuern mehr gehindert wird.
92. Die Vorteile, welche sich im Handgefecht wirksam zeigen, sind dieselben wie beim Feuergefecht.
93. Die beiden ersten Gegenstände (a und b Nr. 87) gehören nicht hierher. Zu bemerken ist aber, daß Überlegenheit im Gebrauch der Waffen nicht so große Unterschiede wie beim Feuergefecht hervorbringen kann, daß dagegen der Mut hier eine ganz entscheidende Rolle spielt. Die unter b (Nr. 87) berührten Gegenstände werden für die Reiterei, die einen großen Teil der Handgefechte liefert, besonders wichtig.
94. Die Zahl ist hier sehr viel entscheidender als im Feuergefecht; sie ist fast die Hauptsache.
95. Die Form der Aufstellung ist gleichfalls noch viel entscheidender als im Feuergefecht, und zwar ist bei gerader Linie umgekehrt die geringere Ausdehnung die vorteilhaftere.
96. Das Terrain.
a) Als Hindernis des Zuganges. Dies ist beim Handgefecht bei weitem die Hauptwirksamkeit desselben.
b) Durch Verbergung. Dies begünstigt die Überraschung, welche im Handgefecht vorzüglich wichtig ist.
Vereinzelung der Gefechte.
97. Wir haben unter Nr. 23. gesehen, daß ein jedes Gefecht ein vielgegliedertes Ganzes ist, bei dem die Selbständigkeit der Glieder ungleich ist, indem sie nach unten hin abnimmt. Wir können jetzt diesen Gegenstand genauer untersuchen.
98. Man kann füglich als ein einfaches Glied betrachten, was im Gefecht noch durch das Kommandowort geführt wird, z. B. ein Bataillon, eine Batterie, ein Kavallerieregiment etc. wenn diese Massen wirklich vereinigt sind.
99. Wo das Kommandowort nicht mehr zureicht, tritt ein mündlicher oder schriftlicher Befehl ein.
100. Das Kommandowort ist keiner Gradation fähig, es ist schon ein Teil der Ausführung. Der Befehl aber hat Abstufungen von der höchsten, an das Kommandowort grenzenden Bestimmtheit bis zur größten Allgemeinheit. Er ist nicht die Ausführung selbst, sondern nur ein Auftrag.
101. Alles, was unter dem Kommandowort steht, hat keinen Willen; sowie aber statt dessen der Befehl eintritt, so beginnt auch eine gewisse Selbständigkeit der Glieder, weil der Befehl allgemeiner Natur ist, und der Wille des Führers ihn ergänzen muß, wenn er nicht zureicht.
102. Ließe sich ein Gefecht in allen seinen neben- und nacheinander liegenden Teilen und Ereignissen genau vorherbestimmen und übersehen, könnte also der Plan desselben bis in die kleinsten Teile hineindringen, wie bei der Einrichtung einer toten Maschine, so würde der Befehl diese Unbestimmtheit nicht haben.
103. Aber die Fechtenden hören nie auf, Menschen und Individuen zu sein, können nie zur willenlosen Maschine gemacht werden, und der Boden, auf dem sie fechten, wird selten oder nie eine vollkommene und leere Ebene sein, welche ohne allen Einfluß auf das Gefecht bliebe. Es ist also ganz unmöglich, alle Wirkungen vorher zu berechnen.
104. Dieses Unzureichende des Plans wächst mit der Dauer des Gefechts und mit der Zahl der Fechtenden. Das Handgefecht eines schwachen Haufens ist fast ganz in seinem Plan enthalten; dagegen kann der Plan im Feuergefecht selbst kleiner Haufen wegen der Dauer desselben und der eintretenden Zwischenfälle nicht in dem Maße durchdringen. Von der andern Seite kann auch das Handgefecht großer Massen, z. B. einer Kavalleriedivision von 2000 oder 3000 Pferden, nicht so von den Bestimmungen des ersten Plans durchdrungen werden, daß nicht häufig der Wille einzelner Führer ihn ergänzen müßte. Von einer großen Schlacht aber kann der Plan außer der Einleitung nur die Hauptumrisse angeben.
105. Da also die Unzulänglichkeit des Plans (Disposition) mit der Zeit und dem Raum, welche das Gefecht einnimmt, wächst, so wird auch in der Regel den größeren Truppenabteilungen ein größerer Spielraum gegeben werden müssen als den kleinern; und die Bestimmtheit des Befehls wird in absteigender Ordnung bis zu den Teilen zunehmen, die durch das Kommandowort regiert werden.
106. Die Selbständigkeit der Teile wird aber ferner nach den Umständen verschieden sein, in welchen sie sich befinden. Raum, Zeit, Charakter des Bodens und der Gegend, Natur des Auftrags müssen sie bei ein und derselben Abteilung schwächen oder verstärken.
107. Außer dieser planmäßigen Trennung des Gesamtgefechts in gesonderte Glieder wird auch eine unabsichtliche entstehen können, und zwar:
a) indem die beabsichtigte größer wird, als im Plane lag;
b) indem da eine Trennung eintritt, wo sie gar nicht vorhanden sein, sondern das Kommandowort alles führen sollte.
108. Diese rührt von Umständen her, die sich nicht vorhersehen ließen.
109. Die Folge ist ungleicher Erfolg bei Teilen, die zusammengehören (weil sie sich nämlich in ungleichen Verhältnissen befinden können).
110. Es entsteht dadurch bei einzelnen Teilen das Bedürfnis einer Veränderung, die nicht im Plane des Ganzen gelegen hat,
a) indem sie sich Nachteilen des Terrains, der Zahl, der Aufstellung entziehen wollen;
b) indem sie in allen diesen Punkten Vorteile erhalten, die sie benützen wollen.
111. Die Folge hiervon ist, daß unwillkürlich, oft mehr oder weniger absichtlich, ein Feuergefecht in ein Handgefecht und umgekehrt das letztere in das erstere übergehen wird.
112. Die Aufgabe ist dann, diese Veränderungen in den Plan des Ganzen einzupassen, indem man sie:
a) im Fall des Nachteils auf eine oder die andere Weise gutmacht;
b) im Fall des Vorteils so weit benützt, als ohne Gefahr eines Umschlagens geschehen kann.
113. Es ist also die absichtliche und unabsichtliche Vereinzelung des Gesamtgefechts in mehr oder weniger selbständige Teilgefechte, welche einen Wechsel der Gefechtsformen sowohl vom Handgefecht und Feuergefecht als von Angriff und Verteidigung innerhalb des Gesamtgefechts hervorbringt.
Jetzt bleibt in dieser Beziehung noch das Ganze zu betrachten.
Das Gefecht besteht aus zwei Akten, dem Zerstörungs- und dem Entscheidungsakt.
114. Aus dem Feuergefecht mit seinem Zerstörungsprinzip und aus dem Handgefecht mit seinem Vertreibungsprinzip gehen nach Nr. 72 für das partielle Gefecht zwei verschiedene Akte hervor: ein Zerstörungsakt und ein Entscheidungsakt.
115. Je kleiner die Massen sind, um so mehr werden diese beiden Akte aus einem einfachen Feuergefecht und einem einfachen Handgefecht bestehen.
116. Je größer die Massen werden, um so mehr werden diese beiden Akte kollektiv genommen werden müssen, so daß der Zerstörungsakt aus einer Reihe von neben- und nacheinander stattfindenden Feuergefechten und der Entscheidungsakt ebenso aus mehreren Handgefechten besteht.
117. Auf diese Weise setzt sich die Teilung des Gefechts nicht nur fort, sondern erweitert sich auch immer mehr, je größer die kämpfenden Massen werden, indem der Zerstörungsakt und der Entscheidungsakt in der Zeit immer weiter voneinander getrennt werden.
Der Zerstörungsakt.
118. Je größer das Ganze ist, um so wichtiger wird die physische Vernichtung, denn
a) um so geringer ist der Einfluß des Führers. (Dieser Einfluß ist beim Handgefecht größer als beim Feuergefecht.)
b) Um so geringer die moralische Ungleichheit. Bei großen Massen, z. B. ganzen Armeen, bleibt nichts als die nationale Verschiedenheit; bei kleineren kommen die der Korps und die der Individuen, endlich besondere zufällige Umstände hinzu, die sich bei großen Massen ausgleichen.
c) Um so tiefer ist die Aufstellung, d. h. um so mehr Reserven zur Erneuerung des Gefechts sind vorhanden, wie wir in der Folge sehen werden. Es nimmt also die Zahl der einzelnen Gefechte zu und folglich die Dauer des Gesamtgefechts, und dadurch wird der Einfluß des ersten Augenblicks vermindert, der beim Vertreiben immer so viel entscheidet.
119. Aus der vorigen Nummer folgt, daß, je größer das Ganze ist, um so mehr die physische Vernichtung die Entscheidung vorbereiten muß.
120. Diese Vorbereitung liegt darin, daß sich die Masse der Kämpfenden von beiden Seiten verkleinert, das Verhältnis aber sich zu unserm Besten verändert.
121. Das erste ist zureichend, wenn wir moralisch oder physisch überlegen sind, das zweite erforderlich, wenn dies nicht der Fall ist.
122. Die Zerstörung der feindlichen Streitkräfte besteht:
a) in allem, was physisch außer Gefecht gesetzt ist, – Tote, Verwundete und Gefangene;
b) in dem, was physisch und moralisch erschöpft ist.
123. In einem Feuergefecht von mehreren Stunden, in welchem eine Truppe einen namhaften Verlust erleidet, z. B. 1/4 oder 1/3 des Ganzen, ist der übrige Teil vorderhand fast wie eine ausgebrannte Schlacke zu betrachten. Denn:
a) die Leute sind körperlich erschöpft;
b) sie haben sich verschossen;
c) die Gewehre sind verschleimt;
d) Viele haben sich mit den Verwundeten entfernt, ohne selbst verwundet zu sein;
e) die übrigen glauben, daß sie für diesen Tag das Ihrige getan haben und gehen, wenn sie einmal aus der Sphäre der Gefahr zurückgenommen sind, nicht gern wieder hinein;
f) das ursprüngliche Gefühl des Mutes ist abgestumpft, die Kampflust befriedigt;
g) die ursprüngliche Organisation und Ordnung ist zum Teil gestört.
124. Die Folgen e und f treten mehr oder weniger ein, je nachdem das Gefecht unglücklich oder glücklich gewesen ist. Eine Truppe, die Terrain gewonnen oder das ihr anvertraute glücklich behauptet hat, ist eher wieder zu gebrauchen, als eine, die zurückgeworfen ist.
125a. Es sind zwei Folgen von Nr. 123 in Betracht zu ziehen.
Die erste ist die Ökonomie der Kräfte, die aus dem Gebrauch einer geringeren Streitkraft im Feuergefecht erwächst, als der Gegner sie anwendet. Denn wenn die Zerstörung der Kräfte im Feuergefecht nicht bloß durch die Verluste an solchen entsteht, die außer Gefecht gesetzt werden, sondern auch dadurch, daß alles, was gefochten hat, in seiner Kraft geschwächt ist, so wird natürlich die Schwächung desjenigen geringer sein, der weniger angewendet hat.
Wenn 500 Mann imstande gewesen sind, 1000 Mann das Gleichgewicht im Gefecht zu halten, so bleiben bei gleichen Verlusten auf beiden. Seiten, die wir auf 200 annehmen wollen, dem einen 300 Mann mit erschöpften Kräften, dem andern 800, von denen 300 erschöpft, 500 aber frisch sind.
125b. Die zweite Folge ist, daß die Schwächung des Gegners, also die Zerstörung der feindlichen Streitkräfte, viel mehr Umfang hat, als die Zahl der Toten, Verwundeten und Gefangenen ausdrückt. Diese Zahl beträgt vielleicht nur 1/6 des Ganzen, es sollten also 5/6 übrig bleiben. Aber unter diesen 5/6 sind eigentlich nur die ganz intakten Reserven und die Truppen, welche zwar gebraucht worden sind, aber noch weniger gelitten haben, als brauchbar und die übrigen (vielleicht 4/6) einstweilen als ein caput mortuum zu betrachten.
126. Diese Verkleinerung der wirkenden Massen ist die erste Absicht des Zerstörungsakts; die eigentliche Entscheidung kann nur mit kleineren Massen gegeben werden.
127. Es ist aber nicht die absolute Größe der Massen, welche bei der Entscheidung ein Hindernis ist (wiewohl auch diese absolute Größe nicht gleichgültig ist; denn 50 Mann gegen 50 Mann können auf der Stelle zur Entscheidung schreiten, aber nicht 50 000 Mann gegen 50 000), sondern die relative Größe. Wenn nämlich 5/6 des Ganzen im Zerstörungsakt ihre Kräfte schon aneinander abgemessen haben, so sind beide Feldherren, wenn sie auch beide vollkommen im Gleichgewicht geblieben wären, dem endlichen Beschluß, welchen sie zu fassen haben, dennoch viel näher, und es gehört nur noch ein verhältnismäßig kleiner Anstoß dazu, um die Entscheidung zu bewirken. So ist es, das übriggebliebene Sechstel möge einer Armee von 30 000 Mann angehören, also 5000 Mann stark sein, oder einer von 150 000 und somit 25 000 Mann betragen.
128. Die Hauptabsicht beider Teile im Zerstörungsakt geht dahin, sich in demselben ein Übergewicht für den Entscheidungsakt zu verschaffen.
129. Dieses Übergewicht kann durch Vernichtung feindlicher physischer Kräfte, aber auch in den übrigen unter Nr. 4 angegebenen Fällen erreicht werden.
130. Es ist also in dem Zerstörungsakt ein natürliches Bestreben vorhanden, alle Vorteile, welche sich darbieten, so gut als es die Verhältnisse erlauben, zu benützen.
131. Nun zerfällt das Gefecht größerer Massen immer in mehrere partielle Gefechte (Nr. 23), die mehr oder weniger selbständig sind und also häufig in sich einen Zerstörungs- und Entscheidungsakt haben müssen, wenn man die Vorteile, welche man durch den ersten erhalten hat, benützen will.
132. Durch die geschickte und glückliche Einmischung des Handgefechts wird man hauptsächlich die Vorteile erhalten, welche man in der Zerstörung des feindlichen Muts und der feindlichen Ordnung und im Terraingewinn sucht.
133. Aber selbst die physische Zerstörung der feindlichen Streitkräfte wird dadurch sehr gesteigert, denn Gefangene kann man nur durch das Handgefecht machen.
Wenn also ein Bataillon durch unser Feuer erschüttert ist, wenn unser Bajonettangriff es aus seiner vorteilhaften Stellung wirft und wir ihm auf seiner Flucht ein paar Schwadronen nachsenden, so begreift man, wie dieser partielle Erfolg bedeutende Vorteile aller Art in die Wagschale des allgemeinen legen wird; aber es ist freilich Bedingung, daß es geschehe, ohne in Verlegenheit mit dieser siegenden Truppe zu geraten, denn wenn unser Bataillon und unsere Schwadronen dabei überlegenen feindlichen Kräften in die Hände fielen, so wäre diese partielle Entscheidung unzeitig gewesen.
134. Die Benützung dieser partiellen Erfolge liegt in der Hand der Unterbefehlshaber und gibt derjenigen Armee eine große Überlegenheit, welche erfahrene Offiziere an der Spitze ihrer Divisionen, Brigaden, Regimenter, Bataillone, Batterien u. s. w. hat.
135. So sucht jeder der beiden Feldherren schon im Zerstörungsakt sich diejenigen Vorteile zu verschaffen, die die Entscheidung herbeiführen, und dadurch diese wenigstens vorzubereiten.
136. Die wichtigsten dieser Gegenstände sind stets genommene Geschütze und genommenes Terrain.
137. Das letztere nimmt an Wichtigkeit zu, wenn der Feind in der Verteidigung einer starken Stellung begriffen war.
138. So ist schon der Zerstörungsakt auf beiden Seiten, vorzugsweise aber auf seiten des Angreifenden, ein behutsames Vorschreiten zum Ziele.
139. Da im Feuergefecht die Zahl so wenig entscheidet (Nr. 53), so folgt von selbst das Bestreben, in demselben mit so wenig Kräften als nur möglich auszureichen.
140. Da im Zerstörungsakt das Feuergefecht vorherrscht, so muß auch das Bestreben der höchsten Ökonomie der Kräfte in demselben herrschen.
141. Da beim Handgefecht die Zahl so wesentlich ist, so wird bei den Entscheidungen der partiellen Gefechte im Zerstörungsakt auch häufig eine Überzahl angewendet werden müssen.
142. Im ganzen muß aber der Charakter der Sparsamkeit auch hier vorwalten, und es werden in der Regel nur diejenigen Entscheidungen zweckmäßig sein, die sich ohne große Überlegenheit der Zahl gleichsam von selbst ergeben.
143. Ein unzeitiges Bestreben nach Entscheidung hat zur Folge:
a) wenn sie mit Ökonomie der Kräfte eingerichtet ist, daß man in überlegene Massen hineingerät; oder
b) wenn die gehörigen Kräfte angewendet werden, daß man sich zu früh erschöpft.
144. Die Frage, ob es zeitgemäß ist, eine Entscheidung herbeizuführen, wiederholt sich innerhalb des Zerstörungsaktes sehr oft, sie tritt jedoch für die Hauptentscheidung am Ende desselben ein.
145. Der Zerstörungsakt hat deshalb das natürliche Bestreben, aus einzelnen Punkten in den Entscheidungsakt überzugehen, weil jeder Vorteil, der sich in seinem Verlaufe darbietet, erst durch die zum Bedürfnis gewordene Entscheidung sein volles Maß erreichen kann.
146. Je erfolgreicher die im Zerstörungsakt angewendeten Mittel sind, oder je größer die physische oder moralische Überlegenheit war, um so stärker wird diese Tendenz des Ganzen sein.
147. Bei geringen oder negativen Erfolgen oder bei der Überlegenheit des Gegners kann sie aber auch in den einzelnen Punkten so selten und so schwach sein, daß sie für das Ganze so gut wie gar nicht vorhanden ist.
148. Diese natürliche Tendenz kann im einzelnen und im allgemeinen zu unzeitigen Entscheidungen führen, ist aber, weit entfernt, darum ein Übel zu sein, vielmehr eine ganz notwendige Eigenschaft des Zerstörungsaktes, weil ohne sie viel versäumt werden würde.
149. Das Urteil des Führers auf jedem Punkt und des Feldherrn für das Allgemeine muß bestimmen, ob die sich darbietende Gelegenheit zu einer Entscheidung vorteilhaft ist oder nicht, d. h. ob sie nicht zu einem Rückschlag und damit zu einem negativen Resultat führt.
150. Die Leitung eines Gefechts in Beziehung auf die der Entscheidung vorangehende Vorbereitung oder vielmehr Zubereitung desselben besteht also darin, ein Feuergefecht und im weiteren Sinne einen Zerstörungsakt anzuordnen und demselben eine angemessene Dauer zu geben, d. h. die Entscheidung erst eintreten zu lassen, wenn man glaubt, daß der Zerstörungsakt hinreichende Wirkung getan hat.
151. Dieses Urteil wird sich aber nicht sowohl nach der Uhr richten, d. h. nicht aus den bloßen Zeitverhältnissen hervorgehen, sondern aus den Umständen, welche sich ergeben haben, aus den Zeichen einer schon gewonnenen Überlegenheit.
152. Da nun der Zerstörungsakt, wenn er von gutem Erfolg begleitet ist, schon selbst zur Entscheidung strebt, so kommt es für den Führer mehr darauf an, zu beurteilen, wann und wo es Zeit ist, ihm die Zügel schießen zu lassen.
153. Wenn die Tendenz zur Entscheidung in dem Zerstörungsakt sehr schwach wäre, so würde dies schon ein ziemlich sicheres Zeichen sein, daß auf keinen Sieg zu rechnen ist.
154. Es werden also die Führer und Feldherren in diesem Falle meistens die Entscheidung nicht geben, sondern empfangen.
155. Wo sie dennoch gegeben werden soll, da geht sie von dem ausdrücklichen Befehl aus, der von allen der Führung zu Gebote stehenden persönlichen Mitteln der Ermunterung und des fortreißenden Einflusses begleitet sein muß.
Der Entscheidungsakt.
156. Die Entscheidung ist dasjenige Ereignis, wodurch der Entschluß zum Abzuge in dem einen der Feldherren hervorgerufen wird.
157. Die Gründe zum Abzug haben wir unter Nr. 4 angegeben. Diese können nach und nach entstehen, indem sich schon im Zerstörungsakt ein kleiner Nachteil zum andern häuft, und der Entschluß also ohne eigentlich entscheidendes Ereignis gefaßt wird. In diesem Falle findet ein besonderer Entscheidungsakt nicht statt.
158. Der Entschluß kann aber auch durch ein einzelnes sehr nachteiliges Ereignis, also plötzlich, hervorgebracht werden, nachdem bis dahin alles noch im Gleichgewicht geschwebt hatte.
159. In diesem Falle ist nun diejenige Handlung des Gegners, welche dieses Ereignis hervorgebracht hat, als die gegebene Entscheidung zu betrachten.
160. Der gewöhnlichste Fall ist, daß die Entscheidung im Laufe des Vernichtungsaktes nach und nach reift, daß aber der Entschluß des Besiegten durch ein besonderes Ereignis den letzten Anstoß erhält. Also auch in diesem Falle ist die Entscheidung als eine gegebene zu betrachten.
161. Ist die Entscheidung eine gegebene, so muß sie eine positive Handlung sein.
a) Dies kann ein Angriff sein,
b) aber auch ein bloßes Anrücken neuer Reserven, die bis dahin versteckt gehalten wurden.
162. Bei kleinen Haufen ist oft schon das Handgefecht in einem einzigen Anfall zur Entscheidung zureichend.
163. Bei größeren Haufen kann der Angriff vermittelst des bloßen Handgefechts auch noch zureichen, doch wird es dann schwerlich bei einem einzelnen Anfall bleiben.
164. Werden die Haufen noch größer, so mischt sich das Feuergefecht ein, wie bei dem Angriff bedeutender Kavalleriemassen die reitende Artillerie.
165. Bei großen, aus allen Waffen bestehenden Massen wird die Entscheidung niemals in einem bloßen Handgefechte stattfinden, sondern es wird ein neues Feuergefecht notwendig werden.
166. Aber dieses Feuergefecht wird dann im Charakter des Anfalls selbst stattfinden, es wird in dichteren Massen, also mit einer in Zeit und Raum konzentrierten Wirkung als eine kurze Vorbereitung des eigentlichen Anfalls gebraucht werden.
167. Erfolgt die Entscheidung nicht mehr durch ein einzelnes Handgefecht, sondern durch eine Reihe von gleichzeitigen und successiven Gefechten beider Art, so wird sie dadurch ein besonderer Akt des Gesamtgefechts, wie das Nr. 115 ff. schon im allgemeinen gesagt ist.
168. In diesem Akte wird das Handgefecht vorherrschen.
169. In eben dem Maße, wie das Handgefecht vorwaltet, wird auch der Angriff vorherrschen, wiewohl auf einzelnen Punkten die Verteidigung stattfinden kann.
170. Gegen das Ende einer Schlacht wird die Rücksicht auf den Rückzugsweg immer wichtiger, daher wird auch das Bedrohen dieses Weges ein wichtiges Mittel zur Entscheidung.
171. Wo die Verhältnisse es zulassen, wird deshalb schon von Hause aus der Plan der Schlacht auf diesen Punkt gerichtet.
172. Je mehr die Schlacht oder das Gefecht sich im Sinne dieses Planes entwickelt, um so mehr wird auch der feindliche Rückzugsweg bedroht.
173. Ein anderes großes Mittel zum Siege ist das Brechen der Ordnung. Die künstliche Struktur, mit welcher die Streitmassen in das Gefecht gehen, leidet in dem langen Zerstörungskampfe, in dem sich ihre Kräfte ausringen, beträchtlich. Ist diese Erschütterung und Schwächung bis auf einen gewissen Punkt gekommen, so kann ein schnelles Vordringen mit konzentrierten Massen von seiten des einen in die Schlachtlinie des andern eine große Verwirrung hervorbringen, die diesen an keinen Sieg mehr denken läßt, sondern alle Kräfte in Anspruch nimmt, um die einzelnen Teile in Sicherheit zu bringen und einen notdürftigen Zusammenhang des Ganzen herzustellen.
174. Aus allem bisher Gesagten geht hervor, daß, so wie in dem Vorbereitungsakte die höchste Ökonomie der Kräfte vorherrscht, im Entscheidungsakte die Überwältigung durch die Zahl vorherrschen muß.
175. So wie im Vorbereitungsakte Geduld, Standhaftigkeit und Kälte vorwalten sollen, so sollen im Entscheidungsakte Kühnheit und Feuer vorherrschen.
176. Von beiden Feldherren pflegt nur einer die Entscheidung zu geben, der andere empfängt sie.
177. Wenn alles noch im Gleichgewicht ist, so kann der, welcher die Entscheidung gibt,
a) der Angreifende,
b) der Verteidigende sein.
178. Da der Angreifende den positiven Zweck hat, so ist es am natürlichsten, daß er sie gibt, und daher tritt dieser Fall auch am häufigsten ein. 179. Ist aber das Gleichgewicht schon merklich gestört, so kann die Entscheidung gegeben werden
a) von dem Feldherrn, der im Vorteil ist,
b) von dem, der im Nachteil ist.
180. Das erstere ist offenbar das Natürlichere, und ist dieser Feldherr zugleich der Angreifende, so wird es noch natürlicher; daher wird es nur wenige Fälle geben, in welchen die Entscheidung nicht von diesem Feldherrn ausginge.
181. Ist es aber der Verteidiger, welcher im Vorteil ist, so ist es auch natürlich, daß er die Entscheidung gibt, so daß das nach und nach eingetretene Verhältnis mehr entscheidet als die ursprüngliche Absicht von Angriff und Verteidigung.
182. Ein Angreifender, welcher schon in merklichem Nachteil ist und doch noch die Entscheidung gibt, sieht es als den letzten Versuch an, seine ursprüngliche Absicht zu erreichen. Wenn der im Vorteil befindliche Verteidiger ihm Zeit dazu läßt, so ist es allerdings in der Natur der positiven Absicht des Angreifenden, einen solchen letzten Versuch zu machen.
183a. Ein Verteidiger, der in merklichem Nachteil ist und dennoch die Entscheidung geben will, tut etwas, was ganz gegen die Natur der Dinge und als eine Handlung der Verzweiflung zu betrachten ist.
183b. Der Erfolg im Entscheidungsakt richtet sich nach den eben entwickelten Verhältnissen, so daß er in der Regel nur dann für den günstig sein wird, welcher die Entscheidung gibt, wenn diese aus den natürlichen Verhältnissen hervorgeht.
184. Wo sich alles noch im Gleichgewicht befindet, ist der Erfolg gewöhnlich für den, welcher die Entscheidung gibt, denn in dem Augenblick einer zur Entscheidung gereiften Schlacht, wenn sich die Kräfte aneinander ausgerungen haben, ist das positive Prinzip von viel größerem Gewicht als im Anfang derselben.
185. Der Feldherr, welcher die Entscheidung empfängt, kann sich dadurch entweder augenblicklich zum Rückzug bestimmen lassen und jedem weiteren Gefecht ausweichen, oder er kann das Gefecht noch fortsetzen.
186. Setzt er es fort, so kann er dies nur
a) als Anfang seines Rückzugs, indem er Zeit zu gewinnen sucht, dazu seine Einleitungen zu treffen;
b) als einen wirklichen Kampf, in welchem noch auf Erfolg zu hoffen ist.
187. Befindet sich der Feldherr, welcher die Entscheidung annimmt, in sehr günstigen Verhältnissen, so kann er dabei auch in der Verteidigung beharren.
188a. Ist aber die Entscheidung aus natürlichen, d. h. günstigen Verhältnissen dessen, der sie gibt, hervorgegangen, so wird auch der Feldherr, welcher sie annimmt, mehr oder weniger zu einer aktiven Verteidigung übergehen, d. h. dem Anfall mit Anfall begegnen müssen, teils weil die natürlichen Vorteile der Verteidigung ( Stellung, Ordnung, Überraschung) im Verlaufe des Gefechts sich nach und nach erschöpfen und zuletzt nicht mehr hinreichend vorhanden sind, teils weil (wie wir in Nr. 184 gesagt haben) das positive Prinzip ein immer größeres Gewicht erhält.
Ihre Trennung in der Zeit.
188b. Die hier gegebene Ansicht, daß jedes Gefecht in zwei getrennte Akte zerfällt, wird auf den ersten Anblick viel Widerspruch finden.
189. Dieser Widerspruch wird teils aus einer angewöhnten falschen Ansicht vom Gefecht, teils daraus hervorgehen, daß man dem Begriff des Getrennten eine zu pedantische Wichtigkeit beilegt.
190. Man denkt sich den Gegensatz zwischen Angriff und Verteidigung zu groß, beide Tätigkeiten zu rein antithetisch, oder man legt vielmehr den Gegensatz dahin, wo er sich in der Ausführung nicht findet.
191. Die Folge hiervon ist, daß man sich den Angreifenden vom ersten Augenblick bis zum letzten mit einem gleichmäßigen, unausgesetzten Streben zum Vorschreiten, und die Ermäßigung der vorschreitenden Bewegung immer nur wie eine ganz unwillkürlich erzwungene denkt, die unmittelbar vom Widerstande ausgeht.
192. Nach dieser Vorstellungsart wäre nichts natürlicher, als daß jeder Angriff mit der höchsten Energie des Sturmes anfinge.
193. Für die Artillerie hat man doch auch bei dieser Vorstellungsweise sich schon an einen Vorbereitungsakt gewöhnt, weil es doch zu sehr einleuchtete, daß sie sonst größtenteils unnütz sein würde.
194. Sonst aber hat man jenes unvermischte Streben zum Vorschreiten für so naturgemäß gehalten, daß man den Angriff, ohne einen Schuß zu tun, wie eine Art Ideal betrachtet hat.
Selbst Friedrich der Große hat bis zur Schlacht von Zorndorf das Feuer beim Angriff wie etwas Ungehöriges betrachtet.
195. Wenn man auch davon später etwas zurückgekommen ist, so glaubt doch noch heute der große Haufe, daß der Angreifende sich der bedeutendsten Punkte einer Stellung nicht zu früh bemächtigen könne.
196. Diejenigen, welche dem Feuer noch die meisten Konzessionen machen, wollen doch gleich zum Angriff vorrücken, in großer Nähe einige Bataillonssalven geben und dann mit dem Bajonett draufgehen.
197. Aber die Kriegsgeschichte und ein Blick auf unsere Waffen zeigen, daß die absolute Verwerfung des Feuers beim Angriff ein Absurdum ist.
198. Etwas mehr Bekanntschaft mit dem Gefecht und besonders die anschauliche Erfahrung lehrt auch, daß eine Truppe, die einmal ins Feuern verfällt, selten noch zu einem kräftigen Sturme zu brauchen ist. Folglich ist die in Nr. 196 erwähnte Konzession nichts wert.
199. Endlich zeigt die Kriegsgeschichte eine unzählige Menge von Fällen, in welchen man einen errungenen Vorteil mit großem Verlust wieder hat aufgeben müssen, weil man unvorsichtig vorgedrungen war. Es kann also auch der in Nr. 195 ausgesprochene Grundsatz nicht zugestanden werden.
200. Wir behaupten demnach, daß die ganze hier berührte Vorstellungsweise von der ungemischten Natur des Angriffs, wenn man uns diesen Ausdruck erlauben will, falsch ist, weil sie nur äußerst wenigen, sehr eigentümlichen Fällen entspricht.
201. Liegt aber das Beginnen mit dem Handgefecht und eine unvorbereitete Entscheidung bei größeren Gefechten nicht in der Natur der Dinge, so entsteht von selbst eine Teilung in Vorbereitung der Entscheidung durch das Feuer und in die Entscheidung selbst, also in die beiden Akte, mit denen wir uns beschäftigt haben.
202. Wir haben zugegeben, daß diese Teilung bei ganz kleinen Gefechten wegfallen kann (z. B. bei kleinen Kavalleriehaufen). Es entsteht nun die Frage, ob sie nicht auch wieder aufhört, wenn die Massen eine gewisse Größe bekommen; nicht als ob die Anwendung des Feuers aufhören könnte, das wäre ein Widerspruch in sich, sondern ob die scharfe Trennung beider Tätigkeiten aufhören wird, so daß man sie nicht mehr als zwei getrennte Akte betrachten kann.
203. So könnte vielleicht behauptet werden, ein Bataillon solle schießen, ehe es Sturm läuft; das eine müsse dem andern vorhergehen, und so entständen zwei verschiedene Akte, aber nur für das Bataillon und nicht für die größere Abteilung, die Brigade u. s. w. Diese habe keinen Feuer- und Entscheidungsabschnitt, sie suche das ihr angedeutete Objekt zu erreichen und habe die Art, wie dies geschehe, den Bataillonen zu überlassen.
204. Wer sieht nicht ein, daß so alle Einheit verloren gehen müßte? Bei der großen Nähe, in welcher ein Bataillon neben dem andern ficht, müssen die Erfolge und Nichterfolge des einen notwendig Einfluß auf die andern haben, und bei der geringen intensiven Wirkung unseres Flintenfeuers und folglich seiner beträchtlichen Dauer, wenn es wirksam werden soll, muß jener Einfluß wegen dieser Dauer größer und entscheidender werden. Schon aus diesem Grunde muß eine gewisse allgemeine Zeiteinteilung für das Zerstörungs- und Entscheidungsgefecht auch bei der Brigade entstehen.
205. Aber ein noch wesentlicherer Grund ist, daß man sich zur Entscheidung gern frischer, wenigstens anderer Truppen als zum Zerstörungsakte bedient; diese aber werden von den Reserven genommen und die Reserven müssen ihrer Natur nach ein gemeinschaftliches Gut sein, können deshalb nicht bataillonsweise vorher verteilt werden.
206. Sowie nun das Bedürfnis eines Abschnittes im Gefecht von den einzelnen Bataillonen zu der Brigade übergeht, so geht es von dieser zur Division über und von der Division zu noch größeren Abteilungen.
207. Da aber die Teile eines Ganzen (Glieder der ersten Ordnung) immer unabhängiger werden, je größer das Ganze ist, so wird allerdings auch die Einheit des Ganzen weniger beschränkend auf sie wirken, und daher kommt es, daß innerhalb eines Teilgefechts immer mehr Entscheidungsakte vorkommen können und werden, je größer das Ganze ist.
208. Es werden sich also die Entscheidungen bei einem größeren Teile nicht in dem Maße zu einem einzigen Ganzen vereinigen, wie dies bei dem kleineren Teile der Fall ist, sondern sich in Zeit und Raum mehr verteilen, doch wird immer noch eine merkliche Sonderung der beiden verschiedenen Tätigkeiten nach Anfang und Ende hin bemerkbar bleiben.
209. Nun können die Teile so groß, ihre Trennung voneinander kann so bedeutend werden, daß ihre Tätigkeit in dem Gefecht zwar noch von dem Willen des Feldherrn ausgeht (wodurch die Selbständigkeit des Gefechts bedingt wird), daß aber diese Leitung sich auf eine anfängliche Bestimmung oder höchstens auf mehrere im Verlauf des Gefechts beschränkt; in diesem Falle vereinigt ein solcher Teil den ganzen Organismus des Gefechts fast vollständig in sich.
210. Je größer die Entscheidungen sind, die einem Teile nach seinem Verhältnisse zustehen, um so mehr werden sie die Entscheidung des Ganzen mitbestimmen; ja, man kann sich die Verhältnisse der Teile so denken, daß in ihrer Entscheidung schon die des Ganzen enthalten, also ein eigener Entscheidungsakt für das Ganze nicht mehr nötig ist.
211. Beispiel. Eine Brigade kann in einer großen Schlacht, in welcher die Glieder erster Ordnung Korps sind, gleich von vornherein den Auftrag erhalten, ein Dorf zu nehmen. Sie wird sich dazu ihres Zerstörungs- und ihres Entscheidungsaktes für sich bedienen. Die Eroberung dieses Dorfes kann nun auf die Entscheidung des Ganzen mehr oder weniger Einfluß haben, aber es liegt nicht in der Natur der Dinge, daß sie diese Entscheidung in einem hohen Grade bestimme oder gar schon selbst bewirke, weil dazu eine Brigade im Anfange der Schlacht ein zu kleiner Teil des Ganzen wäre; dagegen kann man sich sehr wohl denken, daß die ganze Eroberung dieses Dorfes noch zu den Zerstörungsmaßregeln gehöre, durch welche die feindlichen Streitkräfte nur geschwächt und erschüttert werden sollen.
Denken wir uns dagegen ein bedeutendes Korps, welches vielleicht den dritten Teil oder gar die Hälfte des Ganzen ausmacht, mit dem Auftrage, einen gewissen bedeutenden Teil der feindlichen Stellung zu nehmen, so können die erlangten Erfolge dieses Teils sehr leicht so wichtig sein, daß sie über das Ganze entscheiden, und daß, wenn das Korps seinen Zweck erreicht hat, eine weitere Entscheidung nicht mehr nötig wird. Nun können die Verhältnisse leicht so gedacht werden, daß diesem Korps wegen der Entfernung und wegen der Gegend im Laufe der Schlacht nur wenig Bestimmungen zugehen können, es muß ihm also die Vorbereitung und die Entscheidung zugleich mit aufgetragen werden. Auf diese Weise kann der gemeinschaftliche Entscheidungsakt ganz wegfallen und in abgesonderte Entscheidungsakte einiger großen Glieder zerlegt werden.
212. Dies ist in großen Schlachten allerdings oft der Fall, und eine pedantische Vorstellung von der Trennung beider Teile, in welche wir das Gefecht zerlegen, würde also im Widerspruch mit dem Hergange einer solchen Schlacht sein.
213. Indem wir diesen Unterschied in der Gefechtstätigkeit feststellen und darauf einen großen Wert legen, ist es gar nicht unsere Absicht, diesen Wert auf die regelmäßige Absonderung und Trennung dieser beiden Tätigkeiten zu legen und dies als einen praktischen Grundsatz aufzustellen; wir wollen nur, was wesentlich verschieden ist, auch in der Vorstellung sondern und zeigen, wie diese innere Verschiedenheit auch die Form des Gefechts von selbst beherrscht.
214. Die Trennung in der Form zeigt sich am deutlichsten in dem kleinen Gefechte, wo das einfache Feuer- und Handgefecht einander gegenüberstehen. Der Kontrast wird weniger stark, wenn die Teile größer werden, weil sich da in den beiden Akten die beiden Gefechtsformen, von welchen sie ausgegangen sind, wieder verbinden; aber die Akte selbst werden größer, nehmen mehr Zeit ein und rücken folglich in der Zeit weiter auseinander.
215. Die Trennung für das Ganze kann auch aufhören, insofern die Entscheidung schon den Gliedern erster Ordnung übertragen ist; aber selbst dann wird sich doch auch im ganzen noch eine Spur davon zeigen, da man dahin streben wird, die Entscheidungen dieser verschiedenen Glieder in Beziehung auf die Zeit in Zusammenhang zu bringen, sei es, daß man ein ganz gleichzeitiges Eintreten der Entscheidung oder ein Eintreten nach einer gewissen Ordnung für nötig hält.
216. Es wird sich also der Unterschied dieser beiden Akte auch für das Ganze niemals ganz verlieren, und was davon für das Ganze verloren gegangen ist, wird sich in den Gliedern erster Ordnung wiederfinden.
217. So muß also unsere Ansicht verstanden werden, und so verstanden, wird ihr von der einen Seite die Realität nicht fehlen, von der andern wird sie die Aufmerksamkeit des Führers eines Gefechts (es sei groß oder klein, Teilgefecht oder Gesamtgefecht) darauf richten, jedem der beiden Tätigkeitsakte seinen gebührenden Anteil zu geben, damit ebensowenig etwas übereilt als versäumt werde.
218. Übereilt werden die Sachen, wenn dem Zerstörungsprinzip nicht Raum und Zeit genug gegeben, wenn die Sache übers Knie gebrochen wird; ein unglücklicher Ausgang der Entscheidung ist die Folge davon, die entweder gar nicht wieder gut zu machen ist, oder doch ein wesentlicher Nachteil bleibt.
219. Versäumt wird überall, wo eine völlige Entscheidung aus Mangel an Mut oder aus falscher Ansicht der Verhältnisse unterbleibt; die Folge hiervon ist in jedem Falle Kraftverschwendung, sie kann aber auch ein positiver Nachteil sein, weil die Reife der Entscheidung nicht ganz allein von der Dauer der Zerstörung abhängt, sondern auch von andern Umständen, d. h. von der günstigen Gelegenheit.
Plan des Gefechts. Definition.
220a. Der Plan des Gefechts macht die Einheit desselben möglich; jedes gemeinschaftliche Handeln bedarf einer solchen Einheit. Diese Einheit ist nichts anderes als der Zweck des Gefechts; von ihm gehen die Bestimmungen aus, welche für alle Teile nötig sind, um den Zweck auf die beste Art zu erreichen. Die Feststellung des Zwecks und der aus ihm folgenden Bestimmungen ist also der Plan.
220b. Wir verstehen hier unter Plan alle Bestimmungen, welche für das Gefecht gegeben werden, sei es vor demselben, bei seinem Anfange oder in seinem Verlaufe; also die ganze Einwirkung der Intelligenz auf die Materie.
220c. Offenbar besteht aber ein wesentlicher Unterschied zwischen solchen Bestimmungen, die notwendig vorher gegeben werden müssen, und die sich vorher geben lassen auf der einen Seite, und solchen auf der andern, die der Augenblick erzeugt.
220d. Das erstere ist der Plan im eigentlichen Sinne, das letztere kann man die Führung nennen.
221. Da diese Bestimmungen, die der Augenblick erzeugt, ihren reichhaltigsten Quell in der Wechselwirkung beider Gegner haben, so werden wir erst dann diesen Unterschied festhalten und näher betrachten, wenn wir uns mit der Wechselwirkung beschäftigen.
222. Ein Teil des Plans liegt schon stereotypisch in der Formation der Streitkräfte, durch welche die große Zahl der Glieder auf wenige zurückgeführt wird.
223. Beim Teilgefecht ist diese Formation mehr die Hauptsache als beim Gesamtgefecht, sie macht da oft den ganzen Plan aus, und zwar um so mehr, je kleiner der Teil ist. Ein Bataillon macht in einer großen Schlacht nicht viel andere Dispositionen, als ihm durch das Reglement und den Übungsplatz vorgeschrieben sind; eine Division aber reicht damit nicht aus, hier werden schon individuelle Bestimmungen nötiger.
224. Im Gesamtgefecht ist aber auch beim kleinsten Haufen die Formation selten der ganze Plan, sondern dieser löst oft die Formation auf, um Freiheit zur individuellen Disposition zu bekommen. Eine Schwadron, die einen Überfall auf einen kleinen feindlichen Posten unternimmt, teilt sich ebensogut in mehrere getrennte Teile wie die größte Armee.
Ziel des Plans.
225. Der Zweck des Gefechts macht die Einheit des Plans; wir können ihn als das Ziel desselben betrachten, nämlich als diejenige Richtung, nach der alle Tätigkeiten hinlaufen sollen.
226. Zweck des Gefechts ist der Sieg, also alles, was den Sieg bedingt und in Nr. 4 aufgezählt ist.
227. Alle in Nr. 4 genannten Gegenstände können im Gefechte nur durch Vernichtung feindlicher Streitkraft erreicht werden, sie erscheint also bei allen als das Mittel.
228. Sie ist sogar in den meisten Fällen der Hauptzweck selbst.
229. Wo das letztere der Fall ist, ist der Plan auf die möglichst größte Vernichtung feindlicher Streitkraft gerichtet.
230. Wo andere von den in Nr. 1 genannten Gegenständen höher gestellt werden als die Vernichtung der feindlichen Streitkraft, nimmt diese als Mittel eine untergeordnete Stelle ein; dann wird nicht mehr die größtmöglichste, sondern nur eine genügende Vernichtung gefordert, und man darf dann die nächsten Wege zum Ziel einschlagen.
231a. Es gibt Fälle, in welchen die in Nr. 4 c d e f g genannten Gegenstände, welche den Abzug des Feindes bestimmen, ganz ohne Vernichtung feindlicher Streitkräfte erreicht werden können; dann hat man den Feind durch ein Manöver überwunden, und nicht durch ein Gefecht. Aber dies ist kein Sieg, also nur brauchbar, insofern man anderes als einen Sieg zum Zwecke hatte.
231b. In diesen Fällen wird zwar die Anwendung der Streitkräfte immer noch den Begriff eines Gefechts, also einer Vernichtung feindlicher Streitkräfte, voraussetzen, aber nur als möglich, nicht als wahrscheinlich. Denn indem man seine Absicht auf andere Dinge als die Vernichtung feindlicher Streitkräfte richtet, setzt man voraus, daß diese anderen Dinge wirksam sein und es nicht zu einem namhaften Widerstande kommen lassen werden. Dürfte man diese Voraussetzung nicht machen, so könnte man auch diese anderen Dinge nicht zu seiner Absicht wählen, und irrte man sich in der Voraussetzung, so wäre der Plan ein verfehlter.
232. Aus der vorigen Nummer folgt, daß überall, wo eine bedeutende Vernichtung feindlicher Streitkräfte die Bedingung des Sieges wird, sie auch der Hauptgegenstand des Plans sein müsse.
233. Da nun ein Manöver an und für sich kein Gefecht ist, dieses aber stattfindet, wenn das Manöver nicht gelingen will, so können die Gesetze für das Gesamtgefecht auch nicht auf den Fall eines Manövers passen, und die eigentümlichen Dinge, welche im Manöver wirksam sind, können zur Theorie des Gefechts nicht beitragen.
234. Es kommen freilich in der Ausführung häufig gemischte Verhältnisse vor, das hindert aber nicht, die Dinge, die in ihrem Wesen verschieden sind, in der Theorie zu trennen; weiß man, was man an jedem Teile hat, so lassen sich die Kombinationen leicht machen.
235. Es ist also die Vernichtung feindlicher Streitkräfte in allen Fällen die Absicht, und die in Nr. 4 b c d e f genannten Dinge werden dadurch erst hervorgerufen, treten dann aber freilich als eigene Potenzen mit derselben in Wechselwirkung.
236. Das, was von diesen Dingen immer wiederkehrt, d. h. nicht die Folge individueller Verhältnisse ist, ist auch lediglich als eine Wirkung der Vernichtung feindlicher Streitkraft zu betrachten.
237. Insofern etwas ganz allgemeines über den Plan des Gefechts festzustellen ist, kann es sich also nur auf die wirksamste Anwendung der eigenen Streitkraft zur Vernichtung der feindlichen beziehen.
Verhältnis zwischen Größe und Sicherheit des Erfolgs.
238. Da man es im Kriege und folglich auch im Gefechte mit moralischen Kräften und Wirkungen zu tun hat, die sich nicht bestimmt berechnen lassen, so bleibt immer eine große Ungewißheit über den Erfolg der angewendeten Mittel.
239. Diese wird noch durch die Menge der Zufälle vermehrt, mit welchen die kriegerische Handlung im Kontakt ist.
240. Wo Ungewißheit ist, wird das Wagen ein wesentliches Element.
241. Wagen in der gewöhnlichen Bedeutung heißt, auf Dinge bauen, die mehr unwahrscheinlich als wahrscheinlich sind. Wagen in der weitesten Bedeutung aber heißt Dinge voraussetzen, die nicht gewiß sind. In dieser letzten Bedeutung wollen wir es hier nehmen.
242. Gäbe es nun bei allen vorkommenden Fällen eine Linie zwischen Wahrscheinlichkeit, und Unwahrscheinlichkeit, so könnte man auf den Gedanken kommen, sie zur Grenzlinie des Wagens zu machen, und also das Wagen über dieselbe hinaus, nämlich das Wagen im engeren Sinne, für unzulässig halten.
243. Allein erstlich ist eine solche Linie eine Chimäre, zweitens ist der Kampf nicht bloß ein Akt der Überlegung, sondern auch der Leidenschaft und des Mutes. Man kann diese Dinge nicht ausschließen; wollte man sie aber allzu sehr beschränken, so würde man seinen eigenen Kräften die stärksten Triebfedern nehmen und dadurch in konstanten Nachteil geraten; denn in der Mehrheit der Fälle gleicht sich das unvermeidliche häufige Zurückbleiben hinter der Linie nur dadurch aus, daß zuweilen darüber hinausgegangen wird.
244. Je günstiger die Voraussetzungen sind, die man macht, d. h. je mehr man wagen will, um so größer sind die Erfolge, welche man bei denselben Mitteln erwartet, also die Zwecke, welche man sich vorsetzt.
245. Je mehr man wagt, um so geringer ist die Wahrscheinlichkeit, also die Sicherheit des Erfolgs.
246. Größe des Erfolgs und Sicherheit desselben stehen also bei denselben Mitteln im Gegensatz zueinander.
247. Die erste Frage wäre nun, wieviel Wert man auf das eine oder andere dieser beiden entgegengesetzten Prinzips legen soll.
248. Darüber kann nichts allgemeines bestimmt werden, es ist vielmehr das Individuellste im ganzen Kriege. Einmal bestimmen es die Verhältnisse, die in manchen Fällen das größte Wagnis zur Notwendigkeit machen können, und zweitens ist der Unternehmungsgeist und der Mut etwas rein Subjektives, was nicht vorgeschrieben werden kann. Man kann von einem Führer fordern, daß er seine Mittel und Verhältnisse mit Sachkenntnis beurteile, ihre Wirkungen nicht überschätze; tut er das erstere, so muß man ihm überlassen, was er vermöge seines Mutes damit auszurichten denkt.
Verhältnis zwischen Größe des Erfolgs und des Preises.
249. Die zweite Frage in Beziehung auf die zu vernichtenden feindlichen Streitkräfte betrifft den Preis, mit welchem man sie bezahlen will.
250. Bei der Absicht, feindliche Streitkräfte zu vernichten, ist freilich gewöhnlich die Bedingung gedacht, von ihnen mehr zu vernichten, als wir selbst dabei aufopfern; aber diese Bedingung ist keineswegs notwendig, denn es kann Fälle geben (z. B. den großer Überlegenheit), in welchen die bloße Verminderung der feindlichen Kraft ein Vorteil ist, wenn wir sie auch mit einer größeren der unsrigen bezahlen.
251. Aber selbst dann, wenn unsere Absicht bestimmt darauf gerichtet ist, mehr feindliche Streitkräfte zu vernichten, als wir dabei von den eigenen aufopfern, bleibt immer noch die Frage nach der Größe dieser Opfer stehen, denn mit ihnen wächst und fällt natürlich das Resultat.
252. Man sieht wohl, daß die Beantwortung dieser Frage von dem Wert abhängt, den unsere Streitkräfte für uns haben, also von den individuellen Verhältnissen. Diesen muß die Entscheidung überlassen bleiben, und man kann weder sagen, daß die möglichste Schonung der eigenen Streitkräfte, noch daß der rücksichtslose Verbrauch derselben ein Gesetz sei.
Bestimmung der Art des Gefechts für die einzelnen Glieder.
253. Der Plan des Gefechts bestimmt für die einzelnen Glieder, wann, wo und wie, gefochten werden soll, d. h. er bestimmt Zeit, Raum und Art des Gefechts.
254. Hier wie überall lassen sich die allgemeinen, d. h. die aus dem bloßen Begriff hervorgehenden Verhältnisse von denen unterscheiden, die der individuelle Fall herbeiführt.
255. Die mannigfaltigste Verschiedenheit der Gefechtspläne muß natürlich aus den letzteren hervorgehen, indem die eigentümlichen Vorteile und Nachteile aufgesucht, jene zur Wirksamkeit gebracht, diese neutralisiert werden.
256. Aber auch die allgemeinen Verhältnisse geben gewisse Resultate, und wenn diese der Zahl nach nur gering und der Form nach sehr einfach sind, so sind sie auch dafür um so wichtiger, weil sie das eigentlichste Wesen der Sache betreffen und mithin bei allen übrigen Entscheidungen das Fundament ausmachen.
Angriff und Verteidigung.
257. In Beziehung auf die Art des Gefechts gibt es nur zwei Unterschiede, die überall vorkommen, also allgemein sind; der erste entspringt aus der positiven oder negativen Absicht und gibt den Angriff und die Verteidigung, der andere aus der Natur der Waffen und gibt das Feuergefecht und das Handgefecht.
258. Streng genommen wäre Verteidigung ein bloßes Abwehren des Stoßes und gebührte ihr also keine andere Waffe als der Schild.
259. Dies wäre aber eine reine Negation, ein absolutes Leiden; Kriegführen aber ist kein Leiden oder Dulden; der Verteidigung kann also niemals der Begriff durchgehender Passivität zugrunde gelegt werden.
260. Genau betrachtet, ist die passivste der Waffen, die Feuerwaffe, immer noch etwas Positives und Aktives. Aber die Verteidigung bedient sich ja überhaupt derselben Waffen wie der Angriff und auch derselben Gefechtsformen von Feuergefecht und Handgefecht.
261. Man muß also die Verteidigung ebensogut als einen Kampf betrachten wie den Angriff.
262. Dieser Kampf kann nur um den Sieg geführt werden, der also ebensosehr Zweck der Verteidigung wie des Angriffs ist.
263. Man ist durch nichts berechtigt, sich den Sieg des Verteidigers als etwas Negatives zu denken; wenn er in einzelnen Fällen etwas Ähnliches ist, so liegt das in den individuellen Bedingungen; in den Begriff der Verteidigung darf es nicht aufgenommen werden, sonst wirkt es logisch auf die ganze Vorstellung vom Kampfe zurück und bringt Widersprüche hinein, oder führt bei strenger Konsequenz wieder auf das Absurdum eines absoluten Duldens und Leidens zurück.
264. Und doch besteht ein höchst wesentlicher Unterschied zwischen Angriff und Verteidigung, welcher aber auch der einzige im Prinzip ist: nämlich der, daß der Angreifende die Handlung (das Gefecht) will und ins Leben ruft, der Verteidiger dies aber abwartet.
265. Dies Prinzip geht durch den ganzen Krieg, also auch durch das ganze Gebiet des Gefechtes, und aus ihm fließen ursprünglich alle Unterschiede zwischen Angriff und Verteidigung.
266. Wer aber eine Handlung will, muß damit etwas bezwecken, und dieser Zweck muß etwas Positives sein, weil die Absicht, daß nichts geschehe, keine Handlung hervorrufen könnte. Der Angreifende muß also eine positive Absicht haben.
267. Der Sieg kann diese nicht sein, denn er ist ein bloßes Mittel. Selbst in dem Falle, wo man den Sieg ganz um seiner selbst willen suchte, der bloßen Waffenehre wegen, oder um in den politischen Unterhandlungen mit seinem moralischen Gewichte zu wirken, ist immer diese Wirkung und nicht der Sieg selbst der Zweck.
268. Die Absicht des Sieges muß der Verteidiger mit dem Angreifenden gemeinschaftlich haben, aber sie entspringt bei beiden aus verschiedenen Quellen; bei dem Angreifenden aus dem Zweck, welchem der Sieg dienen soll, bei dem Verteidiger aus dem bloßen Faktum des Gefechts. Jenem kommt sie von oben herab, diesem bildet sie sich von unten herauf. Wer sich schlägt, kann sich nur des Sieges wegen schlagen.
269. Warum schlägt sich nun der Verteidiger, d. h. warum nimmt er das Gefecht an? Weil er die positive Absicht des Angreifenden nicht zulassen, d. h. zunächst, weil er den status quo erhalten will. Dies ist die nächste und notwendige Absicht des Verteidigers; was sich weiter daran anknüpft, ist nicht notwendig.
270. Die notwendige Absicht des Verteidigers oder vielmehr der notwendige Teil in der Absicht des Verteidigers ist also negativ.
271a. Überall, wo diese Negativität des Verteidigers vorhanden ist, d. h. überall und immer, wo er das Interesse hat, daß nichts geschehe, sondern die Sachen bleiben, wie sie sind, muß er dadurch bestimmt werden, nicht zu handeln, sondern abzuwarten, bis der Gegner handelt; aber von dem Augenblick an, wo dieser handelt, kann der Verteidiger seine Absicht durch bloßes Abwarten und Nichthandeln nicht mehr erreichen; nun handelt er also ebenso wie sein Gegner, und es hört daher der Unterschied auf.
271b. Wendet man dies zuvörderst bloß auf das Gesamtgefecht an, so würde der ganze Unterschied zwischen Angriff und Verteidigung darin bestehen, daß diese jenen abwartet, der Gang des Gefechts selbst aber dadurch nicht weiter bedingt werden.
272. Nun kann man aber dieses Prinzip der Verteidigung auch auf das Teilgefecht anwenden; es kann auch für Glieder und Teile des Ganzen das Interesse vorhanden sein, daß keine Veränderung entstehe, und sie können also dadurch zum Abwarten bestimmt werden.
273. Dies ist nicht allein möglich für Glieder und Teile des Verteidigers, sondern auch für die des Angreifenden, und findet auch wirklich bei beiden statt.
274. Es liegt aber in der Natur der Sache, daß es beim Verteidiger häufiger vorkommen wird als beim Angreifenden, was sich erst zeigen läßt, wenn die mit dem Verteidigungsprinzip in Verbindung tretenden individuellen Umstände in Betracht kommen.
275. Je weiter man sich in einem Gesamtgefecht das Verteidigungsprinzip bis zu den kleinsten Gliedern hinuntersteigend denkt, und je allgemeiner man es auf alle Glieder ausdehnt, um so passiver wird der ganze Widerstand, um so mehr wird sich die Verteidigung jener Linie eines absoluten Leidens nähern, die wir als ein Absurdum ansehen.
276. Wo in dieser Richtung der Vorteil des Abwartens für den Verteidiger aufhört, d. h. seine Wirksamkeit erschöpft ist, wo gewissermaßen der Sättigungspunkt eintritt, werden wir erst in der Folge näherbetrachten können.
277. Für jetzt ziehen wir nur den Schluß aus dem bisher Gesagten, daß die Absicht des Angriffs oder der Verteidigung nicht bloß über den Anfang eines Gefechtes etwas bestimmt, sondern dasselbe auch in seinem Verlaufe durchdringen kann, daß also dadurch wirklich zwei verschiedene Arten des Gefechtes gegeben werden.
278. Der Plan des Gefechts hat also in jedem Falle für das Ganze zu bestimmen, ob dasselbe Angriffs- oder Verteidigungsgefecht sein soll.
279. Eben diese Bestimmung muß er für diejenigen Teile enthalten, welchen er eine von der des Ganzen abweichende Aufgabe erteilen will.
280. Lassen wir alle individuellen Verhältnisse, welche über die Wahl von Angriff und Verteidigung entscheiden können, jetzt noch unberücksichtigt, so ergibt sich nur ein Gesetz, nämlich, daß man da, wo man die Entscheidung aufhalten will, verteidigend, da, wo man sie sucht, angriffsweise verfahren muß.
281. Wir werden diesen Grundsatz gleich mit einem andern in Verbindung treten und sich dadurch deutlicher gestalten sehen.
Feuergefecht und Handgefecht.
282. Der Plan des Gefechts muß ferner die Wahl der aus den Waffen hervorgehenden Gefechtsformen, nämlich des Feuergefechts und des Handgefechts, bestimmen.
283. Allein diese beiden Formen sind nicht sowohl Glieder des Gefechts als primitive Bestandteile desselben. Sie sind durch die Bewaffnung gegeben, gehören zueinander und machen zusammen erst das vollständige Gefechtsvermögen aus.
284. Die Wahrheit dieser Ansicht (die übrigens nur eine annähernde, die Mehrheit der Fälle umfassende, keine absolute ist) zeigt sich durch die Verbindung der Waffen des einzelnen Streiters und durch die zum Bedürfnis gewordene innige Verbindung der Truppengattungen.
285. Aber eine Trennung dieser beiden Elemente und ein Gebrauch des einen ohne das andere bleibt nicht nur möglich, sondern kommt auch sehr oft vor.
286. In Beziehung auf das Zusammengehören beider und ihre natürliche Ordnung unter sich hat der Plan eines Gefechts nichts zu bestimmen, da dies schon durch den Begriff, durch die Formation und die Übungsplätze feststeht, also wie die Formation zu dem stereotypen Teile des Plans gehört.
287. Über den getrennten Gebrauch dieser beiden Formen gibt es gar kein allgemeines Gesetz, wenn man nicht dafür gelten lassen will, daß er immer nur als ein notwendiges Übel, d. h. als eine schwächere Wirkungsform betrachtet werden muß. Sämtliche Fälle, in denen man veranlaßt sein kann, sich dieser schwächeren Form zu bedienen, gehören in das Reich individueller Umstände. Für den Gebrauch des bloßen Handgefechts, z. B. wenn man überfallen will oder wenn sonst die Zeit zum Feuergefecht fehlt, oder wenn man auf einen sehr überlegenen Mut der Seinigen rechnen darf, sind offenbar Vorkommenheiten nur vereinzelte Fälle.
Bestimmung von Zeit und Raum.
288. Für die Bestimmung von Zeit und Raum ist zuerst für beide gemeinschaftlich zu bemerken, daß für das Gesamtgefecht die Raumbestimmung allein der Verteidigung, die Zeitbestimmung dem Angriff angehört.
289. Für die Teilgefechte aber hat sowohl der Plan eines Angriffs-, wie der eines Verteidigungsgefechts Bestimmungen für beide zu geben.
Die Zeit.
290. Die Zeitbestimmung für die Teilgefechte, welche auf den ersten Blick den Gegenstand höchstens in einigen Punkten zu berühren scheint, nimmt gleichwohl bei näherer Betrachtung eine ganz andere Wendung und durchdringt ihn von einem Ende bis zum andern mit einem höchst entscheidenden gesetzgebenden Gedanken, nämlich der Möglichkeit eines successiven Gebrauchs der Streitkräfte.
Successiver Gebrauch der Streitkräfte.
291. An und für sich ist bei der gemeinschaftlichen Wirkung einzelner Kräfte die Gleichzeitigkeit eine Grundbedingung. Dies ist auch im Kriege und namentlich im Gefecht der Fall. Denn da die Zahl der Streitkräfte in dem Produkt derselben ein Faktor ist, so wird bei übrigens gleichen Umständen die gleichzeitige Anwendung aller Streitkräfte, d. h. die höchste Vereinigung derselben in der Zeit gegen einen Feind, der sie nicht alle zugleich anwendet, den Sieg geben, und zwar zuerst über den Teil der feindlichen Streitkräfte, der gebraucht worden ist; da aber durch diesen Sieg über einen Teil die moralischen Kräfte des Siegers überhaupt zu- und die des Besiegten abnehmen müssen, so folgt, wenn auch der Verlust der physischen Kräfte auf beiden Seiten gleich groß wäre, schon daraus, daß ein solcher Teilsieg die Gesamtkräfte des Siegers über die Gesamtkräfte des Besiegten erheben und folglich auch den Sieg im Gesamtgefecht bedingen kann.
292. Aber die in der vorigen Nummer gemachte Folgerung setzt zwei Bedingungen voraus, die nicht vorhanden sind: nämlich erstens, daß die Zahl kein Maximum haben könne; zweitens, daß der Gebrauch ein und derselben Streitkraft, so lange noch etwas von ihr übrig ist, keine Grenzen habe.
293. Was den ersten Punkt betrifft, so begrenzt schon der Raum die Zahl der Streiter, denn was nicht zur Wirksamkeit kommen kann, muß als überflüssig betrachtet werden. Dadurch wird also die Tiefe und die Ausdehnung der Aufstellung aller zur gleichzeitigen Wirksamkeit bestimmten Streiter beschränkt, und mithin die Zahl der Streiter.
294. Aber eine viel wichtigere Beschränkung der Zahl liegt in der Natur des Feuergefechts. Wir haben gesehen (89c), daß die größere Zahl in demselben innerhalb gewisser Grenzen nur die Wirkung hat, die beiderseitige, also die Gesamtkraft des Feuergefechts zu verstärken. Da also, wo für einen Teil in dieser Verstärkung nicht schon ein Vorteil liegt, hört sie auf, wirksam für ihn zu sein; sie erreicht also da leicht ein Maximum.
295. Dies Maximum bestimmt sich ganz nach dem individuellen Fall, nach dem Terrain, dem moralischen Verhältnis der Truppen und den näheren Zwecken des Feuergefechts. Hier genügt es, zu sagen, daß es ein solches gibt.
296. Es hat also die Zahl der gleichzeitig anzuwendenden Streitkräfte ein Maximum, über welches hinaus eine Verschwendung stattfinden würde.
297. Ebenso hat der Gebrauch einer und derselben Streitkraft seine Grenzen. Wie die im Feuergefecht gebrauchte Streitkraft nach und nach unbrauchbar wird, haben wir (Nr. 123) gesehen; aber auch im Handgefecht entsteht eine solche Verschlechterung. Ist die Erschöpfung der physischen Kräfte hier geringer als im Feuergefecht, so ist die der moralischen bei unglücklichem Erfolge viel größer.
298. Durch diese Verschlechterung, welche die Streitkräfte im Gebrauch auch an allen übrigbleibenden Teilen erfahren, kommt ein neues Prinzip in das Gefecht, nämlich die innere Überlegenheit frischer Streitkräfte gegen schon gebrauchte.
299. Es kommt aber noch ein zweiter Gegenstand in Betracht, der in einer vorübergehenden Verschlechterung gebrauchter Streitkräfte besteht, nämlich in der Krise, welche jedes Gefecht in ihnen hervorbringt.
300. Das Handgefecht hat, praktisch genommen, keine Dauer. In dem Augenblick, wo sich ein Kavallerieregiment auf das andere stürzt, ist die Sache entschieden, und die wenigen Sekunden des wirklichen Herumhauens kommen als Zeit nicht in Betracht; nicht viel anders ist es bei der Infanterie und bei großen Massen. Aber die Sache ist darum noch nicht ganz abgemacht; der kritische Zustand, der sich in der Entscheidung entladen hat, ist mit ihr noch nicht ganz vorüber; das siegende Regiment, welches dem besiegten mit verhängtem Zügel folgt, ist nicht gleich dem Regiment, welches in geschlossener Ordnung auf dem Kampfplatz hielt; seine moralische Kraft ist allerdings gestiegen, aber seine physische und die Kraft seiner Ordnung ist in der Regel geschwächt. Es ist nur der Verlust, den der Gegner an moralischer Kraft erlitten hat, und der Umstand, daß er eben so aufgelöst ist, wodurch der Sieger sein Übergewicht behält; kommt nun ein anderer Gegner, der seine moralische Kraft noch nicht eingebüßt und seine Ordnung nicht verloren hat, so ist keine Frage, daß er, bei gleichem Wert der Truppen, den Sieger schlagen wird.
301. Auch im Feuergefecht findet eine solche Krise statt, so daß derjenige, welcher durch sein Feuer eben siegreich gewesen und den Gegner abgewiesen hat, sich doch in dem Augenblick in einem merklich geschwächten Zustande seiner Ordnung und Kraft befindet, ein Zustand, der so lange dauert, bis alles, was sich in dem Ordnungsgefüge gelöst hatte, wieder in sein Verhältnis gebracht worden ist.
302. Was wir hier von kleineren Teilen gesagt haben; gilt auch von größeren.
303. An sich ist die Krise bei kleineren Teilen größer, weil sie das Ganze gleichartiger durchdringt, aber sie ist von kürzerer Dauer.
304. Am schwächsten ist die Krise des Ganzen, besonders ganzer Armeen; sie dauert aber auch am längsten, bei beträchtlichen Armeen oft viele Stunden.
305. Solange die Krise des Gefechtes beim Sieger dauert, liegt darin ein Mittel für den Besiegten, dasselbe herzustellen, d. i. seinen Erfolg zu wenden, wenn er frische Truppen in angemessener Zahl herbeiführen kann.
306. Dadurch wird also der successive Gebrauch der Streitkräfte auf einem zweiten Wege als ein wirksames Prinzip eingeführt.
307. Ist aber der successive Gebrauch der Streitkräfte in einer Reihe hintereinander folgender Gefechte möglich, und ist der gleichzeitige Gebrauch nicht unbegrenzt, so folgt von selbst, daß die Kräfte, welche nicht im gleichzeitigen Gebrauch wirksam sein, es im successiven werden können.
308. Durch diese Reihe hintereinander liegender Teilgefechte wird die Dauer des Gesamtgefechts bedeutend ausgedehnt.
309. Diese Dauer nun bringt einen neuen Grund für den successiven Gebrauch der Streitkräfte in die Betrachtung, indem sie eine neue Größe in die Rechnung bringt; diese Größe ist das unvorhergesehene Ereignis.
310. Ist überhaupt ein successiver Gebrauch der Streitkräfte möglich, so weiß man auch nicht, welchen Gebrauch der Gegner von den seinigen machen wird; denn nur, was er zu gleichzeitiger Wirkung anwendet, liegt unserer Beurteilung vor, das andere nicht, und wir können uns nur im allgemeinen darauf gefaßt machen.
311. Die bloße Dauer der Handlung bringt aber auch noch den reinen Zufall in die Rechnung, und dieser spielt der Natur der Sache nach im Kriege eine viel größere Rolle als sonst irgendwo.
312. Die unvorhergesehenen Ereignisse erfordern eine allgemeine Berücksichtigung, und diese kann in nichts anderem bestehen, als im Zurückstellen einer angemessenen Kraft, nämlich der eigentlichen Reserve.
Tiefe der Aufstellung.
313. Alle Gefechte, die successiv geliefert werden sollen, erfordern aus den Gründen, aus welchen sie entspringen, frische Streitkräfte. Diese können entweder noch ganz frisch, d. i. ungebraucht sein, oder schon gebraucht, aber durch eine Erholung von dem Zustande der Schwächung wieder mehr oder weniger hergestellt. Man sieht leicht ein, daß dies viele Abstufungen hat.
314. Beides, der Gebrauch ganz frischer Streitkräfte, sowie der Gebrauch solcher, die sich wieder hergestellt haben, bedingt eine Zurückstellung derselben, d. h. eine Aufstellung außerhalb der Region der Zerstörung.
315. Auch dies hat seine Abstufungen, denn die Region der Zerstörung hört nicht mit einemmal auf, sondern verliert sich nach und nach, bis sie zuletzt ganz aufhört.
316. Sehr merkliche Stufen bilden das Flintenfeuer und das Kartätschenfeuer.
317. Je weiter eine Truppe zurückgestellt worden ist, um so frischer wird sie sich beim Gebrauch zeigen.
318. Jede Truppe aber, die im wirksamen Flinten- und Kartätschenfeuer gestanden, ist nicht mehr als eine frische zu betrachten.
319. Wir haben also einen dreifachen Grund für das Zurückstellen gewisser Streitkräfte. Sie dienen
a) zum Ablösen oder Verstärken erschöpfter Kräfte, besonders im Feuergefecht;
b) zur Benützung der Krisis, in welcher der Sieger sich unmittelbar nach dem Erfolge befindet;
c) gegen unvorhergesehene Ereignisse.
320. Alles, was zurückgestellt ist, gehört in diese Kategorien, von welcher Waffe es sei, es mag zweites Treffen oder Reserve heißen, einem Teil oder dem Ganzen angehören.
Polarität des gleichzeitigen und des successiven Gebrauchs der Streitkräfte.
321. Da der gleichzeitige und successive Gebrauch der Streitkräfte einander entgegengesetzt sind, und jeder seine Vorteile hat, so sind sie als zwei Pole zu betrachten, welche den Entschluß jeder für sich an sich ziehen und ihn dadurch auf den Punkt stellen, wo sie sich ausgleichen, vorausgesetzt, daß dieser Entschluß die gegenseitige Kraft richtig schätzt.
322. Nunmehr kommt es darauf an, die Gesetze dieser Polarität, d. h. die Vorteile und Bedingungen beider Kraftverwendungen und dadurch auch ihr Verhältnis untereinander kennen zu lernen.
323. Die gleichzeitige Anwendung der Streitkräfte kann eine Steigerung erhalten:
A. bei gleicher Front, und zwar
a) im Feuergefecht,
b) im Handgefecht;
B. bei größerer Front, d. h. umfassend.
324. Nur was zu gleicher Zeit zur Wirksamkeit gebracht wird, kann als gleichzeitig angewendet betrachtet werden. Es ist also bei gleicher Front begrenzt durch die Möglichkeit, wirksam zu werden. Drei Glieder z. B. können allenfalls im Feuergefecht noch zugleich wirken, sechs unmöglich.
325. Wir haben (Nr. 89) gezeigt, daß zwei Feuerlinien von ungleicher Stärke sich das Gleichgewicht halten können, und daß die Verminderung des einen Teils, wenn sie gewisse Grenzen nicht überschreitet, nur den Erfolg hat, die gegenseitige Wirkung zu schwächen.
326. Je schwächer aber die Zerstörungskraft des Feuergefechts wird, um so mehr Zeit wird erforderlich, die gehörige Wirkung hervorzubringen. Daher hat derjenige, welcher hauptsächlich Zeit gewinnen will (gewöhnlich der Verteidiger), das Interesse, die gemeinschaftliche (d. i. die Summe der beiderseitigen) Zerstörungskraft des Feuergefechts so viel als möglich zu mäßigen.
327. Ferner ist auch der in der Zahl bedeutend Schwächere in diesem Fall, denn bei gleichen Verlusten sind die seinigen relativ immer größer.
328. Die entgegengesetzten Bedingungen werden die entgegengesetzten Interessen hervorbringen.
329. Wo kein besonderes Interesse für die Beschleunigung der Wirkung vorherrscht, werden beide Teile das Interesse haben, sich mit so wenigem als möglich zu behelfen, d. h. wie schon (Nr. 89 b) gesagt ist, nur so viel anzuwenden, um nicht durch die geringe Zahl den Gegner zu veranlassen, sogleich zum Handgefecht überzugehen.
330. Auf diese Weise ist also die gleichzeitige Anwendung der Streitkräfte im Feuergefecht durch den Mangel des Vorteils beschränkt, und beide Teile sind auf den successiven Gebrauch der entbehrlichen Kräfte hingewiesen.
331. Im Handgefecht entscheidet die Überlegenheit der Zahl vor allen Dingen, und die gleichzeitige Anwendung der Kräfte hat deshalb so sehr den Vorzug vor der successiven, daß diese durch den bloßen Begriff fast ganz ausgeschlossen und erst durch die Nebenumstände wieder möglich wird.
332. Das Handgefecht ist nämlich eine Entscheidung, und zwar eine, die fast ohne alle Dauer ist; dies schließt die successive Kraftanwendung aus.
333. Aber wir haben schon gesagt, daß die Krisis des Handgefechts die successive Kraftanwendung sehr begünstigt.
334. Ferner sind die Entscheidungen der einzelnen Handgefechte, wenn sie Teilgefechte eines größeren Ganzen sind, keine absoluten; es müssen also die ferneren möglichen Gefechte bei der Kraftanwendung gleich mit berücksichtigt werden.
335. Dies führt denn auch beim Handgefecht dahin, nicht mehr Kraft zu gleicher Zeit anzuwenden, als man eben nötig erachtet, um des Erfolges gewiß zu sein.
336. Hier gibt es kein anderes allgemeines Gesetz, als daß Umstände, welche die Wirksamkeit erschweren (hoher Mut des Feindes, starkes Terrain u. s. w.), eine größere Anzahl von Streitkräften notwendig machen.
337. Wichtig aber bleibt für die allgemeine Theorie die Bemerkung, daß eine Kraftverschwendung beim Handgefecht nie so nachteilig ist als im Feuergefecht, weil bei dem ersteren die Truppen nur im Augenblick der Krise unbrauchbar werden, nicht dauernd.
338. Es ist also beim Handgefecht die gleichzeitige Anwendung der Kräfte so bedingt, daß sie in jedem Falle für den Erfolg hinreichend sein müssen, und daß der successive Gebrauch die Unzulänglichkeit auf keine Weise ersetzen kann, weil sich nicht wie im Feuergefecht die Erfolge addieren lassen, daß aber, wenn der nötige Grad erreicht ist, eine größere gleichzeitige Kraftanwendung Verschwendung sein würde.
339. Nachdem wir beim Feuer- und Handgefecht die Anwendung großer Streitkräfte durch Vermehrung der Dichtigkeit derselben betrachtet haben, kommen wir zu derjenigen, welche in einer größeren Front, d. h. der umfassenden Form, möglich ist.
340. Eine größere Summe von Streitkräften gleichzeitig durch eine größere Frontausdehnung ins Gefecht zu bringen, ist auf zwei Arten denkbar. Nämlich:
1. indem man durch eine größere Front auch den Gegner zu einer Verlängerung der seinigen veranlaßt. In diesem Falle gibt es uns keine Überlegenheit über den Feind, aber es hat die Wirkung, daß von beiden Seiten mehr Kräfte gleichzeitig ins Spiel gebracht werden.
2. Durch das Umfassen der feindlichen Front.
341. Von beiden Seiten mehr Kräfte sogleich anzuwenden, möchte nur in wenigen Fällen für einen der beiden Teile einen Wert haben, auch ist es ungewiß, ob der Feind diese weitere Frontausdehnung annehmen wird.
342. Nimmt er sie nicht an, so wird entweder ein Teil unserer Front, also unserer Streitkräfte, müßig, oder wir müssen den überschießenden Teil unserer Front zum Umfassen des Feindes verwenden.
343. Die Furcht vor diesem Umfassen ist es denn auch allein, die den Feind bewegen kann, sich ebensoweit auszudehnen.
344. Wenn jedoch der Feind umfaßt werden soll, so ist es offenbar besser, sich gleich von Hause aus darauf einzurichten, und die größere Front ist also nur unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten.
345. Die umfassende Form in dem Gebrauch der Streitkräfte hat nun das Eigentümliche, daß sie nicht bloß die Summe der gleichzeitig angewendeten Streitkräfte auf beiden Seiten vermehrt, sondern auch gestattet, deren mehr als der Gegner in Wirksamkeit zu setzen.
346. Wenn z. B. ein Bataillon von 180 Schritt Front nach vier Seiten gegen einen umfassenden Feind Front machen müßte, und dieser sich in der wirksamen Gewehrschußweite (150 Schritt) von diesem Bataillon befände, so hätte er Raum für acht Bataillone, welche gegen dieses wirksam sein können.
347. Wegen dieser Eigentümlichkeit also gehört die umfassende Form hierher; wir müssen aber zugleich auch ihre andern Eigentümlichkeiten, nämlich ihre Vorteile und Nachteile, hier mit in Betracht ziehen.
348. Ein zweiter Vorteil der umfassenden Form ist die stärkere Wirkung des konzentrischen Feuers.
349. Ein dritter Vorteil ist das Abschneiden des Rückzugs.
350. Diese drei Vorteile des Umfassens nehmen ab, je größer die Streitkräfte, oder vielmehr ihre Fronten werden, und nehmen zu, je kleiner sie sind.
351. Denn was den ersten betrifft (345), so bleiben die Schußweiten dieselben, die Truppenmasse mag groß oder klein sein (vorausgesetzt, daß sie aus denselben Waffen besteht), es bleibt also auch die Differenz der umfassenden Linie und der umfaßten dieselbe und bekommt folglich einen immer geringeren Wert, je größer die Frontlänge wird.
352. Ein Bataillon könnte auf 150 Schritt Entfernung von 8 Bataillonen umschlossen werden (346); 10 Bataillone dagegen würden nur von 20 Bataillonen umschlossen werden können.
353. Die umschließende Form kommt jedoch selten oder nie ganz, d. h. im vollen Kreise vor, sondern nur teilweise, gewöhnlich unterhalb 180°. Denkt man sich nun die Streitkraft von der Größe einer beträchtlichen Armee, so sieht man wohl ein, wie gering der oben entwickelte erste Vorteil unter solchen Umständen bleiben wird.
354. Genau so verhält es sich mit dem zweiten Vorteil, wie der Augenschein zeigt.
355. Auch der dritte Vorteil muß merklich abnehmen, je größer die Front ist, wie sich von selbst versteht, obgleich hier noch andere Verhältnisse in Betracht kommen werden.
356. Aber die umfassende Form hat auch einen eigentümlichen Nachteil, nämlich, daß die Kräfte dabei in einem größeren Raume ausgebreitet und deshalb in zwei Beziehungen in ihrer Wirksamkeit geschwächt sind.
357. Es kann nämlich die Zeit, welche angewendet wird, einen gewissen Raum zu durchlaufen, nicht zugleich zum Schlagen angewendet werden. Nun finden alle Bewegungen, die nicht gerade senkrecht auf die feindliche Linie führen, bei dem Umfassenden in einem größeren Raume statt als bei dem Umfaßten, denn dieser bewegt sich mehr oder weniger auf den Radien eines kleineren Kreises, jener auf der Zirkumferenz eines größeren, was sehr bedeutende Unterschiede gibt.
358. Hieraus folgt die Möglichkeit, daß der Umfaßte seine Kräfte leichter auf verschiedenen Punkten brauchen kann.
359. Aber auch die Einheit des Ganzen wird durch die größeren Räume geschwächt, weil Nachrichten und Befehle eine größere Entfernung zu durchlaufen haben.
360. Diese beiden Nachteile des Umfassens nehmen mit der Frontausdehnung zu. Bei wenigen Bataillonen sind sie unbedeutend, bei großen Armeen hingegen beträchtlich, denn
361. die Differenz zwischen Radius und Umkreis bleibt dieselbe, es werden also die absoluten Unterschiede immer größer, je größer die Fronten sind; auf diese absoluten Unterschiede aber kommt es hier an.
362. Außerdem kommen aber bei ganz kleinen Teilen wenig oder keine Seitenbewegungen vor, und sie nehmen zu, je größer die Teile werden.
363. Endlich fällt für das Durchlaufen der Nachrichten aller Unterschied weg, so lange man die Räume übersehen kann.
364. Sind also die Vorteile des Umfassens bei kleinen Fronten sehr groß und die Nachteile sehr klein, nehmen die einen ab, die andern zu mit dem Wachsen der Front, so folgt, daß es einen Punkt geben wird, wo sie sich das Gleichgewicht halten werden.
365. Über diesen Punkt hinaus kann also die Frontausdehnung dem successiven Kraftgebrauch keine Vorteile mehr entgegenstellen, sondern es entstehen Nachteile.
366. Das Gleichgewicht zwischen den Vorteilen successiver Kraftverwendung und denen einer größeren Front (Nr. 341) muß sich also diesseits jenes Punktes finden.
367. Um diesen Punkt des Gleichgewichts aufzusuchen, müssen wir die Vorteile der umfassenden Form noch bestimmter in Betracht ziehen. Der einfachste Weg dazu ist folgender.
368. Eine gewisse Front ist notwendig, um sich der Wirksamkeit der ersten beiden Nachteile des Umfaßtwerdens zu entziehen.
369. Was die konzentrische (doppelte) Wirkung des Feuers betrifft, so gibt es eine Frontlänge, wo diese absolut aufhört, nämlich, wenn die Entfernung der zurückgebogenen Teile, im Fall man vom Feinde umfaßt wird, größer ist als die Schußweiten.
370. Man braucht aber hinter jeder Aufstellung auch einen unbeschossenen Raum für die Reserve, für die Kommandierenden u. s. w., die sich hinter der Fronte befinden. Wenn diese von drei Seiten beschossen werden sollten, so würden sie aufhören, das zu sein, wozu sie bestimmt sind.
371. Da diese Gegenstände bei größeren Massen selbst größere Massen bilden und folglich mehr Raum brauchen, so muß der unbeschossene Raum hinter der Front auch um so größer sein, je größer das Ganze ist, mithin muß aus diesem Grunde die Front mit der Größe der Massen wachsen.
372. Der Raum hinter einer beträchtlichen Truppenmasse muß aber nicht bloß darum größer sein, weil die Reserven u. s. w. mehr Platz brauchen, sondern er muß auch außerdem noch größer sein, um mehr Sicherheit zu gewähren; denn erstens würden verlorene Schüsse gegen größere Truppenmassen und Trains eine viel größere Wirkung haben als gegen ein paar Bataillone; zweitens dauern die Gefechte der großen Massen viel länger, und die Verluste, welche hinter der Front bei den Truppen stattfinden, die nicht eigentlich im Gefechte sind, werden dadurch viel größer.
373. Setzte man also für die notwendige Frontlänge eine gewisse Größe fest, so müßte sie mit der Größe der Massen steigen.
374. Der andere Vorteil der umfassenden Form (die Überlegenheit der gleichzeitig wirkenden Kräfte) führt auf keine bestimmte Größe für die Frontlänge; wir müssen also dabei stehen bleiben, daß er mit der Länge der Front abnimmt.
375. Zur näheren Bestimmung müssen wir hier bemerken, daß sich die gleichzeitige Wirksamkeit größerer Streitkräfte hauptsächlich auf das Flintenfeuer bezieht; denn für das Geschütz wird es, so lange dasselbe allein wirkt, auch in der kleineren Kreislinie des Umfaßten niemals an Raum fehlen, ebensoviel aufzustellen als der Gegner in seiner größeren; weil man niemals so viel Geschütz hat, um damit eine zusammenhängende Linie zu bilden.
376. Man wende nicht ein, daß dem Gegner immer noch der Vorteil des größeren Raumes bleiben würde, weil seine Geschütze nicht so dicht stehen und also weniger getroffen werden; denn man kann seine Batterien nicht gleichmäßig in einzelnen Geschützen auf dem großen Raume verteilen.
377. Bei einem bloßen Artilleriegefechte oder einem Gefechte, in welchem die Artillerie die Hauptwaffe ist, wird der Vorteil der größeren umfassenden Front allerdings vorhanden und wegen der größeren Schußweite, also der großen Differenz beider Fronten, sehr groß sein. Dieser Fall tritt z. B. bei einzelnen Redouten ein. Aber bei Streitkräften, bei welchen die anderen Waffen die Hauptsache sind und die Artillerie untergeordnet ist, hört dieser Vorteil auf, weil es da, wie gesagt, auch dem Umfaßten nicht an Raum fehlt.
378. Es ist also hauptsächlich das Infanteriefeuergefecht, in welchem sich die Vorteile der größeren Front zur gleichzeitigen Anwendung größerer Streitkräfte zeigen müssen. Hier beträgt die Differenz beider Fronten das Dreifache der Flintenschußweite (wenn das Umfassen bis auf 180° getrieben ist), also etwa 600 Schritt. Dies gibt für eine Front von 600 Schritt das Doppelte, ist also dann sehr fühlbar; für eine Front von 3000 Schritt aber würde sie nur 1/5 geben, was schon nicht mehr als ein sehr wirksamer Vorteil zu betrachten ist.
379. Man kann also sagen, daß in dieser Beziehung die Frontlänge hinreicht, sobald die Differenz, welche aus der Flintenschußweite hervorgeht, aufhört, eine merkliche Überlegenheit zu gewähren.
380. Aus allem bisher über diese beiden Vorteile des Umfassens Gesagten geht hervor, daß kleine Massen Mühe haben, sich die gehörige Frontlänge zu verschaffen; dies ist so wahr, daß sie, wie wir aus der Erfahrung wissen, meistens genötigt sind, die stereotype Ordnung ihrer Formation zu verlassen und sich viel mehr auszudehnen. Höchst selten wird ein sich selbst überlassenes Bataillon ein Gefecht in der bloßen Frontlänge seiner gewöhnlichen Aufstellung (150 bis 200 Schritt) annehmen, sondern sich in Kompagnien und diese wieder in Tirailleurs weiter auseinanderziehen und, nachdem es einen Teil zur Reserve zurückbehalten hat, mit dem übrigen einen zwei-, drei- und viermal so großen Raum einnehmen, als es eigentlich sollte.
381. Je größer aber die Massen werden, um so leichter wird man zu der notwendigen Frontlänge kommen, weil diese zwar mit den Massen wächst (373), aber nicht in demselben Maße.
382. Große Massen haben also nicht nötig, die Formationsordnung zu verlassen und können vielmehr Truppen zurückstellen.
383. Dies hat dahin geführt, daß man für die größeren Massen auch eine stereotype Ordnung mit zurückgestellten Teilen eingeführt hat, wie die gewöhnlichen Schlachtordnungen in zwei Treffen, gewöhnlich noch ein drittes von Kavallerie dahinter, auch außerdem noch eine Reserve von 1/8 bis 1/6 u. s. w.
384. Bei ganz großen Massen (Armeen von 100 000, 150 000 bis 200 000 Mann) sehen wir die Reserven immer größer werden (1/4 bis 1/3), ein Beweis, daß die Kräfte das Frontbedürfnis immer mehr übersteigen.
385. Wir führen das jetzt hier bloß an, um durch einen Blick auf die Erfahrung die Wahrheit unserer Entwickelung mehr in die Augen fallen zu lassen.
386. So verhält es sich also mit den beiden ersten Vorteilen des Umfassens. Anders ist es mit dem dritten.
387. Die beiden ersten wirken auf die Sicherheit des Erfolgs, indem sie unsere Kräfte steigern, der dritte tut das auch, aber nur bei ganz kurzen Fronten.
388. Er wirkt nämlich auf den Mut der in der feindlichen Front Fechtenden, indem er ihnen die Vorstellung eines verlorenen Rückzugs gibt, die immer auf den Soldaten sehr stark wirkt.
389. Dies ist jedoch nur da der Fall, wo die Gefahr, abgeschnitten zu werden, so nahe und augenscheinlich ist, daß der Eindruck davon alle Gesetze der Disziplin und des Befehls überwältigt und den Soldaten unwillkürlich fortreißt.
390. Bei größeren Entfernungen, und wenn der Soldat nur durch das in seinem Rücken entstehende Kanonen- und Flintenfeuer mittelbar darauf hingeführt wird, können Besorgnisse bei ihm entstehen, aber wenn der Geist nicht schon ganz schlecht ist, so werden sie ihn nicht verhindern, den Befehlen des Führers zu gehorchen.
391. In diesem Falle ist also der Vorteil des Abschneidens, welchen der Umfassende hat, nicht mehr als ein solcher zu betrachten, der die Sicherheit, d. i. die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs erhöht, sondern als einer, der die Größe eines schon eingetretenen Erfolgs steigert.
392. Auch in dieser Beziehung ist der dritte Vorteil des Umfassens dem Gegensatz unterworfen, daß er bei kurzer Front am größten ist und mit der zunehmenden Front abnimmt, wie der Augenschein lehrt.
393. Dies verhindert aber nicht, daß die größeren Massen nicht einer größeren Front bedürfen sollten als die kleinen, denn da der Rückzug niemals in der ganzen Breite einer Aufstellung geschieht, sondern auf einzelnen Wegen, so folgt von selbst, daß große Massen mehr Zeit dazu brauchen als kleinere; diese längere Zeit bedingt also eine breitere Front, damit der Feind, der diese Front umfaßt, nicht so schnell an die Punkte gelangt, durch welche der Rückzug geht.
394. Wirkt (nach 391) der dritte Vorteil des Umfassens in der Mehrheit der Fälle (nämlich bei nicht zu kurzen Fronten) nur auf die Größe, nicht auf die Sicherheit des Erfolges, so folgt daraus, daß er nach den Verhältnissen und Absichten des Fechtenden einen ganz verschiedenen Wert bekommt.
395. Wo die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs ohnehin gering ist, muß für diese zunächst gesorgt werden; in solchem Falle kann also ein Vorteil, der hauptsächlich auf die Größe desselben geht, nicht sehr in Betracht kommen.
396. Wenn dieser Vorteil aber gar der Wahrscheinlichkeit des Erfolgs entgegen wäre (365), so würde er in solchem Falle ein positiver Nachteil werden.
397. In einem solchen Falle wird getrachtet werden müssen, durch die Vorteile successiver Kraftanstrengungen denen der größeren Front das Gleichgewicht zu halten.
398. Man sieht also: der Indifferenzpunkt zwischen den beiden Polen der gleichzeitigen und successiven Kraftverwendung, der Ausdehnung und Tiefe, liegt nicht bloß anders bei großen als bei kleinen Massen, sondern auch anders nach Verhältnissen und Absichten beider Teile.
399. Der Schwächere und der Vorsichtige muß der successiven, der Stärkere und der Kühne der gleichzeitigen Kraftanstrengung den Vorzug geben.
400. Es liegt in der Natur der Sache, daß der Angreifende der Stärkere oder der Kühnere ist, gleichviel, ob aus Charakterzug des Feldherrn oder aus Notwendigkeit.
401. Die umfassende Form des Gefechts, d. h. diejenige, welche die meiste gleichzeitige Kraftanstrengung bei uns und beim Gegner bedingt, ist also dem Angreifenden natürlich.
402. Die umfaßte, d. h. die, welche auf successive Kraftanstrengung angewiesen ist und sich darum dem Umfaßtwerden aussetzt, ist also die natürliche Form der Verteidigung.
403. In dem ersteren liegt die Tendenz einer schnellen Entscheidung, in dem letzteren die des Zeitgewinnes, und diese Tendenzen sind mit dem Zweck beider Gefechtsformen in Harmonie.
404. In der Natur der Verteidigung liegt aber noch ein anderer Grund, welcher sie auf die tiefere Aufstellung hinweist.
405. Einer ihrer bedeutendsten Vorteile liegt nämlich in dem Beistand der Gegend und des Bodens, von diesem aber macht die örtliche Verteidigung desselben ein wichtiges Element aus.
406. Nun sollte man glauben, dies führe dahin, die Front so lang als möglich zu machen, um diesen Vorteil so weit als möglich zu treiben, eine einseitige Ansicht, die als das hauptsächlichste Motiv betrachtet werden kann, welches die Feldherren so oft zu den ausgedehnten Stellungen verleitet hat.
407. Wir haben aber bisher die Frontausdehnung stets so gedacht, daß sie entweder zu einer ebenso großen des Feindes führt oder zur Überflügelung, d. h. zur Umfassung der feindlichen Front.
408. Solange man sich beide Teile gleich aktiv, also noch nicht unter dem Gesichtspunkt von Angriff und Verteidigung denkt, hat die Verwendung einer größeren Front zum Umfassen keine Schwierigkeit.
409. Sobald aber mit dem Frontalgefecht mehr oder weniger örtliche Verteidigung verbunden wird (wie das bei der Verteidigung der Fall ist), so hört jene Verwendung der überschießenden Frontteile auf; sie ist entweder gar nicht oder schwer mit der Überflügelung zu vereinigen.
410. Um diese Schwierigkeit richtig zu schätzen, muß man immer an die Gestalt der wirklichen Fälle denken, in denen die natürlichen Deckungsmittel des Bodens die Maßregeln des Feindes so schwer übersehen lassen, also ein Scheingefecht die zu einer örtlichen Verteidigung angewiesenen Streitkräfte so leicht täuschen und in Untätigkeit erhalten kann.
411. Hieraus folgt, daß man es in der Verteidigung als einen entschiedenen Nachteil ansehen muß, wenn man eine größere Front hat, als diejenige ist, welche der Angreifende notwendig zur Entwickelung seiner Kräfte braucht.
412. Wie groß die Front des Angreifenden notwendig werden muß, soll uns später beschäftigen; hier haben wir nur zu sagen, daß, wenn der Angreifende eine zu kleine Front annimmt, der Verteidiger ihn dafür nicht dadurch straft, daß er seine eigene Front von vornherein größer bestimmt, sondern durch offensive umfassende Gegenmaßregeln.
413. Es ist also gewiß, daß der Verteidiger, um in keinem Falle in den Nachteil einer zu großen Front zu geraten, die kleinste nehmen wird, die ihm die Umstände gestatten, denn dadurch behält er mehr Kräfte zum Zurückstellen; diese können aber nie in den Fall kommen, müßig zu bleiben, wie die Teile einer zu großen Front.
414. So lange der Verteidiger sich mit der kleinsten Front begnügt und die größte Tiefe zu erhalten sucht, d. h. der natürlichen Tendenz seiner Gefechtsform folgt, so lange hat der Angreifende die entgegengesetzte Tendenz: die Frontausdehnung so groß als möglich zu machen, d. h. den Gegner so weit als möglich zu umfassen.
415. Aber dies ist nur eine Tendenz und kein Gesetz, denn wir haben gesehen, daß die Vorteile dieses Umfassens mit der Größe der Fronten abnehmen und also auf gewissen Punkten dem Vorteil successiver Kraftverwendung nicht mehr das Gleichgewicht halten können. Diesem Gesetze ist der Angreifende wie der Verteidiger unterworfen.
416. Hier sind nun zwei verschiedene Frontausdehnungen zu unterscheiden: nämlich die, welche der Verteidiger durch seine genommene Aufstellung bestimmt, und jene, zu welcher der Angreifende durch seine beabsichtigte Überflügelung des Gegners veranlaßt wird.
417. Ist die erste schon so groß, daß alle Vorteile der Überflügelung verschwinden oder unkräftig werden, so muß diese wegfallen; der Angreifende muß dann den Vorteil auf einem andern Wege suchen, wie wir gleich sehen werden.
418. Ist aber die erste Front so klein, wie sie nur irgend sein konnte, hat mithin der Angreifende ein Recht dazu, durch Überflügelung und Umfassung nach Vorteilen zu streben, so muß doch wieder die Grenze dieses Umfassens bestimmt werden.
419. Diese bestimmt sich durch die in einem übertriebenen Umfassen liegenden (Nr. 356 bis 365 genannten) Nachteile.
420. Jene Nachteile entstehen, wenn das Umfassen trotz einer zu großen feindlichen Frontausdehnung gesucht wird; sie werden aber, wie der Augenschein lehrt, noch viel größer, wenn die Übertreibung in einem zu weiten Umfassen einer kurzen Linie liegt.
421. Stellen sich dem Angreifenden diese Nachteile entgegen, so müssen die Vorteile successiver Kraftverwendung, die der Gegner durch seine kurze Front erhält, um so mehr Gewicht bekommen.
422. Nun scheint es zwar, daß der Verteidiger, welcher die kurze Front und tiefe Aufstellung nimmt, dadurch nicht in dem einseitigen Vorteile der successiven Kraftanwendung bleibt; denn wenn der Angreifende eine ebenso kleine Front annimmt, also den Gegner nicht umfaßt, so haben beide die Möglichkeit successiver Kraftverwendung in gleichem Grade; wenn der Angreifende den Gegner aber umfaßt, so muß dieser überall eine Front entgegenstellen, also (mit Ausnahme des geringen, hier nicht zu berücksichtigenden Unterschiedes der Ausdehnung beider konzentrischen Kreise) in ebenso großer Front fechten. Hier kommen vier Fälle in Betracht.
423. Erstlich bleibt es, wenn auch der Angreifende seine Front ebensosehr verkürzt, immer ein Vorteil des Verteidigers, daß das Gefecht aus der Region der ausgedehnten und schnell entschiedenen in die der konzentrierten und dauernden übergeht, denn die Dauer des Gefechts liegt im Interesse des Verteidigers.
424. Zweitens ist der Verteidiger, wenn er vom Gegner umfaßt wird, nicht immer gezwungen, die umfassenden Glieder in paralleler Front zu bekämpfen, sondern er kann sie in der Flanke und in dem Rücken angreifen, wozu die geometrischen Verhältnisse gerade die beste Gelegenheit darbieten; dies ist aber schon ein successiver Gebrauch der Streitkräfte, denn dieser bedingt ja nicht notwendig, daß die späteren gerade so verwendet werden wie die früheren, oder daß die späteren überhaupt in die Stelle der früheren treten, wie wir gleich näher angeben werden. Ohne das Zurückstellen von Streitkräften wäre ein solches Umfassen des Umfassenden nicht möglich.
425. Drittens läßt die kurze Front mit starken zurückgestellten Reserven die Möglichkeit eines übertriebenen Umfassens von seiten des Angreifenden zu (Nr. 420), wovon dann eben vermittelst der zurückgestellten Kräfte Nutzen gezogen werden kann.
426. Viertens endlich muß als ein Vorteil betrachtet werden, daß der Verteidiger dadurch vor dem entgegengesetzten Fehler eine Kraftverschwendung durch unangegriffene Frontteile gesichert ist.
427. Dies sind die Vorteile der tiefen Aufstellung, d. h. der successiven Kraftverwendung. Sie halten der Ausdehnung nicht bloß beim Verteidiger das Gleichgewicht, sondern veranlassen auch den Angreifenden, eine gewisse Grenze des Umfassens nicht zu überschreiten, ohne jedoch die Tendenz zur Ausdehnung bis zu dieser Grenze hin aufzuheben.
428. Diese Tendenz aber wird geschwächt oder ganz aufgehoben, wenn der Verteidiger sich sehr ausgedehnt hat.
429. Zwar kann der Verteidiger unter diesen Umständen, da es ihm an zurückgestellten Massen fehlt, den Angreifenden für seine eigene große Ausdehnung beim Umfassen nicht bestrafen, aber die Vorteile des Umfassens werden schon ohnedies in diesem Falle zu gering.
430. Der Angreifende wird also die Vorteile des Umfassens nun nicht mehr suchen, wenn er nicht seiner Verhältnisse wegen einen sehr großen Wert auf das Abschneiden legen muß. Auf diese Weise ist also die Tendenz zum Umfassen geschwächt.
431. Sie wird aber ganz aufgehoben, wenn der Verteidiger eine so große Front genommen hat, daß der Angreifende einen großen Teil derselben müßig lassen kann, denn dies ist ihm ein wesentlicher Gewinn.
432. In solchen Fällen kommt der Angreifende dahin, seine Vorteile gar nicht mehr in der Ausdehnung und dem Umfassen, sondern auf der entgegengesetzten Seite, nämlich in der Konzentrierung seiner Kräfte gegen einen Punkt zu suchen. Daß aber dies mit einer tieferen Aufstellung gleichbedeutend ist, sieht man leicht ein.
433. Wie weit der Angreifende die Verkleinerung seiner Front treiben darf, hängt ab
a) von der Größe der Massen;
b) von der Größe der feindlichen Front;
c) von seiner Bereitschaft zur Gegenoffensive.
434. Bei kleinen Massen kann man keinen Teil der feindlichen Front mit Vorteil unbeschäftigt lassen; denn diese Teile können, da alles übersehen wird und die Räume nur klein sind, auf der Stelle zu anderer Wirksamkeit verwendet werden.
435. Hieraus folgt von selbst, daß auch bei großen Massen und Fronten die angegriffene Front nicht zu klein sein darf, weil sonst der eben berührte Nachteil wenigstens teilweise daraus entstehen würde.
436. Im allgemeinen aber liegt es in der Natur der Sache, daß der Angreifende, wenn er seinen Vorteil im Konzentrieren der Kräfte suchen darf, weil ihn die übermäßige Front des Verteidigers oder dessen Passivität dazu berechtigt, in der Verkürzung seiner Front weiter gehen darf als der Verteidiger, weil dieser durch seine zu große Ausdehnung nicht auf die offensive Gegenwirkung des Umfassens eingerichtet ist.
437. Je größer die Front des Verteidigers ist, um so mehr Teile derselben kann der Angreifende unbeschäftigt lassen.
438. Ebenso, je stärker die Absicht örtlicher Verteidigung ausgesprochen ist.
439. Endlich, je größer überhaupt die Massen sind.
440. Am meisten Vorteil wird also der Angreifende im Vereinigen seiner Kräfte finden, wenn sich alle diese günstigen Umstände vereinigen, nämlich große Massen, zu lange Front und viel örtliche Verteidigung des Gegners.
441. Bei Betrachtung der Raumverhältnisse kann dieser Gegenstand erst seine volle Erledigung finden.
442. Den Nutzen successiver Kraftverwendung haben wir bereits (Nr. 291 u. ff.) gezeigt. Wir haben hier nur noch darauf aufmerksam zu machen, daß die Ursachen, welche ihn bedingen, nicht bloß die Erneuerung desselben Gefechts mit frischen Truppen, sondern auch jede spätere Anwendung der zurückgestellten Streitkräfte gestatten.
443. In diesem späteren Gebrauch liegt ein Hauptvorteil, wie sich in der Folge zeigen wird.
444. Durch alle diese Entwickelungen sehen wir, wie sich der Indifferenzpunkt zwischen dem gleichzeitigen und dem successiven Kraftgebrauch je nach der Größe der zurückgestellten Teile, nach dem Verhältnis der Macht, nach Lage und Absicht, nach Kühnheit und Vorsicht anders stellt.
445. Daß Gegend und Boden ebenfalls einen großen Einfluß darauf haben, versteht sich von selbst und wird hier, wo wir von aller Anwendung abstrahieren, bloß berührt.
446. Bei so vielfältigen Beziehungen und zusammengesetzten Verhältnissen können keine absoluten Zahlen als Normalgrößen festgestellt werden, aber es muß doch irgend eine Einheit geben, welche zum festen Punkte für diese zusammengesetzten, wandelbaren Verhältnisse dient.
447. Solcher Anhaltspunkte gibt es nun zwei, nämlich nach jeder Seite hin einen. Der erste ist, daß eine gewisse Tiefe als eine solche angesehen wird, deren Kräfte gleichzeitig wirken. Zum Besten der Ausdehnung eine geringere anzunehmen, darf also nur als ein notwendiges Übel betrachtet werden. Dies bestimmt also die notwendige Tiefe. Der zweite ist die Sicherheit der Reserve, von der wir schon gesprochen. Diese bestimmt die notwendige Ausdehnung.
448. Die eben erwähnte notwendige Tiefe liegt allen stehenden Formationen zugrunde; wir werden erst in der Folge, wenn wir auf das Einzelne der Waffenordnung eingehen, dies Resultat feststellen können.
449. Ehe wir aber mit Antizipierung dieses Resultats unsere allgemeine Betrachtung zu einem Schlußresultate bringen können, müssen wir noch die Raumbestimmung entwickeln, weil diese gleichfalls Einfluß darauf hat.
Raumbestimmung.
450. Die Raumbestimmung beantwortet die Frage, wo gefochten werden soll, sowohl für das Ganze als für die Teile.
451. Der Ort des Gefechts für das Ganze ist eine strategische Bestimmung, die uns hier nicht berührt. Wir haben es hier nur mit der Konstruktion des Gefechts zu tun und müssen also voraussetzen, daß beide Teile aneinanderkommen; also wird der allgemeine Ort des Gefechts entweder da sein, wo die feindliche Armee ist ( beim Angriff), oder da, wo wir sie erwarten dürfen ( bei der Verteidigung).
452. Was die Raumbestimmung für die Glieder des Ganzen betrifft, so entscheidet sie über die geometrische Figur, welche die gegenseitigen Streitkräfte im Gefechte einnehmen sollen.
453. Wir abstrahieren hier von den in der eingeführten (Normal-) Formation enthaltenen Formen, welche wir später betrachten wollen.
454. Die geometrische Gestalt des Ganzen kann auf zwei zurückgeführt werden, nämlich auf die geradlinige und die in den konzentrischen Kreis-Abschnitten. Auf eins von beiden läuft alles andere hinaus.
455. Was nämlich wirklich miteinander im Gefecht gedacht werden soll, muß in parallelen Grundlinien gedacht werden. Wenn also eine Armee senkrecht auf die Grundlinie der andern aufmarschiert ist, so muß diese entweder ihre Front ganz verändern und sich parallel mit jener stellen, oder sie muß es wenigstens mit einem Teile tun. Unsere Armee aber muß den Teil, gegen welchen kein Teil der feindlichen herumgeschwenkt ist, selbst herumschwenken, wenn sie zur Wirksamkeit kommen will; so entsteht also eine Aufstellung in konzentrischen Kreis- oder Polygonstücken.
456. Die gradlinige Form ist offenbar als indifferent zu betrachten, denn die Verhältnisse beider Teile sind ganz gleich.
457. Man kann aber nicht sagen (wie es auf den ersten Blick scheint), daß die gradlinige Form nur aus dem graden und parallelen Angriff entspringt, sie kann auch entstehen, wenn der Verteidiger sich einem schiefen Angriff parallel entgegengestellt hat. In diesem Falle werden die übrigen Umstände freilich nicht immer gleich sein, denn oft wird die neue Stellung nicht gut, oft wird sie nicht ganz vollendet sein usw. Wir antizipieren dies hier nur, um einer Verwechslung der Begriffe vorzubeugen. Die Indifferenz, welche wir in diesem Falle sehen, liegt nur in der Form der Aufstellung.
458. Welcher Natur die Form in konzentrischen Kreisstücken (oder Polygonstücken, was dasselbe ist) sei, haben wir bereits oben ausführlich entwickelt; es ist die umfassende und die umfaßte Form.
459. Die Raumbestimmung für die Teile würde durch die geometrische Form der Grundlinien erschöpft sein, wenn überall den feindlichen Streitkräften eigene entgegengesetzt werden müßten; dies ist aber nicht notwendig, es entsteht vielmehr in jedem einzelnen Falle die Frage: sollen alle Teile der feindlichen Streitkräfte bekämpft werden oder nicht? und im letzteren Falle welche?
460. Können wir einen Teil der feindlichen Streitkräfte unbekämpft lassen, so werden wir dadurch stärker gegen die andern, sei es nun im gleichzeitigen oder successiven Gebrauch der Streitkräfte. Ein Teil der feindlichen Macht wird dann durch unsere ganze bekämpft.
461. Auf diese Weise werden wir also auf den Punkten, auf welchen wir unsere Macht brauchen, entweder der feindlichen überlegen oder wenigstens stärker sein, als es das allgemeine Machtverhältnis mit sich bringt.
462. Diese Punkte aber können bei der Voraussetzung, daß wir die übrigen unbekämpft lassen dürfen, für das Ganze genommen werden; es entsteht also eine künstliche Steigerung unserer Macht durch eine größere Vereinigung derselben im Raume.
463. Daß dieses Mittel ein höchst wichtiges Element aller Gefechtspläne ist, leuchtet von selbst ein, es ist das am meisten angewendete.
464. Es kommt also darauf an, diesen Gegenstand genauer zu betrachten, um die Teile der feindlichen Macht zu bestimmen, welche in diesem Sinne für das Ganze genommen werden können.
465. Wir haben in Nr. 4 die Motive angegeben, welche den Rückzug eines Fechtenden bestimmen. Es ist klar, daß sich die Tatsachen, aus welchen diese Motive entspringen, entweder auf die ganzen Streitkräfte oder wenigstens auf einen so wesentlichen Teil derselben beziehen, daß dieser mehr gilt als alle übrigen, also über diese mitbestimmt.
466. Daß sich diese Tatsachen auf die ganze Streitkraft beziehen, kann bei kleinen Massen sehr gut gedacht werden, aber nicht bei größeren. Hier beziehen sich zwar auch die unter d f g angegebenen Motive auf das Ganze, aber die übrigen, besonders der Verlust, betreffen immer nur gewisse Teile, denn bei größeren Massen ist es höchst unwahrscheinlich, daß alle Teile auf gleiche Weise davon betroffen werden.
467. Die Teile nun, deren Zustand die Ursache des Rückzugs wird, müssen natürlich im Verhältnis zum Ganzen bedeutend sein; wir wollen sie der Kürze wegen die überwundenen nennen.
468. Diese überwundenen Teile können entweder nebeneinander liegen oder in der ganzen Streitkraft mehr oder weniger verteilt sein.
469. Es ist kein Grund vorhanden, sich das eine wirksamer als das andere zu denken. Ist von einer Armee ein Korps vollkommen geschlagen, alles übrige aber intakt, so kann das in dem einen Falle schlimmer, in dem andern besser sein, als wenn der Verlust auf die ganze Masse gleichförmig verteilt wären.
470. Der zweite Fall setzt eine gleichmäßige Anwendung der entgegenstehenden Kräfte voraus; wir beschäftigen uns hier jedoch nur mit der Wirkung einer ungleichmäßigen (mehr auf einem oder einigen Punkten vereinigten) Anwendung der Kräfte, haben es also nur mit dem ersten Falle zu tun.
471. Liegen die überwundenen Teile nebeneinander, so kann man sie kollektiv als ein Ganzes betrachten, und so verstehen wir es, wenn wir von dem angegriffenen oder besiegten Teile oder Punkte sprechen.
472. Kann man bestimmen, wie dieser Teil beschaffen sein muß, um das Ganze zu beherrschen und in seiner Richtung mit fortzuziehen, so hat man dadurch auch bestimmt, gegen welchen Teil des Ganzen die Kräfte gerichtet sein müssen, die den eigentlichen Kampf kämpfen sollen.
478. Wenn wir von allen Gegenständen des Terrains absehen, so haben wir den anzugreifenden Teil nur nach Lage und Größe zu bestimmen. Wir wollen zuerst die Größe in Betracht ziehen.
474. Es sind zwei Fälle zu unterscheiden: der erste, wenn wir unsere Kräfte gegen einen Teil der feindlichen vereinigen und den übrigen gar nichts entgegenstellen; der zweite, wenn wir dem übrigen Teil bloß geringere Kräfte entgegenstellen, um ihn zu beschäftigen. Beides ist offenbar eine Vereinigung der Kraft im Raum.
475. Die Frage, wie groß im ersten Falle der Teil der feindlichen Streitkraft ist, den wir notwendig bekämpfen müssen, ist offenbar gleichbedeutend mit der, wie klein unsere Front sein darf. Diesen Gegenstand aber haben wir bereits in Nr. 433 u. ff. entwickelt.
476. Um den Gegenstand im zweiten Falle genauer kennen zu lernen, wollen wir uns zuerst denken, daß der Gegner ebenso positiv und tätig sei als wir, woraus folgt, daß er, wenn wir mit einem größeren Teile unseres Ganzen einen kleineren des seinigen schlagen, dasselbe seinerseits tut.
447. Wollen wir also den Totalerfolg für uns haben, so müssen wir es so einrichten, daß der Teil der feindlichen Macht, den wir schlagen wollen, im Verhältnis zu seinem Ganzen größer sei, als der von unserer Macht preisgegebene Teil im Verhältnis zu unserm Ganzen ist.
478. Wollen wir z. B. den Hauptkampf mit 3/4 unserer Macht führen und 1/4 zur Beschäftigung der nicht angegriffenen Teile verwenden, so muß der Teil der feindlichen Macht, den wir ernsthaft bekämpfen, größer sein als 1/4, also etwa 1/3. Treten in diesem Falle die Erfolge in entgegengesetzten Richtungen ein, so schlagen wir mit 3/4 unserer Macht 1/3 der feindlichen; der Feind aber mit 2/3 der seinigen 1/4 der unsrigen, was uns offenbar im Vorteil läßt.
479. Wären wir dem Feinde sehr überlegen, so daß die 3/4 unserer Macht hinreichten, uns über 1/2 der seinigen einen gewissen Sieg zu versprechen, so würde der Totalerfolg noch entscheidender für uns sein.
480. Je überlegener wir in der Zahl sind, um so größer darf der Teil der feindlichen Macht sein, den wir ernstlich bekämpfen, und um so größer wird dann der Erfolg sein. Je schwächer wir sind, um so kleiner muß der ernsthaft bekämpfte Teil sein, was mit dem natürlichen Gesetze, daß der Schwache seine Kräfte mehr konzentrieren muß, übereinstimmt.
481. Hierbei ist aber stillschweigend vorausgesetzt, daß der Feind ungefähr ebensoviel Zeit braucht, unsern schwachen Teil zu schlagen, als wir zur Vollbringung unseres Sieges über den seinigen nötig haben. Wäre das nicht der Fall, sondern fände ein sehr merklicher Unterschied statt, so würde er einen Teil seiner Truppen noch gegen unsere Hauptmacht verwenden können.
482. Nun ist aber ein Sieg in der Regel um so schneller erfochten, je ungleicher die Macht ist; es folgt also daraus, daß wir den Teil, welchen wir aufopfern wollen, nicht willkürlich klein machen dürfen, sondern daß er zu der feindlichen Macht, die er beschäftigen soll, ein erträgliches Verhältnis behalten muß. Das Konzentrieren hat also beim Schwachen seine Grenzen.
483. Die in Nr. 476 gemachte Voraussetzung findet jedoch äußerst selten Anwendung. Gewöhnlich ist ein Teil des Verteidigers örtlich verwendet und dieser nicht imstande, das Vergeltungsrecht so schnell zu üben, wie nötig wäre, woraus denn hervorgeht, daß der Angreifende beim Konzentrieren seiner Kräfte auch jenes Verhältnis noch etwas überschreiten darf, und daß er z. B. noch immer einige Wahrscheinlichkeit des Gesamterfolges für sich hat, wenn er mit 2/3 seiner Kräfte 1/3 der feindlichen schlägt, weil das von ihm übriggebliebene Drittel schwerlich in eben dem Maße ins Gedränge kommen wird.
484. Wollte man aber in dieser Folgerung weitergehen und den Schluß machen, daß, wenn der Verteidiger gar nichts Positives gegen den schwächeren Teil des Angreifenden täte (ein Fall, der sehr oft eintritt), daraus immer der Sieg des Angreifenden folgen müßte, so würde man einen Fehlschluß tun; denn in den Fällen, in welchem der Angegriffene sich nicht an dem schwächeren Teile der feindlichen Macht zu entschädigen sucht, unterbleibt dies hauptsächlich, weil er noch Mittel findet, einen Teil seiner nicht angegriffenen Macht in das Gefecht gegen unsere Hauptmacht zu bringen und also den Sieg derselben zweifelhaft zu machen.
485. Je kleiner der Teil der feindlichen Macht ist, den wir angreifen, um so eher wird das möglich sein, teils wegen des kleinen Raumes, teils und besonders weil die moralische Kraft des Sieges bei kleinen Massen so sehr viel geringer ist; der Sieg über einen kleinen Teil macht den Feind nicht so leicht Kopf und Mut verlieren, die noch vorhandenen Mittel zur Wiederherstellung anzuwenden.
486. Nur wenn der Feind sich in die Lage versetzt hat, weder das eine noch das andere tun zu können, d. h. weder durch einen positiven Sieg über unseren schwächeren Teil zu entschädigen, noch sich mit den dort überflüssigen Kräften dem Hauptangriff entgegenzustellen, oder wenn er aus Unentschlossenheit nicht dazu kommt, so darf der Angreifende hoffen, ihn auch mit einer verhältnismäßig sehr kleinen Macht durch das Mittel der Konzentrierung zu überwinden.
487. Die Theorie darf jedoch nicht den Verteidiger allein als in dem Nachteil befangen darstellen, die Konzentrierung der Kräfte des Gegners nicht gehörig vergelten zu können, sondern sie muß darauf hinweisen, daß jeder der beiden Teile, der Angreifer so gut wie der Verteidiger, in solchen Fall kommen kann.
488. Es ist nämlich die unverhältnismäßige Vereinigung von Kräften auf einem Punkte, um dadurch auf diesem überlegen zu werden, immer mit auf die Hoffnung gebaut, den Gegner zu überraschen, damit er weder Zeit habe, auf diesen Punkt ebenso viele Kräfte hinzuschaffen, noch sich auf eine Wiedervergeltung einzurichten. Die Hoffnung, daß die Überraschung gelinge, gründet sich wesentlich auf den früher gefaßten Entschluß, d. i. auf die Initiative.
489. Dieser Vorteil der Initiative hat aber auch wieder seinen Gegensatz, wovon weiter unten gehandelt werden soll; wir bemerken hier bloß, daß er kein absoluter Vorteil ist, dessen Wirkungen sich in allen Fällen zeigen müssen.
490. Aber wenn man auch von dem Grunde des Gelingens der Überraschung, welcher in der Initiative liegt, absieht, und kein objektiver Grund übrig bleibt, so daß das Gelingen nichts mehr für sich hat als das Glück, so ist das doch in der Theorie nicht verwerflich, denn der Krieg ist ein Spiel, von dem das Wagen unmöglich ausgeschlossen werden kann. Es bleibt also zulässig, da, wo alle andern Motive fehlen, auf gut Glück einen Teil seiner Macht zu konzentrieren in der Hoffnung, damit den Gegner zu überraschen.
491. Gelingt diese Überraschung auf der einen oder andern Seite, so wird daraus, es mag der Angreifende oder der Verteidiger sein, dem sie gelingt, für den überraschten Teil ein gewisses Unvermögen folgen, sich durch Wiedervergeltung zu entschädigen.
492. Bisher haben wir uns mit der Größe des zu bekämpfenden Teiles oder Punktes beschäftigt, jetzt kommen wir zur Lage desselben.
493. Sieht man von allem Terrain und andern individuellen Umständen ab, so können wir nur die Flügel, die Flanken, den Rücken und das Zentrum als Punkte unterscheiden, die ihre Eigentümlichkeiten haben.
494. Die Flügel, weil man dort die feindlichen Streitkräfte umfassen kann.
495. Die Flanken, weil man hoffen darf, dort auf einem Terrain zu schlagen, auf welchem der Feind nicht eingerichtet ist, und ihm den Rückzug zu erschweren.
496. Den Rücken ebenso wie die Flanken, nur daß das Erschweren oder völlige Abschneiden des Rückzugs hier noch mehr vorherrscht.
497. Bei Flanken und Rücken aber wird notwendig vorausgesetzt, daß Man den Feind zwingen könne, uns dort Streitkräfte entgegenzustellen; wo wir dieser Wirkung unseres Erscheinens nicht gewiß sind, würde es gefährlich sein; denn wo man keinen Feind zu bekämpfen hat, ist man müßig, und wo dies mit der Hauptmacht der Fall wäre, würde man unzweifelhaft seinen Zweck verfehlen.
498. Ein solcher Fall, daß nämlich der Gegner Flanken und Rücken preisgibt, ist nun zwar höchst selten, aber er kommt doch vor, und zwar am leichtesten, wenn der Gegner sich durch offensive Gegenunternehmungen schadlos hält (Wagram, Hohenlinden, Austerlitz gehören als Beispiele hierher).
499. Der Angriff auf das Zentrum (worunter wir nichts anderes verstehen als einen Teil der Front, der nicht Flügel ist) hat die Eigentümlichkeit, daß er zur Trennung der Teile führen kann, die gewöhnlich das Sprengen genannt wird.
500. Das Sprengen steht offenbar dem Umschließen entgegen. Beide wirken im Fall des Sieges sehr zerstörend auf die feindlichen Kräfte, aber jedes auf andere Weise, und zwar:
a) Das Umfassen trägt zur Sicherheit des Erfolges durch seine moralische Wirkung bei, indem es den Mut des Gegners schwächt.
b) Das Sprengen im Zentrum trägt zur Sicherheit des Erfolges bei, indem es unsere Kräfte mehr beieinander läßt. Beides haben wir schon besprochen.
c) Das Umfassen kann unmittelbar zu einer Vernichtung der feindlichen Armee führen, wenn es mit sehr überlegenen Kräften ausgeführt wird und gelingt. In jedem Falle ist, wenn es zum Siege führt, der Erfolg der ersten Tage dabei größer als beim Sprengen.
d) Das Sprengen kann nur indirekt zur Vernichtung der feindlichen Armee führen und zeigt seine Wirkung nicht leicht schon am ersten Tage so groß, sondern mehr strategisch in den folgenden.
501. Das Sprengen der feindlichen Armee durch Vereinigung unserer Hauptkräfte gegen einen Punkt setzt eine übertriebene Frontlänge beim Feinde voraus; denn es ist viel schwerer, die übrigen Streitkräfte des Feindes durch geringere zu beschäftigen, weil die dem Hauptangriff zunächst liegenden feindlichen Kräfte leicht zur Bekämpfung desselben verwendet werden können. Nun liegen aber bei einem Zentralangriff dergleichen zu beiden Seiten, bei einem Flügelangriff nur auf einer Seite.
502. Die Folge hiervon ist, daß ein solcher Zentralangriff leicht in Gefahr kommen kann, durch einen konzentrischen Gegenangriff in eine sehr nachteilige Gefechtsform zu geraten.
503. Es wird also die Wahl unter diesen Punkten mit Rücksicht auf die bestehenden Verhältnisse geschehen müssen. Länge der Front, Beschaffenheit und Lage der Rückzugslinie, Tüchtigkeit der feindlichen Truppen und Eigentümlichkeit des Feldherrn, endlich das Terrain werden die Wahl bestimmen. Wir werden diese Gegenstände erst in der Folge genauer betrachten.
504. Wir haben die Vereinigung der Hauptmacht auf einen Punkt zum wirklichen Kampf betrachtet, sie kann aber allerdings auf mehreren Punkten, auf zweien, ja auf dreien stattfinden, ohne daß es aufhört, eine Kraftvereinigung gegen einen Teil der feindlichen Macht zu sein. Allerdings wird mit der Mehrzahl der Punkte die Kraft des Prinzips geschwächt.
505. Bisher haben wir nur die objektiven Vorteile einer solchen Kraftvereinigung im Auge gehabt, nämlich ein günstigeres Kraftverhältnis auf dem Hauptpunkte; es gibt aber auch einen subjektiven Grund für den Führer oder Feldherrn, nämlich den, den Hauptteil seiner Macht mehr in seiner Hand zu haben.
506. Obgleich in einer Schlacht der Wille des Feldherrn und seine Intelligenz das Ganze leitet, so dringen doch dieser Wille und diese Intelligenz nur in einem sehr geschwächten Grade bis zu den unteren Gliedern durch, und dies ist um so mehr der Fall, je entfernter die Truppen von dem Feldherrn sind; die Wichtigkeit und Selbständigkeit der Unterbefehlshaber nimmt zu, und zwar auf Kosten des obersten Willens.
507. Es ist aber nicht nur natürlich, sondern, solange keine Anomalie stattfindet, auch vorteilhaft, daß der Oberbefehlshaber die größte Wirksamkeit behält, welche die Umstände nur irgend gestatten.
Wechselwirkung.
508. Hiermit haben wir alles erschöpft, was sich im allgemeinen über die Verwendung der Streitkräfte im Gefecht aus ihrer Natur selbst entwickeln läßt.
509. Nur einen Gegenstand haben wir noch zu betrachten: es ist die Wechselwirkung der beiderseitigen Pläne und Handlungen.
510. Da der eigentliche Gefechtsplan nur das feststellen kann, was sich in der Handlung vorhersehen läßt, so beschränkt er sich meistens auf drei Dinge, nämlich auf:
1. die großen Umrisse;
2. die Vorbereitungen;
3. die Einzelheiten des Anfangs.
511. Nur der Anfang kann durch den Plan wirklich ganz festgestellt werden; der Verlauf erfordert neue, aus den Umständen hervorgehende Bestimmungen und Befehle, d. h. die Führung.
512. Natürlich ist es wünschenswert, die Grundsätze des Planes auch bei der Führung zu befolgen, denn Zweck und Mittel bleiben ja dieselben; wenn es also nicht überall geschehen kann, so ist das nur als eine unvermeidliche Unvollkommenheit zu betrachten.
513. Das Handeln der Führung ist unverkennbar ganz anderer Natur als das des Entwurfs. Dieser wird außer der Region der Gefahr und mit völliger Muße gemacht, jene findet immer im Drange des Augenblicks statt. Der Plan entscheidet immer von einem höheren Standpunkt aus mit einem weiteren Gesichtskreise; die Führung wird von dem Nächsten und Individuellsten bestimmt, ja oft fortgerissen. Wir wollen später von dem Unterschiede in dem Charakter dieser beiden Tätigkeiten der Intelligenz reden, hier aber noch davon absehen und uns damit begnügen, sie als verschiedene Epochen von einander getrennt zu haben.
514. Denkt man sich beide Teile so, daß keiner etwas von den Anordnungen des Gegners kennt, so wird jeder die seinigen nur nach den allgemeinen Grundsätzen der Theorie machen können. Ein großer Teil davon liegt bereits in der Formation und der sogenannten Elementartaktik der Heere, die natürlich nur auf das Allgemeine gegründet ist.
515. Es ist aber offenbar, daß eine Anordnung, die sich nur auf das Allgemeine bezieht, nicht die Wirksamkeit einer solchen haben kann, die auf individuelle Umstände gebaut ist.
516. Folglich muß es ein sehr großer Vorteil sein, seine Anordnungen später als der Feind und mit Berücksichtigung der feindlichen zu treffen; es ist die Hinterhand des Spielers.
517. Selten oder nie wird ein Gefecht ohne Berücksichtigung individueller Umstände angeordnet. Der erste, dessen Kenntnis niemals ganz fehlen kann, ist das Terrain.
518. Die Kenntnis des Terrains wohnt vorzugsweise dem Verteidiger bei, denn nur er weiß genau und vorher, in welcher Gegend das Gefecht stattfinden wird, und hat also Zeit, diese Gegend gehörig zu untersuchen. Hier schlägt die ganze Theorie der Stellungen insofern sie in die Taktik gehört, Wurzel.
519. Auch der Angreifende lernt die Gegend zwar kennen, noch ehe das Gefecht angeht, aber nur unvollkommen, denn der Verteidiger ist in deren Besitz und erlaubt ihm nicht, alles genau zu untersuchen. Was er etwa von fern erkennen kann, dient ihm zur Bestimmung seines Planes.
520. Will der Verteidiger einen anderen Gebrauch von der Gegend machen als den der bloßen Kenntnis, will er sie zu lokaler Verteidigung benützen, so folgt daraus mehr oder weniger eine bestimmte, ins einzelne gehende Verwendung seiner Streitkräfte; dadurch kommt der Gegner in den Fall, sie kennen zu lernen und bei seinem Plane zu berücksichtigen.
521. Dies ist also die erste Berücksichtigung des Gegners, welche eintritt.
522. In den meisten Fällen ist diese Station als diejenige zu betrachten, in welcher die Pläne beider Teile abschließen; was weiter geschieht, gehört schon zur Führung.
523. In Gefechten, in denen keiner der beiden Teile als eigentlicher Verteidiger zu betrachten ist, weil beide einander entgegenkommen, vertreten Formation, Schlachtordnung und Elementartaktik (als stereotype Disposition, etwas modifiziert durch das Terrain) die Stelle eines eigentlichen Planes.
524. Bei kleinen Ganzen kommt dies sehr häufig vor, bei großen Ganzen seltener.
525. Ist aber die Handlung in Angriff und Verteidigung geteilt, so befindet sich der Angreifende auf der Nr. 522 genannten Station, was die Wechselwirkung betrifft, offenbar im Vorteil. Zwar hat er die Initiative des Handelns ergriffen, der Gegner aber hat schon durch seine Verteidigungsanstalten einen großen Teil dessen, was er tun will, kundgeben müssen.
526. Dies ist der Grund, aus welchem in der Theorie der Angriff bisher als eine überwiegend vorteilhafte Form des Gefechts betrachtet worden ist.
527. Den Angriff aber als die vorteilhaftere oder mit einem bestimmteren Ausdruck: als die stärkere Form des Gefechts zu betrachten, führt zu einem Absurdum, wie wir in der Folge zeigen werden. Dies hat man übersehen.
528. Der Fehler des Schlusses liegt in der Überschätzung des Nr. 525 genannten Vorteils. Er ist wichtig in Beziehung auf die Wechselwirkung, aber diese ist nicht alles. Der Vorteil, sich des Terrains als einer Hilfsmacht zu bedienen und damit seine Streitkräfte gewissermaßen zu verstärken, ist in sehr vielen Fällen von größerer Bedeutung und könnte bei gehörigen Anordnungen in den meisten sein.
529. Aber falscher Gebrauch des Terrains (sehr ausgedehnte Stellungen) und ein falsches System der Verteidigung (bloße Passivität) haben allerdings jenem Vorteil des Angreifenden, mit seinen Maßregeln in der Hinterhand zu bleiben, solche Bedeutung gegeben, daß der Angriff diesem Punkt fast allein die Erfolge zu danken hat, die er in der Praxis über das natürliche Maß seiner Wirksamkeit hinaus zeigt.
530. Da die Einwirkung der Intelligenz mit dem eigentlichen Plan nicht aufhört, so müssen wir das Verhältnis der Wechselwirkung durch das Gebiet der Führung verfolgen.
531. Das Gebiet der Führung ist der Verlauf oder die Dauer des Gefechts; diese ist aber um so größer, je mehr successive Kraftverwendung stattfindet.
532. Wo man also auf die Führung viel rechnen will, bedingt dies eine große Tiefe der Aufstellung.
533. Es entsteht zuerst die Frage, ob es besser ist, mehr dem Plane oder mehr der Führung anzuvertrauen.
534. Es wäre offenbar widersinnig, irgend ein vorhandenes Datum absichtlich unberücksichtigt zu lassen und, wenn es für die beabsichtigte Handlung irgend einen Wert hat, diesen nicht mit in die Überlegung aufzunehmen. Hiermit ist aber nichts anderes gesagt, als daß man den Plan in die Handlung so weit hineingreifen lassen wird, als Data vorhanden sind, und daß das Feld der Führung nur da anfangen wird, wo der Plan nicht mehr hinreichen kann. Die Führung ist also nur eine Stellvertretung des Planes und insofern als ein notwendiges Übel zu betrachten.
535. Aber wohlverstanden: es ist nur vom motivierten Plan die Rede. Alle Bestimmungen, die eine individuelle Tendenz haben müssen, dürfen nicht auf willkürliche Voraussetzungen, sondern müssen auf Data gebaut sein.
536. Wo also die Data aufhören, müssen auch die Bestimmungen des Planes aufhören, denn es ist offenbar besser, daß etwas unbestimmt, d. h. unter die Obhut allgemeiner Grundsätze gestellt bleibe, als daß es auf eine Weise bestimmt werde, die nicht zu den Umständen paßt, welche sich hinterher ergeben.
537. Jeder Plan, der im Verlauf des Gefechts zu viel Detail bestimmt, muß dadurch fehlerhaft und verderblich sein, denn das Detail hängt nicht bloß von allgemeinen Gründen, sondern wieder von Einzelheiten ab, die unmöglich vorher gekannt sein können.
538. Wenn man überlegt, daß die Einwirkung einzelner Umstände (zufälliger und anderer) mit Zeit und Raum zunimmt, so sieht man, daß hier der Grund liegt, warum sehr weit umfassende und kombinierte Bewegungen selten gelingen und häufig verderblich werden.
539. Überhaupt liegt hier der Grund der Verderblichkeit aller sehr zusammengesetzten und künstlichen Gefechtspläne. Sie sind sämtlich, oft unbewußt, auf eine Masse von kleinen Voraussetzungen gegründet, von denen ein großer Teil nicht zutrifft.
540. Statt den Plan ungebührlich auszudehnen, ist es besser, mehr der Führung zu überlassen.
541. Dies setzt aber (nach 532) eine tiefe Aufstellung, d. h. große Reserven, voraus.
542. Wir haben (525) gesehen, daß der Angriff hinsichtlich der Wechselwirkung mit seinem Plane weiter reicht.
543. Dagegen hat der Verteidiger durch das Terrain zahlreiche Veranlassungen, den Gang seines Gefechts im voraus zu bestimmen, d. h. mit seinem Plane weit in dasselbe hineinzugreifen.
544. Bliebe man auf diesem Standpunkt stehen, so würde man sagen, daß die Pläne des Verteidigers viel durchgreifender sind als die des Angreifenden, daß dieser also vielmehr der Führung überlassen muß.
545. Dieser Vorzug des Verteidigers ist aber nur scheinbar, nicht wirklich vorhanden. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, daß die Anordnungen, die sich auf das Terrain beziehen, bloß Vorbereitungen sind, die sich auf Voraussetzungen, nicht auf wirkliche Maßregeln des Gegners gründen.
546. Nur weil diese Voraussetzungen gewöhnlich sehr wahrscheinlich sind, und insofern sie das sind, haben sie sowie die auf sie gegründeten Anordnungen Wert.
547. Diese Bedingung aber, die für den Verteidiger in betreff seiner Voraussetzungen und der darauf gebauten Anordnungen stattfindet, beschränkt diese natürlich sehr und nötigt ihn, mit seinen Anordnungen und Plänen vorsichtig zu sein.
548. Ist er damit zu weit gegangen, so kann der Angreifende sich ihnen entziehen, und dann entsteht auf der Stelle eine tote Kraft, d. h. eine Kraftverschwendung.
549. Hierher gehören die zu ausgedehnten Stellungen und zu häufig angewandte Lokalverteidigung.
550. Gerade diese beiden Fehler haben oft den Nachteil gezeigt, welcher aus einer übertriebenen Ausdehnung des Planes bei dem Verteidiger entsteht, und den Vorteil, welchen der Angreifende aus der naturgemäßen Ausdehnung des seinigen ziehen kann.
551. Nur sehr starke Stellungen, die es aber auch unter allen Gesichtspunkten sind, geben dem Plane des Verteidigers ein größeres Gebiet, als der Plan des Angreifenden haben kann.
552. In dem Maße aber, als die Stellung weniger ausgezeichnet gut oder gar nicht vorhanden ist, oder als Zeit fehlt, sich gehörig darin einzurichten, in demselben Maße wird der Verteidiger mit den Bestimmungen seines Planes hinter dem Angreifenden zurückbleiben und sich mehr auf die Führung verlassen müssen.
553. Dies Resultat führt also wieder dahin, daß der Verteidiger vorzugsweise die successive Kraftverwendung suchen muß.
554. Wir haben früher gesehen, daß nur die großen Massen den Vorteil kurzer Fronten haben können, und müssen jetzt noch bemerken, daß der Verteidiger sich um so mehr vor der Gefahr einer übermäßigen, durch das Terrain veranlaßten Ausdehnung seines Planes, einer verderblichen Kraftzersplitterung, und zwar durch die Hilfsmittel, bewahren muß, die in der Führung, d. i. in den starken Reserven, liegen.
555. Hieraus geht offenbar die Folgerung hervor, daß das Verhältnis der Verteidigung zum Angriff um so günstiger wird, je größer die Massen werden.
556. Dauer des Gefechts, d. i. starke Reserven und möglichst successive Verwendung derselben, ist also die erste Bedingung für die Führung und die Überlegenheit in diesen Dingen muß also auch eine Überlegenheit in der Führung mit sich bringen, abgesehen von aller Virtuosität dessen, der sie verwendet; denn die höchste Kunst kann ohne Mittel nicht wirksam werden, und man kann sich sehr gut denken, daß der minder Geschickte, dem aber noch mehr Mittel zu Gebote stehen, im Verlauf des Gefechts das Übergewicht bekommt.
557. Nun gibt es noch eine zweite objektive Bedingung, welche im allgemeinen die Überlegenheit in der Führung gewährt, und diese liegt ganz auf der Seite des Verteidigers: es ist die Bekanntschaft mit der Gegend. Welchen Vorteil diese da geben muß, wo es auf schnelle Entschlüsse ankommt, die ohne Übersicht im Drange der Umstände gefaßt werden, ist an sich klar.
558. Es liegt in der Natur der Dinge, daß die Bestimmungen des Planes mehr die Glieder höherer Ordnung, die der Führung mehr die der niederen betreffen; folglich wird jede einzelne Bestimmung der letzteren von geringerer Bedeutung sein, aber natürlich sind sie auch viel zahlreicher, wodurch der Unterschied in der Wichtigkeit zwischen Plan und Führung zum Teil ausgeglichen wird.
559. Ferner liegt es in der Natur der Sache, daß in der Führung die Wechselwirkung ihr eigentliches Feld hat, sowie daß sie hier nie aufhört, weil beide Teile einander im Angesicht sind, und daß sie folglich den größten Teil der Bestimmungen entweder veranlaßt oder modifiziert.
560. Ist nun der Verteidiger besonders darauf hingewiesen, die Kräfte für die Führung aufzusparen (Nr. 553), ist er im allgemeinen bei ihrem Gebrauche im Vorteil (Nr. 557), so folgt daraus, daß er den Nachteil, in welchem er sich bei der Wechselwirkung der Pläne befindet, durch das Übergewicht in der Wechselwirkung der Führung nicht nur wieder gutmachen, sondern auch ein Übergewicht in der Wechselwirkung überhaupt wird erreichen können.
561. Wie aber auch in dem einzelnen Falle das Verhältnis in dieser Beziehung zwischen beiden Teilen sei, es wird bis auf einen gewissen Grad das Bestreben vorhanden sein müssen, mit seinen Maßregeln in die Hinterhand zu kommen, um die des Gegners dabei berücksichtigen zu können.
562. Dies Bestreben ist der eigentliche Grund der so sehr viel stärkeren Reserven, die in der neueren Zeit bei großen Massen in Anwendung kommen.
563. Wir tragen kein Bedenken, bei allen bedeutenden Massen, nächst dem Terrain, in diesem Mittel das vorzüglichste Agens der Verteidigung zu finden.
Charakter der Führung.
564. Wir haben gesagt, daß zwischen dem Charakter der Bestimmungen, die den Plan, und jener, die die Führung eines Gefechts bilden, ein Unterschied ist; die Ursache hiervon ist, daß die Umstände verschieden sind, unter denen die Intelligenz wirkt.
565. Diese Verschiedenheit der Umstände besteht in drei Elementen: nämlich in dem Mangel an Daten, in dem Mangel an Zeit und in der Gefahr.
566. Dinge, die bei vollkommener Übersicht der Lage und des großen Zusammenhanges Hauptsachen werden, können es nicht mehr sein, wenn diese Übersicht fehlt; es werden also andere und zwar, wie sich von selbst versteht, näherliegende Erscheinungen vorherrschend wichtig.
567. Ist der Plan eines Gefechts also mehr eine geometrische Zeichnung, so ist die Führung mehr eine perspektivische; jener mehr ein Grundriß, diese mehr eine perspektivische Ansicht. Wie dieser Fehler gutgemacht werden muß, werden wir in der Folge sehen.
568. Außerdem, daß Mangel an Zeit auf den Mangel an Übersicht wirkt, wirkt er auch auf die Überlegung. Es kann weniger ein vergleichendes, abwägendes, kritisches Urteil als der bloße Takt wirksam werden, d. i. eine durch Übung gewonnene Gewandtheit des Urteils. Auch das müssen wir uns merken.
569. Daß das unmittelbare Gefühl großer Gefahr (für sich und andere) störend auf den bloßen Verstand wirkt, liegt in der menschlichen Natur.
570. Wenn also das Urteil des Verstandes auf jede Weise beengt und geschwächt wird, wohin kann es sich flüchten? – Nur zum Mut.
571. Es ist hier offenbar ein Mut doppelter Art erforderlich: Mut, um nicht von der persönlichen Gefahr überwältigt zu werden, und Mut, um aus Ungewisses zu rechnen und sein Handeln darauf einzurichten.
572. Das zweite pflegt man Mut des Verstandes ( courage d'esprit) zu nennen; für das erste gibt es keinen dem Gesetz der Antithese genügenden Namen, weil jene Benennung selbst nicht richtig ist.
573. Fragen wir uns, was in der ursprünglichen Bedeutung Mut genannt wird, so ist es die persönliche Aufopferung in der Gefahr, und von diesem Punkte müssen wir auch ausgehen, denn darauf stützt sich zuletzt alles.
574. Ein solches Gefühl der Aufopferung kann zwei ganz verschiedene Quellen haben: erstens Gleichgültigkeit gegen die Gefahr, sei es, daß sie aus dem Organismus des Individuums oder aus Gleichgültigkeit gegen das Leben oder aus Gewohnheit der Gefahr hervorgehe, und zweitens positive Motive: Ehrgeiz, Vaterlandsliebe, Begeisterung jeder Art.
575. Nur die erste ist als die echte angeborene oder zur Natur gewordene Mut zu betrachten, und er hat das Eigentümliche, daß er mit dem Menschen ganz identisch ist, also nie fehlt.
576. Anders ist es mit dem Mut, der aus positiven Gefühlen entspringt. Diese stellen sich den Eindrücken der Gefahr entgegen, und dabei kommt es natürlich auf ihr Verhältnis zu denselben an. Es gibt Fälle, in welchem sie viel weiter führen als die bloße Gleichgültigkeit gegen die Gefahr, in andern werden sie von dieser überwogen. Diese läßt das Urteil nüchterner und führt zur Standhaftigkeit, jene machen unternehmender und führen zur Kühnheit.
577. Ist mit solchen Anregungen Gleichgültigkeit gegen die Gefahr verbunden, so entsteht der vollkommenste persönliche Mut.
578. Dieser bisher betrachtete Mut ist etwas ganz Subjektives, er bezieht sich bloß auf die persönliche Aufopferung und kann darum persönlicher Mut genannt werden.
579. Nun ist aber natürlich, daß jemand, der auf das Opfer seiner Person keinen großen Wert legt, auch die Aufopferung der andern (die zufolge seiner Stellung von seinem Willen abhängig gemacht sind) nicht hoch anschlägt. Er betrachtet sie als eine Ware, über die er in eben der Weise schalten kann wie über sich selbst.
580. Ebenso wird der, welcher durch irgend ein positives Gefühl in die Gefahr hineingezogen wird, dieses Gefühl den andern entweder leihen oder sich berechtigt glauben, diese andern seinem Gefühle unterzuordnen.
581. Auf beide Arten bekommt der Mut einen objektiven Wirkungskreis. Er wirkt nun nicht mehr bloß auf die eigene Aufopferung, sondern auch auf den Gebrauch der ihm untergebenen Streitkräfte.
582. Schließt der Mut alle zu lebhaften Eindrücke der Gefahr von der Seele aus, so wirkt er auf die Tätigkeiten des Verstandes. Diese werden frei, weil sie nicht mehr unter dem Druck der Besorgnisse stehen.
583. Aber freilich können Verstandeskräfte, die nicht vorhanden sind, dadurch nicht entstehen, und noch weniger Einsichten.
584. Es kann also der Mut bei Mangel an Verstand und Einsicht oft zu sehr falschen Schritten führen.
585. Ganz andern Ursprungs ist der Mut, welchen man Mut des Verstandes genannt hat. Er entspringt aus der Überzeugung von der Notwendigkeit des Wagens, oder auch aus einer höheren Einsicht, welcher das Wagen nicht so groß als den übrigen erscheint.
586. Diese Überzeugung kann auch in solchen Menschen entstehen, die keinen persönlichen Mut haben, sie wird aber erst Mut, d. h. sie wird erst eine Kraft, die den Menschen im Drange des Augenblicks und der Gefahr aufrecht und im Gleichgewichte erhält, wenn sie auf das Gemüt zurückwirkt, die edleren Kräfte desselben weckt und steigert; aber darum ist der Ausdruck Mut des Verstandes nicht ganz richtig, denn aus dem Verstande selbst entspringt er nie. Daß aber Gedanken Gefühle hervorbringen, und daß diese Gefühle durch fortdauernde Einwirkung des Denkvermögens gesteigert werden können, weiß jeder aus der Erfahrung.
587. Indem auf der einen Seite der persönliche Mut die Verstandeskräfte unterstützt und dadurch erhöht, auf der andern die Verstandesüberzeugung die Gemütskräfte weckt und belebt, nähern sich beide einander und können zusammenfallen, d. h. dasselbe Resultat in der Führung geben. Dies ist jedoch selten der Fall; gewöhnlich haben die Handlungen des Mutes etwas von dem Charakter seines Ursprunges.
588. Wo großer persönlicher Mut und großer Verstand sich vereinigt finden, da muß natürlich die Führung die vollkommenste sein.
589. Daß der von der Verstandesüberzeugung ausgehende Mut sich hauptsächlich auf dasjenige Wagen bezieht, welches in dem Vertrauen auf ungewisse Dinge und auf gutes Glück besteht, und weniger auf die persönliche Gefahr, liegt in der Natur der Sache, denn diese kann nicht leicht ein Gegenstand großer Verstandestätigkeit werden.
590. Wir sehen also, daß in der Gefechtsführung, d. h. im Drange des Augenblicks und der Gefahr, die Gemütskräfte den Verstand unterstützen und dieser die Gemütskräfte wecken muß.
591. Ein solcher Zustand der Seele ist erforderlich, wenn das Urteil ohne Übersicht, ohne Muße, im heftigsten Drange der Erscheinungen treffende Entscheidungen geben soll. Man kann ihn das kriegerische Talent nennen.
592. Wenn man ein Gefecht mit seiner Masse großer und kleiner Glieder und der von ihm ausgehenden Handlungen betrachtet, so fällt in die Augen, daß der Mut, welcher von der persönlichen Aufopferung ausgeht, in der niederen Region vorherrschen, d. h. mehr über die kleinen Glieder gebieten wird, der andere mehr über die großen.
593. Je weiter man in dieser Gliederung hinuntersteigt, um so einfacher wird das Handeln, um so mehr kann also der einfache Verstand zureichen, um so größer aber wird die persönliche Gefahr, und folglich um so mehr wird der persönliche Mut in Anspruch genommen.
594. Je höher man hinaufsteigt, desto wichtiger und folgenreicher wird das Handeln des einzelnen, weil die Gegenstände, über welche er entscheidet, mehr oder weniger in einem durchgreifenden Zusammenhange mit dem Ganzen stehen. Hieraus folgt, daß um so mehr Übersicht erforderlich ist.
595. Nun hat zwar die höhere Stelle auch immer einen weiteren Horizont, übersieht den Zusammenhang viel besser als die niederen; aber alle Übersicht, die im Laufe eines Gefechts vermißt wird, fehlt doch hauptsächlich hier, und es ist also auch hauptsächlich hier, wo so vieles auf gut Glück und mit dem Takte des Urteils vollbracht werden muß.
596. Dieser Charakter der Führung steigert sich immer mehr, je weiter das Gefecht vorrückt, denn um so weiter hat sich der Zustand von dem ersten, der uns bekannt war, entfernt.
597. Je länger das Gefecht gedauert hat, um so mehr Zufälle (d. h. Ereignisse, die außer unserer Berechnung liegen) haben darin stattgefunden, um so mehr ist alles aus den Fugen seiner Ordnung gewichen, um so milder und verworrener sieht es hier und da schon aus.
598. Je weiter aber ein Gefecht vorgerückt ist, um so mehr häufen sich die Entscheidungen, um so näher rücken sie aneinander, um so weniger Zeit bleibt zur Überlegung.
599. So kommt es, daß auch die höheren Glieder nach und nach – besonders für einzelne Punkte und Augenblicke – in die Region hinabgezogen werden, wo persönlicher Mut mehr gilt als Überlegung und fast alles ausmacht.
600. Auf diese Weise erschöpfen sich in jedem Gefechte die Kombinationen immer mehr, und zuletzt ist es fast der Mut allein, der noch kämpft und wirkt.
601. Wir sehen also, daß es der Mut und die von ihm erhöhte Intelligenz sind, welche die Schwierigkeiten auszugleichen haben, die dem Handeln in der Führung entgegentreten. Wie weit sie das können oder nicht, ist darum nicht die Frage, weil es beim Gegner ebenso aussieht, unsere Fehler und Mißgriffe also in der Allgemeinheit der Fälle durch die seinigen ausgeglichen werden. Aber worauf es sehr ankommt, das ist: dem Gegner in Mut und Intelligenz, vor allem aber in dem ersten, nicht nachzustehen.
602. Es gibt indes noch eines, was hier von großer Wichtigkeit ist: es ist der Takt des Urteils. Dies gehört nicht bloß dem angeborenen Talent, sondern hauptsächlich der Übung an, welche mit den Erscheinungen vertraut und das Auffinden der Wahrheit, also das richtige Urteil, fast zur Gewohnheit macht. Hierin liegt der Hauptwert der Kriegserfahrung und das große Übergewicht, welches sie dem Heere geben kann.
603. Endlich haben wir noch zu bemerken, daß, wenn die Umstände in der Gefechtsführung immer dem Näheren eine überwiegende Wichtigkeit vor dem Höherstehenden oder Entfernteren geben, dieser Fehler in der Ansicht der Dinge nur dadurch gutgemacht werden kann, daß der Handelnde in der Ungewißheit, ob er das Rechte getroffen hat, seine Handlung zum Bestimmenden zu machen sucht. Dies geschieht, indem er alle möglichen Erfolge, die daraus zu ziehen sind, wirklich erstrebt. Auf diese Weise wird das Ganze, welches immer von einem hohen Standpunkt aus geleitet werden sollte, da, wo dieser nicht zu gewinnen war, von einem untergeordneten aus einer gewissen Richtung mit fortgerissen.
Wir wollen suchen, dies durch ein Beispiel deutlicher zu machen. Wenn ein Divisionsgeneral in dem Gewirre einer großen Schlacht aus dem Zusammenhang des Ganzen herausgekommen und ungewiß ist, ob er noch einen Angriff wagen soll oder nicht, so wird er, wenn er sich zum Angriff entschließt, allein darin eine Beruhigung für sich und das Ganze finden können, daß er dahin strebt, nicht allein mit seinem Angriff durchzudringen, sondern auch einen Erfolg zu erhalten, der, was sich auch unterdes auf anderen Punkten Schlimmes zugetragen haben mag, alles wieder gutgemacht.
604. Ein solches Handeln ist das, was man im engeren Sinne ein entschlossenes nennt. Die Ansicht also, welche wir hier geben, daß auf diese Weise allein das Ungefähr beherrscht werden kann, führt zur Entschlossenheit; diese bewahrt vor halben Maßregeln und ist die glänzendste Eigenschaft in der Führung eines großen Kampfes.