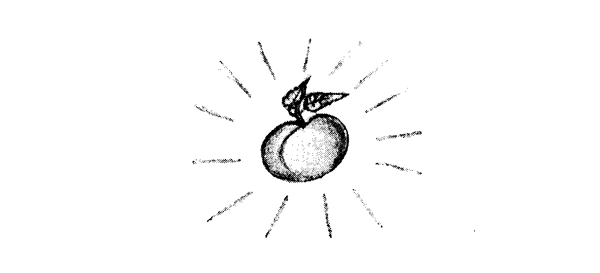|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Mittlerweile entfernten sich Schapian und Sajo immer weiter von den Sprechenden Wassern, und ihr Vater wußte nichts von ihnen. – –
Tschikanii erlebte sein Schicksal.
Während der vier oder fünf Tage, die der Händler mit seinen indianischen Kanuführern zur Rückkehr in die Handelsniederlassung brauchte, ging es dem kleinen Biber nicht schlecht. Einer der Indianer versorgte ihn getreulich mit Wasser und Nahrung. Tschikanii konnte aber nicht begreifen, weshalb Bruder Tschilawii und Sajo und Schapian nimmer bei ihm waren. Er fühlte sich verlassen und klagte nach seiner Beschützerin, die in solchen Fällen immer herbeigeeilt war und gute Worte gesprochen hatte. Jetzt kam nicht sie, sondern ein Fremder, der nur das Wasser wechselte oder frisches Futter brachte. Dieser Fremde schaffte Tschikanii auch auf dem Dampfboot zur Eisenbahn und sandte ihn weiter. Die Kiste stand ein Weilchen auf dem Bahnhof, und Tschikanii glaubte, wieder daheim zu sein, und schrie, um herausgelassen zu werden. Er dachte, nun müßten seine Spielgefährten herbeistürzen und ihn aus der dumpfen Kiste nehmen. Niemand kam. In seiner Not fing er an, sein Gefängnis zu benagen. Rauhe Stimmen schrien auf ihn ein. Dann versuchte er, die Wände hochzuklettern, sie waren aber zu hoch, und die Fremden brüllten noch ärger und klopften an das Holz. Jetzt fürchtete Tschikanii sich wirklich, rührte sich nicht mehr und klagte nur leise vor sich hin. wo war Sajo, wo war Tschilawii?
Etwas später wurde er in den Zug geladen, der viele Stunden lang dahinfauchte und -rumpelte. Als der Zug anfuhr, vergaß er die Ohren zu schließen, Die Biber können die Gehörgänge verschließen und tun es auch, um Wasser und unangenehme Geräusche abzuhalten. so daß ihn das Getöse fast von Sinnen brachte. In seiner furchtbaren Angst versuchte er, durch den kleinen Wasserbehälter in die Freiheit zu tauchen und warf ihn dabei um. So kam zu seiner übrigen Not auch noch quälender Durst und ein grabender Hunger. Krank, hungrig, einsam, von Angst gepeinigt versuchte er immer wieder, ein Loch in das Holz zu nagen. Beinahe wär's ihm auch gelungen, aber er brach sich an einem herausstehenden Nagel einen Zahn ab; das tat sehr weh. Die dünne Lagerstreu wurde verschmutzt; die Stöße des fahrenden Zuges warfen ihn gegen die harten Gefängniswände; Tschikanii war ganz zerschlagen. Wohl versuchte er, sich in der Mitte zu halten, aber es gelang ihm nicht. Ein Zugschaffner meinte es gut mit ihm und warf sein Frühstücksbrot in die Liste. Doch als der kleine Biber Hilfesuchend die Menschenfinger umklammerte, glaubte der Mann, Tschikanii wolle ihn beißen. Von da ab gab man ihm weder zu fressen noch zu trinken. –
Nach vielem Halten und Wiederanfahren und einer grausam rauhen Fahrt auf einem schlecht gefederten Handwägelchen wurde es plötzlich wohltuend still. Der Kistendeckel flog hoch und eine starke, aber gute Hand faßte nach seinem Schwanz; eine zweite folgte und legte sich um seine Brust, und dann wurde er herausgehoben. Matt ließ der Kleine den Kopf hängen. Ein Zeigefinger streichelte die winzigen Pfoten, eine tiefe Stimme sprach beruhigend auf ihn ein. Tschikanii fühlte sich beinahe geborgen. Hände und Stimme gehörten dem Tierpfleger des Zoos, wo Tschikanii seine künftigen Tage verbringen sollte. Der Mann verstand etwas von Tieren und Tierpflege. Als er seinen neuen Gast untersuchte und sah, wie schmutzig der war – Tschikanii, der sich immer so sauber gehalten hatte! – packte ihn die Wut; er ließ sie an dem Botenjungen aus, der doch garnichts dafür konnte.
»Kein Wasser, nichts zu fressen, trockene Füße, trockener Schwanz, heiße Nase, alle Zähne hin! Wenn das keine Schweinerei ist!! – Wart, kleiner Bursche, wir werden dir schon helfen!« Tschikanii fand sich bald in einem Gelaß, einer unfreundlichen Behausung mit einem harten, leblosen Boden; es war ein von dicken Eisenstäben umgebener Käfig, der reinste Bärenzwinger.
In diesem Gefängnis sollte Tschikanii, der gutmütige Tschikanii, sein ganzes Leben verbringen, gefangen wie ein böses, reißendes Tier. Fürs erste merkte er nichts davon, denn er roch Wasser! Ein kleiner, klarer Teich glänzte ihm entgegen. Ob klein oder groß, er enthielt Wasser! Tschikanii stürzte sich kopfüber hinein und trank durstig. Der ausgetrocknete, rissige Schwanz, die brennenden Füße sogen das köstliche, lebenspendende Naß auf, die Schmutzkruste, die das Fell verklebte, löste sich. Tschikanii fühlte sich wie neugeboren. Nach drei Tagen voll Lärm, voll Hunger, voll Schmutz und tiefstem Elend schwamm er wieder umher. Der heiße, fiebrige Körper kühlte ab, und alle die Beulen und Male hörten auf zu schmerzen, als das kühlende Wasser seine heilende Arbeit an dem zerschlagenen Leib verrichtete.
Tschikanii hielt den »Teich« für ein Tauchloch. Dort unten am Grund mußte die Ausfahrt und ohne Zweifel auch die Freiheit, die Heimat, Bruder Tschilawii und die beiden Freunde sein. Bruder Tschilawii würde ihm entgegenpurzeln, und Sajo würde ihn in die Arme schließen, zärtliche Worte ins Ohr flüstern und sein Kinn kitzeln.
Tschikanii nahm alle Kraft zusammen – und tauchte. Hart schlug der Kopf gegen den harten Betongrund. Fast bewußtlos vor Schmerz kam der Kleine wieder an die Oberfläche und versuchte es von neuem, wieder der schmerzhafte Widerstand. Verzweifelt biß und kratzte das Tierchen, um einen Weg zu bahnen; es mußte doch ein Gang ins Freie führen! Aber Tschikanii zerbrach sich nur Zähne und Klauen. Erschöpft kroch er aus dem Wasser, schlich zum Gitter hinüber und versuchte sich zwischen die Stäbe zu drängen, sie standen aber zu dicht. Seine zerbrochenen Zähne, mit denen er die Stäbe durchnagen wollte, ritzten kaum das Metall. Von wilder Verzweiflung geschüttelt rannte er rund umher, immer rund herum, hielt bald da, bald dort und fing zu graben an. Alles umsonst. Lange, lange Zeit mühte sich das arme Tier, das sein Unglück nicht begriff. Endlich sah es das Nutzlose seiner Bemühungen ein: es gab kein Tauchloch, und nirgends führte ein Weg ins Freie. Niedergeschlagen und ohne Hoffnung legte Tschikanii sich platt auf den heißen, harten Boden und klagte, klagte wie in jenen glücklichen Tagen, wenn er sich einsam fühlte und Sajos Tröstungen wollte. Damals ward ihm Erfüllung, damals war das sein Schlummerlied, mit dem er sich in Schlaf lullte.
Der freundliche Pfleger sah ihm lange zu und schüttelte dann den Kopf. »Schlimm, schlimme Sache, armer Kerl«, murmelte er. Seine Arbeit bestand darin, die eingelieferten wilden Tiere vertraut zu machen. Er tat es gerne, weil er ein Herz für die stummen Geschöpfe besaß, und trotzdem haßte er manchmal seine Pflicht. Er sah nicht das »wilde Tier«, sondern nur hoffnungslose, unglückliche Geschöpfe, die der Liebe bedurften. Dieser einfache Mann wußte, daß der soviel größere und stärkere Mensch, mit seinem überragenden Wissen, gütig sein und ihnen helfen soll, so gut und soviel er kann. Der kleine Biber, der um seine Freiheit kämpfte, tat ihm herzlich leid, denn Tschikanii war nicht der erste seiner Art, den er in Obhut nahm. Er kannte ihr gutmütiges, freundliches Wesen. Als er den Jammer des verzweifelten Tierchens nicht mehr länger mit ansehen konnte, trat er in den Käfig und hob es behutsam auf. Tschikanii fühlte die Güte und nestelte sich schutzsuchend in die starken Hände, sie waren viel freundlicher und wärmer als der harte Beton.
Tschikanii wurde in die Wärterwohnung getragen, wo drei Kinder dem Vater neugierig entgegensahen. Groß war das Geschrei, als sie den kleinen Gast entdeckten, so daß Tschikanii von neuem erschrak und sich im Kittel des Mannes verstecken wollte. Nachdem einigermaßen Ruhe eingetreten war, setzte der Vater seinen Schützling behutsam auf den Fußboden. Tschikanii, der wieder ein Dach über dem Kopf, eine Behausung fühlte, wurde ein ganz klein wenig zutraulicher. Erwartungsvoll stand die Familie herum und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Die Frau des Wärters fuhr zärtlich über den Pelz.
»Armer, kleiner Kerl! Wie mager er ist. John«, wandte sie sich an den Ältesten, »hol mal rasch einen Apfel. Die andern Biber waren immer so versessen drauf.«
John sauste ab und kehrte mit einem schönen runden Apfel wieder, den er vor Tschikanii niederlegte. Dieser schnupperte mißtrauisch, denn es war der erste Apfel seines Lebens. Gut roch das Ding, gut, und er hieb seine zerbrochenen Zähne in die saftige Frucht. Es schmeckte, es schmeckte sogar herrlich! Die kleinen Händchen hielten fest, und bald war die größere Hälfte verspeist. Ein zufriedenes Lächeln erhellte die Züge des Pflegers. Fein war das, der kleine Kerl fraß. »Kinder, der kommt durch.« Alle strahlten und lachten über den kleinen, komischen Burschen, der wie ein braunes Erdmännchen vor ihnen saß und den Apfel vertilgte.
»Na also! Hab ich's nicht gewußt?« freute sich die Mutter, »sicher kriegen wir ihn durch.«
Ihr Mann eilte rasch zum Käfig hinüber und holte die frischen Pappeltriebe, die Tschikanii nicht angesehen, geschweige denn berührt hatte. Nun fraß er sie aber auf, und die Kinder staunten ein übers andere Mal, wie er die Leckerbissen mit den Händen ins Maul schob. Tschikanii, der sich nun bedeutend besser fühlte, begleitete die langentbehrte Mahlzeit mit zufriedenen Lauten.
»Hört doch, hört doch nur! Grad wie ein kleines Kind. Vater, laß ihn heute da, in der Küche.« Auch die Mutter meinte: »Ja, laß ihn ein wenig hier. Draußen ist doch kein Mensch. Grad, als würde man ein Kind ins Gefängnis stecken.«
»Hast vielleicht recht«, meinte der Mann. »Heute Nacht bleibt er da.«
Tschikanii erhielt ein Lager, der Wärter stellte eine Wasserschüssel auf den Boden, stülpte eine große Kiste um, mit der Öffnung auf der Seite, tat frisches Stroh hinein und setzte Tschikanii in die entstandene Herrlichkeit. Dort verbrachte er die erste Nacht, vielleicht nicht besonders glücklich, aber sehr bequem.
Am nächsten Morgen wurde er wieder in seinen Käfig gesetzt. Am Abend jedoch, nachdem die Besucher fortgegangen waren, wanderte er wieder in die Küche des Wärterhauses zurück. So verging ein Tag nach dem andern. In der Küche fraß und schlief er, verzehrte seinen täglichen Apfel, der zwar manchen Kummer linderte, aber nicht alle Sorgen vertrieb, denn Tschikanii mußte, solange sein Leben währte, einsam und verlassen bleiben, wenn nicht ... Die Biber haben von allen nordamerikanischen Tieren wahrscheinlich das beste Gedächtnis. Jeden Morgen bot sich den Augen der Hausfrau eine ziemlich durcheinandergeratene Küche dar. Geschälte Stöcke, abgeschnittene Zweige, Blätterreste schwammen in Wasserlachen, aber niemand machte ihm einen Vorwurf, die Familie liebte ihn, und er gehörte, soweit die Menschen in Frage kamen, bald dazu.
Mit der Zeit lernte er die Menschen kennen, die sich seiner annahmen. Den Kindern erschien er als ein gutmütiges, wolliges Spielzeug, und er ließ sich's gefallen. Freilich, er war nicht mehr der alte Tschikanii und mochte nicht immer spielen. Still legte er sich in die Kiste, und sein kleines, sorgenbeladenes Herz sehnte sich nach den alten Spielgefährten an den Sprechenden Wassern.
Tschikaniis Zähne waren wieder nachgewachsen und zu lang geworden. Eifrig knirschte und schliff er sie aneinander, daß es ratterte. Seinen Pelz, den er eine Zeitlang vernachlässigt hatte, kämmte und pflegte er nun jeden Tag, und die kleine Gestalt, vor kurzem noch ein von schlottriger Haut umgebenes Knochenhäuflein, rundete sich wieder. Er war beinahe wieder der Alte, aber nur beinahe.
Solange er seine »Arbeitszeit« im Käfig absaß, war er wirklich unglücklich. Sein Pfleger wußte das und hatte jedesmal, wenn er den Kleinen in den Käfig setzte, ein schlechtes Gewissen.

In diesem Gefängnis aus Eisen und Beton sollte er sein Leben verbringen
Gedrückt hockte das Tierchen im Gefängnis und starrte traurig dem Davongehenden nach. Zwanzig Jahre oder mehr wird ein Biber alt, überlegte der Mann, zwanzig Jahre in diesem Loch – nein, man hat nicht recht an dir gehandelt. In zwanzig Jahren sind meine Kinder groß und ausgeflogen, und ich werde nicht mehr da sein. Aus dem Nest wird eine Großstadt werden, und du wirst immer hinter Gittern sitzen und durch die Stäbe starren. Und warum? Nur damit dich gedankenlose Menschen ein paar Minuten lang anglotzen können, wenn sie dich überhaupt angucken. Solche und ähnliche Gedanken beschäftigen den stillen, nachdenklichen Mann, der seinen Pfleglingen gut war. So oft er Tschikanii mit seinen Kindern spielen sah, wünschte er, ihm zu helfen. Soweit es an ihm lag, wollte er den Gefangenen glücklich machen und solange es irgend anging, in der Wohnung behalten.
Tschikanii gab sich noch nicht verloren, an einer Hoffnung hielt er lange fest. Irgendwann und irgendwie mußte Bruder Tschilawii kommen. Früher war er doch auch immer herbeigestürzt, um nach dem Gefährten zu sehen. Tschikanii hatte es nicht vergessen und suchte ihn unverdrossen, einmal im kleinen Holzverschlag, der im Käfig stand, das andere Mal in der Wärterwohnung. Einmal mußte er ihn finden. Nach einem Monat voller Enttäuschungen verlor er den Mut und suchte nicht mehr.
Hunderte Kilometer entfernt tat Bruder Tschilawii dasselbe und auch vergeblich. – –
Tschikanii war eben daran, sich endlich ein bißchen heimisch zu fühlen. Da ereignete sich das Schlimmste, was geschehen konnte, und doch etwas, das seinem heißesten Wunsch nahekam. Eines Tages ging eine Indianerfrau mit einem bunten Kopftuch vorüber. Tschikanii rannte, aufs höchste erregt, ans Gitter und streckte kläglich schreiend die Ärmchen durch die Stäbe, voll Angst, daß die Frau vorübergehen könnte, ohne ihn zu beachten. Sie blieb erstaunt stehen und sprach zu ihm. – Dieselben Laute, die er draußen im Indianerland tagtäglich gehört hatte, aber nicht die Stimme, nicht die Stimme. – Prüfend blickte er in das Braungesicht, nahm die Witterung auf und trottete müder und mutloser als je in seinen Verschlag. Sajo hatte er erwartet, und sie war es nicht.
Diese Enttäuschung, so böse sie auch war, senkte neue Hoffnung in sein Herz. Von jenem Tag an musterte er die Menschen. Die Nachmittage brachten viele Besucher, und fast alle blieben auch vor seinem Käfig stehen. Man wollte doch wissen, wie so ein Biber aussah. Tschikaniis »Kunden« verweilten jedoch nicht lang. Soso, ein Biber. Na ja, ganz nett, sieht aus wie ein junger Hund und hat einen Plattschwanz. Die einen guckten gleichgültig, die andern neugierig; der eine zeigte mit dem Stock und gab – wie Tschikanii sich einbildete – drohende Laute von sich. Wenige, nur ganz wenige fühlten Mitleid und schenkten ihm Erdnüsse und Zucker, und keiner roch nach Sajo. Tschikanii hoffte immer noch, blickte in jedes Gesicht, beroch jede Hand, die sich ihm entgegenstreckte. Nichts, keine Sajo. wann würde ihre Stimme wieder »Tschika-niii!« rufen, wann eine kleine, zärtliche Hand über seinen Pelz streicheln, wann durfte er seine feuchte Nase wieder in jene köstlich warme, weiche Halsgrube bohren und schnaufen und blasen und schlafen – und vergessen?
Stundenlang, tagelang harrte und hoffte er, und wenn er in seiner Kiste lag, dachte er halb bewußt, halb unbewußt an die vergangene glückliche Zeit, an sein und Bruder Tschilawiis Gemach unter Schapians Schlafbank, an das verrückte kleine Biberhaus und an all die Taten, die sie so einmütig vollbracht und verbrochen hatten. Die tägliche Enttäuschung seiner Hoffnung drückte ihn zuletzt doch noch nieder, das Fünkchen erlosch; er mochte nicht mehr spielen, vernachlässigte seinen Pelz, fraß nicht mehr, hielt seinen Apfel, ohne davon abzubeißen, ließ den Kopf hängen, schloß die Augen und atmete schnell und schwer.
Der Pfleger wußte sich nicht mehr zu helfen. »Ich brauch mir nicht mehr den Kopf zerbrechen. Der Kleine lebt gewiß keine zwanzig Jahre.«
Tschikaniis Nase war heiß und trocken, er fieberte. In den Halbträumen, die sein kleines Hirn umnebelten, sah er die Spielgefährten ganz deutlich vor sich. Das ist gewiß wahr; auch die Tiere träumen, böse Träume und – wie man an ihrem schlafbefangenen Grunzen und Schmatzen merken kann – auch gute.
Eines Nachts erwachte er aus einem so wirklich scheinenden Schlafbild, daß er aufstand und wimmernd in der Küche umherlief. Als er die Gesuchten nicht fand, packte ihn der Schmerz so stark, daß er sich nicht mehr beruhigen konnte und unaufhörlich schrie.
Er wußte nicht und konnte auch nicht wissen, daß kaum zwei Kilometer entfernt ein anderer kleiner Biber in einem ähnlichen Raum den Morgen erwartete. Mit ihm warteten zwei Indianerkinder: ein vierzehnjähriger stolzer, aufrechter Junge und ein jüngeres Mädchen mit einem bunten Kopftuch. In einer Ecke stand ein wohlbekanntes, ziemlich mitgenommenes Körbchen aus Birkenrinde.