
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
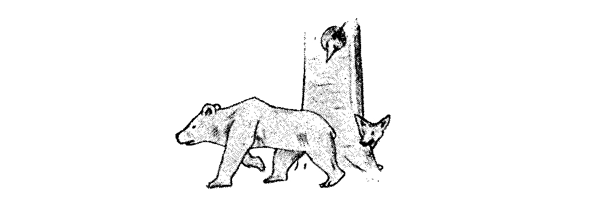
Weit hinter Stadt und Ackerland, hinter den letzten Niederlassungen Nordkanadas liegt ein wildes, fast unbekanntes Land. Wer es erreichen will, muß über Berge und Täler in fernste Fernen wandern; dort gibt es keine Eisenbahnen, keine Straßen, weder Häuser noch Hütten, weder Weg noch Steg. Und zuletzt müßte der Wanderer in ein Kanu steigen und sich der führenden Hand eines Indianers anvertrauen und durch ein unermeßlich großes, aus Wäldern, Seen und Flüssen bestehendes Reich ziehen, in dem Elch und Hirsch, Bär und Wolf wild und frei hausen und große Karibuherden (Kanadisches Renntier) über Land wandern, viele, viele, unzählige Karibus.
Und dort in jenem herrlichen Nordland tritt uns Nordamerika entgegen wie es war, ehe der weiße Mann kam und wie es – hoffentlich – noch viele kommende Jahre bleiben wird. Nur wenige Weiße leben dort, meistens Fallensteller und Pelzhändler, und außer ihnen da und dort ein paar Indianersippen vom Stamm der Odschibwä. Sie haben sich dieses Land zur Heimat erkoren und nennen es Ki-wä-din, das Land des Nordwestwindes. Die Odschibwä sind ein Teil einer Menschenrasse, die so alt ist und so lange in diesem Land wohnt, daß niemand, nicht einmal sie selbst, wissen, woher und wie sie hereingekommen sind. Dort oben kann sie die Zivilisation, der Fortschritt nicht mehr erreichen, dort leben und sterben sie wie ihre Vorväter, als Jacques Cartier vor 400 Jahren an den Nordlandgestaden landete. Ihre Dörfer mit den spitzen Tipis und den vereinzelten, länglich-niederen Blockhütten kann man heute noch finden. Sie liegen in windgeschützten Hainen und sonnigen Waldblößen oder an klaren Waldseen, oft viele, viele Kilometer voneinander entfernt. In jenen kleinen Dörfern leben die indianischen Familien, jede in ihren eigenen vier Wänden. Sie sind glücklich und gut genährt in fetten Zeiten und hungrig, wenn die Tage schlecht sind und mager. Es geht ihnen genau wie den Menschen in den Städten, heute Fülle, morgen Not.

In solchen kleinen, an freundlichen Seeufern errichteten Dörfern leben die Indianer
Im Indianerdorf muß jeder arbeiten, sogar die Kinder. Arbeit hängt meistens mit Reisen und Wandern zusammen, denn die Indianer sind immer auf dem Wanderpfad. Es gibt Zeiten, da die Tiere, von denen der Indianer abhängt, aus der Gegend fortziehen, einfach verschwinden, und dann müssen die roten Menschen ihnen folgen, wenn sie nicht verhungern wollen, oder ganz neue Jagdgründe suchen. So kommt es, daß das Dorf immer wieder abgebrochen werden muß. Die wenigen Blockhütten bleiben natürlich stehen, aber sonst wird alles abgebaut und in die Kanus gepackt oder – im Winter – auf die Toboggans geladen. Und dann geht das Wandern an, oft viele, viele Kilometer weit. Auf den Winterreisen helfen Buben und Mädchen den Pfad bahnen. Sie schnallen sich die Schneereifen an die Füße und bahnen den nachfolgenden Hundeschlitten und den von den Erwachsenen gezogenen Toboggans einen Weg durch den tiefen Schnee. Sie brechen den Pfad und sind stolz darauf. Im Sommer paddeln sie mit den Großen in den Kanus, und jedes Kind hat seine Last, sein Stück Gepäck, das es über die Portages (auf deutsch Tragestellen Portage, das zwischen zwei schiffbaren Wasserwegen liegende Land, über das Boote, Waren und Lasten von einem zum anderen schiffbaren Wasserlauf getragen werden. befördern muß. Sie freuen sich ihrer Arbeit und verrichten sie so ernst und gewissenhaft wie ihre Eltern.
Die Indianerkinder, die den Sommer in der Nähe einer Pelzhandels-Niederlassung oder in einer Reservation verbringen, können in die Schule gehen und sind oft sehr gute Schüler. Gar mancher Indianerjunge ist später Rechtsanwalt oder Schriftsteller oder Künstler geworden. Diejenigen jedoch, die das ganze Jahr draußen in der wilden, freien Natur leben, gehen auch in die Schule, aber in eine ganz andere. Ihre Schule ist der Wald, und dort lernen sie alles, was sie auf ihrem Lebensweg brauchen. Erdkunde, Geschichte, Rechnen oder Englische Sprache nützen ihnen im Wald gar nichts; dafür beobachten und lernen sie, was im Pflanzenreich vorgeht, wie die Tiere sich verhalten, wie man sie beschleicht, wie man den Fisch fängt und wann. Und dann noch das Allerwichtigste: die Kunst, bei jedem Wetter Feuer zu machen, mag es regnen, schneien oder stürmen. Sie lernen Vogel- und Tierstimmen kennen und nachahmen. Die Großen lehren ihre Kinder, die Bewegungen, Launen und Strömungen des Wassers in den Flüssen und Seen beobachten. Man unterweist sie, wie man mit den Schneereifen, mit Axt und Gewehr umgeht, wie man ein Hundegespann lenkt, wie man Mokassins näht, Häute gerbt und Feuerholz findet, auch dort, wo scheinbar gar keins vorhanden ist. Und alle, Knaben und Mädchen, müssen kochen können! Ein Kompaß ist ihnen unbekannt, und trotzdem können sie kreuz und quer durch die Wälder und durchs Land ziehen, denn sie richten sich nach Sonne, Mond und Sternen, nach der Gestalt der Bäume, nach den Umrissen der Berge, nach dem Benehmen der Tiere und nach vielen anderen Zeichen. Ihr Wissen vom Wald ist so groß, daß sie bald selbständig werden und auf eigene Faust lange Reisen machen und vielen Gefahren mutig ins Auge blicken, so wie Schapian und seine Schwester Sajo, von denen ich berichten will.
Ein Indianerleben ist hart und mühsam, darum kann man Müßiggänger im Indianerdorf nicht brauchen. Wer zu faul ist, um auf die Jagd zu gehen, steht bald ohne Nahrung und ohne Kleider da und ohne ein Dach über seinem Kopf. Gewiß, der Indianer hilft seinem Nebenmenschen mit allem, was er hat, aber Faultiere kann er einfach nicht ertragen. Obwohl das junge Volk viel Arbeit hat, finden Knaben und Mädchen trotzdem Zeit für ihre einfachen, aber lebhaften Spiele. Und wenn der Arbeitstag zu Ende ist, sitzen sie draußen unter dem glitzernden nördlichen Sternhimmel rund um das Feuer gelagert und lauschen den Erzählungen der Großen. Diese Geschichten berichten von Jagdzügen, von andern, fernen Indianerstämmen, von großen Männern der Vergangenheit, von seltsamen Abenteuern und Erlebnissen in den dunkeln Wäldern. Doch die seltsamsten Geschichten erzählen diejenigen, die das Wunderland im fernen Süden besucht haben, das Land, aus dem die Weißen kommen, wo es große, große Räderschlitten gibt, die schnell wie der Wind über eine eiserne Spur sausen, wo rauchende Kanus – die Dampfschiffe – beinahe ebenso schnell wie der Räderschlitten durchs Wasser flitzen, und wo es keine Indianer, wenig Bäume, dafür aber Reihen und Reihen großer Steinhütten gibt. So viele Steinhütten, zwischen denen die Weißen allein, zu zweien und in großen Klumpen gehen, eilen und jagen. Welch ein Land, o welch ein Land, wo man ohne Geld weder schlafen kann, noch etwas zu essen bekommt! Und das können sie nicht fassen, denn der Waldwanderer ist immer erwünscht, wenn er ruhen oder essen möchte. Der weiße Fallensteller heißt ihn an seinem Feuer ebenso willkommen wie der Indianer, und der Gast hat nichts zu bezahlen. Diese Indianerkinder wissen vom Stadtleben ebenso wenig wie ihre Eltern. Und ihr wißt nichts vom Leben in der Wildnis.
Und nun will ich, der ich einer der ihren bin, eine Geschichte aus der Wildnis erzählen.
Ehe ich beginne, müßt ihr wissen, daß diese große, geheimnisvolle Waldwildnis mit ihren seltsamen Menschen und Tieren von vielen gewaltigen Strömen und Flüssen durcheilt wird. Diese Wasserwege dienen nicht nur den Indianern und ihren flinken Kanus als »Landstraße«, sondern auch vielen wasserliebenden Tieren wie Biber, Fischotter, Nerz und Bisamratte. Dieses herbe, strenge Waldland wird von zahllosen Pfaden durchzogen, Pfaden, die ihr nie finden würdet und auf denen dennoch die Landtiere wandern wie auf einer angelegten Straße. Sie wandern immer, diese Geschöpfe Gottes, und sind, wie die Menschen des Landes, immer beschäftigt. Sie müssen ihre Nahrung suchen, ihre Jungen füttern und aufziehen. Die einen leben für sich allein ohne ständiges Zuhause, andere halten zusammen und bewohnen große, unterirdische Städte mit Familienhöhlen, die durch Gänge oder Straßen miteinander verbunden sind. Die klügsten unter ihnen, die Biber, bauen sich warme Häuser, legen Wasserbehälter an, in denen sie umherschwimmen können, sammeln große Nahrungsvorräte für den langen Winter und schaffen und werken fast wie die Menschen. Und wenn sie von der Arbeit ausruhen, sprechen sie miteinander. Und so haben alle Tiere, jedes nach seiner Art, viel zu tun und zu sorgen.
Weil sie so klug und fleißig sind, hat sie der Indianer achten gelernt. Leider muß er sie manchmal töten, aber nur, weil auch er leben muß. Er nimmt großen Anteil an ihrem Tun und Treiben und sieht sie fast wie einen andern Menschenstamm an. Und ganz besonders die Biber, die haben es ihm angetan. Mancher rote Mann kann bis zu einem gewissen Grad ihre Sprache verstehen, denn ihre Stimme ist der des Menschen nicht ganz unähnlich. Alle Tiere, mögen sie noch so klein und wertlos scheinen, haben ihren Platz auszufüllen. Keines ist umsonst da.
Das weiß der Indianer, und darum läßt er sie, wenn er es nur irgendwie kann, in Ruhe und Frieden. Und weil sie mit ihm die Mühsal des Lebens in der Wildnis teilen, heißt er sie »Kleine Brüder«. Wie oft sieht man einen kleinen Bären, einen jungen Biber, ein Fischotterchen oder ein Elchkälbchen frei durchs Indianerdorf toben. Sie könnten gehen, wenn sie wollten, niemand würde ihnen die Freiheit verwehren, aber sie bleiben, wo sie sich zuhause und geborgen fühlen. Eines Tages sind sie erwachsen, und dann ist der Ruf der Wildnis stärker als alle Bande, und sie ziehen fort, ihrem eigenen Leben entgegen. Und das Indianerdorf? Oh, das hat bald wieder irgendeinen kleinen Liebling.
Nun wißt ihr, wie das Land aussieht und wie die Indianer leben. Ihr habt etwas von den Tieren des Landes erfahren, und nun will ich von dem »kleinen Volk der Wälder« berichten. Eine wahre Geschichte; sie begann an einem kleinen Gewässer, an dem eine glückliche Biberfamilie lebte.
Ich werde von einem indianischen Jäger, von seinem Sohn und von seiner Tochter erzählen und von zwei kleinen Biberkindern, die ihre Freunde waren. Ihr sollt hören von ihren Abenteuern in den großen Nordlandwäldern und in der fremden Stadt. Ihr sollt erfahren, welch gute Freunde diese vier waren, wie einer der Kameradschaft verloren ging und wiedergefunden wurde. Ich werde berichten von den Gefahren, die sie bestanden, von den Freuden, die sie erlebten, und wie alles zu Ende ging.
Und nun laßt uns Automobil und Rundfunk vergessen, löschet aus eurem Gedächtnis das Kino und alle Dinge, ohne die wir nicht leben zu können glauben. Wir wollen anderes denken: Kanu, Zelt, Schneereifen und Hundegespann. Laßt uns aufbrechen in jenes ferne, zauberhafte Nordland, wo große Ströme rauschen und stille, klare Seen funkeln, wo dunkle Wälder wogen und seltsame Tiere wohnen, Kleine Brüder, die sprechen und arbeiten. Laßt uns in jenes Reich ziehen, wo aus den Wassern singende Geisterstimmen tönen.
Und dann wollen wir uns in einem braunverräucherten Wigwam am flackernden Feuer niederlassen und der Geschichte lauschen. Höret!
