
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
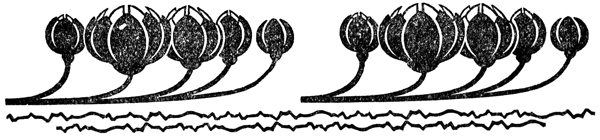
Gott im Himmel, wir auf Erden
Und der König absolut.
Wenn er unsern Willen thut.
Lobt die Jesuiten.
Chamisso.
![]() Pater Ignatius Loyola klopfte an demselben Abend demütig wie ein Bettelmönch an die Pforte von Bärneck. Man ließ ihn ein, musterte sein Habit, führte ihn in den Vorsaal. Er gab seinen Empfehlungsbrief ab und stellte sich in die Fenstertiefe.
Pater Ignatius Loyola klopfte an demselben Abend demütig wie ein Bettelmönch an die Pforte von Bärneck. Man ließ ihn ein, musterte sein Habit, führte ihn in den Vorsaal. Er gab seinen Empfehlungsbrief ab und stellte sich in die Fenstertiefe.
»Die Gnädige ist ausgeritten,« zischte die Zofe.
»Verzeihen Sie, daß ich Ihnen Mühe mache, mein liebes Kind,« sprach der Jesuit.
Die Zofe war ein abgestandenes, halbverdorrtes Frauenzimmer von dreißig Jahren mit langen Schmachtlocken, die, wie vom Regen durchweicht, bis auf die Schultern herabhingen, ein krankhaftes, sommersprossiges Gesichtchen mit gefärbten Augenbrauen. »Bitte, bitte,« sagte sie, den Mund freundlich verziehend, »die Gnädige wird sehr erfreut sein. Man lernt endlich« – sie seufzte bei dem »endlich« – »die Welt kennen. Uns bleibt nur ein Trost, die Religion. Wer uns diese raubt, raubt uns alles. Ich heiße Florette, Hochwürden. Ich glaube das alles nicht, was über Ihren Orden gedruckt wird, ich liebe die Jesuiten, ich bin überhaupt fromm, aus tiefster Ueberzeugung, nicht so wie gewisse Leute.« Sie zog dabei ziemlich überflüssig ihren Busenstreif herauf: Mademoiselle war zwar sehr dekolletiert, aber es war doch überflüssig.
»Und die Gnädige?«
»Die ist auch fromm, recht fromm, nur hat sie noch eine zu große Vorliebe für wilde Pferde und wilde Jungen. Aber was rede ich da! Ach! sie langweilt sich zu Tode die arme Frau, und da sieht sie den jungen Herrn nicht ungern, den Herrn von Bal.«
»Nennt sich Herr von Bal nicht Leon?« fragte der Pater.
»Ganz richtig, und ist der Bruder der jungen Baronin von Moldawetz. Aber das ist alles ganz unschuldig, ganz unschuldig – was werden Sie von mir denken, Hochwürden! Es hätte ja gar keinen Zweck, hier Toilette zu machen, wenn nicht Baron Leon wäre. Das ist alles. Doch da sprengt eben die gnädige Frau in den Schloßhof.« Florette setzte rasch die Lorgnette an die matten grünen Augen. »Sehen Sie doch, Hochwürden, wie süperb sie zu Pferde sitzt, eine magnifique Gestalt, diese filigrane Taille und diese embarassante Fülle! Ich eile ihr entgegen.«
Die Zofe schoß zur Thür hinaus, ihre Locken flogen ihr steif wie der Schwanz eines Papierdrachen nach. »Die ist reif für den Jungfrauenverein,« dachte Pater Loyola.
Frau Aspasia ließ den Jesuiten ziemlich lange warten, sie fand es offenbar nötig, wieder einmal Toilette zu machen. Endlich flogen die Flügelthüren auseinander und Florette führte den feinen Pater durch eine Enfilade von Zimmern in das Boudoir ihrer Herrin. Ein pomphafter Luxus sprach von jeder Wand, aus jeder Ecke zu dem welterfahrenen Manne. Schon vor der Schwelle des kleinen Kabinetts empfing ihn ein süßer, betäubender Duft; wie er dieselbe überschritt, fiel der Thürvorhang geräuschlos zusammen und er sah sich Frau von Bärneck gegenüber.
Aspasia war eine hohe, ebenmäßige Gestalt, die feine Taille etwas künstlich durch ein vorzügliches Mieder ihrer Fülle abgerungen, das schwarze Seidenkleid schnitt allzu scharf in die üppigen Schultern, die stolze Brust. Den unedlen, aber weichen, reizvollen Zügen gab eine meisterhaft aufgetragene weiße Schminke einen Marmorglanz, ein leiser Schimmer von Rot war auf die vollen Wangen gehaucht. Das verdächtig reiche aschblonde Haar fiel in einer prächtigen Unordnung kleiner und großer Locken bis auf den Nacken und schlängelte sich um das kleine zierliche Ohr, das dem Jesuiten augenblicklich ausfiel.
Während er sich artig, aber vornehm vor ihr neigte, ruhten Aspasias Augen vorsichtig, forschend auf ihm. Die Farbe dieser Augen war selbst der Jesuit nicht imstande gleich anzugeben.
Diese Augen lachten so unschuldig blau, sie verschwammen so sehnsuchtsvoll dunkel in majestätischer Melancholie, sie sprühten grüne Flammen, wenn sie zürnten, und hatten einen matt grauen, durchsichtigen Eisglanz, wenn sie kalt und sicher berechneten.
Das kleine Kabinett, in welchem Frau von Bärneck den Jesuiten empfing, war ihre illustrierte Biographie.
Die mit grüner Seide überzogenen Wände, die grünen Vorhänge an Thür und Fenstern dämpften das Licht, welches in dasselbe fiel, und gaben eine milde, dämmerhafte Beleuchtung. In der Fenstertiefe stand ein hoher gotischer Sessel; ein fein geschnitztes Spinnrad, ein paar Blumenstöcke, ein abgegriffenes Gebetbuch vollendeten den Gretchenwinkel.
Die eine Wand nahm eine imposante Trophäe, die Mitte derselben eine Rüstung der Wlasta ein, um welche prächtige Waffen, Beutestücke der Türkenkriege und Folterinstrumente zierlich gruppiert waren. Ein Stahlstich zeigte Ctirad, den Scharka auf das Rad flechten läßt, ein zweiter die Zarin Katharina, wie sie lächelnd den in einem Käfig verwahrten Empörer Pugatschew betrachtet. Ein kunstvoll ausgestopfter Bär, dessen Kopf wie lebendig auf den mächtigen Tatzen ruhte, bildete Drahomiras seltsames Ruhebett, während gegenüber hellenische Plastik aus der Wand quoll, heitere klassische Schönheit Aspasia umgab.
In einer Laube von blühenden Rosen standen die goldenen Stühle der Götter Griechenlands, aus dem dunklen Laub leuchtete der Marmorleib einer Venus, Rosen schlangen sich um ihr Postament, einzelne halboffene Knospen stiegen wie Flammen zu ihr empor, Rosenduft erfüllte das ganze Gemach.
Frau von Bärneck lud den Jesuiten ein, in der Laube ihr gegenüber Platz zu nehmen, sie heftete den Blick vor sich auf den Boden, ihr Auge war tief dunkel. »Sie nennen sich Pater –«
»Ignatius Loyola Kohanowski,« unterbrach sie der Jesuit sanft, doch höre ich am liebsten Loyola, den großen Stifter unseres Ordens, dem ich mit meiner schwachen Kraft nacheifere und nachfolge.«
»Sie werden mir von meiner Freundin Gräfin Bielin auf das wärmste empfohlen. Ich freue mich, Sie beherbergen zu können, und hoffe, daß Sie längere Zeit mein Gast sein werden.«
»Es wird dies vorzüglich von Ihnen abhängen, Frau Baronin.«
»Von mir?«
»Ich habe hier eine Mission zu erfüllen. Von Ihrer Parteinahme hängt das Gelingen oder Mißlingen derselben ab. Sie sind zugleich die schönste und geistreichste Frau der Landschaft, und wer wäre allmächtig, wenn nicht eine schöne Frau?«
»Sie schmeicheln.«
»Niemals, Frau Baronin!« Der Titel that Frau von Bärneck offenbar sehr wohl, der Jesuit bemerkte es und lächelte selbstzufrieden.
»Nun, so will ich auch mit Ihnen offen sein,« entgegnete Aspasia. »Erwarten Sie nicht zu viel von mir. Ich gebe mich, wie ich bin. Ich kann nicht leben, ohne zu lieben, ohne geliebt zu werden. Ich glaube nicht, daß ich Anlage habe, bigott zu werden, aber ich schätze die Jesuiten sehr hoch, ich fühle Sympathie für sie, denn es sind Männer von Geist. Ich habe es nie verstanden, einen Mann ohne Geist zu lieben.«
»Sehr begreiflich.«
Die Dame sah den Pater erstaunt an.
»Und doch,« sagte sie dann, »ist seit einiger Zeit eine Umwandlung mit mir vorgegangen. Ich nehme mehr Interesse als sonst an religiösen Dingen, doch ist dasselbe mehr ein poetisches, als ein Bedürfnis des Gemütes. Sehen Sie also zu, wie Sie in das Boudoir einer verliebten Frau, wie Ihre Mission, Ihre Pläne zu der Rüstung der Wlasta, den blühenden Rosen der Liebesgöttin passen.«
»Vortrefflich, gnädige Frau.«
Aspasia lachte und zeigte zum Erstaunen des Jesuiten zwei Reihen prachtvoller großer Zähne.
Pater Loyola begann sich für sie zu interessieren.
Wieder senkte Aspasia ihre Augen, so daß die langen Goldfäden ihrer Wimpern tiefe Schatten auf die Wangen warfen und den Jesuiten neuerdings mit Bewunderung erfüllten. Und wie diese Augen sich langsam, beinahe schüchtern zu ihm erhoben, schwammen sie in tief dunkler Schwermut, und eine teuflische Selbstanbetung, ein rührender Welthaß sprachen titanenhaft zu ihm. Er verstand diese Augen, er allein.
Ganz zart faßte er die kleine, nervös zitternde Hand der schönen Frau und führte sie an die Lippen.
»Und doch ekelt mich die Welt an,« sprach Frau von Bärneck leise vor sich hin, ich möchte die Menschen mit Füßen treten, ich möchte Gott anklagen. Hat die Unendlichkeit nicht Raum für mich, für meine Wünsche? O, was habe ich vom Leben zuerst innig erbetet, dann leidenschaftlich verlangt und endlich mit Neronischer Ruhe gewaltsam in Besitz genommen, und was ist mir erfüllt worden, was war des Raubes wert! Das Pater Loyola, das allein kehrt mich von dieser Welt von Karikaturen, Gaunern und Narren ab. Ich bin dort angelangt, wo man den Himmel stürmt oder sich ihm in Demut unterwirft.«
Zornige grüne Blitze schossen aus ihren Augen, ihr Arm erhob sich anklagend und drohend.
»Und die Schülerin Schopenhauers sollte sich so übereilt in den Schoß der Kirche flüchten?«
»Die Schülerin Schopenhauers?«
»Sie haben ihn doch eben zitiert.«
Frau von Bärneck sah den Jesuiten an.
»Steht nicht Schopenhauers Philosophie dem Christentum, dessen Lehre vom Elend des Lebens, von der freiwilligen Armut und Entsagung sehr nahe?« »Dem Christentum gewiß, wir sprechen aber von der Kirche.«
Die schöne Frau aber sah den Jesuiten zum zweitenmale überrascht an. Ihre Hand zitterte leise und jetzt erst fühlte sie, daß sie in der seinen lag, und zog sie sanft zurück. Zugleich rauschte die Portière. Florette hüpfte in das Kabinett und bat zum Thee.
Der galante Jesuit bot Frau von Bärneck den Arm und führte sie in den Salon, wo der russische Samowar dampfte, die kleinen Kartoffeln zierliche Rauchwolken aufwirbelten, das Aspik auf Galantineschnitten zitterte und eine poetische Sülze Vanillendüfte versendete. Bald erschien auch Herr von Bärneck. Man begrüßte sich und nahm Platz. Der Schloßherr war ein feiner Mann von mittlerer Größe; die Jahre hatten sein Haupt tüchtig gefegt und ihn dafür stattlich abgerundet. Seine weichen Züge waren formlos geworden, nur sein blaues Auge zeigte noch eine gewisse Lebhaftigkeit. Er füllte seine Tasse mit Zucker, goß Rum darauf und zog dann ein Zeitungsblatt aus der Tasche.
»Was hast Du, Karl?«
»Ueber Land und Meer.«
»Gewiß ein neuer Rebus?«
»Erraten.« Bärneck breitete das Blatt halb auf den Tisch, stützte den Kopf in beide Hände und brütete. Madame plauderte indes mit ihrem Gaste.
»Nimmst Du keinen Thee?« fragte sie nach einer Weile.
»Doch. Ich habe bereits genommen.«
»Du hast nur Zucker und Rum.«
»Richtig! Der verdammte Rebus da – verzeihen Sie, Hochwürden, der macht mich toll.«
»Sie interessieren sich für Rebusse, Herr Baron?«
»So nebenbei.«
»Nebenbei,« lachte Frau von Bärneck; »sie absorbieren seine Seele so vollständig, daß weder für Gott noch Teufel etwas von ihr übrig bleibt.«
Bärneck besann sich, schenkte Thee in seine Tasse, heftete dann seine Augen gedankenlos zuerst auf seine Frau, dann auf den Pater und vertiefte sich wieder in das Blatt.
»Da sehen Sie selbst,« fuhr Aspasia fort, »er hört und sieht nichts, er macht Jagd auf Rebusse, wie ein anderer auf Frauen, es ist auch etwas Don-Juanerie dabei, denn sobald er mit einem fertig ist, stürzt er sich mit der Wut eines Raubtieres auf den zweiten, er abonniert auf kein Blatt, das nicht Rebusse bringt. Ihm ist das ganze Leben nur ein großer Rebus.«
»Das ist es auch,« fuhr Bärneck auf. »Was ist am Ende die Liebe, das immer neue Suchen nach einem unmöglichen Ideal, das Bemühen, eine fremde unbegreifliche Individualität zu enträtseln, zu verstehen? Was ist die Arbeit der Forscher, der Dichter, der Philosophen –«
»Was anders als Versuche, ewige Rebusse aufzulösen,« lachte Aspasia und zeigte ihre großen weißen Zähne.
»Nun, das ist eigentlich Ihr Metier,« wendete sich Bärneck boshaft zu dem Jesuiten.
»Gewiß,« erwiderte dieser, »nur ist das Verdienst nicht so groß, da uns eben die Auflösungen gleich mit gegeben sind. Ihr Scharfsinn bedarf derselben gewiß nicht, Herr Baron?«
»Ich habe bis jetzt jeden Rebus gelöst,« sprach der Schloßherr bewußtvoll.
»Karl!« rief Aspasia, mit dem Finger drohend.
»Jeden!«
»Karl!«
»Nein, richtig. Einen einzigen Rebus habe ich bis jetzt nicht gelöst.«
»Und dieser wäre?« fragte der Pater.
»Meine Frau.«
Der Jesuit lächelte und Aspasia ließ wieder ihre Zähne blitzen. Das illustrierte Blatt wanderte von Hand zu Hand, man riet, erriet, lachte und stritt. Pater Loyola ergötzte sich nebenbei an dem unwilligen Gesichte des liberalen Kammerdieners Manhardt, der eine rote Weste trug, die eine Manschette mit dem edlen Haupte des Johannes Huß und die zweite mit dem Feuerkopfe des Hieronymus zuknöpfte. Als er ihm nach dem Thee über den Gang in sein Zimmer leuchtete, kniff ihn der Jesuit mit seinen langen aristokratischen Nägeln in das Ohr und schenkte ihm dann einen kleinen Rosenkranz aus Brotrinde.
Graue durchsichtige Nebel wälzten sich auf der Erde und stiegen langsam wie Rauchsäulen gegen den Himmel; ein weißer Streifen im Osten, ein Rabe, welcher still durch den Dunst schwamm, ein scharfer Luftstoß, der die Stoppeln bewegte, verkündeten den Morgen, als der Jesuit vorsichtig aus dem Schlosse trat und an den Wirtschaftsgebäuden vorbei den grasbewachsenen feuchten Pfad nach Moldawa einschlug. Ein Hund bellte, ein Rebhuhn flog im Felde auf und fiel zehn Schritte weiter wieder nieder. Es fröstelte den Pater, er zog sein Habit zusammen und barg die Hände gekreuzt in den Aermeln desselben. Mit der Kunst eines Gymnastikers balancierte er über den dünnen Balken, welcher hier den Taborbach überbrückte. In den Erlenbüschen jenseits desselben traf er auf einen Jäger und begrüßte ihn mit »Waidmanns Heil«.
Der zog ehrerbietig verblüfft den Hut und gab dann seinem Hunde einen Fußtritt.
»Sind Sie der Förster von Moldawa?«
»Zu dienen, Hochwürden.«
»Sie erwarten den Baron?«
»Den jungen Herrn, zu dienen. Wir schießen so jeden Morgen unsere Hühner, denn es wird bereits zeitig heiß und da halten sie dann am besten aus.«
»Werde ich den Baron noch im Schlosse treffen?«
»Den Baron Leon, zu dienen.«
Der Förster küßte den Aermel des Paters, welcher hierauf rasch in die stolze Allee riesiger Pappeln bog, die zu dem Herrensitz von Moldawa führte. Vor dem Gitterthor desselben lehnte ein blutjunger Lakai in mausfarbiger Livree, mausfarbigen Gamaschen, durchbrochenen weißen Strümpfen, hielt einen großen schwarzen Wasserhund an der Schnur und zitterte am ganzen Leibe.
»Wo sind die Zimmer des Herrn von Bal?« fragte der Jesuit.
Der Lakai deutete auf ein beleuchtetes Fenster des linken Flügels, seine Kniescheiben schlugen an einander. der Wasserhund saß vor ihm, wedelte den Staub auf und winselte freudig.
»Kann ich ihn sprechen?«
»J – a – a – a,« klapperte der Lakai mühselig heraus.
Die Sonne lag in einem Weizenfelde, ein unförmlicher rotglühender Klumpen, die ersten Lerchen stiegen in den reinen blauen Himmel, goldene Schleier verhüllten den fernen Wald.
Der Jesuit stieg die Treppe empor und klopfte an die braune Eichenthür im Korridor, welche ihm der am hellen Morgen schlafwandelnde Küchenjunge gezeigt hatte. »Er hat starke Backenknochen, er muß sehr gutmütig und sehr verfressen sein,« dachte der Pater, klopfte noch einmal und trat ein.
Ein junger blasser Mann mit dem wehmütigen Gesicht, den fieberhaften Augen einer nervösen Frau, kurzlockigem, braunem Haar saß an einem niedlichen Schreibtisch und tropfte wohlriechendes Wachs auf ein elegantes Billet; indem er sich erhob, um den Pater zu begrüßen, drückte er zugleich rasch sein Petschaft auf dasselbe und ließ es dann in seine Brust gleiten. Der Jesuit übergab seinen Empfehlungsbrief. Leon überflog ihn und lud zugleich den Pater durch eine vornehme Handbewegung ein, Platz zu nehmen. »Sie sind im Begriff, auf die Jagd zu gehen, Herr Baron,« wendete dieser artig ein.
»Nennen Sie das Jagd, in Feld und Büschen streifen, ein paar Hühner schießen?«
»Nun, dann erlauben Sie, daß ich Sie begleite.«
Leon riß mit nervöser Hast an der Glocke. Der Jäger, betreßt, galoniert, und womöglich noch verschlafener als der Lakai und der Küchenjunge, trat in soldatischer Haltung ein.
»Meinen zweiten Lebeda für den hochwürdigen Herrn.«
»Behüte,« rief der Jesuit lächelnd, »ich bitte mich als eine Art Jagdhund mitzunehmen – voilà tout.«
»Wie Sie befehlen.«
Pater Loyola warf noch einen flüchtigen Blick auf den Tisch, auf dem ein zweites Billet lag, dessen Siegel erbrochen war. Dieses Siegel zeigte ein von einem Pfeile durchbohrtes Herz, von einer Guirlande offener Rosen umgeben. »Wie geschmacklos!« dachte er.
»Ein lieber Freund, ein Jagdgenosse empfiehlt Sie mir,« sprach Leon, während sie die Treppe hinabstiegen. »Ach, das waren andere Tage, andere Jagden in Ihrer wilden poesievollen Heimat. Gegen Sonnenaufgang das podolische Getreidemeer, gegen Abend die blauen Nebelriesen der Karpaten. Schöne Frauen schaukelten sich graziös im Sattel, bloßfüßige Bauern trieben mit Haselstöcken Wölfe und Bären, Adler kreisten über unserm Haupte. Ich komme mir oft recht erbärmlich vor, wenn ich die kleinen seidenweichen Hühner schieße. Vor wenig Wochen lief mir eine Rebhenne mit ihren Küchlein über den Weg und ich schwor, nie wieder eins dieser Tiere zu töten. Aber das Leben macht uns alle grausam, und je mehr uns das Dasein unnütz, wertlos zwischen den Fingern zerfließt, um so erfinderischer werden wir, fremdes Leben zu zerstören, und empfinden beim Tode anderer jene süße Wollust, die unser Leben uns versagt.«
»Ihr Gemüt scheint krank, Herr Baron?«
»Nur meine Nerven, würdiger Pater Loyola; nervöse Menschen haben kein Gemüt. Sie sehen, ich bin nicht gewöhnt, mir selbst zu schmeicheln. Wir sind eine Rasse für uns, Langeweile ist unser ganzes Unglück. Alles, was neu ist, fesselt uns, regt uns auf, entzückt uns, versetzt uns in die beste Laune, söhnt uns mit der Welt, mit uns selbst aus. Wie quälen wir uns selbst und andere, wenn es uns an Zerstreuung, an Abwechslung fehlt! Geben Sie mir jeden Tag einen neuen geistreichen Freund, jede Nacht eine neue reizende Geliebte und ich höre auf, Gott zu leugnen.«
Der Jesuit lächelte. Sie standen an dem Gitterthor, der Lakai ließ den Wasserhund los, der ein paar tolle Sprünge machte und laut jubelte, der Jäger reichte seinem Herrn die Flinte. Leon blickte mit halbgeschlossenen Augen gegen die Sonne und ging dann mit dem Jesuiten den Erlenbüschen zu.
Bei seiner Rückkehr traf Pater Loyola Frau von Bärneck, welche eben erst aus dem Bett gestiegen war, vor ihrem Toilettentisch. Sie ließ ihn ohne weiteres ein.
»Eigentlich ist es recht unklug, Pater Loyola,« rief sie ihm entgegen, »daß ich Sie so sehr in meine Karten blicken lasse, alle meine kleinen Künste preisgebe, aber Sie machen ja keinen Anspruch darauf, sich in mich zu verlieben, und Sie verraten mich nicht.«
»Gewiß nicht, nur halten Sie mich um Gotteswillen nicht für einen Neuling. Soll ich Ihnen die französische Firma nennen, von der Sie Ihre Vampyrblässe und den Rosenhauch Ihrer Wangen beziehen?«
Frau von Bärneck warf sich laut lachend über die Lehne zurück und zeigte diesmal zugleich die prachtvollsten Zähne und die niedlichsten Füße.
»Dieses Fläschchen, gnädige Frau, welches Sie so sorgfältig vor mir zu verbergen suchen, ist ein von allen medizinischen Autoritäten sanktioniertes, ganz kostbares Fleckwasser, und es sind diese zwei kleinen braunen Flecke auf Ihrer Götterstirn, welche Sie bisher erfolglos mit demselben bekämpfen und weit glücklicher mit weißer Schminke und ein paar losen Löckchen zu verhüllen wissen.«
Aspasia sah den Jesuiten frappiert an.
»Ich bewundere Sie.«
»Dann bewundern wir uns gegenseitig, Madame.«
»Pater Loyola,« sprach die schöne Frau rasch, »Sie haben die Absicht, aus mir Ihre Geliebte oder eine – Jesuitin zu machen.«
»Vielleicht beides.«
Aspasia sah ihn noch einmal mit halboffenen Lippen, großen Augen, lächelnd über die Schulter an, tauchte dann einen feinen Pinsel in das wunderthätige Fläschchen und begann die kleinen braunen Flecke auf ihrer Stirn damit zu tupfen.
»Lassen Sie das mich machen, Frau Baronin,« bat der Pater.
Aspasia überließ ihm den Pinsel und lehnte, die Arme auf der Brust gekreuzt, den Kopf mit halbgeschlossenen Lidern sanft zurück, ihre Lippen verzogen sich etwas und zeigten die schimmernden Spitzen der Zähne.
»Die Toilette ist eine Kunst,« erklärte der Jesuit ernsthaft, »und in ihr ist Poesie, wie in der Malerei, wie in der Musik –« »Sie haben recht,« unterbrach ihn Frau von Bärneck, »doch fordert sie immer eine gewisse Schönheit des Körpers, den sie umkleidet.«
»Verzeihung, aber Sie irren, schöne Frau. Die Toilette ist Form. Fordert die Form in irgend einer Kunst einen schönen Inhalt? Nein, Madame. Nicht der Inhalt, die Form ist das Merkmal der Kunst. Ein gewaltiger, genialer oder ergreifender Inhalt kann in einer schlechten Form frappieren und bis zu einem gewissen Punkte wirken, aber er wird uns nie einen wahrhaften Genuß gewähren. Wir sind dort angelangt, wo jene Gesinnungsmalerei, Gesinnungsmusik, jene Gesinnungslitteratur beginnt, welche das gesamte deutsche Leben vergiftet. Da entstehen dann Opern, denen das deutsche Publikum zujauchzt und bei denen sich musikalische Völker, wie Italiener und Slaven, die Ohren zuhalten, da entstehen dann Bücher, welche man in Deutschland abgöttisch verehrt und welche Briten, Franzosen und Russen mit einem mitleidigen Lächeln ansehen. Die Kunst hat etwas Absolutes. Goethes »Faust«, Berangers Chansons, Shakespeares »Othello«, Turgenjews »Tagebuch eines Jägers« entzücken in allen Sprachen Europas und den »Werther«, dieses einzige Buch voll echter Empfindung, voll lebendigen Naturgefühls, illustrieren sogar die Chinesen.«
»Und auch die Toilette wäre etwas Absolutes?« warf Frau von Bärneck ein, indem sie ihre Locken vor dem Spiegel ordnete.
»Gewiß,« erwiderte der Jesuit. »Aber wie verderben Sie Ihre Haare!« Er begann mit dem feinen Kamme und seinen noch feineren durchgeistigten Fingern die üppigen blonden Wellen zu teilen und effektvoll über einander zu werfen. »Prachtvoll, prachtvoll!« rief er dazwischen. »Ich habe noch nie ein so schönes Haar gekämmt.«
»Nun?«
»Sie befehlen?«
»Enden Sie doch Ihre Predigt über die Toilette.«
»Ganz recht. Die Toilette ist die Form in der Kunst der Schönheit, und genau so wie ein häßlicher Inhalt durch eine schöne Form zum Kunstwerke wird, giebt eine vollendete Toilette der Häßlichkeit Poesie und Harmonie.«
»Sie sind heute kostbar, Pater Loyola.«
»Ich bin immer kostbar, gnädige Frau.«
»Sie müssen mir nächstens eine Vorlesung über die Farben halten.«
»Sie erkennen ganz richtig die Bedeutung der Farbengebung in jeder Kunst, Frau Baronin. Dies bewies mir schon bei unserer ersten Unterredung Ihr Seidenkleid. Schwarz macht den weißen rosigen Teint einer Blondine geradezu blendend und hat auch einen großen Vorzug –«
Aspasia drohte ihm mit dem Finger.
»Es macht schlank.«
»Sie sind unartig, Pater Loyola.«
Damit erhob sich Frau von Bärneck, klingelte ihrer Zofe und entließ den Jesuiten mit einer graziösen Handbewegung.
»Darf ich nicht länger bleiben?« fragte er erstaunt.
»Wollen Sie mich etwa einschnüren?«
»Warum nicht?«
Aspasia tupfte ihn schalkhaft mit dem Pinsel auf die Nase und zog sich mit Florette in ihre Garderobe zurück.
Der Jesuit ließ zuerst sein Auge durch das Boudoir schweifen, dann setzte er sich in den Sammetfauteuil und blätterte in dem kostbaren Album, das auf dem Tische lag, in großen Photographien die Meisterwerke der Dresdener Galerie enthaltend.
Er betrachtete mit stiller Andacht Rafaels Madonna, dann ebenso die ruhende Venus von Tizian. Nebenan rauschten die Roben, plapperte die Zofe, endlich hüpfte sie heraus, blickte über die Schulter des Jesuiten und betrachtete sich hierauf im Spiegel, um sich zu überzeugen, ob sie auch gehörig rot geworden sei. Aspasia rief zugleich den Pater.
Er fand sie in ihrem Kabinett, in einer kunstvollen grünen robe princesse, ein Brief lag aufgebrochen auf ihrem Sekretär, einen andern hielt sie geschlossen in der Hand.
Loyola warf nur einen flüchtigen Blick auf das gebrochene Siegel.
»Schließen Sie diesen Brief,« scherzte Frau von Bärneck.
»Mit Vergnügen,« erwiderte der Pater, empfing das Couvert aus ihrer Hand, siegelte es und setzte sich dann an den Schreibtisch.
»Soll ich auch die Adresse schreiben?«
»Wie Sie wollen.«
Der Jesuit nahm die Feder und schrieb: A Monsieur le Chevalier Léon de Bàl.
Aspasia machte eine Bewegung und zog die Brauen finster zusammen. »Können Sie noch erbleichen?« sprach er ruhig.
Indes hatte sie ihm den Rücken gekehrt und drehte zornig ihr Taschentuch zusammen.
»O wie reizend Sie zürnen können,« fuhr der Pater fort. »Dieser Knabe berührt also Ihr Gemüt.« »Wer sagt Ihnen denn das?« fuhr Frau von Bärneck auf.
»Sie selbst, Ihre Augen sprechen, Ihre flammenden Wangen, Ihre feinen Nasenflügel, welche sich leidenschaftsvoll bewegen.«
»Und wenn ich ihn liebe?«
»Dann thun Sie Unrecht,« entgegnete der Jesuit. »Man soll nie lieben, man soll sich immer nur lieben lassen.«
»Wirklich?«
»Versuchen Sie es, Madame, und fangen Sie gleich mit diesem Leon an.«
»Aber das ist es ja eben, daß er mich nicht liebt!«
Der Jesuit besänftigte die zornigen Falten der robe princesse und sagte dann: »Lassen Sie mich das machen.«
»Sie?«
»Mich.«
»Sie wollen mich zu Ihrem Werkzeuge machen, Pater Loyola.
»Alle sollen hier meine Werkzeuge werden, alle, nur Sie nicht. Sie sollen meine Verbündete sein, und ich will Ihnen helfen, Ihre Schlingen legen.«
»Und Sie wollen mich bekehren?« »Eben deshalb.«
Aspasia lachte.
»Lachen Sie nicht, die Religion, Baronin, ist auch nichts Anderes als ein Fleckwasser.«
»Ein Fleckwasser?«
»Gewiß. Jene, welche scheu an den Kirchenthüren vorbeigehen, bedürfen ihrer mehr als alle andern. Die Religion ist ein stiller Segen für reine Gemüter, Hilfe und Rettung für verlorene Seelen, für jene, welche sündigen; ein kostbares Präservativmittel für jene, welche sündigen wollen. Wenn Ihre Marmorstirn nicht diese fatalen kleinen braunen Flecke hätte –«
Aspasia verzog den Mund.
»Würden Sie dann ein Fleckwasser brauchen? Gewiß nicht,« fuhr der Jesuit fort. »Sie halten das Leben fest und siegreich in Ihren allerliebsten Krallen, Sie wollen genießen, sündigen, freveln. Nun, ziehen Sie es vor, dies mit jener ewigen Seelenpein, mit jener namenlosen Angst oder in tiefem Herzensfrieden zu thun? O Sie kennen jene fahlen, bleichen Phantome, welche aus dem Boden aufsteigen, welche sich von der Wand loslösen, wenn weltmüde Augen sich im heiligen Dunkel der Nacht schließen wollen.«
»Sprechen Sie mir nicht davon,« rief Aspasia. Einen Augenblick waren ihre weichen Züge häßlich verzerrt und ihre Augenlider zitterten wie im Krampfe.
»Da, meine Hand,« sprach sie dann mit jener gebrochenen Stimme, jenem süßen, herzzerreißenden Röcheln kranker Lungen, kranker Seelen, »ich will Ihnen gehören, Ihrem Orden, ich will fromm werden, aber ich will auch sündigen, Mann Gottes, ich will freveln! Weh Dir, wenn ich es nicht mehr darf.«
Grüne Blitze sprühten aus ihren Augen auf den Jesuiten, der ihre feine unruhige Hand hielt und sanft streichelte.
»Sie wollen also vor allem diesen Leon haben,« sprach er ruhig.
»Er wagt es, mir zu widerstehen,« rief Frau von Bärneck, »aus Stolz, aus Ekel am Dasein, ich weiß es nicht, genug, er verletzt mich, er fordert mich heraus. Ich bin das Weib seiner Phantasie, ich kenne seine Phantasien, er muß wahnsinnig werden, wenn er in meine Nähe kommt, aber er nähert sich mir nicht. Ich hätte ihn vielleicht geliebt, aber jetzt will ich ihn quälen, ihn foltern und töten.«
Der Jesuit dachte einen Augenblick nach.
»Ich werde Ihnen diesen Leon überliefern,« sprach er dann lächelnd.
»Und was verlangen Sie dagegen?« »Davon sprechen wir später.«
»Nein, nein! Der Pakt muß klar sein, Sohn des Himmels.«
»Nun gut. Ich will Ihren Neronischen Passionen dienen, Ihren Launen gehorchen als Ihr Knecht, Sie unterstützen mich dagegen in meiner Mission.«
»In was für einer Mission?«
»Sie sollen dieselbe kennen lernen, wenn es an der Zeit ist. Die Sterne sind uns günstig. Es liegt nur an uns, die Reaktion, welche sich gegenwärtig in Oesterreich vollzieht, für uns auszubeuten. Das neue Régime soll die letzten Schleier liberaler Heuchelei abwerfen. Wir wollen dem Throne seinen vollen Glanz wiederbringen, wenn er die höhere Macht der Kirche anerkennt, wir wollen dem Monarchen seine absolute Macht zurückgeben, wenn er der heiligen Weisheit der Gesellschaft Jesu sein Ohr leiht.«
»Und Leon?«
»Auch ich habe meine Pläne mit diesem schönen Knaben,« erwiderte der Jesuit. »Lange wollen Sie sich doch nicht mit ihm amüsieren, dann also, wenn Sie seine Süßigkeiten satt haben, wenn er Sie langweilt, dann gehört er mir.«
»Gut,« rief Frau von Bärneck, »Sie führen ihn in mein Netz und ich liefere ihn dann in das Ihre.« »Und wenn die Reue über Sie kommt?« sagte Pater Loyola lauernd. »Wenn Sie sentimental werden, schöne Selbstquälerin?«
»Dann, Mann Gottes, werde ich mich erinnern, daß es ein Mittel giebt für kranke Seelen, ein jesuitisches Fleckwasser.«
