
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Freiherr von Conrad fuhr in den Zweifrontenkrieg. Noch hoffte man am Ballplatz, daß »die Strafexpedition« gegen Serbien mit schnellem Marschieren zu Ende käme, ohne daß Rußland eingriffe. Oder doch zu Ende käme, bevor Rußland mit völliger Machtentfaltung eingriffe. Conrad hoffte nichts. Er wartete auf die Russen.
Sein Aufmarsch rollte ab, wie ein Uhrwerk. Die Züge liefen Tag und Nacht. Nach Serbien sowohl wie nach Rußland. Blieb der serbische Krieg wirklich ohne Verwicklung, so stand jetzt gegen das Königreich fast Österreich-Ungarns halbe Streitmacht. So lange Übermacht gegen Serbien möglich war, sollte sie dort rastlose Arbeit tun. In das galizische Aufmarschgelände trugen die Bahnen der Streitmacht größeren Hauptteil. Nur wer die Beförderungsziffern der Bahnen mitrechnete, vermochte eine Kraftverteilung zu verstehen, die zunächst gegen zwei völlig ungleiche Gegner nahezu gleiche Macht zu setzen schien. Nach dem Nordosten waren alle Bahnen belastet bis über das Höchstmaß. Die Lokomotivenparks waren leer, die Wagenparks unterwegs. Alles dampfte, alles rollte. Böhm-Ermollis zweite Armee, schon jetzt für Rußland bestimmt, marschierte vorerst gegen Serbien auf. Selbst aus Serbien konnte sie nicht um eine Stunde später auf dem russischen Kriegsschauplatz eintreffen, als bei unmittelbarem Abmarsch dahin. Untätig in Hinterlandgarnisonen wollte sie Conrad nicht lungern lassen. In Serbien vermochten sie vielleicht an einer Beschleunigung der Dinge, an ersten Vorteilen der Überlegenheit mitzuhelfen. Kaum lag der erste Bahnstrang frei, rollten ihre Kolonnen auch schon dem Dnjestr zu. Serbien war ein Nebenkriegsschauplatz. Alle Welt begriff es, alle Welt erklärte es. Conrad hatte es längst begriffen. Er hatte aus dem technisch Erreichbaren das Günstigste herausgeholt.
Den Berichten über die unfertige russische Mobilisierung mißtraute er. Einen Koloß erwartete er. Nur dies eine war fraglich, wie weit der Koloß sich schon vorwärts gewälzt hatte und wo er zum Stoß ausholte. Freiherr von Conrad wußte, daß auch gegen Riesen die beste Aussicht auf Abwehr und Erfolg im Angriff liegt. Noch einmal überlegte er, wie er sich für den Fall eines russischen Krieges, der ihm Verteidigung aufzwänge, schon vor seinen Friedenskarten solch einen Angriff zurechtgelegt hatte. Und was darüber mit Moltke, dem Generalstabschef des deutschen Feldheeres, in mündlicher Beratung und regem Briefwechsel bereits vereinbart worden war. Sie hatten beide endlich beschlossen, mit ihren Truppen in Polen einzudringen. Polen war die große Heerstraße nach Schlesien. Der Marsch durch Polen war der russische Marsch über Breslau nach Berlin. Sowohl in Galizien, als auch in Ostpreußen wollten die Verbündeten sich in unbedingter Verteidigung halten. Selbst wenn es den Russen glückte, in Ostpreußen oder in Galizien – oder gar in beiden Ländern – ein Stück vorwärtszukommen, so zerriß ihr Riesenheer durch einen erfolgreichen Angriff in Polen in zwei flatternde Flügel, die, ohne Verbindung miteinander, von selbst schnell weichen mußten. In Polen aber wollte man das wandernde Russenheer von oben, von unten in eine eiserne Zange fassen. Dies ganz Polen war ein großer, bauchiger Sack, den man nahe am offenen Ende abbinden wollte, wenn er unten mit Russen gefüllt war. Conrads Leute sollten also über Lublin nach Norden, Moltkes Leute über Siedlce nach Süden marschieren. Wenn sie sich trafen, war der Sack geschlossen. Oder wenigstens eine Barriere von Ostpreußen quer durch Polen bis nach Galizien gezogen. Was an Russen links von der Barriere, mit dem Gesicht nach Schlesien stand, war dann der gefährlichsten Bedrohung durch das Zufassen der Gegner verfallen. Was rechts von der Barriere stand, war dann auf alle Fälle schwer geschwächt und schwer verwirrt. Der Russenvormarsch aufgehalten. Nichts war an dem Plan zu ändern. Nichts an ihm zu deuteln. Das erste Ziel der österreichisch-ungarischen Heeresleitung war: Vormarsch nach Russisch-Polen – in Ostgalizien Abwehr.
In Ostpreußen waren zur Zeit des österreichisch-ungarischen Aufmarschs auch deutsche Truppen versammelt worden. Generalleutnant von Prittwitz und Gaffron war dort Kommandant einer Armee. Sie war stattlich, sie zählte zwölf Divisionen. Aber an den Marsch nach Russisch-Polen, an die polnische Zange vermochte weder Herr von Prittwitz, noch Moltke jetzt zu denken. Vom Njemen drang ein Russenheer ins Land. Ostpreußen mußte Deutschland näher sein als Polen und österreichische Vereinbarungen. Vorläufig konnte die deutsche Führung das erste Übereinkommen nicht halten. Vorläufig mußte der Freiherr von Conrad sich allein bescheiden. Im Westen schien alles jetzt Entscheidung. Alles andere kam später, würde später leicht sein. Für den Osten war Ostpreußens Schutz jetzt das einzig Wichtige. In hartem Zusammenstoß mit den Russen wurden freilich die zwölf deutschen Divisionen geworfen und geschlagen. General Prittwitz ging. Mit ihm sein Stabschef Waldersee, der Neffe des Marschalls. Es war die erste Enttäuschung, die der deutsche Generalstab besorgt verschwieg. Ostpreußen lag schutzlos.
Für Österreich-Ungarn aber begrenzte nüchterne Betrachtung die Zeit, die sein Alleinstehen gegen Rußland möglich war. Ein Reich von 52 Millionen Menschen focht gegen ein Reich von 160 Millionen. Serbien und Montenegro brauchte man gar nicht erst mitzuzählen. Überdies war der Grundplan des Handelns umgestoßen. Freiherr von Conrad hatte noch vor Kriegsbeginn mit General v. Moltke Besprechungen darüber gehabt, wie er sich den Gang der Ereignisse, wie er sich das Bild des Ganzen dächte. Die wirkliche Entscheidung, hatte Moltke gemeint, müßte im Westen fallen. Mindestens der gefährlichere Gegner stünde dort. Freiherr von Conrad hatte dies eingesehen. Nur eines hatte er noch wissen wollen: wann nach Moltkes Meinung die Entscheidung im Westen fallen werde. Der deutsche Generalstabschef hatte »den 39. bis 40. Mobilisierungstag« genannt. Gut, – hatte Conrad geantwortet. Dann würde er – Moltke – mit den nötigen Kräften eben nach dem Osten herüberkommen.
Vorläufig gab es keine andere Rolle, die Österreich-Ungarn hätte spielen können. Schnell zeigte sich, wie hoch die Anforderungen waren, die sie an Kraft, Ausdauer und Geistigkeit stellte.
Drei Aufgaben lagen vor Freiherrn von Conrad. Das Ringen in Frankreich durfte durch Vorfälle im Osten nicht beeinträchtigt werden, die eine freie, sorglose Verwendung aller dort eingesetzten Armeen behindert hätten. Rückendeckung wurde verlangt im weitesten Sinn. Dann war der russische Einbruchsversuch nach Schlesien um jeden Preis zu vereiteln. Und schließlich blieb Galizien zu schützen.
Die Rückendeckung konnte Conrad Deutschland nur gewähren, wenn er fast alle Heere Rußlands auf die eigenen Truppen zog und sie in so heftige Arbeit verstrickte, daß ihnen keinerlei andere Beschäftigung erlaubt war. Den Einmarsch in Schlesien konnte er nur vereiteln, wenn er die Straße durch Polen versperrte. Galizien konnte er nur halten, wenn dann noch die Truppen reichten. All das, wenn die russische Mobilisierung wirklich nicht beendet war; wenn er blitzschnell war; und wenn kein Fehler geschah.
Tief nach Polen stieß er – Auffenberg und Dankl – zwei starke Angriffsarmeen. Die Verteidiger Ostgaliziens spannte er – Brudermann und Köveß – im Querbogen bis nach dem bessarabischen Grenzrand. In Polen drangen Auffenberg und Dankl kraftvoll nordwärts. Sie sperrten wirklich den Russenmarsch nach Breslau. Vielleicht erreichten sie auch mehr. Aber in Ostgalizien fielen gleich in den ersten Kampfphasen jäh die Schleier. Rußland mußte seit Monaten schon mobilisiert haben: gegen die Reichsgrenzen marschierten dort allein drei russische Armeen. Ruski, Iwanow, Brussilow. Wer rechnete, erschrak. Freiherr von Conrad hatte, selbst wenn Böhm-Ermolli schon mitkämpfte, knapp eine halbe Million Soldaten. Die Russen mit Reichswehr und Sibiriaken anderthalb Millionen Mann. Conrad blieb unerschüttert. An den Zahlen konnte er nichts ändern. Aussicht auf deutsche Mithilfe gab es jetzt nicht.
Von der Nordostecke Galiziens sprang die Armee Auffenberg weit in polnisches Gebiet. Teile dieser Armee konnten gewendet werden. Sie sprang wie ein Hammer aus Conrads Front, deren Mitte vor Lemberg lag. Wenn Böhm-Ermolli eingetroffen war, wollte Conrad den zweiten Hammer ansetzen. Tief im Süden vom Dnjestr herauf … Da warf General Brudermann um.
Brudermann hatte den Befehl erhalten, dem Marsch der Russen Einhalt zu gebieten, die von Podolien her und über Zloszow ihre Kolonnen vortrieben. Er war an vorgeschriebene Defensive nicht gebunden, aber in völliger Verkennung der Situation glaubte er seine Aufgabe am besten so zu lösen, daß er selbst vormarschierte. Er sah General Dankl siegbegleitet im Vormarsch nach Polen. Er sah auch General Auffenberg in rastlosem Vorwärtsschreiten. Und er griff an. Er wartete nicht einmal, bis seine Divisionen, die aus den Bergen dazu erst heraustreten mußten, in der Ebene alle versammelt waren. Er griff ohne Versammlung an. Er warf die Truppen Stück um Stück in den Angriff. Er wurde geschlagen. Seine Front weit hinter Przemislany zurückgeworfen. Selbst mit Böhm-Ermollis Truppen konnte Conrad jetzt keinen Hammer mehr schmieden. Der ganze Südteil der Front mußte neu aufgebaut werden. Zeit und Möglichkeiten waren eingebüßt. Brudermann hatte das ganze Konzept schwer umgestoßen.
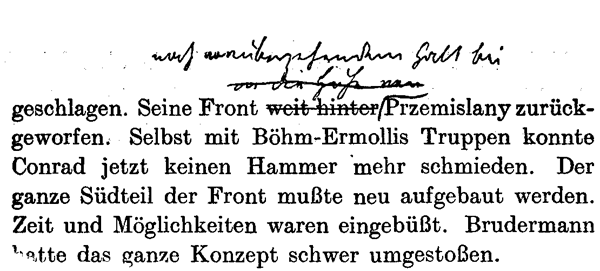
Handschriftliche Eintragung von Feldmarschall Conrad auf Seite 56 eines Exemplares der ersten Auflage
Man stand damals im Anfang des Krieges. Die Armee Prittwitz hatte Ostpreußen verloren. Antwerpen hielt sich noch. In Antwerpen die belgische Armee. In Frankreich begann die Rechnung General Moltkes nicht zu stimmen. An der Wiederherstellung der ostpreußischen Lage aber arbeitete eben erst ein neues Triumvirat. Der bedächtige, feste Generaloberst von Hindenburg war sein Haupt, dessen Ruheausdruck immerhin Sicherheitsgefühle wecken konnte. Er war in das Hauptquartier der deutschen Oststreitkräfte mit Erich Ludendorff gekommen, einem General in mittleren Jahren, der vor Lüttich nach bitteren Stunden vom Siegertum schon gekostet hatte, dem man aber trotz der rücksichtslosen Energie, mit der er Beschlossenes durchführte, trotz des eisernen Griffes einer unbarmherzigen Faust, um seiner verhältnismäßigen Jugend willen die Befehlsgewalt über eine Armee nicht geben mochte. Im Hintergrunde noch ein Dritter: der geistvolle, ideenreiche Major Hoffmann, im Hauptquartier schon über die Karten, über neue Aufmarschpläne, neue Vormarschpläne gebeugt, indes mit dem Generalobersten der Stabschef erst anrollte. Das Triumvirat schlägt die Schlacht bei Tannenberg. Rennenkampfs Heer wird zur Hälfte in die Sümpfe Masurens gedrängt, die andre Hälfte wird gefangen, nur Bruchteile entkommen. Anlage, Durchführung, Ausnützung der Schlacht tragen geniale Züge; ihr Ergebnis ist Ostpreußens Wiedergewinn. Ihr Ergebnis ist noch weit mehr: die seelische Hebung und unbedingtes Zukunftszutrauen aller Deutschen. Ein Rausch erfaßt ganz Deutschland. Ein Name wird auf den Schild gehoben: Hindenburg. Weniger bedeutet das Geschehnis im Rahmen der ungeheuren Vorgänge. Selbst für den Osten ist die Schlacht von Tannenberg kaum mehr als eine dem Gegner unbequeme Episode. Zwei Russenheere standen gegen Ostpreußen. Rund 350 000 Mann. Jetzt ist von den neuen Feldherrn mit den neuen Truppen, die die Reste der außer Gefecht gesetzten Armee Prittwitz füllten, das eine Russenheer kampfunfähig gemacht. Aber in Galizien und Polen stehen 1 500 000 Mann und werden stündlich mehr. Von einer Bannung der Russengefahr ist keine Spur. Für die Wissenden ist kein Grund zum Jubel. Zuversichtlich ist die Stimmung im Lager des Vierverbandes. Für die Mittelmächte ist die Stimmung der Wissenden ernst.
Conrad erwog darum, ob er Lemberg preisgeben mußte. Militärisch war ihm der Besitz der Stadt gleichgültig. Aber den politischen Eindruck scheute er in bedrückter Zeit. Noch konnte er, noch wollte er die Hauptstadt halten. Da trat in seinen Beschluß einer jener Zwischenfälle, die mitunter grundlos die Nerven der Truppen besiegen. Bei Zolkiew, vor einem Wäldchen, hatte die dreiundzwanzigste Honved-Division jähe Panik erfaßt. Sie ging plötzlich zurück. Ohne allen Grund. Bei Zolkiew klaffte ein Loch. Jetzt war Lemberg freilich nicht mehr zu halten. Rapid riß Conrad die Front zurück. Und stand bei den Grodeker Teichen.
Die Russen aber rechneten mit Auffenberg ab. Zwar waren sie überrascht, von Conrads vernichtet geglaubten Südkräften plötzlich abermals so sieghaft angegriffen zu werden, daß Lemberg wieder nahe lag. Aber gegen Auffenberg allein rollten Russenarmeen. Halb focht der General noch südwärts zur Grodeker Schlacht gewendet, halb wehrte er sich schon wieder gegen Norden. Und nunmehr erst wurde auch der Zeitverlust durch Brudermann eine vollkommene und tragisch fortstrahlende Wirkung. Jetzt schütteten alle Bahnen, alle Straßen die russischen Reserven aus, die während der ersten Schlacht noch weit hinter dem Kampfplatz marschiert waren. Auffenberg drohte von Dankl abgerissen, beide von Übermacht umflutet zu werden. Gegen den neuen Stoß, der kommen mußte, fehlte es an Reserven. Conrad brach jählings die Schlacht ab. Weiterkämpfen war Vernichtung. Vier Heere riß er mit einer Entschließung, mit einem Ruck über 160 Kilometer zurück. Ehe die Russen zur Austilgung aufbrachen, war er verschwunden.
Hinter dem Dunajec gab er den Truppen Erholung. Sie hatten sich alle heroisch geschlagen, sie waren erschöpft, doch ungebrochen. Sie wurden zu neuem Vormarsch gerüstet. Im Hauptquartier, im Städtchen Sandec, durfte sich Freiherr von Conrad sagen, daß er von den drei ihm gestellten Aufgaben nur die eine nicht hatte lösen können: Galizien war nicht zu halten gewesen. Aber von einem russischen Marsch nach Schlesien war keine Rede. Drei Viertel der russischen Streitmacht hatte Conrad allein beschäftigt, hatte sie verwirrt und durch Verluste schwer geschwächt, drei Viertel der Russen hatte er allein gebunden. Vorsichtig tappten sie jetzt der neuen Linie zu. Mehr hatten die Truppen, mehr hatte er selbst nicht leisten können. Die beiden ersten, langen und bangen Kriegsmonate lag das russische Ungetüm gefesselt. Die große Rückendeckung war so dem deutschen Waffengefährten in Frankreich wahrhaftig gegeben. Allerdings begann in Frankreich die Moltkesche Rechnung immer weniger zu stimmen. Oder sie stimmte längst nicht mehr. Die Sendboten mit den Großkreuzen des Maria-Theresien-Ordens, die Kaiser Franz Joseph, mitgerissen von den belgischen Siegen, dem Kaiser Wilhelm und dem Grafen Moltke ins Große Hauptquartier geschickt hatte – zu früh für Conrads Empfinden, der in allen belgischen Siegen doch nur die Anfangserfolge sah –, hatten in Homburg auf verstörte Gesichter getroffen. Der Bevollmächtigte des österreichisch-ungarischen Oberkommandos im Großen Hauptquartier, der dort freilich so wenig zu erfahren pflegte, daß man ihn schließlich abberief, hatte nichts von der Schlacht an der Marne gehört. Und auch die deutsche Heimat wußte nichts, die Monarchie wußte nichts. Selbst Freiherrn von Conrad brachten auf Umwegen erst die Schilderungen der Sendboten, die mit den Großkreuzen ausgereist waren, die Nachricht der verlorenen Schlacht. Bisweilen mußte jetzt Conrad von Hötzendorf daran denken, daß er sich das Zusammenarbeiten mit dem deutschen Hauptquartier eigentlich anders vorgestellt hatte. Jedenfalls: der Vormarsch in Frankreich stand. Und die Frist des Alleinseins gegen Rußland war zweifach um. Der Koloß wuchs noch immer. Freiherr von Conrad wartete jetzt auf die von Moltke versprochene deutsche Hilfe.
Generaloberst von Hindenburg war der Helfer. Er kam mit leidlich starken Kräften, die er zwischen Kreuzburg und Tschenstochau vormarschieren ließ, oberhalb der Festung Krakau in die polnischen Gouvernements Kielce und Radom. Der Anschluß an die Verbündeten war jetzt erreicht. Der neue Vormarsch konnte beginnen, die Versammlung der deutschen Truppen war überaus rasch geschehen. Nur die Vereinbarung, die Einigung der beiden obersten Befehlsstellen mußte noch erfolgen, wie der Vormarsch unternommen werden sollte. Hier hatte für das österreichisch-ungarische Armeeoberkommando Freiherr von Conrad zu sprechen; dort Generaloberst von Hindenburg, dem als Oberkommandierenden aller deutschen Osttruppen der Chef des deutschen Generalstabes Vollmachten gegeben hatte. Freiherr von Conrad erwog ein festgeschlossenes, vorsichtiges, dennoch zähes Vorschreiten der ganzen verbündeten Front. In Galizien, sowie in Polen. Er kannte den Gegner. Er kannte die Schwierigkeiten. Nur ein harter, festgefügter Block konnte sich allmählich vorwärtsschieben und die Russen dadurch, daß er nirgends verwundbare Blöße und Schwäche zeigte, durch die Überlegenheit des soldatischen Materials langsam zurückdrücken. Der Generaloberst von Hindenburg hatte sich noch nicht darüber entschieden, wie er sich zu solcher Absicht stellen wollte. Vielleicht war im Aufmarsch noch ein letztes zu vollenden. Aber da meldete er sich auch schon.
Freiherrn von Conrad brachte General Metzger, der Chef seiner Operationskanzlei, ein Telegramm des Generalobersten von Hindenburg. »Der Vormarsch habe begonnen.« Er gehe gegen die Weichsel. »Um die Russen zu überrennen«, wie es in der Depesche hieß. Conrad las sie mit unbehaglichem Gefühl. Er studierte das Telegramm noch einmal, aber das darin gemeldete Unternehmen dünkte ihn immer sonderbarer. Hindenburg hatte den Vormarsch an die Weichsel mit auseinandergezogenen Divisionen angetreten. Sie liefen geradezu auseinander … Sonderbar nannte das Unternehmen Conrad. Sonderbar nannte es der Chef seiner Operationskanzlei – –
Aber Hindenburgs Vormarsch war bereits im Rollen. Conrad vor eine vollzogene Tatsache gestellt. Seine Hauptmacht kämpfte er durch Galizien vor, dem San und der Festung Przemysl entgegen, um die der russische Belagerungsring lag. Der starken Armee Dankl befahl er, die Bewegungen auszuführen, die den Anschluß an die vormarschierenden Truppen Hindenburgs sichern sollten. Hindenburgs Truppen hatten im Marsch die Gerade. Dankls Truppen am Weichsellauf den tiefgebauchten Bogen. Wenn überhaupt diese Vormarschlinie Bogen und Sehne war, so war die Sehne der Weg Hindenburgs. Der Unterschied ergab eine beträchtliche Kilometerzahl zu Ungunsten General Dankls. Obendrein eilte Hindenburg durch nahezu russenfreies Gelände. Dankl mußte, noch ehe er vormarschieren konnte, erst den Weichselübergang erzwingen. Seinen Marsch beunruhigte die russische Weichselfront. Dennoch: General Dankl marschierte. In Eilmärschen, in Gewaltmärschen. Und traf schließlich sogar rascher ein, als die anfängliche Berechnung hätte erwarten lassen.
Generaloberst von Hindenburg setzte, was er in seinem Hauptquartier geplant hatte, sofort in die Tat um. Er stürmte mit allen 108 Bataillonen vor, die er mitgebracht hatte. Er griff die Russen einfach an. Er trieb gegen den Strom seine Divisionen wie einen Fächer auseinander. Er dachte im Ernste daran, die Russen ohne weiteres »überrennen« zu können. Für einen Augenblick gingen ihre Vortruppen vom Westufer der Weichsel auf das Ostufer auch hinüber. Aber gleich im nächsten Augenblick strömten sie als unhemmbare Flut zurück. Auf dem ganzen Kampfplatz in Westgalizien und in Polen marschierten Hindenburg und Conrad mit 564 Bataillonen. Die Russen waren zwar durch die Lemberger Schlachten, durch die Anfangsschlachten von Komarow und Krasnik geschwächt, – Ostpreußen schaltet für diesen Kampfabschnitt, für seine Kräfteberechnung ganz aus – überdies war die Armee Radko Dimitrieff jetzt durch die Belagerung von Przemysl gebunden. Aber für den neuen Waffengang hatten sie, noch bevor sie auf Nachschübe rechneten, immer noch 928 Bataillone bereit. Waren also um 460 Bataillone, fast um eine halbe Million Soldaten, abermals überlegen. Darum hatte Conrad einen breiten Block bauen wollen. Hindenburg aber, allzu sicher seit dem Teilerfolg bei Tannenberg, unterschätzte den Gegner. Und trieb, von Josefow weichselabwärts bis Warschau, über 150 Kilometer seine Truppen mit solcher Gewalt auseinander, daß er dann für je 17 Kilometer bloß eine einzige Division aufbringen konnte. Mit dem »Überrennen« war es nichts. Im Gegenteil, – Hindenburg wurde geschlagen.
Ins Hauptquartier nach Neu-Sandec meldete General Dankl, daß er bei Iwangorod in schwerem, doch günstigem Kampfe stehe. Vorläufig könne er sich sehr gut halten. Aber im Hauptquartier in Neu-Sandec lief gleichzeitig eine neue Depesche Hindenburgs ein: »der Rückzug seiner Truppen habe begonnen«. Freiherr von Conrad stand vor der zweiten vollzogenen Tatsache. Beide Handlungen – Vormarsch wie Rückmarsch – waren von dem deutschen Verbündeten ohne vorangehende Verständigung unternommen worden. Immerhin, jetzt war die Lage klar. Allein konnte die Armee Dankl oben an der Weichsel nicht stehenbleiben. Sie wäre von den Russen einfach umgangen worden. Conrads siegreiche Hauptmacht in Westgalizien aber war durch den bisherigen Verlauf des Hindenburgschen Hilfefeldzugs plötzlich an den Rand einer Katastrophe gedrängt. Sie hatte in Westgalizien Przemysl befreit. Sie stand nach harten Krisen schon wieder am San. Das elende Wetter schlug plötzlich um. Die zerstörte Przemysler Bahn war soeben wieder hergestellt. Der Munitionsnachschub rollte nunmehr reibungslos. Da kehrte Hindenburg an der Weichsel um. Blieb Freiherr von Conrad auch nur einen einzigen Tag noch am San, so war unheilbares Verhängnis da: die Russen rollten dann von Polen her seine ganze Streitmacht auf. Langsam hieß Freiherr von Conrad die Armee Dankl zunächst an die Opatowka zurückgehen. Aber die Russen im polnischen Kampfraum warfen sich jetzt auf Dankl, der dort allein übriggeblieben war, mit allen freigewordenen Kräften. Bei Opatow drückte Übermacht seine Linie schließlich ein. Conrad befahl dem General, bis vor Krakau zurückzugehen. Dankl hielt nach allen den Vorgängen, hielt der ganzen Lage nach so nahes Halten für schwierig. Aber Conrad blieb hart. Befehl war Befehl. Der General gehorchte, vermochte es auch, die befohlene Stellung zu versteifen. Vorläufig deckte er also noch die Kräfte in Westgalizien. Vom San riß Conrad abermals alle Truppen zurück. Abermals stand er am Rande Westgaliziens und im Karpathenvorland. Das Hauptquartier begab sich nach Teschen. Denn selbst über den Dunajec kamen die Russen. Abermals war die Festung Przemysl verloren. Dies alles brachte das Ende der Unternehmung in Polen, die eigentlich als Hilfsfeldzug gedacht war. Und in Polen stand kein einziger Soldat, der dem Einbruch russischer Massen nach Schlesien hätte wehren können.
Schlesien lag schutzlos. Nicht anders, als drei Monate vorher Ostpreußen. Zwar hatte Hindenburgs rückströmende Armee in Polen zahlreiche technische Abteilungen zurückgelassen, die alle Eisenbahnen, alle Behelfsbauten, alle Magazine, durch die ein vormarschierendes Heer unterstützt werden konnte, mit seltener Gründlichkeit zerstörten. Aber die russischen Truppen konnten dadurch nur aufgehalten, nicht abgehalten werden. Was von ihrem Anrollen drohte, war schlimmer als ein Vorwärtskommen in Ostpreußen, auch wenn Teile dieser Provinz für kurze Zeit verlorengingen. Schlesien war nicht nur so wertvoll wie das agrarische Ostpreußen. Schlesien hatte Kohlen. Schlesien hatte Industrien. Über Schlesien kam man nach Berlin. Über Schlesien kam man nach Wien. Über Schlesien marschierte man ins Herz der Mittelmächte. Waren die Russen erst in Schlesien, so gab es keine ostpreußisch enge Front mehr, die Linien, die man – im reichsten Landstrich der Mittelmächte – zu halten hatte, wurden dann weit. Großzügiges und Ungewöhnliches mußte geschehen, um die Lage zu retten. Zwei Einfälle retteten sie. Den einen hatte Freiherr von Conrad, den anderen der Generaloberst von Hindenburg.
Bei Sambor in Galizien, die Karpathen im Rücken, stand Böhm-Ermollis zweite Armee. So weit war sie auf eigenem Vormarsch während der Vorgänge an der Weichsel gekommen. An ein Weitertragen ihres Angriffs war nicht zu denken. Conrad erwog einen kühnen Entschluß und führte ihn gleich darauf aus. Er verhüllte Böhm-Ermollis Front mit ganz dünnen Schleiern. So behutsam geschah die Ablösung, daß die Russen nichts von ihr merkten, weder jetzt, noch später. Die ganze Armee Böhm-Ermolli packte Conrad in die Eisenbahn. Von den Zügen erzwang er Schnellzugsgeschwindigkeit. Er warf die ganze Armee mit täuschender Richtung über Budapest hinauf nach Schlesien. Hindenburg war mit 108 Bataillonen nach Polen gezogen, zur Hilfe für die Monarchie. Conrad hatte 110 Bataillone aus der eigenen Front genommen, ein Viertel seiner gesamten Streitmacht, die eigentlich gegen den russischen Koloß immer noch so gut wie allein stand, zum Schutze Schlesiens … Noch ehe die ersten russischen Vorhuten Deutschland von ferne sahen, stand die Armee Böhm-Ermolli als Wall an der Grenze. Wollten die Russen wirklich in Deutschlands Innere, so ging der Weg nur über die Trümmer der zweiten österreichisch-ungarischen Armee.
Hinter ihrem schützenden Rücken hatte sich Hindenburgs Heer erholt. Die Erholten setzte auch der Generaloberst plötzlich auf die Bahn. Schnelltransporte dampften in den Raum von Thorn. Was im überhitzten Vorrennen an die Weichsel mißlungen war, gelang vielleicht, wenn man die Russen mit überraschendem, hartem Griff in der Flanke faßte. Der Einfall war aus dem Augenblick geboren, er war glücklich und versuchte das Beste, das zu tun war. Die Russen marschierten ruhig der schlesischen Grenze zu. Dort freilich standen sie maßlos verblüfft, statt vor den Resten der Armee Hindenburgs, vor einer neuen, vollkommenen österreichisch-ungarischen Mauer, die wie ein Spuk über Nacht gebaut schien. Aber noch hatte sich die Verblüffung der Russen nicht gegeben, als auch schon Hindenburgs Flankenstoß sie mit verheerender Wirkung traf. Aus dem Norden war er schnurgerade, pfeilschnell in ihre Flanke mit voller Wucht gefahren. Plötzlich hatte der russische Vormarsch zwei Fronten. Vorn stand Böhm-Ermollis Mauer, die nach Osten drückte, von oben hieb und stach der Generaloberst von Hindenburg. Die Russen wendeten sich diesem Gegner, der ihnen der gefährlichere schien, schwerfällig zu und nahmen eine Schlacht an, die in stürmender Entwicklung eine Reihe der Schlachten, binnen wenigen Tagen ein Schlachtendrama wurde, das von Mittelpolen über Südpolen und Galizien bis hinab an die Karpathen reichte. Hindenburgs Stoß von Norden war gewaltig. Russische Hilfskorps jagten zum Entsatz gegen Lodz. Vielleicht brachten die Korps dort noch rettende Entlastung. Aber jetzt griff Freiherr von Conrad ein. Hindenburgs Erfolg sollte ausreifen. Conrad marschierte von Bochnia und Krakau her den russischen Hilfskorps nordwärts in die Flanke. Die Russen haben Mittel, sich zu helfen. Jetzt stoßen sie mit ihren Angriffen westwärts gegen Krakau und Bochnia. Conrad durchkreuzt das Manöver, das erwartet ist. Die Russen, die vor Bochnia und Krakau kämpfen, faßt er aus dem Süden. Noch hat der Gegner eine einzige Möglichkeit. Er kann Conrads neuen Marsch durch Truppen stören, die er vom Osten her auf die Walstatt von Limanowa führt. Aber es ist die letzte russische Flankenstaffel. Das letzte Wort behält gleichwohl Conrad: von den Karpathen trifft er die Russen als letzter in der Flanke. Der Riesenkampf ist damit entschieden. Es ist die große Schlacht, die Schlachtenfolge der Flankenstöße. Die Russen haben keinen Einsatz mehr. Gekämpft hatte man an vielen Stellen gleich hart. Bei Lodz, vor Krakau, bei Bochnia, bei Limanowa. Aber Lodz und Limanowa waren die Brennpunkte und die Entscheidung. Im Norden hatte Hindenburg auf den Gegner eingehämmert, hatte ihn überrascht, ihn umkrallt, betäubt und zerrissen. Frontabwärts hatte Conrads geistige Überlegenheit, seine gedankliche Vorbereitung und Beherrschung aller Vorgänge, Bewegungen und Räume überall triumphiert. Die Russen waren geschlagen im Norden und Süden. Der Generaloberst von Hindenburg hatte nach den polnischen Erfahrungen auf alle Vorteile einer einseitig gepflegten Strategie diesmal verzichtet. Der Erfolg wurde sichtbar im Augenblick. Die russischen Massen stockten. Schlesien war außer Gefahr. Die berüchtigte russische »Dampfwalze« stand still.
Der russische Oberbefehlshaber Großfürst Nikolai Nikolajewitsch war zweifellos ein Mann bedeutender Willenskräfte. Er hatte eine Anzahl wichtiger Schlachten bisher gewonnen, andere verloren. Er war der Eroberer Lembergs und Galiziens. Die schwerfälligen russischen Heereskörper beherrschte er oder sein Stabschef mit so viel Technik, wie eben jene Schwerfälligkeit des russischen Materials zuließ. Immerhin war seine Beweglichkeit noch groß. In Ostpreußen hatte er eine der beiden für diesen Nebenschauplatz bestimmten Armeen eingebüßt. Aber das zweite Heer rettete er ganz. In Galizien machte Conrads Sprungfähigkeit, die stets die Situation selbst bestimmte, ihn und seine Massen durch Monate atemlos. Immerhin, der Großfürst hatte die Entscheidung der Masse so weit durchgesetzt, daß sie über dem Lande jetzt ausgebreitet lag, In Polen hatte er Hindenburgs Überrennungsversuch durch ein paar Bewegungen sofort mühelos niedergeschlagen. Er hatte in Ostpreußen und in Galizien empfindliche Verluste gehabt. Aber die Masse in Rußland war unerschöpflich. So viel war dem Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch klar, daß er nur durch die Masse, wenngleich sie im Augenblick in Polen und hinter dem Dunajec stillstand, eine Entscheidung erzwingen könne. Er mußte sie nur richtig bewegen. An der schlesischen Richtung war er gescheitert. Das dichte Bahnnetz gab dort von allen Seiten dem Gegner die Waffen zu schnell in die Hand. Aber es gab noch andere Marschwege. Die Richtung mußte, wenn die russischen Heere aufgefüllt waren, einfach geändert werden.
Von beiden Gegnern Rußlands schien Österreich-Ungarn der schwächere, nicht bloß darum, weil die von ihm aufgebrachten Zahlen kleiner sein mußten als die Zahlen Deutschlands. Österreich-Ungarn war ein vielfach slawischer Staat. Von Österreich-Ungarn sagte und schrieb seit Jahren alle Welt, daß Irredenta und Hochverrat dort zu Hause seien und der staatliche Zerfall vor der Tür war. Nicht nur alle Welt glaubte es: auch Deutschland bangte. Ja, einen Augenblick lang war der Kaiser Franz Joseph selbst einmal skeptisch gewesen. Den Freiherrn von Conrad hatte er 1909, als die serbische Krise einen Waffengang mit dem Königreich nicht ausschloß, mit raschem Einwurf gefragt: »Sind Sie denn der Truppen sicher?« Moltke hatte hart vor dem Kriege an den Baron die gleiche Frage gestellt. Dem Kaiser, wie dem Verbündeten hatte Conrad die gleiche Erwiderung gegeben. Einzelne Fälle von Widersetzlichkeit und Indisziplin würden unterlaufen. »Aber im ganzen: die Armee wird das tun, was man ihr befiehlt.« Von der Auflehnungsmöglichkeit südslawischer Truppen brauchte man vorerst kaum noch, von einem Versagen kroatischer Truppen überhaupt nicht zu sprechen. Aber auch wenn die Rekruten tschechischer Herkunft zum Heeresdienst eingerufen wurden, spannen vorläufig nur in wenigen Köpfen großslawische, monarchiefeindliche Träume. Die Rekruten aus dem tschechischen Industriegebiet waren nicht von nationaler Leidenschaft beherrscht. Sie dachten teils allgemein sozialistisch, teils kamen sie mit anarchistischer Färbung. Das russische Proletariat, die Arbeiterschaft der belgischen Kohlengruben, die italienische Arbeiterschaft lebte nicht in anderen Gedankengängen. Die slawische Idee brachten höchstens die Rekruten aus den tschechischen Städten mit, aufgewühlt von Volkstribunen, deren Treiben die Wiener Regierung lächelnd mit ansah; die Bauernburschen aus der mährischen Hanna, aus der böhmischen Fruchtebene verstanden die Idee kaum. Und immer hatte dann dreijährige Erziehung im Heer das gleiche Bild gezeigt: was zügellocker gekommen war, disziplinierte sich in straffer Zucht. Man konnte von einem wahrhaftigen Geist in der Armee sprechen, denn dieser Geist setzte sich wahrhaftig durch. Er modelte das Material. Er absorbierte restlos, was nicht in ihn paßte. Armee und Politik waren zweierlei Dinge in der Monarchie. Die Armee kannte keine nationalen Programme. Sie war unberührt. Noch umspannte sie als einheitliches, unbeflecktes Band alle Völker des Reiches. Nur wer in dieser Armee gelebt hatte, nur wer ihre Geschichte kannte, verstand die seltsame Erscheinung. Freiherr von Conrad hatte einer Überzeugung Ausdruck gegeben: »Die Armee wird das tun, was man ihr befiehlt.« Fälle von Widersetzlichkeit kamen wirklich vor, aber auch die tschechischen Regimenter standen und stürmten gegen Russen und Serben nicht viel anders als ungarische oder kroatische Regimenter. Paniken gab es bei allen Armeen. Vor Zolkiew hatten ungarische Honveds durch kopflose Flucht Lemberg den Russen überliefert. Auf dem Exerzierplatz vor Lublin rannte vor den Russen preußische Landwehr davon. Überläufer gab es allenthalben. Tschechische Trupps ergaben sich oder gingen über. Die Elsässer und Lothringer, die Polen lieferten in dieser Hinsicht den gleichen, wenn nicht höheren Prozentsatz. Berichte an das österreichisch-ungarische Hauptquartier nannten merkwürdige Überläuferziffern bloß aus dem Straßburger Korps. Daß man die Haltung der Elsässer und Polen verschwieg, war vielleicht klug. Daß man die Haltung der Tschechen in alle Welt hinausschrie, war sicher weniger klug. Wenn alle Welt, wenn der deutsche Bundesgenosse von Österreich-Ungarns militärischer Unzuverlässigkeit sprach, wenn Kaiser Franz Joseph selbst geschwankt hatte, wie weit er dem Staatsgefüge, dem Heeresgefüge trauen durfte, dann mußte der Großfürst Nikolai nicht als Einsamer an einen ehernen Zusammenhalt der Völker glauben, die er bekämpfte. Sicher war, daß Österreich-Ungarns Gefüge mehr Schwäche zeigte, als das ziemlich einheitliche Deutsche Reich. Sicher schien, daß Österreich-Ungarn auch der schwächere Gegner war.
Um so merkwürdiger war dann die Gesamtleistung der österreichisch-ungarischen Armee. Sie war zurückgedrückt worden. Aber sie war eigentlich immer noch nicht geschlagen. Von Vernichtung war schon gar nicht die Rede. Sie stand noch immer da. Im Gegenteil: gerade jetzt war sie wieder siegreich. In Galizien hatte sie die russischen Heere nach einem ganz bestimmten Willen umhergewirbelt. Ihre Heereskörper hatten eine Beweglichkeit ohnegleichen. Die große Flankenschlacht, die soeben geschlagen worden war, war in der Führerschaft vollkommen durchgeistigt. In Ostpreußen war von den Deutschen Tannenberg restlos gewonnen worden. Die Deutschen nannten diese Schlacht sogleich das »Beispiel einer Vernichtungsschlacht« und »die Musterschlacht bei Tannenberg«. Mochten sie auch den Sieger unverweilt zum Nationalhelden erheben: der neue Nationalheld Hindenburg hatte darum doch seinen polnischen Feldzug, noch im seelischen Bann seines großen Sieges, als ein Draufgänger unternommen, der seinen Gegner unterschätzte. Vielleicht war Hindenburg ein Blücher, vielleicht ein gewaltiger Haudegen vor dem Herrn. Konnte sein, daß die Zukunft ihn noch höher trug. Vorläufig ließ sein strategisches Genie sich noch ertragen. Der Stoß von Thorn herunter war fast so glanzvoll wie der Ring von Tannenberg. Aber die Schlacht bei Lodz war an der Arbeitsstätte des Triumvirats keineswegs zu Ende; sie fing dort erst an; sie reichte bis in die Karpathen. Mochten ruhig alle in Deutschland nur den einen feiern. Mochten ruhig alle in den deutschen Zeitungen von der schlotternden Angst schreiben, die der Nationalheld den Russen schon bei der Namensnennung bereite. Weil die Deutschen solch eine Tatsache feststellten, glaubten sie dennoch nicht die Russen. Das russische Hauptquartier mußte ganz im Gegensatz dazu spüren, daß hier irgendwo noch ein anderer war. Kein Triumvirat und kein Duo, sondern eine höchst persönliche, überall gleich charakteristisch durchwirkende Einheit. Die Anfangshaltung der österreichisch-ungarischen Truppen, ihre Zügelung, ihr Herumwerfen: all das war schon ungeheure Leistung von besonders geprägter Führung gewesen. Irgend jemand hatte über Nacht die schlesische Mauer gebaut, irgend jemand mit Uhrwerksgenauigkeit in die polnisch-westgalizischen Kämpfe eingegriffen. Alles, was geschah, hatte großes Format, die Linie war ohne Unterschied straff. Die Unterführung versagte bisweilen, weit öfter als bei deutschen Truppen: ein Kopf riß dann alles wieder hoch. Die Oberste deutsche Heeresleitung nannte den Generaloberst von Hindenburg den Oberbefehlshaber der deutschen Oststreitkräfte; aber nur aller deutschen Kräfte im Osten. Die österreichisch-ungarische Heeresleitung wahrte über ihre eigenen Truppen selbständiges Befehlsrecht. Hindenburg hatte ihnen nichts zu sagen. In Serbien hatte gerade zur Zeit der jüngsten Kämpfe ein österreichisch-ungarischer General eine empfindliche Niederlage erlitten. Feldzeugmeister Potiorek war von den Serben bitter geschlagen worden. Sein Heer war zersprengt, die Reste über die Donau zurückgeworfen. Aber Feldzeugmeister Potiorek zeichnete für seinen Kriegsschauplatz gleichfalls und durchaus selbständig. Mit den Leistungen Potioreks hatte der oberste Kopf und Herr im österreichisch-ungarischen Armeeoberkommando offenbar gar nichts zu schaffen. Die serbische Fahrlässigkeit war nicht sein Konto. Irgendein Mann stand dort oben im Dunkel der Nordost-Front und hatte doch alle Fäden in der Hand. Indes niemand ihn nannte, niemand ihn beachtete, war er bis jetzt gefährlicher als Hindenburg. Er griff überall ein. Er ließ sich nie verwirren. Er war nie zu entmutigen. Er war immer da. Er entriß den Russen die wahre Entscheidung jedesmal genau in dem Augenblick, da der Großfürst sie gefallen wähnte. Nicht eine Kopflosigkeit war ihm bisher vorzuwerfen. Obgleich mehr als einmal die Dinge so für ihn standen, daß mancher andere den Kopf verloren hätte. Und obzwar Österreich-Ungarn der schwächere Gegner war, schien doch bis jetzt in den Händen dieses Mannes die österreichisch-ungarische Armee für den Großfürsten das gefährlichere Kriegsinstrument. Der es so geschickt führte, mußte ausgeschaltet werden. Von ihm konnte Unheil drohen. Ihn mußte man vernichten. Das Instrument mußte zerbrochen werden. Vielleicht kam, wenn dies erst halb gelungen war, dann auch die helfende Zersetzung des Reiches schneller. In der Armee war vorläufig nicht mehr von ihr zu spüren, als in anderen Armeen auch. Die nüchterne Erwägung, daß Österreich-Ungarn im Zusammenhalt seines Hinterlands schwächer sei als Deutschland, daß Österreich-Ungarn aber im Augenblick gefährlicher war als Deutschland, trieb die Hauptmacht des Großfürsten noch einmal gegen die Heere der Monarchie. Ihren Kopf wollte er zerschmettern. Ihren Rumpf wollte er zerstückeln. Vielleicht war dann sogar wirklich die Verbindung mit den Serben möglich, die ihres Angreifers sich erwehrt hatten: die breitgespannte Brücke über Ungarn nach dem Balkan. Mit ungeheuren Fronten mußte man rechnen in einem Krieg, den der Kontinent ausfocht. Die Türkei würde dann abgeschnitten von den Mittelmächten. Die Mittelmächte würden eingeklemmt, wichtiger Vorratsmittel und der reichsten Hilfsquellen beraubt. Rumänien wartete. Italien wartete. Der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch war keineswegs nur ein sinnloser Knutenschwinger, auch keineswegs ein irrlichtelierender Phantast. Er ließ sich nur nicht von Stimmungen der Mittelmächte, von Selbsteinflüsterungen deutsch-österreichisch-ungarischer Volksbegeisterung, nicht von deutsch-österreichisch-ungarischen Vergötterungen die eigene Wahrnehmung und den eigenen Verstand verwirren. Er tat, als glaubte er tatsächlich, wovon bei den Mittelmächten jeder behauptete, daß Frankreich, England, Rußland es glaube. Er glaubte sogar an den Russenschreck. Im übrigen ließ er freilich Hindenburg ohne weiteres Hindenburg sein. Das ganze Triumvirat ließ ihn vorderhand kühl. Der Kopf der Monarchie war ihm jetzt wichtiger. Noch einmal holte er zu einem Riesenschlage aus. Der Großfürst rüstete seine Karpathenheere.
Russische Streiftruppen waren über die Karpathen schon im Herbst 1914 vorgedrungen. Zusammengeraffter Landsturm hatte sie wieder über die Pässe gejagt. Zusammengeraffter Landsturm war sogar bis in die preisgegebene Bukowina wieder vorgedrungen, Freischaren hatten sich für kurze Zeit selbst in Tschernowitz festgesetzt. Aber die Russen kamen wieder. Bisher waren es Kleinkämpfe gewesen. Jetzt begann gegen die ganze Karpathenfront ein Heer anzuwogen, das allmählich fünfviertel Millionen Soldaten zählte. Die Karpathenpässe – der Uszoker Paß, der Duklapaß – fielen in russische Hand. Eigentlich stand auf österreichisch-ungarischer Seite nur die Armee Boroevic zum Schutze da. Denn Böhm-Ermollis Heer war noch in Schlesien. Dann besaß General Pflanzer-Baltin gegen die Bukowina zu noch so eine Art Armee, die eigentlich erst in der Bildung begriffen war. Wieder war die Not groß.
Freiherrn von Conrad drückte die Sorge schwer. Zu der Erwartung des neuen russischen Ansturms kam das Bangen um die Festung Przemysl, die durch die Vorgänge an der Weichsel abermals verloren war. Einen Entsatzversuch wollte er wagen. Aber um Przemysl allein ging es gar nicht. Auch für Galizien selbst mußte etwas geschehen. Conrad hatte einmal den Plan gehabt, seine Truppen an den Paßübergängen zu sammeln, aus den Pässen hervorzustoßen und so die Russen jenseits der Pässe zusammenzudrücken. Aber, wenn er Böhm-Ermollis Armee jetzt auch aus Schlesien zurückholte, hatte er an Truppen immer noch zu wenig. Dieser Krieg war für ihn ein ewiges Hin und Her mit gleich wenig Mitteln, ein Krieg der beständigen Behelfe, vor allem ein Kampf mit geistigen Einsätzen, die auch durch Verblüffung und Schnelligkeit nur in bestimmtem Maß das gewaltige Material des Gegners aufwogen. Dauernd hatte solch eine Methode keine Aussicht auf Erfolg. Die Oberste deutsche Heeresleitung hatte aus dem Westen, wo der Kampf zum Stellungskrieg geworden war, zwar längst Truppen nach dem Osten geschickt. Aber sie hatte diese Truppen ausschließlich nach Ostpreußen, ausschließlich dem Triumvirat im Lager des Generalfeldmarschalls von Hindenburg für seine Kampfhandlungen geschickt. Sie hatte bisher in Ostpreußen, in Mittelpolen ausschließlich und einzig deutsches Gebiet geschützt. Erst in den Dezemberkämpfen von Lapanow-Limanowa war in den Rahmen der österreichisch-ungarischen Truppen eine einzige deutsche Division eingefügt worden. 20 000 Mann. Nicht mehr und nicht weniger. So sah, obgleich der Krieg nunmehr schon fast ein Halbjahr währte, die deutsche Hilfe aus. Freiherr von Conrad beschloß, auf Änderung endlich zu bestehen.
Moltke, der sich an die Chefstelle des Deutschen Generalstabes niemals gedrängt hatte, war nach der Marneschlacht von seinem Amte abgelöst worden. Er starb in Bitternis. Der preußische Kriegsminister General von Falkenhayn war an seine Stelle getreten. General von Falkenhayn hatte nicht von vornherein die Art preußischer Junker. Seinem Willen verstand er offenbar Geltung zu schaffen. Doch war alles an ihm weltmännisch, klug und geschmeidig. Er sprach gut, fand auch warme und überzeugende Töne, war überhaupt im ganzen nicht ohne den Eindruck einer gewissen, ruhigen Überlegenheit. Denn nur selten geschah es, daß er seine hellgrauen Augen, wenn er rasch den Kopf herumwarf, jäh aufblitzen ließ, wobei sie dann freilich stechenden Ausdruck zeigten. Dem General von Falkenhayn, der hoch in der Gunst seines kaiserlichen Herrn stand, konnte niemand nachsagen, daß er nicht auch fremde Interessen anhörte, daß er den Horizont nicht begriffen hätte, an dem fremde Interessen mit deutschen Interessen sich kreuzten, daß er nicht auch fremde Ideen von Zeit zu Zeit willig und, soweit dies mit seinem abgeschliffenen Wesen sich vertrug, sogar feurig zur eigenen Idee machte. Was Freiherr von Conrad ihm vortrug, sah er schneller ein als der scheu gemachte Moltke, der nach den Erlebnissen an der Marne den Boden Frankreichs überheiß empfand. Graf Moltke hatte nichts von großen Dingen im Osten, nichts von einer Abrechnung zunächst mit Rußland hören wollen. Kaum die russische Gefahr hatte er anerkannt. Falkenhayn sah, daß alles in Frankreich jetzt stillstand. Daß vorläufig der Krieg im Westen nicht zu entscheiden war, und daß selbst für den Fall eines Sieges in Frankreich der ganze Krieg unnütz geführt werde, wenn Österreich-Ungarn unter russischem Druck zusammenbrach. General von Falkenhayn gab daher Truppen an Freiherrn von Conrad. Für die Monarchie sollte endlich etwas geschehen. Nicht nur verantworten ließ es sich: es war geradezu Pflicht. Freiherr von Conrad verlangte deutsche Truppen für die Karpathen. Allerdings hatte General von Falkenhayn Bedenken. Gebirgstruppen wären die Deutschen nicht. Conrad beschwichtigte ihn. Die Karpathen wären nicht die Alpen, und den leichten Train, der dort in den Bergen nötig sei, stelle er aus dem eigenen Heer. Falkenhayn widerstritt nicht länger. Nur einen besonderen Wunsch hatte er noch. Sofort wollte er vier Divisionen an die Karpathenfront stellen; aber Freiherr von Conrad sollte gleichfalls vier Divisionen bereithalten. Aus allen acht Divisionen wollte er, Falkenhayn, eine neue eigene Karpathenarmee bilden. Daß vier österreichisch-ungarische Divisionen genau die Hälfte der neuen Armee ausmachten, könnte eine vertrauliche Angelegenheit der verbündeten Generalstäbe bleiben. Aber nach außen hätte das neue Karpathenheer den Namen »Kaiserlich deutsche Südarmee« zu führen. Zum Armeekommandanten sei der Generalleutnant von Linsingen ausersehen. Freiherr von Conrad fand das Ansinnen merkwürdig. Den politischen Sinn solcher Haltung gegen den Bundesgenossen begriff er nicht. Vernünftig war, sein Ansehen in der öffentlichen Meinung zu stärken, nicht zu schwächen. Das Gegenteil konnte Verstimmungen, vielleicht sogar Schädigungen in Zukunft bringen. Aber anders gab Falkenhayn keine Truppen. Der Ruhm war für die deutschen Waffen da, auch wenn eigentlich ebensoviel andere Waffen mitschlugen. Hier kam, so schien es Freiherrn von Conrad, in das Weltmännische, fast Diplomatische, das General von Falkenhayn sonst hatte, ein Zug plötzlich horizontbeengten Junkertums. Freiherrn von Conrad war der Ruhm so gleichgültig wie Würden und Orden. Vielleicht war dies Bescheidenheit, vielleicht auch Selbstbewußtsein. Es schien, als kümmerte ihn nur die Sache. Nicht gleichgültig waren ihm Przemysl und Galizien. Viel Zeit zur Überlegung gab es auch nicht. Die Russenheere stauten sich. Freiherr von Conrad nahm an. Zum Ende des Januar 1915 stand der General von Linsingen mit acht Divisionen marschbereit im Karpathenabschnitt östlich des Uszoker Passes. Als Armeebefehlshaber unterstand er mit seinen Truppen dem österreichisch-ungarischen Armeeoberkommando so gut wie der deutschen Heeresleitung. Von beiden bekam er die gemeinsam festgelegten, gemeinsam unterfertigten Befehle. Aber dieser Umstand ließ den General von Falkenhayn kühl. Diesen Umstand vermochte man weder im Reiche, noch in der Monarchie zu erkennen. Es war eine etwas merkwürdige Angelegenheit. Aber wie sie auch war: in den Karpathen half dem Bundesgenossen eine Kaiserlich deutsche Südarmee. An ihrer Spitze stand der kaiserlich deutsche General von Linsingen.
Die Russen hatten auf Ungarn zu in die Pässe gedrückt. Sie hatten sie um die Jahreswende 1914/15 genommen. Conrad mußte die Pässe wiederhaben. Ende Januar 1915 drückte er entlang der ganzen Karpathenfront nach Galizien und der Bukowina aus den Bergengen heraus. Conrad wollte auch Przemysl befreien. Bis gegen Ende März konnte die Festung sich halten. Die Pässe wurden zurückgenommen. Von Cisna am Uszoker Paß zählte der Weg nach Przemysl 60 Kilometer. Der Weg schnitt zwar die Kammlinien der Karpathen, aber wenn der furchtbare Winter im März nur ein wenig nachließ, wenn Freiherr von Conrad nur genug Kräfte aufbrachte, mußte das Befreiungswerk gelingen. Im Hauptquartier in Teschen setzte Conrad dem General Böhm-Ermolli, als er von Schlesien mit seinen Truppen durchfuhr, rasch seine Pläne auseinander. Böhm-Ermolli hatte Bedenken, die sich entkräften ließen. Freiherr von Conrad rechnete ihm die 110 000 Feuergewehre vor, die Böhm-Ermolli noch immer besaß. Es handelte sich gar nicht um ganze 60 Kilometer. Je weiter sich Böhm-Ermollis Armee nach Norden kämpfte, desto stärker wurde die Unterstützung durch die Ausfallstruppen der Festung selbst. Kühn war die Operation. Aber sie war schön zugleich. Und außerdem: an Böhm-Ermollis rechtem Flügel stand die »Kaiserlich deutsche Südarmee«. In der Bukowina schloß sich die kampffertige Armee Pflanzer-Baltins an. Links von Böhm-Ermolli stand das Heer des Generals Boroevic. Alle vier Armeen sollten gleichzeitig Befehl zum Vormarsch erhalten. Böhm-Ermolli reiste ab. Der Vormarsch begann.
Pflanzer-Baltin stürmte förmlich durch die Bukowina nordwärts. Boroevic durchkämpfte einen schweren Angriff der Russen, der gegen seine Front von ihnen als Generalangriff geführt wurde. Böhm-Ermolli schritt zäh, dennoch stetig und sichtbar auf Przemysl vor. Still stand aber der Generalleutnant von Linsingen. Böhms Flankenschutz versagte damit. Dem General von Linsingen war die Erreichung der Stadt Stry in Galizien als Ziel befohlen. Aber Linsingen kam keinen Schritt vorwärts. Zwischen ihm und Pflanzer klaffte schon ein Riß: Pflanzer mußte seinen Vormarsch zügeln, mußte selbst wieder Rückmarsch daraus machen, wenn er nicht Gefahren beschwören wollte. Plötzlich setzte obendrein schwerster Nachwinter ein. Die Truppen marschierten und schlugen sich bei zwanzig Grad Kälte. Schließlich deckte Berg und Tal der Schnee meterhoch. Der Vormarsch hörte auf. Automatisch. Przemysl fiel. Durch Hunger. Die allzu große Sparsamkeit im Frieden, die Kleinlichkeit in der Bewilligung der für die Reichsbefestigung geforderten Mittel hatten sich gerächt.
Die Kämpfe aber gingen weiter. Die Russen drückten nach Süden, die Verbündeten nach Norden. Das Ergebnis war die ungeheuerliche Karpathenschlacht, die durch Monate währte. Ihr Grauen, ihr Entsetzen übertraf, was immer der Krieg bisher ersonnen hatte. Die Elemente selbst traten in den Krieg. Der Großfürst gab allen Einsatz her. 500 000 Russen bettete er tot in die Karpathen. Der Großfürst grub Rußlands Grab vor Ungarns Toren. Oft brach er halb die Tore schon auf. Freiherr von Conrad schlug sie wieder zu. Freiherr von Conrad war überall: in dem kleinen zierlichen Manne steckten federnde, unberechenbare Kräfte. Wie der russische Gigant vorstürmte, sah es aus, als schnitte er sich selbst alle Adern auf. So mußte schließlich seine Kraft verströmen. Er hatte die »Kaiserlich deutsche Südarmee« heftig, dennoch nicht so hart angegriffen wie Böhm-Ermolli und Boroevic. Vor allem mit den Truppen der zersetzten Monarchie rang er. Als er fast verblutet war, traf neuerlich ein deutsches Korps ein. Es griff mit einer Wucht an, die der Erschöpfte nicht mehr ertrug. Und auch der ausgeruhte General von Linsingen begann endlich zu marschieren. Wo immer deutsche Mannschaft, deutsche Offiziere, wo immer das deutsche Volk kämpfte, war dies Kämpfen beispiellos. Vom Glanze oberster deutscher Führung sprach, schrieb, las alle Welt, von ihm sprach vor allem die deutsche Führung selbst. Sie war nicht immer glanzvoll. Aber wo mit deutscher Truppe, mit dem Einsatz deutscher Volkskraft allein eine Entscheidung durchgesetzt werden konnte, fiel fast ausnahmslos die Entscheidung für das deutsche Volk. Das Kriegsinstrument der Deutschen war fleckenlos, blieb rein in Ost und West. Am Ende der Karpathenschlacht gab es den Russen den letzten, unbarmherzigen Stoß. Die längst Erschöpften mußten ihr Blut völlig versickern lassen. Der Großfürst hatte den Einsatz verspielt. Die große Karpathenschlacht schlief ein.
Aber Freiherr von Conrad schlief nicht. Er saß über galizische Karten gebeugt. Vor ihm lagen die Verlustziffern der Russenheere aus den langen Monaten der Karpathenschlacht. Er übersah die Heerscharen der Toten und Verwundeten. Die Riesenarmee des Großfürsten Nikolai war völlig entkräftet, sie hatte sich verkämpft und verbraucht. Der Koloß hatte vor Lemberg geblutet, in Ostpreußen und in Polen. Hindenburgs Winterschlacht in Masuren hatte wiederum fast eine ganze russische Armee zertrümmert. Die Karpathenschlacht allein aber hatte eine Reihe von russischen Heeren begraben. Zuletzt noch, als Przemysl gefallen war, als dort die Belagerungsarmee frei wurde, versanken vor Uszok noch 100 000 Russen in Feuer und Schnee. Alle Bahnen in Galizien dampften von Zügen. Aber sie fuhren alle landeinwärts ins Russische, in weitem Bogen um die Stadt Lemberg, dessen spähende Menschen nichts erschauen, nichts erzählen sollten: die galizischen Bahnen trugen nur mehr russische Verwundete. Es war klar, daß Rußland blutleer wurde. Es war klar: das reiche, unerschöpfliche Rußland stand am Wege, arm zu werden.
Freiherr von Conrad sah ein, daß er nicht rasten durfte. Weit eher war die Zeit der Tat nahe; wenn jemals, so war der Augenblick des Angriffes, die Möglichkeit der russischen Bezwingung jetzt gekommen. Wenn Conrad von Hötzendorf sich in seine Karten vertiefte, so trat die Eigentümlichkeit der Russenfront, hinter der Galizien lag, immer deutlicher, das Besondere dieses Frontaufbaues immer schärfer hervor. Von Polen herein lief die russische Stellung hinter dem Dunajec nahezu geradlinig bis an die Karpathenberge. Dann bog sie bald hinter Gorlice mit einem beinahe rechten Winkel um, dann lief sie, abermals fast in einer Geraden, über die Pässe der Berge am Karpathenkamm nach Osten zu.
Je tiefer er sich in die Karten vergrübelte, desto lebendiger sprangen ihm dicke Striche, dicke Knoten und tiefe Flecke entgegen. Vorn die Front selbst, die einzelnen Frontabschnitte, beachtete Conrad nicht. Aber ein Gerippe, ein Gerüst wurde die Karte von Galizien. Die dicken Striche waren die Bahnen, die den Russen gehörten. Die dicken Knoten waren die Treffpunkte, die Kreuzungen der Bahnen. Die tiefen Flecke waren die großen Becken der galizischen Landschaft, die sich von West nach Osten fortsetzten. Sie waren die Sammlungsräume, die Aufstapelungsräume der Russen. Dort standen ihre Magazine, dort stauten sich ihre Trains. Freiherr von Conrad kümmerte sich nicht um Truppenteile. Aber die Striche und Knoten waren die Nervenstränge des russischen Heeres. Sie speisten den russischen Heereskörper, sie speisten die Sammelräume, sie gaben dem russischen Heereskörper nicht bloß die Kraft, sie allein gaben ihm überhaupt die Möglichkeit des Lebens. Sie allein gaben ihm die Möglichkeit, Galizien überhaupt zu halten. Ihre Anatomie studierte er. Das russische Heer lag hinter dem Dunajec von Nord nach Süd. Vor den Karpathen lag es von West nach Ost. Aber in dem großen galizischen Raum dahinter liefen die dicken Striche, die Nervenstränge, die den Körper speisten, alle von Norden nach Süden. Wenn Freiherr von Conrad Truppen ballte, wenn er als ein jähes, unerwartetes Ungewitter von Westen hereinbrach, wenn er quer und breit vom Westen durch die Beckenreihe von Krosno-Jaslo nach Ost vorstieß, so waren alle russischen Zufahrtsbahnen Nord-Süd durch den einen gewaltigen Stoß von Westen nach Osten durchsägt. Die Nervenstränge waren dann entzweigerissen. Die Speisung durch Masse, Munition, Material hörte für die Russen mit einem Schlage auf. Ihr ganzer galizischer Aufbau stürzte zusammen. Wenn man den Vorstoß überdies nahe dem Frontknie ansetzte, oberhalb der Stelle, wo die vom Norden herabeilende russische Linie scharf nach dem Osten umbog, so mußte die vorstoßende eigene Angriffsarmee nach geglücktem Durchbruch unmittelbar im Rücken beider russischer Frontteile stehen. Es gab dann für die Russen nicht Rückzug; dann gab es nur schnellste Flucht, sonst war alles durch die Aufrollung bedroht. Hier war die Aussicht auf endlichen Erfolg. Hier konnte ein rascher, gewaltiger Schlag den gefährlichsten Gegner nicht bloß zurücktreiben, vielleicht sogar – für immer – außer Gefecht setzen.
Was Freiherr von Conrad jetzt über seinen Karten baute, war von ihm übrigens auch 1915 im Kriege schon einmal versucht worden. Ende März 1915 hatte er zwei Divisionen vor Gorlice im Angriff vorgeschickt. Der Angriff war kein Durchbruch geworden. Tiroler Kaiserjäger hatten den Friedhof von Gorlice gestürmt. Mehr war nicht geglückt. Zwei Divisionen waren keine Armee. Die Kräfte hatten nicht gereicht. Man mußte warten. Aber jetzt, da die Karpathenschlacht eben im Ausklingen war, da die Blutleere der Russen sichtbar wurde, jetzt wollte er nicht mehr warten. Hundertmal hatte er über der Befreiungstat gegrübelt. Hundertmal hatte er die Einzelheiten seines Planes mit den Offizieren der Operationskanzlei, mit den Referenten für den russischen Kriegsschauplatz, durchgesprochen. Jetzt mußte er Truppen bekommen um jeden Preis. Truppen hatte der General von Falkenhayn. Conrad legte die Stoßrichtung fest. Conrad bestimmte den Angriffsraum. Conrad berechnete die Zahl der Truppen, die nötig waren, wenn der Erfolg sicher sein sollte. Conrad ließ ausarbeiten, wie es um die Leistungsfähigkeit der Bahnen stand, die dem Aufmarsch dienen mußten. Und er berechnete, wie lange der Aufmarsch dauern sollte. Dann fuhr er nach Berlin. Er wollte mit Falkenhayn sprechen.
Falkenhayn begriff sofort. Was ihm Conrad über den Stoß durch die Beckenreihe von Gorlice-Krosno-Jaslo in ausführlicher Besprechung im Berliner Kriegsministerium vortrug, mußte einleuchten. Der deutsche Generalstabschef bot zwei Divisionen an. Aber so viel konnte zur Not auch Conrad aufbringen. Selbst vier Divisionen hätten nicht genügt. Conrad reiste aus dem »Hotel Adlon« unverrichteter Dinge ab. General von Falkenhayn bestritt nicht, daß Conrads Absicht die Wahrscheinlichkeit des Erfolges für sich hätte. Er bestritt nur, daß er im Augenblick mehr Truppen entbehren könnte.
Ganz plötzlich kam es dann, daß Falkenhayn umschwenkte. An der österreichisch-ungarischen Karpathenfront war das zehnte Korps von einem starken Angriff der Russen durchbrochen worden. Von deutschen Truppen, die Freiherr von Conrad zur Unterstützung erbeten hatte, war dort die Lage unter der Führung des Generals von der Marwitz zwar wieder hergestellt worden, aber die Angriffe der Russen hatten sich immer heftiger auch auf den Raum der Armee Böhm-Ermolli ausgedehnt, die hart ins Gedränge kam. Freiherr von Conrad entschloß sich, abermals Truppenaushilfe von Falkenhayn zu erbitten. Er teilte seine Wünsche dem deutschen Bevollmächtigten, General von Cramon, mit. Herr von Cramon, in allen Vermittlungsfragen zwischen den Chefs der beiden Generalstäbe ein Mann von feinstem Taktgefühl, zugleich ein Militär von großer und schnell erkennender Einsicht, Herr von Cramon neigte zu der Ansicht, daß diesmal die deutsche Heeresleitung neue Truppen nicht zur Verfügung stellen werde. Zum wenigsten wäre sehr zweifelhaft, ob sie weitere Verbände im Osten für defensive Aufgaben werde festlegen wollen. Vielleicht für offensive Zwecke … Aber General Conrad nannte einen Angriff aus dem Raum der zweiten Armee, der ja vor kurzer Zeit zum Entsatz von Przemysl versucht worden und nicht durchgedrungen war, ein Unternehmen von geringer Aussicht. Er verabschiedete sich von Herrn von Cramon.
Und ließ ihn eine Viertelstunde später zu sich bitten. General von Cramon hätte vorhin von Offensive gesprochen. Wenn an eine Offensive gedacht würde, so käme dafür nur ein Angriff aus dem Raume von Tarnow-Gorlice in Betracht. Conrad entwickelte dem General von Cramon jetzt seine Gedankengänge über solch eine Offensive aus dem Raume von Tarnow-Gorlice. Noch in der gleichen Nacht gab Herr von Cramon die Anregung mit Conrads Gedankengang an den General von Falkenhayn weiter. Die Antwort lief unverzüglich ein. Auch er – General von Falkenhayn – hätte sich schon viel mit der angeregten Idee beschäftigt … Er sei nicht abgeneigt … General von Cramon möchte Einzelheiten ausarbeiten.
General von Cramon arbeitete die Einzelheiten aus, mit Oberst Straub, der – nach den Weisungen des Generals Metzger – die Daten über die Leistungsfähigkeit der Bahnen bereits zusammengestellt hatte. General von Cramon schlug vier Divisionen für das Unternehmen vor. Er gab Einzelheiten über die Vormarschwege jenseits der russischen Front, wenn diese einmal durchbrochen wäre. Er übermittelte die Einzelheiten an Falkenhayn. Der Chef des deutschen Generalstabes sandte ein umfangreiches Schriftstück zurück und übermittelte seinerseits gleich festumrissene Vorschläge. Das Schriftstück sprach dabei stets wie von einer ganz neuen Angelegenheit. Geplant wäre ein Angriff in Galizien, für den mit sehr vieler Artillerie sechs Divisionen bereitgestellt würden. Drei weitere Divisionen würden in der Folge nachkommen. Der nähere Plan sei, von West nach Ost einen »Stoß durch die Beckenreihe Krosno-Jaslo« zu führen. Gorlice sei zum Angriffsraum gewählt. Vor allem auch wegen der Leistungsfähigkeit der dort in Frage kommenden Bahnen. Freiherr von Conrad las das Schriftstück überrascht und verdutzt zugleich. Seine beiden ersten Generale Metzger und Christofori, die die Vorgeschichte kannten, waren nicht weniger verdutzt. Dem deutschen Generalstabschef hatte Freiherr von Conrad wiederholt erklärt: »Rivalitäten wollen wir nicht aufkommen lassen. Wer dies, wer jenes gemacht hat, darauf kommt es nicht an. Wenn nur das Ziel erreicht wird.« Daß aber der General von Falkenhayn sich weder auf die Berliner Beratung bezog, noch daß überhaupt das Schriftstück Gelegenheit nahm, den Schöpfer des Grundgedankens zu dem neuen Vorhaben auch nur zu erwähnen: alle diese Umstände stellten ein um so größeres Kunststück dar, als das Exposé des Generals von Falkenhayn den von Freiherrn von Conrad geprägten, allen Offizieren seines nächsten Stabes längst geläufigen, hier bezeichnenden Ausdruck – den »Stoß durch die Beckenreihe von Krosno-Jaslo« – ruhig übernommen hatte. Das Schriftstück berief sich noch besonders auf die »Leistungsfähigkeit der in Frage kommenden Bahnen«. Woher wollte, wenn nicht aus den Vorträgen Conrads im Berliner Kriegsministerium und den Studienergebnissen des Generals von Cramon mit Oberst Straub, der General von Falkenhayn wissen, wie leistungsfähig die ihm fremden Bahnen waren? Unwillkürlich mußte das ganze Schriftstück den Eindruck eines Planes durchaus deutscher Herkunft und durchaus deutscher Selbständigkeit erwecken. Jedenfalls hatte das Vorhaben hier seine erste, offizielle Niederschrift. Wer die Vorgeschichte nicht kannte, wer Freiherrn von Conrads Mitarbeiter nicht sprach, wer auch den General von Cramon nicht fragte, der am ganzen Hergang der Dinge, an ihrer positiven Entwicklung das größte Mitverdienst hatte, ohne die zweifellos intellektuelle Urheberschaft Conrads an dem ganzen Unternehmen zu leugnen, wer nur in das Schriftstück blickte, mußte sich allerdings darauf vorbereiten, daß der kommende Sieger von Tarnow und Gorlice der General von Falkenhayn war. Vielleicht war der deutsche General auch wirklich nur merkwürdig zerstreut gewesen. Freiherr von Conrad blieb auf alle Fälle sachlich. Den Generalen Metzger und Christofori reichte er das Schriftstück zurück:
»Jetzt wird gemacht, was wir immer gewollt haben. Sie werden es uns wieder nehmen. Aber die Hauptsache: es wird gemacht – –«
Mehr sagte er nicht. Vielerlei blieb noch zu regeln. Noch sah er nicht, ob hier nicht doch ein Fehler seines Wesens war. Ob er nicht doch der Volkspsychologie zu wenig Rechte gab, die sehnsüchtig nach Heroen verlangt. Im deutschen Lager wurden Postamente gezimmert und Büsten verfertigt. Der Eifer war groß. Vor der Berliner Siegessäule wuchs der eiserne Hindenburg aus Holz in den Himmel. Freiherr von Conrad aber, der unsichtbare Gegner, den der Großfürst gesucht hatte, Freiherr von Conrad, den das deutsche Hauptquartier willig schätzte und noch williger arbeiten ließ, Freiherr von Conrad sorgte selbst für Dunkel und Schatten, darin er sich verbarg. Vielleicht hatte er Gründe. Aber keinesfalls war er bereit, sich zu zeigen. Wer ihm davon sprach, hörte das Wort: »Von meiner Linie möchte ich nicht abweichen.« Viel anderes blieb vorderhand noch zu regeln.
Den aus dem Westen anrollenden sechs deutschen Divisionen sollte das österreichisch-ungarische Korps des Generals Arz von Straußenburg beigegeben werden. Alle sollten zu einer neuen Armee zusammengefaßt werden: Mackensen war zum Armeebefehlshaber bestimmt. Übrigens sollte sich auch die österreichisch-ungarische vierte Armee, die statt des Generals von Auffenberg schon eine ganze Weile Erzherzog Josef Ferdinand führte, an den bevorstehenden Kämpfen beteiligen. Auch Josef Ferdinand hätte auf Falkenhayns besonderen Wunsch dem Generalfeldmarschall von Mackensen zu unterstehen. Freiherr von Conrad sah zwar die Notwendigkeit dazu nicht ein; der deutsche Wunsch nach Außenwirkung begann ein wenig weit zu gehen; aber er konnte in die neue Bedingung doch einwilligen, da sowohl der Erzherzog, als auch der Generalfeldmarschall von Mackensen seinem eigenen unzweideutigen Oberbefehl unterstand. Nunmehr durfte Mackensens Stabschef Seeckt mit seinen Offizieren nach Teschen herüberkommen, um sich mit General Metzger und dessen Offizieren zur Ausarbeitung und Beratschlagung der Einzelheiten an einen Tisch zu setzen. Ihre Arbeiten gediehen rasch. Das Endergebnis wurde Freiherrn von Conrad vorgelegt. Conrad selbst brachte die letzten entscheidenden Korrekturen an. Das Manuskript wurde dann in zwei Abschriften hergestellt. Beide Abschriften wurden unterfertigt: »Conrad – Falkenhayn.« Ein Stück behielt das österreichisch-ungarische Armeeoberkommando. Das zweite Stück ging nach Berlin.
Von da ab rollt alles mit überraschender Geschwindigkeit. In Berlin hatte der General von Falkenhayn, so wenig kleinlich er in der Truppenbeisteuer gewesen war, als Herr von Cramon bei ihm vorsprach, doch noch einmal geschwankt. Cramon hatte er gefragt: »Wollen wir es also machen?« – General von Cramon war mit der gleichen Wärme für die Aussichten der Offensive eingetreten, wie in jenem Telegramm nach der Unterredung mit Conrad. Da hatte Falkenhayn das Schwanken aufgegeben. Er drückte auf einen Knopf. Tappen trat ein, sein erster Offizier.
»Lassen Sie die Divisionen abrollen.« –
Und bei Tarnow und Gorlice zerbricht der Angriff der Verbündeten die russische Front. Der Schlag ist furchtbar. Nach wenig Tagen ist der Gegner überall im Rückzug. Westgalizien ist frei. Die russische Karpathenfront wankt. Auch sie wird überstürzt zurückgenommen. Der Krieg erlebt die ersten phantastischen Gefangenenziffern und Beutezahlen aus einer einzigen Schlacht. Der Stoß geht durch die Beckenreihe Krosno-Jaslo. Die Stimmung des Generals Falkenhayn ist gehoben. Mackensen und der Erzherzog sind auf stürmendem Vormarsch, Boroevic und Böhm-Ermolli den Russen von den Karpathen her auf den Fersen. Pflanzer-Baltin steht in Tschernowitz. Und auch der General von Linsingen wird glücklich nach Stry kommen. Falkenhayn hofft, daß die Truppen in Westgalizien bis an den San und Tanew gelangen werden. Dort aber will er, daß sie haltmachen. Daß sie in fester Erdsicherung sich eingraben. Freiherr von Conrad ist anderer Meinung.
»Wir werden weitergehen. Wir werden nicht stehenbleiben.«
Conrad denkt an Ostgalizien. Falkenhayn ist nicht davon abzubringen, daß am San gehalten werden müßte. Aber Conrad drängt und drängt. Die drei frischen Divisionen rollen an, die das deutsche Schriftstück angekündigt hat. Falkenhayn will ihren Vormarsch nach Polen ansetzen, in der Richtung etwa auf Lublin. Conrad ist anderer Meinung. Der Besitz polnischer Gebiete wird sich ganz von selbst ergeben. Unnötig ist, daß vor der Säuberung Galiziens eine polnische Erwerbung stehe. Strategisch hätte ein Marsch auf Lublin vorläufig auch wenig Sinn. Er erreicht es bei Falkenhayn, daß die Armee Mackensen nunmehr über Rawaruska südostwärts marschiere; zugleich führt er über Mosziska die Armee Böhm-Ermolli nordostwärts vor. Der neue Stoß ist weiter nach Osten geplant, aber wo beide Armeen sich treffen, wird zunächst auch Lemberg liegen. Conrad von Hötzendorf gibt der Monarchie Lemberg zurück. Wieder ist der besorgte Falkenhayn mit aller Entschiedenheit dagegen, nunmehr auch noch den Bug zu überschreiten, genau wie er sich am San gegen den Übergang gewehrt. Ein Vorwärtskommen in der Sumpfzone wäre undurchführbar. Conrad ist anderer Meinung.
»Sie werden sehen, daß es geht.«
Conrad setzt seinen Willen durch. Und es geht. Conrad hat die grundlegenden Operationen des Durchbruches ausgedacht; er hat Galizien wiedergenommen. Er hat den Zug der Offensive mit einem berauschenden Rhythmus und einer gewaltigen Entschlossenheit geführt: gegen Falkenhayns stets erneute Bedenken und Besorgnisse geführt. Die Russen sind geworfen, geschlagen und zu Paaren getrieben. Der Koloß ist umgerissen. Tief in Wolhynien stehen die verbündeten Heere. Längst haben die Fäden auf Polen übergegriffen. Die Weichselfestungen sind nicht mehr zu halten. Jetzt mußte nach Galiziens Fall, da die Verwirrung und Schwächung der russischen Heere hoch nach Norden übergriff, auch Warschau, jetzt mußte ganz Polen fallen. Die Feuerzeichen des Gorlicer Angriffs lodern zuletzt aus Brest-Litowsk. Fünf große Akte sind vorbei. Die Erinnerung an die grauenhafte Übermacht Rußlands ist ein ferner, böser Spuk. Der Nebenschauplatz Ostpreußen sah Zusammenbruch und Auferstehung. Nach dem schnellverrauschten polnischen Intermezzo, nach der Zimmerung des Riegels, der von Lodz bis Limanowa reichte, der gesprengt zu werden drohte, aber dennoch hielt, ist die Atempause kurz. Die Karpathenschlacht strebte gleich darauf der Peripetie mit gespensterhaften Heerscharen zu. Die russischen Mitspieler waren weit über Millionen hinaus tot, verwundet und gefangen. Tarnow und Gorlice aber ist jetzt des Schicksals eherne Lösung. Das große Drama ist vorläufig zu Ende. Die Verbündeten atmeten im Osten frei. Der gefährlichste Gegner ist wehrlos.
Auf dem Balkan stehen seine Bundesgenossen in Waffen.