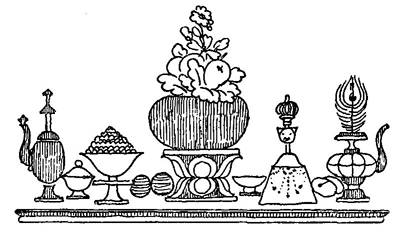|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
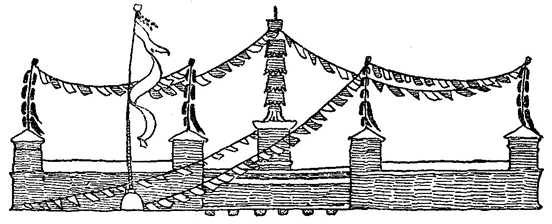
 Während Tsangpo Lama sein Abenteuer auf dem See bestanden hatte, war innerhalb der Pilgerkarawane eine große Veränderung vor sich gegangen. Die Mandarine und die tibetischen Gesandten hatten beschlossen, den Aufenthalt im Delta des Stroms der Jakstiere abzukürzen. Deshalb waren vier Fünftel der Karawane schon vor einigen Tagen nach Tibet aufgebrochen, und nur die Tsacharen und die Sunjut- und Barinmongolen waren zurückgeblieben, die ersteren, um die Rückkehr ihres Stammesgenossen abzuwarten, die letzteren, weil sie damit beschäftigt waren, Jake gegen Kamele einzutauschen. Jetzt wurden die führenden Häuptlinge und Mönche zusammengerufen und beschlossen, bereits am folgenden Tag aufzubrechen und den Spuren der Hauptkarawane zu folgen.
Während Tsangpo Lama sein Abenteuer auf dem See bestanden hatte, war innerhalb der Pilgerkarawane eine große Veränderung vor sich gegangen. Die Mandarine und die tibetischen Gesandten hatten beschlossen, den Aufenthalt im Delta des Stroms der Jakstiere abzukürzen. Deshalb waren vier Fünftel der Karawane schon vor einigen Tagen nach Tibet aufgebrochen, und nur die Tsacharen und die Sunjut- und Barinmongolen waren zurückgeblieben, die ersteren, um die Rückkehr ihres Stammesgenossen abzuwarten, die letzteren, weil sie damit beschäftigt waren, Jake gegen Kamele einzutauschen. Jetzt wurden die führenden Häuptlinge und Mönche zusammengerufen und beschlossen, bereits am folgenden Tag aufzubrechen und den Spuren der Hauptkarawane zu folgen.
Wieder herrschte in dem eben noch so ruhigen Lager lebhafte Geschäftigkeit. Alle Lasten wurden abgewogen und bereitgestellt und am Abend die Tiere von den Weideplätzen heimgetrieben. Wohl stand Mittwinter bevor, die Zeit der scharfen Kälte, und es war keine Aussicht vorhanden, bis zum Neujahrsfest ans Ziel zu gelangen. Aber alle sehnten sich danach, den Kampf mit den hohen Bergen aufzunehmen und im Frühling die Pappeln von Lhasa im Winde rauschen zu hören.
Als sie aufbrachen, waren sie über zweihundert Mann stark, wozu noch eine Anzahl Frauen kamen. Die Sonne hatte die schneidende Kälte herabgemindert, unter der sie die letzte Nacht am Delta zu leiden gehabt hatten. Beim Klang der Glocken zogen sie nach Westen und Südwesten und erreichten nach drei Wochen den Südrand des Tsaidambeckens, wo sie fast täglich Tadschinurmongolen begegneten und ihren Lebensmittelvorrat ergänzen konnten. Zwei sichere Führer wurden gemietet. Der Weg, der bisher in ziemlich offenem Gelände leicht zu finden gewesen, führte nun an die Grenze unbewohnten Landes, wo eine Bergkette sich höher erhob als die andere und wo es immer bergauf ging.
Auf Anraten der Wegkundigen rastete die Karawane einige Tage am Fuß der ersten Berge. Dort konnten sich die Schafe, Pferde und Kamele zum letztenmal für zwei Monate sattfressen. Von jetzt ab wurde das Weideland mit jedem Tage spärlicher und hörte auf gewissen Strecken ganz auf. Nur die Jake, die sich mit Moosen und Flechten begnügten, konnten fast überall genügende Weide finden.
Nach beendeter Rast zog die Karawane langsam die Windungen eines Tals hinauf. Seine Wasserläufe waren in den steinigen Betten ganz vereist. An den Seiten fielen steile Felswände, Kulissen gleich, jäh ab, und im Hintergrund erhoben sich, von weißen Wolken umgeben, schneebedeckte, flache Berggipfel. Je weiter man nach Südwesten kam, um so schroffer wurde die Steigung, um so wilder und höher die Berge. Um die Tiere zu schonen, mußte man sich mit kurzen Tagemärschen begnügen; trotzdem war die Anstrengung für einige noch zu groß. Kein Tag verging, ohne daß ein paar oder mehr Tiere stürzten. Hier blieb ein Kamel liegen, da ein Pferd. Sogar die ausdauernden Jake litten in der verdünnten Luft an Atemnot, und mancher mußte getötet werden, nachdem seine Hufe auf dem steinigen Boden zersprungen waren. Der Hauptkarawane war es nicht besser ergangen: das sah man an den Tierkörpern, die an ihrem Weg lagen.
Beim Eintritt in diese Gebirgswelt wurde manchen Pilgern unheimlich zumute. Sie hatten das Nan-schan-Gebirge gesehen, aber was waren seine Kämme im Vergleich mit diesen! Hier fühlte man sich hilflos. Verzagt umzukehren, wurde von Tag zu Tag unmöglicher. Man mußte vorwärts und aufwärts. Wohin man das Auge richtete, sah man nur Berge! Und oft tauchten die gewaltigsten Gipfel wie Inseln aus Wolkenmassen auf, die sich wie Dampf und Rauch gen Boden hinzogen.
Wohl hatten die Mongolen in ihrer Steppenheimat erfahren, was Kälte zu bedeuten hat, aber einen lähmenderen Frost als diesen in den Tälern von Burchan Buddha hatten sie nie erlebt. In der Steppe hatte man Brennstoff in Fülle und man konnte jederzeit einen verdorrten Busch anzünden. Hier war sogar der Jakdung selten – das einzige Brennbare, das es gab –, und man war froh, wenn man sich am Abend Tee und Fleisch kochen konnte. Aber das schlimmste war der anhaltende Westwind, der in den Tälern klagte und heulte und durch Mark und Bein ging, wenn man über die runden Pässe zwischen ihnen ritt. Das Schneetreiben peitschte die erfrorenen Wangen der Pilger und hüllte Pferde und Kamele in wirbelnde Wolken. Oft verschwand die ganze Landschaft in undurchdringlichem Nebel, und man konnte kaum seinen nächsten Nachbar erkennen. Man hörte das ersterbende Jammern eines Kamels, das nicht weiterkonnte, und ein gestürztes Pferd, das die Schneewehen in dem weitesten, weichsten Bett begruben, mahnte an die Vergänglichkeit alles Daseins.
Tsangpo Lama, die wegkundigen Tadschinurmongolen und die Pilger, die den Weg über das Gebirge nicht zum erstenmal zurücklegten, trösteten die Kleinmütigen; sie sagten ihnen, alle Wallfahrer, die im Winter reisten, müßten dieselbe Prüfung bestehen, um an den heiligen Orten Trost zu finden. Wenn der Tagemarsch beendet war und die Zelte und Jurten in einem geschützten Tal oder auf einer von Bergen umschlossenen Ebene mit magerer Weide aufgeschlagen wurden, sahen die Wanderer das Leben in hellerem Licht und freuten sich bei dem Gedanken, ihrem Ziel um einen Tag nähergekommen zu sein. Da schürten sie das Feuer aus Jakdung und hüllten sich dichter in ihre Schafpelze. Draußen aber in der Nacht brüllte der Wind, und oft heulten dazu hungrige Wölfe.
Eines Tages zog die Karawane schwerfällig und langsam durch ein breites Tal. Der Himmel war dunkel von Wolken. Obwohl zeitweilig Schneegestöber herrschte, wurde der Boden nicht weiß, da der Sturm ihn rein fegte. In einiger Entfernung im Süden entdeckten die Führer, links vom Wege, eine Schar schwarze Reiter.
»Was für Leute sind das?« fragte Tsangpo Lama.
»Tanguten!« antworteten die Tadschinur ernst. »Von jetzt ab darf niemand mit müden Pferden und Kamelen zurückbleiben. Wir müssen zusammenhalten und immer die Flinten in der Nähe haben.«
Die Reiterschar war in das Tal zwischen den flachen Bergrücken hinabgeritten und verschwunden. Sie hatte dieselbe Richtung eingeschlagen wie die Pilger, war aber von ihnen durch die Anhöhe getrennt. Nun verstummten alle Gespräche, nur das Klingen der Glocken und der Wind waren zu hören.
Man lagerte an Quellen in einem breiten, offenen Tal, wo man nach allen Seiten Ausschau halten konnte. Solange es taghell war, durften die Tiere frei herumlaufen und ihre kümmerliche Nahrung suchen; in der Dämmerung wurden sie näher ans Lager herangetrieben und von Schützen bewacht. Man lud alle Flinten und stellte Posten für die Nacht auf. Die Klöppel der Kamelglocken umwickelte man mit Tuchstreifen. Die Nacht wurde grimmig kalt und still. Man hörte die Pferde in der Ferne wiehern. Tsagan und die übrigen Hunde der Karawane bellten wütend; offenbar schlichen tangutische Späher nahe ans Lager heran. Die Pilger waren der größten Unruhe preisgegeben und erwarteten jeden Augenblick einen Überfall. Sie befanden sich nordwestlich von den Quellen des Gelben Flusses, in jener Gegend, die bekannt war als besonders von Räubern heimgesucht.
Die Nacht verlief ruhig. Am nächsten Morgen wurde beim Aufbruch auf Anraten der Führer beschlossen, die gewöhnliche Wallfahrtsstraße und die Spur der Hauptkarawane zu verlassen und dafür einen weiter westlich verlaufenden Weg einzuschlagen: dieser führte zwar durch unwegsamere Gebirgsgegenden, es waren auf ihm aber Hinterhalte und Plünderungen weniger zu befürchten.
Die Unruhe der Pilger ließ nicht nach, als sie sich von dem vielbenutzten Wege entfernten, auf dem ihre Kameraden vorausgegangen waren, um so mehr als sich die schwarzen Reiter immer häufiger, bald hier, bald da in der Umgebung blicken ließen. Alle ihre Bewegungen wurden also von dem Feinde beobachtet, der es auf ihre Habe und die Karawanentiere abgesehen hatte. Da aber ein Tag nach dem andern verging, ohne daß etwas geschah, kehrte allmählich die Ruhe zurück. Die Pilger fingen wieder an zu singen und sich zu unterhalten und sie nahmen die Tuchstreifen wieder von den Klöppeln der Glocken herunter.
Als eines Tages eine Schar von etwa zehn Reitern auf einer flachen Erhöhung in der Nähe ein bedrohliches Manöver ausführte, setzte ihnen Tsangpo Lama mit einigen beherzten Leuten aus der Begleitmannschaft der Tsacharen nach. Da ließen die Tanguten ihren Pferden die Zügel schießen und verschwanden hinter dem nächsten Gebirgskamm; an diesem Tage ließen sie sich nicht wieder blicken. Die Pilger lachten über ihre Feigheit und kümmerten sich nicht weiter um sie. Am Abend lagerte man an Quellen, deren Wasser inmitten spärlichen Rasens zwischen mächtigen Eisschollen hervorsickerte.
Noch etwas anderes beunruhigte die Pilger auf ihrer Fahrt. Seitdem sie immer tiefer in den schneidenden Gebirgswinter hineingedrungen und ihre Wanderung immer schwerer und mühseliger geworden war, hatten die Kräfte des alten Priors von Tag zu Tag abgenommen, und schließlich fühlte er, daß er mit den andern nicht über das Gebirge hinüberkommen werde, das noch höher war als dieses.
Kaum hatte die Karawane bei den Quellen mit den Eisschollen haltgemacht, als der Prior zusammensank und aus dem Sattel gefallen wäre, wenn nicht Tsangpo Lama und die andern Mönche, die immer in seiner Nähe waren, ihm schleunigst heruntergeholfen hätten. Schnell wurden seine Jurte und sein Schaffellbett in Ordnung gebracht, und nachdem er der Einwirkung von Wind und Kälte entzogen war, wurde ihm von den Medizinlamas der Tsacharen alle mögliche Pflege zuteil. Diese hausten jetzt mit Schagdur Lama und Tundup Lama in der Tempeljurte, während der Prior mit Tsangpo Lama eine kleinere Jurte bewohnte, die leichter warm zu halten war.
Des Kranken wegen blieb man an den Quellen über einen Tag. Des Priors Zustand besserte sich nicht. Da es ihn aber quälte, die Ursache eines längeren Aufenthalts zu sein, drängte er zum Aufbruch, als am nächsten Tag die Sonne an einem wolkenfreien Himmel heraufstieg. Es war klar, daß er nicht zu Pferde sitzen konnte. Deshalb wurde aus Zeltstangen, Decken und Pelzen eine Sänfte hergerichtet. Vier Mann trugen sie; sobald sie ermüdeten, wurden sie von vier andern abgelöst. Die Reise ging über Berge und Täler weiter nach Westen und Südwesten.
Man machte immer kürzere Tagemärsche. Das Wetter wurde wieder schlechter. Es herrschte schneidender Frost. Scharfer Wind hüllte die Sänfte in Schneegestöber. Der kranke Prior war zeitweilig irre. Er verwechselte sich mit dem Taschi-Lama, der auch durch Tibet getragen worden war. In Gegenden, in denen kein Grashalm wuchs, strengte man sich aufs äußerste an, um rasch vorwärtszukommen. Man mußte an die Pilger und ihre Frauen und an die Karawanentiere denken und mußte zugleich den Prior möglichst zu schonen suchen. Es war notwendig, so schnell als man konnte die kahlen Höhen zu überwinden.
Tsangpo ritt am Tage neben der Sänfte und wachte nachts bei dem Kranken; von Zeit zu Zeit lösten ihn die andern Mönche ab. Tief betrübt wurde er, als der Prior eines Morgens beim Aufbruch auf einen fernen Berg mit drei schneebedeckten Gipfeln wies und sagte:
»Ehe wir an diesem Berge dort vorübergekommen sind, bin ich tot.«
Tsangpo versuchte seinen alten Lehrer zu trösten, der nur mit einem freundlichen Lächeln antwortete; aber er fürchtete, daß der Kranke mit seiner Prophezeiung recht haben werde. Seltsam schien der Klang der Kamelglocken zwischen den hohen Bergen. Alle Pilger waren still, es war wie ein Leichenzug. Das ganze Land machte den Eindruck, als sei es die Heimat des Todes. Keine Antilope, kein anderes Tier war zu sehen, nicht eine Spur. Zuweilen konnte man zwei, drei Tage gehen, ohne einen Grashalm zu finden. An die Tanguten dachte man nicht mehr so viel, trotzdem manchmal einer aus der Karawane beteuerte, er habe in der Ferne Reiter gesehen oder Köpfe, die in der Nähe hinter Felsen auftauchten und spähende Blicke auf den langsam fortschreitenden Zug warfen.
Inzwischen drangen die Pilger in dem ungastlichen Lande immer weiter vor und kamen immer höher hinauf. Alle erfüllte die Hoffnung, an den heiligen Stätten den Lohn für die bereits überstandenen und noch bevorstehenden Mühsale zu empfangen. Daß dann und wann ein Kamel, ein Pferd, ein Jak stürzte, hatte nicht viel zu bedeuten. Die Karawane war groß, das Gepäck nicht allzu schwer. Die stärksten Tiere blieben doch am Leben. In einem Monat konnte man in Naktschu neue Jake kaufen. Es würde schon gut gehen! Wenn nur der Prior von Jehol, den alle liebten und verehrten, nicht so krank gewesen wäre! Man überlegte, wie man ihm in seinem Zustand am besten behilflich sein und seine sinkenden Kräfte stärken konnte.
Man sprach von einer abermaligen Teilung der Karawane. Die Hauptmasse mit den Pilgern und Frauen sollte die Reise schneller fortsetzen, die Lamas aber und ein Teil der Begleitmannschaft mit dem Prior sollten in einem geschützten Tal zurückbleiben, in dem es Weideplätze gab. Als es aber zur Teilung kam, wollte niemand den Alten verlassen. Er war der vornehmste Seelsorger gewesen und hatte unterwegs den Gottesdienst zum Heile aller versehen. Ihn in seiner Krankheit zu verlassen und die Reise in Ungewißheit über sein Schicksal fortzusetzen, war mehr, als man von ernsten Pilgern verlangen konnte.
Bald wurde auch offenbar, daß es nicht mehr lange dauern konnte, bis seine Seele sich befreite. Beim Aufbruch am Morgen umstand seine Sänfte immer eine andächtig harrende Schar. Alle wollten tragen helfen. Einem Kanpo-Lama, der des Taschi-Lama Freund gewesen war, behilflich zu sein, galt für ein frommes Tun, das der Wallfahrt Segen brachte.
An dem Tage, der nach allgemeiner Überzeugung der letzte des Priors sein sollte, waren die hilfsbereiten Hände eifriger denn je. Der Westwind jagte über den Boden und heulte und klagte in Felsenschluchten und Schroffen. Es schneite, aber der Schnee wurde ebenso schnell weggefegt, wie er kam. Schwere Wolken zogen über die Erde hin. Auch mitten am Tage herrschte Dämmerung. Im Brausen des Sturmes hörte man kaum das Klingen der Glocken. Langsam zog die Karawane einen allmählich ansteigenden Abhang zu einem flachen Paß hinan, auf dem die Pilger der ganzen Gewalt des Unwetters schutzlos preisgegeben waren. Die Kamelreiter saßen ab, um nicht zu erfrieren. Den Kamelen hingen unter den Augen Eiszapfen im Haar – Tränen, die sie in Sturm und Schneetreiben vergossen hatten. Eine Öde ohnegleichen umgab den Zug; aber Wolken und Schneegestöber versperrten die Aussicht. Nur die mongolischen Führer aus Tsaidam kannten den Weg.
»Von hier aus«, sagten sie, »können wir gerade nach Süden abbiegen. Dann kommen wir zum Naktschu, dem Schwarzen Fluß, oder zum Tengri-nor, dem Himmelssee.«
Schweigend und geduldig lag der Prior in seiner Sänfte unter den Wolfsfellen. Mehrere Träger glaubten schon, sie trügen einen Toten. Wenn beim Wechseln die Sänfte auf die Erde gestellt wurde, hob Tsangpo Lama das weichere Fell, das das Gesicht des Kranken bedeckte. Er lebte noch, aber sein Bewußtsein war getrübt. In einer kleinen Talweitung, in der kümmerliches Gras wuchs und trockener Dung von Wildjaken verstreut lag, lagerte die Karawane. Die Zeltbahnen flatterten und klatschten im Sturm. Die Tiere wurden losgelassen. Die Männer holten Eis aus einem gefrorenen Bach. Graublaue Wolken stiegen aus den Rauchfängen; in Zelt und Jurte wurden die Töpfe über das Feuer gestellt. Alle, die nicht im Freien zu arbeiten hatten, blieben im geschützten Raum. Tsangpo Lama und die andern Mönche waren um den Prior besorgt und holten schleunigst Glut von den nächsten Feuern. Die Dämmerung brach herein, es dunkelte. Aber trotz Wolken und Schneegestöber wurde es nicht ganz dunkel; denn es war Vollmond. Die Hunde knurrten und bellten unruhig. Plötzlich erscholl aus dem umgebenden Dunkel wildes Geheul, das die Pilger erschreckte. Es klang wie Wolfsgeheul. Aber die Führer erklärten, es rühre von Tanguten her, die auf diese Weise ihre Überlegenheit zu erkennen zu geben pflegten. Die Begleitmannschaft feuerte aufs Geratewohl ein paar Flintenschüsse ab. Danach wurde es still, und die Pilger wurden in Frieden gelassen.
Am Abend hörte der Sturm auf, und das Gewölk zerstreute sich. Der Mond schien hell auf die furchtbare Öde herab. Einige Patrouillen wurden ausgeschickt; sie kamen zurück, ohne schwarze Reiter erblickt zu haben. In der klaren Luft sah Tsangpo, daß die Karawane sich gerade am Fuß des Berges mit den drei Schneegipfeln gelagert hatte. Der Prior hatte gesagt, er werde sterben, ehe die Pilger an diesem Berge vorüber wären. Als Tsangpo wieder zu dem Kranken hineinging, durchschauerte ihn das Gefühl, daß der Tod auf Besuch gekommen war.
Um so größer war sein Erstaunen, als der Prior, der bisher geschlummert hatte, die Augen aufschlug und um eine Schale Tee bat. Nachdem er getrunken hatte, sagte er:
»Ich fühle, daß dies meine letzte Nacht wird. Sind wir am Berge angelangt?«
»Vater, wir lagern am Fuß des Berges«, antwortete Tsangpo.
»Dann ist es an der Zeit, daß ich dir über Sakjamuni, den Weisen aus Sakjas Stamm, sage, was ich schon so lange auf dem Herzen gehabt habe.«
Er richtete den Blick fest auf Tsangpo Lama und fuhr fort:
»Der Glaube, den du ebenso hegst wie der Taschi-Lama, wie alle Mönche im Kloster von Jehol und ich selbst, ist nur ein verhallender Nachklang der hohen Weisheit, die Buddha, solange er auf Erden wandelte, seinen Jüngern gepredigt hat. Hast du nicht in Jehol gemerkt und während unserer gemeinsamen Pilgerfahrt geahnt, daß der Glaube, den auf unsern Klosterhöfen die Schneckenhörner und Posaunen verkünden, meiner Seele nicht genügte? In meiner Eigenschaft als Prior hatte ich nicht das Recht, deine Blicke von der Mystik unseres Tempels und der Heiligkeit unserer lebenden Buddhas, der Chubilgane, abzulenken. Jetzt aber, da der Tod gekommen ist, mich heimzuholen, kann ich dir unbesorgt sagen, daß alles, was du bisher gelernt hast, leeres und eitles Gerede ist verglichen mit Buddhas unverfälschtem Wort.
Ich vermag dir nicht mehr von Buddhas Leben zu erzählen. Die Minuten verrinnen schnell, und hier am Fuße des dreigipfligen Berges ist meine letzte Lagerstatt. Vielleicht aber gelingt es mir, ehe ich für immer einschlafe, mit einigen kurzen Worten dir die Grundzüge seiner Lehre zu zeichnen.
Er predigte Reinheit des Herzens und des Wandels. Den Herzen derer, die ihm lauschten, suchte er Erbarmen einzuprägen; Wohlwollen, Liebe zum Nächsten, Opferwilligkeit, Keuschheit, Vertilgung der Sünde. Während wir und unsere Mönchsbrüderschaft nur für eigene Rechnung die Schlüssel zur Seligkeit bewahren, verglich Buddha seine Lehre dem Wasser, dem Feuers dem Himmel, die allen müden Erdenpilgern im gleichen Maße zugute kommen. Für ihn gab es kein Ansehen der Person. Er sagte: mein Gesetz ist ein Gesetz der Gnade für alle. Elende und Beladene eilten zu ihm, wenn er auf Gassen und Märkten und auf den schwülen Landstraßen am Ufer des Ganges seine Stimme erschallen ließ, wo dunkelhäutige Männer ihre Elefantenzüge lenkten. In Gleichnissen und Bildern verbreitete er Licht über das Geheimnis des Daseins, und indem er ›Brahma‹, das Ursein, verwarf, die Hoheit des Veda und die Macht des Opfers leugnete, sowie die Spitzfindigkeit des brahminischen Kultus mit Füßen trat, öffnete er allen die Pforten der Erlösung. Du bist selbst Zeuge gewesen, wie unsere Heiligen, sogar der gerechte Taschi-Lama, Kaisersöhnen, Fürsten, Bettlern und Krüppeln ihren Segen nach verschiedenem Maße schenken. Vor Buddha galt ein Landstreicher soviel wie ein König. Die Lampen, die die Hohen der Erde zu seiner Ehre anzündeten, erloschen. Die Lampe aber, für die eine arme Frau ihr letztes Scherflein geopfert hatte, brannte die ganze Nacht mit helleuchtender Flamme.
Gautama Buddha lehrt, daß der Kreislauf von Geburt und Tod ein Unglück, und daß die Welt der Menschen ein bodenloser Abgrund von Elend ist. Mit ausgestreckten Händen greifen sie nach dem, was sie nicht besitzen, und wenn sie es errungen haben, gewährt es ihnen kein Glück, nur Enttäuschung und Kummer. Alles ist eitel und leer. Nichts besteht, alles vergeht. Alles ist Wechsel, Leiden und Kummer.
Auch der Leib des Menschen wandelt sich beständig; er ist ohne Wirklichkeit, das Gewächs eines Augenblicks in der unermeßlichen Zeit. Das Leben ist wie das Bild im Spiegel. Es schwindet wie der Blitz am Himmel, wie der Schaum auf dem Wasser. Alles geht unter, nichts ist ewig. Erde, Himmel, Hölle, alles wird zunichte und wird erneuert im Ring eines Kreislaufs, dessen Anfang und Ende kein Sterblicher messen kann.
Nichts ist so böse wie das Dasein selbst. Von seiner Geißel will Gautama, der Büßer aus Sakjas Stamm, die Menschenkinder erlösen. Seine Erlösung führt vom Fluch der Geburt, der Krankheit, des Alters und des Todes zur Auslöschung des Ichs, zum Nirwana. Die Seele des Menschen lebt nicht nach dem Tode, sie wandert. Lebende Wesen werden geboren und sterben und werden aufs neue geboren ins Unendliche. Die Seelenwanderung ist ein Fluch, dessen Kette von Gautama Buddha gesprengt werden soll. Der Mensch, der Kummer, Leiden und Enttäuschung erntet, hat selbst in einem früheren Leben Eitelkeit, Sünde und Verbrechen gesät. Das einzige, was fortlebt, ist die Summe seiner Taten, der guten und der bösen, das ›Karma‹, das, was nicht stirbt. Betritt daher den Weg, der von der Bosheit der Welt wegführt, den Weg, der zur Freude und Ruhe im Nirwana der Weisheit und des Friedens geleitet!
Das Leben ist eine Last. Zu leben ist ein Unglück, das sich durch die Seelenwanderung beständig erneuert. Weder Gebete, noch Opfer, noch Kasteiung vermögen davon zu befreien und die Pforte zum Nirwana zu öffnen. Bloß wenn er dem Wege folgt, gelangt der Pilger zu vollkommener Befreiung von der Liebe zum Leben und dem Selbstischen, und dieser Weg steht allen offen. Der Weg ist die Lehre Buddhas, der Weg der vier Wahrheiten. Lehren heißt ›das Rad des Gesetzes drehen‹, das Rad der vier Wahrheiten.
Vernimm nun die vier Wahrheiten vom Kummer, seiner Ursache, seiner Unterdrückung und vom Wege, der zu seiner Vertilgung führt! Sind nicht Geburt, Krankheit, Alter und Tod Zustände voller Schmerzen und Qual? Sind nicht Selbstbetrug, Verlangen, Liebe zum gegenwärtigen Leben und zu einem künftigen Leben Ursachen des Leidens und des Kummers? Unterdrücke die Lebenslust, und du erstickst den Kummer! Wer diesen verächtlichen Durst besiegt, von dem gleitet das Leben ab wie die Wassertropfen vom Lotosblatt. Wer tugendhaft und nachdenkend den Weg wandert, der wird von der Knechtschaft unter dem Versucher Mara, dem Herrn in der Welt der Gelüste, befreit. Böses Verlangen wird aus seiner Seele getilgt, er fühlt nur gerechtes Verlangen für sich selbst, Mitgefühl und Liebe zu den andern. Wer die zehn Verirrungen besiegt hat, Selbstbetrug, Zweifel, Werkknechtschaft, Abhängigkeit von äußeren Einflüssen, Haß, Liebe zum irdischen Leben, Sehnsucht nach einem künftigen Leben, Hochmut, Selbstgerechtigkeit und Unwissenheit – der hat allem Kummer ein Ende gemacht.
Nirwana ist das Ziel der vier Wege. Hast du seine Schwelle überschritten, so wirst du nicht von neuem geboren. Dein altes Karma ist erloschen wie eine Lampe.
Buddha gebot jedem Sramana oder Bettelmönch, in seinem Sangha oder Orden nach Glück für sich selbst zu trachten und nach Wohlergehen für seine Feinde. Der Sramana soll Mitleid fühlen mit allen Geschöpfen in Not und Bedrängnis, er soll trauern über das Leid seiner Widersacher. Er soll nicht vergessen, daß die Sterblichen, dadurch, daß sie beständig geboren werden, sterben und von neuem geboren werden, Knechte des Leidens und des Schmerzes sind. Denn also spricht Buddha: Die Seelenwanderung ist wie das Meer. Ihre wandernden Wellen sind Geburten. Der Schaum auf den Wellenkämmen ist der vergängliche Leib. Das jenseitige Ufer ist Nirwana. Wer dahin gelangt ist, wird nie wieder auf das Meer des Sansara, der Seelenwanderung, hinausgestoßen werden.
Und Buddha sagt: Niemals in dieser Welt wird Haß mit Haß erstickt. Haß wird mit Liebe erstickt. Laßt uns also glücklich leben, ohne die zu hassen, die uns hassen. Laßt uns frei von Haß leben unter Menschen, die hassen.
In Buddhas Augen besaß der Tod keine Macht. Durch den Tod ging der Weg in den großen Frieden. Die Trauer um die Toten war irdisch. Wir müssen uns von den Fesseln des Lebens befreien, um Nirwana zu erreichen.
Vernimm diese Erzählung von einem reichen Kaufmann, der zu Buddhas Zeit in einer indischen Stadt lebte. Er hatte mehrere Sklaven. Seine Tochter Kisagotami verliebte sich in einen von diesen, und er erwiderte ihre Liebe. Sie flohen weit weg, bis sie es wagten, sich in einer Stadt niederzulassen und mit dem Geld, das sie mitgenommen, Handel zu treiben. Sie gebar ihm einen Sohn. Nach einiger Zeit zogen sie weiter, aber in einem großen Wald mußten sie rasten; denn sie war im Begriff, noch einem Sohn das Leben zu schenken. Der Mann baute eine Hütte für sie. Eines Abends, als er weggegangen war, um im Walde Holz zu schlagen, wartete sie vergebens auf seine Rückkehr. Voller Angst ging sie bei Tagesanbruch ihn suchen und fand ihn tot im Walde, von einer giftigen Schlange in die Ferse gestochen. Kummer im Herzen, brach sie auf, um Menschenwohnungen aufzusuchen. Sie trug den Neugeborenen auf ihrem Arm und führte den Erstgeborenen an der Hand. So kam sie an einen Fluß. Er war so tief, daß sie nicht beide Kinder auf einmal hinübertragen konnte. Deshalb ließ sie den Ältesten zurück und hieß ihn warten, bis sie zurückkehrte. Mit dem Neugeborenen watete sie durch den Fluß und legte ihn unter einen Baum. Dann kehrte sie ans Ufer zurück, um den ältesten Knaben zu holen; als sie aber in die Mitte des Flusses kam, hörte sie in der Luft ein gewaltiges Brausen, sie wandte sich um und sah einen großen Adler auf den Kleinen herabstoßen und ihn in seinen Klauen entführen. Ihr verzweifeltes Schreien half nichts. Sie kehrte also um, um den ältesten Knaben zu holen. Als der aber ihr ängstliches Rufen gehört hatte, hatte er geglaubt, sie rufe ihn, und er war in den Fluß ihr entgegengelaufen. Er war nicht weit gelangt, als die Strömung ihn ergriff und ihn eilig ins Meer hinaustrug.
»Vor Kummer dem Tode nahe, beschloß die Frau, ihren Vater aufzusuchen und seine Verzeihung zu erlangen. Als sie durch das Tor ihrer Vaterstadt wankte, begegnete ihr ein prachtvoller Leichenzug, und sie fragte, wer der Tote wäre. Und da man ihr den Namen ihres Vaters nannte, fiel sie zu Boden, des Lichtes ihres Verstandes beraubt. Ein Bettelmönch erbarmte sich ihrer in ihrem Leid und Elend und bewog sie, zu Gautama zu gehen.
Nachdem sie den Einsiedler gefunden hatte, sagte sie: ›Herr und Meister! Weißt du ein Mittel, mir die wiederzuschenken, die ich geliebt habe?‹ – ›Ja‹, antwortete er. – ›Welche Kräuter soll ich holen, damit du die Meinen ins Leben zurückrufen kannst?‹ – ›Ich brauche einige Senfkörner‹, antwortete Gautama. Schon wollte die Frau voller Freude forteilen, um sie zu holen, als der Meister hinzufügte: ›Du mußt sie aus einem Haus holen, in dem weder ein Sohn, noch eine Tochter, noch ein Schwiegersohn, noch ein Vater, noch eine Mutter, noch ein Sklave gestorben ist, sonst haben sie keine Wirkung.‹ – ›Gut‹, antwortete sie und eilte fort. Im ersten Haus wurde ihr auf ihr Klopfen freundlich geantwortet: ›Hier hast du Senfkörner.‹ Als sie aber fragte, ob ein Sohn, eine Tochter, ein Schwiegersohn, ein Vater, eine Mutter oder ein Sklave in dem Hause gestorben wäre, erhielt sie die Antwort: ›Weib, was sagst du! Der Lebenden sind wenige, der Toten sind viele!‹ In andern Häusern hieß es: ›Ich habe einen Sohn verloren. Wir haben unsere Eltern verloren. Mein Sklave ist gestorben.‹ Wie sie auch suchte, nie fand sie ein Haus, in dem niemand gestorben war. Betrübt wendete sie ihre Schritte zurück zur Hütte des Meisters.
›Nun,‹ fragte er, ›hast du einige Senfkörner gefunden?‹ – ›Nein‹, antwortete sie. ›Sie sagen, der Lebenden seien wenige, der Toten viele.‹ Nachdem er der Frau den tiefen Sinn seiner Lehre erklärt und ihr gezeigt hatte, wie eitel alle irdischen Dinge seien und wie vergänglich das Leben, suchte sie Trost in seinem Gesetz und betrat den ersten der vier Wege, die nach Nirwana führen.«
Der alte Prior schloß die Augen und verstummte. Die Anstrengung hatte die letzten Kräfte des Sterbenden erschöpft. Nach einer Weile vermochte er nur noch zu flüstern:
»Vieles hätte ich dir noch zu sagen. Doch ehe der neue Tag anbricht, bin ich bereits an das jenseitige Ufer des Sansara-Meers gelangt. Laß dich nicht von dem Glanz verwirren, der im fernen Süden in den gewaltigen Tempeln schimmert. Wer den Weg der vier Wahrheiten wandert und das Rad des Gesetzes dreht, braucht keine äußerlichen Gebärden und kein Getöse von Pauken und Zimbeln. Das Licht, das deinen Weg erhellen soll, muß in deiner eigenen Seele brennen. Folge Buddhas Lehre, und Nirwana wird auch dich in seinen Schoß aufnehmen!«
Wieder verstummte er. Nach einer längeren Pause erwachte er von neuem, und seine Augen leuchteten, als er sprach:
»Schaffe meinen toten Leib nicht den langen Weg nach Taschi-lunpo, wo der Taschi-Lama träumt unter dem goldenen Dach seiner Pagode! Der Leib ist nicht mehr als das Gras, das auf dem Felde welkt. Meine Seele wird in Nirwana ruhen. Meine Taten, Karma, werden niemals untergehen. Trag meinen vergänglichen Leib auf den dreigipfligen Berg hinauf. Von dem mittelsten Gipfel geht ein felsiger Höhenzug aus. Such, bis du eine Platte findest, die der Wind von Schnee reingefegt hat und die sich schroff neben einem blauschimmernden Gletscher erhebt. Lehne mich, aufrecht sitzend, an eine senkrechte Granitwand und laß in meinem Schutze das Bild Sakjamunis zurück, dessen Bronzegesicht im Schein der Lampen in Wüsten und Gebirgen mein Zelt erhellt hat. Dort laß mich zurück! Denk nicht an lange Totengebete! Für meinen Leib ist eine Stunde mehr als genug. Laß die sehnsüchtigen Pilger nicht warten! Stürme werden schönere Messen singen vor meinem schneegekrönten Thron. Wende mein Gesicht nach Osten, damit die Sonne meine eingetrockneten Züge bescheint. Ich will unter einem Thronhimmel von Eis sitzen und den Weg überschauen und den Zug der Pilger segnen.«
Wieder verstummte er. Sein Atem ging kurz und schnell. Seine linke Hand bewegte er, als hielte er die Klingel beim Gottesdienst. Der erlöschende Blick irrte suchend umher. Das Bewußtsein trübte sich und floh. Nur gebrochene, verworrene Worte kamen noch über seine Lippen. Gespannt lauschte Tsangpo, um seine Gedanken zu erfassen.
»Marpo-gumpa, der rote Tempel! – Suche den roten Tempel – niemand hat ihn gesehen – im Herzen von Tibet – zwischen hohen Bergen. Einen Monat nach Westen, einen Monat nach Südwesten – im Karawanentempo. – Die armen Nomaden – niemand denkt an sie – geh zu den Nomaden.«
Dann verstummte er für immer. Der Prior war tot.
Nachdem Tsangpo Lama sich neben ihm ausgeweint hatte, ging er ins Zelt der Mönche. Sie saßen, Gebete murmelnd, an ihrem Feuer. Schagdur Lama, Tundup Lama und ein dritter Bruder begaben sich an das Sterbelager, um die Nacht über für den Toten zu beten. Es ging kein Wind, die Luft war klar, und silberweiß schien der Vollmond. In feierlichem Rhythmus sangen und beteten sie ohne Unterlaß, und der Klang ihrer kummerschweren Worte drang bis zu den nächsten Zelten. Da wußten die Pilger, die noch wach waren, daß jetzt der alte Prior gestorben und seine Seele im Nirwana war.
Tsangpo Lama aber verblieb im Zelte der Mönche, wo er, in seinen Schafpelz gehüllt, sich zur Ruhe legte. Es war sein letzter Schlaf bei den Pilgern.