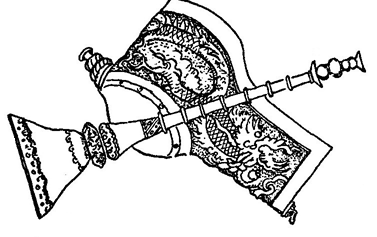|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
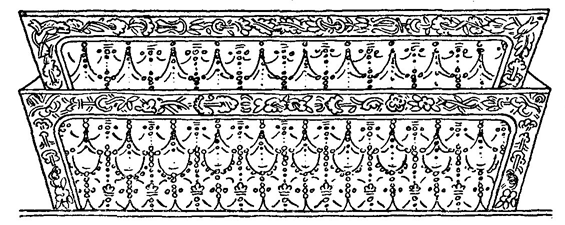
 Nach ein paar Tagemärschen hörte die Steppe auf. Die Pilgerkarawane ließ die letzten Rasenhügel und Tamarisken hinter sich und gelangte in eine jedes Pflanzenwuchses entbehrende Wüste von niedrigen, unregelmäfßigen Sanddünen. Eine weitere Tagereise führte sie an einen kleinen Salzsee, an dessen Südufer Süßwasserquellen zutage traten. Die Feuchtigkeit des Bodens gab einem bogenförmigen Vegetationsgürtel Nahrung.
Nach ein paar Tagemärschen hörte die Steppe auf. Die Pilgerkarawane ließ die letzten Rasenhügel und Tamarisken hinter sich und gelangte in eine jedes Pflanzenwuchses entbehrende Wüste von niedrigen, unregelmäfßigen Sanddünen. Eine weitere Tagereise führte sie an einen kleinen Salzsee, an dessen Südufer Süßwasserquellen zutage traten. Die Feuchtigkeit des Bodens gab einem bogenförmigen Vegetationsgürtel Nahrung.
Hier lagerten sie um Mittag. Der nächste Tagemarsch war der beschwerlichste und längste von allen und führte die ganze Zeit durch flachen Flugsand. Deshalb wurde der Befehl ausgegeben, das Quellwasser in Anspruch zu nehmen, soweit es reichte, die Pferde sich satt trinken zu lassen und die übrigen Tiere, soviel als sie vermochten; ferner sich eine Stunde vor Mitternacht zum Aufbruch bereitzuhalten.
Die Ruhezeit war daher für die meisten nur kurz. Es brannten weniger Feuer als sonst und spärlicher; denn anderer Brennstoff als der, den man vom letzten Lagerplatz mitgenommen hatte, war nicht zu haben. Viele schlugen gar nicht erst ihre Zelte auf. Behielten sie einige Zeit zum Ausruhen übrig, so kauerten sie sich, in ihre Schafpelze gehüllt, hinter den Zelten anderer zusammen. Die ganze Zeit ging damit hin, die Tiere zu tränken und die Ziegenschläuche zu füllen.
Terge Ritschen und die beiden wüstenkundigen Ölöten erkundeten den Weg zwischen den flachen Dünen so weit nach Südwesten, als die Karawane vermutlich vor Tagesanbruch gelangen konnte. Diese Strecke war kaum ein Drittel der ganzen Entfernung bis zum nächsten Lager.
Nur vier Stunden hatte die Dunkelheit gedauert, als bereits der erste Signalschutz ertönte. Man machte sich zum Aufbruch fertig, aber immer noch drängten sich Menschen und Tiere in dichten Scharen bei den Quellen.
Der zweite Schuß ertönte. Tibeter und Chinesen begannen sofort ihren Marsch. Die Tsacharen und einige Stämme der Chalchamongolen folgten. Wie schwarze Schatten zogen ihre Kamele in langen Reihen zwischen den Sandwellen dahin.
Dann gab es eine neue Unterbrechung. Es wimmelte in der Dunkelheit an den Quellen von Menschen und Tieren. Immer neue Scharen von Reitern kamen mit ihren Pferden heran. Mongolen, die die erlaubte Anzahl von Ziegenschläuchen noch nicht gefüllt hatten, warteten, bis sie an die Reihe kamen. Von Zeit zu Zeit wurden heftige Wortkämpfe um den Platz ausgefochten.
Die Naimanen brachen auf. Eine neue Pause trat ein. Das Gerücht hatte sich verbreitet, manches Jahr versage das Wasser beim nächsten Lagerplatz. Während eines Marsches, der die halbe Nacht und einen ganzen Tag anhielt, mußte man außerdem unterwegs zu trinken haben. Man wollte sich nicht verspäten, aber noch weniger mit durstigen Pferden und leeren Ziegenschläuchen den Kampf mit der Wüste aufnehmen. Deshalb entstand eine aufgeregte Stimmung und ein großes Durcheinander. Man schrie und lärmte, die Glocken klingelten, die Kamele brüllten, und die Stimmen derer, die den Oberbefehl hatten, konnten nicht durchdringen. Tsangpo Lama versuchte ihnen zu helfen. Als er schließlich aufbrach, um sich den Seinen anzuschließen, war fast die halbe Karawane noch zurück, so daß er fürchtete, die letzten würden erst bei Tagesanbruch fortkommen.
Zwischen den flachen Dünen ritt er durch die Nacht. Der bleiche Sternenschein genügte, um den Weg kenntlich zu machen, und das Pferd sehnte sich nach den Kameraden. Er ritt an einer Abteilung nach der andern vorüber und unterhielt sich zuweilen mit den Treibern, die neben einem ruhebedürftigen Kamel im Sande lagen. Einmal scheute das Pferd vor einem gestürzten Kamel, in dessen nach oben gerichtetem, noch feuchtem Auge sich die Sterne spiegelten.
Endlich war zu hören, daß die Hauptmasse der Karawane in der Nähe war, und jetzt kam Tsangpos Pferd in Schuß. Bei jedem Schritt warf es den Nacken und schnaubte. Die letzten im Zuge waren Chalchamongolen. Alle andern waren zurückgeblieben, und vielleicht zankten sich noch viele an den Quellen.
Die große Karawane marschierte langsamer als sonst. Der ganze Zug machte einen schläfrigen Eindruck. Die Kamelreiter hatten sich auf den Kasten und Bündeln auf den Bauch gelegt und schnarchten. Auf den Pferden schwankten die Männer mit dem Oberkörper von einer Seite zur andern. Keine Unterhaltung wurde laut, kein Ruf, nur das langsame Klingeln der Glocken, die Atemzüge der Kamele und das Auftreten ihrer schwieligen Sohlen im Sande.
Tsangpo verweilte eine Zeitlang bei dem alten Prior, der gebückt, aber sicher im Sattel saß. Nachdem er sich von seinem Wohlbefinden überzeugt hatte, ritt er noch vor zu Terge Ritschen, der seine beiden Berater aus dem Stamm der Ölöten zur Seite hatte. Diese schliefen nicht. Sie schienen mit ihren Augen das Dunkel zu durchdringen und erkannten die Spur, die ihr Erkundungsritt vom vorigen Tage im Wüstensand zurückgelassen hatte.
»Na, es ist nicht mehr weit. Auf alle Fälle kommen wir vor Tagesanbruch ans Ziel«, sagte der Tibeter, während die wegkundigen Ölöten fortfuhren, ins Dunkel hinauszuspähen.
»Was tun wir, wenn eure Spur aufhört?«
Der eine Ölöte betrachtete ein etwas über dem Horizont stehendes Sternbild und sah dann nach Osten. Darauf antwortete er:
»Der Punkt, an dem wir gestern umkehrten, liegt auf einer kleinen Bodenerhebung. Von dort aus reicht die Aussicht weit hinaus nach Südwesten, wo unser Weg verläuft und die Berge von Nan-schan in der Ferne sichtbar sind, und nach Nordosten in der Richtung des Wegs, den wir zurückgelegt haben. Auch ohne Tageslicht können wir ruhig weiterziehen und uns nach den Sternen richten. Wenn der helle Stern untergegangen ist, der dort etwas über dem Horizont leuchtet, ist es nicht mehr weit bis Tagesanbruch. Da wir auf dieser langen Tagereise auf alle Fälle von Zeit zu Zeit den Kamelen und Pferden etwas Ruhe gönnen müssen, können wir gern die erste Rast dort halten, wo die Spur auf der Anhöhe aufhört. Während wir rasten, bricht der Tag an, und wir erkennen unsern Weg ohne Hilfe der Sterne.«
»Das ist klug gesprochen«, antwortete Tsangpo. »Und unterdessen kann sich die Karawane sammeln; jetzt erstreckt sie sich bis zum Lager am Salzsee.«
»Sind einige so weit zurückgeblieben?«
»Ja. Alle wollten Wasser mitnehmen und ihre Tiere trinken lassen. Deshalb sind die einzelnen Abteilungen in langen Zwischenräumen aufgebrochen.«
»Es ist gefährlich, ohne Führer durch die Sandwüste zu ziehen«, erwiderte der Ölöte. »Was soll einer vom Chalchastamm anfangen, der die Spur verloren und keinen Führer hat? Seine Männer sind ja in diesem Teil der Wüste fremd.«
»Ja, aber die Spur ist doch auch in der Nacht erkennbar. Meinst du?«
Der Ölöte fragte seinen Kameraden:
»Was sagst du zu dem Wetter?«
»Im Westen und Nordwesten scheinen die Sterne nicht in ihrem vollen Glanz.«
Der erste Ölöte wandte sich an Tsangpo Lama mit der Frage:
»Die Mönche bei den Stämmen aus dem Norden und Nordosten sind vermutlich alle schon in Lhasa gewesen? Und es gibt wohl kaum eine Abteilung im Zug, die nicht einen Lama hat. Ein Lama, der diese Straße gezogen ist, muß wissen, daß er in sechs Tagen am Fuß des Nan-schan-Gebirges anlangt, wenn er nach Süden, Südwesten oder Westen geht, und daß er nur ein oder zwei Tagereisen im Karawanentempo nach Südosten bis zum Gelben Flusse braucht. Lebensgefährlich ist es also nicht, die Spur zu verlieren.«
»Nein, nicht für den, der vom Nan-schan-Gebirge gehört hat«, antwortete Tsangpo, »oder der weiß, wie nahe der Gelbe Fluß ist. Aber für die andern. Für die Gedankenlosen, die jetzt auf den Kamelen schlafen! Oder für die, die vielleicht noch in dieser Stunde sich an der letzten Quelle um das Wasser zanken! Sie können bei schlechtem Wetter fehlgehen und sich schlimmstenfalls nach Nordwesten oder Norden verirren.«
»Dann sind sie verloren! Nach diesen beiden Himmelsrichtungen würden sie in endlosen Wüsten versinken.«
»Ich fürchte auch,« sagte Tsangpo, »daß die Mönche sehr ungleich auf die zurückgebliebenen Abteilungen verteilt sind. Alle Lamas der Tsacharen sind bei uns, und ich glaube auch vorhin bemerkt zu haben, daß die Lamas der Chalcha gleichfalls zusammenhielten. Was kümmern sich die Mönche um das Wasser! Ihre Sache ist es nicht, die Schläuche zu füllen und die Tiere zu tränken. Ich glaube nicht, daß ein einziger Lama beim letzten Lager zurückgeblieben ist.«
Die Ölöten ritten schweigend und sahen bald auf den Weg hinaus, bald zu den Sternen empor. Das Gelände begann langsam zu einer flachen Anhöhe anzusteigen. Hier hielt Terge Ritschen und saß ab. Der eine Ölöte kehrte sich im Sattel um und rief aus Leibeskräften: »Halt!« Verschlafene reckten sich, und einige, die sich wach gehalten und ihn verstanden, gaben den Ruf nach hinten weiter. Wie ein Lauffeuer ging er durch die ganze Karawane, bis er in der Ferne verklang.
Binnen kurzem hörte das regelmäßige Glockengeläute auf, und nur ab und zu schrillte ein Klingeln, wenn ein Kamel sich schüttelte, um den Kitzel loszuwerden, den das Reiben des Packsattels verursachte, oder wenn ein anderes seinen langen Hals herabbog, um vergebens nach Weide zu suchen.
Ein paar Chinesen traten an die Führer heran und unterrichteten sich mit Hilfe eines Dolmetschers über die Lage. Die andern sahen ab, legten sich der Länge lang in den Sand und schliefen laut schnarchend ein. Viele Pilger blieben auf ihren Kamelen liegen und schliefen weiter, als wäre nichts geschehen. Andere begannen sich zu unterhalten. Von Mann zu Mann ging die Botschaft, daß eine Zeitlang gerastet werden solle.
An mehreren Stellen flackerten kleine Feuer auf; vorsorgliche Diener, die etwas Holz mitgenommen hatten, wärmten in Kupferkannen Teewasser für ihre Häuptlinge. Die Kamele blieben reihenweise stehen; einige, die müde waren, legten sich von selber nieder. Hier und da wälzte sich ein Pferd im Sande, wurde aber sofort wieder von seinem Besitzer aufgescheucht, der nicht haben wollte, daß sein Sattel beschädigt wurde. Das Blöken von Schafen war in der Nacht zu vernehmen: ein paar flinke Hirten hatten den Platz schon vor der Spitze der Karawane erreicht.
»Wie lange werden wir hier halten?« fragte Tsangpo Lama die Führer.
»Bis Tagesanbruch, vielleicht auch länger. Die Häuptlinge trinken ja ihren Morgentee. Wenn es ihnen aber beliebt, länger zu bleiben, so kommen wir erst im Dunkeln an die Quelle, und dann ist es schwer, diese zu finden.«
Da Tsangpo voraussehen konnte, daß der Aufenthalt lange dauern werde, beschloß er, die Zeit nützlich anzuwenden.
Er nahm vom Prior Abschied und schwang sich auf ein Pferd, das bisher unberitten gegangen war – er hatte wie andere vornehme Pilger ein Reservepferd. Er hob die Reitpeitsche, ohne zu schlagen, und ritt in rasendem Galopp die ganze Flanke entlang an wechselnden Lagerbildern, qualmenden Feuern und bellenden Hunden vorüber. Gerade als er die letzte Reihe erreichte, tauchte eine der zurückgebliebenen Abteilungen auf und machte halt; nach einigen Minuten begegnete er der nächsten. Im Vorüberreiten gab er ihnen die nötigen Aufklärungen.
Dann dauerte es einige Zeit, bis wieder Schellen im Dunkel erklangen.
»Beeilt euch,« rief er, »dann könnt ihr in Ruhe essen! Weiter vorn rastet die Karawane.«
Er begegnete neuen Pilgerabteilungen und hatte sich bald so weit von der rastenden Karawane entfernt, daß die Gruppen, die er jetzt traf, wohl erst ans Ziel kommen konnten, wenn die Karawane sich schon wieder in Marsch gesetzt hatte.
»Macht Beine!« rief er daher. »Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr noch die andern einholen. Vergeßt nicht, immer geradeaus nach Südwesten zu gehen bis zum Fuße des Gebirges, wenn das Wetter schlecht wird.«
Kaum hatte er diese warnenden Worte den schläfrigen Treibern zugerufen, so hörte er auch schon am Schlag der Glockenklöppel, daß das Marschtempo beschleunigt wurde. Reitergruppen setzten sich in Trab, sobald sie seine Worte gehört hatten. Noch herrschte finstere Nacht. Lange Zeit verging, bis Schellengeläute das Herannahen der nächsten Abteilung ankündigte. Ihrem Führer, der auf einem Esel ritt, rief Tsangpo zu:
»Beeilt euch! Die Karawane hat schon eine Stunde gerastet; ihr holt sie erst im nächsten Lager ein. Wahrscheinlich gibt's Sturm. Ein Glück für euch, daß ihr Wasser habt!«
Der Führer trieb seine Leute zu größerer Eile an. Mehrere Kamelreiter, die die Stimme geweckt hatte, wurden ganz munter und stiegen von ihren Tieren, um ihre Last zu erleichtern. Sie weckten alle andern, und Tsangpo hörte noch lange, wie sie ihre Kamele antrieben.
Er ritt so schnell, als sein Pferd vermochte. Der Sand wirbelte unter den Hufen. Immer wieder rief er neuen Abteilungen dieselbe Warnung zu, die er immer mehr verschärfte, je größer die Entfernung von der Spitze des Zuges wurde.
Als lange Zeit niemand kam, machte er eine Weile halt, um das Pferd verschnaufen zu lassen und selbst zu lauschen. Er fragte sich, ob er vielleicht schon die letzten von den Zurückgebliebenen gesehen hatte. Als aber Tsagan, der ihn begleitete, bellend weiterlief, wurde ihm klar, daß noch mehr Leute unterwegs waren. Bald hörte er denn auch wieder Schellengeläute. Es war ein Teil der Karawane der Barinmongolen. Er klärte sie nachdrücklich über die Lage auf.
»Selbst Terge Ritschen erreicht den Lagerplatz erst nachts. Feuer werden dort angezündet werden; erhebt sich aber ein heftiger Sturm, der die Spur verwischt, so haltet euch nach Südwesten und zieht weiter, bis ihr ans Gebirge kommt. Dort bleibt. Dort gibt es Wasser und Weide. Seid ihr die letzten oder kommen noch mehr hinter euch?«
»Als wir die Quelle verließen, waren noch die Solonen da. Sie können nicht weit sein.«
Auch die Barinmongolen saßen ab und beschleunigten den Marsch. Als Tsangpo bald darauf den letzten begegnete, fragte er: »Waren noch welche von den Unsern bei den Quellen, als ihr aufbracht?«
»Nein, von den Unsern niemand. Aber wir hörten Menschenstimmen und Pferdewiehern aus der Richtung unseres gestrigen Marsches. Wir nahmen an, daß einige Pilger sich verspätet hatten, und kümmerten uns nicht weiter um sie. Als wir gerade abzogen, sprengten einige Reiter an die Quellen heran. Das Dunkel war zu schwarz, als daß wir hätten erkennen können, wer oder wie viele sie waren. Ein paar von uns blieben zurück, um zu horchen. Die Reiter berieten sich eifrig, wir verstanden aber nicht, was sie sagten. Offenbar tränkten sie ihre Pferde. Nach kurzer Zeit ritt die Schar vorwärts. Wir glaubten aber zu hören, daß ein paar Reiter unserer Spur folgten, jedoch in einiger Entfernung nördlich von unsern Weg.«
»Wie lange seid ihr gewandert, seit ihr den Salzsee verließt?«
»Die Töne eines Schneckenhorns wären hier noch zu hören; weiter ist es nicht.«
»Die unbekannten Reiter haben den Platz verlassen, sagt ihr?«
»Ja, soviel wir hörten.«
»Ich reite dorthin, um nachzuforschen, und folge dann eurer Spur. Wieviel Wasser habt ihr?«
»Für zwei, im Notfall für drei Tage.«
»Bei schlechtem Wetter braucht ihr vielleicht mehr. Ihr habt noch einen weiten Weg bis zur Spitze der Karawane. Ich rate euch, eilt, wenn ihr nicht Tage erleben wollt, die keiner von euch vergessen wird!«
Tsangpo hatte Leben in die Solonen gebracht. Erschreckt durch seine Worte und durch die Gestalten, die sie bei den Quellen gesehen hatten, trieben sie ihre Kamele mit lauten Rufen an. Die Halsglocken läuteten und schrillten, als gälte es, in den Krieg zu ziehen. Die Solonen waren nur fünfundzwanzig Mann stark und hatten zwanzig Kamele und ebenso viele Pferde. Während sie im Dunkel verschwanden, saß Tsangpo ab und mahnte Tsagan, nach den Fehlenden zu suchen. Der Hund lief einige Schritte in der Richtung des Salzsees, hob dann die Nase, schloß halb die Augen, windete und kehrte zu seinem Herrn zurück. Offenbar war niemand mehr bei den Quellen.
Ehe er nach dem Salzsee auf Kundschaft ritt, streckte sich Tsangpo Lama auf einer Düne aus, um eine Weile zu ruhen. Nach dem scharfen Ritt und einer schlaflosen Nacht war er müde. Der Bericht der Solonen hatte auf ihn keinen tieferen Eindruck gemacht. Ohne Zweifel gehörten die nächtlichen Reiter doch zur Karawane. Das Wetter war ruhig und still. Daß die Sterne verblichen, war nicht weiter wunderlich in einem Lande, dessen Luft so oft mit Staub durchsetzt war. Er schloß die Augen und schlief binnen einer Minute ein. Später sollte er es bitter bereuen, daß er sich in einem so ungünstigen Augenblick vom Schlaf hatte übermannen lassen!
Er bemerkte nicht, wie es im Osten tagte, wie das Licht zum Zenit stieg und die Sterne vertrieb, wie die Sonne, rotglühend wie geschmolzenes Eisen, durch dünne streifige Wolken blickte, sie feuerrot färbte und einen bedrohlichen Widerschein in der Sandwüste verbreitete. Er bemerkte nicht, wie der Himmel im Nordwesten sich vom Horizont aus schwärzte, und wie mauerdicke Sand- und Staubwolken vom Sturm über die Wüste getrieben wurden und sich purpurn färbten.
Die Sonne stieg höher; anstatt aber heller zu werden, wurde ihr roter Glanz dunkelrot. Die ersten Sturmstöße fegten über die Dünen; aber Tsangpo konnten sie nicht wecken. Er hörte nicht, wie es in der Ferne rauschte. Er hatte nicht bemerkt, daß sein Reitpferd, als die Solonen und ihre Reiter und Pferde im Dunkel verschwunden waren, sich einsam und verlassen fühlte, die Ohren spitzte, hinter ihnen drein wieherte und dann ganz ruhig ihrer Spur folgte. Er hatte nicht gehört, wie Tsagan, der begriff, daß das Pferd kein Recht hatte, seinen Herrn im Stich zu lassen, wahnsinnig bellend zu springen und dem Ausreißer vor der Nase herumzutanzen begann. Ganz verzweifelt über ein so schändliches Benehmen, hatte der Hund hartnäckig versucht, das Pferd zur Umkehr zu bewegen. Er hatte damit aber nur erreicht, seinen Gang zu verlangsamen; dieser wurde auch dadurch aufgehalten, daß das Tier in einem fort auf den schleppenden Zügel trat. Die Solonen waren infolgedessen nicht gewarnt worden, was geschehen wäre, wenn sie das Pferd ohne Reiter gesehen hätten. Das Hundegebell hörten sie nicht; die Entfernung war zu groß, und die Glocken ihrer Tiere läuteten zu stark. Im übrigen mußten sie auch bald an anderes denken. Sie gingen einem Unglückstag entgegen, der für einige von ihnen der letzte wurde.
Als die ersten Sturmstöße über das Land pfiffen, mußte Tsagan, vor Ärger und Unruhe knirschend, seine Versuche aufgeben. Er witterte nach Nordosten; ein Gedanke kam ihm, er lief pfeilgeschwind in der Spur zu Tsangpo Lama zurück. Von seinem naseweisen Verfolger befreit, konnte das Pferd seinen Gang beschleunigen, und vermutlich holte es allmählich die Schar der Solonen ein.
Unterdessen kam Tsagan zu seinem Herrn zurück, kurz bevor der Sturm mit aller Gewalt über den Platz fegte und den Sand von den Windseiten der Dünen zu heben schien. Laut bellend begann er mit den Vorderpfoten auf dem Schlafenden zu scharren und brachte sofort Leben in ihn. Tsangpo richtete sich auf; er rieb sich die Augen, schaute sich um, sah nach der Sonne und kam zu voller Besinnung.
Ohne zu wissen, was die Solonen dachten, als sie den leeren Sattel erblickten, konnte Tsangpo sich ihre Bestürzung ausmalen. War er krank geworden? War er tot niedergefallen? Sicherlich, glaubte er, hätten sie sofort Reiter zurückgeschickt, um ihn zu retten, der sich selber so vieler Mühsal ausgesetzt hatte, um ihnen zu helfen. Als sie aber zu Pferde sitzen und zu dem Einsamen zurückreiten wollten, hatte eine Mauer von Flugsand und Staub sich zwischen ihm und ihnen aufgerichtet, und die zahllosen Karawanenspuren von Kamelen, Pferden, Schafen und Männern begannen zu verschwinden. Da hatten sie vermutlich das Hoffnungslose ihres Suchens eingesehen.
Wie eine Feder schnellte Tsangpo empor und suchte sein Pferd. Er sah den Sturm kommen und hörte sein Rauschen. Tsagan verstand ihn und lief bellend in der Richtung der Solonen. Und während er sprang, drehte er immer wieder, bald rechts, bald links den Kopf nach dem Herrn um, als wollte er ihn mit fortziehen. Tsangpo verstand ihn und fing an zu laufen. Als er aber bedachte, daß es noch dunkle Nacht gewesen war, als er sich von den Solonen verabschiedete, und daß jetzt die Sonne ein Stück über dem Horizont stand, blieb er stehen und rief den Hund. Er sah, wie die Spur langsam im Sande verwischt wurde. Nur da, wo die schweren Kamele die Dünen niedergetreten und aus ihrer Form gebracht halten, mußte es noch einige Zeit dauern, bis der Wind alles wieder aufgefüllt hatte. Nicht einen Tropfen hatte er die ganze Nacht getrunken: jetzt spürte er den Durst. Noch brennender wurde dieser, als er an die trockene Wüste und ihre erstickenden Sand- und Staubwolken dachte und sich erinnerte, was die Ölöten über die Entfernung bis zur nächsten Quelle gesagt hatten, einer Quelle, die er in diesem Wetter nicht zu erreichen hoffen konnte. Deshalb streichelte er Tsagan, wischte ihm den Sand aus den Augenwinkeln, pfiff ihm munter zu und lief eilig an die Quellen des Lagers zurück, von denen er eine Stunde nach Mitternacht aufgebrochen war.
Unversehens stand er am Ufer des kleinen Salzsees und sah das Wasser der nächsten Quelle sickern. Im übrigen war die Gegend in Nebel gehüllt. Kein lebendes Wesen war zu erblicken, kein Reiter, weder Freund noch Feind. Nachdem er seinen Durst gelöscht hatte, überlegte er noch einmal, ob er sofort versuchen sollte, die Solonen einzuholen, oder ob er warten sollte, bis der Sturm sich legte.
»Sie marschierten mit der größten Geschwindigkeit, zu der beladene Kamele getrieben werden können,« dachte er, »und die Entfernung von hier bis zu ihnen ist daher groß. Die Spuren im Sande sind bereits verwischt. Es gelingt wohl einige Zeit, der Karawane zu folgen, aber schließlich erstickt man, wenn man nicht haltmacht. Da sie also sicher still liegen und der Abstand von ihnen nicht wächst und da die Spur schon verwischt ist, ist es besser zu warten. Für sie ist die Gefahr nicht so groß. Sie haben Proviant und Wasser und können ohne Gefahr ruhen, bis der Sturm aufgehört hat. Für mich ist es schwerer, ohne Wasser und Proviant dem Sturm zu trotzen. ›Ich würde mich im Sandmeer verirren und vielleicht nie bis zum Fuße des Gebirges vordringen. Hier gibt es wenigstens Wasser!‹«
Er machte sich auf, den Platz zu durchsuchen, wo das Lager gestanden hatte. Es war noch am Morgen. Ein langer Tag lag vor ihm. Der Sturm nahm an Heftigkeit zu, der Sand trieb in Wolken über den Boden hin. Die Spuren der Zelte und ihrer Pflöcke waren noch nicht verschwunden. Abfall, Knochenwirbel, Fetzen von Decken und Pelzen, Tauenden und Sackleinwand waren hier und da im Gras zu entdecken. Am besten erhalten waren die Feuerstätten, wo ein Topf auf drei zu einem Dreieck zusammengefügten Lehmklumpen über dem Feuer gestanden hatte. An ein paar Stellen glühte noch die Kohle.
Auf seiner Wanderung verlor er das Seeufer nicht aus dem Auge. Er sammelte den Brennstoff, der bei den Feuerstätten übriggeblieben war. Das wichtigste war, etwas Eßbares zu finden, aber die Hunde hatten nichts von ihrem Anteil an den geschlachteten Schafen übriggelassen. Tsagan nahm jedoch mit den Knochen vorlieb, die schon abgenagt waren.
Neben einem erloschenen Herd lagen einige Säcke, die Maiskorn enthalten hatten, das zum Füttern der Pferde verwendet wurde. Tsangpo schüttelte sie gründlich und bekam einige Handvoll zusammen. An einem andern Herd fand er den Schenkelknochen eines Schafs, an dem noch einige Muskeln hingen, ein Pilger hatte sie beim Aufbruch vergessen; die Hunde hatten sich des Feuers wegen nicht darangewagt. Mit seiner Ernte kämpfte sich Tsangpo an die erste Quelle zurück und ließ sich in ihrer Nähe im Schutz eines Tamariskendickichts nieder. Hier gelang es ihm ohne Schwierigkeit, Feuer zu machen und die Maiskörner in der heißen Asche zu rösten, während er mit dem Messer die verwendbaren Fleischstücke von dem gefundenen Schenkelknochen schnitt.
Nach der Mahlzeit fühlte er sich gesättigt und ging an die Quelle zurück, um das Essen hinunterzuspülen. Unter einigen Lumpen, die in dem kleinen Bach lagen, der von der Quelle zum See führte, fand er einen Ziegenschlauch, der dem Wassertransport diente. Wahrscheinlich war er nicht dicht und war deshalb weggeworfen worden. Er füllte ihn mit Wasser und fand die untere Hälfte tadellos. Er schlang daher eine Schnur mehrere Male um ihre Mitte. Auch wenn es ihm nicht glückte, zur Karawane zurückzufinden, mußte er bis zu dem Gebirge gelangen können, ehe der Durst ihn überwältigt hatte.
Hinter dem Tamariskendickicht scharrte er mit den Händen eine längliche Grube in den Sand und legte sich dort neben Tsagan nieder. Ein Schlafbedürfnis fühlte er nicht mehr, dazu war es um ihn herum zu unruhig. Es pfiff im Dickicht, und der Flugsand peitschte seinen Pelz. Um sich selbst war er nicht besorgt; wie mochte es aber in den verschiedenen Abteilungen der Karawane aussehen? Natürlich hatten sie alle haltgemacht, wo sie gerade waren, als das Unwetter losbrach. Die Kamele weigern sich zu gehen, wenn der Sturm sich in ihren Lasten verfängt und sie über den Haufen zu werfen droht.
Eine Ewigkeit schien ihn von der Stunde zu trennen, da er mit den Ölöten und mit Terge Ritschen gesprochen und sich vom Prior verabschiedet hatte. Jetzt waren sie weit weg und lagen wie er zusammengekauert unter dem Brausen des schwarzen Sturms. Sogar die Solonen, die letzten im Zuge, schienen ihm unerreichbar. Wenn er nur mit ihnen gezogen wäre, anstatt sich so leichtsinnig vom Schlaf überraschen zu lassen! Aber er hatte nicht die Absicht gehabt, lange zu schlafen, und er hatte nicht geglaubt, daß der Sturm sobald losbrechen könnte. Er hatte gemeint, in aller Geschwindigkeit die letzten im Zuge einholen zu können. Nun ärgerte er sich, daß er vergessen hatte, das Pferd an seinen Beinen festzubinden. Das hätte im Handumdrehen mit dem Lederriemen geschehen können, der zu diesem Zweck immer am Sattel hing.
Tsagan schlief zu einem Knäuel zusammengerollt, während sein Herr hin und her grübelte. Die Stunden vergingen, ohne daß der Sturm nachließ. Die Tamariskenstämme und -äste waren wie Bogen gespannt und konnten sich nicht einen Augenblick gerade richten. Die ganze Wüste schien auf der Wanderung begriffen. Es war beunruhigend, hier liegen und warten zu müssen, ohne etwas tun zu können.
Schließlich riß Tsangpo die Geduld. Mochte es gehen wie es wollte, jetzt konnte er nicht länger warten. Zur Hälfte unter Flugsand begraben, erhob er sich und schüttelte seine Kleider. Mit dem Messer schnitt er sich einen derben Tamariskenast als Stock ab, band den Wassersack auf den Rücken und begann seinen Kampf mit der Gewalt des Windes. Es war schon schwer, auf dem weichen Sand zu gehen, in dem jeder Schritt einsank, aber der unwiderstehlich wirbelnde und pressende Wind machte es noch zehnmal schwerer. Auf die gewöhnliche Art zu gehen, war unmöglich. Er stemmte sich gegen den Winddruck wie gegen eine Wand und ging langsam Schritt für Schritt. Er tastete sich vorwärts wie durch tosendes Wasser. Als der flatternde Besatz des Pelzes ihn hinderte, band er den unteren Teil des Gewandes an der Mitte unter dem Gürtel fest. Tsagan folgte ihm schnaufend und mißmutig, als fände er diese Wanderung wahnwitzig. Selbst der feine Geruchsinn des Hundes, der bei der Erkundung eines Geländes so wertvoll ist, hat bei einem Sandsturm keinen Wert. Die Sandkörner, die etwas vom Geruch der Karawane bewahrten, waren längst nach allen Himmelsrichtungen verweht, und neue bedeckten die verwischten Wegspuren.
Der Sturmwind war nicht gleichmäßig. Manchmal schien er das Spiel satt zu bekommen und zog mit gedämpfter Kraft vorüber. Dann benutzte Tsangpo die Gelegenheit, um einige Schritte vorwärtszudringen. Aber eine solche Unterbrechung dauerte nur einen Augenblick. Im nächsten erklang ein Getöse wie von einem rauschenden Wasserfall, und die Luft nahm unmittelbar über dem Erdboden einen schwarzbraunen Farbenton an. In einer Sekunde trieb die Windsbraut vorüber. Tsangpo blieb stehen und wandte sich nach der geschützten Seite, wo er das Getöse in der Ferne wie einen Donner weiterrollen hörte.
»Es ist unmöglich, sie zu finden, solange der Sturm andauert«, dachte er, als er wieder Atem holte.
Langsam senkte sich auf die brausende Wüste ein Dunkel herab, das nicht nur vom Sturm herrührte. Der Tag war vergangen, und die Nacht nahte heran. Die matte Beleuchtung fing an zu schwinden; Tsangpo aber setzte seinen Kampf mit verdoppelter Entschlossenheit fort, in dem Gedanken, daß jeder Schritt ihn dem Nachtrab des Pilgerzugs näherbrachte. Zuweilen drehte sich alles um ihn im Kreise, und er wurde durch das andauernde Getöse ganz verwirrt. Bei besonders heftigen Windstößen hatte er ein Gefühl, als müßte er ersticken; er hielt den rechten Arm vor sich wie einen schützenden Schild und rang nach Luft.
Eine nachtschwarze Wulst wirbelnden Sandes kam aus Nordwesten dahergefegt. Tsangpo blieb wieder stehen und kehrte ihr den Rücken zu. Er wurde in Dunkel gehüllt und sah kaum den Boden zu seinen Füßen. Es war ihm. als stünde er mitten in einem Sandstrom, der in zischenden Schnellen nach Südosten strömte, um den Gelben Fluß noch gelber zu machen. Lange hielt der Stoß an. Tsangpo setzte sich und vergrub das Gesicht im Pelz. Als die Windsbraut nachließ, erhob er sich, um weiterzugehen. Aber das Dunkel, das mit dem Sande dahergekommen war, war über dem Erdboden zurückgeblieben. Der letzte Rest der Dämmerung war nach Westen gezogen, und eine neue Nacht schlich von Osten heran, aus den Wüsten von Ordos.
Der einsame Wanderer fing wieder an, sich vorwärtszukämpfen. Bald merkte er, daß er von dem zunehmenden Dunkel verwirrt wurde, das ihm die Richtung des Flugsandes nicht deutlich erkennen ließ. Die über den Boden fegenden Sandmassen waren für das Zurechtfinden genau so wichtig wie der Winddruck selbst. Zuweilen schlug der Wind Wirbel, als wären verschiedene Windmassen gestolpert und kopfüber übereinandergestürzt. Eine Düne, die höher war als die nächsten, oder eine Bodenvertiefung konnten eine solche Unregelmäßigkeit verursachen. Tsangpo sah das Hoffnungslose seines Kampfes ein und beschloß, die Nacht über still liegenzubleiben. Eine endlose Nacht! Aber vielleicht sang der Wind die letzten Strophen seines Lieds? Vielleicht flaute er vor Tagesanbruch ab?
Es galt also nur, einen geeigneten Schlafplatz zu finden. Sich im Schutz einer etwas höheren Düne niederzulegen, war gefährlich; Tsangpo verspürte keine Lust, sich lebend unter wanderndem Flugsand begraben zu lassen. Auf der Windseite oder auf dem Kamme einer Düne war er der ganzen Gewalt des Sturms ausgesetzt.
Nach einigem Suchen fand er zwischen ein paar Dünen eine Vertiefung im Lehmboden. Hier ließ er sich mit dem Rücken gegen den Wind nieder, lockerte den Gürtel, zog die Arme aus den Pelzärmeln und den Pelz über den Kopf. Ringsum in der Wüste war es schwarz wie in einem Sack. Er öffnete die Mündung des Ziegenschlauches und trank. Dann machte er in seiner Fuchspelzmütze eine Vertiefung, aus der Tsagan saufen konnte. Darauf schnürte er den Ziegenschlauch wieder zu und kroch unter den Pelz. Es war Herbst, und die Nächte waren rauh. Es war auch nicht leicht, sich in dem Wirbelwind warmzuhalten. Aber Tsangpo war abgehärtet und schlief ein.
* * *
Als Tsangpo Lama zwei Stunden vor Tagesanbruch die Ölöten und Terge Ritschen verlassen und vom Prior Abschied genommen hatte, um an die Quelle zurückzureiten und die Zurückgebliebenen zu warnen, hatten an der linken Flanke der Karawane an mehreren Stellen kleine bescheidene Lagerfeuer gebrannt, an denen Tibeter, Chinesen und Mongolen sich ihren Tee kochten und ihr Fleisch zum Frühstück brieten. Man hatte einen ganzen Tag in der Wüste vor sich und konnte erst nach Einbruch der Dämmerung im nächsten Lager einen Tropfen heißen Tee erhalten. Dem Beispiel folgten daher alle, die so klug gewesen waren, auf den Kamelen Brennstoff mitzunehmen, und in kurzem funkelte ein Perlenband von Feuern im Dunkel.
Der und jener Nomade, der gewohnt war, Wind und Wetter zu deuten und im Glanz der Sterne zu lesen, hatte das Gefühl, daß nach dem schönen Wetter der letzten Tage und der kalten Stille der letzten Nächte sich in der Luft eine ungewöhnliche Veränderung vorbereitete. Aber sie sagten kein Wort; teils dachten sie, das Wetter könne hier andern Gesetzen gehorchen als in ihrer Heimat, teils brauchten sie sich nicht zu ängstigen, da die Karawane von sicheren Führern gelenkt wurde und sie im Falle einer Gefahr so viele Unglückskameraden hatten.
Eine Stunde verging. Allmählich erloschen die kleinen Feuer und wurden mit Sand zugeschüttet, damit die Kamele nicht in die Glut treten sollten. Aber die Pilger blieben noch in schweigenden, schläfrigen Gruppen sitzen und tranken eine Schale Tee nach der andern, um sich für den langen Marsch zu erfrischen.
Die beiden Ölöten hatten eine Unterredung mit Terge Ritschen, der wohl die Pilgerstraße kannte, dagegen nicht die Erfahrungen des Steppenbewohners hatte, um das Wetter mit Sicherheit Vorhersagen zu können. Sie machten ihm klar, daß höchstwahrscheinlich im Laufe des Tages Sturm zu erwarten sei. Sie beschlossen, die tibetischen Gesandten und die vornehmen Chinesen über ihre Besorgnisse zu verständigen. Auf diese Weise wollten sie die Verantwortung von sich abwälzen, um so mehr als sie von Tsangpo Lama erfahren hatten, daß die Hälfte der Pilger mit ihren Karawanen noch nicht eingetroffen war.
Die baschlikartige Pelzmütze in der Hand und mit zum Gruße ausgestreckter Zunge trat Terge Ritschen an das noch brennende Feuer der Gesandten heran und fragte in demütigem Ton, ob er ihnen eine Mitteilung machen dürfe. Nachdem er dann mit ihrer Erlaubnis gesagt, was er auf dem Herzen hatte, erhoben sich die Herren und gingen zum Feuer der Mandarine, an dem sie sich zur Beratung niederließen; auch die mongolischen und tibetischen Dolmetscher wurden gerufen. Ein Chinese, ein älterer würdiger Herr mit ernsten Gesichtszügen und grauem Schnurrbart, der einen kostbaren Pelz, Pelzkragen, Pelzmütze und pelzgefütterte Sammetstiefel mit derben Sohlen trug, hob den Deckel von seiner Teetasse, nahm einen Schluck und fragte mit unerschütterlicher Ruhe:
»Es gibt also Sandsturm?«
»Ja, Herr, es sieht so aus, als wäre ein Sturm im Anzug«, antwortete der eine Ölöte.
»Wann kann er nach eurer Meinung hier sein?«
»Das ist nicht genau zu sagen, Herr. Er kommt früh für diese Jahreszeit. Die Winterstürme setzen viel später ein, aber einer muß der erste sein, und zuweilen sind die ersten Stürme schwer. Er kann in einer Stunde da sein, er kann am Abend kommen, er kann auch über einen andern Teil der Wüste hinwegfegen und diese Gegend unberührt lassen.«
»Es besteht also die Möglichkeit, daß wir das nächste Lager erreichen, ohne vom Sturm betroffen zu werden?«
»Vielleicht. Aber im Nordwesten verlieren die Sterne ihren Glanz und verbleichen einer nach dem andern. Es ist das beste, sich auf Sturm gefaßt zu machen. Lagerten wir jetzt noch an den Quellen beim Salzsee, wo wir gestern lagerten, so wäre ich dafür, zu bleiben.«
»Und jetzt – was hältst du jetzt für das gescheiteste? Ich für meinen Teil wäre dafür, sofort weiterzuziehen. Kommt der Sturm und zwingt uns haltzumachen, so können wir es nicht schlimmer treffen als hier, wo wir mitten in der Salzwüste sind.«
»Wir brechen also sofort auf?«
Der Häuptling der Tsacharen, der inzwischen zu der Beratung gekommen war, teilte mit, daß ein großer Teil der Karawane noch nicht angekommen sei; es sei gefährlich für die Zurückgebliebenen, von der Spitze des Zuges abgeschnitten zu werden. Die Mandarine erklärten jedoch, diejenigen, die nicht aufgepaßt hätten, müßten für sich selber sorgen, und gaben den Befehl zum Aufbruch. Man gestand nur so viel zu, daß der Aufenthalt verlängert wurde, bis Teekannen, Decken und was man sonst ausgepackt hatte, wieder verstaut waren. Unterdessen wurde es Tag; die Sonne ging auf, und niemand konnte mehr darüber im Zweifel sein, welches Wetter bevorstand. Die Mandarine zauderten eine Zeitlang bei ihren Pferden. Die Wegkundigen wurden abermals herbeigerufen und antworteten auf Befragen:
»Binnen einer halben Stunde haben wir den stärksten Sandsturm!«
Da änderte man die Befehle und ordnete Rast an. Der Beschluß ging in der ganzen Karawane von Mund zu Mund. Die Sonne verfinsterte sich. Überall herrschte größte Geschäftigkeit. Der nächste Befehl ging dahin, die Kamele sollten mit dem Kopf nach Südosten liegen und die Pferde sollten in nächster Nähe angebunden werden.
Die ersten Windstöße kamen, mit ihnen flatternde Sandfetzen. Dann war es eine Zeitlang wieder ruhig. Alle Kamele lagen in einer endlosen Reihe da. Man lief durcheinander und holte aus dem Gepäck alles zusammen, womit man in aller Geschwindigkeit für Häuptlinge und Lamas niedrige Notzelte errichten konnte. Über Stangengerippe wurden Decken und Säcke geworfen; auf die Ränder wurden Kisten gestellt, damit die Zelte nicht wegflogen. Zum zweiten Male lagerte man auf derselben Stelle in der Wüste, aber jetzt herrschte unter den Pilgern ängstliche Unruhe.
Aus einem Lager der Chalcha erklangen die unheimlichen, langgezogenen Töne von Posaunen und Schneckenhörnern, krachten Trommeln, rasselten die Becken. Lamas wollten die Geister der Luft beschwören, sie in Fesseln schlagen und ihre Untaten verhindern. Andere Abteilungen folgten dem Beispiel und überboten einander in laut lärmender Musik. Tundup und Schagdur fragten den Prior, ob nicht auch ihre Tempelkapelle den Sturmmarsch aufspielen solle.
»Jawohl«, antwortete er. »Holt die Instrumente hervor und bearbeitet sie mit aller Kraft! Es scheint ein lustiger Teufelstanz zu werden«, fügte er hinzu, als ein heftiger Windstoß den Sand zwischen den Kamelen aufwirbelte.
Die rotbraune Sonne sandte einen matten Schein auf eine endlose Reihe von dunkeln, liegenden Kamelen herab, auf zusammengekoppelte Pferde, die vor Verlangen nach Gras mit den Vorderhufen im Sand scharrten, auf Männer, die geschäftig Pelze und Decken herbeischleppten, während die Häuptlinge in Gruppen herumstanden und das Nahen des Sturms und die Vollendung ihrer Notwohnungen erwarteten.
Hier und da standen die Lamas bei kleinen im Sande errichteten Zeltaltären, auf denen Buddha mit vergoldeten Lippen dem herannahenden Unwetter zulächelte. Die Mönche schluckten bereits Sandwolken, die von neuen Windstößen in die Mündungen ihrer langen kupfernen Posaunen hineingetrieben wurden.
Die gedämpften Farben wurden immer dunkler, je mehr die Sonne von dem Staubnebel verschleiert wurde, hoben sich aber scharf und deutlich von dem finster drohenden Hintergrund des heraneilenden Sturms ab. Es herrschte das Schwarz und Braun, das schmutzige Gelb und dunkle Grau der Kamele vor, deren Winterwolle in wulstigen Zotteln wuchs. Dort sah man Pferde von verschiedener Farbe, schwarze, weiße und braune, und Herden schwarzer Fettschwanzschafe. Viele von den Mongolen trugen dunkelblaue Pelze mit schwarzen Kragen und Baschliks aus Fuchspelz, dessen Haar den blutroten Tuchkopf der Kappe wie ein rotgelber Kranz einfaßte. In Zwischenräumen erschienen in roten Pelzen und gelben Baschliks die Mönche, die mit ihren Posaunen und Trommeln vergebens die Luftgeister zum Schweigen zu bringen suchten.
Der Sturm verhüllte das ganze Bild, und die malerischen Farben wurden weggewischt. Häuptlinge und Mandarine krochen in ihre Höhlen, die Lamas ließen eiligst ihre Buddhabilder in den Altartruhen verschwinden und packten ihre Musikinstrumente ein. Die Menschen krochen wie Ratten in ihre Löcher. Die Pilger, die kein Zelt hatten, hockten, in Decken und Pelze gewickelt, zwischen den Kamelen, wohin auch die Karawanenführer und Treiber ihre Zuflucht nahmen. Den Hirten ging es am schlimmsten. Sie mußten, solange der Sturm andauerte, wenigstens abwechselnd bei den dummen, leicht zu erschreckenden Schafen Wache halten.
Für die zurückgebliebenen Abteilungen konnte nichts getan werden. Es war der Befehl ergangen, niemand solle seinen Platz verlassen. Wenn das Unwetter vorüber war, sollten berittene, wegkundige Ölöten die Wüste bis zu den Quellen am Salzsee durchsuchen. Viele von den Zurückgebliebenen waren jedoch nachgekommen, nachdem Tsangpo Lama sie zur Eile gemahnt hatte. Als sie im Morgenlicht das drohende Aussehen des Himmels selber erkennen konnten, hatten sie ihre und der Kamele Muskeln bis aufs äußerste angespannt. Die Linie der Hauptkarawane wurde also nach hinten zu immer länger, und alle erreichte die Losung, die für den Tag ausgegeben war. Als der Sturm losbrach, wurden zwar noch einige Abteilungen vermißt, aber keine Glocke verkündete mehr, daß sie im Anzug waren. Sie hatten haltgemacht, als sie die Spur nicht mehr sahen.
Die Szene, die zuvor von der braunen Sonne schwach beleuchtet wurde, bot später einen wunderlichen Anblick dar. Es sah aus, als sei der ganze Zug verhext und in Bildsäulen und Grabdenkmäler verwandelt. Mit vorgestreckten Hälsen und Köpfen lagen die Kamele auf dem Boden und hielten die Augen halb geschlossen. Allmählich wurden sie mit Flugsand und Staub bedeckt und sahen graugelb aus, als wären sie in Lehm geformt. Die Pferde schliefen im Stehen mit hängenden Köpfen; Schwänze und Mähnen flatterten wie zerfetzte Wimpel. Die Schafe hatten an ihren dicken Pelzen einen Schutz gegen den erstarrenden Wind, sie drängten sich dicht zusammen und hielten die Köpfe nach unten.
Andere Männer als die Hirten und ein paar Pferdeknechte waren kaum zu sehen. Die übrigen lagen da wie die Gefallenen auf einem Schlachtfeld und kümmerten sich wenig um den Sand. Man hätte glauben können, sie wären alle in den Tod hinübergeschlummert. Zuweilen nur erhob ein Kamel seinen Kopf und schüttelte ihn, um den kitzelnden, drückenden Sand loszuwerden, der sich an seinem Hals festgesetzt hatte. Dabei klingelte seine Halsglocke, aber niemand hörte oder beachtete es. Geduldig und ergeben ließ es den Kopf wieder zu Boden sinken.
Der Tag ging wie der Sturm über die Rastenden hin; der Einbruch der Nacht brachte keine Veränderung ihrer Lage.