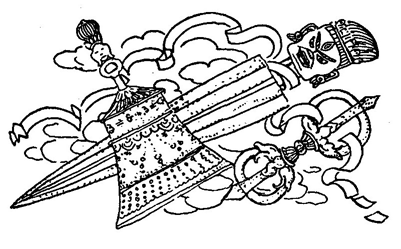|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
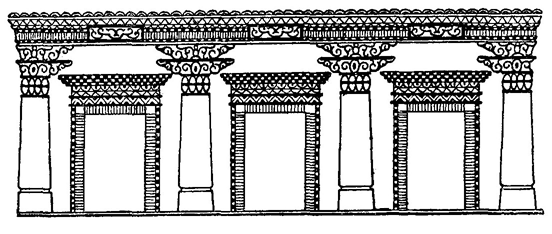
 Kaum hatte die Sonne die Schneefelder an den Südabhängen des Nan-schan hellrot gefärbt wie die wilden Rosen des Graslandes, als Tsangpo Lama schon zum Prior eilte. Der Alte billigte seinen Plan. Eine Wallfahrt nach den tibetischen Klöstern wäre nutzlos gewesen, wenn man nicht die Gelegenheit benutzt hätte, den heiligen Eremiten in ihrer Not Hilfe zu bringen. Wie aber konnte das geschehen?
Kaum hatte die Sonne die Schneefelder an den Südabhängen des Nan-schan hellrot gefärbt wie die wilden Rosen des Graslandes, als Tsangpo Lama schon zum Prior eilte. Der Alte billigte seinen Plan. Eine Wallfahrt nach den tibetischen Klöstern wäre nutzlos gewesen, wenn man nicht die Gelegenheit benutzt hätte, den heiligen Eremiten in ihrer Not Hilfe zu bringen. Wie aber konnte das geschehen?
Auf die Frage des Priors antwortete Tsangpo:
»Vorigen Winter ist Namgjal fünf Tage lang auf einer Eisscholle herumgefahren. Es kommt nur darauf an, etwas zu finden, was im Wasser schwimmt und mich und die Lebensmittel tragen kann, die die Unglücklichen brauchen, bis das Eis trägt und die Nomaden wieder zu ihnen hinübergehen können.«
»Die Entfernung ist groß, und wie willst du die Insel erreichen?«
»Auf dem Meer vor Schanheikuan gehen Dschunken unter Segel. Wir haben Zelttuch und Zeltstangen.«
»Du kannst von einem Sturm überrascht werden.«
»Mein Fahrzeug aus Ziegenhäuten und Stangen schaukelt auf den Wellen, sinkt aber nicht. Für mich besteht keine Gefahr. Ein Sturm kann mich an der Insel vorübertreiben, aber schließlich werde ich immer irgendwo ans Land geworfen.«
»Du weißt, die Chinesen warten voller Ungeduld darauf, binnen zehn Tagen aufzubrechen.«
»Mehr Zeit brauche ich nicht.«
Tsangpo Lama ging sofort an die Ausführung seines Plans. Man sammelte Ziegenschläuche, die zum Wassertransport in der Wüste verwendet worden waren. Der und jener spendete entbehrliche Zeltstangen und Dachsparren. Aus ihnen wurden zwei Gitter zusammengesetzt und dazwischen die mit Lust gefüllten Ziegenschläuche festgebunden. Im Vorderteil wurde eine Zeltstange aufgerichtet, und das Segel erhielt dieselbe Gestalt wie an den Dschunken. Der Proviant bestand aus ein paar Säcken Tsamba, einigen mit Butter gefüllten Schafmagen, ein paar Stücken Ziegeltee und vier lebenden Ziegen.
In der Dämmerung wurde das Fahrzeug fertig. Die Nacht war schneidend kalt, und am andern Morgen war der ganze See mit einer dünnen Eisdecke überzogen. Wenn Frost und Windstille anhielten, war das Eis binnen wenigen Tagen stark genug, um Fußgänger zu tragen. Am Abend traten ein paar bewaffnete Tanguten in das Zelt des Häuptlings vom Bokain-gol, als Tsangpo Lama gerade bei ihm zu Besuch war. Sie brachten Botschaft vom Eremiten Namgjal, der tags zuvor von Labrang aus in ihrem Lager am Südufer des Sees angelangt war.
Zum Lohn für ihre gute Nachricht wurden die Tanguten bewirtet. Sie streiften dann zwischen den Zelten der Pilger umher und unterrichteten sich genau über den Plan zur Rettung der Eremiten. Sie erfuhren auch, daß derjenige, der das gebrechliche Fahrzeug nach der Insel hinüber und von dort aus nach irgendeinem Teil des Seeufers, vielleicht in die Nähe ihrer eignen Lagerplätze, steuern wollte, der Sohn eines reichen Fürsten war. Nachdem sie genug gehört hatten, gingen sie ihrer Wege.
Im Verlauf des nächsten Tages kam Namgjal angewandert. Er freute sich über Tsangpos Plan; dieser könne jedoch nicht ausgeführt werden, wenn der Frost anhielt. Es sei sicherer, sich dem Eise anzuvertrauen, als auf den tückischen Wellen zu treiben.
In der Nacht kam ein scharfer Nordwestwind auf, und vor Sonnenaufgang war das noch dünne Eis bereits aufgebrochen und nach Südosten außer Sehweite getrieben.
Im Nu faßte Tsangpo den Entschluß zum Abmarsch. Namgjal trug kein Bedenken, ihn zu begleiten. Der Proviant wurde an Bord geschafft und verstaut, dazu ein Haufen Brennholz aus derben Tamariskenästen. Am hintern Ende des Fahrzeugs wurde ein Steuerruder von der Art angebracht, wie Tsangpo es bei den Chinesen gesehen hatte. Dann nahmen sie Abschied, und das Floß trieb vor dem Winde auf den See hinaus. Unter den Zuschauern befanden sich einige Tanguten; niemand wußte, woher sie gekommen warm.
Über den richtigen Kurs hatte sich Tsangpo dadurch vergewissert, daß er der Richtung des von einem Feuer aufsteigenden Rauches folgte. Mit Hilfe des Segels trieb denn auch das Floß geradewegs auf die Insel zu. Die Wellen gingen höher und wurden zu schäumenden Hügeln. Das Gitterwerk des Floßes stöhnte und knackte. Das Floß schaukelte auf und ab und bog sich fügsam nach den Formen der Wellen. Das Ufer verschwand; ringsum breitete sich die weite Wasserfläche. Infolge der beträchtlichen Belastung sickerte Luft aus den Ziegenhäuten, das Floß ging immer tiefer, und das Wasser spritzte zwischen den Latten wie Springbrunnen empor. Die beiden Männer waren sich ihrer Machtlosigkeit bewußt. Die Ziegen, deren Füße zusammengebunden waren, meckerten kläglich und zappelten, um loszukommen.
Tsangpo versäumte nicht, den Kurs einzuhalten. Die Insel wurde größer, und schließlich erhob sie sich ganz in der Nähe wie ein runder Berg, auf dessen Scheitel das vergilbte Gras im Wind wehte. Das Floß trieb am Nordufer entlang, und Tsangpo steuerte es mit aller Kraft hinter eine Klippe, wo es vor dem Wind geschützt war. Sie landeten in einer kleinen Bucht mit sandigem Strand. Das Segel wurde geborgen, der Proviant ans Land geschafft, die Ziegen auf dem nächsten Weideplatz angepflockt, das Floß an den Strand heraufgezogen und fest vertäut.
»Das Floß darf nicht davonschwimmen, während ich auf der Insel bin«, sagte Tsangpo. »Denn dann müßte ich warten, bis der See zugefroren ist, und unterdessen würde die Karawane aufbrechen. Dir könnte das freilich gleichgültig sein; du willst ja für immer hierbleiben.«
Weder Tsembe noch Ngurbu Tanduk waren zu sehen. Namgjal und Tsangpo machten sich eiligst nach den nächsten Höhlen auf den Weg. Sie gingen in die erste hinein. Sie war leer.
»Sie sind schon verhungert«, klagte Namgjal. »In Zukunft werde ich mit den vier Ziegen allein sein. Aber wir müssen doch die Leichen finden.«
In der Höhle lagen ein paar Haufen Pergamentblätter. Namgjal las die letzten und sah, daß viel geschrieben worden war, seitdem er die Insel verlassen hatte. Die Asche eines längst erloschenen Feuers war noch vorhanden. Im Hintergrunde der Höhle, da, wo die Einsiedler auf Schaffellen und Lumpen zu schlafen pflegten, war weder ein Lebender noch ein Toter aufzufinden. Irgendwelche Lebensmittel oder Gefäße für Butter und Tsamba waren nicht zu entdecken. Die Höhle mit der vorgebauten Mauer, die als Schafhürde diente, war gleichfalls leer.
Dann stieg Namgjal mit Tsangpo hinauf, um den kleinen Tempel zu besuchen. Sie erreichten den Friedhof, auf dem die Eremiten seit Jahrhunderten ihre verstorbenen Brüder bestattet hatten. Jedes Grab deckte ein flacher Stein mit der Inschrift » Om mani padme hum«. Hier blieb Namgjal stehen und zeigte auf ein ganz frisches Grab.
»Dies«, sagte er, »war noch nicht da, als ich die Insel verließ! Hier ruht entweder Ngurbu Tanduk oder Tsembe. Der Überlebende von den beiden muß noch auf Erden sein, wenn er sich nicht in den See gestürzt hat oder von den Geiern zerfleischt und fortgeschleppt ist.«
Kaum hatte er diese Vermutung ausgesprochen, als sich die niedrige Holztür des Tempels knarrend öffnete und Tsembe über die Steinschwelle trat. Der siebzigjährige Einsiedler, der vierzig Jahre auf der Insel zugebracht, der sie nie auch nur einen Tag verlassen und ebensowenig zu ungesetzmäßiger Zeit Gäste empfangen hatte, erschien; er war nicht übermäßig erstaunt. Aber er stützte sich mit der einen Hand auf den Stock und hielt mit der andern die Tür fest. Stehenbleibend, betrachtete er die Ankömmlinge mit freundlichem Lächeln und sah dann auf den See hinaus, als wollte er sich davon überzeugen, daß er nicht zugefroren war. Trotzdem er schaumgekrönte Wellen über die dunkle Wasserfläche wandern sah, fragte er nicht danach, wie sie hergekommen seien, sondern sagte ruhig:
»Du bist also am Leben, Namgjal. Ich glaubte, du wärst in den grünen Grotten auf dem Seegrunde beim Drachen zu Gaste. Wer ist der junge Mann, den du mitbringst? Hat er die Absicht, die Einsamkeit mit uns zu teilen?«
»Nein, er verläßt uns morgen oder in den nächsten Tagen. Er heißt Tsangpo Lama und ist ein mongolischer Pilger auf der Wanderung nach den heiligen Stätten Tibets. Als er von deiner und Ngurbu Tanduks Not erfuhr, baute er ein Floß, um euch Lebensmittel zu bringen.«
»Die Götter mögen ihn segnen!«
»Wir fürchteten schon, zu spät zu kommen, aber ich begreife, daß eure Vorräte länger gereicht haben als berechnet, da Ngurbu Tanduk gestorben ist. Denn das Grab hier kann doch nur seinen Leib bergen.«
»Du hast recht. Im Frühjahr, als die ersten Wildgänse zurückkehrten, ist Ngurbu Tanduk nach kurzem Hinsiechen gestorben – zwei Monate, nachdem du und Angdu auf eurer Eisscholle vorübergeschwommen waret.«
Jetzt unterbrach Tsangpo Lama das Gespräch.
»Vater, der Tag geht zu Ende«, sagte er. »Wir wollen noch vor Sonnenuntergang unsere Gaben in deine Höhle schaffen und dann beim Abendfeuer deinen Bericht hören.«
Sie kehrten alle drei zum Floß zurück, das sicher verwahrt in seiner Bucht am Ufer lag – um so sicherer, als Wind und Wellen ganz nachgelassen hatten. Tsembe lächelte, als er die wohlgenährten Ziegen erblickte, die im Umkreis ihrer Pflöcke grasten. Tsangpo nahm den Sack mit Tsamba auf den Rücken, Namgjal den Buttervorrat und Tsembe den Ziegeltee, und nachdem sie ihre Lasten in die eine Höhle getragen hatten, kehrten sie zurück, um das Feuerholz und die Ziegen zu holen, die bis zum Einbruch der Dämmerung in der Nähe werden durften. Dann wurden sie in die Hürde gesperrt.
Während Namgjal aus einem Regenwassertümpel Eis holte, machte Tsangpo in der Höhle des Eremiten Feuer. Draußen wurde es finster. Das Rauschen der Wellen verklang in dem ersterbenden Winde. Rotgelbe Flammen erhellten das rußige Gewölbe der Höhle. Die Eisstücke wurden zerschlagen und in eine kupferne Teekanne geschüttet, die ans Feuer gestellt wurde. Dann wurde ein Stück Ziegeltee ins kochende Wasser geworfen. In den herbeigeschafften Holzschalen wurde Tsamba mit Butter geknetet.
»Wir müssen mit dem Holz sparsam umgehen«, sagte Tsangpo. »Es kann lange dauern, bis ihr wieder welches bekommt. Heute abend aber wollen wir das Ende deiner Wartezeit feiern, Tsembe. Nun bist du sieben Monate mutterseelenallein auf der Insel gewesen!«
»Das gesegnete Brennholz, das du mitgebracht hast, wird lange genug reichen, und dann haben wir ja auch den Ziegenmist zur Verfügung.«
Nach einer Pause fragte er: »Wo ist Angdu?«
Namgjal erzählte ausführlich, was er durchgemacht, und als er geendet hatte, sagte er: »Aber laß uns nun hören, was du seit unserer Trennung erlebt hast.«
»Unsere Tage«, begann Tsembe, »gingen in derselben Weise hin wie in der Zeit, als du und Angdu bei uns wart. Wir sahen euch auf eurer Eisscholle nach Südosten verschwinden. Als der Wind sich drehte, konnten wir uns denken, daß ihr nicht das Ufer erreichen, sondern auf den See zurückgetrieben werden würdet. Aber erstaunt waren wir doch, als wir ein paar Tage später deine Stimme draußen auf dem Wasser hörten. Wie aufgeregt und traurig wir wurden, als wir erfuhren, daß Angdu den Verstand verloren hatte, kannst du dir denken. Dich hielten wir für verloren, nachdem wir euch nach Nordwesten halten treiben sehen. Und nachdem der See wieder zugefroren war und bald darauf vom heftigsten Sturm aufgepeitscht wurde, betrauerten wir euch beide als Tote.
»An dem Abend, an dem wir euch zum letztenmal gesehen zu haben glaubten, sprachen wir nicht viel. Mit dem bißchen Brennstoff, der noch vorhanden war und nicht erneuert werden konnte, da wir der Schafe und Ziegen beraubt waren, gingen wir möglichst sparsam um. Wir machten abends kein Feuer, sondern kauerten uns frühzeitig in unsern Ecken in der Höhle zusammen. Dunkel war es nicht. Der See lag im Mondschein. Du kannst dir mein Entsetzen denken, als mich mitten in der Nacht Wolfsgeheul weckte. Ich rüttelte Ngurbu Tanduk aus dem Schlafe. Keiner von uns wagte hinauszugehen. Unheimlich und verzweifelt drangen die langgezogenen Laute durch die Stille der Nacht. Sie kamen von dem See draußen, und ich konnte mir nur denken, daß es der eine von den Wölfen war, die unsere Schafe und Ziegen aufs Eis getrieben und die meisten zerrissen hatten. Auf seiner Eisscholle ist er wie du und Angdu von demselben Wind nach Nordwesten getrieben worden. Wir faßten Mut und gingen ins Freie. Richtig! Wir sahen den Wolf auf einer Eisscholle in so weiter Entfernung vom Ufer, daß er sich wohl nicht getraute, ans Land zu schwimmen. Er trieb bei der schwachen Brise vorüber, und wir hörten sein Klagegeheul, bis es in der Ferne verklang. Als der See in der folgenden Nacht zufror, fürchteten wir, der Wolf könnte zu uns herüberkommen. Die ersten Tage gingen wir nie allein zum Tempel hinauf. Als sich aber kein Wolf auf der Insel sehen ließ und der Sturm dann das Eis aufbrach, beruhigten wir uns.
»Bereits an demselben Tage, an dem ihr uns verließt, untersuchten wir den Vorrat von Tsamba und Butter, den wir von den letzten Hirten erhalten hatten. Ein paar Krüge saure Milch war alles, was von unserer eignen Herde noch vorhanden war. Schale für Schale schütteten wir das Gerstenmehl aus einem Sack in einen andern, und da jeder von uns zwei der kleinsten Schalen brauchte, um das Leben einen Tag zu fristen, so berechneten wir, daß der Vorrat vier Monate reichen werde, bei äußerster Sparsamkeit noch etwas länger. Ihr hattet euch verrechnet, als ihr annahmt, wir hätten Lebensmittel für acht Monate.
»Indessen sahen wir der Entwicklung der Dinge mit Ruhe entgegen. Sobald die Tage hell wurden und die Sommerwärme in die Höhle hereinströmte, mußten wir Hungers sterben. Wir machten neben dem Tempel ein Grab fertig, waren aber der Meinung, der Überlebende werde, wenn ihn der andere verließ, schon so schwach sein, daß er den Toten nicht bestatten konnte.
»Zu Anfang des Frühjahrs wurde Ngurbu kränklich und klagte über Schmerzen in der Brust und im Rücken. Gebückt unternahm er mit schweren Schritten seine Wanderungen zum Tempel hinauf. Eines Tages, als die ersten Wildgänse sich in ihren alten Nestern im Sande niedergelassen hatten, sagte er:
›Heute mußt du meinen Teil des Tempeldienstes mit übernehmen. Ich kann nicht mehr hinaufgehen.‹
»Ich übernahm seinen Dienst zu dem meinen und saß im übrigen den ganzen Tag an seinem Lager. Er verlosch langsam wie eine Lampe ohne Öl. In einer dunkeln, bewölkten Nacht ohne Mond und Sterne ging er von mir. In der Höhle war es finster wie in einem Sack. Der Nordwind heulte draußen in den Klippen, und einige Schritte von uns entfernt donnerten die Wogen gegen das Ufer. Ich konnte ihn nicht sehen, nur fühlen. Seit Einbruch der Dämmerung hatte ich in einem fort Gebete gesprochen, die ihm Trost spenden konnten. Als ich merkte, daß der Tod nahe war, richtete ich seinen Oberkörper in die Höhe, indem ich die Hände gegen seinen Rücken stemmte. Als ich so darauf wartete, daß seine Seele sich emporschwingen werde, wurde das Innere der Höhle plötzlich von blendendem Licht erhellt. In seinem Schein sah ich Ngurbu, die Augen offen, das Gesicht verklärt, die Hände heben. ›Endlich!‹ rief er, ›nun geht es ins Nirwana!‹ Darauf sank er zusammen und war tot. Dann wurde es in der Höhle finsterer und kälter denn je zuvor.
Ein rasendes Unwetter brach los. Sturmregen peitschte die Klippen. Ich mußte so tief wie möglich in die Höhle hineinkriechen. Die Wogen donnerten gegen die Felsen am Ufer, die unter ihrer Wucht erzitterten, und flammende Blitze kreuzten sich. Nie hab ich eine solche Nacht erlebt – höchstens noch vor dreißig Jahren, als der alte Eremit Senge hier in der Höhle starb. Ich fühlte mich ganz einsam und verlassen. Ich beneidete Ngurbu, daß er sein saures, schweres Leben auf der Insel abgeschlossen hatte, die so lange sein freiwilliges Gefängnis gewesen war. Daß sein Tod mein eignes Leben um zwei oder drei Monate verlängerte, erfüllte mich durchaus nicht mit einem Gefühl der Dankbarkeit, eher mit Trauer. Noch nie war ich so einsam gewesen. Mit Ngurbu hatte ich über vierzig Jahre zusammengelebt. Immer hatten zwei oder mehrere Eremiten gleichzeitig mit mir hier gehaust. Aber nun war ich mutterseelenallein.
Die Nacht, die ich mit dem toten Ngurbu zubrachte, schien kein Ende nehmen zu wollen. Der Sturm fegte gerade in den Höhleneingang herein, und der Regen strömte. Von Zeit zu Zeit flammte ein Blitz; sein greller Schein, der durch zahllose Tropfen rieselnden Regens hindurchgegangen war, färbte das Innere der Höhle hellblau. In seinem weißen Haar, seinem schmutzigen roten Mantel und seinen nackten Füßen sah der alte Ngurbu wahrhaftig wie ein Heiliger aus. Trotzdem ein feiner Regennebel in die Höhle hereindrang, war er noch kaum erkaltet. Ich glaubte, die Anwesenheit freundlicher, guter Geister zu spüren, die seine Seele zu holen gekommen waren. Denn ich war davon überzeugt, daß ein Mann, der Ngurbus Leben der Entsagung, Geduld und Selbstzucht geführt, seine letzte Wiedergeburt hinter sich hatte und auf Erden nicht länger geplagt und geläutert zu werden brauchte. Er war reif für die lichte, stille Vernichtung in Nirwana. Deshalb gewann die Höhle für mich eine größere Bedeutung als zuvor, und ich hatte das Gefühl, mich an geweihter Stätte zu befinden.
»Endlich kam der Tag! Das Unwetter dauerte mit der gleichen Heftigkeit an. Nur die Wildgänse waren draußen; ich hörte sie schreien, wenn sie am Höhleneingang vorüberflogen. Das matte Tageslicht beleuchtete Ngurbus Gesicht. Es hatte einen Zug des Friedens und der Verklärung, aber er sah aus wie ein Wanderer, der sich unendlich müde zur Ruhe gelegt hatte.
»Wie du weißt, sind die Eremiten davon befreit, nach dem Tode die achtzackige Krone zu tragen, da sie in ihren öden Höhlen, fern von menschlichen Wohnungen, nicht die Ausrüstung anschaffen können, die dazu nötig ist. Aber meine Verehrung für Ngurbu war so groß, daß ich eine Krone auf seinem Scheitel sehen wollte. Das frische Gras war herausgekommen; aus seinen feinen weichen Halmen flocht ich ein achtzackiges Diadem, das ich, gleichfalls mit dünnen Grasflechten, an dem Kopfe des Alten befestigte.
Ihr wißt, daß nach den Klosterregeln die entschlummerten Mönche von hohem Rang drei Tage lang in ihren Wohnungen verbleiben müssen, bis sie dem Feuer oder der Erde übergeben werden, und daß die ganze Zeit, Tag und Nacht, Ordensbrüder bei ihnen die Totengebete verrichten, während vor ihnen Lampen brennen. Wie sollte ich, der Einsame, alle diese Gebräuche beobachten! Doch wollte ich mein Bestes tun, um Ngurbu zu ehren. Unser Fettvorrat mußte bis zum nächsten Winter reichen, aber die Lampe, die damit gespeist wurde, hatte ihren Platz oben im Tempel vor Buddhas Bild, und ich konnte sie dort wegnehmen. Es wäre auch unmöglich gewesen, sie bei Sturm und Regen in der Höhle brennend zu erhalten.
Ich beschloß daher, Ngurbus Leiche in den Tempel hinaufzuschaffen und selber dort bis zum Begräbnistag die Nächte zu verbringen. Schwer war der Alte nicht! Er war vor Alter und Entbehrungen eingetrocknet. Aber für meine schwachen Kräfte war er doch eine gehörige Last. Mit Mühe gelang es mir, ihn auf die rechte Schulter zu heben, und dann tappte ich langsam und vorsichtig den steilen, schlüpfrigen Pfad hinan, der mir jetzt endlos lang vorkam. Der Sturm peitschte mir den Gußregen gegen den Rücken. Von dem herabhängenden Kopf und den Füßen Ngurbus troff das Wasser herab, und ich und der Tote waren patschnaß, als wir oben ankamen. Immer wieder mußte ich stehenbleiben, um Atem zu schöpfen. Mir wurde schwarz vor den Augen, und ich mußte meine ganze Kraft zusammennehmen, um nicht in dem heftigen Sturm zu fallen.
Endlich war ich auf der flachen Anhöhe angelangt und hatte nun einen einigermaßen ebenen Weg bis zur Tür des Heiligtums. Ich öffnete sie und betrat mit meiner Bürde unsere kleine dunkle Tempelhalle, die schon mehr eine Höhle oder ein Loch ist. Dort legte ich den Toten vorsichtig auf den Boden. Ein kleiner Regenwassersee bildete sich vor dem Altar. Diesem schräg gegenüber, neben der Tür, setzte ich Ngurbu an die Wand; der Schein von Buddhas Lampe beleuchtete schwach sein Gesicht. Am Fuß des Altars nahm ich Platz, rückte die Graskrone auf Ngurbus Kopfe zurecht und begann die Totengebete zu verrichten, während das Regenwasser mir von den Kleidern herablief. Den Oberkörper hin und her wiegend, sprach ich sie laut, wiederholte sie immer wieder und bewegte jedesmal eine Kugel meines Rosenkranzes. Die Tür knackte und knarrte, es pfiff durch die Mauerluke, und die alten moderigen Tempelflaggen hinter dem Buddha flatterten im Zugwind. Die Lampen flackerten, aber der Fettdocht brannte weiter.
Gegen Mittag hörte der Regen auf, die Wolken zerstreuten sich, und die Sonne brach durch. Es wurde wieder warm, und ich ging hinaus, um meine Kleider in dem abflauenden Wind zu trocknen. Nachdem ich Regenwasser aus einem Felsspalt getrunken hatte, ging ich in die Höhle und ah Tsamba und Butter. Hier ruhte ich bis zur Dämmerung, um in der Nacht die Leichenwache im Tempel halten zu können. Bei Einbruch der Dunkelheit begab ich mich mit meinen Schaffellen ins Heiligtum, wo ich mir auf dem Boden mein Lager richtete. Dann begann ich wieder zu beten und fuhr damit mit kurzen Unterbrechungen die ganze Nacht fort. Nur kurze Zeit ruhte ich.
Am Morgen hörte ich schwere Flügelschläge über dem Tempel, und als ich bei Sonnenaufgang hinaustrat, sah ich vier Geier auf dem Dache sitzen. Weniger aus Furcht vor mir als durch das Knarren der Tür erschreckt, flogen sie lässig nach einem nahegelegenen Hügel hinüber. Offenbar warteten sie auf Ngurbu.
Drei Tage lang tat ich meine Pflicht, soweit meine Kräfte reichten. Die Nächte wachte und betete ich, am Tage schlief ich und nahm meine Mahlzeit. Das Wetter war warm und schön. Ngurbus Leichnam löste sich immer mehr auf. Sein Kopf fiel vornüber und lag schließlich auf der Brust. Das lange weiße Haar verdeckte das Gesicht. Damit er nicht ganz zusammensinken und auf die Seite fallen sollte, stützte ich ihn mit Steinen.
Am letzten Tag räumte ich das zusammengeregnete Grab auf, das wir seit zwei Monaten bereit hielten. Am nächsten Morgen trug ich ihn bei Sonnenaufgang hinaus und legte ihn ins Grab, das Gesicht nach Südwesten den heiligen Stätten im südlichen Tibet zugekehrt. Die Geier kamen in vermehrter Zahl und umkreisten mit unbewegten Flügeln den Platz. Allmählich wurden sie so kühn, daß ich mit dem Stocke um mich schlagen mußte, während ich das Grab zuschüttete und flache Steine darauflegte. Ich nahm so schwere, als ich nur zu tragen vermochte, damit die Raubvögel nicht an ihn herankommen und seinen Frieden nicht stören konnten.
Einen großen Teil des Sommers verwandte ich darauf, mit einem harten spitzen Stein in die flachen Steinplatten, die ihr schon auf dem Grab gesehen habt, die heiligen sechs Silben einzugraben. Länger als ein halbes Jahr bin ich nun einsam gewesen. Die Zeit wurde mir nicht lang. Ich hatte ja auch den üblichen Tempeldienst zu verrichten und die heiligen Schriften abzuschreiben. Vor einem Monat merkte ich, daß die Tsamba allzu schnell zur Neige ging und daß sie nur noch ein paar Wochen reichen konnte. Die Butter war schon aufgezehrt.
Trotzdem es nach den Vorschriften der Eremiten nicht erlaubt ist, Vogelnester zu plündern, meinte ich doch, keine ernstere Sünde zu begehen, wenn ich mir jeden Tag ein Gänseei nahm und es mit Tsamba zusammenrührte. Jeden Herbst, wenn die Wildgänse nach Süden ziehen, pflegen mehrere hundert unbebrütete Eier liegenzubleiben. Die meisten sind verdorben, aber dies und jenes, das der Sonne weniger ausgesetzt gewesen, ist frisch. Niemals hatte ich die langen Jahre, die ich auf der Insel war, diesen Ausweg einschlagen müssen, um mich am Leben zu erhalten. Jetzt aber zwang mich die Not dazu. Und wenn ihr auch jetzt nicht gekommen wäret – einen Monat früher, als ich Besuch erwartete –, so hätte ich doch nicht zu verhungern brauchen. Ihr könnt euch denken, wie froh ich bin, daß ich kein Ei mehr anzurühren brauche.«
Nachdem Tsembe seine Erzählung beendet hatte, sah Tsangpo Lama eine Weile in Gedanken versunken da. Dann sagte er:
»Wäre ich Eremit und freiwillig dazu verurteilt, mein Leben auf dieser Insel zu verbringen, dann würde ich ganz sicher einen großen Teil meiner Zeit darauf verwenden, den See zu betrachten und sein veränderliches, ewig wechselndes Aussehen zu beobachten.«
»Ja,« antwortete Tsembe, »in den ersten Jahren! Wenn du aber erst zwanzig, dreißig, vierzig Jahre hier gewohnt hättest, würdest du dich nicht mehr soviel darum kümmern. Ich will jedoch gerne zugestehen, daß mein Interesse für den See und seine unberechenbaren Launen zugenommen hat, nachdem Namgjal, Angdu und Ngurbu mich verlassen hatten. Daran war aber weniger der See selber schuld als seine Macht, mich von dem Verkehr mit andern Menschen fernzuhalten. Nachdem Ngurbu gestorben war, habe ich ja ein halbes Jahr keine menschliche Stimme gehört. Deshalb lauschte ich den eintönigen Gesängen des Tso-ngombo aufmerksamer als früher. Solange ich mit den andern Eremiten sprechen konnte, kümmerte ich mich nicht darum, auf das zu hören, was Wellen und Winde zu sagen hatten. Nach Ngurbus Begräbnis aber wurde das anders. Bei heftigem Sturm ging ich gern an den Strand hinunter und betrachtete die Wellen, wenn sie zelthoch gegen die Klippen rollten und zischend und schäumend an ihnen zerschellten. Bei ruhigem Wetter hörte ich gern die Brandung auf den Steinen plätschern und versuchte die Botschaft zu deuten, die sie von den Ufern des Sees herüberbrachten, wo unsere Freunde, die Hirten, wohnen. Täglich begrüßte ich die Wiederkehr der Sonne und nahm von ihr Abschied, wenn sie im Westen in den Wogen versank.
Im Herbst sah ich mit Freuden, daß zeitiger als in andern Jahren die Wildgänse fortzogen und die Feldmäuse ihre Löcher aufsuchten; das verhieß ja, daß der Winter früher kommen und kälter werden würde als gewöhnlich. Ich konnte also frühzeitig Hirtenbesuch erhoffen. Gleichzeitig hatte ich ein Gefühl der Verlassenheit, als ich eines Morgens die Wildgänse aufbrechen sah. Es war eine Unterhaltung für mich gewesen, ihr Geschnatter in der Luft, am Strande und in den Nestern zu hören. Von alters her wußten sie, daß die Eremiten ihnen nichts zuleide tun, und ich konnte mich daher zwischen ihren Nestern bewegen, ohne daß sie aufflogen.
Sie legten ihre Eier und bebrüteten sie. Tag für Tag suchte ich ihr Lager am Strande auf, um zu sehen, wie die kleinen gelben Gänschen heranwuchsen und wie sie von ihren Müttern ans Wasser geführt wurden, um an seichten Stellen zu tauchen und im Schlick zu wühlen. Da die älteren Gänse nicht die geringste Furcht vor uns zeigten, wurden die jungen fast zahm, und ich, der ihnen früher keine Aufmerksamkeit geschenkt hatte, fand nun ein Vergnügen daran, ihre immer länger werdenden Ausflüge zu beobachten.
Der Sommer ging, und dann kam der Tag, an dem die Mütter ihren ausgewachsenen, grau gekleideten Jungen das Fliegen lehrten. Die ältesten flatterten über den Seespiegel hin, daß das Wasser um sie schäumte, und die jüngeren machten es ihnen nach.
Bei der nächsten Übung erhob sich die Mutter etwas über das Wasser; die Jungen versuchten vergebens, ihrem Beispiel zu folgen. Nach einigen Proben vermochten aber die Flügel sie eine Zeitlang zu tragen, und allmählich dehnten sich die Übungen immer weiter aus. Eines Tags im Spätsommer sah ich eine Schar nach der andern unter lebhaftem Geschnatter die ganze Insel umkreisen. Einige Tage später flogen sie über den See, verschwanden in der Ferne und kehrten erst am Abend zurück. Sie waren vermutlich am Festlandufer gewesen, wo sie bessere Weideplätze im Schlick und am Ufersaum in der Nähe der Süßwasserquellen fanden. Schließlich flogen die Jungen ebenso sicher und andauernd wie die Allen und zeigten sich vollkommen mit den Plätzen vertraut, die sie in der pfeilförmigen Flugordnung einzunehmen hatten.
Die Sommerwärme schwand, die Tage wurden kürzer, das Wetter immer unfreundlicher. Oft gab es Sturm und hohen Wellengang. Bei meinen täglichen Ausflügen nach dem Gänsestrand konnte ich in den verschiedenen Gemeinschaften eine gewisse Unruhe bemerken. Sie schnatterten und schnarrten mit abwechselnden Stimmen in verschiedenem Tonfall, als besprächen und erörterten sie die bevorstehende Reise nach dem Süden. Sie unternahmen in beträchtlicher Höhe Erkundungsflüge nach Süden.
Eines Abends war die Geschäftigkeit der Gänse so groß und die Beratung so laut, daß der Aufbruch offenbar unmittelbar bevorstand. Da unternahm ich etwas, was mir in den langen Jahren, die ich auf der Insel zugebracht hatte, noch nie eingefallen war. Nachdem ich mir eine Schale Tsamba und ein Schaffell geholt hatte, blieb ich, hinter einem Steinblock geborgen, die Nacht bei den Gänsen. Nach einiger Zeit stießen die Leitgänse grelle Schreie aus und mahnten zu Sammlung und Aufbruch. Als die Sonne über den Horizont heraufstieg, flogen alle auf. Sie waren noch nicht weit auf den See hinaus. gekommen, als die Flugordnung schon fertig war. In drei regelmäßigen Pfeilspitzen verschwanden sie im Süden wie dünne feine Striche.
Wie öde war der Strand, nachdem sie sich entfernt hatten! Ich wanderte zwischen den leeren Nestern umher, in denen Federn verstreut lagen und hier und da auch ein unbebrütetes Ei zurückgeblieben war. Als ich mich der Südostspitze näherte, hörte ich gelles Gänsegeschrei und fand eine arme Verlassene, die flatternd am Ufer stand und sehnsuchtsvoll den Kameraden nachblickte, die eben am Himmel verschwunden waren. Sie schrie in einem fort und fühlte sich offenbar höchst unglücklich und verlassen. Ich ging langsam zu ihr hin. Sie hatte nicht die geringste Furcht, eher schien es ihr ein Trost zu sein, einen Genossen im Unglück zu haben. Sie blieb ruhig stehen, und schließlich konnte ich ihr mit der Hand den Rücken streicheln. Wir werden uns Gesellschaft leisten, dachte ich, und in den kalten Herbst- und Winternächten soll sie bei mir in der Höhle eine Freistatt haben.
Nachdem sie es satt bekommen hatte, nach den andern zu rufen, die sie so grausam verlassen halten, schien sie sich zu beruhigen und fing an im Schlick zu wühlen. Dann aber kam es ihr wieder in den Sinn, daß sie einsam war, und sie begann von neuem, nach den fliegenden Pilgern zu schreien. Nach einer Weile erscholl aus der Luft eine Antwort. Aber sie kam nicht von ihren Verwandten, sondern von andern Genossenschaften, die, aus nördlicheren Gegenden kommend, den See nur überflogen. Im beweglichsten Tonfall bat sie diese, sie zu sich hinauf und mit nach Süden zu nehmen. Sie hätten keine Zeit, antworteten sie, und könnten ihr nicht helfen; sie müsse für sich selber sorgen. Vergebens flatterte sie mit den Flügeln, die sie nicht tragen konnten, denn der eine war in ihrer frühesten Jugend bei irgendeinem Unglücksfalle gebrochen.
Schließlich nahm ich sie behutsam unter den Arm und kehrte in die Höhle zurück. Ich trug sie dorthin, um ihr ihre neue Freistatt zu zeigen. Aber sie kehrte schleunigst an den Strand zurück. Unterdessen rupfte ich einen Armvoll Gras, um der Wildgans in der Höhle ein weiches Lager zu bereiten. Als ich zurückkam, war sie fort. Da ging ich den Strand entlang und fand sie an der Südostspitze, wo sie ihr Heim gehabt hatte. Es war leicht zu verstehen, daß sie der schwerste Kummer getroffen hatte, der einer Wildgans widerfahren konnte. Am Abend aber forderte die Natur ihr Recht. Sie zog den Hals ein und verfiel in Schlaf. Da trug ich sie wieder in die Höhle und legte sie auf das weiche Gras.
In der Morgendämmerung begab sie sich an den Strand und schwamm nach der Südostspitze. Nach dem Tempeldienst suchte ich sie dort auf. Wie ich war sie für immer an die Insel gefesselt. Aber sie konnte sich nur an dem Teil des Strandes wohlfühlen, wo sie mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern gewohnt hatte und wohin, wie ihr ihr Instinkt sagte, ihre Verwandten im Frühjahr zurückkehren mürben. Sie tat mir leid. Nachdem die andern weggeflogen waren, war ihr ganzes Leben ein einziger großer Kummer.
Als ich an den Platz hinunterkam, mit dem ihre Erinnerung und ihr Kummer verknüpft waren, war sie nicht mehr da. Ich suchte sie überall. Wohin hatte sie sich begeben? Die Wellen, die am Strande rollten, sprachen davon, aber ich konnte ihre Sprache nicht verstehen. Schließlich sah ich sie weit draußen auf dem See geradewegs nach Süden schwimmen, vielleicht in dem Glauben, der Tso-ngombo erstrecke sich bis zu den neuen Wohnplätzen ihrer Verwandten. Sie hatte ja bisher immer nur von der Insel aus Umschau gehalten und wußte nichts von der unermeßlichen Welt, die sich ringsum ausbreitete. Wiederum hatte ich einen Kameraden verloren, und die Herbsttage und -nächte wurden mir länger und schwerer als bisher.
Der erste Schneesturm kam in diesem Jahre frühzeitig, und seitdem hielten sich die Feldmäuse meistens unter der Erde auf. Ein Gedanke quälte mich sehr: Wenn ich vor dem Winter stürbe, würde ich niemand bei mir haben, der mir helfen könnte, im Sitzen zu sterben. Daher freute ich mich über den zunehmenden Frost, der das Zufrieren des Sees beschleunigen mußte. Deshalb versöhnte ich mich auch mit der schneidenden Kälte, die in die Höhle drang und meinen Schlaf störte. Einige Male zündete ich auch am Eingang der Höhle kleine Heuhaufen an und freute mich des Feuerscheins und der Wärme. Aber die Freude dauerte nur einige Minuten; dann kehrte die Kälte zurück.
Eines Nachts überzog sich der ganze See mit dünnem Eis, das ein paar Tage liegenblieb. Ich untersuchte es und stellte fest, daß es dicker wurde. Da erwachten wieder Hoffnung und Lebenslust. Wenn das ruhige Wetter anhielt, konnte die Insel mit dem Festland in Verbindung kommen. Aber der Sturm brach das Eis wieder auf.
»Entmutigt trat ich heute meinen gewohnten Gang nach dem Tempel an. Da hörte ich bei den Gräbern menschliche Stimmen. Ich ging hinaus und sah euch bei Ngurbus letzter Ruhestätte stehen.«
»Heute nacht sollst du nicht mehr frieren«, sagte Tsangpo Lama, brach einen Tamariskenast entzwei und warf ihn ins Feuer. »Aber nun müssen wir schlafen. Wenn sich der Morgenwind erhebt, gleichgültig aus welcher Richtung er kommt, schaukle ich auf den See hinaus und überlasse euch für immer eurer Einsamkeit.«