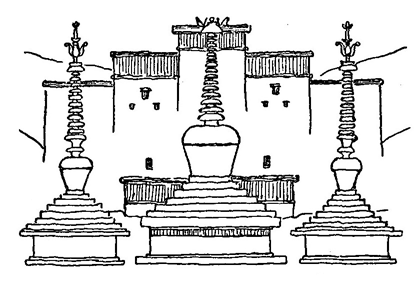|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
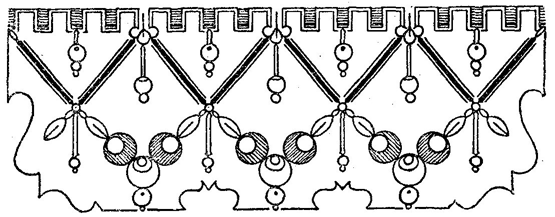
 In der Nacht wurde Tsangpo Lama durch die Kälte geweckt. Er wußte nicht, wie lange er geschlafen hatte und wieviel noch von dieser ewig dauernden Nacht übrig war. Myriaden Sandkörner trommelten auf die Rückseite seines Pelzes und verursachten ein Geräusch, wie wenn Wasser in einem Topfe zu kochen anfängt, nur viel lauter. Er erhob sich, schlang den Gürtel um den Leib, nahm den nunmehr bedenklich erleichterten Wasserschlauch auf den Rücken und brach auf.
In der Nacht wurde Tsangpo Lama durch die Kälte geweckt. Er wußte nicht, wie lange er geschlafen hatte und wieviel noch von dieser ewig dauernden Nacht übrig war. Myriaden Sandkörner trommelten auf die Rückseite seines Pelzes und verursachten ein Geräusch, wie wenn Wasser in einem Topfe zu kochen anfängt, nur viel lauter. Er erhob sich, schlang den Gürtel um den Leib, nahm den nunmehr bedenklich erleichterten Wasserschlauch auf den Rücken und brach auf.
»Die Solonen sind am nächsten«, meinte er. »Wenn ich jetzt in leidlicher Entfernung an ihnen vorüberkomme und der Wind von ihnen zu mir herüberweht, wittert Tsagan die Kamele, und ich brauche dann nur geradewegs gegen den Wind einzubiegen, um ihre Karawane zu finden. Sie können nicht weit weg sein. Weht aber der Wind von mir zu ihnen hinüber, so merkt Tsagan nichts, und wir verlieren sicherlich die Witterung des ganzen Pilgerzugs.«
»Tsagan!« rief er. »Wo sind die Kamele, die Kamele? Such die Kamele!«
Der Hund spitzte die Ohren und starrte schnuppernd ins Dunkel hinein.
»Wo ist mein Pferd, Tsagan? Fass' das Pferd!«
Da begann der Hund zornig zu bellen und lief knurrend einige Sprünge gegen den Wind. Er kam aber sofort zurück und setzte sich winselnd betrübten Angesichts neben seinen Herrn.
»Wir wollen das Pferd und die Kamele suchen, Tsagan«, schlug Tsangpo vor. »Merkst du nicht, daß es sich jetzt leichter geht als gestern abend? Der Wind hat nachgelassen. Aber wir müssen aushalten.«
Der Wind ging noch stark, hatte aber an Heftigkeit verloren. Kein Stern war zu sehen. Rasch schritt Tsangpo vorwärts; der Wind kam von rechts. Er sah nicht die Hand vor den Augen und stolperte oft über harte Lehmkanten; vor Zeiten hatten sie einmal Wasserläufe eingefaßt, jetzt waren sie windzerfressen und spröde. Hier und da trat er auf einen verdorrten Grasbüschel, der wie Glas zersprang.
Er ging stundenlang. Zuweilen blieb er stehen und horchte. Er meinte Stimmen von Menschen zu hören, die heftig und schnell sprachen, und ihm war, als hörte er seinen Namen nennen. Aber es war nur der Wind, der sein Spiel mit ihm trieb. Er eilte weiter. Dann blieb er wieder stehen. Ganz deutlich drangen die Töne von Schneckenhörnern und Posaunen an sein Ohr! Er lauschte mit angehaltenem Atem und klopfendem Herzen. Aber Tsagan merkte nichts. Wieder war es der Wind, der Tsangpo täuschte, und er konnte, ohne sich stören zu lassen, in der undurchdringlichen, andauernden Dunkelheit weitergehen.
»Ich hätte nicht so lange schlafen sollen«, dachte Tsangpo. »Hier geh ich in einem fort, und doch nimmt die Nacht kein Ende. So weit, wie ich jetzt gewandert bin, sind die Solonen nicht gekommen. Ich bin an ihnen vorübergegangen. Und der Wind weht zu ihnen hinüber. Sonst würde Tsagan sie gewittert haben. Die Kamele! Tsagan, wo sind die Kamele?«
»Verschwunden«, antwortete das mißmutige Bellen des Hundes.
»Warte nur! Bald ist die Nacht vorüber, und es wird Tag! Komm, Tsagan! Wir rasten eine Weile und lassen es unterdessen hell werden.«
Er war warm geworden vom Gehen, nahm wieder einen Schluck aus dem Wasserschlauch und gab auch dem Hund sein Teil. Nun war nicht mehr viel übrig. Doch was machte das! Der Tag kam, und man konnte zwanzig Schritt weit sehen. Als er weiterging, war es ganz hell, wenn auch die Luft noch mit Staub erfüllt war. Es wehte immer noch ein kalter Wind. Tsangpo ging und ging, und die Stunden verrannen.
Um die Mittagszeit ließ ein Schimmer im Nebel den Stand der Sonne feststellen. In einiger Entfernung erblickte er ein Dickicht von verdorrten Tamarisken. Dorthin ging er, um sich eine ausgiebige Mittagsrast zu gönnen.
Die spröden Äste zerbrachen, wenn er sie nur anfaßte; er schichtete sie zu einem Haufen. Im Schutze seines geöffneten Pelzes rieb er ein paar Holzstücke zu Pulver und brachte nach einiger Anstrengung den Schwamm des Feuerstahls zum Zünden. Es dauerte nicht lange, und das Feuer prasselte und fauchte im Winde, der die Flammen am Boden hintrieb. Tsangpo machte sich daran, das ganze trockene Dickicht anzuzünden.
»Wenn die endlos lange Karawane nicht zu weit weg ist und der Wind ihr den Rauch zuträgt, dann müssen ihn ihre Hunde wittern«, überlegte er.
Er zog den Pelz aus und warf ihn nach der Windseite lose über seine Schultern. Tsagan setzte sich und sah seinen Herrn fragend an. Der Hund war daran gewöhnt, daß man aß, wenn ein Lagerfeuer angemacht wurde. Als er aber nichts Eßbares witterte, rollte er sich beim Feuer zusammen und schlief ein. Tsangpo folgte seinem Beispiel.
Plötzlich erwachte er davon, daß irgendeine Veränderung eingetreten war. Er stand hastig auf. Ringsum war es still. Das eintönige Heulen des Windes hatte aufgehört. Tsagan lag noch da und war zu faul, auch nur die Augen zu öffnen. Das Feuer war fast niedergebrannt, der letzte Rauch stieg kerzengerade in die Höhe. Der Sturm hatte schneller aufgehört, als er gekommen war. Die Sonne hatte nicht mehr weit bis zum Horizont, war aber nicht zu sehen. Der Himmel hatte sich bedeutend aufgehellt, blieb aber immer noch trüb. Ein paar hundert Schritt weit konnte man sehen.
»Wie es scheint, gibt es abermals eine Nacht ohne Abendessen«, dachte Tsangpo und trank die Hälfte des übriggebliebenen Wassers. Die andere Hälfte erhielt Tsagan, der den Schlauch bis auf den letzten Tropfen ableckte und dann noch daran kaute und hineinbiß.
»Nun gehen wir weiter, Tsagan, solange es noch hell ist. Dann machen wir wieder ein Feuer und schlafen die ganze Nacht. Morgen ist die Luft ganz klar, und wir können die andern sehen.«
Als er in einiger Entfernung eine flache Bodenerhebung bemerkte, von der aus man nach allen Seiten mußte schauen können, soweit es der langsam verziehende Nebel zuließ, beschloß er, dort oben die Nacht zuzubringen.
Bald stand er oben und hielt vom Gipfel des kleinen Hügels Ausschau. Ringsum breitete sich grau in grau das Wüstenmeer, still wie ein Grab, öde wie ein Totenreich.
Kein Laut störte diese Stille, die nach dem Getöse des Sturmes beklemmend wirkte. Keine Antilope war zu sehen, nicht einmal ein Vogel verirrte sich hierher auf seiner Reise über die Erde. Nach Süden zu fiel das Gelände ganz langsam ab. Gegen Abend wurde es immer kälter, und in der abgekühlten Luft sanken die feinen schwebenden Staubteilchen jetzt schneller nieder. Die Aussicht erweiterte sich daher allmählich. Wäre nicht die Dämmerung im Anzug gewesen, hätte Tsangpo vielleicht bald erkannt, daß weit weg im Süden das Gelände nach dem Nan-schan-Gebirge zu wieder anzusteigen begann. Bei Tagesanbruch wollte er nach Südwesten wandern, dort konnte es nicht mehr weit sein bis zum Rande der Wüste. Dann ging es auf Leben und Tod, wenn er nicht Wasser fand.
»Es ist keine Zeit zu verlieren. Diese stille Nacht wird kalt. Ich muß Feuerung zusammentragen, ehe die Nacht hereinbricht.«
Nicht weit vom Hügel gab es reichlich dürre Tamarisken. Er schaffte von den nächsten, soviel er tragen konnte, hinauf. Tsagan begleitete ihn. Als Tsangpo aber wieder einen Armvoll holen ging, blieb der Hund beim ersten Stoß liegen, als wollte er ihn gegen Teufel und böse Geister beschützen. Tsangpo setzte seine Arbeit in der Dämmerung fort, bis es das Dunkel schwer machte, das graue Dickicht von dem ebenso grauen Boden zu unterscheiden. Dann hatte er aber auch einen Vorrat an trockenem Holz aufgestapelt, der für die ganze Nacht reichte.
Je später und je kälter es wurde, um so mehr Sterne traten hervor. Tsangpo hatte sein Feuer angezündet und bereitete sich eine bequeme Lagerstatt; Tsagan hatte die seine bereits fertig.
Der Abend wurde lang. Die gewaltige Karawane, die sich an den verflossenen Marschtagen durch die halbe Wüste zu erstrecken schien, war nun spurlos verschwunden. Zog sie südwestwärts in so großer Entfernung weiter, daß sie weder zu sehen noch zu hören war, so mußte sie wenigstens bei der jetzt herrschenden Stille eine ganze Landstraße von Spuren im Sand zurücklassen. Tsangpo fühlte sich daher sicher und beschloß zu schlafen, um am Morgen des nächsten Tages mit frischen Kräften aus Erkundung auszuziehen.
Er löste seinen Leibgürtel und zog den Pelz aus, in den er sich des Nachts hüllen wollte. Die Mütze zog er so tief als möglich ins Gesicht. Nachdem er noch einen Armvoll Holz ins Feuer geworfen, kauerte er sich unter dem Pelz zusammen und schlief ein.
Langsam schritt die Nacht vor, das Dunkel nahm zu. Immer heller glänzten die Sterne. Das Tamariskenholz brannte allmählich nieder, und schließlich tanzten über der Glut nur noch neckische blaue Flammen. Zuweilen gab es einen Knall, und Funken stiegen in die Höhe, um im Augenblick zu erlöschen. Sonst herrschte tiefste Stille. Ein Horcher hätte keinen andern Laut vernommen als die regelmäßigen Atemzüge Tsangpos und seines Hundes. Das Schweigen der Wüste ist unheimlich, aber auch erhebend wie in einem Tempel. Der Mensch hat ein Gefühl, als betrete er ein Heiligtum. Wer mitten in der Nacht aus seinem Schlaf erwacht, atmet leise und mit offenem Munde, um die Stille nicht zu stören.
Die Mitternachtsstunde nahte heran, die Zeit des tiefsten Schweigens.
Tsagan zuckte zusammen, hob den Kopf, spitzte die Ohren und witterte. Unruhig starrte er nordwärts ins Dunkel hinein, drehte den Kopf seitwärts und zog die Luft durch die Nasenlöcher, die sich schnell erweiterten und wieder schlossen. Als er nichts Verdächtiges witterte, steckte er die Nase wieder unter den Schwanz und schlummerte.
Bald darauf hob er wieder den Kopf, schneller und höher als vorhin, und knurrte dumpf. Jetzt hatte er sich nicht geirrt! Wie eine Stahlfeder sprang er auf und stürzte mit wütendem Gebell den Hügel hinab. Tsangpo erwachte, suchte seine Gedanken zusammen und horchte.
»Die Karawane!« dachte er. »Wir befinden uns also südlich von ihrem Kurs. Oder vielleicht sind es nur einige reitende Ölöten, die unser Häuptling oder der Prior ausgeschickt hat, um nach mir zu forschen. Sie sind natürlich unruhig geworden und haben, nachdem der Sturm aufgehört hat, angefangen, die Wüste nach allen Richtungen zu durchsuchen. Nun sind sie mir auf der Spur; vermutlich haben sie Hunde mit. Herrlich wird es sein, sich wieder satt zu essen und eine Teekanne bis auf den Boden zu leeren.«
Er lachte und wollte gerade wieder einen Armvoll Tamariskenstämme und -zweige in die Glut werfen. Es galt, die Nachtkälte zu vertreiben, die, während er schlief, in seinen Pelz gekrochen war. Da ließ ein Geheul das Blut in seinen Adern erstarren; wie eine trotzige, dringende Drohung durchschnitt es die nächtliche Stille.
»Wölfe!« rief er. »Das Messer habe ich, das ist aber alles!« Er pfiff Tsagan heran, dessen Bellen sich entfernt hatte. Als aber die Wölfe zum zweitenmal ihr hungerheiseres Raubsignal ertönen ließen, waren sie dem Hügel schon nähergekommen.
»Das Feuer! Da habe ich ja eine sichere Waffe«, dachte Tsangpo, schürte eilig die Glut und warf ein Reisigbündel hinein, das er in aller Eile in Brand setzte. Während er immer größere Äste und Zweige zulegte, rief er in bestimmtem Ton dem Hunde.
Sein wütendes, rasendes Bellen kam immer näher. Es klang so abgerissen, heiser und kurz, als hätte sich Tsagan schon mit den Wölfen herumgebissen. Schließlich war der Hund gezwungen gewesen, der Übermacht zu weichen, und kam pfeilgeschwind ans Feuer gestürzt, wo er wutschäumend, an allen Gliedern zitternd, haltmachte und Stellung nahm.
Die Wölfe waren unten am Hügel stehengeblieben. Sie scheuten vor dem Feuer. Es waren ihrer acht. Ihre Augen funkelten in der Dunkelheit. Wütend darüber, daß der Hund, der schon beinahe ihre Beute gewesen, in den Schutz des Feuers entkommen war, wurden sie immer kecker.
Ungeduldig und blutdürstig lief einer nach dem andern vor und wieder zurück. Das Feuer war noch nicht ganz in Schuß gekommen. Es prasselte und qualmte, und der Rauch verhüllte die Flammen, die sich zwischen dem Holz einen freien Ausweg zu schaffen suchten. Deshalb hoben sich die Wölfe von dem grauen Boden nur wie unruhige Schatten ab.
Jetzt schlugen die Flammen empor, und rings um den Hügel wurde es hell. Geblendet und erschreckt zogen sich die Wölfe zornig kläffend zurück. Aber rasch hatten sie sich an den Feuerschein gewöhnt, und der Mut kehrte wieder. Sie hetzten sich gegenseitig. Bald hatten sie ihren alten Platz unten am Hügel wieder eingenommen. Dort oben gab es frisches Fleisch, soviel als sie brauchten. Und klug wie sie waren, hatten sie bereits gemerkt, daß es sich bloß um einen Mann mit seinem Hunde handelte. Mit einem solchen Gegner wurde man leicht fertig. Wenn nur das elende Feuer nicht gewesen wäre. Aber der Brennstoff mußte ja einmal zu Ende gehen, und dann kamen die Wölfe an die Reihe.
Die mutigsten hatten bereits angefangen, den Hügel in Zickzacklinien zu stürmen, als besetzten sie ein System von Laufgräben. Tsangpo ließ die Blicke zu den Sternen schweifen, um abzuschätzen, wie lange es noch bis Sonnenaufgang war. Dann warf er einen Blick auf den Holzhaufen, ob der ebensolange reichen würde wie die Nacht. Er ergriff ein paar armdicke Tamariskenstämme von Manneslänge und steckte ihre Enden ins Feuer. Schließlich rollte er seinen Schafpelz zu einem Bündel zusammen und setzte sich darauf, das Gesicht den Raubtieren zugewandt. Dann zog er sein Messer aus der Scheide und begann, mit nachdrücklichen, langsamen Zügen es am Leder seines linken Stiefelschafts zu schärfen.
Seine Ruhe reizte die Tiere. In geschlossenem Trupp stürmten sie den Hügel hinan. Er fuhr auf. Die erhobene Messerklinge blinkte im Feuerschein. Die Wölfe waren nur einige Schritte entfernt. Ihre Augen leuchteten rot vor Blutdurst. Tsangpo stieß einen gellen Schrei aus und lief ihnen einen Schritt entgegen. Sie zogen sich einen Schritt zurück, rückten aber sofort wieder zwei Schritt vor.
Im nächsten Augenblick konnte er die Wölfe auf dem Halse haben. Als er sah, daß sie sich zum entscheidenden Angriff fertig machten, ergriff er seinen zusammengewickelten Pelz und schleuderte ihn in den Haufen hinein. In wahnsinniger Wut stürzten sich die Tiere auf ihn und hatten ihn binnen einer Minute in Fetzen zerrissen. Währenddem nahm Tsangpo hinter dem Feuer Stellung und warf in aller Eile einen Armvoll Holz darauf.
Der Pelz reizte den Appetit der Wölfe. Sobald sie damit fertig waren, führten sie eine Umgehung aus und kehrten von der Südseite her zurück. Von den hungrigsten waren einige nur ein paar Sprünge entfernt und schienen entschlossen, den Sprung zu wagen. Das Messer anzuwenden, war noch zu früh. Tsangpo riß einen Tamariskenstamm aus dem Feuer, der wie eine Fackel brannte und leuchtete. Er war es von wilden Reiterspielen her gewohnt, zu zielen und zu treffen, und warf die brennende Fackel dem nächsten Wolf mit aller Kraft in den Rachen. Das Tier wurde wild und biß, wie um sich zu verteidigen, in den glühenden Stamm, der zwischen seinen Zähnen prasselte und zischte. Heulend vor Zorn und Schmerz sprang der Wolf hoch in die Luft und verschwand hinter den andern.
Den nächsten Angreifer erwartete wieder eine Holzfackel, die ihn oberhalb der Nase traf und auf der Erde liegenblieb. Das Rudel nahm eine neue Frontveränderung vor. Tsangpo warf noch ein paar faustdicke Tamariskenstämme ins Feuer.
Dann rückten sie von der andern Seite vor. Der Schaum troff von ihren Reißzähnen. Zuweilen schlugen sie die Kiefer aufeinander, daß es krachte. Ihre Augen funkelten vor Bosheit und Mordlust. Tsangpo nahm in die Linke einen Tamariskenstamm von Manneslänge, in die Rechte ein kürzeres Stück Holz, die beide an dem vorderen Ende brannten und knisterten. Als der Anführer des Rudels, ein großer, starker, schwarzgrauer Wolf, auf zwei Schritt Entfernung heranrückte, stürmte Tsangpo auf ihn ein, den brennenden Stamm wie eine Turnierlanze gesenkt, und als die andern, um dem Führer zu helfen, zum Angriff übergingen, sauste der Feuerbrand in den Haufen hinein und trieb ihn auseinander.
Tsangpo gewann etwas Zeit. Er sah an den Sternen, daß es noch lange bis Tagesanbruch war. Der Holzhaufen aber, das sah er auch, konnte bei solchem Verbrauch nicht die ganze Nacht reichen. Er fragte sich, ob er wohl selber zuerst in Stücke gerissen werden würde oder der Hund. Dieser bellte und bellte, aber ohne in seiner Heiserkeit einen einzigen lauten Ton hervorzubringen.
Keuchend und kläffend ruhten die Wölfe eine Zeitlang aus. Sie hielten Kriegsrat. Der Führer hatte einen neuen Plan entworfen. Er stürzte auf den Holzstapel hinauf und richtete bald das offene rote Maul, aus dem der Geifer troff, gegen Tsangpo, bald biß und riß er voller Wut an den Holzstücken, daß Splitter und Späne flogen.
Gleichzeitig gingen die andern in zwei Gruppen zum Angriff über, je eine auf der einen und der andern Seite des Haufens. Da sprang Tsangpo über das Feuer, um es zwischen sich und die Wölfe zu bringen. Im Nu waren sie auf der andern Seite und wurden von neuen Feuerbränden empfangen. Schäumend vor Wut, wiederholten sie das Manöver. Tsangpo fand gerade noch Zeit, neues Holz in das Feuer zu werfen.
Als der Führer des Rudels, vor Blutdurst zitternd, auf dem Holzhaufen stand, bereit, sich auf seine Beute zu stürzen, und die andern darauf warteten, ihm zu Hilfe zu kommen, ergriff Tsangpo den längsten Stamm, stürzte sich mit der Geschmeidigkeit eines Panthers blitzschnell gegen den Holzhaufen und stieß mit Aufgebot seiner ganzen Muskelkraft den brennenden Knüttel dem Anführer des Rudels in den Hals.
Das Tier taumelte, dem Ersticken nahe, den Haufen hinunter. Die andern, die nicht begriffen, was vor sich ging, und das Kommando des Führers vermißten, zogen sich zurück.
Wieder konnte Tsangpo eine Zeitlang Atem schöpfen. Er war schwarz von Ruß und Rauch. Seine Hände bluteten von Wunden, die Zweige und Splitter gerissen hatten. Er zog die Mütze tief herunter; sie konnte vielleicht seinen Kopf vor den Zähnen der Raubtiere schützen. Alles drehte sich um ihn herum, und er schloß die Augen. Vom Holzstapel her erklang ein Heulen der Klage und des Schmerzes und halberstickte Hustenanfälle – der Leitwolf erholte sich und sammelte seine und der Seinen Kräfte für die Stunde der Rache. Und wenn ihm auch der ganze Pelz bis zur Schwarte verbrennen sollte, er wollte Tsangpos Kehle zwischen seinen Zähnen knirschen hören und fühlen, wie sein warmes Blut den brennenden Schmerz unter den Brandblasen auf der Zunge linderte.
Plötzlich riß Tsangpo wieder die Augen auf; ihm war, als wäre es so merkwürdig hell geworden. Halbwirr im Kopf, fragte er sich zuerst, ob vielleicht die Sonne schiene und die Wölfe sich zurückgezogen hätten. Aber zu seinem Entsetzen erkannte er, daß der Holzstapel in Flammen stand. Beim Angriff auf den Leitwolf waren Funken und Glut zwischen die trockenen Zweige gefallen und hatten gezündet. Deshalb war der verbrannte und betäubte Wolf aufgesprungen und davongeschlichen. Und deshalb ging das Rudel nicht mehr zum Angriff über; es fühlte sich besiegt und wartete.
Pfeilschnell eilte Tsangpo zu dem Stapel und riß so viele Äste heraus, als er fassen konnte. Aber das Feuer hatte, während er betäubt dasaß, einen Vorsprung gewonnen; er konnte nur wenige Äste retten. Da sah Tsangpo ein, daß er in der Hand des Todes war und daß seine Seele bald auf die Wanderschaft gehen werde! Es war ihm ein Trost, daß er sich selbst geopfert hatte, um einigen Karawanenabteilungen zu helfen, und er suchte in seiner Erinnerung noch einige andere gute Taten zu entdecken, die ihm zum Vorteil angerechnet werden konnten, wenn seine irrende Seele das nächstemal ihren Wohnsitz in einem vergänglichen Körper aufschlug. Aber er fühlte sich vor den Göttern unzulänglich und glaubte, es werde ihm in der nächsten Daseinsform höchstens so ergehen wie in der, der nun ein Rudel hungriger Wölfe ein Ende bereiten sollte.
Nachdem er gerettet, was zu retten war, versuchte er sich zu beherrschen und ruhig dem Tode ins Auge zu sehen. Es blieb ihm keine andere Wahl. Der Holzstoß brannte wie ein Feuerzeichen über dem Wüstenmeer; ringsum war das öde Land prächtig erhellt. Etwa zwanzig Schritt entfernt standen die Wölfe mit hängenden Zungen und Schwänzen, heimtückisch beobachtend, was auf dem Hügel vor sich ging. Tsagan versuchte nicht mehr zu bellen. Mit gespitzten Ohren stand er einige Schritte vom Feuer entfernt und starrte auf das Rudel. Er gähnte und atmete hastig und schnell.
Vom Holzstapel stieg eine dichte Rauchsäule empor, beleuchtet von zahllosen kleinen Funken, die sich in spielerischem Tanz gegen die Vernichtung wehrten. Von Zeit zu Zeit hörte man ein Rascheln, wenn die Feuerbrände aufgezehrt waren und der Haufen zusammensank. Seine Leuchtkraft ließ nach und ging ins Rötliche über. Der Kreis, den der Feuerschein erhellte, schrumpfte zusammen, und Schritt für Schritt kamen die Wölfe näher. Tsangpo ging um den Holzstoß mit einer Tamariskenstange herum und schichtete die Feuerbrände zu einem dichten Haufen, der lange glühen mußte. Schließlich, dachte er sich, will ich mit meinen bloßen Händen den Wölfen glühende Kohle in den Rachen werfen.
Nur ein paar Schritte war es von dem einen Feuer zum andern. Dorthin setzte er sich; wieder zog er das Messer aus der Scheide und begann es zu wetzen. Es war eine häßliche tatarische Klinge, die er einmal auf einer Reise nach Kobdo von einem Kaufmann aus Andischan erstanden hatte. An einem Tamariskenstamm erprobte er ihre Schärfe. Sie schnitt ihn wie Papier. Aber Tsangpo fuhr trotzdem fort, das Messer zu schleifen, bis der Stiefelschaft glänzte. Die Klinge war zweischneidig und hatte tiefe runde Rinnen, in denen das Blut ablaufen konnte, wenn sie im Kampf in ein lebendes Wesen gestoßen worden war.
Der große Holzstoß hatte sich in einen Gluthaufen verwandelt, und mit dem Holz, das er hatte retten können, unterhielt Tsangpo noch das ursprüngliche Feuer. Aber das Holz ging zur Neige, und die letzten blauen Flammen erloschen. Rings um ihn her breitete sich nächtliches Dunkel. Die Sterne schimmerten hell, nachdem die Kälte die letzten fliegenden Staubteilchen zum Sinken gezwungen hatte. Die Luft war rein. Tsangpo warf noch einen Blick zu den Sternen hinauf und sah, daß noch eine halbe Stunde bis Tagesanbruch vergehen konnte.
Jetzt kamen die Wölfe in geschlossenem Rudel zurück, und nun hatte der Pilger seinen letzten Kampf auszufechten!
Sie stürmten heran. Tsangpo richtete es so ein, daß der große Gluthaufen zwischen ihnen und ihm lag. Als sie von der Seite heranschlichen, wich er ihnen aus und ließ einen Regen glühender Kohle auf das Rudel herniedergehen, das erschreckt auseinanderlief. Dasselbe Manöver wiederholte sich ein paarmal, da die Angreifer immer wieder zurückkamen. Nachdem die Reste des ersten Feuers verbraucht und die herumliegenden Kohlen schwarz und kalt geworden waren, fühlten sich die Wölfe ihrer Beute sicher. Keuchend vor Blutdurst, die Reißzähne im Schein der Sterne glänzend, warf sich der Leitwolf von vorn auf Tsangpo; aber ehe er zubeißen konnte, hatte er das Messer im Herzen. Mit einem rasselnden Laut warf er den Kopf zurück und sank nach einigen Todeszuckungen zu Boden.
Ohne sein Schicksal zu beachten, setzten die andern ihre Angriffe fort. Sie hatten Blut gerochen. Ein großer hellgrauer Wolf biß Tsangpo in den linken Unterarm, um ihn über den Haufen zu werfen. Aber der Biß erschlaffte und glitt ab, da das Tier die Klinge bis zum Schaft in den Rücken bekam. Während Tsagan tapfer im Zweikampf kämpfte, hatte Tsangpo die übrigen fünf gegen sich. Ihre Wut nahm zu. Sie griffen von allen Seiten an. Er drehte sich im Kreise und verteidigte sich mit blitzschnellen Bewegungen. Seine Klinge flog von dem einen zum andern. Ein Wolf biß ihn hinten in den Nacken, ließ aber los, als er den kalten Stahl zwischen seinen Rippen fühlte. Die Verwundeten schäumten vor Wut, und der Geifer hing wie Seifenschaum an ihren Lefzen.
Immer häufiger fühlte Tsangpo ihren heißen Atem über seinem Gesicht. Sie keuchten, und in der kalten Morgenluft stiegen weiße Wolken aus ihren Rachen auf. Sie kläfften, husteten, heulten vor Blutdurst. Bald hier, bald da trafen scharfe Zähne in Tsangpos Muskeln. Er hatte ja nicht mehr den Pelz zum Schutz.
Lange konnte der ungleiche Kampf nicht dauern. Tsangpo führte das Messer mit immer langsameren Bewegungen und stieß mehr aufs Geratewohl zu. Er war ermattet, sein Arm erlahmt. Es wurde ihm schwarz vor den Augen. Der Griff um das Messer war nicht mehr fest. Sein Bewußtsein verschleierte sich, und er stürzte rücklings zu Boden. Mit einem heiseren Siegesgeschrei stürzten sich die Wölfe über ihn.
In demselben Augenblick stieg der Rand der Sonne wie ein blitzender Rubin über den Horizont. Noch ehe die Wölfe dazugekommen waren, die Kehle und den Brustkorb des Gefangenen zu zerfleischen und ihr blutiges Mahl zu beginnen, hielten sie wie auf Kommando inne und sahen erschreckt nach der Sonne. Von dem leuchtenden Osthimmel hoben sich zwei Reiter ab, die mit wildem Geschrei eiligst den Hügel hinansprengten. Ganz von ihrem Blutdurst besessen, hatte das Rudel die Gefahr nicht eher bemerkt.
Die Wölfe zogen sich langsam zurück, haßerfüllte Blicke auf die Angreifer werfend. Die Pferde scheuten vor den Raubtieren. Die Reiter sprangen aus den Sätteln und gingen mit eingelegten Lanzen vor. Es waren jetzt nur noch vier Wölfe. Ein fünfter hinkte langsam hinterdrein. Die Männer sahen bald, daß sie nichts zu fürchten hatten. Sie machten die Pferde fest, indem sie Stricke um die Vorderbeine schlangen, und gingen zu dem Gefallenen hin.
Wie es auf Wüstenreisen üblich ist, hatte jeder seine Wasserflasche im Sattel. Sie erkannten Tsangpo sofort, öffneten seine Kappe, rissen von ihren Sätteln Deckenstreifen los und verbanden damit die blutenden Wunden. Der eine hob seinen Kopf und führte ihm die Flasche an die Lippen. Tsangpo öffnete die Augen und begann zu trinken. Die Wunden waren nicht tief. Aber in einer Sekunde hätte er wohl den tödlichen Biß erhalten. Das Bewußtsein kehrte ihm allmählich zurück. Als er das Blut an seinen Händen und Kleidern und die drei toten Wölfe erblickte, erinnerte er sich des Kampfes auf Leben und Tod, der vor einigen Minuten geendet hatte.
»Wo ist Tsagan?« fragte er eifrig.
»Ach, mit dem armen Kerl ist nicht mehr viel Staat zu machen. Er blutet aus mehreren Wunden. Er liegt hier und leckt sie.«
»Gebt ihm die zweite Wasserflasche!« antwortete Tsangpo. »Er hat sich tapfer verteidigt.«
Jetzt erkannte Tsangpo die beiden Ölöten wieder, die immer neben Terge Ritschen an der Spitze des Zuges zu reiten pflegten, wenn der Lotse des Weges nicht sicher war.
Während der eine für den Hund sorgte, beantwortete der andere Tsangpos Frage, wie sie ihn in dieser gräßlichen Wüste hatten finden können.
»Still, hörst du nicht den Klang?«
Tsangpo horchte und hörte das singende Glockenspiel, das von Minute zu Minute deutlicher wurde. Er wandte den Blick nach Osten und sah, wie die schwarze Masse der Karawane sich unter der Sonne abhob.
»Als gestern abend der Sturm aufhörte.« fuhr der Ölöte fort, »wurde der Befehl zum Aufbruch gegeben. Alles wurde eingepackt. Die Reiter bestiegen ihre Pferde und Kamele. Die Tibeter und Chinesen, die zuerst fertig waren, warteten nicht auf die andern. Der alte Weg war vom Sturm ganz ausgewischt. Der Tag ging bald zu Ende, und die Dämmerung war kurz. Es war nicht leicht, sich zurechtzufinden. Als das Dunkel zunahm, beschlossen wir, daß der Vortrupp die mongolische Kamelkarawane erwarten sollte, die sich sonst verirren könnte. Es schien uns eine Ewigkeit zu dauern, bis sie herankamen. Aber die Sterne dienten uns als Wegweiser, die wir dringend brauchten. Es war Befehl gegeben, daß Reiter bis ans Ende des Zugs geschickt werden sollten, um sich davon zu überzeugen, daß keine Abteilung zurückgeblieben war. Alle waren zur Stelle bis auf die Solonen. Man mußte sie ihrem Schicksal überlassen. Die ganze Karawane konnte ja nicht ihretwegen aufs Spiel gesetzt werden. Sie würden sich schon am nächsten Tag zu helfen wissen, um so mehr, als sie ja nach unserer Meinung dich bei sich hatten. Denn da wir nach deinem Ritt nichts von dir hörten, nahmen wir als selbstverständlich an, daß dich der Sturm gehindert hatte, zurückzukehren und du daher bei den letzten geblieben warst.
»Endlich konnten wir aufbrechen. Ich und mein Kamerad ritten neben Terge Ritschen. Nach unendlich langer Wanderung meinte ich in weiter Ferne ein Feuer zu sehen im Osten, etwas rechts von unserm Kurs. Meine beiden Kameraden sahen es auch. Zuweilen verschwand es, flammte aber dann wieder auf. Der Unterhaltung der Tibeter hinter uns entnahmen wir, daß auch sie den Feuerschein erblickt hatten. Alle lebten auf. Es gab also Menschen, die uns die Aufklärungen geben konnten, die wir brauchten.
»Aber wer konnte sich in diese wüste Gegend verirren, in der die Nomaden keine Weide für ihre Schafe finden? Etwa Antilopenjäger? Oder war es möglich, daß die Solonen, ohne es zu merken, an uns vorübergezogen waren? Wir waren aufs äußerste gespannt und richteten unsern Kurs gerade auf das Feuer zu. Es wurde immer deutlicher und brannte merkwürdig beständig. Sonst wird, wie du weißt, ein aus der Entfernung gesehenes Feuer gewöhnlich von Zeit zu Zeit durch die Männer und Pferde verdeckt, die sich in seiner unmittelbaren Nähe befinden. Hier war aber niemand, der es verdeckte. Ein paar Lamas aus Tibet glaubten, es wäre ein Irrlicht, von den bösen Geistern der Wüste gesandt, um uns irrezuführen.
»Dann geschah plötzlich etwas, was unser Staunen noch erhöhte und worin die tibetischen Mönche einen Beweis dafür sahen, daß Zauberei im Spiel sei. Unmittelbar neben dem kleinen Feuer, das wir so lange gesehen hatten, flammte ein ganzer Scheiterhaufen auf und warf einen blendenden Schein auf den flachen Hügel, auf dessen Höhe er brannte. Im Feuerschein meinten wir einen Mann und einige Schatten zu sehen, die sich bewegten. Aber die Entfernung war noch zu groß. Eine knappe halbe Stunde vor Tagesanbruch erloschen beide Feuer. Wir behielten den Kurs bei, was um so leichter war, als ein paarmal ganze Funkengarben von den Feuerstätten aufstiegen.
»Bei Tagesanbruch hörten wir Wolfsgeheul. Ein Tibeter kam mit zwei Lanzen zu uns und überbrachte uns den Befehl der Gesandten, vorauszureiten und Erkundungen einzuziehen. Während unseres Rittes wurde es hell, und wir sahen deinen verzweifelten Kampf mit den Wölfen. Da stießen wir den Pferden die Hacken in die Seiten und ritten in wildester Karriere, aus Leibeskräften schreiend, auf den Hügel zu. Wir waren nicht mehr viele Pferdelängen entfernt, als du stürztest und die Wölfe sich über dich warfen. Wir schrien, was unsere Lungen hergaben. Da stutzten die Wölfe und warteten mit dem Todesbiß. Auch wenn sie hätten weiterkämpfen wollen, waren sie betrogen; denn dann waren wir bereits auf dem Gipfel und brachten ihnen andere Gedanken bei. Wie du siehst, sind sie nicht weit weg. Dort unten streichen sie in der grauen Wüste auf und ab.«
»Gesegnet sei Buddha, gesegnet der Taschi-Lama! Der Burchan, den er mir gab, hat mein Leben gerettet und mich davor bewahrt, die Wallfahrt abzubrechen und einen neuen Schritt auf dem Wege der Seelenwanderung zu tun.«
So dachte Tsangpo Lama, der weder hören noch sprechen konnte.
Sein Gesicht war so bleich, als es die sonnenverbrannte Haut zuließ, und sein Kopf fiel auf das Knie des Ölöten zurück. Wie im Traum hörte er das Glockenspiel unten am Hügel, wo die Pilgerkarawane vorüberzog und wieder die alte Richtung nach Südwesten einschlug. Zu seinen Ohren drangen auch Stimmen entsetzter Männer, die sich um ihn versammelt hatten. Die Häuptlinge schüttelten den Kopf, als sie die toten Wölfe in geronnenem Blut neben dem jungen Mongolen liegen sahen, der wohl nicht mehr viele Stunden zu leben hatte.
Eine Gruppe nach der andern kam heran, bald zu Fuß, bald zu Pferd, um das nächtliche Schlachtfeld und den Helden zu sehen, der so tapfer um sein Leben gekämpft hatte. Ein paar Schützen schlichen hinter den Wölfen her und verschossen vergebens ihre Kugeln. Ein Wolf blieb aber zurück. Er hatte von Tsangpos Messer mehr bekommen, als er aushielt, und vermochte vor Blutverlust nicht zu fliehen. Eine Kugel streckte ihn zu Boden.
Nach einiger Zeit kam auch der Tsacharenhäuptling und der alte Prior und fragten, was los sei. Sie waren erstaunt, als sie Tsangpo neben den Wölfen mit dem blutigen Messer auf dem Boden liegen sahen. Der Prior hatte genug vom Leben gesehen, um zu wissen, was das Gebot der Stunde war. Er rief einen alten Lama der Tsacharen heran, der in der medizinischen Fakultät des Gelben Tempels ausgebildet war. Die Karawanenabteilung der Tsacharen zog eben vorüber, und der Lama war nicht weit. Er gab den Befehl, Tsangpo auf einem Pelz den Hügel hinabzutragen, wo er nicht mehr die toten Wölfe zu sehen und sich der unheimlichen Nacht zu erinnern brauchte, die er durchlebt hatte.
Der Medizinlama holte seinen Koffer, der heilende Kräuter, Blätter und Pulver enthielt. In eine Tasse siedend heißen Tees, die er dem müden Wanderer zu trinken gab, mischte der Lama einen Pflanzenstoff, der Tsangpos Lebensgeister weckte.
»Er erholt sich,« erklärte der Medizinlama ruhig, »aber er braucht Ruhe.« Immer noch klingelten die Glocken wie zu einem Begräbnis.
Der Prior hieß den Tsacharenhäuptling, einen Teil seiner Karawane an dem Platz halten zu lassen. Man brauchte ein Zelt, Decken, Petze, Kisten, Proviant und Material zu einer provisorischen Bahre. Das Zelt wurde aufgeschlagen und schnell eingerichtet. Ein weiches, bequemes Bett wurde hergestellt, Brennstoff zusammengetragen.
Im Zelt entkleidete der Medizinlama den Patienten und legte frische Verbände auf seine Wunden. Das Blut wurde abgewaschen, er selbst in einen großen warmen Schafpelz gehüllt.
»Hört, wie es draußen klingelt! Es ist, als riefen die Glocken zu einem Gottesdienst.«
Tsangpo mühte sich, seinen Kopf nach dem Teil der runden Jurte zu wenden, der sich dem Eingang gerade gegenüber befand. Der Prior, der begriff, was er wollte, sagte:
»Ja, sei nur ruhig. Der Altar ist errichtet, die Burchane stehen an ihren Plätzen und Weihrauchbecken und Lampen vor ihnen. Neben dem Rauchfang ist ein Kadach, ein Willkommentuch, befestigt. So können böse Geister deinen Schlaf nicht stören. Trommel, Becken und Flöten sind da. Der Tag wird nicht ohne Gottesdienst vorübergehen. Hörst du, wie Tundup Lama auf den Kugeln seines Rosenkranzes die Om-mani-Gebete zählt, die er für dein Wohlergehen betet? Aber wo ist dein Reitpferd geblieben?«
»Ist mein Reitpferd nicht zurückgekommen? Nein, es ist wahr. Die Solonen fehlen ja noch. Es muß bei ihnen sein. Ist nichts unternommen worden, die Solonen zu retten?«
»Doch. Reiter sind auf Erkundung ausgeschickt. Es besteht keine Gefahr für sie.«
»Wie lange werden wir an diesem Platze verweilen, von dem ich so gern fortkommen möchte?«
»Bis du wieder so hergestellt bist, daß du das Schaukeln eines Kamelrückens vertragen kannst. Sobald die andern die nächste Quelle finden, schicken sie Reiter mit frischem Wasser hierher. Die Hauptkarawane wartet nicht auf uns. Holen wir sie nicht eher ein, so finden wir sie sicher in Siningfu oder Kumbum. Wir haben aber keine Eile.«
Tsangpo schlief wieder ein. Tundup Lama murmelte in einem fort seine Gebete. Draußen vor dem Zelt zogen die letzten Kamele vorüber. Endlich hörte das Glockengeläute auf und verklang langsam in der Ferne.
* * *
Nach einigen Tagen war Tsangpo wiederhergestellt und konnte sich mit seinen Freunden wieder der großen Pilgerkarawane anschließen, die sich in einer Gegend mit üppigem Graswuchs und zahlreichen Quellen gelagert hatte, um ihre Tiere werden und sich ausruhen zu lassen.
Vergebens wartete man auf Nachrichten von den Reitern, die den Austrag erhalten hatten, die Solonen zu suchen und ihnen Hilfe zu bringen. Allmählich gab man die Hoffnung auf, sie wiederzusehen, und sprach schon davon, ohne sie aufzubrechen. Da kam eines Abends die Lösung des Rätsels. Die ausgeschickten Reiter kehrten mit etwa zwanzig Solonen zurück, die zu Fuß gingen und sich, ganz ausgeraubt, in elendem Zustand befanden.
Die armen Pilger wurden von den frommen Reisekameraden aufs beste verpflegt. Über ihre Erlebnisse berichtete der Vornehmste von ihnen folgendes:
»Wir waren die letzten, die die Quellen am Salzsee verließen. Im Augenblick des Aufbruchs bemerkten wir zwar, daß einige fremde Reiter angekommen waren, doch schenkten wir ihnen weiter keine Beachtung und setzten unsere Reise in der Spur der großen Karawane fort. Wir waren noch nicht weit gekommen, als wir Tsangpo Lama begegneten, der uns die nötigen Aufklärungen gab und zur Eile mahnte. Wir beschleunigten unser Marschtempo, so gut wir konnten. Von Tsangpo Lama hörten wir nichts mehr, und wir waren wegen seines Ausbleibens in Unruhe.
Nach einiger Zeit tauchten aus dem Dunkel ein paar Reiter auf. Sie kamen auf uns zu und behaupteten, von den tibetischen und chinesischen Führern der Hauptkarawane geschickt zu sein. Ein paar von uns erkannten in ihnen Teilnehmer des Pilgerzugs wieder, und deshalb vertrauten wir blind ihren Worten. Es waren Kalmücken.
Sie behaupteten, auf Grund einer Mitteilung der ölötischen Führer sei beschlossen worden, bei einer in einiger Entfernung nordwestlich von unserm Kurs gelegenen Quelle zu rasten. Da diese Quelle sich genau westlich vom Salzsee befinde, könnten die zurückgebliebenen Abteilungen den Platz schneller erreichen, wenn sie rechts abbögen. Binnen kurzem kämen sie wieder auf die Spur der Hauptkarawane.
Keiner von uns ahnte einen Verrat. Wir folgten den beiden Kalmücken. Wir waren nur erstaunt, daß sie uns immer weiter nach Norden führten, und daß wir auf diese Weise uns dem Salzsee eher näherten statt von ihm entfernten. Ich fragte nach dem Grunde. Sie antworteten, in dieser Richtung gelangten wir bald auf sandfreien Boden und könnten auf bequemerem Wege die andern einholen.
Es wurde Tag. Der Himmel sah bedrohlich aus. Die beiden Kalmücken spähten oft nach Osten und Nordosten, nach dem Salzsee zu, und schienen unruhig. Der Wind setzte ein. Die Luft wurde unklar. Der Himmel bewölkte sich. Ein Sandsturm war im Anzug. Staubwolken hüllten uns ein, und bald war uns alle Aussicht versperrt. Wieder fragte ich unsere Führer, ob sie sicher seien, im Sturm den Weg zu finden. Nachdem sie sich leise besprochen hatten, antworteten sie: ›Nein! Es ist das beste, wir machen hier halt.‹
Der Sturm nahm an Heftigkeit zu. Während wir noch berieten, sahen wir die beiden Kalmücken eiligst nach Norden fortreiten und im Nebel verschwinden.
Das geht nicht mit rechten Dingen zu, rief ich. Tsangpo Lama wußte nichts von einer Änderung des Reiseplans. Sehen wir zu, daß wir die Spur der Karawane wiederfinden, ehe sie vom Sturm verwischt ist.‹
›Ja, aber die beiden Kalmücken! Durften wir sie verlassen? Vielleicht erkundeten sie den Weg, von dem sie gesprochen hatten? Laßt uns eine Zeitlang warten.‹
Die Kragen zum Schutz gegen den Wind hochgeschlagen, saßen wir dicht beieinander im Sand. Lange brauchten wir nicht zu warten! Ein Mann zu Pferd tauchte im Nebel auf. Er stieß einen schrillen Ruf aus und feuerte einen Flintenschuß ab. Im Verlauf einer Minute tauchte bald hier, bald da ein Reiter auf, alle mit Gewehren und Säbeln bewaffnet. Es waren zwölf oder vierzehn Mann.
Wir sprangen auf, um zu unsern Waffen zu eilen, die, wie üblich, an den Kamellasten festgebunden waren. Noch ehe wir uns bewaffnen konnten, war die Räuberbande zur Stelle. Ein grober Kerl schrie auf mongolisch: ›Halt! Wer eine Waffe anrührt, wird erschossen!‹
Zwei von uns, die sich zur Wehr setzten, wurden mit Säbelhieben zu Boden gestreckt. Die übrigen wurden mit Lederriemen gefesselt. Alle Verteidigung war aussichtslos. Das Ganze war das Werk eines Augenblicks. Einige von uns fielen auf die Knie und baten um ihr Leben.
Ein paar Banditen schafften unsere Kamele und Pferde weg. Nachdem sie nach dem Salzsee zu verschwunden waren, wurden wir von den übrigen auch des Silbers und der Wertsachen beraubt, die wir im Gürtel trugen. Darauf schwangen sie sich aufs Pferd und ritten davon.
All unsere Habe war uns genommen, und wir kannten den Weg nicht. Vor Schreck gelähmt wagten wir nicht zu sprechen, aus Furcht, die Bande könnte zurückkehren und uns alle totschlagen. Unterdessen setzte der Sturm mit voller Stärke ein. Immer wieder vermeinten wir, drohende Stimmen und das Gebrüll unserer treuen Kamele zu hören. Nachdem wir ziemlich lange gewartet hatten, ohne daß sich jemand zeigte, kam mir der Gedanke, es bleibe uns nur das eine übrig, zu versuchen, unser Leben zu retten, alles aufzubieten, um euch einzuholen und mit den besten Reitern der Karawane der Räuberbande nachzusetzen. Die Riemen an unsern auf dem Rücken zusammengebundenen Händen waren leicht zu lösen, da wir uns gegenseitig helfen konnten. Der eine von unsern verwundeten Kameraden war bereits tot. Den andern schleppten wir mit. Er starb unterwegs. Wir gingen bis an den Punkt zurück, wo uns die Kalmücken von unserer Spur weggeführt hatten. Sie war gerade noch zu erkennen, wurde aber immer mehr verwischt und hörte schließlich ganz auf.
»Trotzdem setzten wir unsern Marsch fort. Ein gestürztes Kamel zeigte, daß wir auf der rechten Spur waren. Wir versuchten, denselben Kurs einzuhalten. Den ganzen Tag gingen wir, ohne eine Spur von der Karawane zu entdecken. Oft waren wir nahe daran, im Flugsand zu ersticken, hielten aber aus. Es ging ja auf Leben und Tod. In der Nacht versuchten wir zu schlafen und lagen bis Tagesanbruch still. Da hielten wir wieder Rat. Einige fürchteten, wir könnten uns zu weit von euch entfernen. Andere hielten es für hoffnungslos, zu suchen, solange der Sturm andauerte. Wieder andere schlugen vor, nur immer weiter zu gehen, bis wir das Gebirge erreichten, von dem Tsangpo gesprochen hatte. Auf diesen Vorschlag einigten wir uns.
»Wir setzten den Kampf gegen den Sturm fort und gingen, wie wir meinten, auf das Gebirge zu. Später aber zeigte es sich, daß wir, aufgeregt wie wir noch immer waren, in falscher Richtung zogen. Endlich legte sich der Sturm, und das Wetter klärte sich auf. Die Nacht zwang uns wieder zu rasten. Am nächsten Morgen sahen wir in der Ferne zwei Reiter. Wir glaubten, es seien die Wegelagerer, die nach uns spähten, und versuchten uns daher zwischen den Sanddünen zu verstecken. Aber sie hatten uns schon erblickt, und ehe sie herankamen, sahen wir zu unserer Freude, daß es Freunde waren. Halb verdurstet wurden wir von ihnen an eine Quelle geführt, und dann kamen wir hierher.«
* * *
Als Tsangpo Lama hörte, was die Solonen erlebt hatten, grämte er sich noch mehr, daß er sich vom Schlaf hatte übermannen lassen.
»Wäre ich bei euch gewesen, so hätte ich mich vermutlich nicht von den beiden Kalmücken hinters Licht führen lassen. Und wenn mir ihre Aussagen ebenso wahrhaftig erschienen wären wie euch, hätte ich beim Überfall eine kräftige Gegenwehr ins Werk gesetzt.«
»Ohne Zweifel«, antwortete der Solone. »Aber dann wärest du und die meisten von uns erschossen worden. Nein, wir können froh sein, daß wir mit dem Verlust von nur zwei Mann davongekommen sind.«
»Von dem Augenblick an,« sagte Tsangpo, »als das goldene Buddhabild im Zelt des Priors gestohlen wurde, habe ich geahnt, daß wir Verräter in der Karawane hatten. Hoffen wir, daß die beiden Kalmücken die einzigen gewesen sind!«
Die Solonen kamen sich wie Schiffbrüchige vor, die im letzten Augenblick gerettet worden waren. Die übrigen Pilger sorgten für sie aufs beste. Zu je zweien wurden sie auf die Stämme der Mongolen verteilt. Sie erhielten Kamele. Pferde, Proviant und was sie sonst zur Ausführung der Wallfahrt brauchten. Keiner opferte mehr für sie als Tsangpo Lama, der der Meinung war, unfreiwillig ihr Unglück verursacht zu haben.