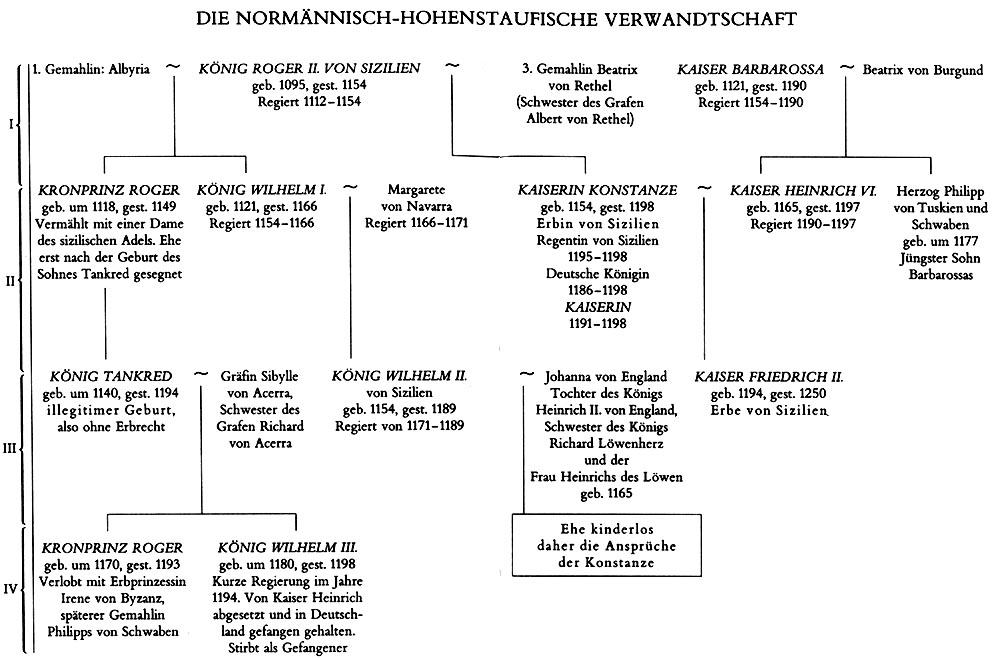|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Palermo, 25./27. November 1198
Als Richard Ajellus, von Herrn von Montigny geleitet, am 24. November des folgenden Jahres in Palermo ankam, fand er die Stadt im Zeichen einer außergewöhnlichen Niedergeschlagenheit. Schon beim Landen erfuhr er die Ursache: das Leiden der Kaiserin, das sich den ganzen Sommer über unter milden Formen hingezogen hatte, war plötzlich in eine hoffnungslose Krise getreten.
In seinem väterlichen Hause, das unweit der Residenz hinter San Giovanni degli Eremiti lag, fand Richard alles für seine Ankunft vorbereitet. Es war nicht, wie das Besitztum der von Heinrich zu Landesverrätern erklärten Anhänger Tankreds, beschlagnahmt worden. Einige arabische Diener hatten das große Anwesen so verwaltet, als ob seine Bewohner jeden Abend zurückkehren könnten. Nun hatte sich der Tag erfüllt: Ein Blinder kam nach Hause, ein Geschlagener: Sinnbild seines Vaterlandes.
Um die Dämmerung saß Lothar am Bett des Freundes. Der Wind trug die Hafensignale in die Stille des Schlafzimmers, das nach dem Meere zu lag. Durch den maurischen Fensterbogen sah man die perlgrauen Wolken mit ihren silbernen Rändern gegen die Horizonte ziehen.
– Was soll werden, wenn die Kaiserin stirbt? fragte Richard.
– Das Chaos. Siehst du irgendeine andre Möglichkeit?
– Nein.
– Und was soll aus dem Kinde werden?
– Nicht auszudenken . . . Wenn wenigstens Pedro geblieben wäre . . . Aber ich begreife, daß er nicht 360 bleiben konnte . . . Seit Lothar von Segni Papst ist, mußte er in sein Land, wo sich das Gewitter vorbereitet. Möglich, daß es noch Jahre dauert, ehe der heimliche Krieg in Romanien zum offnen wird. Nachgeben wird dieser Papst, der sich Innozenz nennt, nicht. Der ›Unschuldige‹ wird den ›Schuldigen‹ nachstellen . . .
– Glaubst du, daß Markward von Anweiler sich schon für den Fall, daß der Kaiserin etwas zustoßen sollte, bereit hält?
– Lieber Lothar, was soll ich noch wissen – und woran soll ich nicht zweifeln? Das Geschehen der Welt ist mir zu einem dumpfen, sinnlosen Geräusch geworden, aus dem ein jeder den Ton heraushört, der ihm gerade paßt. Ihr alle, die ihr noch Augen habt, seid befangen. Nur der Augenlose sieht unbefangen den Grund . . . Ich möchte wissen, ob die Kaiserin auf dem Wege der Sehenden angelangt ist . . .
Lothar hatte es schon nach dem ersten Wiedersehen mit Richard in Trifels vermieden, solche Gespräche auszuspinnen. Auch jetzt lenkte er ab:
– Soll man der Kaiserin deine Ankunft melden?
– Du mußt besser wissen als ich, ob ihr die Erregung nicht schaden kann. Aber vielleicht nimmt sie die Begegnung mit mir so ruhig wie ich sie in meinen Briefen gebeten habe, es zu tun . . .
– Ich weiß es nicht. Wir wollen warten, bis aus dem Schloß Nachricht über ihren Zustand kommt . . .
– Es wird klüger sein.
– Möchtest du mit ihr sprechen?
– Nur, wenn man sicher ist, daß sich ihr Zustand bessern wird . . . Den Weg einer Sterbenden, welche Abrechnung hält, soll kein Schatten kreuzen, der sie 361 ablenken könnte . . . Was kann ihr noch Richard Ajellus sein? Ein Peitschenschlag in eine offne Wunde. Wie leicht hat es der Schuldige! Wie schwer der Schuldlose, der sich schuldig fühlt! Fluch der übergeordneten Verkettungen! . . . Wie einfach ist die berechnete Tat mit ihren Folgen . . . Wenn die Kaiserin schon auf dem letzten Wege ist, wird sie weit, weit entfernt von jenen schönen Sommerabenden sein, als sie sich mit Wilhelm und mir in der Favara die arabischen Dichter erklären ließ . . . Sie hat einen Sohn, für den sie beten muß . . . Wem wird sie ihn anvertrauen?
– Dem Papste. Sie wird die letzten Folgerungen aus den Notwendigkeiten ziehen. Dessen sei ganz gewiß. Der politische Rückzug, den sie seit dem Tode des Kaisers angetreten hat, beweist, welche große und zähe Strategin sie ist. Hätte sie in Sizilien wirklich mit Sizilianern regieren und sich auf die kaiserliche Macht als ultima ratio stützen können, sie hätte anderes erreicht als der nicht mehr zurechnungsfähige Fanatiker, der ›das Reich‹ sagte – und immer nur den ›Kaiser‹ meinte. Ich habe oft mit dem Kanzler Pagliara über den erbitterten Kampf gesprochen, den sie mit Innozenz III. um die Konkordate führte . . . Sie wollte von den durch Hadrian IV. und Clemens III. der normännischen Dynastie verbrieften Rechten retten, was nur zu retten war: sie mußte schließlich der Reihe nach alle preisgeben, um das Wichtigste zu erhalten: die Krönung ihres Sohnes und die Neubelehnung mit dem Königreich durch den Papst. Die Krönung fand am 17. Mai statt. Sie wurde bezahlt mit der Aufgabe aller Ansprüche des sizilischen Königs auf Deutschland. Die Neubelehnung wurde erkauft durch die Bereitschaft, ein neues 362 Konkordat mit der Kurie zu schließen, das die früheren außer Kraft setzte. Bis in die zweite Novemberwoche hat der Kampf um dieses neue Konkordat gedauert. Als der Papst ihre Vorschläge, die sie ihm in Rom durch Thomas von Gaëta hatte unterbreiten lassen, in sehr liebenswürdiger Form, aber mit um so größerer Entschiedenheit zurückgewiesen und nun seinerseits den Kardinal Oktavian von Ostia als seinen Bevollmächtigten nach Palermo gesandt hatte, mußte sie die letzten Zugeständnisse machen, die er von ihr verlangte: sie mußte ihm die Annahme von Beschwerden, die Einberufung von Synoden, die Sendung von Legaten und die Mitbestimmung bei den kirchlichen Wahlen für ganz Apulien-Sizilien zugestehen. Sie mußte außerdem die echte Geburt ihres Sohnes beschwören. Denn man hatte sogar behauptet, Konstantin sei ein untergeschobenes Kind. Erst daraufhin wurde die Leistung des Lehnseides angenommen und die Ausstellung des Lehnsbriefes zugesagt. Oktavian ist gegen den 10. November nach Rom zurückgereist. Die Überbringer des Lehnsbriefes sollen noch vor Ende dieses Monats hier eintreffen. Man erwartet sie jeden Tag.
– Wer weiß, sagte Richard, ob sie nicht zu spät kommen . . . Aber wie immer dem auch sei: die Würfel für Sizilien sind gefallen. Der Enkel muß beginnen, wo der Großvater aufgehört hat: nur daß er ärmer und verlassener in der Welt steht . . . Welches Widerspiel der Kräfte in neun Jahren! Der Sohn des größten Papstfeindes lebt – von Papstes Gnaden! Innozenz ist der Vormund des Stauferkindes!
– Weißt du, ob in zwanzig Jahren nicht vielleicht der Papst der Gefangene dieses Knaben sein wird? 363
– Nichts weiß ich – gar nichts! Keiner weiß – keiner weiß! – ›Oft scheint es mir, auch Gott weiß nichts‹, sagte manchmal der Admiral Margaritus im Laufe der langen Gespräche, die ich mit ihm in Trifels führte.
Sie schwiegen und hingen ihren Gedanken nach. Die Nacht kam rasch, wie in allen südlichen Ländern . . .
– Du hast mir einmal von dem schönen Strande zwischen Pellegrino und Capo Gallo geschrieben, nahm Richard das Gespräch wieder auf . . . Könnten wir nicht in den nächsten Tagen hinausreiten? Ich kenne diesen Winkel und liebe ihn nicht weniger als du. Es ist dort ein starker Duft von Erde und Wurzeln, der sich mit dem Geruch des Meeres vermengt. Es scheint mir, ich spüre erst Sizilien, wenn ich diesen Hauch wieder um mein Gesicht spüre. Was ist denn Heimat, wenn nicht diese ganz besonderen Dinge, die es nur an einem Ort der Erde gibt und an keinem anderen?
– Gewiß werden wir hinausreiten . . . Wann du willst.
– Und auf den Berg hinauf muß ich auch bald. Ich möchte das Meer von da oben sehen. Ich werde es sehen, auch unter der Binde vor meinen Augen – auch den Ätna werde ich sehen, wenn ich wittere, welche Luft um mich ist. An Tagen wie diesen gibt es oft die großen Fernblicke, die der Sommer nicht kennt . . . Warst du jemals oben im Gebirge, in Castrogiovanni?
Lothar erschrak:
– Ja.
Ganz leise fragte Richard:
– Sage mir: ist es wahr, was man sich von dem Ende des Jordanus erzählt? Hat man ihm eine glühende 364 Krone in den Kopf genagelt, weil man in ihm den König der Aufständischen sah?
– Woher weißt du das?
– Man hat es uns in Trifels erzählt . . . Unsere Wächter. Ist es wahr?
– Ja.
– Und ist es auch wahr, daß die Kaiserin der Hinrichtung beiwohnen mußte?
– Sie hat nichts gesehen. Ihr Arzt hatte ihr ein Betäubungsmittel gegeben . . . Sie verlor das Bewußtsein beizeiten . . .
– In welchen Händen war die Welt ein Menschenleben lang?
– Glaubst du, sie wird morgen in – milderen Händen sein?
– Nein. Die Welt ist nicht reif für die Milde.
– Sie wird es niemals werden. Gott bedarf der Bösen. An wen sollte er sonst seine Gnade verschwenden?
Man meldete einen Boten aus dem Schloß. Die Kaiserin habe nach ihrem Beichtvater gesandt. Der Rat der Familiaren sei zusammengetreten.
Am 25. November fertigte die Kaiserin ihr Testament aus und gab es in die Hände des Kanzlers Pagliara. Sie bestimmte den Papst zum Vormund ihres Sohnes und zum Verweser des apulisch-sizilischen Königreiches. Am Nachmittag des 26. empfing sie die Sakramente aus der Hand des Erzbischofs Bartholomäus. Abends 365 stellten sich schwere Krämpfe ein, die sich erst nach Stunden beruhigten. Gegen Mitternacht verlangte sie, mit Berengaria allein gelassen zu werden. Sie hatte dieses Verlangen mit so klarer und entschiedener Stimme geäußert, daß der Arzt stutzte: sollte ihre zähe Natur der Krankheit Herr werden? Sollte ihr Wille das Leben noch einmal zurückbannen? Er wußte nicht, wie weit sie schon aus der Schwerkraft der Erde in den unirdischen Raum vorgedrungen – wie sehr ihre Stille schon die Stille der Entrückten war . . . Voll erneuter Ungewißheit ging er mit den Erzbischöfen, dem Kanzler und dem Justitiar in das Vorzimmer zurück. Als letzte verließ, leise in ihr Tuch weinend, Anne de Perche das Fußende des Lagers.
– Sind sie nun alle gegangen? fragte die Kaiserin . . . Sind wir allein, Berengaria?
– Ja, Majestät.
– Sage mir, Berengaria, wie alt bist du nun?
– Ich bin sechsundsiebenzig Jahre alt.
– Ich weiß, du hast Kinder gehabt . . .
– Ja, Majestät. Sie sind beide jung gestorben. Der eine Sohn mit zehn, der andere mit acht Jahren . . .
– Was hast du gedacht, als sie starben?
– Ich habe geweint und gelitten, ich habe Gott angeklagt und mich für die unglücklichste Frau der Welt gehalten. Später, als ich die Dinge der Welt besser begreifen lernte, habe ich Gott um Verzeihung gebeten. Denn es schien mir, daß das Leben für viele ein fragwürdiges Geschenk sei . . .
– Wir haben kein anderes, Berengaria. Wir wüßten nichts von Gott, wenn wir nicht lebten . . .
– Wer in Gott ruht, braucht nichts von Gott zu 366 wissen. Wer in Gott eingeht, auch nichts mehr. Das Ungeborene und das Vollendete ruht in Gott.
– So glaubst du auch, daß alles Leben nur ein Durchgang zu Gott sei?
– Das lehrt uns die Schrift – und ich glaube es. Auch die Mohammedaner, die zu einem anderen Gott beten als die Christen, glauben es –
– . . . und schmücken doch das Leben mit allen Schönheiten, Berengaria, die ihr Geist erfinden kann . . .
– . . . aber sie opfern auch dieses schöne Leben in jeder Minute für ihren Gott, Majestät, in dessen Paradies sie eingehen . . .
Die Kaiserin lag offnen Auges und schaute nach der Decke, wo die Schatten der Ampel im Schein eines schwachen Kaminfeuers schwankten . . .
– Glaubst du, Berengaria, daß ich mein Leben, das du besser kennst als irgendein Mensch auf der Welt, in Pflichterfüllung und Hingebung Gott geopfert habe?
– Eure Majestät haben vervielfacht an Gott zurückgegeben, was Gott Ihnen verliehen hatte.
– Ich habe mich bemüht, getreu zu sein . . . Du hast alles mit mir getragen, was es zu tragen gab, Berengaria – und es war viel. Du bist wie mein Schatten mit mir gegangen durch alle guten und alle bösen Stunden . . .
– Es waren nicht viele gute, Majestät . . .
– Nein: es waren nicht viele gute. Und ich glaube auch nicht, daß die Zahl der guten überwogen hätte, wenn mir bestimmt gewesen wäre, noch länger zu leben –Ja, ich glaube nicht einmal mehr, daß ich das Leben meines Sohnes hätte lenken können. Du weißt, wie oft ich mich darüber gegrämt habe, als ich ihn nach 367 der Geburt nicht bei mir behalten durfte. Nun, wo er über ein Jahr lang bei mir war, habe ich erkannt, daß es ein Glück für ihn ist, an keine Mutter gewöhnt worden zu sein. Er wird es schwer haben, wenn er am Leben bleibt. Er würde es noch viel schwerer haben, wenn er wüßte, was es heißt, eine Mutter zu verlieren. Auch ich, Berengaria, würde noch viel schwerer gelebt haben, wenn ich Tag um Tag hätte spüren müssen, wie ferne ich ihm bin. In diesem Kinde ist ein großes Schicksal und eine große Berufung. Ich kann es niemandem beweisen . . . Doch ich fühle es in dem Augenblick, wo ich selbst am Ende meiner Bahn bin. Dieses Kind ist aus großen Entfernungen in die Welt geboren. Seine Bestimmung wird die Einsamkeit sein . . . War nicht auch meine Bestimmung die Einsamkeit?
Was schön und süß ist, hat mich nur von ferne gestreift, auch die Mutterschaft. Das Bittre aber war die Nähe meines Lebens. Ich habe mir meinen Sohn nicht mehr in meinen Abschied holen lassen. Dies ist das letzte Opfer, das ich ihm bringen kann. Er könnte wittern, was das Sterben einer Mutter heißt: es könnte ihn lähmen in seinem frühen Wollen. Er muß hart und geschliffen bleiben. Ich werde ihm durch mich selbst verbunden sein, wenn er seine eigne Einsamkeit begreifen lernt . . . Er wird sie früh begreifen lernen: die Welt wird ihm keine Zeit zum Träumen lassen . . .
Längst, längst waren alle diese Worte nicht mehr über die Lippen gekommen, die sich nur noch bewegten, indessen sich die Lider gesenkt hatten. Aber dann standen auch die Lippen still . . .
Erschrocken neigte sich Berengaria – neigte sich tiefer – hielt das dünne Blatt einer Gelsominblüte vor 368 den schweigenden Mund. Noch ging der Atem – noch schlug das Herz . . . Dann tastete eine Hand nach ihrer Hand, ein Winken der Brauen rief das Ohr der Dienerin dicht an die Lippen:
– Sage dem Grafen Ajellus, wenn er nach Hause kommt, Richard Ajellus, verstehst du?, daß ich bis in meine letzte Stunde für ihn gebetet habe . . . Sage Herrn von Ingelheim – nein, ihm brauchst du nichts mehr zu sagen. Er weiß . . .
Es war eine Stunde nach Mitternacht, als Berengaria die Augenlider der Kaiserin schloß, die Kerzen in den Leuchtern anzündete und die Tür zum Vorzimmer öffnete . . .
In der Frühe des aufgehenden Tages traten Lothar Ingelheim und Richard Ajellus an die Bahre, zu deren Häupten Berengaria einen Strauß von Datturablüten gestellt hatte. Zwischen ihnen ging ein erstauntes Kind, welches großen Auges auf die Tote schaute – und dann durch den offnen Fensterbogen gegen das Meer, das soeben in goldnen Feuern erwachte . . .
Eintönig fielen die sich abwechselnden Stimmen der beiden Hofkaplane in die Stille:
– Aus der Tiefe, Herr, habe ich zu dir gerufen, Herr, erhöre meine Stimme.
– Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt.
– Was ist das: ›der Herr‹? fragte das Kind, die Augen gegen die dunkle Binde des Grafen Ajellus hebend . . .