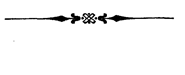|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
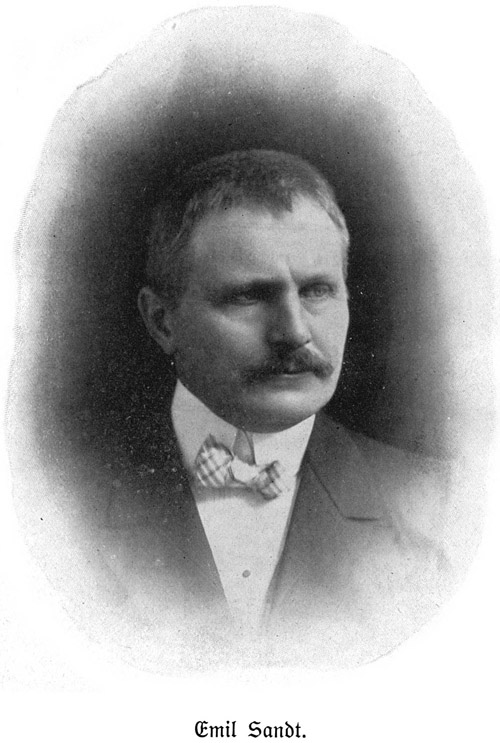
Von Emil Sandt.
Ich habe » Cavete!« im Jahre 1906 geschrieben. Es war ein Jahr, in dem ein aufmerksames Ohr von überallher ein feines Knistern vernehmen konnte, wie wenn unsichtbare Kräfte am Werke sind, von unten eine hindernde Decke zu durchbrechen. Wie die Erkenntnis von der Wichtigkeit der Herrschaft über das Luftmeer sich zu verdichten schien, so schienen sich auch die Kräfte, dieses Ziel zu erreichen, zu vervielfachen. Es war eigentlich keine Kulturnation ausgenommen. Nur arbeitete die eine heimlicher als die andere. Ich sah die Gehirne rechnen und die Finger tasten. Und vor mir entwickelte sich ein Wirrnis, deren Niederschlag mein Roman » Cavete!« wurde. Ich habe ihm absichtlich keine literarische Gattungsbezeichnung gegeben. Weil er in keinen der schablonierten Begriffe hineinpaßt; aber schon heute bekennt alles, was ehrliche und verständnisvolle Kritik hat und übt: » Cavete!« ist geworden, wozu ich es bestimmt hatte: ein kulturhistorischer Roman. » Cavete!« wird bis in die fernsten Zeiten Vergleichsmöglichkeiten und ein Feld für Studien abgeben. Ich habe nirgend unter dem Drucke müßiger oder erhitzter Phantasien gesagt: »So wird es kommen« oder gar nach Art sensationeller Effekthascherei ein genaues Bild der noch Jedem verschlossenen Zukunft entworfen, – ich habe nur an nationalen und internationalen, an sozialen und ökonomischen Fragen den Status abgemessen und gerufen: »Hütet Euch! und bereitet Euch vor. – Das lenkbare Luftschiff kann die Evolution in der Kultur bringen; seht zu, daß es nicht die Revolution bringt.«
Wenn man das Jahr 1906 mit dem Jahr 1908 vergleicht, – welcher Unterschied! – In jenem die Gehirne noch fast taub; in diesem fiebert alles. – Die Nationen wetteifern gegeneinander. Und wenn noch zu Anfang des Jahres 1907 die Franzosen an der Spitze marschierten, so wurden sie bald von uns Deutschen abgelöst. Wir besitzen heute das schnellste Luftschiff; das Luftschiff, das die längste Fahrtdauer aufweist und das am meisten tragen kann. – Das wird die anderen zu den äußersten Anstrengungen veranlassen; und die Unterschiede im Fortschritte werden sich verschieben, manchmal vielleicht verwischen; auch dann nur förderlich im Sinne einer sich aufwärts pflanzenden Kultur.
Als mein Roman abgeschlossen war, schickte ich ihn unsern hervorragendsten Luftschiffkonstrukteuren und bat um ihre Gedanken bei meinem Werk. Nur einer war, der mich sofort verstand. Das war der Graf Zeppelin. Ein anderer schrieb zurück: »Ehe ein solches Luftschiff erfunden würde, müßten erst ganz andere Naturgesetze entdeckt werden!« Wie fehlgegriffen! – Da es doch auf die eine oder die andere Konstruktion gar nicht ankam; da es doch so gleichgiltig war, wie ich gebaut hatte; und da lediglich ein »vollendetes« Luftschiff die Prämisse war; – hätte ich doch sogar das ganze erste Kapitel in die fünf Worte zusammenfassen können: »Das lenkbare Luftschiff war erfunden.« Aber dieser Eine klebte an seiner Konstruktion und jede Abweichung von ihr ließ ihn auch den Zusammenhang mit einer Arbeit ablehnen, deren Hauptthema die Folgen der Erfindung war. Seine Exzellenz Graf Zeppelin hat dem Roman das Geleitwort mitgegeben in richtiger Erkenntnis der Beweggründe, die mich ihn schreiben ließen, und der Ziele, die er verfolgte; aber auch Seine Exzellenz hat mir gegenüber nie ein Hehl daraus gemacht, daß für absehbare Zeit, nicht die geringste Aussicht sei, ein Luftschiff von den vorzüglichen Eigenschaften zu erbauen, wie ich sie meiner »Pax« angedichtet habe. Und Dr. Poritzky sagt in seiner Kritik über » Cavete!« sogar – »er sei überzeugt, daß das Luftschiff in seiner letzten Vollendung, wie ich es gezeichnet hätte, nicht vom Ingenieur, sondern vom Chemiker gebaut werden würde – –« aber gleichviel, es handelt sich in » Cavete!« nicht um die Art des Luftschiffes, das ist müßiges Spiel, – sondern um seine möglichen, seine drohenden Wirkungen.
Das Jahr 1907 kam mit den außerordentlichen Zeppelinschen Erfolgen. Und dann das Jahr 1908! Eines Tages erging an mich, der ich mich in der Umgebung des Grafen Zeppelin befand, die Einladung zu einer Fahrt. »Ich sollte sehen und vergleichen, wie weit sich meine Visionen, die ich in » Cavete!« niedergelegt hatte, verwirklicht hätten.«
Der Bote war kaum auf der Straße, als ich auch schon meine Siebensachen zusammengepackt hatte. Das flinke und elegante Motorboot trug uns nach Manzell hinaus. Alles still da draußen. Wie am frühesten Morgen eines Sommersonntages. Durch die Binsen, die das Ufer einsäumen, strich ein feiner Wind; die Wasserfläche war schwach gekräuselt; die Gehöfte lagen noch im Traum der Nacht. Und hoch über uns spannte sich ein tiefer azurblauer Himmel. Wir legten an der Halle an. Immer wieder dieses Gefühl eines mit Stolz gemischten Staunens. Die Stirnwand der Halle ist nur in dem unteren Streifen zugebaut. Die Verschalungen sind schnell entfernt und die Bahn ist frei für diesen gigantischen Körper. Ich habe ihn schon so oft gesehen, aber immer wieder überrascht mich die Verbindung einer erdrückenden Masse mit der Eleganz ihrer Erscheinung. Während wir uns nach der Anweisung des Grafen auf das Luftschiff begeben, trifft er noch die letzten Anordnungen.
Ich befand mich in der mittleren Gondel. Ihre Wände, ihr Fußboden, ihre Decke bestehen aus dem mildes Licht durchlassenden Ballontuche. Raum für mehr als ein Dutzend Personen gebend, bietet sie an den Längsseiten bequeme Sitze, und vier an feinen aber starken Ketten hängende Tischchen vervollständigen eine Ausrüstung, die nach Raum wie Farbentönung anheimelnd genannt werden darf. Die Seitenwände sind ausgiebig durchbrochen und schenken durstigen Augen eine Aussicht auf den weiten Horizont und der gleichfalls durchbrochene und wie die Seiten mit Celluloid belegte Fußboden gestattet es, in bequemer Lage, geschützt gegen Wind und Sonne zwischen den Füßen hinunter auf die heimatliche Erde zu schauen, die sich bei schönem Wetter bald zu einem farbenfrohen Teppiche ausbreitet.
Die vordere Gondel ist das Gehirn des Giganten, die hintere dient der Bedienung des hinteren Motors, sie ist ebenso geräumig als die vordere und auf gleiche Weise vom Mittelgang aus zu erreichen; die Mittelgondel ist nur für Passagiere bestimmt.
Als mich der Graf hineinführte, meinte er: »Ich habe sämtliche Landkarten hineinlegen lassen, so daß Sie sich stets sofort orientieren können. Papier, Bleistift – es ist alles vorhanden. Restauration wird Ihnen zur Verfügung gestellt – und übrigens: »Wir werden uns ja bald in den Gondeln wiedersehen!«
Unser berühmter Straßburger Meteorologe Geheimrat Hergesell machte die Fahrt zur Gewinnung von Beobachtungen inoffiziell mit. Sonst war niemand außer den Führern und der Bedienung auf dem Luftschiffe. So war ich der einzige Passagier.
Der Raum wurde heller. Durch die Seitenscheiben sah ich, wie das Luftschiff hinausgeschoben wurde; dicht unter meinen Füßen konnte ich das Spiel der kleinen Fischchen beobachten, die erschreckt wieder in die Tiefe schossen, – dann hörte ich die beiden Kommandorufe: Luftschiff voraus! – Luftschiff frei! – und das Wasser versank unter mir; bald sah ich die heimatliche Riesenhalle wie ein Kinderspielzeug unten liegen; ich sah Menschen am Ufer stehen, wie feine bunte Flecke auf einem grünen Teppich. Drüben durchfurchte ein Kursdampfer das smaragdfarbene Wasser. Feine weiße Schaumlinien zogen hinter ihm her. Durch das Glas erkannte ich ihn. Er kam von Konstanz und fuhr nach Lindau. Höher, immer höher zogen wir, – und immer weiter wurde der Horizont. Vom Norden her hob sich aus dem schimmernden Hegau der Hohentwiel, der Schauplatz der Liebe zwischen Ekkehard und Hedwig, die in den schwersten menschlichen Sang ausklang: »Selig der Mann, der sich selbst bezwungen« –; tief unten lag die liebliche Insel Mainau; von drüben her zog Konstanz und Stein am Rhein heran. Wir schwammen hoch vom Überlingersee dem Rheintale zu.
Ich ging in die hintere Gondel. Eine Sache, welche von unten so wagehalsig, vielleicht so unmöglich aussieht. Der Gang durch den Kiel, breit und bequem, mündet durch eine Zelluloidtür auf einen vielleicht 6 Mtr. langen, leicht abwärts führenden durchbrochenen Aluminiumsteg. Der Steg hat kein Geländer; denn die vom Rande des Steges nach dem Riesenbau über ihm gehenden Versteifungen und Streben nehmen gleich die Richtung so weit nach links und rechts ab, daß man sich bei ihrer Benutzung über die Tiefe beugen müßte.
Ich genoß, als ich hier oben stand, einen Blick in der Fahrtrichtung rückwärts Das schwäbische Meer glitzerte herüber, halbrechts lagen die Thurgauer Alpen in dem violetten Schleier, den die hochsteigende Morgensonne aus Nebeln webt, und drüber in scharf geschnittener Pracht standen die Schneefelder und Gletscherschluchten des hohen Säntis und des hohen Karsten. Unter meinen Füßen lag Konstanz als Mittelpunkt, und auf den Fluren, die wie grüner Sammet sich ausbreiteten, Dörfer und Städtchen ohne Zahl; Chausseen und Eisenbahndämme durchzogen das Gewebe wie feine Linien. Und der Rhein glitt wie ein breites silbernes Band quer über das Feld.
Ich ging hinunter nach der Gondel. Da ich nicht schwachnervig bin, könnte ich sagen, es liegt an mir, daß ich schwindelfrei blieb, aber auch die Beobachtung anderer hat ergeben, daß man dieses unheimliche Gefühl dort oben völlig verliert. Man sieht in eine weite Ferne; man sieht rechts und links vom Steg hinunter; der größte Kirchturm ist immer noch nicht größer, als ein kleiner Bleistift. Die Menschen werden zu Punkten – man sieht die D-Züge dahin jagen, – ja, wie ich es zufällig erlebt habe – man sieht unter sich einen Storch seine Kreise ziehen, – und man bleibt doch ohne jedes Angstgefühl. Ich ging den Steg hinunter, vielleicht sieben Schritte in freier Luft und trat in die Gondel. Von hier aus genießt man dann den vollen Rundblick.
Graf Zeppelin hat volle Fahrt signalisiert. Die vier Luftschrauben vollführten ein infernalisches Konzert. Während man in der Passagiergondel wenig oder doch nur ein feines Vibrieren merkt, zittern und zucken die Maschinengondeln von dem Arbeiten der Motore so sehr, daß die Verbindung- und Versteifungsröhren schwingende Linien erhalten. Und wenn man versucht, sie festzuhalten, um ihre Dimensionen zu erkennen, dann wird die angestrengte Faust mit hin- und hergerissen. Die Luftschrauben, deren Flügel verhältnismäßig klein sind, werden in eine so rasende Umdrehung versetzt, daß sie wie eine feine flimmernde Scheibe aussehen, und sie geben einen Klang von sich, wie den tiefsten Ton der größten Orgel. Der Verkehr zur Verständigung zwischen beiden Gondeln wird durch Drahtpost vermittelt und wickelt sich sehr rasch ab.
Wir zogen oder flogen das Rheintal hinunter. Dieses gläserne Wasser, das bald zischenden Gischt über eigensinnige Felsblöcke schleuderte, bald in Kreuz- und Querwindungen durch grüne Fluren floß, bald auch zornig gegen einengende Kunstbauten schäumte, bot uns dann den wunderbaren Anblick seines Sturzes bei Schaffhausen. Graf Zeppelin drückte den Giganten bis auf 80 Meter hinunter über den Fall. Er wollte wissen, wie der vom Wasserfall aufsteigende Luftwirbel auf das Fahrzeug wirkte. So genossen wir den Blick auf den Rheinfall von einer Stelle aus, die noch nie ein Mensch vor uns eingenommen hatte, die höher war, als die sonst zugänglichen Beobachtungspunkte und doch tief genug, um alle Details zu erkennen. Man kann sich nur schwer dagegen wehren, daß in uns ein Großmachtskitzel ausgelöst wird. Ob hoch oder niedrig – ob rechts oder links – wir sind, wo wir fein wollen. Dieses Riesengeschöpf, das uns trägt, ist gehorsam. Denn was ist der letzte Sinn der Lenkbarkeit: der Gehorsam auf den leisesten Druck. Und Graf Zeppelin hat bewiesen, daß er das erreicht hat.
Als wir wieder gestiegen waren, als Schaffhausen sich schon dem Horizonte zugeschoben hatte, genossen wir ein herrliches Panorama. Im Norden versank der Hohentwiel, im Süden stieg der scharfzackige Pilatus auf und neben ihm der vielbesuchte, vielbewunderte Rigi; von Osten her sandte der Säntis seine schneeigen Grüße, und tief unten Tal an Tal, Schluchten und Gebirgssättel, Flüsse, feine glänzende Fäden, die bald unter Felsen und in Wäldern verschwanden, bald sich liebkosend um bebaute Auen schlangen.
Die Tiefen um den Pilatus wurden erkennbar. Über ihnen lag ein Schimmer wie von Heliotrop. Graf Zeppelin lenkte sein Luftschiff das ganze Reußtal hinauf. Wie wir schon von weitem das schöne Luzern, diese Perle in dem reichen Schmuckkasten der Schweiz, gesichtet hatten, so hatte man uns auch von dort aus schon bemerkt. Das tiefe, choralähnliche Singen der Schrauben hatte längst auf uns aufmerksam gemacht. Dieser internationale Treffpunkt einer reichen und müßigen Welt, dieses Dorado eines jeden Landschafts-Enthusiasten bereitete uns einen stürmischen Empfang. Die Straßen, die Dächer der Häuser, die Ufer des Vierwaldstädtersees – alles war dicht besetzt mit Menschen; es war ein Erstaunen und ein großes Entzücken da unten. Trunkenes Rufen drang durch das Getöse zu uns herauf, – wie wohl eine Brandung durch eine schärfere übertönt wird, – ein Meer von Tüchern winkte; wir sahen, wie Automobile und Fahrräder eilends auf die Straße geschoben wurden und wie man sich bemühte, uns zu verfolgen. Diese Kinder ihrer Zeit, deren Herzen der Zukunft und dem Neuen entgegenzuckten, das begriffen sie nicht, daß wir frei waren und sie gefesselt. Hier mußte der eine Halt machen; dort der andere. Hier hemmte ein Fluß, über den keine Brücke, dort ein aufsteigender Wald, durch den kein Pfad führte. – Und wo immer sie verzichten mußten, – das letzte war ein froher, jauchzender Abschiedsgruß.
Graf Zeppelin hat den Luzernern ein besonderes Vergnügen gemacht. Er war mit uns dicht über den Dächern dahingeflogen und hatte das Luftschiff erst wieder steigen lassen, als wir mitten über dem Vierwaldstädtersee standen. Wir flogen Küßnacht zu: wir erlebten das Hochgefühl, in gleicher Schnelle mit einem Eisenbahnzuge durch die Luft zu gleiten, und schwammen in Sonnenschein gebadet und mit den Augen in eine märchenhaft schöne Welt tauchend über Höhen und Wälder hinweg, während dort unten der Eisenbahnzug rasselnd in einen dunklen, rußigen Tunnel fuhr.
Von Küßnacht, das im melancholischen Schatten des Rigi versank, ging es hinüber nach dem Zuger See, über ihm dahin hinauf nach Zug. Und hier wie vorher, wie nachher – ein Staunen, ein Atemstocken, und dann ein jubelndes Grüßen. Politisch sind das da unten keine Deutschen. Die überwiegende Zahl auch nicht einmal Schweizer. Das größte Kontingent stellt das Ausland. Europa ist ebenso beteiligt, wie die anderen Erdteile. Und ich habe gesehen, daß in wirklich großen Momenten die Nationalitäten ebenso ausgewischt werden, wie die Rassen. Es gibt nur Menschen und nur die Kultur. Denn zuletzt ist sich nach allem, was vom Grafen Zeppelin bekannt wurde und über ihn geschrieben wurde, niemand im Unklaren, daß er nur Deutscher, daß er ein Urdeutscher ist, – aber diese Segnung, die er bringt, ist so groß, daß sie allen nationalen Partikularismus bei den anderen vergessen läßt.
Der Flug vom Zuger- bis zum Zürichersee brachte dem Luftschiffe die schwierigste Aufgabe. Hier wird der Luftstrom eingeengt, nicht anders wie beim Wasser, das durch eine Schleuse gezwungen wird. Und es wäre ein leichtes für den Grafen gewesen, das Luftschiff hinüberzuführen, dadurch, daß er es steigen ließ und auf die gewünschte Richtung setzte. Das lag nicht in seinem Sinne. Es sollte sich durchzwängen. So wühlten wir uns über den Gebirgssattel hindurch. Und wie oft auch der Gigant unter dem Drucke der entgegenheulenden Luft ausweichen wollte, Graf Zeppelin zwang ihn immer wieder in die Enge. Wir fuhren mit aller Kraft, die die Maschinen hergeben konnten. Die Musik der Schrauben brachte das Trommelfell zum Zittern: der ganze Riesenkörper bebte – und doch (wir sahen es an unserem Schatten da unten), wir brauchten manchmal Minuten, ehe sich die Spitze des Schattens über eine der vielen weißschimmernden Chausseen geschoben, und manches Warten wurde nötig, bevor sich das Luftschiff von einem Gehöft bis zu dem dicht dabeiliegenden gequält hatte. Einen erheblich erschwerenden Umstand brachten die Querwinde, die aus den Nebentälern pfiffen. Aber das wollte Graf Zeppelin. Er wollte seiner Schöpfung keine Schwierigkeiten ersparen.
In diesem Sinne ist diese Schweizertour nicht nur historisch ein allgemeines geschichtliches Geschehnis, sondern auch in der Geschichte der Kultur und in der Geschichte einer Menschheit, deren Streben nach der letzten Vervollkommnung geht.
Wir sahen Zürich, diesen farbensprühenden Kranz am tiefblauen Zürichersee. Wir konnten von oben genau sehen, wie sich die Ufer des Sees an einigen Stellen noch vielleicht 20 Meter unter dem Wasser hinschoben, um dann jäh in die Tiefe zu versinken. – Wir flogen hinüber nach Winterthur und Frauenfeld und sahen abends in der siebenten Stunde am Horizont wieder das Glitzern des schwäbischen Meeres. Über den Thurgauer Alpen dahinziehend, beschattet von den Schneefeldern des hohen Säntis, unter uns unseres Herrgottes Märchenpracht, die immer wieder mit erstaunten Augen zu uns heraufblinzelte, zogen wir endlich über das reizende Bregenz und Lindau dem heimatlichen Manzell zu. In Friedrichshafen krachten die Böllerschüsse, und Stadt und Ufer waren zum Willkommengruß für die Heimkehr mit Flaggen und Wimpeln bedeckt.
Was habe ich nun erleben dürfen? – Was war die Krone dieses historischen Tages? Der Wille zum Weg hat die Kraft zum Wege gehabt. Und wie wenig fehlt noch an dem, was ich erträumt habe. Wie so sehr wenig! Gras Zeppelin schickte mir einmal als Dank für einen Glückwunsch ein Bild seiner Schöpfung mit der Widmung: »Dem Verfasser von » Cavete!« von dem Vollbringer seiner Vision!« Ein stolzes Wort. Und so wahr als stolz.
Der Mensch glaubt schon frei zu sein, wenn er auf der Erdkruste nach seinem Willen wandeln kann; wie viel mehr ist er es, wenn er in dem dreidimensionalen Reich die Weiten und Höhen und Tiefen ausmessen darf, getragen von einem auf jeden Wink gehorsamen Instrumente. Denn dieser Gehorsam, der gerade ist die Macht. Nichts hat uns gehindert, über Berge zu fliegen, uns durch Schluchten zu winden; die Natur konnte uns kein Hemmnis entgegenstellen; wir zogen trockenen Fußes über tiefe Seen, und unwegsame Wälder hatten für uns ihren Schrecken und ihre Finsternis verloren. Wir zogen im Lichte dahin.
Und so ist das Vorspiel von » Cavete!« vollendet. Diese Vision hat Leben erhalten. Und von uns Deutschen sei es mit Stolz gesagt: Es war ein Deutscher, der der Gesamtkultur diese Tat schenkte! – und nun kann das Drama, um dessentwillen » Cavete!« seinen Warnruf ausstößt, beginnen. Es bürgt viel für die friedliche Entwickelung, daß ein deutsches Gehirn die Erfindung gemacht hat und eine deutsche Faust sie festhält.