
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Von Waffengeklirr hallt die Welt. Vierzig Jahre sind vorüber, seitdem der Deutsch-Französische Krieg das Ende der kampfreichen Periode der Bildung nationaler Staaten in Westeuropa gebracht hat. Friede, hieß es, drückte der Zeit den Stempel auf, wenn auch ein bewaffneter Friede. Und diesen Zustand erklärend, verstiegen sich viele bürgerliche Politiker zu der Behauptung, der Krieg sei unter zivilisierten Völkern nicht mehr möglich. Zwar bedeuteten diese vier verflossenen Jahrzehnte eine Periode sprunghafter Ausbreitung des europäischen Kolonialbesitzes, der Unterjochung von ganzen Völkern in verschiedenen Erdteilen. »Vom Hundert der Fläche gehörten nämlich den europäischen Kolonialmächten, wozu wir auch die Vereinigten Staaten rechnen«, schreibt der Geograph A. Supan, »in
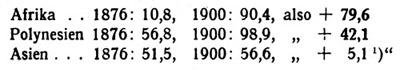
Supan: Die territoriale Entwicklung der europäischen Kolonien, Gotha 1906, S. 254.«
Und diese Ausbreitung, die in erster Linie die Aufteilung Afrikas und Sprengung der Abgeschlossenheit Chinas bedeutet, schritt vor sich unter ununterbrochenen kolonialen Kriegen. Im Jahre 1873 ziehen die Russen nach Chiwa, die Engländer nehmen die Fidschiinseln ein, im Jahre 1874 folgt der Zug der Japaner nach Formosa, im Jahre 1876 wird Fergana russisch, Ketta englisch, im Jahre 1877 Transvaal britisch, im Jahre 1878 bricht der Krieg um Afghanistan aus, im Jahre 1879 wird Bosnien besetzt, im Jahre 1881 wird Transvaal unabhängig, Tunis französisch, die Italiener besetzen Massauah, im Jahre 1882 besetzen die Engländer Ägypten, im Jahre 1884 beginnt offiziell die deutsche Kolonialpolitik, die Franzosen kämpfen gegen China, im Jahre 1885 wird Oberbarma englisch, im Jahre 1887 wird Rhodesien gegründet usw. usw., um nur die wichtigsten Ereignisse zu nennen, die im Kriege Japans mit China im Jahre 1894 und dem Kriege Englands mit den Boeren im Jahre 1899, sowie dem Russisch-Japanischen Kriege von 1905 ihren markantesten Ausdruck fanden. Aber das hochmütige kapitalistische Europa, für das alle noch nicht kapitalistischen Völker nur Objekt der Politik sind, als welches sich der freche Junker Jordan v. Kröcher einmal die deutsche Arbeiterklasse wünschte, wurde durch diese blutigen Kriege, diese tiefgreifenden Umwälzungen, nicht in seiner Meinung gestört, es handle sich hier nicht um Kriege, die europäische Völker gegeneinander auf das Schlachtfeld bringen könnten. Diese Legende vom friedlichen Kapitalismus wurde nicht einmal durch die Tatsache zerstört, daß die koloniale Ausbreitung der kapitalistischen Staaten in Afrika und Asien Gegensätze zwischen europäischen Mächten hervorrief, wie den englisch-russischen, den französisch-englischen, die zeitweise mit einem Kriege enden konnten. Dieser Glaube an den unzerstörbaren europäischen Frieden, der nur vom französisch-deutschen Gegensatz bedroht zu sein schien, wich dem Bewußtsein, daß Europa in ein Zeitalter akuter Kriegsgefahr eingetreten ist, als das Einschwenken Deutschlands ins Fahrwasser des Imperialismus sich im Bau einer Kriegsflotte äußerte, als England, die älteste Kolonialmacht, vor der ihr seitens Deutschland drohenden Gefahr zu zittern begann. Der deutsch-englische Gegensatz, der Gegensatz zwischen dem alten, satten kapitalistischen Räuber und dem jungen, wolfshungerigen, zerstörte in einem Augenblick die unsinnige Mär vom kapitalistischen Lämmlein. Als die Niederlage Rußlands im Kriege mit Japan den englisch-russischen Gegensatz in Asien schwächte, weil sie die Vorstoßkraft Rußlands gelähmt hat, kam der deutsch-englische Gegensatz mit einem Ruck in die vordere Linie. Und seit diesem Moment weicht die Kriegsgefahr auf keinen Augenblick. Wo nur eine Feuersbrunst entsteht oder auszubrechen droht, sei es in Marokko, oder in der Türkei, da zeigen sich auf der Vorderszene die zwei zivilisierten Mächte, Deutschland und England, bis auf die Zähne gerüstet, und man weiß nicht, ob der Kampf wilder Berberstämme gegen ihren Sultan, der sie ans Ausland wie alte Hosen verhandelt, oder der Kampf der türkischen Truppen gegen die Araber, denen die Höhe der jungtürkischen Kultur durch die Vortrefflichkeit der Kruppschen Kanonen vordemonstriert werden soll, nicht mit dem englisch-deutschen Kriege endet. Durch ein weitverzweigtes System von Bündnissen sorgen Deutschland und England dafür, daß ihre Auseinandersetzung sich in einen Weltkrieg auswächst. Der deutsch-österreichisch-italienische Dreibund und der englisch-französisch-russische Dreiverband, das sind die Lager, in die die kapitalistische Welt geteilt ist, und die sich tagtäglich in Kriegslager verwandeln können. Einmal zerstreut, kehren die Kriegswolken wieder zurück, und von Zeit zu Zeit beweist ein Wetterleuchten, daß verwüstende Stürme im Anzuge sind. Zweimal hielt der Marokkostreit Europa in Atem, das zweite Mal schon drohte ein Weltbrand aus den Wirren in der Türkei zu entstehen, und viele andere Kriegsherde gibt es noch.
Mit unverhüllbarer Angst sieht die kapitalistische Welt den Gefahren entgegen, die sie heraufbeschworen hat; aber sie ist nicht imstande, sie zu bannen. Wie blind wandelt sie an den Abgründen. Mit lodernder, wachsender Entrüstung blickt das Proletariat auf das verruchte Treiben, das seine Not noch vergrößern, seine Leiden ins Unermeßliche steigern soll. Aber es will nicht, wie die Bourgeoisie, den Dingen freien Lauf gewähren. Im Kampfe gegen den Kapitalismus lernte es, sein eigenes Los zu schmieden, und es sucht auch der Kriegsgefahr Herr zu werden. Aus seinem Kampfe gegen den Kapitalismus weiß es, daß man nur die Elemente zu überwältigen und zu beherrschen imstande ist, deren Quellen und Triebkräfte man kennt. Darum sucht es zuerst den Grund der nichtnachlassenden Kriegsgefahr kennen zu lernen. Auch der oberflächlichste Blick auf die Geschichte der letzten Jahrzehnte sagt ihm, daß der Gegenstand der Konflikte, die den Frieden bedrohten, das Streben nach Besetzung von unentwickelten Ländern (Kolonien) war, die fern von Europa, von ganz fremden Völkern bewohnt, den Appetit der kapitalistischen Regierungen reizten. Nicht um eine Angliederung eigener Volksteile, die sich unter fremder Herrschaft befinden, ging es den Staaten, sondern um Unterjochung fremder Völker, um Verwandlung ihres freien Bodens in ein Gebiet, auf dem der europäische Kapitalismus schalten und walten konnte. Was erklärt diesen Drang, diesen Kampf um unentwickelte fremde Länder, diese Sucht, sie in kapitalistische Kolonien zu verwandeln? Die Antwort auf diese Frage wird auch zeigen, warum das Proletariat fremd, ja feindlich diesem Bestreben gegenüber stehen muß.
1. Kapitalistische Verdunkelungsversuche.
Es ist klar, daß dieser allgemeine Kampf um kolonialen Besitz, der ohne Rast geführt wird unter steter Bedrohung des Friedens, allgemeine Ursachen haben muß. Das Kapital und seine Verfechter nennen eine Reihe solcher Ursachen: sie sprechen von der Übervölkerung der alten kapitalistischen Länder, von der Notwendigkeit der Zufuhr von Rohstoffen, ohne die die Industrie nicht existieren könne. Und wo diese Gründe nicht verfangen, dort greifen sie zu hochklingenderen Redensarten. Sie sprechen von dem Recht, ja von der Pflicht der höheren Zivilisation, sie den unentwickelten Ländern beizubringen.
Es genügt, die Stichhaltigkeit dieser Argumente kurz zu prüfen, um einzusehen, daß es sich hier um Scheinargumente handelt, die die wahren Ursachen des kapitalistischen Ausbeutungsdranges verschleiern sollen. Wenn sich die Verfechter der kapitalistischen Kolonialpolitik auf die immer wachsende Zahl der Bevölkerung berufen, die auswandern müsse, so fragen wir sie: ja, warum kolonisiert denn Frankreich, dessen Bevölkerungszuwachs sehr klein ist, und dessen Kolonien größtenteils von Untertanen anderer europäischer Staaten besiedelt werden? In Algerien M. Schanz: Algerien, Tunis, Tripolitanien. Verlag: Angewandte Geographie, Frankfurt a. M.(S. 37, 134). hat Frankreich 7 Milliarden Francs verpulvert, und es gelang ihm dort insgesamt 364 Tausend Franzosen unterzubringen. Diese Zahl kann aber erst in ihrer wahren Bedeutung erfaßt werden, wenn man sich erinnert, daß sie nach 70 Jahren algerischer Politik Frankreichs erreicht worden ist, und daß sie eine große Anzahl naturalisierter Spanier, Italiener und Eingeborener enthält. Noch ärger ist es um Tunis bestellt: dort beträgt die Zahl der Franzosen nach dreißig Jahren französischer Herrschaft nur 24 000, während die der Italiener 83 000, der Maltaneser 12 000 beträgt M. Schanz: Algerien, Tunis, Tripolitanien. Verlag: Angewandte Geographie, Frankfurt a. M.(S.37, 134).. Dabei liegen beide Länder dicht vor Frankreich. Diese Zahlen beweisen, daß Frankreich kolonisiert, obwohl es über keine genügende Zahl von Kolonisten verfügt, wozu noch in Betracht gezogen werden muß, daß die französischen Militärkreise jeden französischen Auswanderer als eine militärische Schwächung Frankreichs betrachten, weil Frankreichs Bevölkerung sich fast gar nicht vergrößert, während die deutsche stark zunimmt.
Schon dies würde beweisen, daß die Ursache der Kolonialpolitik nicht in zu großem Wachstum der Bevölkerung besteht. Würden aber auch alle Länder, die kolonisieren, einen starken Bevölkerungszuwachs, ja sogar eine starke Auswanderung besitzen, so könnte das nicht als Triebkraft der modernen Kolonialpolitik angesehen werden. Denn erstens hängt es ganz von den Umständen ab, ob ein starker Bevölkerungszuwachs eine Auswanderung notwendig macht. Als Deutschland noch ein Agrarland war, mußten jahraus jahrein Zehntausende proletarisierter deutscher Bauern, die in Deutschland keine Arbeit finden konnten, übers Meer wandern, obwohl Deutschland damals eine viel kleinere Bevölkerung hatte, als jetzt. Die deutsche Auswanderung betrug in den Jahren 1831 bis 1840 177 000, von 1841–1850 485 000, von 1851–1860 1 130 000, von 1861–1870 970 000, von 1871–1880 595 000. Roscher: Kolonien, Kolonialpolitik und Auswanderung, Leipzig 1885 (S. 377). Obwohl seit dieser Zeit die deutsche Bevölkerung stark zugenommen hat – im Jahre 1871 betrug sie nur 41 Millionen, im Jahre 1880 45 Millionen, im Jahre 1890 49 Millionen, im Jahre 1900 56 Millionen und im Jahre 1910 64 Millionen, – sinkt die Auswanderungszahl in den nächsten Jahrzehnten: in der Zeit vom Jahre 1891 bis 1900 beträgt sie noch 529 869, und in dem letzten Jahrzehnt nur 269 4418 Statistisches Jahrbuch für 1911 (S. 29).. Die deutsche Kolonialpolitik beginnt also just in einer Epoche, wo trotz der starken Bevölkerungszunahme, die in der rapid wachsenden Industrie Beschäftigung findet, die Auswanderung abnimmt. Schon dies beweist, daß zwischen dem Drang des deutschen Kapitals nach kolonialer Ausbreitung und dem deutschen Bevölkerungszuwachs kein Zusammenhang besteht. Daß die deutschen Kolonien für die noch existierende deutsche Auswanderung überhaupt nicht in Betracht kommen, beweisen die folgenden Zahlen Statistisches Jahrbuch für 1911 (S. 29).. Es wanderten aus, nach:
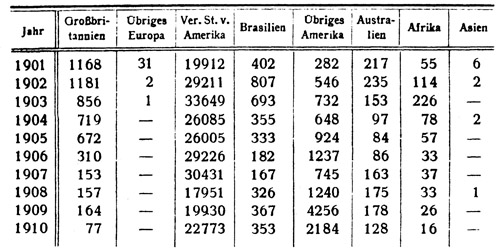
Von 269 441, die in dem letzten Jahrzehnt aus Deutschland ausgewandert sind, begab sich in die jetzigen Kolonialländer (Asien und Afrika) die »stattliche« Zahl von 596 Auswanderern. Und das ist natürlich: die deutschen Auswanderer, Arbeiter, Kleinbürger, wandern in Länder aus, wo sie guten Lohn finden, und das ist in erster Linie Amerika. Die deutschen Kolonien aber eignen sich nicht für die Entwicklung der Industrie; sie haben weder Kohle, noch Eisen, und in der überwiegenden Mehrheit sind sie schon aus klimatischen Gründen für den dauernden Aufenthalt von Europäern nicht geeignet. In die deutschen Kolonien wandern also nur mehr oder weniger kapitalkräftige Elemente aus, die dort als Plantagenbesitzer, Farmer und Händler Profit zu ergattern suchen. Was von dem Argument der Kolonialpatrioten überhaupt zu halten ist, beweist die Tatsache, daß das deutsche Kapital jährlich ungefähr 1½ Millionen ausländischer Arbeiter heranzieht, um die vom deutschen Proletariat erreichte Lohnhöhe niederzudrücken. Dabei soll dieses aber geneigt sein, Kolonien zu gründen und um ihretwillen die Gefahr von Kriegen auf sich zu nehmen, nur um die jetzige, oder zukünftige Arbeiterschaft von den Entbehrungen der Auswanderung in fremde Länder zu retten! Glaube das, wer selig sein will! Aber selbst unter den bürgerlichen Professoren, die sich das größte Verdienst um die Verbreitung dieses Märchens über die Triebkräfte der deutschen Kolonialpolitik erworben haben, findet man Leute, die den Schwindel offen entlarven. So schrieb der Kieler Professor Bernhard Harms, der sich speziell mit den Fragen der Weltwirtschaft befaßt, aus Anlaß der Marokkokrise, in der der abgerittene Gaul des Bevölkerungszuwachses wieder mal abgehetzt wurde: »Es ist meines Erachtens ganz überflüssig, davon überhaupt zu reden, denn im Interesse Deutschlands liegt es, die Masse seiner Bevölkerung im Lande zu behalten, um vermöge seiner größeren Zahl von hier aus seine Macht spielen zu lassen. Unsere künftige Stellung unter den Weltvölkern wird sehr erheblich durch die Zahl der Menschen bedingt, die wir im gegebenen Augenblick aufraffen können. Hätten wir heute schon achtzig bis neunzig Millionen Einwohner in Deutschland, so gäbe es vermutlich gar keine Marokkofrage. Die wirtschaftlich mit so großen Vorteilen verbundene exponierte Lage Deutschlands ist für uns solange ein Glück, als wir durch unsere militärische Macht im Herzen Europas ein unbedingtes Übergewicht haben« Deutsche Revue, Oktober 1911..
Durch das Bevölkerungsargument versuchen sich die Verfechter der deutschen Kolonialpolitik als die größten Volksfreunde aufzuspielen. Demselben Ziel dient das zweite Argument, durch das sie die Notwendigkeit der Kolonialpolitik nachzuweisen suchen. Die deutsche Industrie könne nicht ohne Zufuhr überseeischer Rohstoffe bestehen. In der deutschen Einfuhr machten die Rohstoffe und Lebensmittel im Jahre 1898 80, im Jahre 1908 83 Prozent aus. Diese kolonialen Rohstoffe könnten »wir« selber in Kolonien erzeugen, wenn wir solche in genügender Zahl hätten; dadurch wäre nicht nur die deutsche Industrie von einem Tribut an das Ausland befreit, nicht nur würde die Gefahr, daß uns diese Zufuhr eines Tages gesperrt, wie auch, daß uns die Preise willkürlich diktiert würden, verschwinden, es würde auch eine Verbilligung der Lebensmittel und aller Waren eintreten, zu deren Produktion die teuren ausländischen Rohstoffe nötig sind. Rührend, wenn es wahr wäre! Aber die Statistik und die Nationalökonomie sagten etwas anderes, als das Märchen der Kolonialpatrioten.
Erstens, wie steht es mit unserem Bezug von Rohstoffen? Kommen sie größtenteils aus fremden Kolonien? Nur zu einem sehr kleinen Teile! Ein Blick in die Statistik zeigt, daß es nicht Kolonien sind, aus denen die deutsche Industrie ihre Rohstoffe bezieht. Die deutsche Einfuhr betrug im Jahre 1910 8934,1 Millionen, wovon auf Europa, Amerika, den australischen Bund und Neuseeland (auch diese Länder darf man nicht als Kolonien betrachten, da sie fast selbständig sind und nach eigenen Interessen regiert werden) 7661,5 Millionen entfallen. Von den übrigen 1272,6 Millionen, die sich auf die Einfuhr aus Afrika, Asien und Polynesien verteilen, muß man wenigstens die 36 Millionen der japanischen Einfuhr abziehen, da Japan doch ein selbständiger kapitalistischer Staat ist. Es bleibt also von den ca. 9 Milliarden deutscher Einfuhr, in der die Rohstoffe und Lebensmittel 80 Prozent ausmachen, nur 1 Milliarde 236 Millionen übrig, die aus dem Handel mit allen Kolonialländern Asiens und Afrikas gewonnen werden. In dieser Ziffer ist schon die deutsche Einfuhr aus China (über 94 Millionen) enthalten, und wir wollen ihr auch die aus der Türkei zurechnen, da ja nicht ausgeschlossen ist, daß die beiden Länder, obwohl jetzt unabhängig, noch Objekt der Kolonialpolitik bilden können. Wenn wir also zu den schon gewonnenen 1236 Millionen noch 67 Millionen der Einfuhr aus der europäischen, asiatischen und afrikanischen Türkei zurechnen, erlangen wir die Summe von 1303 Millionen, also keine anderthalb Milliarden und nicht einmal den sechsten Teil der deutschen Einfuhr.
Das wichtigste dabei ist, daß die der deutschen Industrie notwendigsten Lebensmittel und Rohstoffe, Weizen und Baumwolle, nur zu einem winzigen Teil aus den Kolonialländern bezogen werden. So wird die Baumwolle Die Baumwollfrage. Denkschrift des Kolonialamtes. Jena 1910, Verlag Fischer. nur für 73 Millionen von Ägypten, ca. 46 von Britisch Indien, aber für 406 Millionen von den Vereinigten Staaten Nordamerikas, also von einem kapitalistischen Lande, bezogen. Diese Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten, die auf dem Baumwollmarkt fast ein Monopol besitzen – macht das europäische Kapital sehr oft zum Opfer der willkürlichsten Preisspekulationen.
Aber die Kolonien können dagegen nicht helfen. Das deutsche Kapital versucht zwar in Togo, Kamerun und Ostafrika den Baumwollbau einzuführen, es trifft aber dabei auf schier unüberwindliche Schwierigkeiten. Es ist bisher nicht gewiß, ob nicht die klimatischen Verhältnisse alle Versuche des Anbaues von Baumwolle in den deutschen Kolonien aussichtslos machen, es ist aber sicher, daß sich ihnen die sozialen Verhältnisse der deutschen Kolonien entgegenstemmen. Bei den Negern selbst ist die Arbeitsteilung so wenig entwickelt, daß es undenkbar ist, sie ihrer Arbeit an der Hervorbringung der Lebensmittel zu entreißen und sie zu bewegen, sich gänzlich der Baumwollkultur zu widmen. Würde das aber gelingen, so würde die Notwendigkeit, für sie Lebensmittel in die Kolonien einzuführen, den Preis der kolonialen Baumwolle so erhöhen, daß der Baumwollbau sich unrentabel zeigen würde. Und es ist fraglich, ob er sich selbst bei der Unterstützung der Regierung entwickeln würde, denn er erfordert nicht nur eine viel höhere Kulturstufe, als die, auf der sich die Neger trotz 25 jähriger deutscher Herrschaft befinden, sondern jede größere Preisschwankung auf dem Baumwollmarkte entmutigt die Neger so, »daß – wie die Denkschrift über die Entwicklung der deutschen Kolonien im Jahre 1909 hervorhebt – alle diese Zusicherungen und Bemühungen (Geldbelohnung für Fleiß, Versicherung der Mindestpreise) indessen nicht imstande waren, die Bedenken der Eingeborenen ganz zu beseitigen«. Noch schlechter steht es um den Plantagenbetrieb. Die Neger sind in Ostafrika noch Grundbesitzer und haben ihre Verwandtschaftsorganisation noch beibehalten. Es ist sehr schwierig, sie zu überreden, sich auf den Baumwollplantagen schinden zu lassen. Dabei wohnen sie großenteils in dem nordwestlichen Teil Ostafrikas, während die Küstengebiete am meisten für den Plantagenbau geeignet sind. Der Arbeitermangel besteht also schon jetzt, was würde erst sein, wenn die Baumwollernte den Umfang des deutschen Bedarfs – 2 Millionen Ballen – hätte, also 200 000 Leute erfordern müßte. Die zwangsweise Abordnung der Neger zur Arbeit, für die die Kolonialschriftsteller in den verschiedensten Formen eintreten, würde den Baumwollbau nicht weiter bringen, sondern Aufstände hervorrufen. Die deutschen Kolonialkreise sind sich auch dieser Aussichtslosigkeit gut bewußt: das geht schon aus der Tatsache hervor, daß die Regierungsdenkschrift über die Baumwollnot keine Abhilfemittel vorzuschlagen weiß; und welche Stimmung in den kolonialen kapitalistischen Kreisen herrscht, malt ein bekannter Kolonialschriftsteller mit folgenden Worten aus: »Es läßt sich nicht leugnen, daß das vor drei und zwei Jahren, ja im vorigen Jahre sehr große Interesse für den Baumwollbau in den deutschen Kolonien bedeutend nachgelassen hat. Die Gründe dafür sind darin zu suchen, daß der auf Eingeborenen-Kultur in Togo gegründete Baumwollenbau sich als Fehlschlag erwiesen hat, auch die mit großen Hoffnungen ins Werk gesetzten Plantagengründungen die hoch gespannten Erwartungen nicht erfüllt haben, die vor drei und zwei Jahren gehegt wurden.« (Emil Zimmermann im »Reichsboten« vom 7. Januar 1911.) Wenn trotzdem die Baumwollfrage immer wieder angeschnitten wird, ja selbst die deutschen Arbeiter aufgefordert werden, auch ihre Groschen beizutragen, damit sie bei zwecklosen Versuchen verpulvert werden, so hat dieses zwei Gründe: erstens hilft das Baumwollgeschrei den Anschein erwecken, als treibe man Kolonialpolitik im allgemein-wirtschaftlichen und nicht im rein kapitalistischen Interesse, zweitens erzeugt man dadurch Stimmung für den Eisenbahnbau in den Wüsteneien Afrikas, ohne welchen diese zwecklosen Versuche mit den Baumwollkulturen nicht durchführbar sind. Aus dem Eisenbahnbau aber, der aus den Steuern des deutschen Volkes in Afrika gefördert wird, fließen dem Kapital gesalzene Profite zu!
Besser noch als dieses Beispiel zeigt das Verhalten des deutschen Kapitals in dieser Frage die Schwindelhaftigkeit des Rohstoffarguments. Während die Kolonialschriftsteller Wagen von Papier zur Darlegung der Bedeutung deutscher Kolonien für die Versorgung Deutschlands mit Rohstoffen verbrauchen, fällt es dem deutschen Kapital nicht im Traume ein, sich für die koloniale Rohstoffproduktion besonders zu erwärmen. »Zwar hatte schon Bismarck im Jahre 1889 den Plan eines kolonialen Baumwollbaues erwogen – schreibt der Handelsredakteur des »Berliner Tageblattes« O. Jöhlinger Otto Jöhlinger: Die wirtschaftliche Bedeutung unserer Kolonien, Berlin 1910, S. 81. – es gelang indes damals noch nicht, die beteiligten Kreise von der Notwendigkeit zu überzeugen, und die bereits unternommenen Schritte der Regierung mußten ohne tatkräftige Beteiligung der nächsten Interessenten zunächst ergebnislos bleiben.« Und später? Bis zum Jahre 1907 kümmerte sich das deutsche Kapital, mit Ausnahme einiger Lieferanten, um die Kolonien sehr wenig. Für die Baumwollkulturversuche brachte es nach der Regierungsdenkschrift über die Baumwollfrage bis Ende 1909 insgesamt 1.7 Millionen Mark auf. Und dabei hausiert man mit der Behauptung, von der Lösung dieser Frage hänge das Los der deutschen Textilindustrie ab!
Und es kann auch nicht anders sein. Erstens könnten die deutschen Kolonien nach Berechnungen kolonialfreundlicher Schriftsteller Geheimrat Wohltmann im » Tropenpflanzer« (1909, Nr. 1). vielleicht erst nach hundert Jahren den Rohstoffbedarf Deutschlands decken. Auf einen solchen Zeitraum geben aber die Kapitalisten aus eigener Tasche sehr wenig, sie wollen den Profit sofort haben; zweitens sind sie zu gute Geschäftsleute, um nicht zu wissen, daß der Preis der Rohstoffe nicht in Windhuk oder Dar-es-Salam, sondern auf dem Weltmarkte bestimmt wird, daß also die Rohstoffe aus deutschen Kolonien ihnen ebenso teuer oder billig zugestellt werden, wie die ausländischen Rohstoffe. Das deutsche Kohlen- und Roheisen-Syndikat beweisen durch ihre Praxis genügend, daß sie sich ebenso gut auf die Verteuerung der Rohstoffe verstehen, wie die New Yorker Baumwollbörse.
Wenn aber die Kolonialfexe von der Verbilligung der Lebensmittel durch billige Zufuhr aus den Kolonien sprechen, so sollten sie damit nicht einmal den einfältigsten Deutschen zu ködern versuchen; als ob es keine deutschen Junker gäbe mit ihrem Brotwucher. Und daß die deutschen Junker gar nicht gewillt sind, sich den aus deutschen Kolonien bezogenen Lebensmitteln gegenüber anders zu verhalten, als den aus Amerika und Rußland eingeführten, bewiesen sie vollends durch ihre Stellungnahme zu den Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung Südwestafrikas. Die »Deutsche Tageszeitung« wandte sich in schärfster Form gegen alle, die Deutsch-Südwestafrika zur Viehausfuhr entwickeln wollten.
Wenn die beiden »Begründungen« der Kolonialpolitik auch nichts als Irreführung waren, so erforderte doch ihre Widerlegung ein Eingehen auf die ihnen zugrunde liegenden Tatsachen. Das dritte Argument der Verfechter der Kolonialpolitik, das in besonders feierlichen Momenten herbeigeholt wird, die Berufung auf das Recht der höheren Zivilisation, kann sehr kurz abgetan werden. Kapitalistische Staaten stellen Organisationen dar zur Niederhaltung des Volksaufstieges zu höherer Kultur. Niemand weiß das besser als die deutsche Arbeiterklasse, die jedes Atom Kultur im Kampfe gegen die kapitalistischen Kulturträger hat erringen müssen, und sie weiß auch, daß die Kultur, die das deutsche Kapital den wilden Völkern bringen will, Ausbeutung und Unterdrückung bedeutet. Peters, Arenberg, General Trotha, das sind die Träger der deutschen Kultur in den Kolonien. Angesichts dessen klingt die Berufung der Kolonialpolitiker auf das Recht der höheren Zivilisation wie Hohn in den Ohren der Arbeiter. Man kann mit dieser Behauptung Backfische irreführen, aber nicht die deutsche Arbeiterklasse, der Jahrzehnte ernsten, mühevollen Kampfes um die Kultur schon soviel Einsicht in den Charakter des Kapitalismus beigebracht haben, daß sie weiß: wenn das Kapital von Kultur zu sprechen beginnt, so dient das gewiß zur Verdeckung eines besonders guten Geschäftes.
Die kapitalistischen Kolonialfreunde verdunkeln nur den Charakter der Kolonialpolitik. Die kurze Prüfung der Argumente der Kolonialpolitik überhaupt, und der deutschen im besonderen, wie sie von bürgerlichen Schriftstellern gegeben wird, zeigt, daß man die Wurzel der Kolonialpolitik nicht in den allgemeinen Interessen der Gesellschaft und noch weniger in denen der Volksmassen finden kann. Das ist schon durch die Tatsache ausgeschlossen, daß die Träger der Kolonialpolitik eben die schlimmsten Gegner der Arbeiterklasse sind. Lockoutfabrikanten und Brotwucherer, Bureaukraten, die das Volk auf Schritt und Tritt schurigeln, Militärs, die immer wieder nach dem Niederwerfen der »revolutionären Kanaille« schreien, kurz die Spitzen der kapitalistischen Gesellschaft sind es, die sich für Kolonialpolitik am heißesten ins Zeug legen. Werden also nicht ihre Wurzeln in den Interessen dieser Klassen zu finden sein? Darauf bekommen wir am leichtesten eine Antwort, wenn wir uns die Entwicklungstendenzen des Kapitalismus, wie er heute schaltet und waltet, vor Augen führen.
2. Die Triebkräfte des Imperialismus.
Die ungeahnte Entwicklung des Kapitalismus, der in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts in Europa ein Land nach dem anderen erobert, Nordamerika allmählich aus einem Agrar- in ein Industrieland verwandelt, beruht auf einer Entfaltung von Produktivkräften, deren Grenzen überhaupt nicht vorauszusehen sind. Eine technische Erfindung nach der andern hilft die Naturkräfte in den Dienst der Produktion stellen, und mit allen ihren Mitteln ausgerüstet, besiegt die kapitalistische Industrie das Handwerk, die bäuerliche Hausarbeit. Sie reiht den proletarisierten Handwerker in die Armee ihrer Sklaven ein, gesellt ihm den proletarisierten Bauer zu, rottet die Reste der Naturalwirtschaft aus und schafft sich einen inneren Markt. Das Kapital triumphiert. Es gibt außer ihm keinen Gott mehr auf Erden, und alle alten Mächte paktieren mit ihm und dienen ihm. Aber bald zeigt es sich, daß der Altar des kapitalistischen Baal auf einem Vulkan steht, und daß seine Priester leicht in die Luft fliegen können. Die Produktionskräfte wachsen schneller, als der Markt, der die Produkte der kapitalistischen Industrie verschlingen soll, damit der von der Arbeiterklasse erzeugte Mehrwert als blankes Gold – und nur dieses ist Gegenstand der kapitalistischen Sehnsucht – in die Schränke der Hohepriester des Kapitals zurückkehren kann. Die Kaufkraft der Arbeiter, die sich für kargen Lohn abmühen, wächst sehr wenig, da ungeachtet aller kapitalistischen Faseleien die Lage des Arbeiters immer eine schlechte, wenn nicht trostlose bleibt; einen je größeren Teil der Gesellschaft die Arbeiterklasse ausmacht, desto enger werden die Schranken der Markterweiterung, solange der Kapitalismus besteht. Die Entwicklung der Technik aber nimmt auf diese Sorgen des Kapitals keine Rücksicht. Bevor eine neue Erfindung gehörig ausgenützt ist, erscheint eine zweite auf der Oberfläche – und wehe dem Kapitalisten, der sich der alten bedient: er produziert zu teuer, verkauft mit Verlust. Die riesig gewachsenen Produktionskräfte überschwemmen den Markt mit Waren, die keinen Käufer finden. Es ist aber unmöglich vorauszusehen, welche Masse von Waren der Markt fassen kann, wieviel produziert wird, weil es keine Organisation der Produktion gibt, und man immer aufs Geratewohl produziert, je mehr, desto besser, weil angesichts der wachsenden Konkurrenz nur bei vergrößerter Stufe der Produktion Erniedrigung der Produktionskosten eintritt. Das Resultat dieser Entwicklung sind die Krisen. Es wird anarchisch produziert, mehr produziert, als der Markt fassen kann, es muß also ein Moment eintreten, wo die Stockung beginnt. Die Waren finden keinen Absatz; ihr Preis stürzt, der Kredit wird verteuert. Die Vernichtung ungeheurer Massen von Werten ebnet den Weg für die weitere Entwicklung der Produktion. Zertrümmerte kleinere Unternehmungen, die die Krise nicht überstehen konnten, eine Unmenge von Leiden der Arbeiter, die keine Arbeit fanden und darbten, während die Industrie keinen Absatz für ihre Waren fand, dies alles bezeugt, daß in der kapitalistischen Gesellschaft nicht Menschen über die ökonomische Entwicklung walten, sondern daß sie blinden Kräften unterliegen. Die Leiden der Arbeiterschaft bilden die geringste Sorge des Kapitals. Die Arbeiterklasse ist doch noch schwach, unaufgeklärt, unorganisiert und sieht in ihren Leiden Naturereignisse, Fügungen Gottes. Aber die anderen Folgen der Krisen, die sich den Taschen der Kapitalistenklasse fühlbar machen, reizen zur Abwehr. Das Kapital sucht eine Organisation der Produktion durchzuführen, um die Überproduktion zu verhüten, und wenn das nicht geht, die hohen Preise trotz der Überproduktion aufrechtzuerhalten. Es schafft Vereinigungen, die den Markt unter den einzelnen Mitgliedern verteilen, die die Höhe der Preise bestimmen und mit hohen Strafen jene Fabrikanten belegen, die sich erfrechen, billiger abzusetzen, als die andern. Aber die Kapitalistenklasse stößt hier auf ein ernstes Hindernis. Was würde ihm die Gründung von Trusts und Kartellen helfen, wenn fremdes Kapital dank den immer billigeren Transportkosten in ihre Domäne eindringen könnte. Ist das ausländische Kapital in der Lage, in den einheimischen Markt einzudringen, dann würde die Gründung der Kartelle und Trusts nur ein Mittel sein, den Markt für die fremde Wareneinfuhr freizuhalten. Darum schreit das Kapital nach Schutzzöllen, die sein Ausbeutungsgebiet – es nennt es gefühlvoll nach alter Sitte Vaterland – mit einem Wall vor dem Eindringen fremder Waren schützen. Wo schon Schutzzölle aus der Zeit bestehen, in der sie die wenig entwickelte Industrie vor der Konkurrenz der stärkeren, ausländischen schützen sollten, dort fordert man ihre Beibehaltung und Erhöhung, obwohl man der fremden Konkurrenz vollkommen gerüstet gegenübersteht. Der Schutzzoll hat jetzt eine Aufgabe: er soll dem Kapital die Möglichkeit geben, nach freiem Ermessen die Preise zu steigern. So bilden die Trusts und Kartelle eine Macht, die zur Einführung der Schutzzölle, zu ihrer Erhöhung führt, und diese wieder sind die Fittiche, unter welchen diese Ausbeutungsinstitutionen ihr Unwesen treiben können. Aber auch das hilft nur eine Zeitlang. Die technische Entwicklung, die Aufspeicherung immer größerer Kapitale treibt zur Ausbreitung, zur Erweiterung der Produktion. Was aber mit ihren Erzeugnissen tun? Das Kapital wirft sie zu billigen Preisen, manchmal ohne Profit, auf fremde Märkte. So kommt es in die Lage, die Produktionskosten niederzudrücken, und die hohen Preise im Inlande entschädigen es für die profitlose Verschleuderung eines Teils der Erzeugnisse auf den ausländischen Märkten. Aber auch diese Politik der Kartelle kann nicht für immer Abhilfe schaffen. Die Kapitalistenklasse des Auslandes kann sich durch dieselben Maßregeln ihrer Haut wehren, auch sie versteht es, sich mit einer Schutzzollmauer zu umgeben, die Erzeugnisse des Arbeiterschweißes auf fremden Märkten zu verschleudern. Es gilt, auf anderen Wegen dem immer wachsenden Kapital großen Profit zuzuführen. Im Kapitalexport findet man die Lösung der Frage. Die Kapitalkönige borgen den Regierungen der weniger entwickelten, kapitalarmen Länder Geld, damit sie nach dem Muster der großen Staaten Armeen schaffen, Bahnen bauen, eine moderne Verwaltung ausbilden können. Rußland, die Balkanstaaten, die südamerikanischen Staaten, die Türkei, China, sie alle greifen mit vollen Händen in die Taschen des westeuropäischen Kapitals, sie lassen sich Bedingungen vorschreiben, bei denen dem Kapital ungeheure Zinsen zufließen, sie verpflichten sich, die ihnen zur Ausrüstung ihrer Armeen, zum Eisenbahnbau nötigen Waren nur bei ihren Gläubigern zu bestellen. So kehrt das ausgeführte Kapital als Zinsen, als Warenbestellungen in die Taschen des europäischen Kapitals zurück, seine Macht ungeheuer erweiternd. Zur Vertretung seiner so entstandenen Auslandinteressen wendet sich das Kapital an den Staat. Es kann auf seine Hilfe sicher rechnen.
Die Staaten Westeuropas, deren Wirtschaftsleben diese Entwicklung durchgemacht hat, blieben inzwischen nicht die alten. Sie haben sich zusammen mit dem Kapital gewandelt. Wurden sie früher von dem Großgrundbesitz, von den Dynastien, die selbst die größten Großgrundbesitzer des Landes waren, beherrscht, bedienten sie sich des Kapitals zu ihren Zwecken, so sind sie jetzt nur Diener des großen Kapitals. Denn ihm unterliegt jetzt das Land. Die überwiegende Masse der Bevölkerung ist jetzt nicht vom Grundbesitz abhängig, sondern vom Kapital. In seinen Fabriken arbeitet die Mehrzahl der Bevölkerung. Von ihm ist der Staat abhängig, denn ohne seine Hilfe kann er die Staatsmaschine nicht in Bewegung erhalten. Die technische Entwicklung, die jahraus, jahrein die Produktionsmittel umwälzt, beherrscht auch die Entwicklung des Heeres, des wichtigsten Machtorgans des Staates. Die alten Mordmaschinen müssen ebenso rasch neuen, besseren, teueren Platz machen, wie die anderen Maschinen, und die Konkurrenz der Großmächte auf diesem Gebiete ist noch größer, als die der Fabrikanten. Immer größer werden die Kosten, die die moderne Ausrüstung des Heeres erfordert. Und das Heer selbst wächst in demselben Tempo, wie die Bevölkerung, denn seitdem die französische Revolution zur Abwehr ihrer Errungenschaften vor dem Feudalismus Massenheere auf die Schlachtfelder geworfen hat, geht ein Staat nach dem andern von dem System der Söldnerheere zu dem mehr oder minder konsequent durchgeführten System der allgemeinen Wehrpflicht über. Und dieser Wandlung im Charakter der Heere gesellt sich die Wandlung in dem zweiten Machtmittel der kapitalistischen. Staaten zu: in der Bureaukratie. Der Staat greift jetzt in alle Winkel des gesellschaftlichen Lebens hinein. Er ist rege, mannigfaltig geworden, alle seine Teile greifen ineinander, fordern eine Regelung. Die Aufgaben der Bureaukratie wachsen gewaltig. Entspricht sie ihnen nicht, beherrscht sie nicht das ganze soziale Leben, so verliert sie die Macht. Und so treibt sie die Gesellschaft zu immer schnellerem Wachstum: das Heer der Bureaukratie schwillt fortwährend an.
Die Erhaltungskosten der Armee, der Bureaukratie werden immer größer, immer unerschwinglicher. Obwohl der moderne Staat alles zu besteuern sucht, obwohl er die Steuerlast immer mehr vergrößert, muß er zu Anleihen greifen. Die Staatsschuld wächst und mit ihr die Abhängigkeit der Regierungen vom Kapital, das die Anleihen deckt. Denn wie gewinnbringend auch diese Anleihen für das Kapital sind, es schlägt aus ihnen mehr heraus, als bloß den Profit: es gewinnt Macht im Staate. Mag die Regierung noch so feudal sein, mögen die Spitzen der Bureaukratie eine noch so große Verachtung für die bürgerlichen Emporkömmlinge empfinden, sie können ohne sie nicht auskommen, müssen ihnen dienstbar werden. Und das Kapital geniert sich nicht im Gebrauch der Regierungsgewalt: sie dient ihm zur Niederhaltung der Arbeiterklasse und muß es als ihre wichtigste Aufgabe betrachten, seine Interessen den zahlreicheren, wenn auch schwächeren bürgerlichen Schichten gegenüber zu bewachen. Der Willensvollstrecker des Kapitals im Innern, wird der kapitalistische Staat zum Hüter der kapitalistischen Interessen nach außen hin. Wie diese Interessen aussehen, haben wir schon geschildert. Welche Aufgaben übernehmen ihnen gegenüber die westeuropäischen kapitalistischen Staaten? Diese Aufgaben hängen ab von der Eigenart des borgenden Staates und den Bedingungen, unter denen seine Unterjochung durch das fremde Kapital stattfindet. Erstens muß es der unentwickelte Staat, der die Anleihe aufnimmt, als seine heiligste Pflicht betrachten, dem fremden Kapital pünktlich die Zinsen zu zahlen, selbst wenn er alle Pflichten, die er seinen eigenen Untertanen gegenüber hat, unerfüllt lassen müßte. Er muß dem fremden Kapital nicht nur die Zinsen pünktlich zahlen, sondern auch seinen Warenbedarf bei ihm decken. Und will er das fremde Kapital bei gutem Humor erhalten, so ist es notwendig, ihm die Landesreichtümer zu Spottpreisen zu verschleudern. Aber nicht immer kann die Regierung eines halbentwickelten Staates die übernommenen Pflichten erfüllen: der wachsende Steuerdruck, die Ausbeutung durch die Fremden, die wie Ungeziefer im ganzen Lande herumkriechen und an seinen Säften saugen, bringt in die bisher ruhig dahinlebenden Massen der eingeborenen Bevölkerung Bewegung hinein; sie leistet der eigenen Regierung Widerstand, zahlt die Steuern nicht, erhebt sich schließlich mit den Waffen in der Hand. In diesem Augenblick schlägt das europäische Kapital Alarm; es fordert von seiner Regierung Schutz seiner ökonomischen Interessen im fremden Lande und die Besetzung des letzteren.
Oder eine andere Möglichkeit. Das Kapital hat sich in einem wenig entwickelten Lande eingenistet. Es hat der Regierung desselben zu Wucherbedingungen Geld geborgt und fühlt sich jetzt dort wie zu Hause. Mit dem Geld gelang es dieser Regierung, ihre Machtmittel zu vergrößern, ihre Lage der Bevölkerung gegenüber zu befestigen. Sie will das ausnützen. Sie hat sich in der Welt umgesehen und weiß, was für Wucherzinsen sie dem fremden Kapital zahlt. Um ihre Last etwas zu erleichtern, beginnt sie dem fremden Kapital Schwierigkeiten zu machen, macht sie Miene nach der Art des Kapitals durch eine Pleite bessere Bedingungen erlangen zu wollen. Da kocht wieder die Seele des fremden Kapitals vor Entrüstung, es fordert von seiner Regierung, einen Druck auf die betrügerischen Barbaren auszuüben und ihnen beizubringen, daß die Zivilisation in erster Linie in dem Einhalten der übernommenen Verpflichtungen dem fremden Kapital gegenüber besteht. Oder noch ein anderer Fall. Das fremde Kapital ist ein allgemeiner Begriff. In Wirklichkeit werden die Geschäfte mit den Regierungen unentwickelter Länder von nationalen Gruppen des westeuropäischen Kapitals gemacht. Deutsche, englische, französische Kapitalisten versuchen in einem nach Kapital lechzenden Lande ihr Geld unterzubringen. Sie machen einander Konkurrenz, versuchen sich gegenseitig zu verdrängen. Jede nationale Kapitalistengruppe fordert von ihrer Regierung, daß sie mit ihrer ganzen Macht zur Unterstützung ihres Angebotes eintrete. Sie solle doch der borgenden Regierung zu verstehen geben, wie unangenehm sie ihr werden könne, wenn das Angebot der betreffenden Kapitalistengruppe nicht angenommen würde. So solle sie aufmerksam machen auf ihre militärischen Kräfte, auf die Dienste, die sie ihr anderen Mächten gegenüber erweisen könne.
In allen diesen Fällen muß die Regierung eines kapitalistischen Landes die Interessen ihres Kapitals dem borgenden Staate gegenüber vertreten. Einmal endet die Sache mit einem diplomatischen Druck, das zweite Mal mit einer militärischen Demonstration, das dritte Mal mit der Besetzung des Landes, mit seiner Angliederung an das Gläubigerland. So führt der Export des Kapitals in fremde, wenig entwickelte Länder, zu der sogenannten friedlichen Expansion, sehr oft zu ihrer Besetzung. An der goldenen Schlinge werden sie dem Gläubigerstaat näher gebracht, von ihm ausgebeutet, verlieren schließlich, wenn sie sich gegen die sie erdrückende Last erheben und besiegt werden, ihre Unabhängigkeit und verwandeln sich in eine Kolonie. Der Kapitalist weist seiner eigenen Regierung die Rolle zu, die die fremde nicht ausführen konnte oder wollte.
Aber das ist nicht der einzige Weg, auf dem die Kolonien entstehen. Oft muß das Kapital die Regierung seines Landes anfangs zur Besetzung eines Fleckens freier Erde bringen, bevor es an seine Ausbreitung schreiten kann. Kapital exportieren bedeutet: Häfen, Städte, Eisenbahnen in einem unentwickelten Lande bauen. Wenn aber das Land auf einer so niedrigen Stufe der Entwicklung steht, daß es überhaupt keine Staatsorganisation, oder eine so schwache besitzt, daß man ihr den Schutz des geborgten Kapitals überhaupt nicht anvertrauen kann, so muß das Kapital zuerst eine eigene Staatsorganisation dorthin übertragen, d. h. die Bevölkerung unterjochen und sich ihr Land aneignen. So sind z. B. alle deutschen Kolonien entstanden Natürlich läuft die Geschichte nicht in jedem kapitalistischen Lande in derselben Weise ab; es handelte sich aber bei dieser Darstellung nicht um die Entstehung der imperialistischen Politik in einem Lande – den Werdegang der deutschen werden wir noch speziell schildern –, sondern um eine Gruppierung der allgemeinen Triebkräfte des Imperialismus. Eingebender schildert sie Rudolf Hilferding in seinem Finanzkapital, Wien 1910 (S. 374–477), Otto Bauer in der Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, Wien. 1907 (S. 400–490), Parvus in seiner Kolonialpolitik und Zusammenbruch (Leipzig 1907), Kautsky in seiner Kolonialpolitik (Leipzig 1907).(Leipzig 1907).. Wir sehen nun, welche Kräfte zur Eroberung der Kolonien, d. h. zur imperialistischen Politik treiben. Um ihr Wesen aber besser zu erfassen, ist es nötig, genauer zu untersuchen, welche Interessen hinter dieser Politik stehen, und welche Schichten sie unterstützen.
3. Der Imperialismus und das Bürgertum.
Wir haben gezeigt, daß es die Interessen des kartellierten, vertrusteten Kapitals sind, die zur Gründung der Kolonien treiben, und die der Banken, die das Kapital in fremde Lander exportieren. Näher betrachtet sind das in erster Linie die Interessen der Eisenmagnaten und Großbanken. Das den Regierungen der unentwickelten Länder geliehene Kapital wird in erster Linie zum Ankauf von Kanonen, Gewehren, zum Bau von Festungen, Eisenbahnen verbraucht, es liefert also Bestellungen an die Magnaten der Hüttenwerke, Kanonenfabriken usw. Da der kapitalistische Staat, dessen Bourgeoisie Kapital exportiert, jederzeit bereit sein muß, ihr beizustehen, so muß er eine starke Flotte besitzen. Das gibt wieder denselben Zweigen der Industrie Beschäftigung, schafft ihnen einen immer wachsenden Warenmarkt, der desto lohnender ist, weil sie ihm die Preise diktieren können. Wie die Regierungen der vom fremden Kapital unterjochten Länder die Preise der Bestellungen annehmen müssen, wie sie von den Fabriken bestimmt werden, weil sie sonst die Anleihe nicht bekommen, so zahlt auch die heimische Regierung für ihre Schiffe und Kanonen, was man von ihr verlangt. Denn würde sie sich an fremde Fabriken wenden, so würde das Kapital Alarm schlagen, sie gefährde die Sicherheit des Landes; Konkurrenzunternehmungen gründen zu lassen, ist angesichts des ungeheuren Kapitals, das dazu nötig ist, nicht leicht, und alle für den Militarismus und Marinismus nötigen Sachen in eigener Regie fertigzustellen, ist schon darum nicht leicht möglich, weil der bureaukratische Betrieb noch teuerer ausfällt, als die gesalzenen Preise der Krupp. So sehen wir in der schweren Industrie, den Eisenproduzenten, den Waffenfabrikanten, den Reedereibesitzern die stärkste Gruppe der Nutznießer der imperialistischen Politik. Milliarden Mark stecken in ihren Riesenbetrieben. Aber nicht nur das macht ihre Kraft aus, da sie doch trotz ihrer Größe nur einen Teil des deutschen Kapitals darstellen: sie sind zusammengeschlossen, sie stehen in einem lang andauernden Verhältnis zur Regierung, wie es sich durch die Versorgung der Armee herausgebildet hat. Dazu kommt noch die Tatsache, daß hinter ihnen das Finanzkapital steht, bei dem die Regierung mit ihrer Staatsschulden-Politik tief in der Kreide sitzt. Das Finanzkapital steht aber hinter ihnen, weil es selbst zum guten Teil die schwere Industrie dirigiert. Ihr Umfang ist zu groß, als daß sie das Eigentum einzelner bilden könnte. Ihr Kapitalbedarf wächst zu schnell, zu enorm, als daß es aus dem von ihren Arbeitern erzeugten Mehrwert gedeckt werden könnte. Sie muß immer wachsenden Kapitalzufluß haben, und den besorgen die Großbanken. Sie sind also an der Entwicklung der schweren Industrie interessiert. Auch sein ureigenstes Interesse macht das Finanzkapital zum eifrigsten Anhänger des Imperialismus. Erstens nötigt die imperialistische Politik den kapitalistischen Staat zu immer stärkerer Schuldenmacherei, was den großen Banken sehr willkommen ist. Zweitens sind sie es doch, die den Export des Kapitals in fremde Länder vermitteln. Was daraus aber für sie herausspringt, mögen nur einige Beispiele beweisen. Wie die Anleihen des letzten ägyptischen Khediven aussahen, die später zur Besetzung Ägyptens durch England geführt haben, zeigt Th. Rothstein Th. Rothstein: Egypt's Ruin, London 1910 (S. 40). an folgendem Beispiel. Die Anleihe von 1873 wurde angeblich für 32 Millionen Pfund Sterling (640 Millionen Mark) zu 7 Prozent Zinsen und 1 Prozent Amortisation geschlossen. Die Banken, die diese Anleihe unterbrachten, gaben dem Khediven nur 20,7 Millionen Pfund und behielten die übrigen etwa 12 Millionen als Sicherstellung gegen Risiko. Damit nicht genug, zwangen sie ihn, 9 Millionen in Scheinen seiner eigenen schwebenden Schuld zum Kurse von 93 in Zahlung zu nehmen, obwohl die Anleihe eben zur Tilgung dieser Schuld bestimmt war und die Banken die Scheine zum Kurse von 65 erworben hatten. Um ein Beispiel aus jüngerer Zeit zu nennen, so haben die Banken, die den Bagdadbahnbau finanzieren, 100 Millionen Frank für die Vermittlung verdient und 180 Millionen Frank an den Baukosten gespart, die sie der Türkei übermäßig hoch angerechnet haben. So soll das Geschäft nach englischen Berechnungen aussehen; nach den Angaben des Direktors der Deutschen Bank sollen zwar die »Ersparnisse« an den Baukosten kleiner sein, aber der Vermittlerprofit wird auf 138 Millionen Frank angegeben The Nineteenth Century, Juni 1909. Arthur von Gwinner: The Bagdad Railway usw.. Bei der Anleihe, die der Sultan von Marokko im Jahre 1909 in der Höhe von 62 Millionen Frank abschloß, sackten die Banken 14 Millionen ein, bei der 110 Millionen Frank-Anleihe, die sie im vorigen Jahre untergebracht haben, »verdienten« sie für Vermittlung bei jeder 500 Frank-Obligation 71 Frank.
Wenn man bedenkt, wie groß die Macht der Großbanken ist, wie sehr die bürgerliche Presse, die bürgerlichen Parteien von ihnen abhängig sind, so kann man sich ein Bild machen von der Kraft, mit der sie ihre imperialistischen Interessen verfechten, sie zu allgemeinen Interessen des Kapitalismus, ja der Nation auszudehnen suchen. Aber hinter der imperialistischen Politik stehen noch ausgedehntere Interessen, als die der schweren Industrie und des Finanzkapitals. Wenn das Finanzkapital Armeen barbarischer Staaten ausrüstet, wenn es Bahnen in Anatolien oder China baut, so flicht es um diese Unternehmungen, die in erster Linie der schweren Industrie zugute kommen, einen Kranz von Unternehmungen, an denen verschiedene Zweige der verarbeitenden Industrie profitieren. Es reißt einen Teil der Eingeborenen-Bevölkerung von der Arbeit an der heimatlichen Scholle und läßt sie Landstraßen anlegen; es gibt ihr zwar kargen Lohn, aber für das Geld kauft die Bevölkerung europäische Waren. Der Bahn folgen Händler und kaufen den Bauern ihre Erzeugnisse ab, ziehen sie in die Wirrnisse des Warenverkehrs hinein. So erweitert sich der Kreis der industriellen Interessenten des Imperialismus.
Aber die imperialistische Politik findet Anhänger in noch weiteren Kreisen. Ihre eifrigsten Verteidiger findet sie in den Militärkreisen, denen sie ein Feld weiterer Betätigung öffnet. Das nähert ihr die Schicht des Kleinadels, der ursprünglich nicht kolonialfreundlich ist, weil doch die Kolonialpolitik in erster Linie im Interesse des Großkapitals geführt wird. Aber Adelssöhne sind es, die als Offiziere an der imperialistischen Politik interessiert sind, denn den jüngeren Söhnen des kleineren Adels winkt die Hoffnung, in den Kolonien, in die der Staat Millionen hineinsteckt, selbst mit einem kleinen Kapital sich emporzuarbeiten; zu Hause aber würden sie nur den Familienbesitz zersplittern und auf der väterlichen Klitsche nichts ausrichten können.
Damit ist der Kreis der direkten Kolonialinteressenten erschöpft. Kein Interesse haben an ihr die breiten Kreise der verarbeitenden Industrie und des Handels, die für den inneren Markt arbeiten oder aus dem Verkehr mit dem kapitalistischen Ausland ihren Profit ziehen. Sie sind der Zahl nach viel größer, als die für die Kolonien und die unzivilisierten Lander arbeitenden Teile der Industrie. Die imperialistische Politik erschwert ihre Entwicklung, weil sie den Schutzzoll verewigt, die Militärlasten vermehrt und den Weltmarkt immer wieder durch Kriegsgefahr beunruhigt. Aber sie sind nicht imstande, ihr Widerstand zu leisten, denn sie scheint ihnen die Politik zu sein, die auch ihren Interessen in der Zukunft entsprechen wird. Heute geht ? der deutschen Ausfuhr in kapitalistisch entwickelte Länder. Aber was wird der nächste Tag bringen, fragen alle Schichten der Bourgeoisie. Alle Länder entwickeln ihre eigene Industrie; werden sie nicht als Märkte in immer geringerem Maße für sie in Betracht kommen? Mögen die Kolonialländer heute noch so wenig entwickelt sein, gilt es nicht, sie zu entwickeln, damit sie später einen aufnahmefähigen Markt für die heimische Industrie bilden? Natürlich wird sich die Bourgeoisie aus Rücksicht auf ihre zukünftigen Interessen jetzt keine Unkosten machen, aber ihre Berücksichtigung genügt, um sie mit kolonialfreundlichem Geiste zu erfüllen, und das um so mehr, als die Koloniallasten zum größten Teil nicht ihr aufgebürdet werden. Den größten Teil des Budgets der kapitalistischen Staaten decken die Volksmassen durch indirekte Steuern. Und schließlich, wie kann das Bürgertum ohne den kolonialen Traum auskommen, was soll es dem aus den Volksmassen immer lauter erschallenden Ruf nach dem Sozialismus gegenüberstellen? Vor Jahrzehnten konnte es den Sozialismus unbeachtet lassen, als Utopie verlachen. Jetzt, wo die Vergesellschaftung der Arbeit durch die fortschreitende Beherrschung der Industrie durch das Finanzkapital, wo die Ausschaltung der Einzelunternehmer, ihre Verdrängung durch unpersönliche Aktiengesellschaften auf die Entwicklung der Produktion zur gesellschaftlichen Leitung, d. h. zum Sozialismus, hinweist, wo die immer wachsende Macht der Arbeiterklasse beweist, daß auch die Kräfte reifen, die diese Aufgabe aufnehmen können – was kann die Bourgeoisie dem Proletariat gegenüberstellen? Gibt es für sie noch eine andere Ausflucht als die, daß ihrer noch die große historische Aufgabe harrt, in die unzivilisierten Länder den Kapitalismus mit seinen Wundern der Technik hinein zu tragen? Was kann die Bourgeoisie dem Proletariat entgegnen, wenn es darauf hinweist, daß die Einengung der Absatzmärkte die alten kapitalistischen Länder vor Krisen und Erschütterungen stellen wird, in denen das vom Elend gepeinigte Proletariat zu einer anderen Organisation der Produktion greifen wird? Sie hat keine andere Zuflucht, als den Glauben an die Entwicklungsfähigkeit der Kolonien. Darum, mögen auch die breiten Kreise des Bürgertums keinen direkten Nutzen von den Kolonien haben, ja, mögen ihnen aus der imperialistischen Politik Schwierigkeiten erwachsen, sie werden sich doch im Schlepptau dieser Politik bewegen.
Auch für die gebildeten Schichten, die an der Produktion keinen Anteil haben und nur davon leben, was von den Tischen der Bourgeoisie abfällt, bildet der Imperialismus die einzige mögliche Ideologie, wenn sie, aus den Schlupfwinkeln ihrer Interesselosigkeit durch wichtige politische Ereignisse hervorgescheucht, sich in die Politik einmischen. Die Anbetung der starken rücksichtslosen Persönlichkeit, das ist die am stärksten verbreitete Weltanschauung dieser Kreise, die sich nur durch persönliche Tüchtigkeit hervortun können. Wo anders aber lebt sich jetzt die bürgerliche »Persönlichkeit« am rücksichtslosesten aus, wenn nicht in den Kolonien? Und wenn das graue, bürgerliche Leben den Intelligenzler anekelt, wo sieht er die Leute, die vor Abenteuern nicht zurückschrecken, die sich »ganz« ausleben, ohne Rücksicht auf die Sitten und Gesetze und die Heuchelei der Heimat? In den Kolonien! So nimmt der Imperialismus eine bürgerliche Schicht nach der anderen gefangen, er spannt sie vor seinen Wagen und feiert seinen Triumphzug durch die Welt.
Aus den Ländern des entwickelten Kapitalismus, aus England, Frankreich, Deutschland, dringt er in die Länder, in denen das Kapital noch schwach ist, in denen noch Raum ist für seine weitere Entwicklung, und erobert auch hier die Geister. Italien, Österreich, selbst das sieche Spanien sehen, wie die alten kapitalistischen Länder ein Stück Asiens und Afrikas nach dem anderen besetzen. Bald wird nichts mehr zu rauben sein. Sollen sie sich damit vertrösten, daß sie noch für Jahrzehnte mit sich selbst zu tun haben, werden nicht später dieselben Schwierigkeiten vor ihnen auftauchen, die den alten kapitalistischen Ländern heute schon drohend in den Weg zu treten beginnen? Das imperialistische Fieber ergreift auch sie und läßt sie eine Last auf sich nehmen, unter der sie schier zusammenbrechen.
So sehen wir den Imperialismus als die Politik, die den Interessen der schweren Industrie und eines Teiles der verarbeitenden, den Interessen des Finanzkapitals schon heute entspricht; die dem Kapital als die einzige Rettung vor den Schwierigkeiten erscheint, mit denen die weitere Entwicklung es bedroht; die die gebildeten Schichten der Bourgeoisie als einzige »ganze« Weltanschauung anzieht. Nicht mit den Interessen des Volkes, sondern mit denen des Kapitals in seiner letzten Entwicklungsphase ist die imperialistische Politik verknüpft. Sehen wir uns nun den Weg an, den sie in Deutschland zurückgelegt hat, um ihre Wirkungen und die von ihr heraufbeschworenen Gefahren würdigen zu können.
Als in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die kolonialpolitische Welle sich in Frankreich und England zu heben begann, stand Deutschland ohne jeden kolonialen Besitz da. Das Fehlen eines einheitlichen wirtschaftlichen Gebietes und einer zentralisierten Gewalt hatte es ihm im 16. und 17. Jahrhundert unmöglich gemacht, gleich Frankreich, England und Holland eine koloniale Tätigkeit zu entfalten, an die bei Beginn des Zeitalters der kapitalistischen Kolonialpolitik angeknüpft werden konnte. Als Deutschland schließlich durch die wirtschaftliche Entwicklung, sowie durch Blut und Eisen geeinigt wurde, hatten die besitzenden Klassen anfangs Wichtigeres zu tun, als auf kolonialen Raub auszugehen. Die Bourgeoisie begann sich in dem neuerbauten Reiche häuslich einzurichten, die Junker und die Regierung sorgten dafür, daß sie bei dem Umbau keine zu enge Unterkunft bekamen. Für das deutsche Kapital war die Eroberung von Kolonien damals eine fernliegende Sache. Es hatte noch in Deutschland viel Raum für seine Entwicklung, einen Boden, der vom französischen Milliardensegen befruchtet, von gierigen Händen aufgerissen, so umgerüttelt wurde, daß die giftigen Profitpflanzen nur so in die Höhe schossen. Und obwohl dieser wilden Spekulation bald eine Krise auf dem Fuße folgte, hatte die industrielle Entwicklung Deutschlands noch einen weiten Spielraum im Innern. Nach der wirtschaftlichen Krise vom Jahre 1874 wandten sich die Spitzen der kapitalistischen Welt zuerst dem Schutzzoll zu, dem ersten Heilmittel, das ihnen die Möglichkeit geben sollte, auf Kosten der Konsumenten und der verarbeitenden Industrie Extraprofite einzuheimsen. Weite Kreise der verarbeitenden Industrie hielten selbst angesichts der überstandenen Krise den Schutzzoll für unnötig: sie hatten noch Vertrauen in die heilenden Kräfte des Kapitalismus. Da sie keine Interessen in den kapitalistisch unentwickelten Ländern hatten, und ihr Handelsverkehr mit England und Amerika sich in stetem Aufstieg befand, hatte die Frage der Gewinnung von Kolonien selbst für diesen Teil des deutschen Kapitals, der für den Export produzierte, kein Interesse. Noch 1885 schrieb Robert Janasch, einer der ersten Befürworter der kolonialen Ausbreitung Deutschlands Deutsche Aufgaben in der Gegenwart in »Roschers Kolonien«, S. 371, Leipzig 1885.: »Unter unseren Kaufleuten sind es kaum wenige Hunderte, welche durch ihren Unternehmergeist, sowie durch die Art ihres Geschäftsbetriebes veranlaßt worden sind, sich eingehender über die Vorgänge auf den Gebieten der extensiven Kultur zu unterrichten, und welche das Bedürfnis fühlen, an denselben aktiv und zweckbewußt teilzunehmen. Der Einwand, daß der deutsche Kaufmann und Industrielle durch seine Beteiligung an dem so bedeutenden Export Deutschlands tatsächlich sein Interesse an dem internationalen Kulturleben bekunde, ist hinfällig, sobald man gewahrt, daß diese Beteiligung über die Grenzen der alltäglichen Routine spekulativ-merkantiler Tätigkeit nicht hinausreicht. Wo hat sich der Unternehmungsgeist und das Kapital der Börse, unserer großen Banken, das große Privatkapital Einzelner durch Erschließung überseeischer Märkte, durch koloniale Unternehmungen, durch Ausführung großer technischer Kulturwerke ersten Ranges, wie wir deren oben gedachten, betätigt? Und soweit dies ausnahmsweise der Fall gewesen, ist es in Verbindung mit ausländischen Unternehmern, im Dienste ausländischer Interessen geschehen. Während die englischen, ja sogar die französischen und belgischen Banken mit den großen überseeischen Märkten in unmittelbarer Verbindung durch ihre Filialen und Kartellbanken stehen, ist es uns bis jetzt noch nicht gelungen, für australische und viele der südamerikanischen Hauptplätze direkte Bankbeziehungen herzustellen, und die englische Vermittlung ist zurzeit noch unentbehrlich. Es ist eine wenig erfreuliche Tatsache, daß die 1870/71 von den deutschen Kriegsschiffen in den chinesischen Häfen entnommenen Kredite durch Vermittlung dortiger französischer Geldinstitute realisiert werden mußten! Daß unter solchen Verhältnissen der auf die Erwerbung überseeischer Absatzgebiete bedachte Unternehmungsgeist der deutschen Industriellen niedergehalten wird, bedarf keines weiteren Kommentars.«
Für die koloniale Ausbreitung traten nur einige Hamburger und Bremer Firmen ein, die Niederlassungen an der Westküste Afrikas und in der Südsee besaßen. Sie suchten die Regierung dafür zu gewinnen, ihren Handel zu unterstützen; denn sie wußten, daß die Regierung, einmal in ihre Händel hineingezogen, nicht mehr imstande sein würde, die Finger von ihnen zu lassen.
Bismarck Graf Ernst Reventlow: Was würde Bismarck sagen. Berlin 1909, S. 13–31. stand den Fragen der kapitalistischen Kolonialpolitik keinesfalls so fremd gegenüber, wie das oft behauptet wird. Schon sein durch den Sieg über Frankreich stark gehobenes Machtgefühl spornte ihn an, den anderen kapitalistischen Staaten auf diesem Gebiete nachzuahmen. Natürlich konnte mangels einer kolonialen Tradition in Deutschland, angesichts der Gleichgültigkeit des größten Teils des Bürgertums gegenüber den Kolonialunternehmungen und der noch größeren Verständnislosigkeit des Junkertums für eine so ausgesprochene kapitalistische Politik, wie die Kolonialpolitik, keine Rede sein von einem zielbewußten, weitblickenden Eintreten Deutschlands in die Bahnen der Kolonialpolitik. In der ersten Zeit nach der Reichsgründung konnte auch schon deshalb keine Rede davon sein, weil die auswärtige Politik Bismarck: Gedanken und Erinnerungen. Bd. 2, S. 239–287. Cottaische Ausgabe 1909. die Aufmerksamkeit Bismarcks in Europa festhielt. Die Verschiebungen in den Mächteverhältnissen, die der Gründung des Deutschen Reiches auf dem Fuße folgten, waren so groß, daß der Wunsch, Deutschlands internationale Lage zu stärken und sich die Errungenschaften des Sieges vom Jahre 1871 zu sichern, den ersten Platz in der Politik Bismarcks einnahm. Nach dem Frankfurter Frieden erblickte Rußland auf einmal an seiner Westgrenze an Stelle des schwachen zerklüfteten Deutschland das durch Blut und Eisen geeinigte starke Reich; Frankreich aber war schwächer, als es den Interessen des Moskowitenreiches entsprach. Als Deutschland auf dem Berliner Kongreß dem Zarismus nicht ohne jeden Vorbehalt die Stange halten wollte – Bismarck forderte zwar nur, daß Rußland ihm offen seine Wünsche klarlege, damit er sie ihm nicht von den Augen abzulesen brauche –, da verbarg die russische Regierung ihren Groll nicht. Sie verstieg sich zu direkten Drohungen an die Adresse ihrer bisherigen Berliner Mameluken: wenn Deutschland nicht ohne Widerrede die russischen Forderungen in der Orientfrage unterstützte, drohte sie Feindschaft an auf Leben und Tod. Das erklärte der Zar brüsk in einem Briefe an den Kaiser. Bismarck fürchtete, es könnte zu einem Bündnis zwischen Rußland und Frankreich kommen, das bei der noch blutenden elsaß-lothringischen Wunde zu einem Revanchekrieg führen könnte. Auch Österreichs Haltung bereitete ihm Sorge. Das vor Deutschland geheimgehaltene Reichsstädter Abkommen, in dem Rußland noch vor dem Türkisch-Russischen Kriege seine Zustimmung zur Einverleibung Bosniens und Herzegowinas durch Österreich, als Preis für die österreichische Neutralität während des bevorstehenden Krieges gab, weckte in Bismarck die Furcht, es könnte auch zu einem Einverständnis zwischen Österreich und Rußland über die Balkanfrage kommen, durch das Österreich im Bunde mit Rußland und Frankreich die Scharte von Königgrätz auszuwetzen in der Lage sein würde. Von bösen Träumen, Koalitionsträumen, geplagt, um das Wort Schuwalows zu gebrauchen, entschied sich Bismarck gegen das Bündnis mit Rußland, das Deutschland mit der ganzen Welt verfeinden und es Rußland auf Gnade und Ungnade ausliefern würde. Nachdem er über die Bündnisfrage bald nach dem Frankfurter Frieden in Wien sondiert hatte und der Einwilligung Österreichs gewiß war, mußte er noch den starken Widerstand niederringen, den der »Heldengreis« einer Abkehr von Rußland entgegenstellte. Die Familieninteressen – Kaiser Wilhelm war Oheim des Zaren –, der felsenfeste Glaube, daß nur die russische Knute für das Hohenzollernsche Gottesgnadentum in schlechten Zeiten Hilfe gewähren könnte, die höllische Angst vor der Macht des Zarismus, machten den Kaiser so widerspenstig, daß er sich seine Zustimmung nur durch die Rücktrittsdrohung des ganzen Kabinetts abringen ließ. Nachdem der Widerstand des Kaisers gebrochen war, stand nichts mehr dem Bündnis im Wege. Die bürgerlichen Parteien in Deutschland, obwohl überhaupt nicht befragt, äußerten lärmend ihr Einverständnis; in Österreich regte sich nur ein schwacher Unwille bei den slawischen Parteien; die Furcht vor den Machinationen Rußlands in Ostgalizien, vor einem Zusammenstoß mit ihm auf dem Balkan, war für die österreichische Regierung ausschlaggebend.
So entstand der österreichisch-deutsche Bund als Abwehrvertrag gegen Rußland. Die beiden Mächte gelobten sich Hilfe für den Fall, daß eine von ihnen durch Rußland angegriffen, oder daß Rußland einem dritten, sie angreifenden Staate seine Hilfe leihen würde. Deutschland wollte die Unterstützungspflicht auch auf den Fall eines französischen Angriffs ausdehnen, aber dafür war Österreich nicht zu haben.
Diesem Bündnis schloß sich nach langen Vorberatungen auch Italien an, obwohl bei ihm der Gegensatz zu Österreich wegen Welschtirol und Triest vorhanden war. Aber andere wichtige Momente bewirkten, daß das soeben erst geeinigte, mit Frankreich verfeindete Italien sich dem Bunde anschloß: es war die römische und die tunesische Frage.
Unter dem Einfluß der Klerikalen war Napoleon III. als Verteidiger der weltlichen Macht des Papstes aufgetreten. Als nach der Niederwerfung der Kommune in Frankreich die schwärzeste Reaktion ans Ruder kam, schien sie einen Kreuzzug gegen Italien wegen der Einverleibung Roms in das italienische Reich vorzubereiten. Dies verursachte noch vor dem Berliner Kongreß eine Annäherung Italiens an Österreich und Deutschland. Victor Emanuel reiste 1873 nach Wien und Berlin. Obwohl die auf dem Berliner Kongreß beschlossene Angliederung Bosniens und Herzegowinas an Österreich, bei der Italien keine »Entschädigung« bekam, Italiens Beitritt zum Dreibund im Jahre 1879 noch nicht perfekt werden ließ, so sorgte die damals neueinsetzende koloniale Betätigung Frankreichs dafür, daß der Beitritt Italiens nicht lange mehr auf sich warten ließ. Im geheimen Einvernehmen mit England – es war die Entschädigung für die Einnahme Cyperns durch England – und mit Deutschland – Bismarck sah gerne zu, daß Frankreich seine Kräfte außerhalb Europas beschäftigte, weil ihm dann keine für den Revanchekrieg übrig blieben – riß Frankreich Tunis an sich, auf das Italien schon lange Hoffnungen gesetzt hatte. Die außerordentliche Entrüstung der italienischen Bourgeoisie und der Militärkreise führte Italien endgültig dem Bunde zu. Sein Beitritt sicherte das Land vor Österreich und gab ihm die Unterstützung Deutschlands gegen Frankreich. So entstand der Dreibund.
Obwohl er die größten Befürchtungen Bismarcks bannte, blieb jedoch auch ferner das Hauptinteresse der auswärtigen Politik des Deutschen Reiches an den Mächteverhältnissen in Europa haften. Jedenfalls hatte Bismarck in größerem Maße als früher freie Hand auch für die koloniale Ausbreitung. Er wußte jedoch gut, daß Kolonialpolitik in erster Linie Geschäft ist, und daß sich kapitalistische Geschäfte ohne den Willen der Bourgeoisie überhaupt nicht machen lassen. »Um eine überseeische Politik mit Erfolg treiben zu können, muß jede Regierung in ihrem Parlament, soweit sie von ihm abhängig ist, soweit sie eine konstitutionelle Regierung ist, eine im nationalen Sinne geschlossene Majorität, eine Majorität, die nicht von der augenblicklichen Verstimmung einzelner Parteien abhängt, hinter sich haben. Ohne eine solche Reserve im Hintergrunde können wir keine Kolonialpolitik und keine überseeische Politik treiben,« so führte er im Jahre 1884 bei der Einbringung der Dampfer-Subventionsvorlage im Reichstage aus. Daß aber die Mehrheit der deutschen Bourgeoisie in ihrem Herzen noch keine Kolonialfreundlichkeit gefunden hatte, zeigte ihm die Haltung des Reichstags in der Samoafrage. Als im Jahre 1880 das Hamburger Handelshaus Godeffroy, das in der Südsee Handel und Plantagenbau trieb, in Bedrängnis geraten war und eine Aktiengesellschaft seine Interessen nur unter der Bedingung übernehmen wollte, daß die Regierung die Zinsgarantie gewährte, war Bismarck bereit, das zu tun, damit »der deutsche Name« durch den Untergang des Geschäftes nicht in schlechten Ruf gerate. Gegen die Stimmen der Junker, die immer dafür zu haben waren, wenn aus den Taschen des Volkes Parasiten gemästet werden sollten, und gegen einen Teil der Nationalliberalen, lehnte die Mehrheit des Reichstages, bestehend aus Freisinnigen, Zentrum, einem Teil der Nationalliberalen und den Sozialdemokraten, die Vorlage der Regierung ab, die der Aktiengesellschaft eine 3–4½-prozentige Zinsgarantie geben wollte. Noch vier Jahre später hat Bismarck erklärt: »Ich bin durch die Niederlage der Regierung in der Samoafrage lange Zeit abgehalten worden, etwas Ähnliches wieder vorzubringen.« Das entsprach aber nicht den Tatsachen: als er diese Worte sprach, befand sich sein kleiner Finger schon in den Krallen des kolonialen Teufels, der bald auch seine Hand umklammern sollte, obwohl die damaligen Interessen des deutschen Kapitals der Kolonien nicht benötigten und die auswärtige Lage des Reiches noch nicht ganz gefestigt war.
Wie schon erwähnt, standen Bremer und Hamburger Firmen in Handelsbeziehungen zu Westafrika. Deutsche Missionare hatten in Südwestafrika seit den sechziger Jahren gewirkt und den Boden für das deutsche Handelskapital vorbereitet. Das nützte die Bremer Firma Lüderitz aus, um dort eine Handelsfaktorei zu gründen. Sie kaufte von einem Eingeborenenhäuptling einen Landstrich an der Küste von Angra Pequena im Umfange von 900 deutschen Quadratmeilen. Die Regierung gewährte Lüderitz unter der Bedingung Schutz, daß seine Kaufrechte weder gegen die Eingeborenenrechte noch gegen die begründeten Ansprüche irgend einer Macht verstießen. Zu gleicher Zeit wandte sie sich an die englische Regierung mit der Anfrage, ob diese Anspruch auf die von Lüderitz gekauften Gebiete erhebe. Die englische Regierung antwortete, sie habe zwar keine Herrschaftsrechte in diesen Gebieten, aber sie erhebe auf die Küste zwischen der Kapkolonie und der portugiesischen Kolonie Angola Anspruch. Da Bismarck diese Antwort als völkerrechtlich unbegründet und als Beweis ansah, daß England auch in der Zukunft der kolonialen Ausbreitung Deutschlands Schwierigkeiten bereiten wollte, hielt er es für nicht vereinbar mit der Machtposition, die das Deutsche Reich seit dem Deutsch-Französischen Kriege eingenommen hatte, und telegraphierte am 24. April des Jahres 1884 – welcher Tag also als Tag der Gründung der deutschen Kolonialpolitik gelten kann – an den deutschen Konsul in Kapstadt, daß die Erwerbungen von Lüderitz unter deutschem Schutz standen, worauf die deutsche Flagge in Südwestafrika gehißt wurde. England gab nach und ermutigte dadurch Bismarck zum weiteren Zugreifen. Dies schien ihm um so angezeigter, als der russisch-englische Gegensatz in Mittelasien Englands Widerstandskraft gegenüber den kolonialen Gelüsten Deutschlands schwächte, während bei der weiteren Verzögerung der Kolonialerwerbungen damit zu rechnen war, daß in der nächsten Zukunft nichts mehr zu besetzen sein würde. Bismarck begnügte sich nicht mit Südwestafrika. Er nützte die Tatsache aus, daß sich in Kamerun und Togo einige deutsche Handelsniederlassungen befanden und daß deutsche Missionare dort die schwarzen Seelen für Gott und das Kapital bearbeiteten. Er wartete nicht mehr, bis sich die Firmen an die Regierung wandten, sondern spornte die Firmen Woermann, Jantzen, Thorwaldten zum Abschluß von Verträgen mit den Häuptlingen an der Küste Togos und Kameruns an. Nachdem dies geschehen war, wurde auch hier die deutsche Flagge gehißt Das Vorgehen Bismarcks ermutigte schneidige Abenteurernaturen, und so gründete Karl Peters, der in London die englische Kolonialpolitik studiert hatte, eine Deutschostafrikanische Gesellschaft, die an der Küste Ostafrikas von den Häuptlingen 2500 deutsche Quadratmeilen Land kaufte und erschacherte. Ähnlich ging es in Neuguinea zu, wo die »Deutsche Handels- und Plantagengesellschaft« und die Hamburger Firma Hernsheim Fuß gefaßt hatten. Einmal im Sattel, ritt Bismarck auch hier einen scharfen Trab. Der Widerstand Englands reizte ihn, und er gewährte auch diesen Privatunternehmungen Schutz für ihre territorialen Erwerbungen.
Die hier kurz skizzierte Geschichte der Erwerbung der deutschen Kolonien M. Koschitzky: Deutsche Kolonialgeschichte. Leipzig 1887, 2. Bd. zeigt, daß sie von keinen größeren ökonomischen Interessen getrieben worden ist. Eine kleine Schicht von Kapitalisten ging dem ihr winkenden Profit in weiten Ländern nach. Sie dachte nicht an die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands, nicht an alle die schönen Argumente, die jetzt von den Verfechtern der Kolonialpolitik ins Feld geführt werden. Da in dieser Zeit Frankreich und England in größerem Umfange Kolonialpolitik zu treiben begannen, fürchtete die deutsche Regierung, das deutsche Kapital würde, wenn es einmal Lust an Kolonialpolitik gewinnen sollte, keinen Happen mehr abbekommen. Sie griff also zu, planlos, ziellos, wo auch nur die kleinsten wirtschaftlichen Interessen des deutschen Kapitals ihrem Vorgehen einen Schein der Berechtigung lieferten. Und das Bürgertum, das anfangs keine Lust verspürte, sich in koloniale Nesseln zu setzen, stimmte in seiner Mehrheit dieser Politik zu. Den Vertretern des Großkapitals, den Nationalliberalen, leuchtete es ein, daß gewisse Elemente unter ihnen aus dieser Politik große Profite herausschlagen würden; das Zentrum sah in den Kolonien ein neues Gebiet für die Betätigung der Klerisei; den Konservativen winkten Beamtenstellen für ihre Söhne. Weitere Kreise der Bourgeoisie, die damals absolut kein Interesse an den Kolonien hatten, wurden für diese Einschwenkung in das Fahrwasser der Kolonialpolitik eingefangen durch eine rührige Propaganda, die seit einigen Jahren von einer Schar Ideologen, wie Fabri, Janasch, Hübde-Schleiden, getrieben wurde; das Bild der Reichtümer, die England aus seinen Kolonien herausholte, das Bild der Verluste an Menschen und Kapital, welches von der damals so massenhaften deutschen Auswanderung verursacht wurde, verfehlten ihre Wirkung nicht, um so mehr, als der nationale Katzenjammer, der angesichts der Fruchtlosigkeit des Sozialistengesetzes und des Kulturkampfes die Bourgeoisie ergriffen hatte, eine »nationale« Anspornung erforderte, wie sie von dem Trugbild der kolonialen Ausbreitung geliefert wurde. Wie unvorbereitet aber die Regierung für die übernommenen Aufgaben war, geht aus dem Standpunkt hervor, den Bismarck am 26. Juni 1884 im Reichstag vertrat: »Den Interessenten der Kolonie soll das Regieren derselben überlassen und ihnen, nur für Europäer, die Möglichkeit europäischer Jurisdiktion und desjenigen Schutzes gewährt werden, den wir ohne stehende Garnison leisten können. Ein Vertreter des Reiches, ein Konsul, wird die Autorität des Reiches wahren und Beschwerden entgegennehmen; Handelsgerichte werden weitere Streitigkeiten entscheiden. Nicht Provinzen sollen gegründet werden, sondern Unternehmungen mit einer Souveränität, welche dem Reiche lehnbar bleibt; ihre Fortbildung bleibt im wesentlichen den Unternehmern überlassen.«
Aber schon die nächsten Jahre zeigten, daß die Logik der Ereignisse größer war, als die Voraussicht der deutschen Regierung. In Südwestafrika sollten die Hoheitsrechte auf die »Deutsche Gesellschaft für Südwestafrika« übergehen, die aus eigenen Mitteln eine Truppe zu unterhalten die Pflicht hatte. Aber die Gesellschaft wollte die entsprechenden Kosten nicht tragen, und so wurde die Verwaltung vom Reiche übernommen. In Ostafrika brach im Jahre 1888 ein Aufstand der Eingeborenen aus, die durch die Erhebung der Zölle gereizt waren, und das Reich mußte alsbald mit Marine und Landtruppen eingreifen. Es verausgabte bis zum Jahre 1891 8½ Millionen Mark für die Niederwerfung des Aufstandes, worauf es auch diese Kolonie in eigene Verwaltung übernahm. Ähnlich ging es in Kamerun zu; und auch in den Kolonien, wo es zunächst zu keinen Aufständen kam, zeigte es sich, daß die privaten Gesellschaften weder die Lust noch die Möglichkeit hatten, die großen Kosten der Aufpfropfung eines staatlichen Mechanismus auf die primitiven Verhältnisse der unterjochten Völker zu tragen. Im Jahre 1895 gestand auch der Direktor der Kolonialverwaltung, Kayser, dem Reichstag, daß der bismarcksche Plan der Kolonialpolitik Bankrott erlitten habe. »Wir haben die Erfahrung gemacht«, führte er am 28. März 1895 aus, »daß die Zeit der privilegierten Kompagnien vorüber ist, und wir dürfen es heute wohl auch aussprachen, daß wir uns beim Beginn unserer Kolonialpolitik in einem großen Irrtum befunden haben, wenn wir annahmen, daß die Kompagnie, eine Privatgesellschaft, in der Lage sein könnte, staatliche Hoheitsrechte auszuüben. Heutzutage verlangen wir ja auch in den unzivilisierten Ländern und auch in unseren Schutzgebieten schon eine Art staatlicher Organisation mit einem gewissen Rechtsschutz, der unmöglich von einer Privatgesellschaft im vollen Umfange gewährt werden kann.«
Der Art, wie Deutschland zu seinen Kolonien kam, entsprach naturgemäß ihre Entwicklung. Nur da, wo das Kapital stürmisch Anlagesphären, Absatzgebiete heischt, nur da, wo es durch die Arbeit langer Jahre den Boden für seine zukünftige Kolonie vorbereitet, besteht die Möglichkeit des kolonialen Aufschwungs, natürlich, sofern die natürlichen Verhältnisse es erlauben. In den deutschen Kolonien fehlten alle diese Entwicklungsfaktoren. Mit Ausnahme Südwestafrikas handelte es sich um tropische Kolonien, in denen der dauernde Aufenthalt für Europäer nur auf einzelnen Hochebenen möglich war. Das Fehlen von schiffbaren. Flüssen fast in allen Kolonien erschwerte ihr Durchdringen. Der sehr niedrige Entwicklungsgrad ihrer Einwohner eröffnete nur geringe Aussichten für den Handelsverkehr. Wollte die Regierung bei diesen Verhältnissen noch andere Ansiedler als Beamte und Schutztruppen in die Kolonien bringen, so mußte sie dem Kapital Vorrechte Köbner: Einleitung in die Kolonialpolitik. Jena, Fischer 1909, S. 210–224. Dr. A. Zimmermann: Kolonialpolitik. 1905, S. 361–365. geben, die ihm die Kolonien direkt auslieferten. Der Neu-Guinea-Kompagnie wurde im Jahre 1885 das ausschließliche Recht verliehen, in dem Schutzgebiete »herrenloses« Land in Besitz zu nehmen und darüber zu verfügen, sowie Verträge mit den Eingeborenen über Land und Grundberechtigungen abzuschließen. Dasselbe Monopolrecht bekam die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft. Selbst als die Hoheitsrechte dieser Gesellschaft im Jahre 1890 auf die Regierung übergingen, wurde ihr ein weitgehendes Bodenmonopol verliehen. Erst im Jahre 1902 entäußerte sie sich dieser Vorrechte, die selbst nach amtlichem Urteil die Entwicklung des Schutzgebietes verhinderten. Ähnlich verhielt es sich mit dem Bergbau-Monopol in Südwestafrika. An fünf Gesellschaften wurden in Südwestafrika 32 Prozent des Gesamtflächeninhalts dieser Kolonie abgetreten. Selbst angenommen, daß dieser Boden wirklich unbewohnt war, was für einen großen Teil gar nicht zutrifft, selbst davon abgesehen, daß der Boden der Schwarzen verschenkt wurde von den offiziellen Verfechtern des Eigentums, so genügt nur daran zu erinnern, daß Südwestafrika das einzige Land ist, das sich für die Ansiedlung einer größeren Masse von Kolonisten irgendwie eignet. (Der bekannte blutige Kolonialpolitiker Peters Karl Peters: Zur Weltpolitik. Berlin 1911, Verlag Sigismund, S. 154 schätzt die Aufnahmefähigkeit dieser Kolonie auf 100 000 Kolonisten.) Angesichts dessen bedeutete diese Politik eine Besteuerung aller Ansiedler, die in Südwestafrika Farmen anlegen wollen, zugunsten der hinter der Kolonialgesellschaft stehenden Berliner Banken. Die Kolonialgesellschaften nahmen die ihnen gemachten Millionengeschenke an, aber es fiel ihnen nicht ein, das Land zu erschließen. Sie forderten, daß ihnen der Staat mit dem Bahnbau vorangehe, ohne den in den Kolonien überhaupt nichts zu erreichen sei. So blieben denn die Kolonien in einem Zustande der Stagnation und waren weder als Rohstoffland noch als Absatzgebiet von irgend welchem Wert für die deutsche Industrie. Eine spärliche Anzahl von Farmern, die in ihnen Glück suchten, einige Handelsfaktoreien, die die Eingeborenen mit Schnaps und Waffen versorgten, aus Deutschland eingeführte Assessoren, die die preußische Kunst der Bevormundung aller hier einzuführen suchten, eine Handvoll Offiziere und Missionäre – das waren die glorreichen Pioniere der deutschen Kolonialpolitik. Die Frucht eines vom Baume des deutschen Kapitalismus zu früh abgebrochenen Zweiges, der, auf einen unfruchtbaren Boden verpflanzt, seine Kräfte nicht entfalten konnte, waren die deutschen Kolonien vom ersten Tage ihrer Gründung an wurmstichig. Nur eine Pflanze schoß üppig in den deutschen Kolonien hervor: die Pflanze der Verrohung. Jener Beamte Leist, der im Jahre 1894 in Kamerun durch seine Barbareien Aufstände der Eingeborenen provozierte, sein Nachfolger, der Assessor Wehlau, der Leute für Diebstahl mit dem Tode bestrafte, Peters, der seine schwarze Geliebte aufknüpfen ließ – diese in kurzer Zeit aufeinander folgenden Kolonialskandale zeigten deutlicher als der gänzliche Stillstand der Kolonien, daß die deutsche Kolonialpolitik nur die Ausbeutung und Unterdrückung verstärkt hat. Von einer Entfaltung der Produktivkräfte in den Kolonien war keine Rede. Was Wunder also, wenn selbst in den kapitalistischen Kreisen, die an der Mißwirtschaft in den Kolonien nicht direkt interessiert waren, in dem letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts keine Kolonialfreundlichkeit herrschte?
1. Von der Kontinentalpolitik zur Weltpolitik.
Die ersten Erfahrungen, die Deutschland mit seinen Kolonien gemacht hatte, waren nicht geeignet, den Kolonialenthusiasmus der Regierung zu wecken. Sie sah in England eine Verstimmung wegen der deutschen Kolonialpolitik entstehen; schon die ersten Schritte Deutschlands entlockten dem englischen Minister des Auswärtigen, Lord Granville, die Behauptung, Deutschland wolle England nötigen, auf die Aktionsfreiheit in kolonialen Angelegenheiten zu verzichten. Gleichzeitig trat es immer klarer zutage, daß die Gründung des Dreibundes Gegenbemühungen geschaffen hatte, die auf eine Annäherung der französischen Republik an den russischen Zarismus hinarbeiteten. Zwar gelang es Bismarck im Jahre 1887 diesen Bestrebungen die Spitze abzubrechen, indem er einen Vertrag mit Rußland abschloß, nach dem Deutschland und Rußland, falls eines von beiden von irgend einer Seite angegriffen würde, einander wohlwollende Unparteilichkeit zusicherten. Aber das Streben Rußlands, sich in Ostasien auszubreiten, eine Folge des Zurückweichens des russischen Einflusses im nahen Osten, und die Notwendigkeit, seine Rüstungen zu modernisieren und aus strategischen Gründen neue Bahnen zu bauen, trieb es in die Arme Frankreichs, dessen Geldmarkt eine stärkere Anziehungskraft auf Rußland ausübte, als der viel ärmere deutsche Markt. Die offensichtliche Annäherung Rußlands an Frankreich, wie verschiedene militärische Maßnahmen an der russisch-österreichischen Grenze kühlten das Verhältnis zwischen Deutschland und Rußland ab. Wilhelm II., der kurz vorher den Thron bestiegen hatte, suchte durch die Stärkung des Dreibundes, den er in seiner Antrittsrede im Reichstag ein »heiliges« Vermächtnis nannte, und durch eine Annäherung an England die europäische Position Deutschlands zu stärken. Diese Bemühungen führten zu zweierlei Ergebnissen: im Jahre 1890 wurde der sogenannte Sansibarvertrag mit England geschlossen, und im nächsten Jahre war das französisch-russische Bündnis fertig.
Im Sansibarvertrag wurde das Werk, das die kühnen imperialistischen Draufgänger unter der Leitung Karl Peters begonnen hatten, zerstört. Peters war es durch Geld und Drohungen gelungen, die von ihm im Jahre 1885 erworbenen Gebiete weit nach Norden auszudehnen, so daß sie von Sansibar bis zu den Quellen des Nils Deutschland gehörten. Diese neuen Erwerbungen, das Sultanat Witu, Uganda (das doppelt so groß ist wie Bayern) fiel jetzt England zu. Als Entschädigung bekam Deutschland die Insel Helgoland, von der aus die Engländer bisher die Mündungen der Elbe und der Weser beherrschen konnten. Heute besitzt Helgoland für den deutschen Imperialismus die Bedeutung eines stark befestigten Stützpunktes gegen die eventuellen Versuche Englands, die deutschen Küsten während eines Krieges zu blockieren. Die Entwicklung der Unterseeboote, der Funkentelegraphie und der Seeminen haben Helgoland diese Bedeutung gegeben. Zurzeit des Abschlusses des Vertrages mit England bedeutete das Geschäft den Eintausch eines Hosenknopfes gegen eine Hose – wie sich der imperialistische Geschichtsschreiber A. Wirth A. Wirth: Weltgeschichte der Gegenwart. Wien 1910, S. 40. drastisch ausdrückt. Denn Helgoland besaß für England keine große Bedeutung, was schon aus der Bemerkung des englischen Premiers hervorging, im Kriegsfalle könne Deutschland eine Streitmacht auf die Insel schicken vor Ankunft einer englischen Ersatzflotte. Daß auch die deutsche Regierung bei diesem Austauschhandel sich nicht so sehr von der hohen Einschätzung Helgolands, als von dem Wunsche nach guten Beziehungen zu England hat leiten lassen, ging ganz ausdrücklich aus der Denkschrift hervor, in der Caprivi, der Nachfolger Bismarcks, den stark angefeindeten Vertrag verteidigte. »Allem voran stand das Bestreben, unsere durch Stammesverwandtschaft und durch die geschichtliche Entwicklung beider Staaten gegebenen guten Beziehungen zu England weiter zu erhalten und zu befestigen und dadurch dem eigenen Interesse, wie dem des Weltfriedens zu dienen.« Diese guten Beziehungen, führte die Denkschrift weiter aus, seien insbesondere darum notwendig, weil die kolonialen Bestrebungen Deutschlands Reibungen zwischen den beiden Staaten hervorgerufen hätten, die der allgemeinen Politik Deutschlands nicht bekömmlich wären. Deutschlands kolonialer Besitz sei nicht wertvoll genug, daß seinetwegen ein Hader zwischen England und Deutschland entstehen sollte. Die Abtretung großer Kolonialgebiete an England wurde zum Schluß mit folgendem Bekenntnis erklärt: »Die Periode des Flaggenhissens und des Vertragschließens muß beendet werden, um das Erworbene nutzbar zu machen. Es beginnt jetzt die Zeit ernster, unscheinbarer Arbeit, für welche voraussichtlich auf ein halbes Jahrhundert ausreichender Stoff vorhanden sein wird« Beweggründe zu dem deutsch-englischen Abkommen vom 1. Juli 1890..
Das deutsch-englische Abkommen war ein Ausdruck der Tatsache, daß die deutschen Kolonien in den Augen der deutschen Regierung noch keine größere Bedeutung hatten, daß sie jahrzehntelang an keine neuen Kolonialerwerbungen denken wollte, daß sie die Fragen der Weltpolitik den Schwierigkeiten ihrer europäischen Lage unterordnete. In diesem seinem Charakter gab das deutsch-englische Bündnis einen Ansporn zur Ausbreitung der imperialistischen Bewegung in Deutschland. Aus der Empörung über die Abtretung des kolonialpolitisch als sehr aussichtsreich geltenden Uganda an England entstand der Alldeutsche Verband, die Kampforganisation des deutschen imperialistischen Gedankens, die eine rührige Agitation für die imperialistische Machtpolitik entfaltete, der sie im krassen Nationalismus eine ideologische Ausstattung gab. Durch die Agitation des Alldeutschen Verbandes suchten die Nutznießer des Imperialismus Anklang in weiteren Schichten des Bürgertums zu finden und die Regierung auf die Bahnen des Imperialismus zu drängen.
Ein ähnliches, wenn auch unvorhergesehenes Ergebnis hatte das deutsch-russische Verhältnis im Gefolge. Dieses Verhältnis war schon seit der Gründung des Deutschen Reiches ins Wanken geraten. Einerseits sah die deutsche Regierung seit jeher im Zarenreich dem ihrem Charakter am meisten entsprechenden Verbündeten, andererseits aber konnte sie sich dem Zaren nicht so bedingungslos ausliefern, wie das vor der Einigung Deutschlands der Fall gewesen war. Als nun das französisch-russische Bündnis zustande kam, suchte die deutsche Regierung nach einer Gelegenheit, um sich Rußland wieder zu nähern. Neben einem »Erbfeind« an der Westgrenze konnte es einen Feind an der Ostgrenze nicht ertragen, obwohl es ununterbrochen seine Militärausgaben steigerte. Diese betrugen im Jahre 1872 553, im Jahre 1875 584, im Jahre 1887/88 632, im Jahre 1890/91 854 Millionen Mark Bebel: Die Sozialdemokratie im Deutschen Reichstage. Berlin 1909, S. 437..
Die Gelegenheit zu einer Annäherung an Rußland, die den Übergang Deutschlands zur Weltpolitik einleiten sollte, gaben die ostasiatischen Wirren. Trotz der Siege Englands und Frankreichs über China, die die erste Bresche in die chinesische Mauer legten, galt das Riesenreich in den Augen der europäischen Mächte als ein Koloß, mit dem anzubändeln sehr gefährlich sei. Der Sieg Japans über China im Kriege von 1895, der um Korea entbrannt war, zeigte die Verlotterung des chinesischen Militärs, die Fäulnis der Verwaltung Chinas und rollte die Frage von der Herrschaft über den Stillen Ozean auf » Die chinesische Frage« von Pierre Leroy-Beaulieu. Leipzig, Wigand, J., 1900, S. 95–149. Rußland, das sich seit den neunziger Jahren immer mehr daran erinnerte, daß es eine asiatische Macht sei und nach einem eisfreien Hafen im Stillen Ozean strebte, sah sich durch die Vormachtstellung Japans bedroht. Die russische Haltung wurde durch Frankreich unterstützt, das in den Flitterwochen seines Bündnisses mit dem Zarenreiche durch dick und dünn mit ihm ging. Deutschland nahm die Gelegenheit wahr, um durch einen »ostasiatischen Dreibund«, d. h. durch ein gemeinsames Vorgehen mit Rußland und Frankreich die Gefährlichkeit des französisch-russischen Bündnisses für die Machtstellung Deutschlands abzuschwächen. Es schloß sich also der Flottendemonstration Frankreichs und Rußlands gegen Japan an und übte zusammen mit diesen Mächten einen Druck auf Japan aus. Die Folge dieser Aktion war, daß Japan die wertvollere Hälfte seiner Beute, Port Arthur, die Halbinsel Liaotung, an China zurückgab und sich mit der Insel Formosa und einer Kriegsentschädigung von 600 Millionen Mark begnügte. Natürlich wollte Deutschland aus seiner Einmischung in die ostasiatischen Wirren mehr als die Verbesserung seines Verhältnisses zu Rußland herausschlagen. Wie die Diplomatie anderer Staaten, nahm auch die deutsche an, daß die Niederlage Chinas im Kriege mit Japan den Anfang vom Ende der chinesischen Unabhängigkeit bedeute. In diesem Glauben wurde sie durch die inneren Wirren bestärkt, die in China nach dem Kriege entstanden. Daß sie das Erwachen von Elementen bedeuteten, die Chinas Entwicklung beschleunigen könnten, war ein zu tief eindringender Gedanke, als daß die deutsche Diplomatie ihn hätte fassen können. Die deutsche Regierung begann sich mit dem Gedanken an eine Festsetzung in China vertraut zu machen. Ein Teil des mit allen Schätzen der Natur ausgestatteten Reiches, mit seiner arbeitsamen Bevölkerung hatte auch in den Augen der Bourgeoisie eine Anziehungskraft, wie sie keine tropische Kolonie haben konnte. Zwar konnte man sich bei diesem Unternehmen nicht auf die Übervölkerung Deutschlands berufen, weil China selbst dicht bevölkert ist. Aber die Aussichten, die der chinesische Markt der deutschen Industrie zu eröffnen schien, hatten in den Augen der Bourgeoisie eine um so größere Bedeutung. Betrug doch die deutsche Ausfuhr nach China, die in den Jahren 1881 bis 1885 erst 11 Millionen Mark betragen hatte, in den Jahren 1886 bis 1890 auf 19 Millionen Mark gestiegen war, im Jahre 1895 schon 31 Millionen Mark; die Einfuhr aus China war in derselben Zeit von 11 auf 50 Millionen Mark gestiegen Nauticus: Jahrbuch für Deutschlands Seeinteressen für 1900. Siehe Abhandlung: Die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands in China, S. 248–273.. Und welche Aussichten eröffneten sich den Banken, wenn Deutschland in China Fuß fassen würde: der Eisenbahnbau, der Hafenbau würde in diesem kultivierten Reiche in einem ganz anderen Tempo fortschreiten, als in den Sandbüchsen und Sümpfen Afrikas. Als nun die Nachricht kam, daß in der Provinz Schantung zwei deutsche Missionäre getötet waren, besetzte die deutsche Regierung, die jahraus jahrein duldete, daß deutsche Bürger an der russischen Grenze niedergeknallt wurden, »zur Sühne« der Verbrechen am 14. November 1897 den Hafen Kiautschau. Sie nützte » den gewünschten Anlaß« aus, wie der nationalliberale Geschichtsschreiber Egelhaaf G. Egelhaaf: Geschichte der neuesten Zeit. Berlin 1910, S. 394. sich offenherzig ausdrückt. Mit der Pachtung des chinesischen Hafens trat Deutschland endgültig in die Bahnen der Weltpolitik ein.
Dasselbe Einschwenken ins Fahrwasser des Imperialismus vollzog sich auch in einem anderen Brennpunkte der Weltpolitik: im nahen Osten. Die neuzeitlichen deutsch-türkischen Handelsbeziehungen J. Kraus: Deutsch-türkische Handelsbeziehungen. Jena 1901. – W. Kind: Die Zukunft unseres Seehandels. – Nauticus 1907: Das Wirtschaftsleben in der Türkei und seine Beziehungen zu der deutschen Volkswirtschaft., die kurz nach der Kontinentalsperre angefangen hatten und über Wien gegangen waren, verminderten sich seit den dreißiger Jahren. Die Dampfschiffahrt, die damals aufkam und viel billiger als der Landverkehr war, lag zuerst ganz in englischen Händen, was den alten Vorsprung Englands im Levantehandel noch vergrößerte. Als später deutsche Schiffe von der Nordsee her durch das Mittelmeer nach Konstantinopel zu gehen begannen, waren sie angesichts der politischen und maritimen Schwäche Deutschlands bis in die sechziger Jahre viel mehr als die französischen und englischen der Gefahr ausgesetzt, durch die marokkanischen, algerischen und tunesischen Piraten beraubt zu werden. Die Tatsache, daß Deutschland gar keine Rolle in den großen Entscheidungen über die Geschichte des Orients, im Krimkrieg und bei der Auseinandersetzung von 1877 gespielt hatte, verminderte auch die Chancen der deutschen Konkurrenz. Erst nach dem Berliner Kongreß beginnt die deutsche Industrie ihren Platz in der Türkei zu erobern. Von Einfluß war hier nicht nur das Wachsen des Ansehens des deutschen Kapitals nach der Einigung des Reiches, nicht nur sein allgemeiner rapider Aufschwung, sondern in erster Linie der Bau der vom Baron Hirsch begründeten Bahnlinien in der europäischen Türkei (1874 bis 1888) und der Bau der anatolischen Bahnen durch deutsche Banken, der den Orient mit den Erzeugnissen der deutschen Industrie bekannt machte. Das Aufkommen verschiedener Gesellschaften, die sich die Pflege des Orientexportes zur speziellen Aufgabe machten, wandte die Aufmerksamkeit des deutschen Kapitals dem Orient zu. Nicht ohne Einfluß war dabei die Bestechung der Presse, die die Bahnkonzessionäre, wie Baron Hirsch, in großem Maße betrieben (Hirsch gab 101,8 Millionen Franken von 356,4 für die Preßreklame seiner Türkenlose aus Paul Dehn: Deutschland und die Orientbahnen. München 1883.). Die beiden Kaiserreisen nach der Türkei vom Jahre 1888 und 1898 waren also schon ein Ausfluß dieses gestärkten Interesses des deutschen Kapitals für die Türkei und ebneten ihm ihrerseits die Wege durch Anknüpfung neuer politischer Beziehungen zum Orient. Der neue Kurs unterstützte diese sich anbahnende Änderung des Verhältnisses des deutschen Kapitals zu der Türkei, indem er sich zum Schutzherrn des absolutistischen Hamidschen Regiments aufwarf und ihm seine aktive diplomatische Beihilfe während der armenischen Greuel und des Griechisch-Türkischen Krieges gegen England gewährte. Der Erfolg dieser Politik war die Erteilung der Bagdadbahnkonzession durch den Sultan (in provisorischer Form im Jahre 1899) an ein deutsches Kapitalisten-Konsortium, das sich um die Deutsche Bank gruppiert. Diese Bahn mußte zusammen mit den anatolischen Bahnen ein gewaltiges Instrument des deutschen wirtschaftlichen Einflusses in der Türkei und dadurch des politischen Anrechtes auf das türkische Erbe werden, sobald es zur Aufteilung der Türkei kommen sollte. Daß aber diese zu den nahen Möglichkeiten gehörte, glaubte man vor zwölf Jahren allenthalben. Der Plan der Ausführung der Bagdadbahn stieß daher auf um so größere Hindernisse, als diese Bahn eine momentane Stärkung des türkischen Staates herbeiführen mußte. Denn sie ermöglichte rasche Truppentransporte, die zwar nach der damaligen Meinung nicht imstande sein konnten, die Auflösung der osmanischen Macht zu verhüten, doch aber den Aufteilungsprozeß erschweren und verlangsamen mußten. Gerade das entsprach aber eben den Interessen des jungen deutschen Imperialismus, der bei der Aufschiebung der Aufteilung inzwischen an Kräften zu gewinnen hoffte.
Der deutsche Ausbreitungsdrang hatte jetzt Ziele vor sich, für die sich weite Kreise der Bourgeoisie begeistern konnten. Und die Begeisterung für Weltpolitik wurde durch den Anblick des Zusammenbruchs alter Kolonialländer, und des Aufkommens neuer angespornt. Im Jahre 1898 verschwindet das alte Spanien aus der Zahl der Kolonialmächte, und das junge Amerika, einst selbst eine Kolonie, streckt seine Tatzen nach dem Stillen Ozean aus. In Südafrika scheute England vor keinem Opfer zurück, um den Burenaufstand niederzuwerfen. Und wie die asiatischen Schwierigkeiten Englands Anfang der neunziger Jahre als Ansporn gedient hatten zur Eröffnung der deutschen Kolonialpolitik, so erwuchsen aus dem Kriege mit den Buren neue Hoffnungen für den jungen deutschen Imperialismus. »Vor vier Jahren – so führte Bülow am 11. Dezember 1899 im Reichstage aus – hat der Chinesisch-Japanische Krieg, vor kaum einem Jahre der Spanisch-Amerikanische Krieg die Dinge weiter ins Rollen gebracht, große tiefeinschneidende, weitreichende Entscheidungen herbeigeführt, alte Reiche erschüttert, neue ernste Fermente der Gärung in die Entwicklung getragen. Niemand kann übersehen, welche Konsequenzen der Krieg haben wird, der seit einigen Wochen Südafrika in Flammen setzt. Der englische Premierminister hatte schon vor längerer Zeit gesagt, daß die starken Staaten immer stärker und die schwachen immer schwächer werden würden. Alles, was seitdem geschehen ist, beweist die Richtigkeit dieses Wortes. Stehen wir wieder vor einer neuen Teilung der Erde, wie sie vor gerade hundert Jahren dem Dichter vorschwebte? Ich glaube das nicht, ich möchte es namentlich noch nicht glauben. Aber jedenfalls können wir nicht dulden, daß irgend ein fremder Jupiter zu uns sagt: Was tun? Die Welt ist weggegeben. Wir wollen keiner fremden Macht zu nahe treten, wir wollen uns aber auch von keiner fremden Macht auf die Füße treten lassen, und wir wollen uns von keiner fremden Macht beiseite schieben lassen, weder in politischer noch in wirtschaftlicher Beziehung.«
Das Ziel des deutschen Imperialismus war gesetzt. Himmelhochjauchzend stürzte er sich an die Arbeit, um den Kämpfen gerüstet entgegenzueilen.
2. Die deutsche Flotte.
Der deutsche Imperialismus hat sich seine Seewaffen erst schaffen müssen. Die kontinentale Macht, das stärkste Landheer Europas, konnte für seine Zwecke nicht genügen, da es ihm um die Durchsetzung seines Willens in Gebieten ging, denen er mit seiner Landmacht näher zu rücken nicht imstande war. Diese Aufgabe der Flotte ergibt sich direkt aus dem Wesen der imperialistischen Politik, wie im besonderen aus der Lage des deutschen Imperialismus. Als er nur einige Kolonien besaß, genügten ihm die Kreuzer, die die kleine deutsche aus der preußischen Flotte hervorgegangene Küstenschutz-Flotte besaß. Sie dienten zu Flottendemonstrationen, die den jungen kolonialen Erwerbungen die Macht des Deutschen Reiches vorführen sollten oder zur Ausübung eines Drucks auf die kleinen »Mächte«, die oft etwas respektlos mit deutschen Bürgern umzuspringen wagten. Seit dem Aufkommen des Torpedos hielten die deutschen Marinekreise große Schlachtschiffe überhaupt für einen Luxus fehlgeschlagener Experimente. Das änderte sich gründlich, als bei der deutschen Regierung und der Bourgeoisie der Glaube aufkam, die Welt stehe vor einer neuen Teilung. Mit Küstenschutz und Kreuzern konnten sie nunmehr nicht auskommen. Sollte der deutsche Imperialismus bei einer eventuellen Teilung Chinas oder der Türkei auf seine Rechnung kommen, so mußte er die Mittel besitzen, den anderen Mächten zu zeigen, daß man ohne ihn das Erbe nicht teilen durfte. Das Bestehen einer deutschen Schlachtflotte, die auch in weiten Meeren den Willen des deutschen Kapitals mit Nachdruck vertreten konnte, sollte also in erster Linie dazu dienen, dem deutschen Imperialismus eine Stimme zu geben im Rate der alten imperialistischen Mächte: im friedlichen Rate – wenn es sich um das Verschachern von Völkern und Ländern handelte, im Kriegsrate – wenn es galt, gemeinsam mit anderen imperialistischen Mächten auf Raub auszugehen, und endlich auf offener See, – wenn die älteren imperialistischen Staaten dem Ausbeutungsdrang des deutschen Imperialismus brüsk in den Weg treten würden. Diese letzte Aufgabe drückte die Flottenvorlage von 1899 in folgenden knappen Worten aus: »Deutschlands Schlachtflotte müsse so stark sein, daß ein Krieg auch für den seemächtigsten Gegner mit derartigen Gefahren verbunden sei, daß seine eigene Machtstellung in Frage gestellt werde.«
Aus diesen Aufgaben der deutschen Flotte ergab sich der Plan
Für diese und die späteren Ausführungen, soweit sie die marinistische Seite betreffen, siehe:
Foß: »Marinekunde«, Berlin 1910; Admiralitätsrat
Koch: »Geschichte der deutschen Marine« 1906; derselbe: »Die neueren Tendenzen der Marinepolitik« (in »Zeitschrift für Politik«, Band III, S. 93 bis 137); Graf E.
Reventlow: »Die deutsche Marine« (in »Deutschland als Weltmacht«, Berlin 1911) S. 727–745).
Die politischen und wirtschaftlichen Hoffnungen des deutschen Imperialismus dieser Zeit, wie auch seine Argumente findet man gut ausgedrückt in den damals gehaltenen Vorträgen der »Leuchten« der deutschen Wissenschaft, die gesammelt unter dem Titel: »
Handels- und Machtpolitik« (II. Band, bei Cotta in Stuttgart 1900 erschienen sind., wie auch, daß sie Gefahren mit sich brachte, denen aus dem Wege zu gehen nicht mehr in den Kräften des deutschen Imperialismus lag, nachdem er den Weg des Flottenbaues betreten hatte. An der Spitze des Flottenplanes stand der Bau von großen Schlachtschiffen, die den Feind in offener See angreifen oder abwehren konnten.
Kreuzer sollten den Aufklärungsdienst leisten, während
große Kreuzer die Aufgabe hatten, auch gewaltsam, selbst auf die Gefahr des Kampfes hin, Fühlung mit der feindlichen Flotte zu erhalten, und selbständige Unternehmungen kleineren Staaten gegenüber zu übernehmen. Daraus folgte, daß der Flottenbau sich jeder wichtigeren technischen Erfindung, jeder größeren politischen Verschiebung anpassen mußte. Denn während die technischen Erfindungen die älteren Schiffskonstruktionen in bezug auf
Geschwindigkeit und Widerstandskraft entwerteten, wies jede größere Verschiebung in den Mächteverhältnissen der Flotte neue Aufgaben an. So setzte der deutsche Imperialismus mit seiner ersten Flottenvorlage eine
Schraube ohne Ende in Bewegung. Alle seine Versicherungen, der auf Jahre hinaus angelegte Flottenplan sei für die Regierung bindend, waren bewußte Unwahrheiten. Denn wäre die Regierung, aus Rücksicht auf den Flottenplan, bei den alten Kriegsschiffen geblieben, während in England seit 1905 die
Riesendreadnoughts gebaut wurden, so hätte sie dem Bestehen der Flotte jeden Sinn genommen, was vom Standpunkt der imperialistischen Politik natürlich unmöglich war. Die Schnelligkeit, mit der die deutsche Regierung der britischen im Bau der Dreadnoughts nachkam, obwohl »im Rahmen des Flottenplanes« jedes Kriegsschiff von nun an fast doppelt so viel kosten sollte, zeigte dies mit genügender Klarheit. Dasselbe war der Fall bei der Vermehrung der Schiffszahl, je nachdem, ob die Regierung und die Bourgeoisie annahmen, daß sich Zeiten der imperialistischen Ernte näherten oder nicht. Der Amerikanisch-Spanische Krieg und die chinesischen Wirren beschleunigten die Annahme des zweiten Flottengesetzes.
Das Gesagte genügt zur Bewertung des Charakters der deutschen Flotte: sie ist eine Angriffswaffe des deutschen Imperialismus, ein Mittel zur Durchsetzung seiner Ziele, und gegen wen sie angewendet werden soll, wird von den Verhältnissen abhängen. Heute kann sie zur Unterstützung der Türkei gegen England, morgen zusammen mit anderen Flotten gegen die Türkei angewendet werden. Der deutsche Imperialismus ist es nicht, der die akute Kriegsgefahr geboren hat, aber sein Bestehen, wie das Bestehen der deutschen Flotte, beschwören die Gefahr herauf, daß Deutschland an allen Händeln teilnehmen wird, aus denen der Weltbrand entstehen kann.
Die Verfechter des deutschen Imperialismus, die oft mit einer herzerquickenden Klarheit sein Wesen offenlegen, halten es manchmal für nötig, mit der Miene eines Lämmchens den Charakter der deutschen Flottenpolitik zu verdunkeln. Sie tun es nicht so sehr, um dem Ausland Sand in die Augen zu streuen – dies wäre doch ein verlorenes Unternehmen, weil die französische und englische imperialistische Sippschaft aus eigenem Tun die Wege des Imperialismus kennt –, sondern aus Rücksicht auf das deutsche Kleinbürgertum, die Handelsbourgeoisie und alle jene Elemente, die kein direktes Interesse am Imperialismus haben, aber betrogen werden wollen, um imperialistische Politik zu treiben. So erzählen die Imperialisten, die deutsche Flotte sei gebaut worden, um den Handel Deutschlands zu schützen, um die Blockade der deutschen Küsten, ja die Landung fremder Flotten für den Fall des Krieges zu verhindern, – daß sie also ein reines Abwehrmittel sei. Wir übergehen gänzlich die Frage, was denn die Ursache eines Krieges Deutschlands mit den imperialistischen Mächten sein könnte, wenn nicht die Tatsache, daß Deutschland an der imperialistischen Raubpolitik teilnehmen, also andere Staaten oder Völker angreifen will, ein Beweis, daß es in Wirklichkeit selbst Angreifer sein muß, um vor Angriffen Furcht zu haben. Wir übergehen das alles, denn es ist leicht nachzuweisen, daß selbst dann, wenn Deutschland in die Lage der gekränkten Unschuld kommen könnte, die Flotte gar nicht imstande wäre, seinen Handel zu schützen. Deutschland besitzt 4675 Handelsschiffe, die den Handel mit allen Weltteilen unterhalten und nur 56 kleine und große Kreuzer; dabei besitzt es auf den Meeresstraßen, mit Ausnahme von Kiautschau, keine Kohlenstationen und keine marinistischen Stützpunkte. Was kann also den deutschen Handelsschiffen die Flotte nützen? Die deutschen Flottenpolitiker sind zu gute Fachleute, um dieses Argument ernst zu nehmen, und der Admiral Plüdemann erklärte ausdrücklich: »Man darf für den Handelsschutz nicht ein einziges Schiff, nicht einen Mann, nicht ein Geschütz verwenden, die für die Bekämpfung der feindlichen Flotte nutzbringend gemacht werden können. Man wird es den Kolonien und den Handelsschiffen überlassen, sich selbst durchzuhelfen« Plüdemann, »Modernes See-Kriegswesen« 1907..
Was nun die Absperrung der deutschen Küsten zum Zweck der Abschneidung der Zufuhr betrifft, so würde sich im Kriegsfall für die gegnerischen Mächte – hier kommt in erster Linie England in Betracht – die Notwendigkeit der Blockade schon dadurch erübrigen, daß sie die deutschen Handelsschiffe auf der See auffangen können. Wenn aber auch die Blockade für ihre Ziele notwendig wäre, so wäre doch ihre Durchführung sehr schwierig: sie würde, um wirksam zu sein, eine sehr große Anzahl von Schiffen erfordern. Ihre Durchführung würde auch die Interessen der Neutralen treffen und den eigenen Handel der blockierenden Macht in einem solchen Maße schädigen, daß es mehr als unwahrscheinlich ist, daß ihr die Bedeutung zugeschrieben werden kann, die ihr die offiziellen Flottenpolitiker beilegen, und das um so mehr, als schon der Ausbruch des Krieges die Industrie in großem Maße lahmlegt und der Verkehr auch ohne Blockade ruht. Was aber die Lebensmittel betrifft, die Deutschland meist vom Auslande bezieht, so ließen sie sich durch neutrale, an Deutschland angrenzende Staaten weiterbeziehen. Mit dem dritten Scheinargument, der Landungsgefahr, betreiben die Imperialisten einen direkten Schwindel. Erstens bieten die deutschen Küsten eine sehr schlechte Landungsgelegenheit für fremde Truppen, zweitens kennt die moderne Kriegsführung in den See-Minen, Unterseebooten viel billigere Küstenschutzmittel, als es die Flotte ist.
Die deutsche Flotte würde natürlich in einem Kriege auch als Abwehrmittel dienen, sie ist aber nicht zu diesem Zwecke gebaut worden. Der Geist der Offensive beherrscht jedes Machtmittel großer Staaten. Wie könnte es also anders bestellt sein bei einem Staate, der zu spät in die Reihe der imperialistischen Mächte eingetreten ist und mit Volldampf das Versäumte nachzuholen sucht? In drei Jahren hat die deutsche Bourgeoisie durchgesetzt, daß Deutschland, die stärkste Landmacht Europas, mit einem Ruck in die ersten Reihen der Seemächte getreten ist.
Am 17. März 1898 setzte der Reichstag, gegen die Opposition der Vertreter der Arbeiterklasse und eines Teiles des Kleinbürgertums, den Schiffsbestand der deutschen Flotte, abgesehen von den Torpedofahrzeugen, Schulschiffen, Spezialschiffen und Kanonenbooten, fest auf a) Verwendungsbereit: 1 Flottenflaggschiff, 2 Geschwader zu je 8 Linienschiffen, 2 Divisionen zu je 4 Küstenpanzerschiffen, 6 große Kreuzer, 16 kleine Kreuzer als Aufklärungsschiffe der heimischen Schlachtflotte, 3 große und 10 kleine Kreuzer für den Auslandsdienst; b) Materialreserve: 2 Linienschiffe, 3 große Kreuzer, 4 kleine Kreuzer. Aber schon am 14. Juni 1900 wurde der Schiffsbestand in folgender sprunghaften Weise erhöht: er sollte betragen 2 Flottenflaggschiffe, 4 Geschwader zu 8 Linienschiffen, 8 große Kreuzer, 24 kleine Kreuzer als Aufklärungsschiffe. Die Auslandsflotte sollte aus 3 großen und 10 kleinen Kreuzern bestehen; die Materialreserve aus 4 Linienschiffen, 3 großen und 4 kleinen Kreuzern.
Mit Hilfe einer bisher unerhörten Agitation der ganzen bürgerlichen Presse wurden die Waffen des deutschen Imperialismus geschaffen. Der Flottenverein, der zur Entfaltung einer Agitation für die Flotte ins Leben gerufen war, hatte in kurzer Zeit eine Viertel Million Mitglieder. Die deutschen Professoren, das unpolitischste Volk der Welt, zogen als Flottenagitatoren im Lande herum und lieferten dem Imperialismus »wissenschaftliche« Waffen. Unter dem Jubel des ganzen Bürgertums ging die deutsche Flotte vom Stapel. Zehn Jahre sind seit diesem Augenblick verflossen, fünf Milliarden hat der Bau der Flotte schon verschlungen. Wie sehen nun die Erfolge des deutschen Imperialismus aus?
1. Die Weltlage und der deutsch-englische Gegensatz.
Das Einschwenken Deutschlands in das Fahrwasser der Weltpolitik, der Bau einer Flotte, die nicht zum Küstenschutz, sondern zur Teilnahme an den Entscheidungen in fernen Meeren bestimmt war, mußte selbstverständlich die internationale Lage von Grund aus ändern. Zwar war der Übergang Deutschlands von der kontinentalen zur Weltpolitik nur als eine von vielen ähnlichen Wandlungen in der kapitalistischen Welt vor sich gegangen, deren Ausdruck das Eingreifen der Vereinigten Staaten Nordamerikas in die Entwicklung Ostasiens, das Aufkommen der japanischen Macht usw. bildete. Aber die Tatsache, daß Deutschland die militärisch-stärkste Landmacht Europas ist – und Europa ist noch immer die Grundlage der Politik der imperialistischen Staaten geblieben – die Tatsache, daß es der stärkste und sich am schnellsten entwickelnde Industriestaat des Festlandes ist, hat seinem Eintreten in die Weltpolitik, seinem Streben, daß nichts in der Welt ohne sein Zutun geschehe, eine besondere Bedeutung verleihen müssen.
Zuerst beeinflußte das Eintreten Deutschlands in die Reihe der imperialistischen Staaten seine Stellung in Europa. Während Deutschland bisher den Ausbreitungsbestrebungen Rußlands auf dem Balkan, die sich mit den ähnlichen Bestrebungen Österreichs kreuzten, selbst uninteressiert gegenüberstand und sie ausnützen konnte zur Stärkung seiner diplomatischen Position, bekam es jetzt durch seine türkische Politik selbständiges Interesse an der Lösung der Orientfrage. Es konnte sich nicht mehr damit begnügen, den Appetit Rußlands und Österreichs auf den Balkan dazu zu verwenden, um in Österreich die Furcht vor einem Zusammenstoß mit Rußland zu stärken und das Bündnis mit Deutschland für die Donaumonarchie zur Notwendigkeit zu machen. Es mußte danach trachten, daß die Türkei weder von Rußland, noch von einer anderen Macht in ihren Lebensinteressen getroffen würde, weil sonst leicht die türkische Frage aufgerollt und entschieden werden konnte, bevor der wirtschaftliche Einfluß Deutschlands so stark war, daß bei einer eventuellen Teilung des türkischen Erbes auch Deutschland einen gehörigen Machtzuwachs bekommen könne. So verwandelte sich die Orientfrage, die Bismarck nicht einmal des Knochens eines pommerschen Grenadiers wert erschien, in eine der wichtigsten Fragen der deutschen Weltpolitik. Während Deutschlands auswärtige Politik seit dem Deutsch-Französischen Krieg vom Verhältnis zu Frankreich und Rußland beherrscht war, wird sie jetzt in entscheidendem Maße vom Verhältnis zur Türkei bestimmt.
Aber nicht nur die türkische Frage beginnt eine Rolle in der auswärtigen Politik Deutschlands zu spielen. Während es früher die kolonialen Ausbeutungsbestrebungen Frankreichs begrüßt hatte, um Frankreichs Aufmerksamkeit von seinem Gegensatz zu Deutschland, der unglückseligen Folge des Deutsch-Französischen Krieges abzulenken, bekam es jetzt ein selbständiges Interesse an allen Fragen der überseeischen Politik. Es mischte sich in die nordafrikanischen, südamerikanischen, ostasiatischen Angelegenheiten nicht nur dort, wo schon größere Interessen des deutschen Kapitals vorhanden waren, sondern überall da, wo nur das deutsche Kapital in der Zukunft ein Ausbreitungsfeld gewinnen konnte. Obwohl das deutsche Kapital selbst nach einer Monopolstellung strebt, wo eine solche winkt, trat die deutsche Regierung, wo keine Aussichten auf eine territoriale Fußfassung bestanden, für die »Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung« ein, und wo schon starke historisch entstandene Interessen anderer imperialistischer Staaten vorhanden waren, suchte sie durch Einmischung Entschädigungen auf anderen Gebieten zu erringen oder durch Verzicht auf sie die Hindernisse fortzuräumen, die von anderen Mächten einer aktiven deutschen Politik bereitet werden oder in ihren wichtigsten Ansatzpunkten bereitet werden konnten: in China und in der Türkei. Diese Politik der Einmischung in alle Welthändel brachte zwar dem deutschen Imperialismus immer neue Konflikte ein, aber gleichzeitig gab sie ihm Trümpfe in die Hand, die er zur Stärkung seiner europäischen Position oder zur Unterstützung seiner weltpolitischen Hauptziele ausnützen konnte. Daß dabei manchmal der Faden dieser komplizierten Politik zu reißen drohte, und daß Deutschland in Situationen kam, wo es wegen Fragen, die selbst vom imperialistischen, geschweige denn vom nationalen Standpunkte keine Lebensfragen waren, vor einem Kriege stand, wird noch weiter gezeigt werden.
Aber außer den mannigfachen Konflikten mit Frankreich, Rußland, Amerika usw., in die Deutschland in den 10 Jahren seiner imperialistischen Politik verwickelt worden ist, führte diese Politik den deutsch-englischen Gegensatz herbei, der immer größeren Umfang annahm, dem deutschen Imperialismus schwer überwindbare Hindernisse in den Weg legte und schließlich in eine akute Kriegsgefahr ausmündete Über die wirtschaftlichen Grundlagen des deutsch-englischen Gegensatzes siehe die knappe aber gut informierende Schrift von Schulze-Gävernitz: Deutschland und England, Berlin, Verlag Hilfe 1911; über die weltpolitische Seite der Frage, die verhältnismäßig objektive und ruhige Schilderung Paul Rohrbachs in seinem Buche: Deutschland unter den Weltvölkern, Berlin 1911 (dritte Ausgabe)..
Englands Interessen leiden unter dem Wachstum der allgemeinen imperialistischen Tendenz. Bis in die achtziger Jahre hinein beherrschte Englands Industrie den Weltmarkt und Englands Flotte die Bahnen des Weltverkehrs, das Meer. Zwar drohte ihm die feudale Ausbreitung Rußlands in Asien und die imperialistische Frankreichs in Nordafrika, aber keiner dieser Gegner konnte England gefährlich werden. An den Grundlagen der russischen Ausbreitung, an der Herrschaft der feudalen russischen Bureaukratie, deren Interessen die Triebkraft dieser Bestrebungen bildeten, nagte der Wurm der sozialen Entwicklung: der Kapitalismus zersetzte die soziale Ruhe des Zarenreichs, die Grundlage der Ausbreitungspolitik des Zarismus. Wenn er auch manchmal, um die inneren Unruhen zu beschwichtigen, sich aktiver auf auswärtige Abenteuer warf, so mußte ihm dabei auf die Dauer der Atem ausgehen. Das Fehlen einer russischen Flotte verminderte noch dazu die Gefahr, und als Rußland zum Bau einer großen Flotte überging, entstand gleichzeitig die Macht, die England die Austragung des englisch-russischen Gegensatzes ersparen sollte: das moderne Japan. Der koloniale Gegensatz zu Frankreich war angesichts der schwachen Volksvermehrung und des langsamen Tempos der ökonomischen Entwicklung dieses Landes für England nicht gefährlich, obwohl er in seinem Verlauf manche ernste Situationen schuf. Im deutschen Imperialismus jedoch fand England einen Gegner vor, mit dem man ernstlich rechnen mußte. Die deutsche industrielle Ausbreitung bedrohte das englische Kapital selbst in seinem eigenen Hause, was ihm um so gefährlicher werden konnte, als es den Höhepunkt seiner Entwicklung schon überschritten hatte und in der Anwendung der wissenschaftlichen industriellen Methoden nicht mehr auf der Höhe der Zeit stand Th. Rothstein: Der Niedergang der englischen Industrie. »Neue Zeit« 1905. In englischer Sprache in Buchform erschienen.. Dazu kam der Gärungsprozeß im britischen Weltreiche, dessen einzelne Teile, wie Südafrika, Australien, Kanada eine selbständige ökonomische Entwicklung begannen, deren Ergebnis leicht für das englische Kapital gefährlich werden kann Darüber bei Schulze-Gävernitz: Der britische Imperialismus, Leipzig 1907; Leutschau: Großbritannien, Halle 1907; kritische sozialdemokratische Stellungnahme in den entsprechenden Kapiteln des schon zitierten Buches von Parvus über die Kolonialpolitik.. Geographisch zerstreut, konnten sie nur durch starke ökonomische und politische Interessenbande an das Mutterreich geknüpft werden. Werden aber diese Bande nicht durch das Aufkommen einer selbständigen Industrie in den Kolonien gelockert? Die englische Bourgeoisie ist sich dieser Tendenzen, die auf die Auflösung des britischen Weltreiches hinarbeiten, bewußt, und sie sucht neue Formen des Verhältnisses zu ihren Kolonien zu finden, die die Gefahr aus der Welt schaffen könnten. Der Gedanke an eine zollpolitische Zusammenfassung des britischen Weltreiches, an seine strammere Bindung durch gemeinsame parlamentarische Institutionen, eine gemeinsam zu erhaltende Flotte, bahnt sich den Weg, aber er trifft auf große Widerstände in der englischen Handelsbourgeoisie, die von der Parole: die ganze Welt ist meine Werkstatt, nicht lassen will, auf Widerstände in den Kolonien selbst. Jahre sind nötig, voll Krisen und Reibungen, bis der imperialistische englische Gedanke in irgend einer Form realisiert werden könnte, wenn er überhaupt jemals verwirklicht werden soll, was angesichts der großen sozialen und geographischen Unterschiede zwischen England und seinen Kolonien überhaupt zweifelhaft ist. Da taucht die Frage auf: wird die hungrige imperialistische Macht, wird Deutschland diese gefahrvolle Übergangszeit nicht ausnützen, um sich auf Kosten der englischen Weltmacht, oder anderer schwächerer Mächte eine Position in der Welt zu erobern, die der englischen gefährlich werden könnte? Ein Angriff auf die am meisten entwickelten, von Weißen bewohnten englischen Kolonien ist nicht zu befürchten, denn weder Kanada noch Australien würden eine Fremdherrschaft dulden, aber eine Ausbreitungsmöglichkeit auf Kosten der afrikanischen und asiatischen Besitzungen Englands und anderer schwächerer Kolonialmächte, wie Holland, Belgien, Portugal, war nicht von der Hand zu weisen. Aber schon die Ausnützung von Verwicklungen im britischen Kolonialreich zur Erringung maritimer Stützpunkte an den bisher von England beherrschten Seewegen, bedroht die Weltmacht Englands. Während des Burenkrieges blieb Deutschland neutral; es ließ sich abspeisen mit einem Wechsel auf die afrikanischen Kolonien Portugals und mit der Gewährung der Ellenbogenfreiheit für seinen chinesischen Vorstoß. Aber in dieser Zeit befand sich der Ausbau der deutschen Flotte erst in seinen Anfängen. In der Zukunft konnte der deutsche Imperialismus dem englischen noch gefährlicher werden.
Diese Erwägungen riefen in England große Beunruhigungen hervor. Die »deutsche Gefahr« muß überwunden werden, erklärten die imperialistischen Kreise. Sie begannen, dem deutschen Imperialismus Steine in den Weg zu legen und ihn die Macht Englands fühlen zu lassen, und zu gleicher Zeit versuchten sie, eine Verständigung mit ihm anzubahnen. Diese von Chamberlain, dem Haupte des englischen Imperialismus am Anfang dieses Jahrhunderts gemachten Annäherungsversuche konnten aber aus leicht faßbaren Gründen zu keinem positiven Ergebnis führen.
Die Annäherung an England mußte das deutsch-russische Verhältnis stören, das angesichts des nahenden ostasiatischen Abenteuers und der schmachvollen Dienste, die die deutsche Junkerregierung dem Zarismus im Kampfe gegen die russische revolutionäre Bewegung geleistet hatte, sehr »herzlich« geworden war. Der deutschen Regierung war an diesem Verhältnis sehr gelegen, da sie in dem Zarismus die Vormacht der europäischen Reaktion sah, da sie in ihrer Anbetung der brutalen Kraft an Rußlands Sieg in der ostasiatischen Krise glaubte, und durch ein gutes Verhältnis zu Rußland dem französischen Gegner die Hoffnung auf eine Unterstützung seitens des Zarismus nehmen wollte. Aber nicht nur diese Erwägungen hielten den deutschen Imperialismus von einer Annäherung an England zurück. Er wußte wohl, daß er bei einer solchen Annäherung nur mit einem Trinkgeld abgespeist werden würde. Er war noch schwach, und nur der Vollbesitz von Kraft konnte ihm in den kapitalistischen Machtkämpfen Gehör verschaffen und die verbündeten wie die verfeindeten Staaten nötigen, den Interessen des deutschen Imperialismus Rechnung zu tragen.
Der deutsch-englische Gegensatz blieb also chronisch. Der deutsche Imperialismus begann ihn zuerst in der Türkei zu spüren, worauf wir noch weiter ausführlich zurückkommen; aber bald überzeugte er sich, daß er ihm auch in Europa gefährlich werden konnte. Im Jahre 1904 einigte sich der englische Imperialismus mit dem französischen über die nordafrikanischen Fragen, nachdem es sich gezeigt hatte, daß von einem Übereinkommen mit Deutschland keine Rede sein konnte. Frankreich erkannte die Stellung Englands in Ägypten an, und England gab seine Zustimmung zu den marokkanischen Plänen Frankreichs. Dieses Übereinkommen leitete eine Verständigung der beiden Staaten ein, die die Schwächung des deutschen Imperialismus bezweckte. Die Verständigung war für den englischen und französischen Imperialismus um so nötiger gewesen, als die Niederlage Rußlands im Kriege mit Japan Deutschland von dem Druck an seiner östlichen Grenze befreit und seine Aktionskraft nach außen hin verstärkt hatte. Um sie im Zaume zu halten, begann England, das durch das Bündnis mit Japan vom Jahre 1912 von seinen ostasiatischen Sorgen befreit worden war und seine Kräfte gänzlich auf die Austragung des Gegensatzes zu Deutschland konzentrieren konnte, die Politik der Einkreisung Deutschlands. Zu diesem Zwecke schloß es auch mit Rußland, das nach der Niederlage in der Mandschurei und auf den Schlachtfeldern der Revolution England in Asien nicht mehr gefährlich war, ein Abkommen, in dem es Nordpersien als russische Einflußsphäre anerkennt. Dieses Trinkgeld verhütete die Annäherung des geschwächten Rußlands an Deutschland und führte den Zarismus in die Arme Englands. So entstand die Tripelentente, als Gegengewicht zum Dreibund. Nun konnte sich England an die Arbeit machen. Es versuchte einerseits Rußland wegen der Balkanfrage in einen Konflikt mit Österreich zu verwickeln und andererseits den Gegensatz Frankreichs zu Deutschland zu vertiefen. Im ersten Falle konnte es zu einem Kriege zwischen Rußland und Österreich kommen, der Deutschland und Frankreich als Verbündete der beiden Staaten in Mitleidenschaft ziehen mußte. Das Resultat hätte, gleichviel auf wessen Seite der Sieg ausgefallen wäre, die Kräfte Deutschlands wenn nicht aufgerieben, so doch auf Jahre hinaus in Europa festgehalten. Der deutsche Imperialismus hätte dann dem englischen lange Zeit keine Schwierigkeiten bereiten können. Im zweiten Falle hätte vielleicht auch England in die kriegerische Auseinandersetzung Deutschlands mit Frankreich eingreifen müssen, es hätte aber eine leichte Arbeit gehabt: während die Landkräfte Deutschlands sich mit denen Frankreichs hätte messen müssen, konnte England seine Überlegenheit zur See zur Vernichtung der deutschen Flotte ausnützen.
Dreimal stand Europa am Rande des Krieges: Während des russisch-österreichischen Konfliktes im Jahre 1909 und während der Marokkokrisen im Jahre 1906 und 1911. Beide Male zeigte sich jedoch, daß weder Rußland noch Frankreich gewillt waren, den Gegensatz zu Deutschland bis zum Kriege zu treiben, um dem englischen Imperialismus die Sorgen zu verscheuchen. Rußland gedachte seiner Schwäche, ging einem Konflikt mit Österreich aus dem Wege und verpflichtete sich im November 1910 in Potsdam, an keinen Machinationen gegen Deutschland teilzunehmen. Frankreich verständigte sich ein Jahr später mit Deutschland über die Marokkofrage, wodurch auf eine Zeitlang jedes konkrete Streitobjekt zwischen dem deutschen und französischen Imperialismus verschwindet.
Der deutsche Imperialismus ließ sich nicht kleinkriegen. Er hat jahrelang gerüstet und steht nun dem englischen zwar nicht gleich stark gegenüber, jedenfalls aber in solcher Stärke, daß die Austragung des deutsch-englischen Gegensatzes auch für England nicht ohne sehr ernste Gefahren möglich wäre. Der deutsche und der englische Imperialismus stehen fortgesetzt vor der Gefahr des Zusammenstoßes. Und weil sie beide fühlen, welche furchtbare Verantwortung sie bei der Entscheidung dieser Frage auf sich nehmen, versuchen sie diesseits und jenseits des Kanals dem Volke einzureden, daß seine Lebensinteressen in Gefahr stehen, um auf diese Weise die Verantwortung für ihre Katastrophenpolitik dem Volke aufzubürden.
Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, welche Interessen den deutsch-englischen Gegensatz geschaffen haben. Es sei hier noch gestattet, diese Ausführungen durch eine knappe sachliche Zusammenfassung der in Betracht kommenden Momente zu ergänzen, die Karl Kautsky im Jahre 1910 in der Mai-Nummer des englischen Parteiblattes » Justice« den Kriegshetzern ins Stammbuch schrieb:
»Die Verfechter der Seerüstungen in Deutschland begründen sie damit, daß Deutschland zur See stark sein müsse, um seinen auswärtigen Handel zu schützen, ohne den seine Industrie nicht existieren könne. Andererseits behaupten die Verteidiger der Seerüstungen Englands, ihr Land müßte zur See übermächtig sein, weil ihm sonst im Falle eines Krieges die Lebensmittelzufuhr abgeschnitten werde. Außerdem sei Deutschland ein Land politischer Unfreiheit, und England laufe Gefahr, wenn es nicht zur See Sieger bleibe, von einer Invasion Deutschlands betroffen und seiner Freiheiten beraubt zu werden.
Die Deutschen wie die Engländer, die so sprechen, sind beide gleich im Unrecht. Natürlich schädigt jeder Krieg Handel und Industrie, aber Englands Seemacht wäre nie imstande, die Grundlagen der Handelsblüte Deutschlands zu zerstören. Sie könnte höchstens die deutsche Reederei schädigen, aber nicht einmal während des Krieges den Handel Deutschlands unterbinden, da Deutschland zu viele Grenzen besitzt, die für Englands Seemacht unzugänglich sind. Die Grundlage der Handelsblüte Deutschlands bildet aber die Überlegenheit seiner Industrie, und diese wieder hängt ab teils von den natürlichen Hilfsmitteln Deutschlands und seiner geographischen Lage, namentlich aber von der Bildung und Arbeitsfähigkeit seiner Arbeiterschaft. Nur durch Deutschlands eigene verderbliche innere Politik könnte seine Industrie und sein Handel untergraben werden, nie durch die äußere Politik Englands, wie gewaltsam diese auch werden mag.
Ebensowenig wie Deutschland von England hat aber England von Deutschland zu fürchten. Um seine Lebensmittelversorgung zu sichern, braucht Großbritannien keine Übermacht zur See. Eine Änderung des geltenden Seerechts würde genügen, in der die Bestimmungen über Seeleute und Konterbande eine Feststellung erfahren, die Lebensmitteltransporte von der Beschlagnahme durch die Kriegführenden ausschließt. Wenn England nur will, kann es eine derartige Gestaltung des Völkerrechts erreichen.
Davon aber, daß Deutschland ein Stück Englands an sich reißt, oder Englands Freiheiten bedroht, davon könnte selbst im Falle einer deutschen Invasion keine Rede sein. Deutschland wird nicht einmal mit seinen Polen fertig und empfindet diese als Pfahl in seinem Fleische. Die deutsche Regierung hat kein Bedürfnis nach anderen fremden Untertanen, die nur eine Quelle der Schwäche, nicht der Kraft für sie würden. Andererseits gibt es kein Land, das dank seiner insularen Lage so sehr ein unzerreißbares Ganze bildet, wie England. Seit den Tagen der römischen Cäsaren ist bei allen Wechselfällen des Krieges nie ein Stück Englands in fremdem Besitz gewesen, Großbritannien kann man nur ganz oder gar nicht besitzen.
Die Freiheiten eines selbständigen Volkes durch äußere Gewalt anzutasten, ist aber im 20. Jahrhundert nicht mehr möglich. Es ging schon vor 40 Jahren nicht mehr. Frankreich wurde von Deutschland völlig niedergeworfen, trotzdem vermochten Bismarck und Wilhelm nicht, Frankreich die Monarchie aufzuzwingen. Gerade der unglückliche Krieg brachte Frankreich die Freiheit, die Republik. Und heute ist die deutsche Regierung kaum noch imstande, das eigene Volk im Zaume zu halten, das nach mehr Freiheit verlangt. Von ihr hat das englische Volk für seine Freiheit nichts zu fürchten.«
Nicht um die Interessen des Volkes, sondern um die des ausbreitungslustigen Kapitals handelt es sich bei dem englisch-deutschen Gegensatz, wie bei allen anderen Konflikten, die der deutsche Imperialismus in den 10 Jahren seines Bestehens auszufechten gehabt hat. Eine Übersicht dieser Kämpfe an der Hand konkreter Tatsachen wird nicht nur diese Tatsache bestätigen, sondern in Ergänzung an diesen allgemeinen Ausführungen die Kraft des deutschen Imperialismus, die Größe seiner Erfolge zu prüfen erlauben, und erst nach Erledigung dieser Fragen wird die Feststellung der weiteren Entwicklungstendenzen möglich sein.
2. Das deutsche Kapital in China.
In China Professor O. Franke: »Ostasiatische Neubildungen«, Hamburg 1911. Für diesen Zeitabschnitt S. 20–96. schien zu Ende des vorigen Jahrhunderts dem deutschen Imperialismus die Geschichte tüchtig in die Hände zu arbeiten. Der Japanisch-Chinesische Krieg erschütterte das Reich der Mitte in seinen Grundlagen. Die chinesische Bureaukratie und die Kreise, aus denen sie sich rekrutierte, verloren ihre bisherige Geistesruhe: es wurde ihnen klar, daß eine ernste Gefahr im Anzuge war. Jüngere Kräfte, die auf den Kaiser Einfluß hatten, forderten sofortige weitgehende Reformen auf sozialem und politischem Gebiete; die Zentralisierung des Staates und die allmähliche Einführung des Parlamentarismus wurde von ihnen auf die Tagesordnung gestellt. Natürlich stemmten sich die Nutznießer des alten Systems, die höchsten bureaukratischen Kreise in Peking, wie die fast unabhängigen Provinzmachthaber aus allen Kräften diesen Forderungen entgegen, und die alte Kaiserin-Witwe stand an der Spitze der reaktionären Cliquen. Aber auch sie fühlten, daß man in alter Weise nicht weiter regieren konnte. Li Hung Tschang, der Leiter der chinesischen Politik, wandte sich bei seinem Besuch in Deutschland im Jahre 1896 an Bismarck mit der Frage: was China tun müsse, um kräftig auf den Beinen zu stehen? »Eine Armee bilden und damit die Staatsgewalt herstellen, ein anderes Mittel außer diesem gibt es nicht … Nur muß man vorher auf Straßen bedacht sein, auf denen Truppen fortbewegt werden können,« lautete die Antwort Aus dem Tagebuch Li Hung Tschangs, abgedruckt bei Franke l. c. S. 111.. Aber wie niemand über seinen eigenen Schatten springen kann, so konnte die chinesische Bureaukratie nicht gegen ihr eigenes Interesse die zentrale Staatsgewalt stärken, und noch viel weniger China wirklich auf ein modernes Geleise bringen. Statt schleunigst ans Werk zu gehen, nahm sie den Kampf gegen die Reformpartei auf, der so mit der Niederlage der letzteren endete. Die Kaiserin-Witwe riß die Zügel der Regierung an sich und sperrte den reformfreundlichen Kaiser in einen Harem ein. Zu gleicher Zeit brachen Volksunruhen aus. Die Besetzung Kiautschaus durch Deutschland, Port Arthurs durch Rußland, Wei-hei-weis durch England, der Beginn von Eisenbahnbauten, das immer frechere Hervortreten christlicher Missionare brachte die chinesischen Massen in Erregung. In der Hauptstadt Chinas kam es zu Unruhen, die mit der Ermordung des deutschen Gesandten und der Belagerung der Europäer endeten. Die Großmächte ließen sofort ihre Truppen einmarschieren; die fast gänzlich desorganisierte und veraltete Armee wurde aufs Haupt geschlagen, der Hof mußte aus Peking flüchten. Aber der Wunsch des deutschen Imperialismus, der von einer Besetzung des Hinterlandes von Kiautschau, der Provinz Schantung träumte, ging nicht in Erfüllung, da die Mächte die chinesische Frucht noch nicht für reif zum Aufteilen hielten. Ein Resultat aber hat der Feldzug doch gezeitigt. Die deutschen Truppen erfüllten das Geleitwort Wilhelms II.: »Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht«, und eroberten für den deutschen Imperialismus die Gleichberechtigung im Plündern, Sengen und Morden.
Die Entwicklung der ostasiatischen Verhältnisse erlaubte keine weitere Einmischung zum Zweck territorialer Erwerbungen. Vier Jahre nach der China-Expedition brach der Russisch-Japanische Krieg aus. Die Gefahr, vor die die alten kapitalistischen Staaten und das mit ihnen marschierende Rußland China gestellt hatten, bedrohte auch die Zukunftspläne Japans Dr. Hans Plehn: »Weltpolitik«, Berlin 1909, S. 1–74 und 167–202; Fritz Wertheimer: »Die japanische Kolonialpolitik, Hamburg 1910; Franke l. c. d., S. 136–137.. In dem jungen ostasiatischen Reiche wirkten zwar noch keine modernen kapitalistischen Ausbreitungstriebe. Es hatte eine junge kapitalarme Industrie, der es noch nicht gelungen war, den tief in der Naturalwirtschaft steckenden Bauernmarkt zu erschließen. Aber die von der Regierung durch hohe Zölle und Zuwendungen treibhausmäßig gezüchtete japanische Industrie suchte eben infolge der nur langsam sich entwickelnden Aufnahmefähigkeit des inneren Marktes nun auswärtige Märkte an sich zu reißen. Dazu kam noch die Furcht der leitenden japanischen Kreise, daß sie in der Zukunft vor die Tatsache gestellt werden könnten, sich bloß auf ihre kleinen Inseln, die schon jetzt 50 Millionen Menschen ernähren, beschränken zu müssen, und daß das japanische Kapital keinen genügenden Raum in der eigenen Heimat vorfinden würde. Darum tauchte in Japan schon seit den ersten Tagen der Europäisierung der Gedanke auf, an der entgegengesetzten Küste des Japanischen und Gelben Meeres festen Fuß zu fassen. Das Anrücken Rußlands von Norden her, die Absichten Deutschlands auf die Provinz Schantung, der englische Appetit nach dem Jangtsetal, der amerikanische Stützpunkt auf den Philippinen, – das alles war eine Mahnung für Japan, vorzugehen, solange es noch Zeit war. So kam es zum Russisch-Japanischen Kriege, der mit dem gänzlichen Zusammenbruch Rußlands, mit der Festsetzung Japans auf dem ostasiatischen Festlande endete. Der Russisch-Japanische Krieg hat das Aufkommen des neuen China A. Paquet: »Die ostasiatischen Reibungen«, München 1910. beschleunigt, aber es wäre ein Fehler, anzunehmen, daß er es verursacht hat. Unter seiner erschütternden Einwirkung kristallisierte sich alles das, was von der sozialen Entwicklung Chinas seit dem Chinesisch-Japanischen Kriege geschaffen worden ist. Die Einfuhr Chinas, die im Jahre 1890 640 Millionen Mark betrug, belief sich im Jahre 1909 auf 1 Milliarde Mark, die Ausfuhr wuchs von 400 Millionen im Jahre 1890 auf 800 Millionen im Jahre 1909. Wichtiger als dies ist die Tatsache, daß die chinesische Ausfuhr nicht mehr aus bloßen Rohstoffen besteht, sondern auch schon aus Produkten der jungen chinesischen Industrie, die auch einen immer mehr wachsenden Teil des chinesischen Konsums deckt. China besitzt schon eine Bourgeoisie, deren Spitzen bei ihren Reisen durch Europa, Amerika und Japan die Formen der Kapitalherrschaft kennen gelernt haben. Sie begnügt sich jetzt nicht mehr mit dem Streben, die Eroberungspläne des europäischen Kapitals zu durchkreuzen, sie will jetzt die Regierung in ihre Hände bekommen. Sie entwickelt eine eifrige Propaganda, um die nach altem Brauch ohne Nutzen im Versteck gehaltenen Schätze in den Verkehr zu bringen. Sie fordert im Namen der nationalen Industrie die Auslieferung des Bahnbaues in ihre Hände, sie verlangt von der Regierung bei der Verteilung der Konzessionen an Ausländer, daß sie chinesische Ingenieure beschäftigen, sie sendet ihre Söhne zwecks technischer Studien nach Europa, Amerika und Japan. Und es gibt keinen einzigen Forscher, der, aus China zurückgekehrt, nicht erklären würde, daß die ökonomische Selbständigkeit der chinesischen Bourgeoisie mit jedem Monat zunimmt. Zum Kampfe gegen die Bureaukratie hat sie im Handumdrehen eine große Presse geschaffen, die den Haß gegen die Mandschuherrschaft, mit ihrer Vettern- und Lotterwirtschaft predigt. Um die Bourgeoisie sammelt sich nicht nur die junge chinesische Intelligenz, die ihren linken Flügel bildet, sondern auch das Stadtvolk, das in ihr, wie es in den europäischen Revolutionen des vorigen Jahrhunderts der Fall gewesen ist, die Vertreterin der Nationalinteressen sieht und nicht eine um ihre Herrschaft kämpfende Klasse. Während ihr linker Flügel, die Intelligenz, geheime terroristische Gesellschaften bildet und den Volksaufstand predigt, sucht die Bourgeoisie auf legalem Wege zur Herrschaft zu kommen. Die oppositionelle Bewegung der Bourgeoisie nötigte die Regierung zu Zugeständnissen. Nach der schrecklichen Erniedrigung Chinas durch die Mächte im Jahre 1900 begann sie schon Reformen einzuführen. Der Gouverneur von Tschili, Juanschikai, der chinesische Bismarck, organisierte in seiner Provinz ein Heer nach europäischem Muster und unternahm später an der Spitze der Regierung die ersten Versuche in der Richtung der Zentralisierung der Finanzen und Heeresverwaltung, obwohl er auf jedem Schritt den Widerstand der 19 Gouverneure bewältigen mußte, die bisher wie selbständige Fürsten auf eigene Faust geschaltet und gewaltet haben. Aber selbst die Gefahr der Aufteilung Chinas kann die Bureaukratie nicht bewegen, sich freiwillig einer Quelle ihrer Einkünfte zu entäußern, wie sie die feudale Unabhängigkeit der Provinzen darstellte. Im Augenblick aber, da die von den Cliquen zerrissene Bureaukratie nicht imstande war, das Werk der Erneuerung Chinas zu vollbringen, begann der Druck von unten. Wie stark er war, beweist die Tatsache, daß die Regierung, die zuerst die Einberufung des Parlaments für das Jahr 1915 angekündigt hatte, den Termin verkürzen und vorbereitende Schritte zur Eröffnung tun mußte. Sie berief die Provinzlandtage und den Vorbereitungs-Reichstag ein, die die Vorstufen des chinesischen Parlamentarismus bilden sollen. Zwar bestehen sie teilweise aus Beamten und nur zu einem Teile aus Deputierten, die auf Grund eines Steuerzensus gewählt sind; trotzdem aber werden sie zum Sprachrohr der oppositionellen Bewegung und fordern energisch die Einberufung des Parlaments. Dreimal nach Peking gesandte Deputationen, die diese Forderung dem Throne überbringen sollten, bildeten eine stets in Peking wirkende Liga der Kammer um die Einberufung des Parlamentes.
Aber die Beschleunigung der Arbeiten zur Einberufung des Parlamentes konnte das Wachstum der revolutionären Bewegung nicht aufhalten. Diese schöpfte immer wieder neue Kräfte aus dem Zersetzungsprozeß des alten China, der sich in Hungersnöten äußerte, aus der Gier der chinesischen Bourgeoisie, den jetzigen Zuständen, die dem ausländischen Kapital die Vorherrschaft einräumen, möglichst schnell ein Ende zu bereiten, aus dem Bestreben der jungen Militärs, den dem Reiche drohenden Gefahren durch schnelle Maßregeln ein Ende zu bereiten. Nach einer Reihe von kleineren Aufständen bricht im Oktober 1911 in Südchina die Revolution aus; sie bereitet den Regierungstruppen eine Niederlage nach der anderen, verbreitet sich immer weiter, macht der Herrschaft der Mandschus ein Ende und rollt wieder die chinesische Frage in ihrem ganzen Umfange auf.
Diese seit dem Jahre 1900 andauernde Entwicklung erlaubte den Großmächten keine Einmischung in die chinesischen Angelegenheiten, wie sie am Ende des vorigen Jahrhunderts eingeleitet zu sein schien. Die zunehmende Gärung in China zwang zu großer Vorsicht, da man auf einen Widerstand stoßen konnte, der vor 10 Jahren unmöglich gewesen wäre. Dabei kämpften im Schoße der Regierungen verschiedene Ansichten über die Bedeutung der bevorstehenden Umwandlung Chinas. Ein Teil der Bourgeoisie Westeuropas und Amerikas wies auf den stark zunehmenden Anteil Chinas an dem Weltverkehr hin – im Jahre 1901 betrug er 1376,1, im Jahre 1909 2077,2 Millionen Mark –, und folgerte daraus, daß die Beschleunigung dieser Entwicklung auch den Anteil des europäischen Kapitals an der Ausbeutung Chinas entsprechend vergrößern würde. Man zog daraus den Schluß, daß es im Interesse des Kapitals liege, der Entwicklung Chinas keine Steine in den Weg zu legen und jedenfalls auf alle Pläne der Aufteilung Chinas zu verzichten. Ein anderer Teil der bürgerlichen Politiker wies darauf hin, daß Japans Lebensinteressen diese Macht zur Aneignung der Südmandschurei trieben, und daß Rußland an eine Ausbreitung in der Nordmandschurei, der Mongolei und dem Chinesisch-Turkestan denken müsse, da es bei einem wirtschaftlichen Wettstreit mit dem europäischen Kapital auf den Märkten des freien Chinas den kürzeren werde ziehen müssen. Ließen sich aber die Ausbreitungsgelüste Rußlands und Japans nicht eindämmen, so würden die anderen Mächte und in erster Linie Nordamerika, auch eingreifen, wodurch die chinesische Frage an demselben Wendepunkt angelangt sein würde, wie im Jahre 1900. Daran wurde nun die Mahnung geknüpft, sich in Bereitschaft zu halten, die verstärkt wurde durch die Furcht des europäischen Kapitals vor dem chinesischen, und durch die Erwägung, daß die chinesischen Volksmassen, einmal in Bewegung geraten, sich an den Vertretern des ausländischen Kapitals versündigen könnten. Und da das letztere sehr möglich erscheint, weil das chinesische Volk in dem europäischen Kapital seinen Ausbeuter und Unterdrücker sehen muß, so wird das europäische Kapital Vorkehrungen treffen, um in die Entwicklung der chinesischen Frage eventuell mit Waffenmacht eingreifen zu können. So steuerte das Schiff des europäischen Imperialismus in der chinesischen Frage ohne festen Kurs.
Was den deutschen Imperialismus betrifft, so zeigte er in seiner chinesischen Politik dieselbe Unbestimmtheit der Ziele wie der europäische überhaupt. Der im Jahre 1897 »gepachtete« Hafen Kiautschau sollte zum Bollwerk der deutschen Expansion in China ausgebaut werden. 150 Millionen Mark wurden für den Ausbau und die Verwaltung dieses Stützpunktes verwendet, ohne irgend welche ernsteren Ergebnisse zu zeitigen. Auf seine militärische Ausrüstung mußte man aus Rücksicht auf das erstarkende China verzichten, und als ökonomisches Einfallstor konnte er keine spezielle Bedeutung erlangen, weil die industriell vorgeschrittenen Provinzen in Südchina liegen. Zwar ist der Gesamthandel Kiautschaus auf 130 Millionen Mark gestiegen, aber die deutsche Ausfuhr nach Kiautschau war sehr gering und verminderte sich in dem Maße, wie der Ausbau des Hafens und der deutschen Verwaltungsgebäude beigelegt wurde. Im Jahre 1909 betrug die deutsche Einfuhr in Kiautschau 3,3 Millionen Mark und die Ausfuhr 147 000 Mark. Der Erfolg des ersten Schrittes Deutschlands auf dem Wege der territorialen Fußfassung in China war also lächerlich klein.
Ungeachtet dessen wiesen die deutsche Bourgeoisie und das deutsche Kapital jeden Gedanken an die Aufgabe Kiautschaus von sich, weil sie noch immer mit der Möglichkeit eines Zusammenbruchs der chinesischen Erneuerungsversuche und der Wiederkehr der Aufteilungspolitik rechnen. Das deutsche Kapital schafft sich angesichts dessen weltpolitisch das Anrecht, an der zukünftigen Teilung Chinas mitzuwirken. Es nimmt teil am Wettstreit der kapitalistischen Mächte auf allen Gebieten des wirtschaftlichen Lebens Chinas. Aber die Konkurrenz der Mächte, die wie England durch ihre älteren Beziehungen zu China oder wie Japan und die Vereinigten Staaten Nordamerikas durch ihre geographische Lage einen Vorsprung auf dem chinesischen Markte besitzen, erlauben dem deutschen Kapital auch auf diesem Gebiete keine besonderen Erfolge. Der deutsche Anteil an dem Handelsverkehr Chinas ist zwar in dem letzten Jahrzehnt absolut gestiegen – er betrug im Jahre 1901 82,4; 1902 93; 1903 79; 1904 92; 1905 118; 1906 124; 1907 119; 1908 121; 1909 122 und 1910 161 Millionen Mark – aber relativ bedeuten diese Ziffern kein Wachstum: im Jahre 1901 betrug der Anteil Deutschlands am chinesischen Handel in Prozenten 5,99 und 1909 bloß 5,87. Berücksichtigt man nun auch, daß ein Teil der deutschen Ausfuhr durch England geht, also in den Handelsziffern Englands enthalten ist, so kann man dennoch von einem Vordringen des deutschen Handels in China nicht sprechen. Ähnlich verhält es sich auch mit dem Anteil des deutschen Kapitals an den Industrie- und Bankgründungen in China. Neben der im Jahre 1889 gegründeten Deutsch-asiatischen Bank (Sitz in Schanghai, Kapital 20 Millionen Mark), die ziemlich gute Geschäfte macht und ihren Teilhabern 8 Prozent Dividende zahlt, arbeitet in China die Deutsche Schantau-Bergbau-Gesellschaft mit 12 Millionen Mark Kapital, die China Export-Import und Bank-Compagnie mit 1½ Millionen Mark und die Schantung-Bahngesellschaft mit 54 Millionen Mark Kapital. Dazu kommt noch in Betracht die Teilnahme Deutschlands an der Deckung des chinesischen Geldbedarfs, die sich in der teilweisen Unterbringung chinesischer Staatsanleihen an den Börsen Deutschlands äußert; die Höhe der Beteiligung des deutschen Kapitals an diesen Anleihen, die bis zum Jahre 1909 2400 Millionen Mark betragen, läßt sich jedoch nicht ganz genau angeben, aber jedenfalls dürfte er nicht groß sein, da er sonst den Anteil Deutschlands am chinesischen Handelsverkehr beschleunigen müßte. Vergleicht man diese Resultate der wirtschaftlichen Ausbreitung des deutschen Kapitals in China mit dem Wachsen der Prozentzahlen des japanischen und amerikanischen Handels, so muß man zu dem Ergebnis gelangen, daß das deutsche Kapital auf seine Errungenschaften in China keineswegs stolz sein kann. Die deutsche Bourgeoisie verhüllt diese Tatsache nicht, sie zieht aber aus ihr nur den Schluß, daß es notwendig sei, mit gesteigerter Energie an die Eroberung des chinesischen Marktes zu schreiten. Während die Kulturbedürfnisse des deutschen Volkes nur in geringem Maße befriedigt werden, gründet das Deutsche Reich eine Hochschule in China, um durch die Ausbildung von Chinesen Agenten für das deutsche Kapital zu erziehen, während in Deutschland die Teuerung wütet, und die Regierung jeder Forderung des deutschen Volkes nach Abschaffung der von ihr mitverschuldeten Wirtschaftspolitik ein schroffes Nein entgegensetzt, nimmt sie sich liebreich der hungernden chinesischen Bauern in Schantung an, um den Boden für die zukünftige Eroberungspolitik in China vorzubereiten. Der Ausbruch der chinesischen Revolution mit ihren nicht vorauszusehenden Folgen, weckt den alten Appetit des deutschen Imperialismus. » Schaut auf China und baut neue Kriegsschiffe« – schallt es aus den Verhandlungen der Schiffsbautechnischen Gesellschaft, und die imperialistische Presse vertritt die Ansicht, daß China wieder zum Tummelplatz des europäischen Imperialismus werden könne. Das deutsche Kapital wittert wieder Morgenluft. Was es auf dem Wege der friedlichen Ausbreitung nicht errungen hat, will es auf gewaltsamem Wege mit einem Schlage erobern. Und nur von dem Gang der Ereignisse am Gestade des Stillen Ozeans wird es abhängen, ob das nächste Jahr den deutschen Imperialismus nicht im Wirrwarr eines neuen chinesischen Abenteuers findet.
3. Das deutsche Kapital in der Türkei.
Auf dem zweiten Terrain, dessen Unterminierung das deutsche Kapital sich zur Aufgabe gestellt hat, in der Türkei, ist es auf nicht mindere Schwierigkeiten gestoßen wie in China. Sein erstes größeres Unternehmen, der Bau der Bagdadbahn, verletzte wichtige Interessen Englands. Erstens stärkte es die Lage des jungen deutschen Konkurrenten, was dem englischen Kapital um so unangenehmer war, als es diesen Konkurrenten an allen Enden der Welt vorfand. Zweitens stärkte es die Türkei, was seit dem Augenblick, wo Rußland das Schwergewicht seiner Ausbreitung nach dem fernen Osten verlegt hatte, nicht mehr im Interesse des englischen Kapitals lag. Dazu kamen noch englische Pläne, die durch die Bagdadbahn durchkreuzt wurden; so der Plan einer Bahn, die Ägypten durch das südliche Arabien und Persien mit Indien verbinden sollte, und die großen Pläne über die Besiedlung Südmesopotamiens mit ägyptischen Bauern, d. h. die Vorbereitung der Annexion dieser Gebiete durch England. Zu dem englischen Widerstand gesellte sich der seines damaligen mittelasiatischen Konkurrenten, Rußlands. Seit den Erfahrungen, die Rußland mit dem befreiten Bulgarien gemacht, seitdem ihm klar geworden, daß es auf dem Wege nach Konstantinopel starken Widerstand nicht nur bei den westeuropäischen Mächten, sondern selbst bei den erwachenden »slawischen Brüdern«, finden würde, entdeckte es sein asiatisches Herz und wendete sich in der Richtung des kleinsten Widerstandes, zu den Gestaden des Stillen Ozeans, wo es von China keinen nennenswerten und von Japan nur schwachen Widerstand erwartete. In demselben Jahre, in dem die provisorische Konzession der Bagdadbahngesellschaft erteilt wurde, begann der Bau der mandschurischen Bahn. Kein Wunder also, daß die auf die Konservierung des Status quo gerichtete russische Politik im nahen Orient die Bagdadbahn als eine ernste Störung ihrer Kreise betrachten mußte, um so mehr, als sie auf ihre alten Pläne der Erringung des Zutritts zum Persischen Golf nicht verzichtet hatte. Der zukünftigen Position Rußlands in einem Hafen Südpersiens konnte die Möglichkeit des Aufkommens einer türkischen oder, was man für noch wahrscheinlicher hielt, einer deutschen Flotte im Persischen Golf, in dem Hafen, mit dem die Bagdadbahn enden würde, ebenso unangenehm werden wie es England bedrohlich erscheinen würde. Aber auf die Neutralität Deutschlands angesichts der bevorstehenden Auseinandersetzung im fernen Osten angewiesen, mußte sich die russische Gegnerschaft mit zwei Maßregeln begnügen: mit der Verpflichtung der Türkei, daß alle Bahnbauten am Schwarzen Meere nur von Russen oder vom türkischen Staate selbst gebaut werden. Die zweite Maßregel bestand in der Einwirkung auf die französische Regierung, die Bagdadbahnwerte zur offiziellen Notierung auf der Pariser Börse nicht zuzulassen, sie sollte nicht nur der Bagdadbahn schaden, sondern auch den unermeßlichen Pumpplänen Rußlands nützen. Die französische Regierung nahm eine feindliche Stellung dem Bagdadbahnplan gegenüber nicht nur unter der Einwirkung Rußlands ein. Angesichts der Schwäche der französischen Industrie, ihrer geringen Konkurrenzfähigkeit, mußte die französische Regierung die Stärkung des deutschen Exports nach der Türkei befürchten. Tatsächlich ist denn auch, während der deutsche Export nach der Türkei von (in runden Zahlen) 35 Millionen im Jahre 1901 auf 67 im Jahre 1905 gewachsen ist, der französische in derselben Zeit von 35 auf nur 40 gestiegen, obwohl in dieser Zeit das in der Türkei angelegte französische Kapital auf mehr als zwei Milliarden, das deutsche aber nur auf 300 bis 500 Millionen Mark geschätzt wurde. Aber trotz der Feindschaft der französischen Regierung und der Gefahr, die dem französischen Einfluß in der Türkei drohte, nahm das französische Kapital einen starken Anteil an der Finanzierung des Bagdadbahnunternehmens (er beträgt jetzt 30–40 Prozent des Gesamtkapitals). Die hohen Profite, die einzelnen Banken und den Rentiers winkten, überwogen das Interesse der französischen auswärtigen Politik.
Die türkische Regierung ließ sich durch diese Schwierigkeiten nicht abschrecken. Abdul Hamid, ein in wirtschaftlichen Sachen moderner Kopf, wußte die Bedeutung des Eisenbahnnetzes als der wichtigsten Vorbedingung der staatlichen Zentralisation sehr wohl zu würdigen. Er wußte, daß nur die Bagdadbahn ihn zum Herrscher über Mesopotamien und Babylonien machen konnte, über Länder, die jetzt nur ein Tummelplatz der Raubzüge der Beduinen waren. Und die kurzen Erfahrungen, die er mit den anatolischen Bahnen gemacht hatte, zeigten ihm, wie sehr die Bahnen die Steuerkraft erhöhen. Da aber die türkische Regierung nicht imstande war, selbständig den Bahnbau zu unternehmen, mußte sie ihn einer Kapitalistengruppe übergeben, hinter der jene Regierung stand, die am meisten Interesse an einem Verschieben der Aufteilung der Türkei hatte. Das war Deutschland, und so gewährte Abdul Hamid im Jahre 1902 die Kilometergarantie für die 200 Kilometer lange Strecke Konia-Eregli, die am 25. Oktober 1904 dem Betrieb übergeben wurde.
Aber die Gegner ruhten nicht. Sie nutzten die finanziellen Schwierigkeiten der Türkei aus, um den weiteren Bahnbau zu hintertreiben. Wie bekannt, besitzt die Türkei auf Grund internationaler Verträge kein Recht, einen autonomen Zolltarif aufzustellen, zur Erhöhung der Zölle ist die Zustimmung der Mächte nötig, die nach einer treffenden Bemerkung Galsters Galster: »Die Türkei im Rahmen der Weltwirtschaft«, Greifswald 1907, Seite 63. in Konstantinopel als überzeugte Freihändler auftreten, obwohl die Zollmauern von den europäischen Staaten für ihre eigenen Gebiete dauernd erhöht werden. Und so bewilligten im Jahre 1906 die Westmächte die Erhöhung der Wertzölle von 8 Prozent auf 11 Prozent nur unter der Bedingung, daß der Erlös bloß für die Reformen in Mazedonien verwendet wird. Damit wollten sie mit einem Schlage gleich zwei Fliegen treffen: in den Augen der Balkanvölker paradierten sie als ihre speziellen Beschützer, und gleichzeitig glauben sie dem Unternehmen des deutschen Kapitals einen tödlichen Schlag versetzt zu haben. Obwohl nach einem früheren Vertrag der Erlös der Zölle schon der Bagdadbahngesellschaft zugebilligt war, protestierte Deutschland gegen die Bedingungen der Westmächte nicht, um der Türkei, deren Vertrauen zu gewinnen es noch galt, keine Schwierigkeiten zu bereiten. Die deutsche Regierung und die Deutsche Bank konnten so entgegenkommend sein, weil andere Quellen den weiteren, wenn auch langsamen Bau ermöglichten. Im Jahre 1903 fand die Unifizierung der vier Serien der türkischen Staatsschulden statt. Die Ersetzung dieser in schweren Zeiten zu schlechten Bedingungen aufgenommenen Anleihen durch einen einheitlichen Anleihewert machte verschiedene Einnahmen frei, die bis dahin der Verzinsung der Staatsschuld hatten dienen müssen. Nach langem Kampfe, den die Vertreter der Westmächte gegen die Überweisung eines Teiles dieser Einkünfte an die Bagdadbahngesellschaft zur Deckung der Kilometergarantie führten, erteilte Abdul Hamid im Jahre 1908 die Kilometergarantie für die 840 Kilometer lange Strecke bis zum Dorfe El Helif im oberen Mesopotamien, die den schwierigsten Teil des Baues bildet, da es sich um die Durchquerung des Taurus und Amanusgebirges handelt.
Der Bau dieser Strecke war noch nicht begonnen, als das Hamidsche Regime wie ein Kartenhaus unter dem Anprall der jungtürkischen Bewegung zusammenbrach. Mit den Jungtürken schienen die Westmächte die Oberhand in Konstantinopel zu gewinnen. Die Jungtürken, die als Flüchtlinge die Gastfreundschaft Englands und Frankreichs genossen hatten, während der deutsche Boden die Sohlen der Schnorrer und Verschwörer brannte, kamen an das Staatsruder mit der Sympathie für die Westmächte, zu der sich die Antipathie gegen die Freundin Abdul Hamids, die deutsche Regierung, gesellte. Aber die objektive Tatsache, daß die Interessen Englands die Schwächung und Aufteilung der Türkei erfordern, daß Rußland den Balkanstaaten durch die neoslawische Bewegung neue Hoffnungen einzuflößen suchte, daß es nach dem mittelasiatischen Abkommen mit England die Türkei von der persischen Seite her zu bedrohen schien, brachte in sehr kurzer Zeit die auswärtige Politik der Türkei in die alten Geleise. Die Fortführung der Linie von Burgurla an wurde im Frühjahr 1909 begonnen. England mußte nun einsehen, daß die Vereitelung des Baues der Bagdadbahn nicht leicht sein werde, und so versuchte es jetzt wenigstens die Gefahr, die den englischen weltpolitischen Plänen von der Bahn drohte, nach Möglichkeit zu beseitigen. Sie forderte, die Trace von Adana an sollte entlang dem Golf von Alexandrette laufen, was allerdings abgeschlagen wurde, obwohl dieser Teil der Bahn zu den wirtschaftlich einträglichsten gehören würde. Die türkische Regierung blieb nach einem gewissen Schwanken bei dem alten Projekt, da nach der Meinung der militärischen Sachverständigen die Annahme der englischen Pläne den englischen Kriegsschiffen die Möglichkeit geben würde, in Kriegszeiten die Truppentransporte nach Arabien und Mesopotamien zu unterbrechen. Aber nicht nur die gesteigerte Widerstandskraft der Türkei, zu der er teilweise auch beigetragen hatte, kam dem deutschen Imperialismus zugute. Auch die immer mehr zutage tretende Schwäche der auswärtigen Politik des konterrevolutionären Rußlands erwies ihm einen entschiedenen Dienst. Seit dem Zusammenbruch der »neoslawischen« Balkanpolitik Rußlands wendet sie sich wieder von den Fragen des nahen Orients, denen Mittelasiens und des fernen Orients zu. Während sie sich aber im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts dabei nur der Neutralität Österreichs im nahen Orient versichern mußte und Deutschland so sehr durch das Bündnis mit Frankreich einzuschüchtern wußte, daß sie selbst dessen Unterstützung im fernen Orient nach dem Chinesisch-Japanischen Kriege bekam, muß der restaurierte Zarismus jetzt seiner geschwächten und der mächtig gestärkten Stellung des deutschen Imperialismus Rechnung tragen. Und er erklärt in Potsdam, nichts gegen den Weiterbau der Bagdadbahn einwenden zu wollen. Noch mehr, er stimmt dem deutschen Plane zu, nach dem eine Zweigbahn nach der persischen Grenze (nach Chanikin) gebaut werden soll, die nicht nur dank der Beförderung der persischen Pilger zum heiligen Orte in Kerbela zu den finanziell einträglichsten Linien des Bahnsystems gehören wird, sondern noch die persischen Märkte dem deutschen Kapital öffnet. Die so geänderte Haltung Rußlands ermöglichte der türkischen Regierung die Erteilung nicht nur des Zugeständnisses zum Bau der weiteren 1435 Kilometer langen Strecke von Helif nach Bagdad, sondern sie rollt die Frage des Baues der letzten 650 Kilometer betragenden Strecke von Bagdad zum Persischen Golf auf. Über diese Strecke werden jetzt Verhandlungen zwischen Türkei, Deutschland, England, Frankreich und Rußland geführt. Zu ihrer Ermöglichung willigte die Bagdadbahngesellschaft in die Rückgabe der Konzession, auf deren Grund sie die Bahn bis zum Persischen Golf führen könnte, und es wird verhandelt über die Art, wie die letzte Linie gebaut werden soll, ohne die englischen Interessen zu verletzen, welche die Türkei nicht gänzlich ignorieren kann, ohne England zu einer offensiven Politik zu reizen.
In die Verhandlungen tritt England in ganz anderer Haltung ein als im Jahre 1903. Während der letzten Debatten im Oberhaus erklärte der Regierungsvertreter, Lord Morley, gerade heraus, daß die ablehnende Haltung Englands »durch die späteren Ereignisse keinesfalls gerechtfertigt wurde«. Trotzdem wird es wohl noch manche Kämpfe geben, bis es zu einer Einigung kommen wird. Ihr Zustandekommen wird nicht nur durch Gegensätze in der englischen Finanzwelt verschleppt, sondern in erster Linie durch die Bemühungen Englands, selbst nach der bisher verlorenen Kampagne zu retten, was sich retten läßt.
Die Bagdadbahn hatte eine große politische Bedeutung schon in dem Augenblick, wo ihr Plan gefaßt wurde. Diese Bedeutung bestand erstens – wie schon erwähnt – in der Schaffung großer ökonomischer Interessen des deutschen Kapitals auf türkischem Boden, was ihm die Möglichkeit gab, bei einer eventuellen Teilung des türkischen Reiches Erbansprüche zu erheben, zweitens in der militärischen Stärkung der Türkei. Das Erstarken des deutschen Imperialismus, dessen erster mit großer Mühe errungener Erfolg die Bagdadbahn ist, der Sieg der Revolution in der Türkei, das Aufkommen einer modernen revolutionären Bewegung in Indien, die natürlich ganz anders zu bewerten ist als die früheren zerstreuten Aufstände einzelner Stämme, das Aufkommen der nationalistischen Bewegung in Ägypten, der Beginn des Regenerationsprozesses Persiens, das alles hat die politische Bedeutung der Bagdadbahnfrage mächtig erhöht. Zu den Momenten, die wir schon gestreift haben, kommen nun noch andere hinzu. Zunächst die Bedeutung der Bagdadbahn und der von ihr beschleunigten Stärkung der Türkei in Arabien und Mesopotamien für den deutsch-englischen Gegensatz, worauf Paul Rohrbach in der jüngst erschienenen zweiten Auflage seiner Arbeit » Die Bagdadbahn« in folgenden Worten hinweist:
»Es gibt für Deutschland im Grunde nur eine einzige Möglichkeit, einem englischen Angriffskrieg zu begegnen, und das ist die Stärkung der Türkei. England kann von Europa aus nur an einer Stelle zu Lande angegriffen und schwer verwundet werden: in Ägypten. Mit Ägypten würde England nicht nur die Herrschaft über den Suezkanal und die Verbindung mit Indien und Asien, sondern wahrscheinlich auch seine Besitzungen in Zentral- und Ostafrika verlieren. Die Eroberung Ägyptens durch eine mohammedanische Macht wie die Türkei könnte außerdem gefährliche Rückwirkungen auf die 60 Millionen mohammedanischer Untertanen Englands in Indien, dazu auf Afghanistan und Persien haben. Die Türkei aber kann nur unter der Voraussetzung an Ägypten denken, daß sie über ein ausgebautes Eisenbahnsystem in Kleinasien und Syrien verfügt, daß sie durch die Fortführung der anatolischen Bahn einen Angriff Englands auf Mesopotamien abwehren kann, daß sie ihre Armee vermehrt und verbessert, und daß ihre allgemeine Wirtschaftslage und ihre Finanzen Fortschritte machen … Auf der anderen Seite aber würde die bloße Erkenntnis, daß die Türkei militärisch stark, ökonomisch gefestigt und im Besitz genügender Eisenbahnverbindungen ist, für England möglicherweise schon genügen, um auf den Gedanken des Angriffs auf Deutschland zu verzichten, und das ist es, worauf die deutsche Politik abzielen muß. Die Politik der Unterstützung, die Deutschland der Türkei gegenüber verfolgt, bezweckt nichts anderes als den Versuch, eine starke Versicherung gegen die von England her drohende Kriegsgefahr zu schaffen« Rohrbach: Die Bagdadbahn, Berlin 1911 (Seite 19).. Die Ausführungen Rohrbachs stellen sehr weite politische Perspektiven dar, die nur bei der weiteren Erstarkung der Türkei sich verwirklichen könnten. Vor wenigen Jahren noch hätte die Möglichkeit einer türkischen Offensive gegen England nicht einmal als Gegenstand der Bierbankpolitik, sondern direkt als Hirngespinst gegolten. Heute aber muß man diesem bisher bei der Behandlung der Bagdadbahnfrage wenig in Betracht kommenden Moment die ihm zukommende Bedeutung zuerkennen. Denn obwohl die Mächte auch heute noch mit der Möglichkeit eines Zusammenbruchs des jungtürkischen Regiments rechnen, so ziehen sie andererseits auch die Möglichkeit in Betracht, daß sich die Türkei durchschlagen und eine Rolle in den weltpolitischen Auseinandersetzungen spielen wird. Was weiter eine besondere Berücksichtigung erfordert, sind die Umwälzungen in Mittelasien, speziell in Persien. Hier läuft die englische Politik nach dem Siege der Revolution auf die Hemmung des Reorganisationsprozesses Persiens hinaus. Das ist aber nur möglich, wenn das Tempo seiner ökonomischen Entwicklung verlangsamt wird. Ob das geschieht zur Schaffung eines wüstenartigen Glacis in Südostpersien, ob zur Vorbereitung der späteren Annexion – dies festzustellen ist natürlich unmöglich –, die Erstarkung der Türkei in Mesopotamien, die wirtschaftliche Entwicklung dieser Stätte alter Kultur würde jedenfalls einen dicken Strich durch die englischen Pläne darstellen, und so ist es kein Wunder, daß in der jetzigen Situation, wo die Hintertreibung des Baues unmöglich ist, nachdem der Versuch, die Bahn unter die Obhut der englischen Schiffskanonen im Golf von Alexandrette zu stellen, mißlungen ist, England selbst alles tut, um den bestimmenden Einfluß auf die Bahnlinie von Bagdad zum Persischen Golf zu bekommen.
Welche Trümpfe hat England in der Hand? Neben dem wichtigsten, einer maritimen und finanziellen Macht, die der Türkei nicht erlaubt, ohne sehr großes Risiko offen auf die Seite des Dreibundes überzugehen, ist es seine Stellung in Koweit, der besten Endstation der Bagdadbahn am Persischen Meer. Da der Hafen in Bassora sehr kostspielige Arbeiten erfordern würde, um als Endstation zu dienen, muß der Türkei sehr daran gelegen sein, die Bahn in Koweit ausmünden zu lassen. Koweit ist formell seit 1638 ein der Türkei untertäniges Sultanat, das, seitdem Midhat Pascha von Bagdad aus in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die türkische Herrschaft am Persischen Meer befestigte, als solches selbst von England angesehen worden war. Seitdem aber die Bagdadbahnfrage England auf die Gefahr der Erstarkung der Türkei am Persischen Meer aufmerksam gemacht hatte, wußte England seine Stellung in Koweit so zu befestigen, daß die Türkei genötigt war, nach einem von dem bekannten englischen diplomatischen Schriftsteller Lucien Wolff gesehenen Dokumente (»Daily Graphic« vom 20. März 1911) einen Zustand anzuerkennen, nach dem weder die Türkei noch England Koweit militärisch besetzen dürfen. Das bedeutet, daß ohne Einwilligung Englands die Bagdadbahn nicht in Koweit enden kann, wenn die Türkei nicht einen militärischen Konflikt mit England unmittelbar heraufbeschwören will. Der zweite Trumpf in Englands Händen, auf den Sir Edward Grey jüngst erst unzweideutig im englischen Parlament hinwies, ist die Unmöglichkeit der von der Türkei schon so lange begehrten Erhöhung der Zölle von 11 auf 15 Prozent ohne Einwilligung Englands.
Welche Forderungen will England vermittels dieser Trümpfe durchsetzen? Es ist in erster Linie die Übergabe der Leitung der Bahnlinie von Bagdad bis Koweit in die Hände Englands, zweitens die überwiegende Anteilnahme des englischen Kapitals an der Finanzierung dieser Strecke. Demgegenüber erstrebt die Türkei eine internationale Verwaltung der Linie und eine solche Beteiligung der türkischen und ausländischen Kapitalistengruppen, daß keine das Übergewicht bekommt. Bei den Verhandlungen darüber sucht man einen Mittelweg zwischen den beiden extremen Standpunkten zu finden, und die allgemeine internationale Situation der nächsten Jahre wird bestimmen, welche Interessen den Sieg behaupten werden. Die alldeutsche Presse behauptet, daß der deutsche Imperialismus ganz um das erstrebte Ziel kommen wird, wenn die Lösung der Frage auch nur annähernd den Forderungen Englands entspricht, da dann die Bagdadbahn das Los des Suezkanals teilt. Selbst wenn man die wirtschaftliche Bedeutung der Bagdadbahn fürs erste ganz beiseite läßt, muß man diese Erklärung der Dehn, Plehn und Konsorten doch lediglich als einen Versuch ansehen, der deutschen Regierung den Rücken zu stärken, denn die Tatsache schon, daß die Türkei ihre Herrschaft in Mesopotamien bis Bagdad festigen würde, müßte jeden Versuch Englands, vom Süden her einen Vorstoß zu wagen, sehr erschweren, ganz abgesehen von der gänzlichen Durchkreuzung der englischen Pläne einer Bahn, die Ägypten mit Indien verbinden sollte, oder der Lahmlegung der wirtschaftlichen Entwicklung an den Gestaden des Persischen Golfs.
So bedeutet die Bagdadbahn einen Sieg des deutschen Imperialismus, selbst wenn bei dem Bau ihrer letzten Linie die englischen Interessen mehr berücksichtigt würden, als es nach Lage der Dinge heute zu erwarten ist. Aber der moderne Imperialismus ist keine Jagd nach Phantomen, nach einer bloß platonischen Weltherrschaft, sondern eine Politik des Kapitalismus, seiner reifsten Phase, der nach Anlagesphären für das von der sinkenden Profitrate bedrohte Kapital sucht. Von dem wirtschaftlichen Standpunkt gesehen, bedeutet der Bau der Bagdadbahn einen vollen Erfolg des deutschen Kapitals. Wie wir schon im ersten Kapitel ausgeführt haben, geben die Leiter des Unternehmens den bloßen Gründergewinn auf 138 Millionen Francs an, gar nicht gesprochen von den »Ersparnissen«, die sie bei den ihnen von der Türkei zugestandenen Baukosten machen. 160 Millionen Francs sollen diese Ersparnisse nach den Berechnungen englischer Fachmänner betragen. Daß der Bau der Bagdadbahn auch den deutschen Handelsverkehr mit der Türkei günstig beeinflußt, ergibt sich schon aus der Tatsache, daß seine Ziffern – die deutsche Einfuhr aus der Türkei stieg in den Jahren 1902 bis 1910 von 36 auf 37 Millionen Mark, die deutsche Ausfuhr in die Türkei von 43 auf 105 Millionen Mark – nicht nur absolut, sondern auch im Vergleich mit dem Handelsverkehr anderer Staaten stark gewachsen sind.
4. Die Marokkopartie.
Wir erwähnten schon in dem einleitenden Abschnitt dieses Kapitels, daß die Konzentrierung der deutschen auswärtigen Politik auf zwei der wichtigsten Ziele – auf die Erringung einer Position in der Türkei und in China – keinesfalls das Vordringen auf anderen Gebieten ausschloß. Der deutsche Imperialismus benutzte jede Gelegenheit, Positionen zu erlangen, die wie die nach dem Spanisch-Amerikanischen Kriege von Spanien gekauften Karolineninseln, die deutschen älteren Besitzungen in der Südsee abzurunden halfen. Er suchte den Einfluß des deutschen Kapitals auch in Gebieten zu verstärken, die er dank ihrer geographischen Lage und historischen Entwicklung nicht in seine Einflußsphäre zu ziehen vermochte. Denn späterhin konnte er für den Verzicht auf politische Ansprüche in diesen, außerhalb der Linie seiner Entwicklung liegenden Gebieten Entschädigungen in anderen Gebieten erlangen, seien es politische oder territoriale, die wiederum zur Abrundung, zur Kommassation der alten Besitzungen dienen konnten.
Eine ganze Anzahl von Aktionen des deutschen Imperialismus, die auf den ersten Blick Ausbrüche einer irren, unsteten Politik zu sein scheinen, gehören bei näherer Betrachtung zu dieser Politik der Schaffung von Hilfsmitteln zur Unterstützung der hauptsächlichsten Ziele des deutschen Imperialismus. So war es mit der deutschen Politik in Persien, die neben den Handelszielen den Zweck verfolgte, Trümpfe gegen Rußland in die Hand des deutschen Imperialismus zu geben, und die übrigens auch dazu verholfen hat, Rußland von einem zu nahen Verhältnis zu dem englischen Imperialismus abzuhalten. Zu dieser Politik muß auch die Marokkopolitik der deutschen Regierung gerechnet werden, wenn man sie jetzt, beim Abschluß der Marokkokrise, rückschauend untersucht.
Die ganze Entwicklung der nordafrikanischen Geschichte in den letzten drei Jahrzehnten wies darauf hin, daß dieses entwicklungsfähige Land Aus der reichhaltigen, aber in vielen Fällen recht phantastischen Literatur über die wirtschaftlichen Verhältnisse Marokkos ist die objektiv geschriebene Abhandlung von Nauticus (für das Jahr 1909): » Marokko und seine Beziehungen zur deutschen Volkswirtschaft« (S. 270–296) hervorzuheben., wenn es nicht imstande sein würde, seine Unabhängigkeit zu wahren, Frankreich zufallen müßte. Die deutsche Marokkopolitik konnte den Plan der Fußfassung in Marokko nicht verfolgen, wollte sie ihre Kräfte nicht gänzlich zersplittern und eine Reibungsfläche mit Frankreich schaffen, die der deutschen Regierung die Hände auf anderen wichtigeren Gebieten binden müßte. Deutschland griff in die Marokkofrage ein, als Frankreich und England hinter seinem Rücken die Geschicke Marokkos im Jahre 1904 zu entscheiden suchten. Ein Protest dagegen sollte dartun, daß das deutsche Kapital den Anspruch erhebt, bei jeder Weltteilung mitsprechen zu dürfen. Das Ziel dieses Protestes war, den Versuch zu unternehmen, ob sich die Unabhängigkeit Marokkos nicht retten ließe, und ob es nicht ein Gebiet der gemeinsamen Ausbeutung für das internationale, nicht nur französische Kapital, bilden könnte. Wäre die Aktion Deutschlands gegen die französischen Marokkopläne im Jahre 1905 von Erfolg gekrönt gewesen, dann hätte das deutsche Kapital zwei Fliegen mit einem Schlage getötet: es hätte sich ein Feld zur Ausbeutung bewahrt, und könnte als Beschützer der islamitischen Freiheit vor der Türkei stolzieren. Diese Ziele wurden nicht erreicht, obwohl die deutsche Regierung sie durch starkes Säbelgerassel unterstützte; Frankreich wurden dank der Unterstützung Englands, Rußlands und Italiens auf der Konferenz in Algeciras im Jahre 1906 Funktionen in Marokko überwiesen, deren Ausübung, bei gleichzeitiger Minierarbeit des französischen Börsenkapitals, Marokko mit jedem Tage immer mehr an Frankreich ausliefern mußte. Angesichts dieser Tatsache mußte der deutsche Imperialismus auf seine bisherigen Ziele in der Marokkopolitik verzichten, denn der diplomatische Kampf gegen die Beherrschung Marokkos durch Frankreich mußte mit einem Kriege enden, Marokko aber war eines Krieges für das deutsche Kapital nicht wert, denn es lag abseits von den Hauptzielen der deutschen Weltpolitik. Es galt hier nun, aus der Anerkennung des französischen Appetits auf Marokko politischen Gewinn zu erzielen und zugleich koloniale Nebengewinne herauszuschlagen. Diese Politik hatte die deutsche Regierung in dem Februarabkommen vom Jahre 1909, wie in dem Novemberabkommen des Jahres 1911 verfolgt. Im Jahre 1909 erkannte sie an, daß Frankreich in Marokko politische Interessen besitzt, und nahm für sich nur Handelsinteressen in Anspruch. Dank diesem Zugeständnis schloß sich Frankreich den Versuchen Englands nicht an, die bosnische Krise in einen Weltkrieg zu verwandeln, in dem Deutschland und Österreich einer englisch-französisch-russischen Koalition gegenübergestanden wäre. Die deutschen Zugeständnisse in der Marokkofrage dienten also zur Abwehr eines Angriffes der Tripelentente, was zur Durchbrechung des Ringes, den England um Deutschland gezogen hatte, um den deutschen Imperialismus auf die Knie zu zwingen, führte.
In den letzten zwei Jahren entwickelte sich die Marokkofrage soweit, daß sie zur Lösung reif wurde. Die Weltlage erlaubte der deutschen Regierung nicht, die bisherigen Bahnen ihrer Marokkopolitik zu verlassen und ein Stück des marokkanischen Bodens an sich zu reißen. Die Lage der Türkei war seit dem Frühjahr bedroht: der albanische und arabische Aufstand, der Niedergang des jungtürkischen Ansehens, das Brodeln auf dem Balkan, ließen Verschiedenes erwarten. Die Türkei bildet aber, wie hier schon wiederholt angegeben worden ist, eine wichtige Position in den Berechnungen des deutschen Imperialismus gegenüber England. Dabei näherte sich das deutsch-englische Ringen um die Endlinie der Bagdadbahn seinem Abschluß. In einer solchen Situation eine Politik zu beginnen, die Frankreich und England fesseln müßte, war für die deutsche Diplomatie – schätzt man sie auch noch niedriger als gewöhnlich ein, obwohl Übertreibung auch hier die Erkenntnis trübt – unmöglich. Umgekehrt: ihre Politik ging darauf hinaus, das Werk von Potsdam weiterzuführen. In Potsdam wurde Rußlands Verhältnis zur Tripelentente gelockert. Die Liquidation der Marokkofrage sollte Frankreich von der Notwendigkeit befreien, die englische Unterstützung in Marokko mit der Unterstützung Englands im nahen Osten zu bezahlen, wo die französischen Interessen selbst keine Schwächung der Türkei erfordern. Dieses allgemeine Ziel der letzten deutschen Marokkoaktion erklärt zum Teil den nervösen und sonst unverständlichen Eingriff der englischen Regierung in die deutsch-französischen Verhandlungen durch die Rede Lloyd Georges vom 21. Juli vorigen Jahres. Es galt, in Frankreich den Eindruck hervorzurufen, als ständen der deutschen Aktion noch andere Ziele als die offiziell zugestandenen, es galt, in der Welt den Eindruck zu wecken, Deutschland bleibe in dem Rahmen von Entschädigungsforderungen nur dank dem englischen Machtwort. Und dieses Ziel war die Ursache, warum es Deutschland so sehr daran gelegen war, daß die Verhandlungen unter vier Augen, nur zwischen Frankreich und Deutschland, stattfanden. Die zweite weltpolitische Ursache, warum Marokko nicht das Ziel der deutschen Politik bilden konnte, war die schon früher bei der Festlegung der deutschen Marokkopolitik in Betracht gezogene Tatsache, daß eine Besitzergreifung eines Teiles von Marokko ohne Zustimmung Frankreichs – selbst wenn sie zu keinem Kriege geführt hätte, was sehr unwahrscheinlich zu sein scheint –, Deutschland genötigt hätte, dort eine große Land- und Seemacht zu unterhalten, das heißt, sich für die nächsten, für die ganze weltpolitische Entwicklung so kritischen Jahre, in der Nordsee sehr zu schwächen. Denn selbst wenn die Reichstagsabgeordneten ohne weiteres eine große Flottenvermehrung bewilligen wollten, würde ihr Ausbau Jahre erfordern, in denen die Schiffe in Agadir die Entblößung der heimischen Gewässer bedeuten müßten. Zuletzt kam in Betracht die Gefahr des Krieges, der von vornherein als Angriffskrieg unter für Deutschland sehr ungünstigen diplomatischen Bedingungen stattfinden würde. Schon diese Momente genügten, um den deutschen Imperialismus von allen territorialen Absichten auf Marokko zurückzuhalten. Sie wurden unterstützt durch das Fehlen größerer kapitalistischer Interessen Deutschlands in Marokko, durch die Teilnahme eines Teils des deutschen Kapitals an den französischen Unternehmungen in Marokko und durch die zunehmende Protestation des Proletariats, mit der nicht zu rechnen die Regierung keinen Grund hatte, da Marokko nicht zu den Lebensinteressen des deutschen Kapitals gehört.
So verfolgte die deutsche Regierung auch bei der letzten Marokkoaktion in erster Linie die alten Ziele vom Jahre 1909, die Schwächung der Position Englands durch die Wegräumung des Konfliktsstoffes, der immer wieder zu Reibungen mit Frankreich führte und es dem englischen Imperialismus in die Arme trieb. Ferner versuchte sie für die volle Anerkennung der französischen Marokkopläne Entschädigung auf kolonialem Gebiet zu erlangen. Die von Frankreich abgetretenen Gebiete von Französisch-Kongo Siehe Werner Stahl: Französisch-Kongo im Lichte der amtlichen französischen Berichterstattung des letzten Jahrzehnts. Berlin 1911. ein Sumpf- und Waldland, das nur dem Finanzkapital Profite abwerfen wird, da es nötig sein wird, aus den Groschen der deutschen Arbeiter neue Kolonialbahnen zu bauen – erlauben aber dem deutschen Imperialismus, den Versuch zu unternehmen, durch weiteren kolonialen Schacher mit Belgien und Portugal eine Verbindung zwischen den afrikanischen Kolonien Deutschlands zu schaffen. Ob das Abkommen das erste Ziel erreicht, ob es in England den Eindruck erweckt, daß es ebensowenig auf die aktive Unterstützung Frankreichs wie Rußlands gegen Deutschland wird rechnen können, ist eine Frage, die sich jetzt nicht beantworten läßt. Diese beiden Ziele geben der Marokkopolitik der Regierung, obwohl sie zum Verlust Marokkos für das deutsche Kapital und zur »Kongoentschädigung« geführt hat, die selbst für breite Kreise des Industrie- und Handelskapitals wenig verlockend ist, vom Standpunkt ihrer allgemeinen imperialistischen Politik einen gewissen Sinn. Die Tatsache, daß die deutsche Regierung keine territoriale Besitzergreifung in Marokko anstrebte, daß sie also nicht gesinnt war, wegen Marokko einen Krieg zu beginnen, hat keinesfalls die Gefahr eines Krieges ausgeschlossen. Da der Charakter der deutschen Marokkopolitik auch der französischen und englischen Regierung bekannt war, konnten sie in ihrer Unnachgiebigkeit weiter gehen, als der deutsche Imperialismus ohne Einbuße an Ansehen zu ertragen vermochte. Das hätte leicht zu einer Besitzergreifung in Marokko mit allen ihren Konsequenzen führen können, und auch etwaige Unruhen in Südmarokko zur Zeit der Stationierung der deutschen Kriegsschiffe in Agadir hätten Deutschland aus der festgelegten Bahn herauswerfen können.
Die Marokkopolitik des deutschen Imperialismus konnte den Weltkrieg entfesseln wie jede seiner Aktionen, die von Anfang an auf Biegen oder Brechen losging. Dasselbe gilt von allen anderen imperialistischen Unternehmungen, die dem deutschen Imperialismus als untergeordnete Trümpfe bei seinen Hauptzügen dienen sollen. Es gibt in dieser Zeit der großen weltpolitischen Spannungen keine imperialistischen Aktionen, denen nicht die Gefahr des Weltkrieges auf dem Fuße folgen würde. Die Tatsache also, daß der deutsche Imperialismus in einer Frage keine territorialen Absichten hat, nimmt seiner Einmischung, wenn sie nur ernsterer Natur ist, nicht den Charakter einer imperialistischen, den Frieden gefährdenden Aktion. Dasselbe gilt natürlich auch von der Einmischung Englands oder Frankreichs in die Hauptaktionen des deutschen Imperialismus. Die imperialistischen Gegensätze können an Punkten zur Austragung kommen, die keineswegs zu den Brennpunkten der deutschen auswärtigen Politik gehören.
Von Jahr zu Jahr wächst das deutsche Kapital an Macht, und es verfügt über eine immer größere Schar von Proletariern. Auf dem inneren Markt hat es mit dem alten, selbständig produzierenden Kleinbürgertum aufgeräumt. Mit jedem Jahre steht es gefügter da, in Kartellen und Aktiengesellschaften zusammengeschlossen, die mit jedem Jahre immer einheitlicher von einem halben Dutzend Banken kommandiert werden. Nur die Vereinigten Staaten Nordamerikas können sich mit der rapiden Entwicklung des deutschen Kapitals messen. Mit Stolz schaut es auf die Ziffernreihen, die diesen Entwicklungsprozeß illustrieren. Die Kohlen- und Eisenproduktion, dieser Maßstab des wirtschaftlichen Fortschrittes, betrug in der Zeit von 1890 bis 1910 Nauticus für 1910: Zehn Jahre Flottengesetz, S. 15–42..
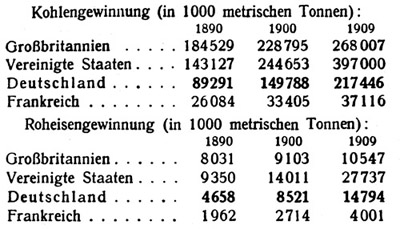
Auf dieses Wachstum der Produktionskräfte gestützt, hat das deutsche Kapital seinen Außenhandel in den letzten 25 Jahren mehr als verdoppelt. Von 6,5 Milliarden Mark im Jahre 1883 ist er auf 14,1 Milliarden Mark im Jahre 1908 gestiegen. Das Tempo seiner Entwicklung ist derart, daß es unmittelbar hinter den Vereinigten Staaten folgt. Der Außenhandel betrug:
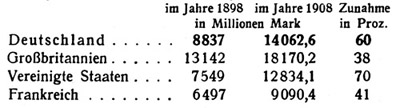
Der deutsche Besitz an auswärtigen Wertpapieren wurde im Jahre 1905 offiziell auf 16 Milliarden geschätzt. Obwohl es an späteren Schätzungen fehlt, weist eine ganze Reihe von Tatsachen darauf hin, daß der deutsche Wertpapierbesitz in viel schnellerem Tempo wächst, als früher. Denn seitdem Deutschland die Bahnen des Imperialismus beschritten hat, sucht das deutsche Kapital, die ihm von den imperialistischen Machtmitteln verliehene Position in den wirtschaftlich unentwickelten Ländern auszunützen, und es wird von der Regierung angespornt, ihre imperialistischen Aktionen wirtschaftlich vorzubereiten Der französische Ökonomist Blondel berechnet in den »Questions diplomatiques et coloniales« (Sommer 1911), daß der deutsche Kapitalexport vor 15 Jahren 10, vor 10 Jahren 16 Milliarden betragen hat; für das Jahr 1908 beziffert er die Wachstumsrate auf 744, für das Jahr 1909 auf 977 Millionen. Den Zuwachs im Jahre 1910 berechnet die Frankfurter Zeitung« mit 20 Prozent.. Das Machtgefühl des deutschen Kapitals ist stark gewachsen. Es will sich nicht mehr als Bittender in die Fremde begeben, der nachschaut, ob ihm nicht vom Tische der älteren kapitalistischen Staaten ein Brocken zufällt, wie das vor der Reichsgründung der Fall war. Aber dem wachsenden Machtgefühl im Inneren gesellt sich nicht die Durchsetzungsmöglichkeit dieser Macht dem Auslande gegenüber. Das deutsche Kapital blickt mit Eifersucht auf die Weltstellung des englischen Kapitals: es sieht, wie das französische Kapital, das sich weder auf eine zunehmende Bevölkerung, noch auf eine rapid wachsende Industrie stützen kann, ein großes Weltreich gegründet. Das deutsche Kapital sieht, daß der Handelsverkehr seiner Kolonien mit Deutschland nach 25-jährigem Bestehen 100 Millionen Mark beträgt – bei 16 Milliarden des deutschen Außenhandels; selbst die Ausbeutung des deutschen Volkes vermittels dieser Kolonien geht nur schwer vonstatten. Zwei Jahrzehnte hindurch mußte es die Ausgaben für die Kolonien dem Reichstag direkt erpressen, denn jede Geldforderung für den Bau von Kolonialbahnen, die dem Kapital fette Zinsen abwerfen, wurde selbst von bürgerlichen Parteien mit der Erklärung beantwortet, das bedeute, Millionen in den Sumpf hineinzustecken. Parteien, die wie der Freisinn oder das Zentrum einen Anhang von Arbeitern oder Kleinbürgern besaßen, fürchteten die Verantwortung für diese offenkundige Verschleuderung von Millionen Steuergroschen für koloniale Ausgaben, von denen nicht einmal breitere Kreise der Bourgeoisie irgend einen Nutzen hatten.
Der Drang nach neuen Eroberungen, der die Einschwenkung Deutschlands in das Fahrwasser des Imperialismus vor 12 Jahren verursachte, nimmt mit jedem Jahr zu. Einmal im Sattel, reißt der Imperialismus auch solche Schichten des Bürgertums mit sich, die ihm anfangs Widerstand geleistet haben. Das Kleinbürgertum, das der Kolonialpolitik feindlich gegenüberstand, weil sie ihm nur neue Lasten auferlegte, die Handelsbourgeoisie, die die geringen Erträge des deutschen Kolonialbesitzes den großen Profiten aus dem Handelsverkehr mit den kapitalistisch entwickelten Ländern gegenüberstellte, alle diese Schichten gerieten in den Bann des Imperialismus, als er Aussichten auf neue Eroberungen eröffnete. Das Kleinbürgertum wurde von der nationalen Phrase in Gefangenschaft genommen, mit der der Imperialismus seine Geschäfte zu umgeben verstand, während die Handelsbourgeoisie von den Aussichten auf Profit geblendet wurde. Dem Imperialismus gelang es, einen so weitgehenden Umschwung in der Stimmung des deutschen Bürgertums herbeizuführen, daß selbst seine Stellung gegenüber den Kolonien eine freundlichere wurde. Der einen Teil des Kleinbürgertums und der Handelsbourgeoisie vertretende Freisinn, dessen führendes Organ, die »Freisinnige Zeitung«, noch am 10. November 1905 geschrieben hatte: »Die Kolonien lassen sich nicht ausbeuten, sondern beuten durch ihren Zuschußbedarf das Mutterland selbst aus«, zog im Verein mit den Konservativen und Nationalliberalen im Dezember 1906 in die Wahlschlacht unter dem Zeichen der Kolonialpolitik, und während der Marokkokrise des Jahres 1911 marschierte er Schulter an Schulter mit ihnen unter dem Banner des Imperialismus. Dieselbe Wandlung hat das Zentrum durchgemacht. Mit der imperialistischen Verseuchung dieser Parteien hat der deutsche Imperialismus, soweit es sich um die bürgerlichen Parteien handelt, freie Bahn im Innern erlangt.
Anders verhält es sich auf den Gebieten, wo der Kampf um neuen kolonialen Besitz ausgefochten werden muß. Hier stößt der deutsche Imperialismus auf Schritt und Tritt auf Hindernisse. Und die stärksten werden ihm von der ältesten imperialistischen Macht, von England, in den Weg gerollt. Will er türkische Bauern ausbeuten, indem er sich vom türkischen Staate Zinsgarantien beim Bahnbau und gesalzene Preise für Lieferungen bezahlen läßt, so kann er das nur tun, nachdem er die zahlreichen Steine fortgeräumt hat, die ihm das englische Kapital in den Weg gelegt hat. Und keinen Tag ist er sicher, ob England nicht die milchende türkische Kuh auf die Schlachtbank stößt. Will der deutsche Imperialismus den Appetit des französischen Kapitals auf Marokko ausnützen, um ihm ein Stück Mittelafrika zu entreißen, so stößt es wieder auf das englische Kapital, das dem französischen den Rücken stärkt, damit das deutsche keinen zu großen Anteil bekommt. Der deutsche Imperialismus weiß hierbei sehr gut, daß es sich nicht um eine vorübergehende Erscheinung handelt. Wie groß die Welt ist, wo nur noch etwas zu erobern ist, überall hat das englische Kapital wirtschaftliche oder strategische Interessen. Es ist eben eine Weltmacht. Es stellt sich den Bestrebungen des deutschen Kapitals entgegen, neue Kolonien durch Neuerwerbungen in Mittel- und Südafrika zu vereinigen, weil das England die Möglichkeit nehmen würde, die Bahn, die von Kairo bis weit nach dem Süden von Ägypten und vom Kap bis weit nach Rhodesien hinein gebaut wurde, zu einer Querbahn zu vereinigen, die Afrika vom Norden bis zum Süden durchschneidet. Will der deutsche Imperialismus Flottenstützpunkte erwerben, ohne die er keinen Krieg in fernen Ozeanen führen kann, so tritt ihm auch hier das englische Kapital in den Weg, das in ihm seinen gefährlichsten Feind sieht.
So zeigt sich der deutsch-englische Gegensatz als ein kapitalistischer Gegensatz, der nicht aus der Welt geschafft werden kann, solange das englische Kapital den Anspruch auf Weltherrschaft erhebt und das deutsche einen Teil dieser Herrschaft für sich gewinnen will. Nach Kämpfen, die, wie z. B. während der Marokkokrise, beide Staaten dicht an den Rand des Krieges gebracht haben, versuchen sie sich nun zu verständigen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß der deutsche und der englische Imperialismus eben jetzt solche Versuche unternimmt oder unternehmen wird. Es ist möglich, daß der englische Imperialismus dem deutschen gewisse Zugeständnisse machen wird, um die Spannung auf eine kurze Zeit abzuschwächen. Aber keiner von ihnen traut dem anderen über den Weg, keiner glaubt daran, daß sich die Gegensätze zwischen ihnen überbrücken lassen, und jeder will weiter rüsten, um in voller Rüstung dem anderen gegenübertreten zu können, wenn die Verständigungsidylle zu Ende ist. Und darum ist es totsicher, daß dieselbe deutsche Regierung, die heute offenkundig eine Verständigung mit England über die zentral-afrikanischen Fragen anstrebt, nach den Wahlen dem Reichstag eine neue Flottenvorlage auftischen wird. Ein Kampf gebärt den anderen, selbst wenn er von einem Waffenstillstand unterbrochen wird. Das Wettrüsten hört nicht auf, und der nächste Tag kann einen Zusammenprall zwischen dem deutschen und dem englischen Imperialismus bringen. Die Gefahr eines solchen Zusammenpralls wird durch die Tatsache erhöht, daß seit einigen Jahren in den Ländern des Orients eine Entwicklung eingesetzt hat, die überhaupt jede imperialistische Politik unmöglich machen kann. In dem von England seit hundert Jahren ausgesogenen Indien haben sich mit der Zeit Elemente entwickelt, die den Kampf um die Abschüttelung des englischen Joches mit modernen Mitteln zu führen beginnen. Die junge indische Bourgeoisie und Intelligenz will nicht länger Sklave des englischen Kapitals sein. In der schon stattlichen Schicht des Fabrikproletariats beginnt es zu gären, und diese soziale Gärung fließt mit der allgemeinen nationalen zusammen. Volksbewegungen und terroristische Attentate zeigen England, daß es eines Tages genötigt sein wird, seine Herrschaft über Indien mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Dies bringt einen unruhigen Zug in die englische Politik hinein, die unter dem fortwährenden Alp lebt, die indischen Schwierigkeiten könnten von anderen Mächten ausgenutzt werden, und die in dieser Angst sich auf Kämpfe vorbereitet und zu Kämpfen drängt. Dieselben Anzeichen des Erwachens der Orientvölker sehen die Franzosen in Indo-China. Die persische Revolution spricht dieselbe Sprache. Und die türkische wie die chinesische Frage beginnt eine Entwicklung, deren Konsequenzen überhaupt noch nicht abzusehen sind.
Die ganze imperialistische Welt steht Entwicklungstendenzen gegenüber, die dem Imperialismus die Kehle einzuschnüren drohen. Da ergreift jeden Staat die Lust, noch vor Torschluß auf Beute auszugehen, damit ihm die anderen Staaten nicht zuvorkommen und ihm die Möglichkeit kolonialer Entwicklung nicht gänzlich verschließen. Rußland steuert auf die Aufteilung Persiens los, damit dieser Staat nicht erstarkt und in die Reihen der kapitalistischen Staaten einrückt; Österreich, Bulgarien und Italien beeilen sich, ihre Beute in Sicherheit zu bringen, bevor die türkische Revolution die Türkei aus einem Objekt der imperialistischen Politik in einen mächtigen Staat verwandelt; andere Staaten lauern auf den Augenblick, wo sie dasselbe tun könnten. In Ostasien drängten Rußland und Japan, um im Nordwesten und Nordosten des chinesischen Reiches Fuß zu fassen, und die chinesische Revolution rollt auch vor allen anderen Staaten die Frage auf, ob es nicht besser sein würde, China aufzuteilen, solange das noch irgendwie möglich ist.
Die Gärung in den Ländern, die sich der Imperialismus seit Jahren auserkoren, steigert die Gärung in den imperialistischen Staaten. Niemand weiß, was er morgen tun wird, niemand, was er heute will. Einerseits mahnen die drohenden Gefahren seitens der erwachenden Kolonialländer an die Notwendigkeit, zwischen den alten kapitalistischen Staaten ein Einvernehmen herzustellen. So erklärt England sich bereit zu einem Übereinkommen mit Deutschland, das der deutschen Kolonialpolitik neue Bahnen in Afrika eröffnen würde; so versuchen England, Deutschland, Frankreich und die Vereinigten Staaten zusammen in China einzumarschieren. Aber zugleich mit diesen Tendenzen zur Schaffung eines Abkommens, das die alten imperialistischen Raubstaaten in eine Front gegen die Länder des erwachenden Orients stellen würde, wirken andere Kräfte, die nicht nur diese Tendenzen zu hintertreiben suchen, sondern selbst die alten Mächtegruppierungen in Gefahr stellen und alles ins Wanken bringen. Wenn die Angst vor großen Verwicklungen im Orient zu Vereinbarungen unter den imperialistischen Staaten drängt, so wirkt der Wille zum schnellen Zugreifen zersetzend auf diese Tendenz. Um Persiens Entwicklung zu hemmen, schlossen England und Rußland im Jahre 1907 ein Abkommen, das die beiden Staaten auch in der europäischen Politik näher brachte. Aber Rußland will nicht nur die persische Entwicklung aufhalten, sondern auch Nordpersien möglichst schnell in seine Hände bringen, wozu England schon darum keine Neigung zeigt, weil es in keine direkte Nachbarschaft mit Rußland, aus der nur Streitigkeiten entstehen können, kommen will. Darum näherte sich Rußland Deutschland, um freiere Hand gegen England in Persien zu erhalten. Angesichts dessen gewährt ihm aber auch England eine größere Bewegungsfreiheit in Persien, als im Vertrag von 1907 vorgesehen ist, daß aber dieses Recken und Strecken des Vertrages das Zusammengehen Rußlands und Englands in Europa, das zu den Grundpfeilern der weltpolitischen Lage gehört, nicht fördern kann, ist klar. England, Rußland und Frankreich gehören zu einem weltpolitischen Lager, aber während England die Aufrollung der türkischen Frage anstrebt, weil seine Bahnbaupläne zwischen Ägypten und Indien, wie seine ganze Stellung im Orient keine starke Türkei dulden können, wollen Frankreich und Rußland die jetzige Lage im nahen Osten aufrecht erhalten, weil das erste in Marokko, das zweite in Persien und an den chinesischen Grenzgebieten alle Hände voll zu tun hat und sich noch nicht stark genug fühlt, seine Kräfte auf dem Balkan mit Österreich, oder in Kleinasien mit der Türkei zu messen. So schafft die Entwicklung fortwährend Gegensätze in demselben imperialistischen Lager.
Wie sieht es nun in entgegengesetzter Lage aus? Die Annexion Bosniens und Herzegowinas durch Österreich im Jahre 1907 stellte eine Zeitlang die Position des deutschen Imperialismus in Frage, der als Verbündeter Österreichs für die Politik der Donaumonarchie verantwortlich gemacht wurde. Dieselbe Wirkung hat der Tripolisraub Italiens herbeigeführt, und es ist noch eine Frage, ob nicht der Fortgang des Türkisch-Italienischen Krieges Österreich zu einem Vorstoß auf dem Balkan verlocken wird. So zeigt sich der Dreibund, der als Organ der kontinentalen Machtpolitik entstanden ist, in den Fragen der imperialistischen Politik von Gegensätzen unterminiert.
Was nun? Diese Frage zu beantworten sind am wenigsten die Regierungen imstande. In allen Staaten nehmen die imperialistischen Kräfte an Umfang zu. Für alle verschlechtern sich die Bedingungen der imperialistischen Politik. Da nicht alle gleich stark sind, entsteht die Gefahr, daß manche auf eigene Faust Vorstöße im fernen und nahen Osten unternehmen werden. Gleichzeitig stehen in Afrika Machtverschiebungen bevor, die durch das deutsch-französische Kongoabkommen und die Schwäche Portugals aufgerollt worden sind. Und in dieser Situation voll Konfliktsmöglichkeiten fehlt den Regierungen jeder ordnende, leitende Gedanke. Jede verfolgt ihre eigenen Ziele, und wenn sie sich auch zur Erreichung eines gemeinsamen Zieles heute verständigen, so entzweien sie sich morgen wegen anderer Ziele, die die politische Situation aufgerollt hat. Ein Strudel reißt die imperialistischen Staaten mit sich fort und stößt sie aufeinander. Niemand ahnt, was aus diesen Zusammenstößen morgen erwachsen kann. Die kapitalistische Entwicklung, die wie keine andere die Beherrschung der Naturkräfte ermöglicht, hat ein neues Gebiet elementarer Kräfte geschaffen, von denen sie beherrscht und wild vorwärts getrieben wird. Sie endet als Gesellschaftsordnung, die die Gefahr eines Weltkrieges zu einer steten sozialen Tatsache erhoben hat. Die Grundbedingung ihres Bestehens ist die Sicherheit und Ruhe der ökonomischen Entwicklung. Sie hat aber einen Zustand geschaffen, in dem das wirtschaftliche Leben sich in jedem Augenblick vor der Gefahr der gewaltsamen Zerstörung befindet.
Der englische Staatssekretär des Äußern, Sir Edward Grey sprach neulich von einem Zustand des politischen Alkoholismus, und weder die Bourgeoisie noch ihre Regierungen kennen ein Mittel, der ihn aus der Welt schaffen könnte. So taumeln sie aus einer Kriegsgefahr in die andere, bis sie auf dem Schlachtfelde aufeinander stoßen, oder bis die eiserne Hand des Proletariats sie an die Gurgel packt, um diesem Treiben ein Ende zu machen.
Das Gerassel der auffahrenden Kanonen, die die zivilisierte Welt in ein Trümmer- und Leichenfeld zu verwandeln drohen, vermag nicht den dröhnenden Schritt der Arbeiterbataillone zu übertönen, die auf dem weltpolitischen Kampffelde antreten. Der akuten Kriegsgefahr folgt die Gefahr revolutionärer Straßenkämpfe, – eine Gefahr für das Kapital, ein Hoffnungsstrahl für die Menschheit.
1. Das Wettrüsten und seine wirtschaftlichen Folgen.
Der Imperialismus bedeutet die Politik der Gewalt gegen schwache Völker, darum ist er ohne Gewaltmittel, Flotte und Landheer unmöglich. Der Imperialismus erzeugt den Kampf aller Staaten gegen alle, darum ist er ohne Wettrüsten undenkbar. Bereit sein ist alles, heißt es für jeden imperialistischen Staat, darum spannt jeder alle Kräfte an, um seine Machtmittel technisch und zahlengemäß an der Spitze zu erhalten, und zwar in der Stärke, die seinen strategischen und diplomatischen Notwendigkeiten entspricht. Welchen Umfang finanziell das Wettrüsten angenommen hat, zeigt die umstehende Tabelle, die wir nach den eingehenden Angaben des Nauticus für 1911 zusammengestellt haben.
In neun Jahren ist die militärische Belastung Deutschlands auf den Kopf der Bevölkerung um mehr als 4 Mark, und für die fünfköpfige Familie um 20 Mark gestiegen, ähnlich geht es in allen anderen Staaten. Dieses Rüsten ohne Ende zerrüttet die Finanzen eines Staates nach dem andern und nötigt sie zu immer neuen »Finanzreformen«, d. h. zu einer immer stärkeren Anziehung der Steuerschraube. Selbst in Ländern, in denen nicht alle Lasten durch indirekte Steuern aufgebracht werden, stärkt das Wettrüsten den Widerstand der besitzenden Schichten gegen eine Erhöhung der direkten Steuern und nimmt der Arbeiterklasse die Aussicht auf Erfolg im Kampf für die Herabsetzung der indirekten ihren Lebenshalt belastenden Steuern. In Ländern, wo auf den indirekten Steuern der ganze Haushalt des Staates aufgebaut ist, verewigt der Imperialismus durch seine wachsenden Ausgaben das System der Schutzzölle, ohne die er nicht auskommen kann. Die wachsende indirekte Steuerlast bedeutet aber eine wachsende Teuerung aller Lebensmittel. Ihr Preis wird nicht nur um den vom Staate eingezogenen Zoll erhöht. Unter dem Schutze der Zollmauer schließt sich das Kapital zusammen, um den von der auswärtigen Konkurrenz gesäuberten Markt gehörig auszubeuten. Es schraubt den Preis der Waren fast um den ganzen Zollbetrag in die Höhe. Nach den Berechnungen Gradnauers betrug diese Preiserhöhung der wichtigsten und industriellen Produkte in Deutschland im Jahre 1908 46 Mark auf den Kopf der Bevölkerung, d. h. pro Familie 230 Mark Siehe Berechnungen im Buche Gradnauers »Der Wahlkampf«, S. 50, Dresden 1911..
2. Die imperialistische Ausdehnung und die Lage der Arbeiterklasse.
Der Imperialismus verursacht das Wachstum der Steuerlast der Arbeiterklasse und die wachsende Teuerung der notwendigsten Lebensmittel. Diese Tatsache zu leugnen, fällt selbst den rabiatesten Vertretern des Imperialismus schwer. Sie versuchen deshalb ihre Bedeutung durch die Behauptung abzuschwächen, die imperialistische Ausdehnung gebe der Arbeiterschaft erhöhte Arbeitsgelegenheit und hebe infolgedessen die Arbeitslöhne. Diese Behauptung ist völlig aus der Luft gegriffen. Erstens ist eine Produktionserweiterung und ein größerer Warenverkehr keinesfalls gleichbedeutend mit erhöhter Arbeitsgelegenheit. Geht die Produktionserweiterung Hand in Hand mit der Einführung arbeitssparender Maschinen, so kann sogar eine Verringerung der Arbeitsgelegenheit folgen. Dasselbe Resultat ergibt sich, wenn das Kapital Massen von kulturell niedrig stehenden Arbeitern aus den Ländern herbeizieht, die durch seine Ausdehnung proletarisiert worden sind. Das englische Kapital, das Südafrika unterjochte, um seine Goldminen besser ausbeuten zu können, wendet dabei chinesische Kulis an, die fast wie Sklaven behandelt werden.
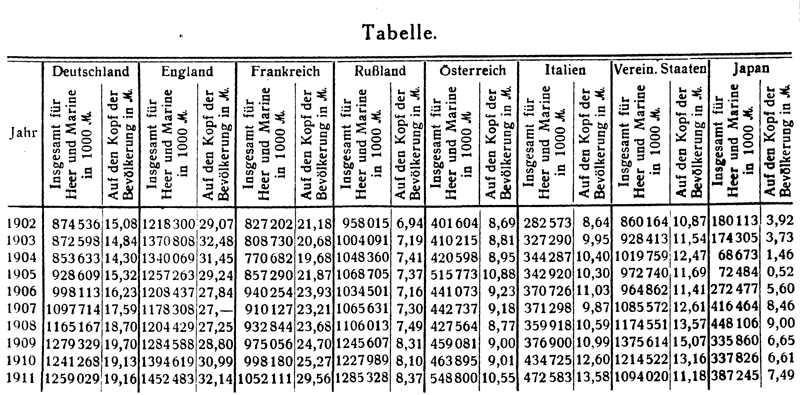
Und die deutschen Reeder, die Chinesen als Matrosen beschäftigen, zeigen, daß auch das deutsche Kapital es nicht verschmäht, die durch seine Ausbreitung von der Scholle vertriebenen und proletarisierten chinesischen Kulis auszubeuten. Aus dem Dargelegten folgt, daß sich aus dem vergrößerten Warenabsatz noch keineswegs eine Hebung der Lage der Arbeiterklasse ergeben muß. Wir wissen aber, daß der Warenabsatz der deutschen Industrie nur zu einem geringen Teil in die Länder der imperialistischen Ausdehnung des deutschen Kapitals geht, und daß diese Länder mit ihrer unentwickelten Bauernbevölkerung auch in der Zukunft keine großen Absatzmärkte versprechen. Würde es aber dem Kapital gelingen, eine Industrie mit ihnen großzuziehen, so würden sie auch selbst die von ihnen benötigten Industrieerzeugnisse schaffen. Zwar wird das nicht mit einem Schlage geschehen, und der Prozeß der Industrialisierung Chinas wird der europäischen Industrie eine Zeitlang große Märkte eröffnen, da er einen großen Bedarf für Maschinen und Textilerzeugnisse schaffen wird; es wird sich hier aber dennoch nur um eine vorübergehende Belebung der europäischen Industrie handeln. Denn wenn die industrielle Entwicklung der rückständigen Länder früher ihren Warenverkehr mit den älteren kapitalistischen Ländern erhöht hat, so findet dieser Prozeß seine Grenzen in der nur allmählich steigenden Kaufkraft der Länder, in denen das Proletariat mit jedem Jahre einen größeren Teil der Bevölkerung ausmacht.
Die imperialistische Ausdehnung Deutschlands hat bisher der deutschen Arbeiterklasse nicht einmal eine größere Arbeitsgelegenheit geschaffen, wenn wir von einem winzigen Teil absehen, der direkt für die Flottenlieferanten arbeitet. Würde also die erhöhte Arbeitsgelegenheit für einzelne Arbeitergruppen sogar gleichbedeutend sein mit der Möglichkeit, eine besser entlohnte Arbeit zu finden, so hätte die Arbeiterklasse als Ganzes dennoch keinen Nutzen davon. Wie sich die Verfechter des Imperialismus auch anstrengen, sie sind nicht imstande, irgend welche Tatsachen vorzubringen, die beweisen würden, daß die zwölf Jahre der imperialistischen Politik, neben der wachsenden Teuerung und der Steuerlast, irgend welche Wirkungen herbeigeführt haben, die der Arbeiterklasse günstig waren. In dem bereits zitierten Artikel »Zehn Jahre Flottengesetz«, den der offiziöse Nauticus Nauticus: Jahrbuch für Deutschlands Seeinteressen 1910, S. 40. im Jahre 1910 zur Verherrlichung des Flottengesetzes und seiner Wirkungen veröffentlicht hat, konnte nur aufgeführt werden, daß der Konsum pro Kopf der Bevölkerung gestiegen ist:
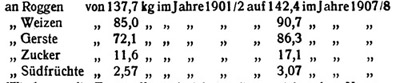
Wir lassen die Frage offen, wieviel von diesem steigendem Konsum wirklich auf die Arbeiterklasse, und wieviel auf die besitzenden Schichten entfällt. Wir lassen auch die Frage unberücksichtigt, wie die Lage der deutschen Arbeiterklasse ausgesehen hätte, wenn nicht die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie, die sich des größten Hasses der Imperialisten und der Regierung erfreuen, ihren ständigen Kampf im Interesse der Arbeiterklasse geführt hätten. Es genügt, daß die Regierung zur Illustrierung der segensreichen Wirkung des Imperialismus auf die Lage der Arbeiterklasse nichts weiter auszuführen hat, als 5 kg Roggen und Weizen, 5½ kg Zucker und 14 kg Gerste. Daß auch dieses Mehr an Lebensmitteln, welches die Arbeiterklasse angeblich verbraucht hat, nur in der Phantasie des offiziellen Skribenten auf das Konto des Imperialismus gestellt werden kann, ist eine besondere Tatsache. Denn wenn sie nicht dem opfervollen Kampfe unserer Gewerkschaften und der Sozialdemokratie zu verdanken wären, so würde sie lediglich der Arbeitsgelegenheit zuzuschreiben sein, die der Handelsverkehr mit den kapitalistischen Ländern Europas bietet, nicht aber dem nur langsam zunehmenden Handelsverkehr mit den unentwickelten Ländern, auf den das Bestehen der Kriegsflotte einen Einfluß haben kann.
Ähnlichen Einwendungen, wie die soeben gemachten, begegnen die Imperialisten gewöhnlich mit dem Hinweis auf die angebliche Hebung der Lage der arbeitenden Klassen in England durch die Kolonialpolitik. Diesen Einwand hat schon Parvus Parvus: Kolonialpolitik und Zusammenbruch, Leipzig 1907, S. 126/127. widerlegt, indem er nachwies, daß die Zeit der Lohnsteigerungen in England zugleich die Zeit der relativen Verminderung des kolonialen Exports war, daß also die Aufbesserung der Lage der Arbeiterklasse in England ganz anderen Faktoren zuzuschreiben ist, als der englischen Kolonialpolitik. Was Parvus für die Vergangenheit theoretisch nachgewiesen hat, beweisen die kolossalen Arbeitsaufstände, die in diesem Jahre in ganz England getobt haben, noch nachdrücklicher. Welchen Ursachen dieses Sichaufraffen der englischen Arbeiter als Musterknaben zuzuschreiben ist, die ein halbes Jahrhundert lang von den bürgerlichen Sozialpolitikern gefeiert wurden, geht aus einem lehrreichen Artikel des holländischen Schriftstellers F. M. Wibaut Neue Zeit (vom 16. Juli 1911).: »Ein Menschenalter des Kapitalismus« hervor, in dem auf Grund englischer offizieller Materialien der Beweis geführt wird, daß die Lage der Arbeiterklasse in England sich in den letzten dreißig Jahren (1875–1907) verschlechtert hat. »Nur in der ersten Hälfte des betrachteten Zeitabschnittes« – so faßt er seine Untersuchungen zusammen – »fand eine bedeutende Zunahme des Reallohnes statt, aber sie war hauptsächlich eine Folge der Senkung der Lebensmittelpreise.« In der zweiten Hälfte dagegen, seit 1895, sinkt der Reallohn; die Verringerung der Kaufkraft des Lohnes war größer als die Steigerung der Geldlöhne. Auch wird die Sicherheit der Existenz nicht größer; die Schwankungen in der Arbeitsgelegenheit werden nicht geringer; der Teil der Lebenszeit, in dem die Arbeitskraft Käufer findet, wurde von 1891 bis 1901 kleiner. Diese Worte des Forschers seien noch durch folgende Ziffern ergänzt: In der Zeit von 1875 bis 1905 weisen die Löhne eine durchschnittliche Steigerung von 13 Prozent auf. Aber in der Zeit von 1905 bis 1908, verglichen mit der Zeit 1895 bis 1899, steigen die Preise der Lebensmittel schneller als die Geldlöhne, nämlich um 18 Prozent. Die Lage der englischen Arbeiterklasse hat sich also absolut verschlechtert. Und dies geschah in der Zeit, wo die Produktionskraft der englischen Arbeiterklasse und der Wohlstand der Kapitalisten mächtig gewachsen ist. Die englische Einfuhr ist in den letzten 28 Jahren um 92, die Ausfuhr um 808 gewachsen, während die Bevölkerung nur um 29 Prozent gestiegen ist. Gleichzeitig ist das aus Handel und Industrie stammende Kapitalisteneinkommen um 92 Prozent gestiegen. Es ergibt sich also: Der Arbeiter lieferte der Gesellschaft viel mehr als früher, die Kapitalisten erhöhten ihr Einkommen um 92 Prozent. Würde sich die Lage der Arbeiter gehoben haben, ständen sie absolut jetzt besser als vor dreißig Jahren, sie würden relativ trotzdem heute schlechter stehen. Aber das nicht einmal ist der Fall. Während der Wohlstand der Kapitalistenklasse ungeheuer steigt, kann der englische Arbeiter nicht einmal sagen, daß sein »Wohlstand«, wenn auch nicht in demselben Maße, so doch wenigstens überhaupt, gestiegen wäre. Die Lage der englischen Arbeiterklasse hat sich positiv verschlechtert. Wer das nicht dem Marxisten Wibaut glauben will, der vielleicht von der legendären Verelendungstheorie verblendet ist, der lese den Aufsatz des englischen liberalen Statistikers Chiozza-Money in dem Londoner liberalen Wochenblatt »The Nation« (vom 30. April 1911) über Lohn und Profit in den letzten fünfzehn Jahren. Er findet dort eine Bestätigung der Ausführungen Wibauts. Dies alles zeigt, daß die Kolonialpolitik Englands – die erfolgreichste Kolonialpolitik, die jemals in der Geschichte getrieben worden ist –, die Arbeiterklasse nicht vor dem bittersten Elend hat schützen können. Angesichts dessen verlieren alle Hinweise darauf, daß sich die deutsche Kolonialpolitk erst in den Anfängen befinde, selbstverständlich allen Wert. Keine Kolonialpolitik kann die Lage der Arbeiterklasse heben, jede aber führt zu Ergebnissen, die niederdrückend auf sie wirken.
3. Imperialismus und Sozialreform.
Der Imperialismus verschlechtert die Lage der Arbeiterklasse, indem er das Einkommen der Arbeiter mit immer wachsenden Steuern für den Staat, die Junker und die Schlotbarone belastet. Er schafft der Arbeiterklasse keine Gelegenheit für bessere, lohnendere Arbeit. Das allein würde schon genügen, um in dem Imperialismus eine Kraft zu sehen, die den Aufstieg der Arbeiterklasse hemmt und alle ihre Bemühungen nach Erringung einer höheren Lebenslage lahmzulegen sucht. Aber damit erschöpft sich keineswegs die niederdrückende Wirkung des Imperialismus auf die Lage der Arbeiterklasse. Er verstopft auch die Quellen der Sozialreform, des staatlichen Schutzes der Arbeitskraft vor der Raubwirtschaft des Kapitals. Am 4. Februar 1890 kündigte bekanntlich ein Kaiserlicher Erlaß Reformen an, »die die Erhaltung der Gesundheit, die Gebote der Sittlichkeit, die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Arbeiter und ihren Anspruch auf gesetzliche Gleichberechtigung wahren sollten«; am 5. Dezember 1894 erklärte die Thronrede als die vornehmste Aufgabe des Staates, die schwächeren Klassen zu schützen und ihnen zu einer höheren wirtschaftlichen Entwicklung zu verhelfen. Und als einige Jahre später der imperialistische Kurs in Deutschland begann, hofften die bürgerlichen Sozialreformer, daß er Hand in Hand mit einer Beschleunigung des sozialpolitischen Kurses gehen würde: »So treiben wirtschaftlicher Fortschritt und soziale Reform sich gegenseitig vorwärts, wie zwei ineinander greifende Zahnräder,« schrieb damals der Redakteur der »Sozialen Praxis«, Professor Franke. »Und darum erheischt eine erfolgreiche Weltpolitik und Weltmachtpolitik als unerläßliches Korrelat (Ergänzung) auch eine kräftige Fortführung der Sozialpolitik in Deutschland … Weltpolitik und Sozialpolitik sind die beiden Pole, an denen sich ein und dieselbe Kraft manifestiert. Dem nationalen Drang nach außen muß der soziale Fortschritt im Innern entsprechen … Das Deutsche Reich muß im 20. Jahrhundert Weltpolitik treiben, wenn es seinen Platz an der Sonne haben will, und es muß die Sozialpolitik fortführen, wenn dem äußeren Glanze auch die innere Kraft den Bestand verleihen soll«. Handels- und Machtpolitik. Cotta 1900. Vortrag von Prof. Franke über Weltpolitik und Sozialreform.
Diese guten Leute und schlechten Musikanten bemerkten nur nicht, daß die Flottenvorlage von der Zuchthausvorlage begleitet wurde. Und seitdem Deutschland mit Volldampf den imperialistischen Kurs steuert, seitdem es seine Rüstungen von Jahr zu Jahr steigert, ist im Deutschen Reichstage kein einziges Gesetz angenommen worden, das imstande gewesen ist, die Lage einer breiteren Schicht des Proletariats wirklich zu heben. Auch für einen Blinden ist es klar, daß zwischen den beiden Tatsachen, dem gänzlichen Versagen der Sozialreform und dem ununterbrochenen Rüsten ein Zusammenhang besteht. Aber es hieße an der Oberfläche der Dinge haften bleiben, wenn man annehmen wollte, dieser Zusammenhang bestehe nur darin, daß die Rüstungsausgaben das für die Sozialreform notwendige Geld verschlingen. Der Zusammenhang ist ein viel tieferer. Nicht nur das Geld wird durch die Rüstungen verschlungen, die Rüstungen sind zudem Ausfluß desselben Kurses, der die Sozialreform zum Stillstand verurteilt. Die Sozialreform entspringt entweder dem Kampfe der verschiedenen Schichten der bürgerlichen Gesellschaft untereinander, der von der Arbeiterklasse geschickt ausgenützt wird, oder sie ist ein Ausfluß des Glaubens der herrschenden Parteien, die Arbeiterklasse durch Zugeständnisse von dem revolutionären Kampfe abbringen zu können. Eben dieser Spekulation verdankt die Arbeiterklasse, daß die deutsche Regierung in den neunziger Jahren ihr soziales Herz entdeckt hat, und daß sich diese sozialen Gefühle noch verstärkten, als die Peitsche des Sozialistengesetzes sich als ohnmächtig erwies. Es zeigte sich aber bald, daß die deutsche Arbeiterklasse nicht umsonst dreißig Jahre Klassenkampf hinter sich hatte. Es trat bald zutage, daß die Regierung, die den »neuen Kurs« inauguriert hatte, nicht imstande war, ihn durchzuführen, da die Klassen, deren Willen sie zu vollstrecken hatte, ihr das nicht erlaubten. Der hohe Grad des proletarischen Bewußtseins entsprach einer mit jedem Jahre an Kraft zunehmenden Macht des Kapitals, das nicht bloß Herr im Hause sein wollte, sondern auch über die fernen Meere seine Herrschaft zu ziehen suchte. Dieselbe Macht, die dem Kapital ermöglichte, dem neuen Kurs Einhalt zu gebieten, gestattete ihm auch, der Regierung den imperialistischen Kurs vorzuschreiben, Die Knechtung der arbeitenden Klasse in Deutschland und die Ausbeutung der fremden, wenig entwickelten Völker durch die imperialistische Politik gehen Hand in Hand miteinander.
Daß der Arbeiterschutz und der Imperialismus aus einer Quelle fließen, bedeutet aber keineswegs, daß die imperialistische Politik den Arbeitertrutz nicht stärken sollte. Sie tut es in bedeutendem Maße schon dadurch, daß die Bourgeoisie, die die Eingeborenen in den Kolonien wie Sklaven behandelt, geneigt ist, dieselben Herrschaftsmethoden auch gegenüber dem Proletariat im Mutterlande zu gebrauchen. Aber noch stärker beschleunigt der Imperialismus diese Rückentwicklung vom Arbeiterschutz zum Arbeitertrutz, indem er die Entwicklung des Staates zur Demokratie hemmt.
4. Der Imperialismus und die Demokratie.
Der Imperialismus verschlechtert die Lage der Arbeiterklasse und verstopft zugleich die Quellen der Sozialpolitik. Indem er so der Arbeiterklasse immer neue Lasten aufbürdet, legt er ihr zu gleicher Zeit Fesseln an, damit sie sich nicht zu wehren vermag. Der Imperialismus höhlt zuerst den Parlamentarismus aus, der für die Arbeiterklasse eine Kampfeswaffe, ein Mittel zur Aufrüttelung der Volksmassen ist, indem er an die Spitze der bürgerlichen Interessen solche stellt, die sich öffentlich nicht behandeln lassen. Die Bourgeoisie stimmt diesem Vorhaben gerne zu, denn sie sieht in dem Parlamentarismus nicht die Form, in der das Volk seine Herrschaft ausüben soll, sondern die, in der sie am besten ihre eigenen Klasseninteressen vertritt. Sieht also die Bourgeoisie in dem Streben nach Eroberung fremder, kulturell niedriger stehender Lander zwecks ihrer Ausbeutung durch den Export des Kapitals und der Waren die ihren Interessen am meisten entsprechende Politik, so wird das Parlament zur Waffe des Imperialismus, und von den Notwendigkeiten der Weltpolitik wird es abhängen, inwieweit das Parlament selbst die Leitung der auswärtigen, jetzt imperialistischen, Politik in seinen Händen behält. Die Bourgeoisie weiß aus historischer Erfahrung, daß es ihren Interessen nicht entspricht, wenn sie ihre auswärtigen Interessen gänzlich der Bureaukratie überläßt. Bureaukratie heißt Routine, geringe Anpassungsfähigkeit an neue Notwendigkeiten, und in vielen Fällen Schlendrian. Sie verbürgt nicht nur die beste Verwaltung, sondern nicht einmal die beste Kenntnis der Sachlage. Besonders was die Kenntnis der Kolonialpolitik betrifft, die wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Betätigung in fremden Ländern, zieht der Bureaukrat, der an seinem Schreibtisch gebunden oder nur auf kurze Reisen angewiesen ist, gegen den Kaufmann, den Journalisten, den Gelehrten, die im freien Verkehr Land und Leute viel besser kennen lernen können, den kürzeren. Darum befaßt sich die Presse, die Wissenschaft und das Parlament der imperialistischen Staaten so viel mit den Angelegenheiten der imperialistischen Politik. Aber ihre Ausführung befindet sich, wie jede Gesetzausführung, in den Händen der Bureaukratie. Während aber bei der Einführung neuer Gesetze, die die innere Politik betreffen, die Bourgeoisie die einzuschlagenden Wege sorgfältig im Parlamente prüft und sich die Kontrolle ihrer Ausführung im vollen Umfange vorbehält, vermeidet sie die öffentliche Erörterung bevorstehender Schritte ihrer auswärtigen Politik; selbst nachdem sie es schon getan, geht das bürgerliche Parlament sehr vorsichtig zur Ausübung seines Beaufsichtigungsrechts über.
In England, wo in den Kreisen der Bourgeoisie die Kenntnis der auswärtigen Angelegenheiten dank der weitverzweigten Ausbreitung der Handelsbeziehungen usw. verhältnismäßig hoch steht und das parlamentarische System am höchsten entwickelt ist, erfährt das Parlament von den Plänen seiner der parlamentarischen Mehrheit entsprossenen Regierung größtenteils erst später, wenn man sich dieselben auch schon nach den Taten der Regierung zurechtkonstruieren kann. Was dem Parlament direkt von der Regierung »eröffnet« wird, sind größtenteils allgemeine Redensarten über die Richtlinien der auswärtigen Politik, die man sich auf Grund der in Betracht kommenden Tatsachen auch ohne »Eröffnungen« entwerfen kann, oder Erklärungen, die der Regierung zur Erhöhung des Eindrucks ihrer Schritte im Auslande nötig erscheinen. Und die regierenden Klassen entäußern sich gerne ihres Rechts auf bestimmenden direkten Eingriff in die auswärtige Politik. Wissen sie doch sehr gut, daß die von ihnen abhängige Regierung keine selbständigen, sondern ihre Interessen dabei vertritt, und daß sie in diesem Sinne handelt, wenn sie sich in den Mantel des Schweigens hüllt. Denn obwohl es den Kabinetten nur in den allerseltensten Fällen gelingt, ihre Töpfe vor den neugierigen Blicken der ausländischen Diplomatie geschlossen zu halten, und obwohl das Spiel zwischen den Diplomaten verschiedener Staaten in Wirklichkeit größtenteils mit aufgedeckten Karten stattfindet, liegt es im Interesse der Kämpfenden selbst, daß die breite Masse des Volkes die Ziele und Trümpfe nicht kennen lernt. Würde das Spiel offen vor der ganzen Welt gespielt werden, so würde es viel schwieriger sein als jetzt, dieser Politik des schmutzigsten Profitinteresses das Mäntelchen des nationalen Interesses umzuhängen. Gerät aber die Politik der Regierung in Gegensatz zu den Interessen einer Gruppe der Bourgeoisie, und versucht diese durch öffentliche Debatte die Pläne ihrer Widersacher zu durchkreuzen, so läßt die Mehrheit des Parlaments die Verhandlung überhaupt nicht zu, indem sie sich hinter die Unmöglichkeit der offenen Besprechung dieser Angelegenheiten in diesem Stadium aus »vaterländischem Interesse« verschanzt. Dies gelingt ihr noch leichter, wenn die Interpellation von einer kleinen Gruppe Ideologen ausgeht, die sich mit ihren abstrakten Auffassungen an dem konkreten Schmutz stoßen, oder von den Vertretern der Arbeiterklasse. Es genügt, an den Ausgang verschiedener Interpellationen der englischen Labour Party oder des Genossen Jaurès zu erinnern. Wenn man einwenden wollte, daß es die Labour Party an der nötigen Geschicklichkeit fehlen ließ, daß sie ihre Position dadurch schwächte, daß sie sich vorher mit der Regierung in Verbindung setzte, so ist das bei Jaurès nicht der Fall. Der französische Genosse kennt die Interna der Diplomatie, und – was man auch von seiner prinzipiellen Auffassung der Probleme der auswärtigen Politik denken mag – in konkreten Tatsachen läßt er sich keinen Bären aufbinden. Daß es ihm aber gelungen wäre, jemals die Regierung ins Bockshorn zu jagen und von ihr mehr zu erfahren, als sie sagen will, das läßt sich auch beim besten Willen nicht behaupten. Das Interesse der Bourgeoisie nimmt dem Parlamentarismus den Charakter einer Waffe gegen den Imperialismus auch in den Ländern, wo die Demokratie in größerem Maße als in Deutschland verwirklicht ist, und wo die besitzenden Klassen viel Selbstbewußtsein besitzen und sich keinesfalls als Objekte der bureaukratischen Verwaltung betrachten.
In Deutschland, wo das Parlament niemals eine selbständige Kraft besessen hat und wo die Parlamentsbeschlüsse von der Regierung und dem Bundesrat einfach in den Papierkorb geworfen werden können, hat man die Macht des Parlaments überhaupt nicht zu schmälern brauchen. Der Imperialismus hat die Ohnmacht des Parlaments nur in das rechte Licht gerückt und gezeigt, daß es mit Zustimmung der Bourgeoisie ohnmächtig ist. Der Reichstag hat mit Bereitwilligkeit der Regierung die Absolution erteilt, als sie ohne seine Genehmigung im chinesischen Abenteuer ungeheure Summen verpulverte. Der Reichstag hat dem mit keinem einzigen Wort widersprochen, daß die Regierung sich heuer in die Marokkokrisen eingemischt und die Gefahr eines Krieges auf sich genommen hat, ohne der Volksvertretung auch nur ein Wort darüber zu sagen. Als im Jahre 1908 das persönliche Regiment sich durch die Selbstenthüllungen des Kaisers im »Daily Telegraph« in furchtbarster Weise kompromittierte, reichte die Erregung der bürgerlichen Parteien nur dazu aus, an das persönliche Regiment die Bitte zu richten, es möge doch seine Interessen besser verwalten. Und als heuer sich in der Bourgeoisie die Meinung verbreitete, die deutsche Diplomatie sei nicht imstande, ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten, da gipfelten ihre Wünsche nicht in dem Rufe nach dem Ausbau der Demokratie, sondern in der Bitte, die diplomatischen Stellen mit bürgerlichen Elementen zu besetzen, die besser als die Junker imstande sein würden, sich mit den fremden Diplomaten wegen der Profitinteressen herumzuschlagen.
Der Imperialismus höhlt die Macht des Parlaments aus und stärkt zugleich die Macht der Bureaukratie. Nicht nur weil die Ohnmacht des Parlaments die Allmacht der Bureaukratie bedeutet, sondern auch weil der Imperialismus das Wachstum der Machtmittel der Bureaukratie fördert, indem er mit jedem Jahre das Budget, die Rüstungen anschwellen läßt. Kein Wunder also, wenn die Bureaukratie ihr verstärktes Machtgefühl späterhin nicht nur auf dem Gebiet der auswärtigen Politik zur Geltung bringt, sondern die Arbeiterklasse immer heftiger schurigelt. Nachdem die Quellen der Sozialpolitik mit dem Eintritt Deutschlands in die Bahn des Imperialismus versiegten, hat die Arbeiterklasse zusehen müssen, wie ihre kümmerlichen Selbstverwaltungsrechte in den Krankenkassen, die sie mit Mühe zum Wohl der leidenden Proletarier ausgenützt hat, der Bureaukratie ausgeliefert worden sind.
Von Jahr zu Jahr wächst die imperialistische Gefahr. Sie vernichtet die Resultate jahrzehntelangen Ringens der Arbeiterklasse um die Aufbesserung ihrer Lage und droht, die sich immer solidarischer fühlenden Proletarier aller Länder auf das blutige Schlachtfeld zu führen. Je größer ihr Umfang wird, je öfter der Imperialismus nach einer kaum überstandenen Gefahr, vor der es selbst der Bourgeoisie graut, wieder von neuem seine ruchlose Arbeit beginnt, desto klarer tritt es zutage, daß in diesem Wahnsinn ein System steckt, desto offensichtlicher wird es, daß es keine bürgerliche Schicht gibt, die ihm Widerstand leisten könnte. Was tun, wie dieses zügellose Treiben bändigen, wie diesem Wahnsinn ein Ende bereiten?
Bürgerliche Friedensfreunde vermeinten der Kriegsgefahr beikommen zu können, ohne den Kapitalismus abschaffen zu müssen. Sie glauben sogar, daß der Kapitalismus, nachdem der Imperialismus vermittels ihrer unschuldigen Hausmittel überwunden sein wird, erst recht aufblühen würde. Da sie gegen die Ausbeutung der unentwickelten Völker durch die alten kapitalistischen Staaten nichts einzuwenden haben und nur an dem Wettrüsten, an der Gefahr eines Krieges unter den zivilisierten Völkern, Anstoß nehmen, sehen sie in dem gemeinsamen Vorgehen der kapitalistischen Staaten das zu erstrebende Ziel und glauben, am Kapitalismus selbst Kräfte zu finden, die dieses Ziel verwirklichen könnten. Immer mehr – so behaupten die bürgerlichen Friedensapostel – wächst die Zahl der gemeinsamen ökonomischen Interessen der zivilisierten Länder, d. h. der Bourgeoisie der kapitalistischen Staaten. Deutsches Kapital steckt in englischen kolonialen Unternehmungen und französisches in deutschen Industrieunternehmungen. Der Handelsverkehr knüpft diese Länder immer fester aneinander; ein Krieg zwischen ihnen, möge er ausfallen wie er will, müßte allen die größten Wunden schlagen. Angesichts dessen müßten sich die Regierungen der zivilisierten Länder über ihre kolonialen Streitfragen einigen und schließlich lernen, nachdem sie sich über die Teilung der Beute geeinigt, in den Ländern der ökonomischen Ausdehnung des europäischen Kapitals – in China, in der Türkei usw. – gemeinsam aufzutreten. Wird diese Einigung erzielt, so ist das Ende des Wettrüstens da, und es ist nur noch nötig, die verhältnismäßig geringen Machtmittel gegen die sich widerstrebenden Barbaren zu unterhalten. Alle eventuell auftauchenden Streitigkeiten würden dann von den obligatorischen internationalen Schiedsgerichten friedlich aus der Welt geschafft werden.
Die Entwicklung der Orientvölker in den letzten Jahren hat eine neue Quelle der Rüstungen eröffnet, die durch keine kapitalistischen Abmachungen verstopft werden können. Handelt es sich doch dabei um die Auflehnung der Orientvölker gegen das internationale Kapital. Diese Abmachungen könnten nur auf eine Zeitlang die Gefahr des Zusammenstoßens der konkurrierenden kapitalistischen Staaten vermindern, sie könnten sie aber nicht abhalten, gegen den erwachenden Orient zu rüsten. Können aber solche Abmachungen das Wettrüsten aus der Welt schaffen und die kapitalistischen Staaten zu dauerndem gemeinsamen Vorgehen bewegen? Dies ist mehr als zweifelhaft, obwohl die Interessen des Kapitals der verschiedenen Länder sich in der Tat zu einem Teile immer mehr verflechten. Die Trusts und Aktiengesellschaften, die von dem sich immer mehr international gestaltenden Finanzkapital gespeist werden, haben indes auch ihre »nationalen« Interessen. Diese bestehen darin, daß einzelne »nationale« Kapitalistengruppen die Möglichkeit haben, einen schwachen Staat um so stärker schröpfen zu können, je kleiner der Einfluß der anderen Kapitalistengruppen in ihm ist. Selbst wenn sie sich in der Folge über die Aufteilung dieses Marktes einigen wollen, müssen sie vorher ihre Kräfte messen, um die Beute nach dem Kräfteverhältnis teilen zu können, und wenn es sich morgen zeigen sollte, daß eine der »nationalen« Kapitalsgruppen schwächer geworden ist, so wäre in demselben Augenblick das gestrige Übereinkommen über den Haufen geworfen, und alle anderen konkurrierenden Gruppen würden sofort versuchen, ihren Anteil an der Beute auf Kosten der schwächeren zu vergrößern. Es gibt eben keinen anderen Teilungsmaßstab als die ökonomische Macht, die sich in den staatlichen Machtmitteln äußert. Darum fordern die Kapitalisten aller Staaten, selbst wenn sie sich verständigen wollen, das Rüsten ohne Unterlaß; denn sie sehen in den Rüstungen den Maßstab, nach dem ihr Anteil an der Beute bemessen wird, die Garantie, daß sie jede Verschiebung in den Kräfteverhältnissen anderer Gruppen auszunützen imstande sein werden. Keinem internationalen Schiedsgericht wollen sie die Entscheidung über ihre wichtigen Interessen anvertrauen, was die Schiedsgerichte zu Institutionen stempelt, welche die Konflikte schlichten, die nicht einmal eines diplomatischen Krieges wert sind. Ist also auch die Angst des Kapitals vor dem Kriege groß, so vertröstet sich jeder kapitalistische Staat dennoch damit, daß die andern vor ihm werden zurückweichen müssen, wenn er sehr stark dastehen würde. So geht das Wettrüsten immer weiter. In derselben Richtung wie die politische Entwicklung geht der technische Fortschritt des Militarismus. Würde auch zwischen einzelnen Mächten eine Verständigung wegen ihrer Rüstungen erzielt werden, so würde eine das Kräfteverhältnis von Grund aus ändernde neue militärische Erfindung als Ansporn für neue Rüstungen dienen; denn welche Macht würde sich der Lockung widersetzen können, die in ihren Händen befindlichen Trümpfe möglichst schnell auszunützen? Daß die Erfindung schon morgen kein Geheimnis bleiben würde, schafft heute die Möglichkeit nicht aus der Welt, mit ihrer Hilfe einen größeren Anteil an der Weltbeute zu erkämpfen. Darum ist das Aufrüsten und nicht das Abrüsten das Zeichen der Zeit.
In dieser Hinsicht hat keine einzige Macht einer anderen etwas vorzuwerfen. Wenn England seine Rüstungen mit Friedenserklärungen und Aufforderungen zu einer Flottenverständigung begleitet, so tut es dies nur, weil es einen Vorsprung in den Rüstungen besitzt, der ihm die Beherrschung der Welt sichert. Rüsten aber alle anderen Staaten weiter, so verringert sich dieser Vorsprung trotz der größten Anstrengungen Englands. Der deutsche Imperialismus, der sehr spät aufgestanden ist und von dem Raubgut nur die schlechtesten Teile ergattert hat, hofft bei fortgesetzten Rüstungen an Macht zu gewinnen und beantwortet deshalb alle englischen Einladungen zu einer Flottenverständigung mit einer glatten Absage. Sollte es aber schließlich wegen des Bautempos seiner Kriegsschiffe sich mit England verständigen, um koloniale Zugeständnisse zu erhalten, so kann man sicher sein, daß es dann die erste Gelegenheit, die durch eine neue politische Mächtegruppierung geschaffen werden kann, benutzen wird, um mit verstärkter Kraft das versäumte nachzuholen.
Das von den bürgerlichen Friedensfreunden aufgestellte Ziel und die von ihnen zur »Zivilisierung« des Imperialismus vorgeschlagenen Mittel sind also utopisch. Aber selbst wenn dieses Ziel verwirklicht werden könnte, wenn in dem Chaos der sich auflösenden bürgerlichen Gesellschaft und der sie zerfleischenden Gegensätze sich eine Organisation aller kapitalistischen Staaten zur schnelleren Ausbeutung und Unterdrückung der rückständigen Länder bewerkstelligen ließe, so wäre das noch immer kein Ziel, das von der Arbeiterklasse unterstützt werden könnte. Als unterdrückte Klasse kann das Proletariat nicht mithelfen, andere zu unterdrücken, weiß es doch aus eigener Erfahrung, daß die Peitsche, die es zu schwingen mitgeholfen hätte, später auf seinen eigenen Rücken niedersausen wird, ganz abgesehen davon, daß es auch die Kosten dieser Unterdrückungspolitik tragen müßte.
Wie die Wundermittel der bürgerlichen Friedensfreunde – die Verständigung des Kapitals, die Internationalen Schiedsgerichte – keinen Damm gegen die wachsende imperialistische Gefahr bilden können, so räumt der Imperialismus auch mit allen anderen Hindernissen auf, die ihm auf dem Boden des Kapitalismus in den Weg gestellt werden können. Die parlamentarische Opposition macht er, wie wir gesehen, ohnmächtig, indem er unter der Zustimmung der Bourgeoisie dem Parlamentarismus jede Widerstandskraft raubt. Stellt sich ihm die Presse in den Weg, so knebelt er sie, wie er das in Deutschland nach dem Hunnenfeldzug tat, als die sozialdemokratische Presse die Barbaren der deutschen Zivilisation in China zu geißeln begann. Es tritt immer deutlicher zutage, daß in der Rüstkammer der bürgerlichen Gesellschaft kein Mittel vorhanden ist, das dem tobenden Imperialismus die Kandare anlegen könnte. Mit der wachsenden imperialistischen Gefahr wächst aber der Grimm der Arbeiterklasse gegen sie. Jede neue Aktion, die die Kriegsgefahr heraufbeschwört, entfacht eine heftige Protestaktion des Proletariats der kapitalistisch entwickelten Länder. Kein Appell an die »nationalen« Instinkte hilft nunmehr gegen die mächtig anschwellende antiimperialistische Gesinnung der Volksmassen; denn unter dem nationalistischen Mäntelchen guckt immer deutlicher das kapitalistische Profitinteresse als Triebkraft der imperialistischen Aktionen hervor. Ist nun die zunehmende Protestaktion des Proletariats das Mittel, die Abkehr des Kapitalismus von der imperialistischen Politik zu erzwingen?
Damit das der Fall sein könnte, müßten für den Kapitalismus andere Entwicklungsbahnen freistehen, als die er eingeschlagen hat. Dies ist aber nicht der Fall. Diese Tatsache geht nicht nur daraus hervor, daß alle kapitalistischen Staaten imperialistische Politik treiben, sondern auch daraus, daß die Politik des Freihandels, die Politik des Abrüstens, die Politik der Demokratie – worin die dem Imperialismus entgegengesetzte, aber immer noch bürgerliche Politik zusammengefaßt werden kann – nichts anderes bedeuten würde, als die Selbstauslieferung des Kapitalismus an den Sozialismus. Der Freihandel würde die Produktivkräfte mit solcher Schnelligkeit entfalten, daß die bürgerliche Gesellschaft vor die Frage gestellt würde: entweder sozialistische Regelung der Produktion oder Lahmlegung der Produktion durch Krisen. Und während die immanente wirtschaftliche Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft diese Frage vorlegen würde, würde das in der Demokratie erstarkte, mit allen ihren Waffen ausgerüstete, arbeitende Volk einen gelinden Druck auf die Kapitalistenklasse ausüben, um die Beantwortung dieser Frage im Sinne des Sozialismus zu beschleunigen. Diesen Weg, dessen Ziel dem Kapital nicht verborgen ist, kann der Kapitalismus, wenn er nicht zugunsten des Sozialismus abdanken will, nicht beschreiten. Im Imperialismus sieht das Kapital seine letzte Zuflucht vor dem Sozialismus. Die Trusts und Kartelle haben ihm die Möglichkeit gegeben, sich der Entwicklung der Produktivkräfte zu widersetzen oder ihre für das Kapital ungünstigen Folgen – wie z. B. den Preissturz – zu vermeiden. Der Militarismus und die kolonialen Unternehmungen ersetzen ihm den sich einengenden inneren Markt. Die wachsenden Machtmittel des Staates geben ihm die Möglichkeit, das Proletariat niederzuhalten. Das Kapital weiß nicht, daß das nur Notbehelfe sind, die ihm nur eine Zeitlang helfen können, sich über Wasser zu halten, und nur eine kurze Galgenfrist gewähren. Es hofft durch Entfaltung des Nationalismus, durch die kolossalen Gewaltmittel, die ihm der Imperialismus in die Hände liefert, allen Gefahren standzuhalten. Die Umwälzungen, die es jenseits der großen Ozeane herbeiführt, steigern in ihm den Glauben an eine soziale Mission, die es zu erfüllen hat. Es hält am Imperialismus aus allen Kräften fest und ist bereit, jeden Widerstand zu brechen, der sich seinen imperialistischen Lebensinteressen in den Weg stellen sollte. So steht das Proletariat vor der Tatsache, daß es von dem Imperialismus mit den größten Gefahren bedroht wird, daß es keine Möglichkeit gibt, dem Kapitalismus eine andere Politik aufzudrängen, ohne die politische Macht aus den Händen des Kapitalismus zu entwinden. Diese Situation führt das Proletariat zum Kampfe um den Sozialismus, denn hat es einmal die Macht in Händen, so hat es keinen Grund, für andere Ziele als für die Erfüllung seiner eigenen historischen Aufgabe zu kämpfen. Die historische Entwicklung hat den Sozialismus schon lange aus dem Stern, der dem Wanderer aus weiter Ferne den Weg zeigte, zu einer Tatsache gemacht, für die die Gesellschaft ökonomisch reif ist. Der Grad der durch die technische Entwicklung erreichten Ausgiebigkeit der menschlichen Arbeit erlaubt in den kapitalistischen Staaten allen Menschen, ihre Bedürfnisse zu decken. Der hohe Grad der Vergesellschaftung der Arbeit, die hohe Konzentration der Industrie, ihre Beherrschung durch die Banken, erlauben die zentrale Leitung der Produktion. Die Frage des Sozialismus ist jetzt eine reine Machtfrage geworden. Hat die Arbeiterklasse dem Kapital die Macht entrissen, so gibt es für sie kein anderes Ziel, als die Verwirklichung des Sozialismus. Dieses aber bedeutet: die einzige gründliche Entwurzelung des Imperialismus drängt die Arbeiterklasse zum Kampfe um den Sozialismus, vor dem die imperialistische Politik die Bourgeoisie eben retten sollte.
Hie Imperialismus, hie Sozialismus – das ist die Losung, die aus dem Ringen der kapitalistischen Staaten um die Welt, aus dem Kampfe des Proletariats gegen den Imperialismus hervorgeht. Daß sie im Sinne der historischen Entwicklung gelöst wird, daß sie also mit der Zertrümmerung des Kapitalismus enden muß, dafür bürgt die Höhe der sozialen Entwicklung, die der Kapitalismus in seinen ältesten Domänen erklommen hat. Der Kapitalismus ist in seinen ältesten Stätten kein Faktor der wirtschaftlichen Entwicklung mehr; seine imperialistische Politik entspringt, wie wir schon gezeigt haben, in letzter Linie der Tatsache, daß er die Produktivkräfte in seinem Mutterlande nicht entwickeln, sondern hemmen will. Damit ist schon gesagt, daß der Boden für den Sozialismus in den alten Ländern der kapitalistischen Entwicklung reif ist, daß die Ernte nur auf die Schnitter wartet.
Das Proletariat selbst ist aber in den vorgeschrittenen Ländern nur in seiner Minderheit dieser Tatsache sich bewußt, und nur zu einem Teile bereit, sich für den Sozialismus in die Schanzen zu schlagen. Das gibt dem Imperialismus die Möglichkeit, noch eine Zeitlang die Menschheit zu bedrohen. Aber indem er dies tut, beschleunigt er auch den Augenblick, da das ganze Volk die Sturmglocken vernehmen wird. Jedes neue Brigantenstück des Imperialismus weckt eine stärkere Protestaktion des Proletariats, während die zunehmende Teuerung und die ständig wachsenden Steuerlasten dem Heer der Kämpfenden immer neue Bataillone zuführen. Genügt nicht die Kraft des unter dem Banner des Sozialismus gegen den Imperialismus kämpfenden Proletariats, um den Ausbruch eines europäischen Krieges zu hintertreiben, so werden die Greuel dieses Krieges, die unermeßliche Not, die er über die Volksmassen aller Länder ausschütten wird, dafür sorgen, daß die Besiegten wie die Sieger vom blutigen Schlachtfelde als Gefangene des Sozialismus heimkehren. Das Proletariat kann nicht im Kampfe gegen den Imperialismus besiegt werden. Dafür bürgt nicht nur die Tatsache, daß das Kapital nicht imstande ist, die Arbeiterklasse zu besiegen, ohne die Wurzeln seiner Macht, die Produktion, ihres wichtigsten Betriebsmittels, der Arbeitskraft zu berauben. Dafür bürgt auch die Tatsache, daß das moderne Heer, das wichtigste Machtmittel des Imperialismus, in immer steigendem Maße aus Proletariern besteht. Wie stark auch der Einfluß des militärischen Drills und des Kadavergehorsams ist, die den Proletarier im Soldatenrock von dem im Arbeitskleide zu trennen suchen, so muß er dennoch versagen vor den erschütternden Folgen des Krieges.
Es wäre müßig, zu untersuchen, in welchen Formen die Auseinandersetzung zwischen dem Proletariat und den Mächten des Imperialismus stattfinden wird. Jedenfalls gehört eine solche Untersuchung nicht in den Rahmen dieser Schrift, die sich zur Aufgabe gestellt hat, die Entwicklungstendenzen des deutschen Imperialismus und die Interessen, die seine Triebkraft bilden, darzustellen. Die vorgeschrittenen Elemente der Arbeiterklasse müssen angesichts der nahenden großen Kämpfe Aufklärung in die Massen tragen über den Charakter des Imperialismus und die historischen Aufgaben der Arbeiterklasse. Je energischer diese Arbeit geleistet wird, je mehr dem Imperialismus die Maske abgerissen wird, desto geringer werden die Opfer sein, die der Kampf erfordern wird. Daß sie aber nicht klein sein werden, weiß das Proletariat sehr wohl. Handelt es sich doch um nichts Geringeres, als eine Klasse zu entthronen, die in ihrer Machtfülle die Welt beherrscht, die Fesseln zu sprengen, die Millionen von Menschen in Sklaven verwandeln, und an Stelle des Prinzips des weltbeherrschenden kapitalistischen Besitzes das Prinzip der Arbeit zu setzen. Daß die bevorstehenden Kämpfe nicht im nationalen Rahmen ausgefochten werden können, ergibt sich schon aus dem internationalen Charakter des Imperialismus. Und die zunehmende Schlagfertigkeit, mit der die Arbeiterklasse gegen den Imperialismus manöveriert, beweist, daß die objektiven Aufgaben, die der internationalen Arbeiterklasse harren, ihre bewußten Träger schon in der ganzen kapitalistischen Welt besitzen. Das Band der internationalen Solidarität, das vor fünfzig Jahren noch ein theoretischer Begriff war und erst in den wirtschaftlichen und politischen Kämpfen des Proletariats erstarkt ist, verwandelt sich unter dem Einfluß der immer wieder vom Imperialismus heraufbeschworenen Kriegsgefahr in einen eisernen Ring, der die Arbeiterklasse der kapitalistischen Länder als eine Kampfkolonne zusammenhält. In der kommenden Auseinandersetzung zwischen dem Imperialismus und dem Proletariat wird es sich aber in einen engeren Ring verwandeln, der den Kapitalismus erdrosseln wird.
Großen Kämpfen schreitet das Proletariat entgegen. Mögen auch die Opfer groß sein, die seiner harren, es hat keine Ursache zu zaudern, oder nervöse Voreile zu zeigen. Die Arbeiterklasse geht den künftigen Kämpfen freudig entgegen, denn was auch die Lobredner des Kapitalismus sagen mögen, die Arbeiterklasse hat doch nur ihre Ketten zu verlieren. Ihr winkt in der Ferne der Sozialismus, dessen Sonne über blutige Schlachtfelder scheinen wird, wenn es dem Proletariat nicht gelingt, durch einen Krieg gegen das Kapital den Krieg der Nationen unmöglich zu machen.