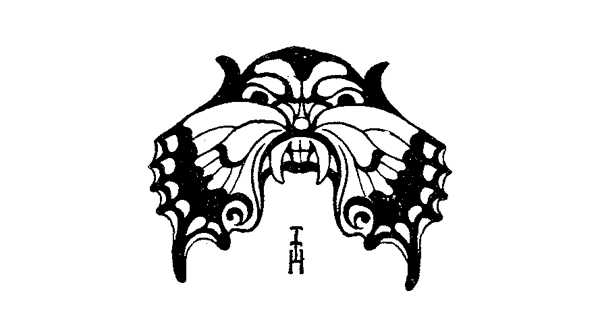|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Pirnitz und Friederike begaben sich direkt in die rue de la Sourdière zurück, während Daisy noch den Professor Bonchardon aufsuchte, um mit ihm über Genevièves Verbringung in eine Heilanstalt zu beratschlagen.
Gegen sieben Uhr trafen sie sich dann bei Duyvecke.
»Sie müssen entschuldigen, daß Rémi noch nicht da ist,« sagte die junge Frau lachend, »er macht sich schön für Sie.«
Während Friederike und Romaine die geschmackvolle Einrichtung des kleinen Salons bewunderten, kam der kleine Gaston auf sie zugelaufen. Etwas schüchtern wandte er sich an Friederike und fragte:
»Wo ist denn die andre hübsche Dame?«
Die »andre hübsche Dame« war Lea. Friederikes Herz krampfte sich zusammen. Sie nahm den Kleinen in die Arme und sagte:
»Sie ist fort, mein Junge. Und sie wird wohl nie wiederkommen.«
Der Kleine sah sie ganz erschrocken und nachdenklich an. Ein peinliches Stillschweigen folgte seinen Worten. Aber zum Glück trat grade in diesem Augenblick Rémineau in das Zimmer.
Er hatte sich, seit er verheiratet war, entschieden zum Vorteil verändert und sah fast elegant aus in seinem gutsitzenden blauen Tuchanzug.
Friederike fing den dankbaren und zugleich verliebten Blick auf, den Duyvecke ihm zusandte. Rémineau begrüßte sie etwas verlegen. Er empfand für Friederike eine ganz besondre Verehrung und bemühte sich, ihr auszusprechen, wie sehr er und Duyvecke sich über ihren Besuch freuten. Aber er konnte mit seiner kleinen Rede nicht recht fertig werden und Duyvecke kam ihm zu Hilfe:
»Geh, sei doch nicht so schüchtern, Rémi. – Aber glauben Sie mir, Mlle. Friederike, es kommt ihm wirklich von Herzen, wenn er sich auch ungeschickt ausdrückt. Wenn Sie wüßten, wie oft wir von Ihnen sprechen. Sie und Mlle. Pirnitz sind beinah wie ein paar Schutzheilige für uns. Es fehlt nicht viel, daß wir Sie überhaupt anbeten.«
Dann erschien die Magd, eine rundliche, blonde Flamländerin aus Duyveckes Heimat.
Das Eßzimmer war klein, behaglich und, wie die ganze Wohnung, sehr hübsch eingerichtet.
Duyvecke machte mit großem Eifer die Honneurs. Dabei erzählte sie in ihrer naiven Weise von den Leiden und Freuden ihres jetzigen Lebens – wie sie damals bei Gaston geblieben war, um ihn zu pflegen, wie sie Pirnitz ihren Entschluß, Rémineau zu heiraten, mitgeteilt hatte. Dann war sie ein paar Tage wirklich ganz unglücklich gewesen. Und weil sie Gaston doch nicht unter ihrer schlechten Laune leiden lassen wollte, hatte der arme Rémineau dafür büßen müssen. –
Rémineau blickte von seinem Teller auf und lachte maliziös:
»Ja, ich glaube wirklich, sie wollte mich vom Heiraten abschrecken. Aber ich kannte sie doch zu gut und sagte mir: Nur Geduld, Rémi, und halt' die Ohren steif. Das wird schon wieder vorübergehen. Früher oder später muß Duyvecke doch wieder Duyvecke werden.«
Dabei sah er zärtlich zu ihr hinüber und sie lächelte.
»Ich weiß ganz genau, wann Papa und Mama Vecke sich zum erstenmal geküßt haben,« sagte jetzt der kleine Gaston mit seiner hellen Kinderstimme. – »Das war, als ich wieder aufstehen konnte.«
Alle lachten, selbst Pirnitz und Friederike, während Duyvecke errötete.
»Gott, wir waren so glücklich, wie der kleine Lump wieder gesund wurde. – Wir fielen uns in die Arme wie zwei Leute, die zusammen Schiffbruch gelitten haben und wieder festen Boden unter den Füßen fühlen.«
So redeten sie noch eine Zeitlang weiter über sich selbst und ihr Glück, mit dem rührenden Egoismus zweier Menschen, die sich wirklich lieb haben und überzeugt sind, daß alle andern ihre Seligkeit teilen.
Das Souper war ausgezeichnet. – Aber Pirnitz und Friederike aßen sehr wenig, und Daisy behandelte die auserlesensten Gerichte mit derselben Gleichgültigkeit, als ob sie einen Teller Kartoffeln vor sich gehabt hätte.
»Aber Sie essen ja gar nichts,« sagte Duyvecke ganz traurig.
»Sie wissen doch, wir waren von jeher schlechte Gäste,« antwortete Friederike lächelnd. »Aber Sie dürfen uns deshalb nicht böse sein.«
Duyvecke schob jetzt auch ihren Teller zurück.
»Eigentlich haben Sie recht. Ich sollte auch nicht so viel essen. Ich werde immer dicker. Aber ich habe immer solchen Appetit. Es ist zum Verzagen.«
»Aber ich finde, es steht dir grade gut, daß du so stark bist,« meinte Rémineau, »und dann – – mußt du jetzt doch auch für zwei essen,« fügte er mit verschmitztem Augenzwinkern hinzu.
Duyvecke warf ihm einen wütenden Blick zu.
Er schwieg und lachte still in seinen schwarzen Bart hinein.
Friederike fing an, sich unbehaglich zu fühlen. Diese ewigen Geschichten von ehelicher Liebe und Schwangerschaft widerten sie förmlich an.
Duyvecke schien ihre Gefühle zu erraten und wurde plötzlich ernst:
»Trotz alledem giebt es doch Momente, wo ich mich nach der alten Zeit zurücksehne. Sehen Sie, Mlle. Pirnitz, ich werde doch nie vollkommen glücklich sein, weil ich etwas Besseres gekannt habe.«
»Bah,« sagte Daisy, »Sie haben gethan, was Sie konnten. Kein Mensch ist verpflichtet, eine Last zu tragen, die zu schwer für ihn ist.«
»Sehr gut gesagt,« stimmte Rémineau ihr bei.
Aber jetzt ergriff Pirnitz mit ihrer klaren, durchdringenden Stimme das Wort.
»Ja, Sie haben recht, Daisy. Nur sind meistens unsre Schultern stärker als unser Herz, ich meine damit, daß oft die Kräfte ausreichen würden, wenn nur der Wille nicht zu schwach wäre. – Übrigens sage ich das nicht etwa in Bezug auf Sie, Duyvecke. Sie haben redlich versucht, Ihre ganze Kraft dranzugeben. – Das Schicksal hat Sie auf die Ehe und die Mutterschaft hingewiesen. Aber ich bin fest überzeugt, daß Sie Ihr Kind, wenn es ein Mädchen ist, zu einem freien, selbständigen Wesen erziehen werden.«
Duyvecke war so bewegt, daß ihre Augen sich mit Thränen füllten.
»Ich danke Ihnen,« sagte sie leise. »Sie sind so gut.« –
»Wir werden thun, was wir können, Mlle. Pirnitz,« fiel Rémineau ein. »Wenn es ein Mädchen ist, so wollen wir es in Ihren Ideen aufziehen – so daß es Duyvecke später einmal ersetzen kann. – Ich habe es ihr versprechen müssen und war ganz damit einverstanden.«
Nach Tisch bat Duyvecke um Erlaubnis, erst den kleinen Gaston zu Bett bringen zu dürfen. Rémineau servierte währenddem den Kaffee.
Dann erschien Duyvecke wieder. Da alle etwas schweigsam geworden waren, setzte sie sich ans Klavier.
Sie spielte eine Sonate von Mozart. Friederike mußte unwillkürlich an die Abende in Apple-Tree-Yard denken – sie sah Tinka vor sich in ihrem weißen Piquékleid, mit ihren kurzen, blonden Haaren – und Georgs hohe Gestalt, wie er am Klavier saß und spielte. – Der Gedanke an jene längstvergangene Zeit nahm sie völlig gefangen, sie war froh, daß die Musik jedes Gespräch unmöglich machte.
»Wo mögen sie jetzt sein – – Lea ist jedenfalls längst bei ihnen – in England oder in Italien.« –
Und dann wieder kam ihr eignes Leben ihr so traurig, so inhaltslos vor. Aber nur auf einen Augenblick.
»Nein, ich beneide sie nicht, wenn sie auch noch so glücklich sind. Sie sind nicht mehr die Elitemenschen, die ich früher in ihnen sah und die ich so sehr geliebt habe. Georg ist ein Mann wie alle andern Männer geworden. Und Lea hat sich unter das Joch gebeugt – wie Duyvecke.«
Sie blickte Pirnitz an und drückte ihre schmale, bleiche Hand.
»Nein, ich bin nicht allein auf der Welt. Und wenn ich von allen Menschen verlassen werde, solange sie mir nur bleibt, ist alles gut. Ich könnte alles verlieren, nur sie nicht.«
Duyvecke hatte aufgehört zu spielen und setzte sich neben Pirnitz und Friederike, während ihr Mann mit Daisy über Geneviève sprach.
Sie erkundigte sich voller Interesse nach ihren Zukunftsplänen. Pirnitz erzählte ihr, daß sie in einem der volkreichsten Viertel von Paris wieder eine Schule aufthun wolle.
»Wenn es uns diesmal gelingt, so hoffe ich, daß manche von unsren einstigen Schülerinnen wieder zu uns kommen.«
»Das ist es grade, was Mlle. Heurteau fürchtet,« sagte Duyvecke. »Ich sah sie neulich, als ich mich in der rue des Vergers nach Ihnen erkundigte. Sie weiß zwar nicht, was Sie vorhaben, aber sie scheint es zu ahnen. Übrigens sprach sie die Hoffnung aus, daß es ihr mit der Zeit gelingen würde, Sie wieder zurückzurufen. Mein Gott, und wäre es nicht schließlich doch am besten so?« fügte sie etwas schüchtern hinzu.
»Nein, Duyvecke, das würden wir nie thun.«
»Aber Mlle. Heurteau meint es im Grunde nicht böse.«
»Das ist richtig,« sagte Pirnitz, »aber man kann nicht zweien Herren dienen. Louise Heurteau hätte der Frauensache große Dienste leisten können, aber sie will vor allem ihren persönlichen Ehrgeiz befriedigen und ihre Zukunft sichern.« –
Die Magd kam mit dem Thee herein.
Dann brachen die Gäste trotz Duyueckes und Rémineaus Bitten auf. Als sie schon im Vorzimmer waren, sagte Duyvecke:
»O, Sie müssen Gaston noch einmal sehen, wie er schläft. – – Er ist so niedlich.«
Rémineau ging mit der Lampe voran, die andern folgten ihm auf den Zehenspitzen. Die Thür zum Nebenzimmer, wo das Ehepaar schlief, stand weit offen.
Der Anblick des breiten, aufgedeckten Bettes schokierte Friederike.
Dort würden sie also nachher nebeneinander ruhen, dieser plumpe, halbgebildete Mann engumschlungen mit seiner hübschen, blonden Frau, die in nächster Zeit Mutter werden sollte – –
Eben beugte Duyvecke sich über den schlummernden Knaben und Rémineau, der neben ihr stand, küßte sie zärtlich auf den Hals.
»Kommt, laßt uns gehen,« murmelte Friederike.
Ihr war zu Mute, als ob sie in dieser Atmosphäre ersticken müßte. Duyvecke war ihr beinah unsympathisch geworden.
»Mein Gott, wenn ich Lea einmal so wiedersehen sollte. – Nein, lieber will ich sie überhaupt nicht wiedersehen.«