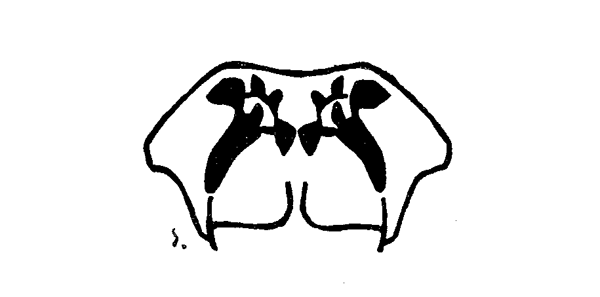|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Der Zug hatte eben Châtellerault verlassen und eilte jetzt weiter durch die Ebene auf Tours zu.
Friederike saß, ganz in Schwarz gekleidet, am Coupéfenster und ließ ihre Blicke hinausschweifen über die herbstliche Landschaft, die in rasch wechselnden Bildern an ihr vorüberglitt.
Außer ihr und Schwester Ottilie war niemand im Coupé. Die Nonne saß ihr gegenüber und schlief, ohne sich anzulehnen, wie die frommen Leute manchmal in der Kirche einschlafen.
Vorgestern abend hatten sie Paris verlassen, um Mlle. de Sainte-Parade zur letzten Ruhe zu geleiten. Am 17. September, kaum drei Monate, nachdem der Schlaganfall sie getroffen, war die alte Dame sanft entschlafen.
Auf Marias Rat hatte man an ihren Neffen, das einzige noch lebende Mitglied der Familie, telegraphiert. Er antwortete, daß er selbst leidend sei und deshalb bäte, die Leiche nach Pondenats zu überführen, wo sie begraben werden sollte.
Maria kehrte nach dem Tode ihrer Herrin in ihre Heimat zurück. Pirnitz und Daisy waren aus Sparsamkeitsrücksichten in Paris geblieben. Daisy hätte sich auch sonst schwerlich zur Reise entschlossen, da Geneviève im Gefängnis schwer erkrankt war. Schwester Ottilie war in ihr Kloster zurückberufen worden, sie wollte gleich von Paris aus weiterfahren.
Friederike dachte mit tiefem Schmerz daran, wie sie jetzt alle auseinander gestoben waren, die sich einst voll heiliger Begeisterung um das Werk geschart hatten. Was für stolze Hoffnungen hatten sie damals erfüllt, und was war das Ende gewesen? Die Feindseligkeit der Männer hatte alles wieder zerstört, was sie mit soviel Mühe aufgebaut hatten. Sie dachte an ihre ernste, arbeitsvolle Kindheit, an den Einfluß, den sie schon als kleines Mädchen auf ihre Mutter, ihren Großvater und ihre Schwester ausgeübt hatte – wie sie dann Pirnitz begegnet war, die sie in ihre Freiheitsideen einweihte – an den Aufenthalt in London – Free-College – das geschwisterliche Zusammenleben in Apple-Tree-Yard. Alles, was das Leben ihr während ihrer Kinder- und Jugendjahre gebracht, hatte dazu gedient, sie für ihren Apostelberuf heranzubilden. Selbst das bitterste Leid war ihr nicht erspart geblieben: sie hatte einen Mann geliebt und heroisch auf seinen Besitz verzichtet. Und doch, wie hatte sie an diesem entsagungsvollen Leben gehangen, dessen einzige Freude darin bestand, sich für eine große Idee aufzuopfern.
Und jetzt, wo ihre Jugend zu Ende ging – war alles um sie her zusammengebrochen. Ihre Träume waren nur für einen kurzen Augenblick zur Wirklichkeit geworden. Und das Schmerzlichste bei dieser Niederlage war, daß die Schar der Getreuen sich aufgelöst und in alle Himmelsrichtungen zerstreut hatte. Duyvecke war die erste gewesen, die Liebe eines Mannes hatte ihr näher gestanden, als die Befreiung ihrer Mitschwestern – dann Geneviève, die unter dem entsetzlichen Einfluß ihrer erblichen Belastung zur Verbrecherin geworden war. – Und nun war Mlle. de Sainte-Parade gestorben, Schwester Ottilie kehrte in ihr Kloster zurück, Mlle. Heurteau hatte die gemeinsame Sache verraten, um ihrem persönlichen Ehrgeiz zu fröhnen – Daisy Craggs würde wahrscheinlich den Rest ihrer Kraft der unglücklichen Geneviève opfern. – – So waren nur Pirnitz und Friederike zurückgeblieben.
Und noch eine war fahnenflüchtig geworden – eine, deren Namen Friederike selbst in Gedanken nicht mehr aussprechen wollte. Dieser letzte Schlag hatte sie zu tief getroffen – sie hatte Lea für immer aus ihrem Herzen gestrichen, wie ein Vater, der seine gefallene und entehrte Tochter von jetzt an verleugnet.
O dieser lakonische letzte Brief, der nichts weiter enthielt, als ein paar kühle Abschiedsworte:
»Meine liebe Fedi!
Unser Werk ist zerstört, und ich fühle, daß Ihr mich jetzt entbehren könnt. So halte ich es für meine Pflicht, zurückzukehren zu dem, der mich liebt, der um mich leidet.
Ich wollte Euch und mir selbst den Abschied und alle etwaigen peinlichen Erörterungen ersparen. Deshalb habe ich niemand etwas von meiner Absicht gesagt, die übrigens schon seit lange feststand. Vergieb mir, Fédi, wenn Du auch die Stimme Deines eignen Herzens hörst, so wirst Du mich verstehen.
Leb wohl, ich danke Dir und Romaine für alles, was Ihr an mir gethan habt – und umarme Euch alle drei
von Herzen Deine Lea.« –
Sie hatte Daisy und Pirnitz, die in angstvoller Erwartung lauschten, diesen Brief vorlesen müssen. Und dabei hatte sie sich ihrer Schwester geschämt; so in tiefster Seele geschämt, daß sie den Schmerz über die Trennung kaum mehr empfand.
Ja, die kleine Schar der Auserwählten war jetzt bis auf Friederike und Pirnitz zusammengeschmolzen. Und grade das war so tief demütigend, daß alle, mit Ausnahme von Daisy, sich schließlich doch unter das Joch der Männer gebeugt hatten. Friederike war zu klug und zu klardenkend, um die deprimierende, aber unabänderliche Wahrheit nicht einzusehen, die daraus hervorging: die freiwillige Unterordnung der Frau, die in ihrer tiefsten Natur begründet ist. Die Geschichte der Schule war der beste Beweis dafür: Mlle. Heurteau beugte sich, um aus den Händen der Männer Ehren und Auszeichnungen entgegenzunehmen; Duyvecke aus dem instinktiven Bewußtsein, daß das Weib zur Gattin und Mutter geschaffen sei. Geneviève war zur Verbrecherin geworden, weil ihr perverser Geschlechtstrieb sie bezwang – und Lea – die selbst Pirnitz und Friederike um ihre Reinheit beneidet hatten – verließ jetzt alles, um einem Manne nachzufolgen. –
Während sie so in Gedanken verloren dasaß, fiel ihr Blick auf Schwester Ottilie, die immer noch schlief, während ihre gefalteten Hände den Rosenkranz fest umklammert hielten.
Was für ein seltsames Wesen, diese Schwester – auch sie hatte einst an den Sitzungen des »Generalstabs« teilgenommen, und obgleich sie Pirnitz' Ansichten nie geteilt hatte, – sie war doch immer sich selbst und ihrem Berufe treu geblieben, während all die andern abfielen.
Ihr ruhiges, ausdrucksloses Gesicht hatte keine Spur von Trauer gezeigt, als der Sarg der alten Dame in die Erde versenkt wurde. Und doch hatte sie dieselbe vier Jahre lang mit größter Aufopferung gepflegt. Auch nach den Angelegenheiten der Schule hatte sie sich nie erkundigt, obgleich Mlle. de Saint-Parade alles mit ihr zu besprechen pflegte.
»Was mag überhaupt in ihrer Seele vorgehen?« dachte Friederike. »Was mag sie hoffen oder wünschen? Ist sie wirklich so völlig frei von allen menschlichen Leidenschaften, daß nichts sie interessiert oder bewegt?« –
Der Zug fuhr jetzt langsamer. Schwester Ottilie wachte allmählich auf. Ihre Blicke begegneten sich. Lächelnd fragte sie:
»Sind wir schon in Paris?«
»O nein, erst in Tours,« antwortete Friederike.
»Wo können wir wohl etwas zu uns nehmen?«
»Ich denke in Aubrais – um vier Uhr werden wir dort sein.«
Es war Friederike während der Reise aufgefallen, daß Schwester Ottilie einen ausgezeichneten Appetit entfaltete und großes Gewicht auf dessen Befriedigung legte. Bei dem Neffen der alten Dame hatte sie sogar schwarzen Kaffee verlangt und sich darüber beklagt, daß er nicht gut zubereitet war. Und das junge Mädchen fühlte sich unangenehm berührt durch dieses Gemisch von Egoismus und Selbstverleugnung, von religiösem Stoizismus und kleinlichen materiellen Bedürfnissen.
Als die Schwester über diesen Punkt beruhigt war, nahm sie ihren Rosenkranz und fing an zu beten.
In Aubrais angelangt stiegen sie aus, um am Büffet einige Erfrischungen zu sich zu nehmen. Als sie dann wieder im Zug saßen, jammerte die Nonne darüber, daß man kaum Zeit gehabt habe, um ordentlich zu essen. Sie schien aber trotzdem sehr gut aufgelegt und fing beinah an, redselig zu werden. Überhaupt pflegte sie nach den Mahlzeiten eine kleine Erholungspause zu machen, wahrscheinlich, weil es im Kloster so Brauch war.
Sie sprach von der langen Reise, die sie noch vor sich hatte, und von dem Kloster im Elsaß, das für sie die Heimat bedeutete.
»Sind Sie noch nie im Tham gewesen?« fragte sie.
»Nein, gute Schwester.«
»O, aber es ist so schön dort, viel schöner als hier. Unser Kloster ist so groß wie ein Palast, die Kapelle allein vermag 1500 Menschen zu fassen – beinah wie eine Stadtkirche.« –
»Freuen Sie sich darauf, es wiederzusehen?«
»O sehr. – Es sind bald vier Jahre – denken Sie nur, vier Jahre, daß ich in Paris bin. Unsre frühere Oberin ist während dieser Zeit gestorben – die jetzige kenne ich noch gar nicht.«
»Werden Sie denn jetzt im Kloster bleiben?«
»Das weiß ich noch nicht. Es ist Sitte bei uns, daß wir auf eine Zeit ins Kloster zurückgehen, wenn die Kranken uns nicht mehr brauchen. Die Frau Oberin bestimmt dann darüber, was weiter mit uns geschieht.« –
»Aber es muß doch sehr traurig sein,« sagte das junge Mädchen, »wenn solch ein Wesen, das man lange gepflegt hat, plötzlich stirbt. – Ihr Leben ist schön, aber doch gewiß oft recht schwer.« –
»O,« antwortete die Schwester einfach, »ich habe von jeher gern Kranke gepflegt. – Es ist nicht so schwer, man muß nur den inneren Beruf dazu haben.« –
»Ja, aber wenn nun eine Kranke stirbt, die Ihnen mit der Zeit sehr lieb geworden ist – ist das nicht doch ein großer Schmerz für Sie?«
»Es ist Gottes Wille,« entgegnete die Nonne sehr ernst. Und dann, nach einer kleinen Pause, fuhr sie fort:
»Wenn ich jetzt heimkomme, werde ich wohl kaum jemand von den Schwestern mehr kennen. Lauter neue Gesichter. – Und ich gehöre jetzt zu den Alten.« –
»Wie alt sind Sie, Schwester?« fragte Friederike.
»Dreißig.«
»Aber dann gehören Sie doch gewiß noch zu den Jüngeren.«
»Sie wollen sich wohl über mich lustig machen, Mlle. Friederike. Die Jungen sind achtzehn bis zwanzig Jahre alt. – Wir Schwestern erreichen überhaupt für gewöhnlich kein hohes Alter. Der liebe Gott pflegt uns zeitig heimzurufen.«
Nachdem sie das gesagt hatte, hustete sie leise, um anzudeuten, daß sie das Gespräch für beendet halte. Dann fing sie wieder an zu beten.
Draußen war es jetzt völlig dunkel geworden. Aber Friederike wollte nicht schlafen. Sie wollte noch einmal in aller Ruhe überlegen, was ihr jetzt nach ihrer Rückkehr zu thun blieb.
Sie freute sich darauf, Pirnitz und Daisy wiederzusehn, die einzigen, die ihr noch geblieben waren. Pirnitz hatte recht, ihre Pflicht und ihr Heil lag darin, noch einmal von vorne zu beginnen, wieder aufzubauen, was zerstört war. Noch waren sie ja nicht aller Mittel beraubt. Wenn die Sache mit der Kaution geordnet war, blieben ihnen noch 40 000 Francs. Und diese Summe genügte immerhin, eine bescheidene Schule zu errichten.
»Wir wollen von jetzt an nur noch im Stillen wirken,« hatte die Heilige gesagt. »Auf diese Weise sind wir den Angriffen unsrer Feinde nicht so ausgesetzt. – Wir mieten uns eine kleine Wohnung, Sie, Daisy, und ich, und versammeln einige Kinder aus dem Viertel um uns, die wir so gut wie möglich unterrichten. Mit den Mitteln, die uns noch zu Gebote stehen, können wir uns etwa fünf Jahre lang halten. Bis dahin liegen die Verhältnisse vielleicht wieder günstiger für uns.« –
Nachdem der erste Schmerz um Leas Flucht verwunden war, hatte Friederike sich mit dieser Idee abgefunden. Am liebsten hatte sie gleich morgen wieder mit der Arbeit begonnen, um alles andre zu vergessen. – Aber vorher hatte sie noch einen andern Schritt zu thun, der nicht länger hinausgeschoben werden durfte und der sie eine schwere Überwindung kostete.
Es handelte sich um Geneviève Soubize und um das, was sie Daisy versprochen hatte.
Friederike hatte ihren wirklichen Vater nie persönlich kennen gelernt. Wie sie jetzt Leas Namen einfach aus ihrem Leben gestrichen, so hatte sie schon in frühster Jugend vor jenem Manne, der ihre Mutter verführt, und dem sie selbst das Dasein verdankte, nichts mehr wissen wollen, jede Erinnerung an ihn in ihrem Herzen ausgelöscht. Trotzdem hatte sie es nicht vermeiden können, über das Schicksal der Familie d'Ulzac auf dem Laufenden zu bleiben. Der alte Bankier lebte immer noch, obgleich er längst in den Ruhestand getreten war. Sein Sohn, der einstige Liebhaber der armen Christine, hatte glänzende Karriere gemacht. Im Jahre 1894 war er Justizminister geworden, und als fünfzehn Monate später das Ministerium stürzte, wurde er zum ersten Präsidenten des Kassationshofes ernannt. Er galt für einen ernsten, strengen Mann von tadellosen Sitten und schroffem Charakter – und man schrieb ihm großen Einfluß zu.
Friederike wußte alles das, sie kannte sogar sein Porträt aus illustrierten Zeitungen. Mehr wie einmal hatte ihr Stolz sich dagegen empört, wenn sie in diesem strengen, scharfgeschnittenen Gesicht ihre eigenen Züge wiedererkannte. – Sie wußte noch mehr als das, sie hatte erfahren, daß der Präsident sich verschiedentlich auf Umwegen nach dem Schicksal seiner Tochter erkundigte. Selbstverständlich hatte er aus den Zeitungen erfahren, daß sie mit zu den Gründerinnen der Schule gehörte.
Solange es sich mir um ihre eignen Interessen oder um eine materielle Frage handelte, hätte Friederike sich trotzdem niemals entschlossen, ihren Vater aufzusuchen. Aber seit nach den letzten Zeitungsnachrichten Genevièves Sache eine schlimme Wendung zu nehmen schien, konnte sie den Gedanken nicht loswerden: »Vielleicht könnte ich auf diese Weise etwas für die Unglückliche thun?«
Sie hatte auch mit Pirnitz darüber gesprochen.
»O Romaine, ich flehe Sie an, zeigen Sie mir, was meine Pflicht ist – ob ich meinen Vater aufsuchen muß?« –
Und die Heilige antwortete ohne Zögern:
»Sie sind selbstverständlich nicht gezwungen, es zu thun. Aber ich kenne Sie, Friederike, und ich zweifle nicht daran, was Ihre Pflicht ist. Erstens vergeben Sie Ihrer Würde nicht das Geringste, wenn Sie den Präsidenten aufsuchen, und dann handelt es sich hier nicht um materielle Interessen, sondern um eine Frage der Menschlichkeit, der Gerechtigkeit. – Schließlich bin ich fest überzeugt, Sie würden sich die schwersten Vorwürfe machen, diesen Schritt unterlassen zu haben – wenn Geneviève wirklich verurteilt wird.«
So hatte Friederike sich denn schweren Herzens dazu entschlossen. Sowie sie wieder in Paris war, wollte sie Monsieur d'Ulzac aufsuchen. –
Es war dreiviertel auf acht, als sie auf dem Bahnhofe anlangten. Inmitten des Menschengewühls, das auf dem Perron herrschte, nahmen Friederike und Schwester Ottilie Abschied voneinander.
»Müssen Sie gleich weiter nach dem Ostbahnhof, Schwester?« fragte Friederike.
»Ja, ich glaube, um halb zehn geht mein Zug.«
»Also, ich wünsche Ihnen glückliche Reise und eine angenehme Ruhezeit in Ihrem Kloster.«
»Ich freue mich sehr darauf, es wiederzusehen,« antwortete die Schwester einfach.
Dann blätterte sie eine Zeitlang in ihrem alten abgenutzten Gebetbuch und nahm schließlich ein kleines Heiligenbild heraus.
»Wollen Sie dies Bildchen als Andenken behalten? Der Heilige Vater hat es selbst geweiht.«
»Ich danke Ihnen, gute Schwester,« sagte Friederike gerührt.
»Ich besitze kein Symbol meines Glaubens, das ich ihr zum Andenken geben könnte,« dachte sie. – »Und wozu auch? Unsre Auffassung ist ja so himmelweit voneinander verschieden. Und doch besteht eine gewisse Verwandtschaft zwischen meinem Lebenstraum und dem ihren.«
Der Packträger, den sie fortgeschickt hatten, um zwei Fiaker zu suchen, kam jetzt mit einem zurück und ging gleich wieder fort, um den zweiten zu holen. Schwester Ottilie drückte ihrer Gefährtin noch einmal die Hand, dann stieg sie ein und rief dem Kutscher zu:
»Ostbahnhof.«
Friederike mußte noch einen Augenblick warten, bis der zweite Wagen kam. Plötzlich hörte sie hinter sich eine Stimme:
»Mlle. Friederike.«
Als sie sich rasch umwandte, erkannte sie Duyvecke.
»Duyvecke? Sie hier?«
Die junge Frau stammelte sichtlich verlegen:
»Ja, ich bin hergekommen, um – – ich war bei Mlle. Pirnitz, und sie sagte mir, daß Sie heute abend um diese Zeit zurückkämen. – Und da dachte ich, ich könnte Ihnen vielleicht etwas helfen.« –
Friederike umarmte sie und küßte sie auf beide Wangen:
»Gute, liebe Duyvecke!«
Sie hatte sich heute so einsam und verlassen gefühlt, daß sie sich wirklich von ganzem Herzen über dieses unerwartete Wiedersehn freute.
»Ich sah Sie eben, wie Sie mit Schwester Ottilie sprachen,« sagte Duyvecke, »ich hätte ihr auch so gern guten Tag gesagt, aber ich wagte es nicht. Sie wissen ja, ich war nie besonders mutig.«
Dann bat sie Friederike um Erlaubnis, sie nach Hause begleiten zu dürfen. Friederike willigte mit Freuden ein, und sie stiegen zusammen in den Wagen.
Das Geplauder der jungen Frau tat ihrem bedrückten Herzen förmlich wohl. Duyvecke erzählte ihr, daß sie das traurige Schicksal der Schule aus den Zeitungen erfahren hatte. –
»Glauben Sie mir, Rémi und ich waren ganz unglücklich darüber. Er sagte immer wieder: So gehe doch einmal hin zu den Damen und frage sie, ob sie nichts brauchen. – Denn, wissen Sie, Rémi hängt so sehr an Ihnen. Aber ich traute mich wirklich nicht.«
Dann sprach sie von ihrem jetzigen Leben. Sie war überglücklich mit ihrem Mann und dem kleinen Gaston. Dazu fühlte sie sich jetzt selbst Mutter. Trotzdem schien sie ein wenig bedrückt durch das Gefühl, auf jene hohe Stufe von Vollkommenheit verzichtet zu haben, die Pirnitz und Friederike in ihren Augen einnahmen.
»Schließlich mußte Rémi mitkommen, und wir erkundigten uns bei dem Hausmeister in der rue des Vergers. Der sagte uns, wo Sie, Mlle. Pirnitz und Miß Craggs wohnten. Der arme Rémi mußte auch dahin mitgehen, ich hatte gar soviel Angst. – Aber Mlle. Pirnitz war so freundlich gegen mich. O, sie ist wirklich eine Heilige. Sie fragte nach meinem Manne und nach Gaston, und als ich ihr erzählte, daß er unten auf mich warte, ließ sie ihn gleich holen. – Dann sagte sie mir, ich sollte Sie doch heute abend abholen. Ich hätte sonst gewiß nicht den Mut gehabt.«
Als sie in der rue de la Sourdière ankamen, bestand Duyvecke darauf, Friederikens Reisetasche hinaufzutragen.
Dann nahm sie Abschied.
»Ich will Sie heute nicht stören. Sie haben gewiß alles mögliche miteinander zu besprechen. Aber ich hätte noch eine Bitte an Sie –«
»Was denn, Duyvecke?«
»Ich würde ganz unglücklich sein, wenn Sie nein sagen. – Sehen Sie, Rémi und ich möchten Sie – und Mlle. Pirnitz und Daisy – so gern einmal bei uns sehn – die andern Damen haben nichts dagegen.« – –
»Ich auch nicht,« sagte Friederike ganz gerührt. »Im Gegenteil, es würde mir große Freude machen. – Wir alle haben Sie immer noch lieb, Duyvecke.«
»O, ich danke Ihnen,« sagte die junge Frau. Und dann ganz schüchtern: »Welchen Tag würde es Ihnen am besten passen?«
Friederike dachte einen Augenblick nach. Sie wollte gleich morgen zu Monsieur d'Ulzac gehen und es war ihr ein wohlthuender Gedanke, nach diesem schweren Gang mit all ihren Freundinnen zusammen zu sein.
»Morgen abend, wenn es Ihnen recht ist, Duyvecke.« –
Duyvecke dankte ihr noch einmal mit aufrichtiger Freude. Dann umarmte sie Friederike und ging.