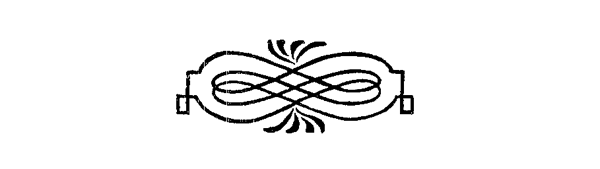|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Ein paar Tage nach der Zusammenkunft Durambertys mit Quignonnet und dem Abbé hielt gegen elf Uhr vormittags eine Droschke vor dem Schulgebäude.
Das Thor wurde rasch geöffnet, und Romaine Pirnitz eilte auf den Wagen zu, um die Ankommende zu begrüßen. Es war eine blonde, ziemlich korpulente Dame, deren volles, regelmäßiges Gesicht die Spuren einstiger Schönheit zeigte.
»Hermine!«
»Meine kleine Romaine!«
Sie umarmten sich mit schwesterlicher Zärtlichkeit. Während der Portier den Kutscher bezahlte und dann mit dem Koffer voranging, nahm die Pirnitz die volle Hand der Freundin zwischen ihre schmalen, weißen Finger und sagte:
»Ich hätte dich so gerne vom Nordbahnhof abgeholt, aber bis ein Viertel zehn hatte ich Vortrag bei den Größeren. Und ich hatte das Gefühl, daß ich meine Pflicht nicht einem rein persönlichen Vergnügen opfern durfte. Bist du mir böse?«
Hermine Sanz drückte ihr innig die Hand.
»Nein, ich hatte es genau ebenso gemacht.«
Dann gingen sie über den kiesbestreuten Hof, zu beiden Seiten lagen die Schulgebäude im hellen Sonnenschein da.
»Du gehst zu schnell für mich,« sagte Madame Sanz und blieb schwer atmend stehen. Dann ließ sie sich auf eine Bank nieder und legte ihre Hand auf die kindlich schmale Schulter der Freundin.
»Du bist immer noch so leichtfüßig wie mit fünfzehn Jahren, aber ich fange an, entsetzlich alt zu werden.«
»Dafür sah ich aber auch mit fünfzehn Jahren schon eben so alt aus wie jetzt.
Madame Ganz blickte sich prüfend um: »Sehr schön alles,« sagte sie, »sehr hübsch und praktisch erdacht.«
»So luxuriös wie im Free-College ist es nicht bei uns,« antwortete die Pirnitz.
»Free-College ist eben eine aristokratische Schule. Nach den in Londen herrschenden Begriffen wäre das hier selbst für eine gewöhnliche Kunstgewerbeschule zu einfach – man will dort nur in Tempeln lehren. –«
Sie standen wieder auf und betraten den linken Flügel des Gebäudes.
»Dein Zimmer liegt neben meinem,« sagte Pirnitz, während sie die Treppe hinaufstiegen. »Lea Sûrier, jenes reizende, junge Mädchen, das du ja in London kennen gelernt hast, tritt es dir ab. Sie wird, solange du hier bist, das Zimmer ihrer Schwester teilen.«
»Wie geht es denn den beiden Schwestern?« fragte Madame Sanz und blieb wieder stehen, um aufzuatmen. »Sind sie immer noch so hübsch und so rastlos thätig?«
»Friederike, ja, Lea geht es weniger gut –«
Der Portier, der den Koffer ins Zimmer getragen hatte, begegnete ihnen auf der Schwelle. Die Pirnitz fügte auf englisch hinzu: » Lea is poorly. I'm afraid of consumption.« Dabei legte sie die Finger auf den Mund und deutete auf die Thür des Nebenzimmers.
»Dort ist ihr Zimmer,« murmelte sie.
»Ah,« rief Madame Sanz und sank in einen Lehnstuhl, »diese entsetzlichen Treppen. Ihr solltet wirklich einen Lift haben – aber reizend ist es hier doch – alles so klar und luftig, man atmet förmlich auf, wenn man von London kommt!« –
Pirnitz stand an den Tisch gelehnt und blickte die geliebte Freundin voll inniger Freude an.
»Ist es denn möglich, Minnie, daß du wirklich da bist – alles, was ich hier geschaffen habe, kam mir so unnütz und unvollkommen vor, bis ich es dir zeigen konnte. Wie würde es mir meine Arbeit erleichtern, wenn ich dich immer in meiner Nähe wüßte.«
»Das habe ich auch schon oft gedacht,« antwortete Madame Sanz, »aber die Zahl unserer Arbeiterinnen ist noch zu bescheiden, als daß jede sich ihre Gefährtin wählen könnte. Und doch sind meine Gedanken immer bei dir, Romaine, auch wenn wir weit von einander entfernt sind. Wenn ich irgend eine schwierige Entscheidung zu treffen habe, so frage ich mich jedesmal: Was würde Romaine wohl an meiner Stelle thun?«
Ihre Augen füllten sich bei diesen Worten mit Thränen. Pirnitz küßte sie auf die Stirn.
»Du hast recht,« sagte sie. »Aber ich würde unendlich glücklich sein, wenn die Vorsehung es so fügte, daß wir den Rest unsres Lebens in gemeinsamer Arbeit verbringen könnten. –«
Beide blieben eine Zeit lang stumm und nachdenklich. Dann schüttelte Pirnitz den Kopf, als ob sie die trüben Gedanken verscheuchen wollte, und fragte: »Wie lange wirst du bei uns bleiben?«
»Kaum eine Woche. Du weißt ja, ich habe hier zu thun. Einige von meinen Schülerinnen im Free-College haben sich in den Kopf gesetzt, hier in Paris eine Filiale unserer Pension zu gründen, um sich in der französischen Sprache zu vervollkommnen. – Die Familien wollen das nötige Geld hergeben. Es handelt sich also nur darum, eine geeignete Wohnung zu finden. Ich schicke dann eine von unseren Gehilfinnen her, um sie einzurichten. Ich denke, in fünf bis sechs Tagen werde ich die Sache erledigt haben. Was meinst du dazu?«
»Ich habe mich schon umgesehen, Liebste. Wir wollen gleich heute Nachmittag einige Wohnungen ansehen. Wie herrlich, dich hier zu haben – mit dir ausgehen zu dürfen –, ich kann dir nicht sagen, wie ich mich darüber freue. Und du kannst mir glauben, es war wirklich notwendig, daß du herkamst. Ich habe ernste Sorgen, die ich durchaus mit dir besprechen muß.«
»Du meinst Lea?«
»Ja, sie in erster Linie – und dann noch manches andere, wovon ich dir noch nicht geschrieben habe.«
»In Bezug auf die Schule?«
»Ja.«
»Es scheint doch alles ausgezeichnet zu stehen?«
»Ja, für den Moment – aber – nun, ich werde dir das später erklären –«
In diesem Augenblick ging die Thür des Nebenzimmers auf: ein schlankes, hochgewachsenes junges Mädchen mit bleichem Gesicht, aus dem zwei wundervolle, blaue Augen hervorleuchteten, erschien in der Thür. Sie trug ein dunkles, eng anschließendes Kleid. Als sie Madame Sanz und Pirnitz erblickte, blieb sie etwas verlegen stehen.
»Kommen Sie nur ruhig herein,« sagte Pirnitz.
»Entschuldigen Sie – ich glaubte – ich hätte ein Buch hier liegen lassen.«
Eine brennende Röte bedeckte ihre sonst so durchsichtig bleichen Wangen. Madame Sanz stand auf.
»Kennen Sie mich denn gar nicht mehr?« »O doch, Madame – verzeihen Sie. Ich war so überrascht, plötzlich jemanden in meinem Zimmer zu finden. Es war zu dumm von mir, ich wußte ja, daß Sie heute kommen sollten – wie geht es Ihnen denn? Friederike wird sich so freuen, Sie wiederzusehen.«
»Ich auch,« sagte Madame Sanz – »ich erinnere mich noch so gut an die Zeit, wo sie meine Gehilfin im Free-College war. Ich habe nie wieder eine so tüchtige Mitarbeiterin gefunden. Friederike ist ein selten intelligentes, gewissenhaftes Mädchen.«
Lea sah sie an – die Farbe war wieder aus ihren Wangen gewichen. Dann sagte sie leise, als ob sie zu sich selber spräche:
»Free-College – London – das liegt jetzt schon alles so weit zurück, und doch kommt es mir vor, als ob es erst gestern gewesen wäre. Die Fahrt aus der Themse – unsere Ankunft – wie Edith Craggs uns an der Schiffsbrücke abholte und uns nach Apple-tree Yard brachte – unser erster Besuch im Free-College – an demselben Abend – erinnern Sie sich noch daran, Madame?«
»O, gewiß,« erwiderte Madame Sanz, »ich weiß, es wurde an dem Abend ein Vortrag über die gemischte Erziehung gehalten, von einer Amerikanerin, Miß – wie hieß sie doch gleich?«
»Miß Smith,« sagte Lea – »Ada Smith.«
»Ja, richtig – und nach dem Vortrag stellte Edith Sie mir vor, ich sehe Sie noch vor mir in Ihren eleganten Pariser Trauerkleidern.«
»Die gute Edith,« murmelte Lea, »sie war eine meiner liebsten Freundinnen in London. Voriges Jahr hat sie uns hier besucht. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört –.«
»Ich habe sie auch lange nicht mehr gesehen,« antwortete Madame Sanz, »als ich sie das letzte Mal traf, teilte sie mir mit, daß sie Lust hätte, Krankenpflegerin zu werden –« sie hielt inne. Lea hatte schon lange nicht mehr zugehört. Es legte sich wie ein Schleier über ihr Gesicht. Pirnitz zog das junge Mädchen mütterlich an die Brust:
»Mein kleiner Liebling,« murmelte sie. –«
Lea machte sich plötzlich los. Ihre Brust wogte stürmisch auf und nieder, und sie war nicht im stande, ein Wort zu sagen. Dann ging sie rasch hinaus.
»Das arme Kind,« sagte Madame Sanz, »sie sieht wirklich leidend aus. Das Wiedersehen mit dir hat sie plötzlich wieder an jene Zeit erinnert, und sie kann den Gedanken daran nicht ertragen – du weißt doch alles, was damals geschehen ist, nicht wahr?«
»Ja, Tinka hat es mir erzählt, nachdem Lea und Friederike London verlassen hatten –«
»Lea kam ganz gebrochen zu mir zurück,« sagte Pirnitz, »sie empfand die Liebkosungen, die sie mit ihrem Verlobten ausgetauscht hatte, wie eine nie wieder gutzumachende Schuld. Ich habe sie in ihrem Entschluß, mit Georg zu brechen, bestärkt. Sie hat sich entschlossen, ihre ganze Kraft einem höheren Beruf zu weihen. Als Georg aus Italien zurückkam, versuchte er, sie uns zu entreißen, aber ich habe sie bewogen, ihm nicht zu folgen.«
»Das hast du thun können? Romaine?«
»Findest du das unrichtig von mir?«
»Nein, die freiwillige Ehelosigkeit bedeutet für die Frau eine so hohe Stellung, setzt einen solchen Seelenadel voraus, es sind wirklich Auserwählte, die sich dazu entschließen können. Aber meine Erfahrungen haben mich gelehrt, daß nicht alle die Kraft dazu besitzen. Die neue Eva, » the new Woman,« von der Tennyson spricht, ist eine Ausnahme. Unser Ideal, die auserwählte Jungfrau, ist noch seltner. Wenn Lea wirklich solch eine Auserwählte ist, so hast du recht gethan. Wenn nicht, so wäre es vielleicht besser gewesen, sie hätte geheiratet.«
»Ich habe seit jenem Tage, wo Georg und Lea sich für immer trennten, viel darüber nachgedacht. Und wenn ich mitansehen mußte, wie das arme Kind leidet, wie sie an ihrem Opfer zu Grunde geht, so habe ich mich oft gefragt: hatte ich denn wirklich das Recht dazu, so zu handeln? – Ich sah Georg wieder vor mir, wie er damals vor acht Monaten hier erschien und seine Braut von mir forderte, wie er ihr das Glück der Gattin und Mutter verhieß – und dennoch habe ich mir gesagt, ich konnte und durfte nicht anders handeln. –«
»Und jetzt?«
»Ich würde jetzt genau so handeln. Ich würde Lea dasselbe sagen wie damals – und das hat sie zurückgehalten, ihm zu folgen: andere Frauen haben ihn die Geheimnisse der Wollust gelehrt, die er jetzt von Ihnen verlangt. Es ist der uralte Handelsvertrag zwischen Mann und Frau, die ewige Sklaverei – Hermine, du warst von jeher meine Gefährtin auf dem dornenvollen Wege des Aposteltums. Wir haben uns gleichzeitig zu denselben Ideen durchgerungen. Du kannst nicht mißbilligen, was ich gethan habe – Ich habe Leas Seele befreit, sollte ich sie wieder in die Sklaverei zurückstoßen?«
Madame Sanz dachte eine Zeit lang nach.
»Ich bin überzeugt, daß du vollkommen recht hast. Wie kannst du glauben, daß ich dein Thun mißbilligte? – Ich glaube nur, ich hätte in demselben Fall nicht den Mut dazu gehabt. Ich war ja immer die schwächere von uns beiden. Und dann – Lea ist ein so liebreizendes Geschöpf – Georg ein so selten sympathischer Mensch. – Ihre Vereinigung wäre vielleicht das Ideal einer Ehe geworden. –«
Das fröhliche Jauchzen der kleinen Schülerinnen, die auf dem Hofe spielten, unterbrach das Gespräch. »Das ist jetzt Leas Familie,« sagte Pirnitz. »Glaubst du, daß ihr Opfer umsonst gewesen ist?«
Sie führte ihre Freundin an das Fenster und ließ sie auf den sonnenbeschienenen Hof hinausblicken. Madame Sanz beobachtete das Treiben der Kinder mit lebhafter Aufmerksamkeit:
»Sie sind wirklich entzückend mit ihren klaren Stimmen und der echt französischen Lebhaftigkeit. Man kann sich kaum vorstellen, daß das wirklich Kinder aus dem Volke sind.«
»Und doch haben wir die meisten aus Volksschulen oder Waisenhäusern übernommen. Du hättest nur sehen sollen, wie sie zu uns kamen, verbildet durch die Heuchelei der traditionellen Erziehung, ohne moralischen Mut, ohne wirkliche Arbeitslust und ohne jede Individualität. – Aber in diesem Alter ist die Kindesseele noch wie weiches Wachs. In kaum einem Jahre haben wir sie zu ganz anderen Wesen gemacht, und nur, indem wir ihnen die Wahrheit gezeigt und das Beispiel gegeben haben. Denke dir, daß wir bis jetzt nur vier Schülerinnen wieder fortschicken mußten, und das war in den ersten Monaten. Man hat jetzt Zutrauen zu uns, sogar die Bourgeoisie schickt uns ihre Kinder. Wenn wir im nächsten Schuljahr alle aufnähmen, die sich gemeldet haben, so würde die Schule bis auf den letzten Platz voll.«
»Und wie steht es mit den Finanzen?« fragte Madame Sanz. »Bis jetzt hat es uns noch nicht an Geld gefehlt. Die Gründerin der Schule, Mademoiselle de Sainte-Parade, unterstützt uns reichlich –.«
»Sie ist sehr vermögend, nicht wahr?«
Pirnitz zuckte zweifelnd die Achseln:
»Das ist schwer zu sagen. Denk dir nur diese alte Dame – die im übrigen eine wahre Heilige ist – spekuliert. Natürlich nur im Interesse der guten Sache. Sie möchte Millionen für das Werk herbeischaffen. Dabei läßt sie sich vollständig von ihrem Geschäftsagenten, einem gewissen Michel, leiten. Bis jetzt sind all seine Unternehmungen gut ausgeschlagen und haben kolossale Summen eingebracht – aber wird es auf die Dauer gehen? – Ist es nicht ein entsetzlicher Gedanke, daß alles, was wir hier geschaffen haben, von einem Börsencoup abhängt?«
»Ihr müßt es mit der Zeit so einzurichten versuchen, daß Ihr sie entbehren könnt –«
»Aber, Liebste, wir sind nicht in England oder Amerika, wo das Geld von allen Seiten herbeiströmt, sobald es sich um Institute oder Schulen handelt. Wenn Mademoiselle de Sainte-Parade uns einmal im Stich läßt, so bleibt nichts andres übrig, als die ewige Vorsehung der Franzosen anzurufen. –«
»Du meinst den Staat?«
»Nun ja; aber du wirst begreifen, wie dieser Gedanke mir widerstrebt. Unsere Direktrice, Mademoiselle Heurteau –, übrigens eine sehr intelligente Dame, die an der Universität studiert hat –, würde gar nichts dagegen haben. Ich glaube, unter uns gesagt, sie hat überhaupt ein Faible für offizielle Geschichten. – Aber, wenn ich daran denke, unsere Schule sollte in ein staatliches Unternehmen umgewandelt werden, so ist mir zu Mute, als ob alles verloren wäre. – – – Wir wollen vor allem die Seelen unserer Kleinen bilden. Wenn wir's nicht mehr in der Hand haben, ihr inneres Leben zu unsren Ideen heranzureifen, so wird unsre Schule auf das Niveau eines ganz gewöhnlichen Pensionats herabsinken, werden unsre Schülerinnen zu sinnlichen, egoistischen Tagediebinnen erzogen werden. – Und dann bleibt uns nichts mehr, als den Staub von unsren Füßen schütteln und anderswo von neuem zu beginnen.«
Ein Schimmer von Schmerz und Resignation feuchtete die großen, dunklen Augen der Sprecherin, aber trotzdem hörte man ihrer Stimme an, daß sie fest entschlossen war, sich durch nichts entmutigen zulassen.
Sie hatten jetzt das Fenster verlassen. Madame Sanz trat vor den Spiegel, um ihren Hut abzunehmen. Dann öffnete sie ihren Koffer und fing an, verschiedene Gegenstände herauszunehmen.
»Und was ist denn inzwischen aus Georg und Tinka Ortsen geworden?« fragte Pirnitz.
»Georg ist damals nach seiner Rückkehr aus Frankreich kaum eine Woche in London geblieben. Er reiste dann nach Larensoe in Finnland, wo Tinkas Mann immer noch mit seinen beiden kleinen Mädchen lebte. Er bewog den Professor Ebner dazu, seine älteste, uneheliche Tochter anzuerkennen. Sie wurde kurz darauf mit einem braven, jungen Kaufmann verheiratet. Als diese Angelegenheit zur allgemeinen Zufriedenheit geordnet war, gingen Ebner und die Kinder mit nach England zurück. Georg wußte es dahin zu bringen, daß Tinka und der Professor sich aussöhnten, – Ich habe sie alle zusammen in London gesehen. Und sie machten einen äußerst glücklichen Eindruck.«
»Georg auch?«
»Georg ist trotz der Umwandlung, die mit ihm vorgegangen ist, ein viel zu energischer Mensch, um sich anmerken zu lassen, daß er leidet. Ich habe ihn niemals von Friederike und Lea sprechen hören.« –
»Glaubst du, daß die Frauen in seinem jetzigen Leben eine Rolle spielen?«
»Ich habe einmal mit Tinka darüber gesprochen, und sie versicherte mich, daß ihr Bruder seit dem Bruch mit Lea ein ebenso sittenreines Leben führe, wie vor seiner italienischen Reise. – Übrigens spricht Georg trotz der mehr wie geschwisterlichen Intimität, die zwischen ihnen herrscht, in Tinkas Gegenwart weder von Lea, noch von irgend einer anderen Frau.«
»Sind sie noch in London?« fragte Pirnitz nach einer Pause. »Nein, die ganze Familie ist schon im Februar nach Cornwallis abgereist, um dort den Frühling zu erwarten. Tinka und Georg haben einen förmlichen Abscheu vor dem nebligen, endlosen Winter in London. Und du weißt, in Cornwallis ist der Winter fast so milde wie in südlichen Ländern.«
»Nun und seitdem?«
»Ich habe nur selten von ihnen gehört. Tinka hat mir zweimal, seit sie dort sind, geschrieben. – Das letzte Mal vor vier Monaten. – Dann habe ich kürzlich in einer schwedischen Zeitung ›Aftonbladet‹ gelesen, daß Tinka demnächst einen Roman ›William Panwells Schwestern‹ veröffentlichen wird. – Das ist alles, was ich von ihnen weiß.«
Madame Sanz hatte, während sie sprach, ihren kleinen Koffer ausgepackt.
»Wo ist denn das Badezimmer?« fragte sie jetzt.
»Oh, verzeih',« antwortete Romaine, »ich rede da in einem fort auf dich ein und vergesse darüber, daß du dich danach sehnst, etwas auszuruhen und Toilette zu machen. –
Komm jetzt, ich will es dir zeigen!«
Die drei nebeneinander liegenden Badezimmer waren helle, luftige Räume mit weiß getünchten Wänden und je einer Zinkbadewanne sowie einem Doucheapparat.
»Nicht so üppig wie in Free-College, nicht wahr?« sagte Pirnitz lächelnd, »aber du magst mir glauben, daß es für eine Pariser Schule schon ein ungewohnter Luxus ist. Die Eltern unsrer Schülerinnen fallen beinah um vor Erstaunen, wenn sie hören, daß die Kinder hier jeden Tag baden. – So, ich laß dich jetzt allein. – Die Wäsche ist dort im Schranke. Es ist bei uns Sitte, daß jeder sich selbst bedient.«
»Ganz wie im Free-College,« antwortete Madame Sanz, »also auf Wiedersehen!«
Als Pirnitz am Zimmer der beiden Schwestern vorüberging, vernahm sie ein heftiges Schluchzen. – Einen Augenblick blieb sie zögernd vor der Thür stehen, dann faßte sie einen raschen Entschluß und trat ein.
Lea saß auf dem Feldbett, das man neben dem Lager ihrer Schwester für sie aufgeschlagen hatte. Als sie Pirnitz sah, fuhr sie in die Höhe, als ob sie sich flüchten wollte, aber dann sank sie mutlos wieder zusammen und versuchte nicht einmal, ihr thränenüberströmtes Gesicht zu verbergen.
Pirnitz setzte sich neben sie und faßte ihre Hand.
»Lea, mein geliebtes Kind.«
Das junge Mädchen blickte ihr in die Augen, und die magnetische Anziehungskraft dieser dunklen Sterne verfehlte ihre beruhigende Wirkung nicht, sie hörte auf zu schluchzen.
»Ist es ein großer Kummer, irgend ein neuer Schmerz?« fragte die Heilige.
Lea schüttelte verneinend den Kopf.
»Nun, und –«
»Ich bin wütend auf mich selbst,« antwortete das junge Mädchen leise, »ich habe keine Kraft, ich bin schlecht.«
»Weil das Wiedersehen mit Madame Sanz Sie erregt hat?« sagte Pirnitz lächelnd. »Wollen Sie sich deshalb für schwach halten – dann will ich Ihnen sagen, daß wir beide, Madame Sanz und ich, vorhin Ihre Tapferkeit bewundert haben.«
Lea schlang beide Arme um Pirnitz' Hals.
»Ach, Romaine, ich bin schwach, ich bin schlecht. All meine Kraft wird mich verlassen. Und ich – ich weiß nicht mehr – nein – ich weiß nicht mehr, ob ich Sie alle nicht belüge, wenn ich noch länger hier bleibe. – Unter all den andren – mein ganzes Leben hier ist eine abscheuliche Lüge.«
»Das versteh' ich nicht,« sagte Pirnitz, »Ihr Leben eine Lüge? Nein, wirklich, Lea, das verstehe ich nicht.«
Ganz leise, aber jedes Wort scharf betonend, als ob es sie eine schwere Anstrengung kostete, es auszusprechen, antwortete Lea jetzt:
»Ja, ich lüge. Ich schäme mich vor mir selbst, ich lebe hier zwischen euch allen, ich thue dieselbe Arbeit wie ihr, ich rede mit Begeisterung von unsrem Werk – ihr alle betrachtet mich als eine der Euren. Ich predige unsren Schülerinnen dieselben Lehren wie ihr: die Befreiung der Frauen – die Selbstständigkeit der jungen Mädchen, die neue Eva, die auserwählte Jungfrau. – – Mein Mund redet in einem fort von all diesen Sachen, aber gerade das bringt mich zur Verzweiflung.« – »Warum?«
»Weil meine Gedanken nicht dabei sind,« rief das junge Mädchen, »ich sage Ihnen, ich lüge, und ich kann diese Lüge nicht mehr ertragen –.«
Sie machte sich los und fing an, auf- und abzugehen.
»Wenn Sie wüßten, was für eine entsetzliche Leere ich in mir fühle, ich hoffe nichts mehr und ich glaube an nichts mehr – die Schule könnte zu Grunde gehen oder abbrennen – ich glaube, ich würde mit größter Gleichgültigkeit zusehen. Was mich früher begeisterte, läßt mich jetzt völlig kalt. – Meine kleinen Lieblingsschülerinnen, die ich fast allein erzogen habe, Alice Ambry, Georgette Vincent und Lydia Ronacker, die ich wirklich wie eine Mutter geliebt, und die mir meine Mühe reichlich vergolten haben, – sie sind mir jetzt völlig gleichgültig, mag aus ihnen werden, was da will, mögen sie fortgehen, mich hassen, mir ist alles einerlei – ach, Pirnitz, ich bin entsetzlich unglücklich.«
Sie stand hochaufgerichtet da, und ihre Augen glühten wie im Fieber. Pirnitz rührte sich nicht. Ihr Blick suchte Leas Augen, aber diesmal ließ das junge Mädchen sich nicht beschwichtigen. Sie wollte ihr Herz ausschütten, ihre ganze Verzweiflung hinausschreien. So fuhr sie jetzt leidenschaftlich fort:
»Wozu soll ich also noch mit euch zusammenleben? Ihr seid alle so ehrlich und so vollkommen, meine bloße Gegenwart muß euch verletzen. Sie müssen mich verstehen, Pirnitz – ich habe den Glauben verloren. – Ich bin jetzt fest überzeugt, hören Sie – fest überzeugt – daß ich nicht dazu geschaffen war, denselben Weg zu gehen, wie Sie und Friederike.«
Pirnitz antwortete nicht, und Lea fuhr fort:
»Es ist schrecklich – mir ist, als ob ich ein Doppelleben führte – ich sehe mich selbst vor mir, wie ich geworden wäre, wenn Friederike mir nicht von Kindheit auf ihre eigene Denkweise und ihren eigenen Willen aufgezwungen hätte – und wenn Sie nicht gekommen wären – Sie, die allein durch ihren Blick selbst Steine zum Leben zu erwecken vermag –«.
Krampfhaft umschlossen ihre Finger die eiserne Stange am Kopfende des Bettes, und sie atmete mühsam.
»Ich weiß, ich wäre so geworden – wie alle die anderen Pariser Mädchen, ein elendes, verworfenes Geschöpf. – Was mein Vater und meine Mutter mir vermacht haben – davon können weder Sie, noch Friederike mich erlösen. – Mein Vater war ein gewissenloser Mensch, der eine Gefallene heiratete, weil man ihm Geld dafür bot – und meine Mutter war imstande, auf diesen Handel einzugehen und ihn trotzdem zu lieben – einen Mann zu lieben, der sich dazu hergab. – Mein Gott, was spreche ich da, Pirnitz! Pirnitz! – haben Sie Mitleid mit mir – helfen Sie mir, halten Sie mich, haben Sie Mitleid.« Die furchtbare Spannung löste sich in einem Strom von Thränen. Sie warf sich vor Pirnitz nieder und verbarg den Kopf in ihrem Schoß. Pirnitz sagte kein Wort, ihre langen, krankhaft blassen Hände strichen langsam über Leas Haar. –
Nach einiger Zeit fing das junge Mädchen an, sich etwas zu beruhigen, sie erhob furchtsam den Kopf und bat mit ganz veränderter Stimme:
»Ich habe eben entsetzliche Sachen gesagt, ich fühle es, Romaine, Sie werden es mir nie verzeihen. Aber, wenn Sie sich von mir abwenden, bin ich verloren.«
Pirnitz blickte ihr tief in die Augen. Sie fühlte jetzt, daß sie ihre Gewalt über die Seele des jungen Mädchens wiedergewonnen hatte.
»Nein, das war nicht die wirkliche Lea, die so sprechen konnte. – Sie fühlen es ja selbst – es war jene andere Lea. – Aber glauben Sie mir, Sie sind nicht die einzige, die gleichsam eine zweite, feindliche Seele in sich fühlt, die sich nicht unter das Joch der Wahrheit beugen will –.«
»Sie nicht, Pirnitz – nein, Sie nicht – Sie sind nie eine andre gewesen als die, die wir alle so bewundern. Sie sind unsre Heilige.«
»Muß ich Ihnen denn immer wieder sagen,« antwortete Pirnitz, »ich bin keine wirkliche Frau wie die andren – sehen Sie mich nur an.«
»Sprechen Sie nicht so,« sagte Lea, »ich weiß, was Sie sagen wollen, aber ich will es nicht hören. Für mich sind Sie die Schönste und Herrlichste – wen hätten Sie nicht allein durch Ihren Blick erobert, wenn Sie nur gewollt hätten – aber Sie sind stark, und ich bin schwach – Sie sind gut, und ich bin schlecht. Sie ahnen ja gar nicht, was für Gedanken mich manchmal beherrschen.«
»Der Gedanke, uns zu verlassen?«
»Ja, auch das – und doch glaube ich, daß ich Sie nie verlassen werde – wohin sollte ich auch gehen, es ist ja alles vorbei – die, die ich geliebt habe, denken vielleicht nicht mehr einmal an mich –.«
Ihr Gesicht verzerrte sich vor Angst, dann fuhr sie fort:
»Nein, ich will nicht fort von Ihnen, aber in Gedanken lebe ich schon nicht mehr mit Ihnen zusammen. Ich lebe nur noch in der Vergangenheit, sie hält mich gefangen, ich kann nicht davon loskommen. Sie selbst haben es ja oft gesehen, daß meine Gedanken nicht bei der Sache sind. Wie so manches Mal haben Sie mir mit Ihrer lieben sanften Stimme gesagt:
»Lea – wo sind Sie?« – Nun ja – ich bin in London, in Tinkas Wohnzimmer – oder in dem großen Atelier bei Clariffs – oder ich gehe durch die Parks von Surrey – mit ihm! – Ich sehe ihn wieder vor mir in unsrer Wohnung in der rue de la Sourdière, wie er plötzlich vor mir stand – oder an jenem Abend nach der Einweihung, als er mich mit sich nehmen wollte und als Ihr Einfluß, Romaine, mich dazu zwang, ihm nicht zu folgen. Ich kann Tag und Nacht nichts andres denken, und alles übrige kommt mir vor wie ein sinnloser Traum. Aber es sind nicht nur diese Bilder, die mich quälen und verfolgen. Ich muß fortwährend nachdenken über alles, was geschehen ist, über das, was den Handlungen der andren zu Grunde lag, und darüber nachgrübeln, was ich selbst hätte thun können. Und das ist furchtbar – es ist so weit mit mir gekommen, daß ich manchmal Sie und Friederike hassen könnte. – Ich habe sogar gedacht – nein – ich habe nicht den Mut, es Ihnen zu sagen, was ich von meiner eigenen Schwester gedacht habe –.«
»Aber vielleicht würde es Ihnen etwas Erleichterung gewähren,« sagte Pirnitz zärtlich, »wenn Sie es mir sagten.«
Lea lag immer noch vor dem Apostel auf den Knieen, während sie jetzt fortfuhr:
»Nun also, ich habe unser ganzes Leben in London immer wieder an mir vorüberziehen lassen. Ich sehe Georg und Friederike wieder vor mir – ihren ganzen Verkehr miteinander – ich erinnere mich an Friederikes seltsames Benehmen an jenem Abend, als Tinka ihr mitteilte, daß Georg und ich uns verlobt hatten – und dann während unserer ganzen Verlobungszeit – an dem Tage, wo ich so verzweifelt aus Richmond zurückkehrte – und dann schließlich hier, als sie Georg so harte, unbarmherzige Worte sagte –.«
»Nun und dann?« fragte Pirnitz, als sie sah, daß Lea sich nicht getraute, weiter zu reden.
»Ja, da – da ist mir ein abscheulicher Gedanke gekommen, der sich mir gegen meinen Willen immer mehr aufgedrängt hat – und den ich nicht los werden kann. O, Romaine, zwingen Sie mich nicht, es Ihnen zu sagen – ich kann es nicht, es ist zu schmachvoll –.«
»Sie haben gedacht, daß Friederike auf Sie oder Georg eifersüchtig war?«
Lea nickte bejahend und verbarg ihr Gesicht wieder an der Brust der Heiligen.
»Ahnt Friederike etwas davon?« fragte Pirnitz.
»Oh nein, – ich möchte um keinen Preis der Welt – ich würde vor Scham umkommen – aber jetzt sehen Sie, wie schlecht ich bin – ich bin es nicht wert, daß Sie –«
Sie hatte sich bei diesen Worten erhoben und stand nun mit niedergeschlagenen Augen da, wie um ihr Urteil zu erwarten.
»Lea,« sagte Pirnitz, »kein Mensch ist Herr über seine Gedanken, aber doch darf man sich nicht von ihnen tyrannisieren lassen, man muß sie bekämpfen, niederzwingen – Friederike eifersüchtig? von kleinlicher, gewöhnlicher Eifersucht erfüllt? – das glaube ich kaum, ich kenne ihre große Seele, aber selbst wenn es so wäre? nehmen wir einmal das Unwahrscheinlichste an: daß sie Georg geliebt hätte, und er liebte sie nicht wieder; denn er liebte ja Sie, Lea. Hat sie sich dann nicht im Gegenteil so edel, wie nur möglich, benommen? Sie hat sich nichts von ihren Gefühlen anmerken lassen. Ihnen selbst ist dieser Gedanke viel später – erst jetzt gekommen, und Sie können es nicht einmal mit Gewißheit sagen. – Wenn ich Ihnen aufrichtig meine Meinung sagen soll – nun ja, ich glaube auch, daß sie eifersüchtig war, aber vor allein auf Sie, auf ihre kleine Lea. Das war sie schon damals, als Sie und ich uns zuerst kennen lernten. Sie litt damals unter dem Gefühl, daß ich ihr etwas von Ihnen nehmen könnte. Das hat sie mir selbst eingestanden. Bedenken Sie nur, was dieses große Herz gelitten haben muß, als jener Mann anfing, alle Ihre Gedanken und Gefühle zu beherrschen.«
Lea senkte den Kopf. Und Pirnitz fuhr in eindringlichem Tone fort:
»Die Vergangenheit ist tot, Lea, Sie dürfen nicht mehr daran denken, nein, Sie dürfen nicht. Lassen Sie die Toten ihre Toten begraben. Die irdische Liebe hat Sie in Versuchung geführt: ich selbst habe Ihnen damals die Wahl gestellt zwischen dem entsagungsreichen und doch so herrlichen Leben der Apostel und dem niedrigen Los der Geliebten. Sie haben sich freiwillig entschlossen, zu den auserwählten Jungfrauen zu gehören, heroisch mitzuarbeiten an der Befreiung des Weibes. – Sie sind frei, Lea, Sie sind heute noch frei, unsre Schule ist kein Gefängnis, sie öffnet ihre Thüre jedem, der nicht mehr hier bleiben will. Sie können uns jeden Augenblick verlassen –.«
»Oh Gott,« murmelte Lea und rang flehend die Hände.
»Sie können gehen, wann Sie wollen. Bedenken Sie nur das eine, einen solchen Entschluß, wie Sie ihn damals gefaßt haben, stößt man nicht ungestraft wieder um. Sie hatten die Wahl, und Sie wählten: bei uns zu bleiben. – Was sollte nun aus Ihnen werden, wenn Sie jetzt fortgingen? Was mag seit jener Zeit in dem Herzen und in dem Leben des Mannes, den Sie liebten, vorgegangen sein? –«
»Er sagte damals,« flüsterte Lea, »damals, als wir uns trennten – er würde mich, so lange er lebte, als seine Frau betrachten.«
»Glauben Sie denn, daß er damit sagen wollte, er würde Ihnen sein ganzes Leben lang treu bleiben, ebenso treu, wie Sie es ihm geblieben sind?
– Daß er niemals einer andren Frau einen Gedanken oder eine Stunde der Liebe schenken würde.
– Sie erröten, Lea, Sie zittern, und doch ist es so, wie ich Ihnen sage. Es ist das uralte Mißverständnis zwischen dem männlichen Herrscher und seiner Sklavin, der Frau. – Während Sie sich hier vor Sehnsucht verzehren, liegt der Mann, den Sie lieben, vielleicht in den Armen irgend einer andren und ist sich nicht einmal klar darüber, daß er Ihnen untreu ist.«
Lea stieß ein leises, schmerzliches Stöhnen aus.
»Und wie wäre es dann, wenn Sie ihn jetzt wiedersähen? Denken Sie an den Schmerz, an die Enttäuschung, die er Ihnen vielleicht bereiten würde. Alles, was Sie jetzt leiden, wäre nichts dagegen. – Lea, Sie haben den Mut gehabt, das Opfer zu bringen. Sie müssen sich darüber klar werden, daß es kein Zurück mehr giebt. Jener Georg Ortsen, den Sie geliebt haben, existiert nicht mehr. Und Sie selbst vermöchten ihm jetzt nicht mehr zu sein, was Sie ihm einst gewesen sind.« –
Schwere Thränen rannen über die Wangen des jungen Mädchens.
Pirnitz stand auf, nahm Leas Arm und führte sie ans offene Fenster.
Die Erholungspause war zu Ende. Die Kinder hörten auf zu spielen und begaben sich einzeln oder truppweise ins Refektorium. Fast alle wuschen sich vorher noch die Hände, denn man legte sehr viel Wert darauf, daß sie sauber und ordentlich zu Tisch kamen.
Lea blickte auf die kleine Schar hinaus, ohne daß der düstere Ausdruck aus ihren Zügen schwand.
»Das ist Ihre Familie,« sagte Romaine, »es ist zu spät, sie jetzt im Stich zu lassen. Sie gehören diesen Kleinen, die den Glauben an Sie nicht verlieren dürfen. Sein Sie stark, mein Kind, trocknen Sie Ihre Thränen, Ich möchte nicht, daß Madame Sanz etwas ahnt.«
»Ach, mein Gott,« sagte Lea, »wenn ich mich nur verbergen könnte – sie nicht sehen müßte. – Ach, Romaine, ich mache Ihnen wenig Ehre. Warum haben Sie es versucht, mich zu sich emporzuheben?«
»Sie machen sich selbst keine Ehre, wenn Sie nur in der Erinnerung an diesen Mann leben, der Sie vielleicht schon längst vergessen hat.«
»Oh, Romaine.«
»Der jedenfalls nicht so an Sie denkt, wie Sie an ihn. Ich will, daß Sie sich völlig frei fühlen sollen – losgelöst von allem, was Sie an ihn erinnert.«
»Ich will es versuchen.«
»Es wird Ihnen gelingen. Es ist nur eine Krisis – zwingen Sie sich dazu, Tag für Tag nur an Ihre Pflichten zu denken, dann werden alle schlimmen Gedanken endlich von selbst vergehen.«
Jetzt ging die Thür auf. Eine hohe Frauengestalt mit dunklem Haar und klaren, edlen Zügen trat in das Zimmer. Sie that, als ob sie Leas verstörtes Gesicht nicht bemerkte und lächelte Pirnitz zu:
»Ich habe gehört, daß Madame Sanz schon angekommen ist. Ist sie in Ihrem Zimmer?«
»Nein, Fédi, sie ist im Bade.«
»So – hast du sie schon begrüßt, Lea?« »Ja.«
Friederike faßte Leas Hand und sah ihr klar und ruhig in die Augen.
»Es ist gut, daß sie gekommen ist und daß du sie gesehen hast. Man muß sich seiner eigenen Kraft bewußt werden – du wirst stärker sein als deine Erinnerungen, wenn du auch im Moment darunter leidest. Seit ich weiß, daß Madame Sanz kommen sollte, habe auch ich mehr als sonst an London zurückgedacht. – Wir müssen uns gegenseitig helfen, stark zu werden.«
Pirnitz beobachtete die Schwestern aufmerksam, und es entging ihr nicht, daß Lea sich unwillkürlich loszumachen suchte. Es flog wie ein Schatten über die Züge der Heiligen.
Dann hörte man Schritte im Nebenzimmer, und gleich darauf erschien Madame Sanz.
»Ah, Friederike, mein liebes Kind,« sie streckte ihr beide Hände entgegen und blickte sie an.
»Sie sind noch schöner geworden, Fédi. Es ist gleichsam der Abglanz Ihres Berufes, der sich in Ihren Zügen wiederspiegelt. Wie freue ich mich, Sie wiederzusehen.«
Damit küßte sie das junge Mädchen auf beide Wangen.
Lea blickte die drei an: Pirnitz, Friederike und Madame Sanz – diese drei Apostel, deren heitere, klare Seele sich in jedem Wort, in jeder Bewegung kundgab, und plötzlich überkam sie eine Anwandlung tiefer Scham. Wortlos faßte sie die Hand ihrer Schwester und küßte sie.
Dann erscholl die Mittagsglocke.
»Wir wollen jetzt zum Frühstück gehen,« sagte Pirnitz. »Du hast gewiß Hunger, Hermine? Ich bin neugierig, was du zu unsrer einfachen Kost sagen wirst, aber ich glaube trotzdem, daß sie es mit eurer englischen Küche in Free-College aufnehmen kann.«
Der Speisesaal lag im Parterre, ein großer, lichter Raum, der trotz seiner einfachen Einrichtung einen freundlichen Eindruck machte. Die Lehrerinnen pflegten sich bei Tisch zwanglos unter die Schülerinnen zu verteilen, so daß jeder Anschein von Beaufsichtigung vermieden wurde. Drei von ihnen, Daisy Craggs, Duyvecke und Geneviève Soubize, standen plaudernd in der Thür.
»Mlle. Soubize,« sagte Pirnitz vorstellend, »sie ist unser Hausarzt und unterrichtet außerdem in Naturgeschichte, praktischer Chemie und Hygieine.«
Dann fuhr sie fort:
»Mlle. Duyvecke-Hespel, Miß Daisy Craggs, Ediths Schwester.«
Madame Sanz drückte allen die Hand. Dann fragte Pirnitz:
»Ist Mlle. Heurteau noch nicht da?«
»Da kommt sie,« sagte Geneviève.
Eine schlanke, etwa vierzigjährige Dame mit hübschem, ernstem Gesicht kam lesend den Korridor entlang.
Als sie die Thür erreicht hatte, blickte sie auf und begrüßte Madame Sanz mit einem liebenswürdigen Lächeln.
»Es ist mir eine große Freude, Madame,« sagte sie, »die berühmte Vorsteherin des Free-College, von dem ich schon so viel gehört habe, kennen zu lernen. – Ich bin gespannt, was Sie zu unsrer bescheidenen Schule sagen werden.«
»Ich fühle schon jetzt,« erwiderte Madame Sanz, »daß hier derselbe Hauch von Wahrheit und Freiheit weht wie bei uns. – Unsre herrliche Pirnitz weiß all ihren Schöpfungen den Stempel ihres Geistes aufzudrücken.«
Mlle. Heurteau geleitete den Gast zu dem Ehrenplatz am oberen Ende des Tisches und setzte sich dann neben sie. Friederike ließ sich zur Linken von Madame Sanz nieder.
Duyvecke hatte Pirnitz beiseite gezogen und sagte leise:
»Sie müssen mich heute nachmittag vertreten, liebste Pirnitz. Ich habe eben ein Telegramm von dem armen Rémineau bekommen. Sein kleiner Junge ist krank geworden – man fürchtet ein Nervenfieber. Der arme Mensch ist ganz außer sich und hat mich gebeten, ihm etwas bei der Pflege zu helfen: – Mlle. Heurteau findet nichts Unpassendes dabei.«
»Schon gut, Duyvecke,« antwortete Pirnitz. Aber dabei blickte sie die große Blondine so durchdringend an, daß sie dunkelrot wurde.