
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Nach Osterland will ich fahren,
Da wohnt mein süßes Lieb!«
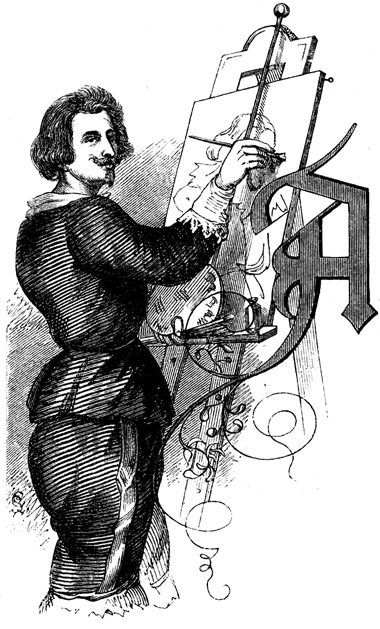
Anton, mit Euch halte es der Teufel aus!« sagte mißmuthig der hochberühmte Meister Rubens zu seinem Schüler van Dyk, der trüb und gesenkten Hauptes an seiner Staffelei stand. »Wie seid Ihr doch verwandelt seit einiger Zeit, ein Kopfhänger und Träumer seid Ihr geworden, und müßtet doch wissen, daß mir just solche Bursche recht in der Seele zuwider sind! Warum sagt Ihr mir nicht was Euch fehlt? wer weiß, ob Euch nicht zu helfen wäre?«
Da erhob sich ein gedämpftes Gelächter aus der andern Ecke des Ateliers, wohin gerade der Sonnenschein des lustigen Frühlingstages fiel, und wo drei junge Schüler des Rubens standen, frische frohe Gesichter, schlanke Jünglingsgestalten. Als nun der Meister sein gebietendes Auge dorthin wandte, sagte eine helle jugendliche Stimme, schwankend zwischen Muthwillen und Schein »Es fehlt ihm nichts Sonderliches, Meister; Anton in nur gewaltig verliebt!«
Ein Lächeln flog über des Rubens prächtige Stirn und zuckte wieder in den Mundwinkeln, aber es verschwand schnell, als er einen Blick auf den Angeklagten warf; Anton war todtenblaß geworden, er preßte die hübschen Lippen fest zusammen und aus seinen stolzen schwarzen Augen brachen Flammen und Thränen des Zornes.
»Ruhe! Ruhe!«
Dieser strenge Ruf des Meisters genügte aber, um augenblicklich jedes Wort, jeden spottenden Blick, jedes Lachen zu unterdrücken; die jungen Leute nahmen ihre Zeichnungen wieder eifrig vor, Anton van Dyk aber setzte den Pinsel an, um die letzten Striche an einem rührend schönen Ecce homo zu vollenden. Tiefe Stille herrschte, nur zuweilen unterbrochen von den festen Schritten des Meisters, der zwischen seinen Schülern hin und wieder ging. Später, nach dem Mittagsmahl, winkte aber Rubens seinem Liebling und führte ihn in ein kleines helles Gemach neben dem Atelier gelegen, strich ihm freundlich die finstern Falten von der Stirn und fragte noch einmal im weichsten Ton: »Nun sprecht, sagt Eurem treuen Freunde, was bekümmert Euch?« Da öffnete sich vor solchem Wort und warmem Blick das Herz des jungen Mannes, wie die Knospe sich vor dem Sonnenstrahl öffnet, und mit gefalteten Händen, als stände er vor dem Priester, legte er vor seinem angebeteten Lehrer seine unschuldige Beichte ab.
»Ihr wißt ja,« sagte er, »daß ich im vergangenen Herbstmond einmal zum luftigen Jahrmarkt nach Maaseyk gewandert bin, und dort zwei Tage recht toll und fröhlich verlebte. Von allen Gegenden der Niederlande waren Landleute und auch Städter dort zusammengekommen, und da war manch schönes Gesicht, manch prächtiger Nacken zu schauen, das glaubt mir, aber auch allerlei seltsame Gestalten und possirliche Fratzen: genug der Studien für Maleraugen. Ich lief hin und her und schaute und lachte und trank, wo es zu lachen und zu trinken gab, bis mir der Kopf ein wenig schwer geworden. Abends ging ich zur Schenke, um mit zu tanzen und auch in dies wilde Leben hineinzugucken, da konnte man aber kein Gesicht recht erkennen, wenn man nicht nahe hinzutrat, so wirbelte der Staub, und die beiden Fiedler und den Pfeifer auf der großen Tonne konnte fast niemand hören, so schrien und lachten die Bursche und Mädchen durcheinander und die Alten stampften den Takt dazu mit ihren Füßen. Ich sah eine Weile zu, da aber, als es immer toller wirbelte und jauchzte, packte mich der Uebermuth, ich mußte selber in den Strudel hinein, riß einem Fiedler die Fiedel weg und sprang damit auf einen Tisch, der seitwärts geschoben war. Gleich stürzten wilde Bursche herbei und begannen mich herabzuziehen und zu stoßen, da sprang ich denn und fiel – an die Brust eines Mädchens, das lachend nicht allzuferne stand. Sie fuhr schreiend zurück. Ich aber faßte sie um den schlanken Leib, denn ich sah, daß sie schön war, und ehe sie wußte, wie ihr geschah, wirbelte ich mit ihr durch die Schenkstube in rasendem Tanz, hinter mir her die anderen Paare, jubelnd und springend. Und ich ließ sie nicht, die frische Dirne, so hastig auch ihr Athem flog, so heiß auch ihre Wangen brannten, so kräftig sie sich sträubte; denn seht, lieber Meister, ihr Auge lachte mich ja an und sagte: »weiter, weiter!« Als ich sie endlich losließ und neben ihr auf die Holzbank fiel, da sprang sie plötzlich mit einem Wehruf auf und griff angstvoll nach dem Busen. »Was habt Ihr?« fragte ich erschreckt. »Ich habe das geweihte Bildniß meines Schutzpatrons verloren,« antwortete sie, »seht her, das Band ist zerrissen im wilden Tanz, der heilige Martin fort!« – Und ich wollte lose scherzen über diese Rede, ich konnte es aber nicht, wie ich ihr junges Angesicht ansah, denn es war schneebleich geworden und Thränen hingen an den dunklen Wimpern der Augen, »O sucht es, sucht es!« bat sie ängstlich. »Es ist nur ein schlechtes Schnitzwerk, aber mein Pathe gab es mir auf seinem Todtenbette, ich trug es seit meiner Kindheit und betete jeden Abend davor. Und der Pathe sagte mir damals, o ich habe es nicht vergessen: »wahre das Bildniß wohl, Marie, mit der Stunde, wo Du es leichtsinnig dahingiebst, wird Unglück über Dich kommen!« – Und ich suchte, und alle Bursche suchten, denn das Mädchen war ja gar zu schön. Meister, selbst Euere Augen sahen gewißlich nie einen schönern Fleischton als den an ihrem Halse, auch keine runderen Arme und frischeren Lippen! Aber sie weinte fort und fort, denn wir fanden nichts; wie sollte das auch möglich sein unter all diesen plumpen Füßen. Ta trat ich endlich dicht vor sie hin und sagte: »Trocknet Eure Thränen, schönste Jungfrau, sie thun mir gar zu weh. Ich werde Euch, das gelobe ich feierlich, in kurzer Frist einen andern St. Martin bringen, und er soll nicht schlechter sein als der verlorene. Ich will Euch sein Bild malen, groß und prächtig, er soll einen goldbesäumten Mantel tragen und auf einem prachtvollen Pferde reiten. Und ich kann das Wort halten, das ich Euch gegeben, denn ich bin ein Maler.«
Da war's auf einmal als ob die Sonne auf ihr Gesicht schiene und sie schlug die Hände zusammen und rief: »Das seid Ihr wirklich? Und das wolltet Ihr wirklich? Nun so gebt mir Euere Hand darauf, daß Ihr mir im Frühjahr meinen Heiligen bringen wollt.« Aber ich sagte ihr, daß ich das Bild nur in ihrem Hause malen wolle, und gab ihr die Hand darauf, daß ich sie besuchen werde im Mai. Dann fragte ich sie, wo sie wohne. – »Ich bin jetzt zum Besuch bei der Muhme in Brügge, gehe aber bald wieder heim nach …« Da rief von der anderen Stube her eine grelle Weiberstimme: Marie, kommt schnell herunter! »Wartet hier,« sagte sie noch zu mir – und war fort. Und ich wartete und lehnte den Kopf an die Wand, und muß wohl eingeschlafen sein, denn als ich mit dem Gedanken an das schöne Weib die Augen aufschlug, war der Tag da – aber sie nicht mehr. »Ihr habt wohl schwer geträumt?« fragte der Schenkwirth, als er mich so traurig sah. Ich fragte nach dem Mädchen im violetten Kleide, er hatte sie nicht gesehen, niemand hatte sie gesehen, und wie ich in der wüsten Schenkstube um mich blickte, war es mir, als ob wirklich alles nur ein Traum gewesen, als ob das Mädchen hier, auf solchem Boden nimmer gestanden haben könne. Da faßte mich eine gewaltige Betrübniß und ich stand auf, um ins Freie zu gehen mit meinem schweren Herzen, aber wie ich mich bückte, meinen runden Hut aufzunehmen, der mir im Schlafe entfallen, da schob sich mir etwas zwischen die Finger. – Wißt Ihr was es war? Ein Stückchen einer geschnitzten Männergestalt, der Kopf fehlte und die Füße auch, es war der verlorne, halb zertretene heilige Martin. Da hüpfte mir das Herz vor Freude, Meister, ich hatte also nicht geträumt! Aber ich fand die Marie nicht wieder, hörte auch nichts wieder von ihr und so mußte ich heimkehren zu Euch. Aber sie ging mir nicht aus dem Sinn und Gedanken den langen Herbst, den dunklen Winter nicht, und nun ist der Frühling da, und ich kann mein Versprechen nicht halten. Das verstümmelte Heiligenbild brennt mir auf der Brust, es hat da eine traurige Heimat gefunden und mag sich wohl nach dem ruhigen Herzen sehnen, an dem es so lange gelegen. – Nun wißt Ihr mein Leid, Meister. Verwundert Ihr Euch noch über meinen Trübsinn?«
»Anton van Dyk,« sagte jetzt Rubens ernst, »schlagt Euch den kurzen kindischen Traum aus dem Sinne; ich befehle es Euch im Namen unserer Kunst. Hat Gott Euch nicht einen glanzvollen unvergänglichen Kranz aufs Haupt gedrückt, auf den Ihr stolz sein dürft, wie mögt Ihr da noch ein so krankhaftes Gelüste tragen nach der verwelklichsten aller Blumen, »ach einer Mädchenrose? Wer Gold in den Händen trägt, wie möchte der nach Kupfermünzen greifen? Soll das tolle Verlangen nach den hübschen Augen eines Weibes dergestalt Eure Kräfte zerstören, Euer Schaffen hemmen, daß Ihr umherwandelt wie ein Träumer? Dann will ich Euer Meister ferner nicht mehr sein! Meint Ihr es aber redlich mit unserer hohen Kunst, nun dann rafft Euch auf und folgt dem Rathe, den ich Euch jetzt geben will. Ihr wolltet ja im nächsten Herbst hinziehen nach Rom, wolltet schauen und lernen dort, wo einem das Schauen und Lernen so leicht gemacht wird. Zieht jetzt hin, gerade jetzt, Anton; wartet keinen Tag länger! Ich selbst helfe Euch, damit sich kein Hinderniß Euch entgegenstelle, aber geht morgen und kehrt nicht eher wieder heim, als bis Ihr erkannt, daß allein die Kunst des rechten Malers ebenbürtiges Eheweib sein könne.«
Vier Tage nach diesem Gespräche nahm Anton van Dyk den wärmsten Abschied von Rubens; er war seinem Rathe gefolgt und rüstete sich zur großen Reise. Er schenkte seinem geliebten Meister das vollendete Gemälde eines Christus im Garten, an dem er lange mit großem Fleiß gearbeitet. Rubens war hocherfreut, machte seinem Liebling ein prächtiges Gegengeschenk mit einem stattlichen Reisepferde, entließ ihn mit den weisesten Ermahnungen und Rathschlägen und der junge Mann zog langsam und schwermüthig aus dem südlichen Thore Antwerpens dem Lande der Kunst entgegen.
Still und einförmig schlich der erste Tag vorüber, van Dyk mochte wohl noch gar traurige Gedanken haben, denn er zog zu Zeiten das kleine verstümmelte Bildniß des heiligen Martin hervor und küßte es heimlich. Am Abend des zweiten Tages war es, als das reizende Dorf Saveltham die Augen des Reiters fesselte. Im sanften Abendroth, ein Bild des Friedens, lag es da wie ein schlafendes Kind. Um die kleine Kirche her standen blühende Bäume, jedes der saubern Häuschen hatte ein Blumengärtchen vor den Fenstern, die Abendglocke läutete den Sonntag zur Ruhe, die Männer und Frauen saßen auf Bänken vor den Hausthüren, die Kinder hatten sich in großen Kreisen bei den Händen gefaßt und sangen beim Spiel, – des Reiters Herz wurde leichter. Er trieb sein Roß an und lüftete den breitrandigen spitzen Hut von den schwarzen Locken zum freundlichen Gruß. Vor der Schenke hielt er still. Der Wirth und sein Weib standen in der Thür, aus dem geöffneten Fenster aber schaute mit aufgestützten Armen ein Mädchen. Die weiße Haube schloß um ihr blühendes Gesicht und hielt die blonden Haare fest, die am Nacken hervorquollen und sich wohl nur mit Mühe wieder unter das Häubchen bergen ließen. Ihr veilchenfarbenes Kleid war mit schwarzem Sammet zierlich eingefaßt, und um den Busen trug sie ein schneeweißes Tuch. Sie schaute den Reiter an, just in demselben Augenblick, als seine Augen sich zu ihr hinwandten. Anton van Dyk schrie jubelnd auf, stürzte fast vom Pferde: er hatte ja seine verlorene Tänzerin erkannt. Das Mädchen sagte nichts, aber ein wunderlich Glühen flog über Stirn, Wangen und Hals und ein leises Zittern erfaßte die kräftige Gestalt. Als er ans Fenster trat, da war sie es aber, die zuerst das Wort fand. Schalkhaft lächelnd und mit dem Finger drohend sagte sie: »Ausgeschlafen? Die Muhme aus Brügge, die hat Euch damals tüchtig gerüttelt. Wir mußten fort, Ihr wachtet nicht auf! Aber nun ists doch gut, daß Ihr da seid, um Euer Wort zu halten!«
Da riß er die Schnur von der Brust und hielt ihr den wiedergefundenen Heiligen hin. Jauchzend fuhr sie auf und drückte das geschnitzte Bild an die Lippen, dann sah sie ihn lächelnd an. »O lächelt immer so,« sagte er in ihrem Anschauen versunken, »so seid Ihr am schönsten!« Dann trat er zu den beiden verwunderten Alten, erzählte von seinem Fund und Gelöbnis; und bat um ein Nachtquartier.
Aus dem Nachtquartier wurden Tage, aus den Tagen Wochen – Anton van Dyk hatte seine Reise nach Italien vergessen. Freilich hatte er hier auch plötzlich so viel Arbeit gefunden, Hände, Augen, Herz wußten nicht fertig zu werden. Der Wirth hatte ihm ein großes Zimmer eingeräumt, da hatte er denn sein Atelier aufgeschlagen und fing an fleißig zu malen. Die kleine Kirche des Dorfes besaß ein schlechtes halbzerstörtes Altarbild, er versprach ihr ein großes neues zu schenken. Und er malte eine heilige Familie, eine wunderschöne lächelnde Madonna, und das Angesicht der Himmelskönigin war eben das Gesicht Mariens, die ihm Stunden lang gegenübersitzen mußte, damit er ihre Züge festhalten konnte auf der Leinwand. Es geschah wohl auch, daß er das Mädchen länger anschaute, als es eben nothwendig war, oder daß er gar den Pinsel wegwarf und hastig und schweigend auf- und niederschritt. Die rosige Maria freute sich wie ein Kind über ihr eigenes Bild und konnte sich nicht satt daran sehen. Die Mutter schlug die Hände zusammen vor Staunen über die heilige Madonna mit den Augen ihres Töchterleins, und der Vater kannte sich nicht mehr vor Stolz und Uebermuth, da er sich selbst als heiligen Joseph in der Ecke stehen sah. Die Leute im Dorfe behaupteten, es sei nicht mehr richtig mit dem dicken Pieter, seit der fremde Maler ihn conterfeit. Der aber lebte von einem Tag in den andern hinein und konnte nicht von den blauen Augen lassen und nicht von dem süßen Lächeln und malte sie sich immer tiefer ins Herz. Und Maria? Nun sie liebte ihn, wie konnte es auch anders sein? War er nicht so schön, so ganz anders als alle Männer, die sie bis jetzt gesehen? Hatte ihn der Himmel nicht lieb vor allen andern, daß er ihm solche Zauberkraft gegeben, und war sie nicht eigentlich viel zu schlecht, daß die Hand, die so Wunderbares zu schaffen verstand, ihr Haar berührte und ihre Wangen streichelte? Und sie wurde ordentlich stolz auf sich selber, als der Geliebte ihr einst sagte, daß die Engel des Himmels, die in seinen Träumen auf- und niederstiegen, ihr Lächeln trügen. Sie hätte immer und immer lächeln mögen. Jung, sorglos und warmen Herzens waren beide und da gönnte ihnen denn der liebe Gott einen kurzen, aber recht seligen Frühling. Nicht mit Worten sagten sie sich wie sie sich liebten, sie gelobten sich auch keine Treue, sie lasen nur eines in des andern Augen täglich so wundersüße neue Liebesmärchen, ein Händedruck sagte so viel, ach! und was vermöchten alle Worte der Welt gegen den berauschenden Hauch eines Kusses? Van Dyk und Maria waren Kinder, die nur in der Gegenwart lebten und jeden Tag mit neuer Lust begrüßten, denn sie wußten, daß er ihnen wiederbringen werde, was der andere mitgenommen. Sie wußten kaum, daß der Sommer und Herbst hingegangen waren und daß der Winter die Erde fest hielt; bei ihnen blieb es Frühling, denn die Lerche ihrer jungen Liebe sang an jedem Morgen ihr selig Lied. Und als es draußen wieder grün geworden, da war das große Altarbild auch vollendet und strahlte in Glanz und Farbenpracht, daß die guten Bewohner des Dorfes der Freude und des Dankes kein Ende finden konnten. Und nun erst gedachte der Maler sein Versprechen zu erfüllen und seinem Liebchen einen heiligen Martin zu malen, den er gleichfalls für die Kirche des Dörfchens bestimmte. Er gedachte aber das Mädchen zu überraschen und der Gestalt des Heiligen seine Züge zu geben, damit Maria sich immerdar seiner erinnere, wenn er einstens ferne von ihr weile. Deshalb verwehrte er ihr von Beginn der Arbeit an den Eintritt in sein Atelier, so hart es ihm selbst im Anfang auch erschien, diesen lebendigen Sonnenstrahl aus seiner Kammer zu verbannen. Die großartige Arbeit selbst half ihm aber bald über diese Trennung hinweg, ja in der freiwilligen Einsamkeit legten sich allgemach die stürmischen Wellen, die die Liebe in seiner Brust schlug, und vor dem heilig ernsten Angesicht der Kunst, dem er nun vom Morgen bis zum Abend still gegenüber saß, verblaßte das Rosengesicht des irdischen Mägdleins. Und war es da zu verwundern, daß in ihm eine leise Erinnerung erwachte, die zitternd den Spiegel seiner Seele bewegte, wie ein Windhauch den See, und dann eine Reue auftauchte und zuletzt eine Sehnsucht?
Die Sehnsucht wuchs empor und breitete sich immer mächtiger aus und beschattete endlich sein ganzes Wesen, wie die dunklen Zweige eines Riesenbaumes: es war die heiße Sehnsucht nach der blauen Ferne, nach dem Wunderland Italien. Und mit jedem Pinselstrich zu dem Bilde des heiligen Martin wurde der Gedanke in ihm fester und klarer: ich muß wandern. An einem Sonntag Abend war das köstliche Bild vollendet, – van Dyk Martins keckes, lebensvolles Gesicht schaute mit ernsten Augen von der Staffelei herunter. Der Maler legte erschöpft den Pinsel nieder, da klopfte es an die Thür seiner Künstlerwerkstatt und ein vornehmer Cavalier trat herein. Die wallende Feder auf seinem Hute, der prächtige Mantel, das seidene Puffenwams und der spitze Degen mit goldnem Knauf verriethen den Edelmann, sein Gesicht aber war widrig und gelb, und seine Augen funkelten wie die Augen einer Schlange, die ein Opfer erspäht. Van Dyk erblaßte vor seinem Anblick. »Suchet Ihr mich, Ritter Nanin?« fragte er schüchtern.
»Ja, just Euch!« lautete die Antwort. »Seid Ihr's denn wirklich?« rief er spöttisch, »seid Ihr's in der That, Anton van Dyk? Nun so hat der Mund nicht gelogen, der die lächerliche Mär von Eurem Liebesleben nach Antwerpen brachte. – Euer edler Meister wollte sie lange nicht glauben! Wie gut, daß ich selbst den Weg nicht scheute, um die Wahrheit zu ergründen. Ihr bleibt wohl nun für immer hier und malt für die Bauern? Meister Rubens läßt Euch sagen, daß er sich schwer getäuscht, als er Euch einstens von jenem Kranze gesprochen, mit dem Gott Euer Haupt geschmückt; für Euch seien die Blumen der Erde just gut genug, Mädchenrosen und andere. Aber er bittet Euch durch mich in Eurem Leben niemandem zu verrathen, daß Ihr sein Schüler gewesen!«
Van Dyk zuckte schmerzlich wild auf. »O nein! so weit sind wir noch nicht, Herr Ritter!« rief er mit blitzenden Augen, »noch habe ich nichts gethan, was dem Meister Schande brächte. Seht her und sagt ihm, was Ihr gesehen!«
Damit riß er den Ritter aus Antwerpen vor das Bild.
»Und dann,« fuhr er aufgeregt fort, »sagt ihm ferner, daß ich doch noch nach Italien gezogen und so meiner Kunst das Schönste und Reichste zum Opfer gebracht, das ein Mensch zu opfern vermag: ein Herz. Ihr versteht das nicht, er aber wird's verstehen! Morgen früh bin ich auf dem Wege nach Brüssel. – Und nun lebt wohl, Herr Ritter, und glaubt mir, daß ich von dannen gezogen ohne Eure höhnische Mahnung!«
Der Cavalier ging achselzuckend zur Thür hinaus. Draußen stand Maria. »Morgen seid Ihr den Liebsten los, hübsche Dirne,« flüsterte er, »wollt Ihr mich behalten an seiner Statt? es sollte Euch nicht gereuen! Versucht's nur nicht, den da drinnen zu halten,« fuhr er boshaft fort, »Ihr beginget sonst eine Todsünde an ihm. Der Adler gehört einmal nicht ins Taubennest!«
Ohne Laut, ohne Klage, ohne Gedanken fast schlich Maria in ihr Kämmerlein. – Van Dyk hatte sich in seiner Künstlerwerkstatt eingeschlossen.
Am andern Morgen reichte der Maler dem dicken Schenkwirth Pieter und seiner schluchzenden Ehehälfte die Hand zum Abschiede. Sein stattlicher Schimmel, der so lange gefeiert hatte im warmen Stall und von Mariens Händen alltäglich gefüttert worden war, stand aufgezäumt und gesattelt vor der Hausthür. Van Dyk hatte die ganze Nacht über seine Geräthschaften und seine Habe zusammengepackt. Das alles barg der große Mantelsack, den er auf das Pferd geschnallt hatte. »Wo ist Maria?« fragte der junge Mann nun. »Sie ging eben noch einmal in die Stube, die Euch gehörte,« antwortete die Mutter. Er trat hinein. Das große Bildniß des heiligen Martin stand im hellen Tagesschein und sah aus, als ob es lebte. Das Mädchen stand nicht allzuweit davon und schaute es an. Der Maler trat dicht an sie heran, sie hörte es nicht und bewegte sich nicht. Dann sagte er ganz sanft: »Maria, lebt wohl!« Sie sah sich nicht um, zuckte auch nicht, sie reichte ihm die Hand so von der Seite hin; die Hand war kalt wie Eis. Da zog er den Arm leise zu sich, die junge schöne Gestalt folgte, aber langsam und schwer. Ehe das Mädchen ihr Angesicht zu ihm wendete, sagte sie zu ihm leise wie im Traum: »Ihr geht nun fort, ich behalte Euch aber doch hier,« sie wies auf das Bild, »und hier,« sie zeigte auf ihr Herz. – »Das weiß ich, Maria,« antwortete er bebend, »und der Heilige da soll Euch mit meinen Augen bewachen, bis ich wiederkehre und Euch als mein Weib in die Arme nehme.« Da wendete sie sich ganz zu ihm. – O wie waren ihre Wangen so bleich geworden über Nacht und wie schwere Thränen standen in ihren Augen. Er sah sie aber voll Staunen an und sagte: »Mädchen, was ist aus Euch geworden, wie schön, wie wunderbar schön seid Ihr!« Es war aber diese Schönheit der Stirn und des Blickes einzig und allein der Abglanz jener Himmelsblüte heißer wahrer Liebe, die sich nimmer eher zur vollen Blume erschließt, als bis die erste Schmerzensthräne auf ihre Knospe fällt. Anton van Dyk drückte das gebeugte Weib fest an sich und flüsterte: »Haltet mir Treue, Maria, ich kehre wieder, so gewißlich, als ich Euch jetzt verlassen muß. Haltet Treue!« Da schaute ein heiliger Schwur aus ihren Augen in seine Seele, heiliger als ihn je Lippen zu sprechen vermögen. Ein heißer Kuß, ein Schrei, – dann riß er sich los, schwang sich auf sein Pferd und ritt ohne sich umzuschauen zum Dorfe hinaus die Straße nach Brüssel entlang.
Es waren Jahre vergangen nach jener stillen schweren Abschiedsstunde, da ritt einmal ein stolzer stattlicher Reiter auf einem schön aufgezäumten Schimmel auf das Dorf Saveltham zu. Ein Junimorgen hatte eben seine glänzenden Flügel über das Dorf gebreitet und so sah es denn gerade so aus wie damals, als derselbe Reiter es zum ersten Male gesehen, und ihm war, als habe er allein Winter und Herbst verlebt in raschem Wechsel, als habe Frost und Sturm just dies eine Plätzchen unberührt gelassen. Ueber sein stolzes schönes Gesicht flog ein Strahl der reinsten Freude, und in den dunkeln Augen stand ungeduldige Erwartung. In diesem Augenblicke hatte Anton van Dyk, denn er war es ja, das herrliche Land Italien, von wannen er kam, ganz vergessen. Der glänzende Himmel des Südens erschien ihm minder warm als das helle lichtblaue Zelt, das über diese einförmige ruhige Landschaft ausgespannt war. Das Grün der Orangen und Myrthen dünkte ihm traurig gegen die lachende Frische der Blütenbäume, die wie lustige Kinder am Wege im Sonnenschein spielten. – Er ritt schneller, nun kamen schon die ersten Häuser des Dorfes und eine lärmende Schaar wilder Knaben stürzte auf den Reiter zu. Plötzlich blieben sie aber alle stille stehen, fast wie in jähem Schrecken und von ihren Lippen glitt leise und scheu der Ruf: »Der heilige Martin kommt, – der leibhaftige heilige Martin!« Und wie er langsam weiter ritt, wurde der Ruf lauter und aus den Häusern kamen Väter, Mütter, Schwestern und Buben, und sie erkannten auch den heiligen Martin, aber sie wußten, wer er war. Und wie er froh lachend allen zunickte, verwunderte es ihn, daß sie alle so traurig seinen Gruß erwiderten oder so mitleidig ihn ansahen. Da trieb er voll banger Ahnung sein Pferd an und ließ es erst stille stehen vor der Thüre der Schenke. Draußen auf der Bank saß der dicke Pieter im Sonnenschein; der war recht alt geworden in den wenigen Jahren und Kummer stand auf seiner Stirn. Sein Weib war inzwischen gestorben.
»Wo ist Maria?« fragte der Reiter halb athemlos und sprang herab. Da erhob sich der Mann, sah den Frager wehmüthig an und sagte: »Ihr kommt zu spät!« Dann kehrte er sich um und weinte.
»Ist sie todt?« schrie Anton hell auf.
»Nein! Sie überlebte alles – sie hat auf Euch gewartet.«
»Wo ist sie?«
»In der Kirche, wo sie jeden Morgen war, seit sie Euren heiligen Martin dort aufgestellt.«
Anton eilte mit bebenden Knien den wohlbekannten Weg zur Kirche hinab. Seine Gedanken flatterten wie scheue Vögel umher, eine Angst legte sich ihm wie eine schwere Hand auf die Brust. Die Dorfkirche, das liebe enge Friedensasyl, stand offen, der Weihrauchduft von der Frühmesse zog ihm sanft grüßend entgegen.
Der Sonnenschein drang durch die bunten Glasscheiben und legte ihm einen farbenreichen zitternden Teppich vor die Füße. Seitwärts im vollen Lichte hing das eine seiner Altarbilder, sein eigenes Portrait, die stolze Gestalt des heiligen Martin, dem Bilde gegenüber aber kniete das Weib, das er suchte. Ihm war, als habe er sie eben erst verlassen; sie trug noch solch ein schlichtes violettes Kleid mit schwarzem Sammet eingefaßt wie damals, das Haar lag noch eben so goldig und dicht wie einst unter dem weißen Häubchen. Anton van Dyk drückte die Hand auf sein Herz: er wollte aufschreien vor Lust. Aber noch konnte er ihr Gesicht nicht sehen, nur die Hände, die recht fest in einander gefügt auf dem Betpulte ruhten, und den weißen schlanken Hals. Er schlich von Pfeiler zu Pfeiler, immer wilder pochte sein Herz, – jetzt, jetzt mußte er sie sehen, – plötzlich lag ihr Antlitz vor ihm. Da, ach da war's ihm, als bohre sich ein scharfer Dolch in seine Brust, da rüttelte ein furchtbarer Schmerz an seinem Leben: Maria's Antlitz war das Antlitz einer Irrsinnigen. Eingeschlafen auf ihren Wangen waren die Rosen, erstarrt auf ihren Lippen jenes Engelslächeln, das ihn so oft beglückt, erloschen die hellen warmen Augen, weggewischt von der Stirn jene leuchtende Spur der Gedanken. Den stieren Blick auf das Bild des Heiligen gerichtet, kniete sie regungslos und bewegte nur zuweilen die Lippen wie im Traume. Da litt es den Lauscher nicht länger in seinem Versteck, er stürzte hervor zu der stillen Gestalt hin und sank an ihr nieder. »Maria, Maria vergebt mir!« rief er wieder und wieder mit heißen Thränen. Weiter konnte er nichts sagen.
Sie bebte beim ersten Laute seiner Stimme zusammen, ein Schauer flog durch ihre Glieder, dann sah sie nach ihm hin, lange, lange und sah von ihm wieder zum Bilde. Leise, wie der erste Tagesstrahl, glitt ein Erinnern über ihre Stirn; es blieb da, dann löste sich der starre Krampf der Züge, das alte wunderliebe Lächeln stand auf aus seiner Todesruh, aus den Augen brach das Sonnenlicht des Erkennens: der liebe Gott hatte Erbarmen mit den beiden Herzen und gönnte ihnen noch eine selige Minute. Mariens Arme umschlangen den Knienden, ihre Lippen drückten sich mit keuscher Zärtlichkeit auf seine Stirn, dann flüsterte sie: »Bist Du gekommen, mein Heiliger, Liebster? Verlangst Du nach der Braut? Sie war treu, nimm sie hin!« Und sie sank langsam ihm entgegen, er fing sie auf, riß sich und sie selbst empor, sie wurde schwerer und schwerer an seinem Herzen, er wußte jetzt, daß er nur ihren müden todten Leib hielt, die geduldige Seele war im Himmel, um ferner des Bräutigams zu harren.
*
Anton van Dyk's Herz hat sich nie wieder von diesem Weh erholt. Er kehrte nach Antwerpen zurück und warf sich mit seinem Schmerz an die Brust seines Lehrers Rubens. Erst nach Monden gelang es dem sanften Zureden dieses seines väterlichen Freundes und den milden Tröstungen des wunderschönen, diesem erst seit einem Jahre vermählten Weibes, die niedergebeugte Seele des Künstlers aufzurichten. Helena Forman, die zweite Frau Rubens', ähnelte ja auch seiner armen Maria; es war ihr Wuchs, ihr Haar, ihr Augenaufschlag. Man behandelte den Traurigen wie ein krankes Kind, wartete und pflegte sein mit der zärtlichsten Sorge. Und van Dyk war ja mit Leib und Seele Künstler, da mußten wohl allmählich seine Gedanken sich wieder auf die richten, die ihm einzig Ersatz zu gewähren vermochte für das Verlorene, auf die Kunst. Rubens zeigte ihm seine neuen gewaltigen Schöpfungen, wie hätte das Auge seines Schülers sie ohne Freude anzuschauen vermocht? Dann fragte der Meister nach Italien, und wessen Lippen könnten bei solcher Frage stumm bleiben?
So durchbrach langsam aber siegend die Sonne die dunklen Wolken der Schwermuth: van Dyk griff wieder nach Pinsel und Palette und suchte und fand so Linderung seiner Qualen. Sein erstes Werk war der heilige Augustin in Begeisterung, ein Bild von großartiger Composition. Wie erstaunte Rubens und ganz Antwerpen über die Meisterschaft des einstigen Schülers, über die Kunst und Glut seines Pinsels, über sein wahrhaft tizianisches Colorit.
Mit wehmüthiger Freude nahm van Dyk alle diese enthusiastischen Lobsprüche hin; sie thaten seiner Seele wohl, aber ruhelos blieb er doch. Kaum hatte er seinen heiligen Augustin vollendet, als er Antwerpen verließ und hin und her zog, wie es ihm eben in den Sinn kam: zuerst nach dem Haag, dann nach England, dann nach Frankreich, bis er sich zuletzt für immer in London niederließ.
Wie es denn hienieden so oft geschieht, daß ein Menschenherz, wenn es seinen Jammer nicht zu stillen vermag, ihn zu übertäuben begehrt, so geschah es auch hier. Van Dyk warf sich mit seinem Leid in den Staub der Welt und lebte ein tolles Leben in äußerem Jubel und Herrlichkeit. – Er widmete sich nun fast ausschließlich der Portraitmalerei, und man bezahlte die höchsten Preise für ein Bildniß von seiner Hand. König Karl I. saß ihm mehrere Male sogar, ebenso der Herzog von Buckingham und alle Großen und Vornehmen des englischen Hofes. Man nennt Anton van Dyk den einzigen Maler, dessen Portraits mit denen des großen Tizian einen Vergleich aushalten. Sein Pinsel war von entzückender Zartheit in seinen Portraits und seine Lichter und Farbentöne wirkten mächtig. – Er malte dabei so erstaunlich rasch, daß er gewöhnlich einen Kopf in Zeit von einem Tage vollendete. Anton van Dyk war bald ein reicher Mann. Sein Haus war glänzend eingerichtet. Neben dem Atelier des Malers lag ein kostbar ausgeschmückter Saal, in welchem Spielleute sanfte Weisen spielen mußten, lange Tafeln standen da, besetzt mit den feinsten Weinen und kostbarsten Erfrischungen. Zu allen Stunden des Tages fanden sich dort die Verehrer des Künstlers ein. Wunderschöne Frauen bedienten die Kommenden und van Dyk's hohe Gestalt sah man dann und wann hin und wieder gehen zwischen seinen Freunden. Er gab auch endlich dem Drängen seines vornehmsten Gönners, des Herzogs von Buckingham, nach und vermählte sich mit einer der schönsten Frauen Altenglands, mit der Tochter des Mylord Ruthwen, Grafen von Gore. Sie hieß Maria und van Dyk liebte sie – um dieses Namens willen. Die Ehe blieb kinderlos und freudlos.
Endlich wurde er müde, der ruhelose Meister, müde des stillen Schmerzes, müde der Feste, müde seines schönen Weibes, müde der Welt! Er hatte eben sein 42. Jahr erreicht, es war im Frühling des Jahres 1641, als Anton van Dyk erkrankte. Die Staffelei mußte man ihm in sein Krankenzimmer tragen, und wenn er zuweilen von seinem Lager aufstand, malte er wieder einige Striche an einem wunderbar lieblichen Bilde: Madonna mit dem Kinde zwischen Rosen und Orangenblüten. Seitwärts kniete ein rührend schöner betender Engel. Die Himmelskönigin trug die Züge der schönen Maria Ruthwen, das Engelantlitz aber – gehörte einer unvergeßlichen Todten.
Das Bild war vollendet. Ein warmer Sonnentag schien durch die hohen Fenster und schickte köstliche Strahlen auf das Lager des Kranken. Das Weib van Dyk's saß trauernd zu seinem Haupte, einige seiner Freunde standen neben ihm, und an der Thür lauschte sein alter treuer Diener, den er aus den Niederlanden mitgebracht. »Rücke die Staffelei näher, Kornelius,« sagte der Maler, »ich will mein Bild sehen!« Und wie die Lichtströme voll und warm auf das Bild flossen, daß alle erstaunten über die Pracht und Schönheit der Gestalten und Farben, da faltete Anton van Dyk schwerseufzend die Hände und murmelte wie damals: »Vergieb, Maria!« Da mußte wohl jener betende Engel auf dem Bilde heimlich eine Antwort hinübergehaucht haben zu dem Sterbenden, denn sein Gesicht verklärte sich plötzlich wunderbar. Das Rührendste und Seltenste, was die Stirn eines Erdenkindes zu krönen vermag, der Friede breitete sich über seine Stirn. Er schloß die Augen, athmete tief auf, der Tod berührte sanft sein heißes Herz. Maria van Dyk beugte sich leise weinend über das Sterbelager. Der leise gehauchte Name » Maria« traf noch ihr Ohr. Hatte der Scheidende sie wohl gerufen?
