
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Von Prof. Dr. F. Wahnschaffe.
Die Rinne, in der die Grunewaldseen liegen, stellt einen schmalen, im Maximum 300 m breiten, stark gewundenen alten Wasserlauf der Eiszeit dar. Was die Entstehung dieser Rinne anlangt, so liegt es auf der Hand, daß die heutigen Niederschläge nicht imstande sind, eine so tiefe und ungleichmäßig gestaltete Rinne auszufurchen. Die teilweise durch Torfmassen ausgefüllten Verbindungsstücke der Seen zeigen uns, daß auch diese flacheren Rinnenteile vor der Bildung des Torfes entstanden sein müssen und früher ebenfalls von Wasser bedeckt waren. Die unregelmäßigen Tiefenverhältnisse des Bodens der Seenkette weisen darauf hin, daß hier kein gleichmäßig fließender Wasserstrom die Ausschürfung bewirkt haben kann, denn gewöhnlich strömendes Wasser pflegt in leicht zerstörbaren Ablagerungen eine sich gleichmäßig vertiefende Rinne zu schaffen. Wir werden die Bildungszeit wohl am besten in die Zeit der zurückschmelzenden letzten Eisdecke verlegen und annehmen, daß hier am Eisrande aus einem Gletschertore ein Schmelzwasserbach hervorwandelt trat, dessen Lauf bereits unter dem Eise von Nordosten her seinen Anfang nahm. Die unregelmäßige Erosion des Bodens erklärt sich am besten durch fließendes Wasser unter dem Eise, wo es unter Druck ähnlich wie in einer geschlossenen Röhre fließt und bald mehr ablagernd, bald mehr erodierend auf den Untergrund einwirken kann. Die Grunewaldseenrinne ist als alte eiszeitliche Nebenrinne der viel bedeutenderen Havelseen entstanden und hat sich aus Mangel an Zufluß nach und nach in einzelne Seen aufgelöst, Die alte Angabe, daß zum Bau des Jagdschlosses Rüdersdorfer Muschelkalk auf dem Wasserwege hierher befördert worden sei, kann nur so verstanden werden, daß die Kalksteine von Rüdersdorf auf der Spree, vielleicht auch bis zur Havel zu Schiff an eine Ablagestelle gebracht worden sind, denn die Annahme einer zusammenhängenden, für Kähne befahrbaren Rinne im Verlaufe der Grunewaldseen in historischer Zeit ist mit den geologischen Verhältnissen nicht in Einklang zu bringen. während die Havelseen durch die alluvialen Gewässer der Havel dauernd miteinander verbunden wurden. Beide Rinnen gehören zu dem von Berendt aufgestellten glazialen Seentypus der Schmelzwasserrinnen, der im norddeutschen Flachland weit verbreitet ist.
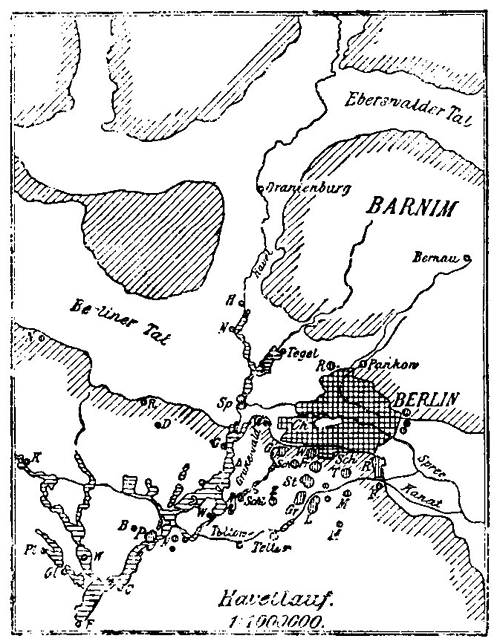
(Aus Wahnschaffe. Der Grunewald.)
Ein besonderes Interesse gewährt die Grunewaldseenrinne durch die nach der Eiszeit eingetretene Vertorfung einzelner Teile. Der Geologe und Botaniker hat hier Gelegenheit, den ganzen Prozeß der Vermoorung von seinen ersten Anfängen an durch die verschiedenen Stadien seiner Entwicklung zu verfolgen, und der Botaniker findet zu seiner Freude die für die verschiedenen Moorarten charakteristischen Pflanzenformationen zum großen Teil erhalten. Man unterscheidet jetzt nach der äußeren Form und Entstehungsweise drei Arten von Mooren: die Flachmoore (Niedermoore), die Zwischenmoore (Abergangsmoore) und die Hochmoore. Die Flachmoore bilden sich meist aus offenen Seen oder in stagnierenden Flußläufen im Niveau des obersten Grundwasserspiegels, während die Hochmoore sich über den Grundwasserstand erheben und, wo sie eine gewisse Ausdehnung erreichen, z. T. in uhrglasartiger Form über ihre nähere Umgebung hinauswachsen.
Der die Flachmoore zusammensetzende Torf bildet sich aus den im Wasser wachsenden Pflanzen, die nach ihrem Absterben unter teilweisem Luftabschluß einen Gärungs- und Humifizierungsprozeß durchmachen, wobei die Pflanzenfaser mehr oder weniger umgewandelt und ihr Kohlenstoffgehalt angereichert wird. Die Pflanzengemeinschaft, die zur Bildung der Flachmoore Veranlassung gibt, ist durchweg nährstoff- und namentlich kalkliebend; sie findet diese Pflanzennährstoffe in den stagnierenden Gewässern, die mit dem Grundwasser in Kommunikation stehen. Alle Glazialablagerungen sind ursprünglich kalkhaltig und liefern durch die Verwitterung der kristallinischen Gesteine Kali und Phosphorsäure. Diese Nährstoffe werden durch die Regen und Schneeschmelzen ausgelaugt und den stagnierenden Gewässern zugeführt. Der Torf der Flachmoore ist meist reich an Kalk und Stickstoff, der Rückstand nach der Verbrennung (sog. Asche) kann z. B. 50% betragen, doch ist er zur Heizung nicht mehr brauchbar, wenn der Aschengehalt 25% überschreitet. Der erste Beginn der Vertorfung eines Seebeckens, wie er an den Grunewaldseen vortrefflich zu beobachten ist, tritt dadurch ein, daß sich an den flachen Uferrändern Vegetationszonen von Sumpf- und Wasserpflanzen ausbilden. »In der Flora der Ufer und des Wassers, sagt Graebner, lassen sich drei Abteilungen gut unterscheiden, die natürlich unter Umständen sich mischen können, aber auch dann sehr leicht in den drei Abteilungen gesucht werden können. Zunächst ist die Flora der nassen, dauernd besiedelten Ufer zu unterscheiden, charakterisiert durch hohe Rohrgräser und Stauden, meist in dichtem Bestande. Daran schließt sich die Flora des nicht stabilen Bodens, also des zeitweise vom Wasser überfluteten, mit Sand und Schlick bedeckten, an, charakterisiert durch lockere Bodenbedeckung niedriger oder mittelhoher Stauden, und einjähriger Arten. Als dritte Gruppe käme dann die Flora der normal untergetaucht oder schwimmend lebenden Pflanzen.«
Zu dieser Flora der Ufer und des Wassers gehören im Grunewald namentlich das Schilfrohr ( Phragmites communis), das gemeine Schilf ( Calamagrostis Epigeios), Cladium mariscus (am Schlachtensee) und der Rohrkolben ( Typha); Binsen-, Bidens- und Scirpus-Arten, Kalmus, Wasserlilie ( Nymphaea alba) und Teichrose ( Nuphar luteum), Froschlöffel ( Alisma plantago) und Froschbiß ( Hydrocharis morsus ranae), Wasserschere ( Stratiotes aloides), Laichkräuter usw.
In vielen Seen bildet sich auf dem Grunde ein breiiger bis gallertartiger Schlamm, der aus den zu Boden sinkenden abgestorbenen Algen (z. B. »Wasserblüte« von Microcystis flos aquae) und auch Resten von höheren Pflanzen gebildet wird, die von den Wassertieren zum Teil zernagt worden sind. Außerdem finden sich in diesem Schlamm Samen von Wasserpflanzen, Reste niederer und höherer Wassertiere und die Exkremente der lebenden. Durch Regengüsse gelangen außerdem häufig tonige und sandige Partikel hinein. Unter Luftabschluß erleidet er einen Fäulnisprozeß, bei dem sich Sumpfgas bildet. Diese von Potonié als Faulschlamm oder Sapropel bezeichnete Masse bildet u. a. auch den Nährboden für das Röhricht und die anderen im Wasser lebenden Pflanzen, die im Seeboden wurzeln.

Westufer des Grunwaldsees bei hohem ...

... und niedrigem Wasserstande
Wenn nun ein solcher See sich selbst überlassen wird, so schiebt sich die Pflanzenzone vom Rande aus immer weiter nach der Mitte vor, die abgestorbenen Pflanzenreste gehen in Torf über und bewirken durch die Bildung eines Sumpfes die immer mehr zunehmende Verlandung der Wasserfläche. Aber den weichen Torfgrund schieben sich Seggenwiesen vom Ufer aus gegen das offene Wasser vor und bilden zum Teil schwimmende Rasen. In diesem Zustande bezeichnet man die Fläche als ein Sumpfmoor, das alsbald den geeigneten Standort für die Erle ( Alnus glutinosa) bildet. Ein Beispiel dafür ist die Verlandungszone am Südende des Hundekehlensees, die durch einen Kranz von Erlen und Weiden umsäumt wird. Auch der Grunewaldsee zeigt am Nord- wie am Südende deutliche Verlandungen durch dichten Rohr- und Schilfbestand an; sowohl die schwimmende Flora des Wassers ( Nymphaea alba), als auch die hochstaudige der Ufer sind bei Paulsborn gut zu beobachten. Beide Pflanzengemeinschaften sind auch vortrefflich entwickelt in der Nordbucht der Krummen Lanke. Auf dem Wasser sind die runden Blätter des Froschbiß ( Hydrocharis morsus ranae) in ganzen Kränzen sichtbar, während der Uferrand vom üppig gedeihenden Röhricht umgeben ist. Das Flachmoor des Riemeistertales, dessen Einmündung in die Krumme Lanke durch die Erlenreihe rechts angedeutet wird, ist durch die Kultur des Menschen zum Teil in eine Moorwiese umgewandelt.

Kiefernwalddurchbruch auf dem Zwischenmoor, südlich von Paulsborn
Ein typisches Flachmoor haben wir in dem Erlenbruch nördlich der Sandgrube beim Riemeistersee vor uns. Die Erlen haben in diesem Stadium die Sumpfgewächse mehr und mehr verdrängt; nach Paulsborn zu sind sie schon reichlich mit Moorbirken untermischt. Ein besonders charakteristisches Erlenbruch, das das östliche und westliche Lichterfelde voneinander schied, ist durch den Bau des Teltowkanals zerstört worden. Hier fanden sich nach Potonis an Hölzern die Erle, das Pulverholz ( Rhamnus frangula), die Kornelkirsche ( Cornus sanguinea) und von den Weiden Salix aurita und alba, Dazwischen wucherte in ungeheurer Üppigkeit Hopfen ( Humulus lupulus), während die Brennessel ( Urtica diocea) ein undurchdringliches Dickicht bildete.
Höht sich das Erlenbruch durch Torfbildung mehr und mehr auf, so wird dadurch sein Boden dem Grundwasserspiegel entzogen, und es finden auch andere Waldbäume, außer den Moorbirken ( Betula pubescens) namentlich Kiefern (Pinus silvestris) auf ihm ihr Fortkommen. Ein solches Moor bezeichnet man jetzt als Zwischenmoor. Auch hierfür bietet die Senke der Grunewaldseen gute Beispiele dar. So schließt sich an das zuerst erwähnte südliche Erlenbruch nach Nordwesten ein mit Birken untermischter Kiefernbruchwald an (vgl. die Tafel bei S. 136 oben). In der Mitte dieses Kiefernbruches ist noch viel Rohr vorhanden, aber in den etwas höheren Randgebieten finden auch schon die Torfmoose günstige Existenzbedingungen. Auf ihnen haben sich bereits charakteristische Heidemoorpflanzen, Ledum palustre, Vaccinium oxycoccus, vereinzelt Andromeda polifolia, angesiedelt, und an einer Stelle sind schon die ersten Anfänge eines Hochmoores zu erkennen.

Hochmoor, nördlich vom Grunewaldsee
Einen dritten Typus der Moore stellen die Hochmoore dar, die hauptsächlich in den regenreicheren Gebieten des nordwestlichen Deutschlands sowie in den Küstengebieten von Pommern und Ostpreußen vorhanden sind. Da sie sich über den Grundwasserspiegel erheben und ihr Wachstum im wesentlichen durch nährstoffarmes Regenwasser bedingt ist, so hat man diese Moore im Gegensatz zu den im Hartwasser sich bildenden Flachmooren auch als Weichwasser- oder Überwassermoore bezeichnet. Die Pflanzen, welche hauptsächlich zur Bildung der Hochmoore beitragen, sind die Torfmoose oder Sphagnen. Sie bilden dichte, schwammige Polster und können infolge ihres maschigen Baues große Mengen von Wasser aufsaugen und festhalten. Sehr häufig vollzieht sich der Vorgang der Torfbildung in einem offenen stagnierenden Gewässer in der Weise, daß aus dem Sumpfmoor ein Erlenmoor sich bildet und dieses bei weiterer Aufhöhung dann in ein Zwischenmoor, d. h. einen Bruchwald mit Moorbirke, Kiefer und Fichte übergeht. Erhöht sich ein solcher Bruchwaldtorf mehr und mehr, so kann das für die Ernährung der Bäume erforderliche, fruchtbare Grundwasser den Bäumen nicht mehr genügend zugeleitet werden. Sie beginnen zu kränkeln, abzusterben und spärlichen Nachwuchs zu erzeugen. In den Lichtungen aber siedeln sich die in ihren Ernährungsbedingungen weit anspruchsloseren Moose, wie das Haarmoos ( Polytrichum) an. Hat das Gebiet viel Regenzufuhr, so erscheinen sehr bald die noch anspruchsloseren Torfmoose ( Sphagnum), die schließlich alles überwuchern, und da sie ein unbegrenztes Spitzenwachstum haben, zur schnellen Aufhöhung des Moores beitragen. Dabei sterben die unteren Partien ab und bilden einen lockeren schwammigen Moostorf, der in 100 Teilen Trockensubstanz 97-98 % verbrennbare Stoffe und nur 2-3 % Asche enthält.
In unserer Seenrinne findet sich nördlich vom Grunewaldsee ein kleines, im wesentlichen aus Torfmoosen gebildetes Hochmoor, auf das auch Potonié hingewiesen hat. Es ist aus dem Zwischenmoore hervorgegangen, das südlich von Hundekehle seinen Anfang nimmt und dort als Kiefern-Birkenbruch ausgebildet ist. Dieses Hochmoor mit seinem schwammigen, besonders im Frühjahr außerordentlich nassen und unzugänglichen Boden ist durch mehrere charakteristische Pflanzen ausgezeichnet, wie z. B. den in der Berliner Gegend immer mehr verschwindenden Porst ( Ledum palustre), der sich auf den hohen Moosbulten angesiedelt hat, ferner die Rosmarinheide ( Andromeda polifolia) und die Moosbeere ( Vaccinium oxycoccus). Von Stauden erwähne ich nur den Sonnentau ( Drosera rotundifolia und anglica), Scheuchzeria palustris und das Wollgras ( Eriophorum vaginatum). Ebenso finden sich hier die für Hochmoore ganz charakteristischen Krüppelkiefern. Die Kiefer zeigt nämlich auf diesem nährstoffarmen nassen Boden eine völlig andere Entwicklung. Während sie sonst auf Sandboden eine lange Pfahlwurzel ausbildet, verkümmert diese bei den Moorkiefern, und statt dessen bilden sich lange, flach unter der Oberfläche sich erstreckende Seitenwurzeln aus, die im Verhältnis zum ganzen Baum oft eine sehr bedeutende Stärke und Ausdehnung erlangen. Sie dienen namentlich auch zur festen Verankerung des Baumes in dem lockeren Boden. Wegen der geringen Nahrungszufuhr ist das Wachstum überaus langsam, so daß der Baum trotz hohen Alters über ein Zwergstadium nicht hinauskommt. Die Torfmoose und Polytrichen, die um den Stamm herum einen Bult bilden, schließen seinen unteren Teil von der Luft ab und bringen den Baum dadurch zum Absterben. Die Krüppelkiefern sind aus dem kleinen Hochmoor nördlich vom Grunewaldsee in charakteristischer Weise ausgebildet. (Vgl. die Tafel S. 136.)
Der Grunewald bietet alljährlich vielen Tausenden der Berliner Bevölkerung Erholung, Belehrung und erquickenden Naturgenuß. Während die mannigfach gegliederten Höhen des westlichen Grunewaldes von den weiten Wasserflächen der Havelseen begrenzt werden, verdankt der bei weitem eintönigere östliche Teil seinen eigentlichen Reiz der idyllischen Schönheit der Seenkette. In einer Zeit, in der die rastlos fortschreitende Ausdehnung Berlins und seiner Vororte eine völlige Umgestaltung der ursprünglichen Oberfläche in weitem Umkreise bewirkt hat, müssen wir uns um so glücklicher schätzen, daß wir nahe vor unseren Toren im Grunewald noch ein Stück sich selbst überlassener Natur besitzen. Hier können wir die in ihrer schlichten Schönheit so überaus reizvollen märkischen Seen zu jeder Jahreszeit in ihrem wechselnden Schmucke und ihren mannigfaltigen Stimmungen genießen, und es wäre in der Tat für die Großstadt und besonders für ihre heranwachsende Jugend ein unersetzlicher Verlust, wenn ihr die Gelegenheit geraubt werden sollte, die Liebe zur märkischen Heimat und das Verständnis für ihre eigenartige Natur an diesem bevorzugten Fleckchen Erde immer von neuem zu wecken und zu vertiefen.
F. Wahnschaffe, Der Grunewald bei Berlin. Seine Geologie, Flora und Fauna. (Jena, Gustav Fischer.)
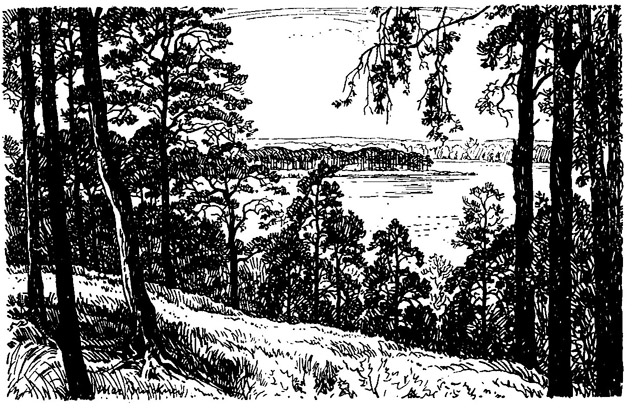
Blick von den Pichelsbergen auf Schildhorn und Havel.
Von Friedrich Wilhelm August Schmidt (Schmidt von Werneuchen).
Lebendig schwebt vor meiner Phantasie
der Festtag noch, der uns vom Lager körnte,
der uns, betaut von Morgennebel, früh,
auf jene Höh'n voll Geistergrau'n entfernte.
Was fand ich, o! für dich, Melancholie,
dort für ein Übermaß der reichsten Ernte!
Dort war's, wo Wodan einst in greiser Zeit
in der Alrune Ohr die Zukunft hauchte,
wo einst der Priester Teuts im Feierkleid
des Messers Kling' ins Blut des Widders tauchte,
wo sühnend einst, dem Heidengott geweiht,
Das Opfertier auf hellem Holzstoß rauchte.
Dort war's, wo sonst im sichern Diebesloch,
trotz Schwert und Strang und allen Frevelrächern,
der Tullian der Vorzeit sich verkroch
und Schnippchen schlug bei vollen Moslerbechern.
Dort blutete der Pilgrim: sahst du noch
die Schädelrest' in jenen Iltislöchern?
Ha! welch Gewühl dort von Insektenbrut!
– Dem Forscher der Natur die schönste Schule –
von Wels und Stint in waldumwachsner Flut!
Von Schlang' und Kröt' im grüngegornen Pfuhle!
Wie gräßlich lockt' im Busch, voll süßer Wut,
die Hindin sich der breitgehörnte Buhle!
Ein Myriadenheer Waldvögel nährt
dort von Wacholderbeeren sich und Wiepen;
dort wanken Vogler nur, auf deren Herd
verführerisch die blauen Meisen piepen,
und seltner arme Weiber noch, beschwert
mit abgestürmtem Raffholz in den Kiepen.
Wenn irgendwo ein scheuer Berggeist haust,
so muß er dort in finstrer Wüste lauern:
Was ist's, das sonst das Wipfellaub durchsaust?
Vernehmlich ächzt aus jener Klüfte Schauern?
Was packt' uns sonst mit unsichtbarer Faust
in jenes Götzentempels öden Mauern?
Geht dort einmal ein müder Wandrer irr,
so muß er tagelang von Vogelkirschen
sich sättigen, umflattert vom Geschwirr
des Federwilds, begafft von Reh'n und Hirschen,
noch glücklich, wenn aus dickem Dorngewirr
der Bache Hau'r ihm nicht entgegenknirschen.
Er rettet selbst aus dieser Wüste Greu'l
zum Pfad sich nie hinaus, und überschrie er
auch gleich der wilden Katze Nachtgeheul,
bis ihn der Jäger leitet, oder früher
vielleicht im Tal des Klafterschlägers Beil
sein Kompaß wird und fernes Roßgewieher.
Zwar von des Urnenbergs verrufner Kluft,
die wilder Apfelbaum und Schleh'n umdunkeln,
und deren Zugang Regen abgestuft,
hört man im Dorf viel Wundersames munkeln:
Dorthin gebannt durch Hexenzauber, ruft
ein Ries' heraus, sobald die Sterne funkeln.
Doch hätt' ich, trotz dem Grimm des Tückenbolds,
der dort, wie im Asyl, keck und vermessen
den Waller neckt, so gern auf Wurzelholz,
voll gelbem Sand, bis in die Nacht gesessen;
ja, hätt' auf dich, Gefühl der Schwermut, stolz,
ein Weilchen selbst mein Hüttendach vergessen.
Almanach romantisch-ländlicher Gemählde für 1798. Berlin.
Mitten auf dem breiten, im Frühsonnenglanz blau und silbern flackernden Havelbecken ruht wie ein riesiges Nymphäenblatt das dunkelgrüne Eiland, selbst wie ein Kind der Tropen, und doch aus märkischem Sande geboren und doch in seiner fröhlichen Besonderheit nur in der sandigen Mark möglich.
Die Pfaueninsel erfreut sich ihrer heutigen Gestalt noch nicht allzu lange. Bis 1863 etwa war sie sogar nur wüste, baumbestandene Wildnis, von hohem Uferschilf umzogen, von riesigen Eichen überwölbt, pfadlos, düster, unbekannt und unbenannt. Johannes Kunkel, des Großen Kurfürsten Hofalchimist, fand Gefallen an der geheimnisvollen Stätte, wo er seinen Studien und Experimenten ungestört obliegen zu können hoffte, und sein Herr schenkte sie ihm 1685 erb- und eigentümlich, nachdem ein 1683 dort eingerichtetes Kaninchengehege aufgegeben worden war. Nun begann ein hexenmeisterliches Treiben auf dem buschigen Werder. Laboratorien wurden erbaut, Schmelzöfen und kunstvolle Goldscheiden; hohe Flammen blitzten durchs Gezweig, und metallisch bunte Dämpfe stiegen in die Baumwipfel empor. Jahrelang hauste hier der Zauberer mit seinen Mannen, unbekümmert um die Welt draußen, fest in der Gunst seines Herrn, und beträchtliche Summen wurden verexperimentiert. Johannes Kunkel, dem wir die Erfindung des Phosphors und des Rubinglases verdanken, war ein tüchtiger Gelehrter, zweifelsohne; Kurfürst Friedrich Wilhelm und seine schöngeistige Gemahlin, die Schülerin Leibnizens, waren aufgeklärte und begeisterte Förderer der Wissenschaft, ihrer Zeit weit voraus, aber die Versuche auf dem »Kaninchenwerder« lohnten ihre fürstliche Freigebigkeit nicht. Soviel Gold auch durch Schornsteine und Retorten gejagt wurde, erzeugen ließ sich keins. Ebensowenig gelangen andere Entdeckungen. Dem Monarchen kam es zwar auch auf greifbare Erfolge nicht an; er hatte seine Freude an artigen, halb wissenschaftlichen Spielereien und äußerte gelegentlich, daß er mit Fug auf die alchimistische Kunst soviel Geld anwenden könnte, wie er früher nutzlos am Kartentisch und in Feuerwerken verpufft hätte. Kunkel bezog von ihm das für die damalige Zeit immerhin hohe Gehalt von 500 Talern, war Eigentümer und Pächter mehrerer Glashütten und fühlte sich recht behaglich in Brandenburg. Als aber der gütige Herr gestorben war und Neider und Ohrenbläser den Gelehrten beim ersten König Preußens anzuschwärzen wußten, wurde dem Alchimisten der Prozeß wegen Unterschleifs gemacht. Er erstritt zwar ein obsiegendes Urteil, doch sein Stern hierzulande erlosch. »Kann Kunkel Gold machen, dann brauchen wir ihm keins zu geben, und kann er's nicht machen, wozu sollte man ihm dann welches geben?« hieß es wie ehemals in Kursachsen nun auch bei uns. 1692 begab sich Kunkel nach Stockholm, wo man sein hohes Können besser zu würdigen wußte – als königlich schwedischer Bergrat Kunkel von Löwenstern starb er im Anfang des 18. Jahrhunderts.
Und wieder wuchsen die Eichen auf dem Kaninchenwerder zusammen, dichter zog sich Gestrüpp und Schilf um ihn herum, mächtiger wurden die Schwärme wilden Geflügels. Kunkels Laboratorium sank bei einer Feuersbrunst in Trümmer, und aus den Schlacken gebrannter Erze, aus den Bauten des Adepten sproß Unkraut und Gerank hervor. Verrufen war die Stätte, und selten betrat sie ein scheuer Wildererfuß. Mit Friedrich Wilhelm II. aber brach die goldene Zeit der Pfaueninsel an. Der König soll sie auf einer Jagdstreife »entdeckt« haben, und da er zuweilen ein schwärmerischer Freund romantischer Einsamkeit war, ließ er sich oft zu dem düsteren Eichenhain hinüberrudern. Nachher, als ihm die Einsamkeit wieder langweilig wurde, feierte man auf den Wiesen der Insel idyllische Hoflustbarkeiten. Mit Spiel und Tanz und Musik vergnügte sich der König im Freundeskreise bis Sonnenuntergang, wo die fröhliche Schar ins Marmorpalais zurückkehrte. Die große Zeit der Pfaueninsel brach an. Es wurden Wege kreuz und quer in das Dickicht geschlagen, die Axt ging dem Gestrüpp zu Leibe, ein Park mit Blumenbeeten, Laubengängen und artigen Baulichkeiten entstand, wo sich bisher knorriger Urwald gereckt hatte. Frau Reichsgräfin Lichtenau ließ sich hier nach eigenen Skizzen vom Meister Brendel ein Landhaus bauen. Ihr Herr Gemahl, der Geheime Kämmerier Rietz, hatte auf »speziellen königlichen Befehl« die Oberleitung des Neuen Gartens in Händen.
Für jene lustigen und jedenfalls vergnüglichen Tage, wo Reifröcke und niedliche Schäferinnen höher bewertet wurden als ernste Ministerfräcke und Professorenperücken, war die Pfaueninsel wie geschaffen. Ihr ein bißchen exotischer, fremder Charakter entsprach so recht dem Unpreußischen der Zeit.
Aber sie verstand es, sich auf der Höhe zu halten, auch als dunkle Tage, tiefernste Ereignisse das Andenken jener Freuden verwischt hatten, als ein strengeres Geschlecht die sündhaften Väter verachtete und Friedrich Wilhelm III. mit keinem Wort an seinen Vorgänger gemahnt werden durfte. Nur der Pfaueninsel blieb er treu; sie wurde nicht wie Sanssouci und das Marmorpalais verächtlich gemieden. Besonders nach Königin Luisens Tod, als Paretz immer wieder trübe Erinnerungen weckte, schenkte der Monarch dem schönen Eiland seine ganze Gunst, ließ Rosengärten auf ihm anpflanzen, den Baumbestand vermehren und verschönern, ein Wasserwerk anlegen, mit dessen Hilfe Lenné nun erst die noch sandigen, wüsten Strecken der Insel in blühende Gärten umschuf. Wilde Tiere seltsamer Art, die jeden guten Berliner erschreckten und verblüfften, wurden hergebracht und eine Menagerie eingerichtet, die später den Grundstock für unseren zoologischen Garten hergab. 1830 entstand ein Palmenhaus, ein wahres Kleinod, in dem die Hauptstädter Tausend und eine Nacht verkörpert sahen; leider ging es 50 Jahre später in Flammen auf. –
Eine Fähre bringt uns ans jenseitige Ufer zur freundlichen Wohnung des Kastellans, von wo aus wir uns über Terrassen fort nach rechts wenden. Die Luft scheint hier weicher und schlaffer als sonstwo; der Fluß und die eng aneinander gerückten Baumriesen wehren alle zudringlichen Winde ab oder mildern ihre Rauheit. Schier sagenhafte Eichenstämme, deren Wipfel sich kuppelartig senken, Rosenhaine und vom Laubwerk überrankte Wege, grüne, viereckige Tunnels, wo an hölzernem Gerüst Schlinggewächs sich breitblättrig dehnt, wechseln mit phantasievollen Bauten, schwellenden Rasenteppichen, und wenn bei jeder Biegung des Weges die blaue Havel hereinfunkelt, wenn ins leise flutende Blättermeer das Sonnenlicht rieselt und die tausendjährigen Eichen den Sommer mitfeiern, so gut es ihnen möglich ist, mit schwachem, hellem Grün, unter dem das weiße Holzskelett breit durchschimmert – dann überkommt einen die rechte Stimmung für das Naturwunder, dem dies Eiland seit Friedrich Wilhelm II. seinen Namen verdankt: für seine prächtigen Pfauen. Ein kurzer, häßlicher Schrei macht uns aufsehen; da sitzt auf kahlem Ast das königliche Tier, in wilden Farben prunkend – o, dies saphirene Blau des Halses! – und nachlässig mit dem mächtigen, dicht befiederten Schweif, seiner kostbaren Schleppe, wippend.
Papageien schreien freilich heute nicht mehr auf der Pfaueninsel, die Palmen sind verbrannt. Nicht mehr wie in früheren Jahrzehnten ist das Eiland der Wallfahrtsort für die Berliner, die hier ihre freien Nachmittage verbrachten und Augen und Ohren aufsperrten ob der Wunderdinge ringsum. Keine Springbrunnen plätschern mehr, keine Kapelle musiziert, keine Lichtenau lächelt mehr ihr süßes, freches Hexenlächeln.
Man suchte auch vergebens an schönen Tagen nach dem Gewimmel kaffeetrinkender Fürstlichkeiten, die es sich bei der ehedem viel genannten Frau Maschinenmeister Friedrich gemütlich machen. Aber der Glanz verschollener Zeiten und der Schimmer eigener Schönheit schmücken die Insel noch heute, und geblieben ist die Erinnerung an Zauberer und Könige, die hier wirkten und hier sich freuten, hier eine Zuflucht suchten in Stürmen. Die Pfaueninsel, das Kronjuwel der gesegneten Landschaft um Potsdam, zeigt, wessen märkische Erde fähig ist, wenn liebevolle Hände sich ihrer annehmen.
Tritt in andächtigem Schweigen näher, Fremdling, und entblöße dein Haupt, denn hier ist geheiligtes Land!
Neben dem Schienenweg her läuft vom Bahnhof Wannsee ein schwarzer Fahrweg. Gleich hinter umfangreichen Gewächshäusern zweigt sich von ihm ein schmaler Steig ab, geht über Sandhügel fort und bringt uns durch Kieferndickicht zum Grabe des Poeten, der die Kraft in sich hatte, der größte Dramatiker des Jahrhunderts zu werden, ja den genialen Briten zu überholen, und der hier, von Krankheit und Enttäuschung zu Tode gehetzt, seinem verwüsteten Leben ein Ziel setzte, am 21. November 1811. Die märkische Erde birgt hier ihr teuerstes Kleinod. Heinrich von Kleist, der mit Schiller um den Lorbeer rang, der uns die wildgeniale Penthesilea schenkte, die Hermannsschlacht, den Prinzen von Homburg und das blauäugige Käthchen, der mit souveränem Humor den spitzbübischen Dorfrichter Adam schuf, dies einzige Lustspiel, diese göttliche Komödie vom zerbrochenen Krug – Heinrich von Kleist, der sein Vaterland und seine märkische Heimat liebte wie keiner. Ein junger Eichbaum beschattet sein Grab, das bis vor kurzem zwar verwahrlost und ohne Schmuck der Liebe, so doch in ergreifender Einsamkeit lag. Modriges und verfaulendes Laub deckte die Gruft, Unkraut umwucherte sie, die Inschrift des Gedenksteins war fast verwischt, und Bubenhände hatten ihn beschmutzt. Ringsumher lagen Frühstücksreste, widriger Unrat. Unten aber, am Fuße des Hügels, plätscherten und flüsterten die Wellen des glitzernden Wannsees, als wollten wenigstens sie dem toten Dichterfürsten Gruß und Dank zurufen. Und rund herum hob der märkische Kiefernwald seine dunklen Fahnen, und rund herum lag das tiefe Schweigen der alten Mark. Heute hat man die Dichtergruft ein bißchen aufgeputzt, aber die Sportshäuser in der Nähe haben das feierliche Schweigen verscheucht. Im neuzeitlichen Lärm läßt sich die Stimme des Genius und die Klage des Waldes um seinen Liebling nur selten noch belauschen.
Kleists Denkstein schmücken die Worte:
»Er lebte, sang und litt
in trüber, schwerer Zeit.
Er suchte hier den Tod
und fand Unsterblichkeit!«
Mögest du, der, die märkische Heide durchstreifend, hier entlang kommt, wenn du in der Kunst mehr siehst als einen Nervenreiz und im Künstler mehr als den grimassierenden Clown, mögest du nicht vergessen, den Pfad zum Grabe Kleists zu erfragen und ein paar Minuten einsam dort oben zu verweilen! Und so gewiß ewig die Flut den Fuß dieses Hügels rauschend bespült, so gewiß die Mittagssonne ewig diese Stätte mit flackerndem Licht umsäumt, des Winters Schnee immer wieder sie schmückt, so gewiß wirst du von dieser Stelle die Liebe mit dir nehmen und die Verehrung für den unglücklichen Kämpen und den redlichen Haß wider Stumpfheit und Gleichgültigkeit, die ihn in den Tod getrieben haben ...
Jagdschloß Dreilinden und sein Runenstein bleiben zurück; durch schweigende Kiefernheide, über Sandstrecken und Kartoffelfelder fort wandern wir fast pfadlos nach Süden auf Gütergotz zu.
Gütergotz, dies halb wendische, halb deutsche Wort, erzählt uns, daß auf seinen Hufen sich einstens ein heiliger Hain erhob, drin die Wendenstämme an geweihtem Altar ihrem jungen, sonnigen Morgengotte, dem Juthrie, Opfergaben darbrachten. Hart am See, wo jetzt das Dorf aufhört, befand sich die heilige Stätte. Nach der Zerschmetterung des Wendenglaubens gründeten hier im 12. oder 13. Jahrhundert die Zisterzienser von Lehnin ein Zweigkloster; erbauten sie doch dem Nazarener mit Vorliebe da Tempel, wo bisher heidnische Götzen angebetet worden waren. Ihnen verdankt Gütergotz auch seine schmucke Kirche. Bis zur Säkularisierung unter dem zweiten Joachim gehörte das Dorf zu dem reichen Besitztum Lehnins; dann ging es in die Hände einer wohlhabenden Bürgermeisterfamilie über, die es 150 Jahre lang hielt. Von 1700 an hat dann das Gut seinen Herrn oft gewechselt; es gehörte u. a. dem Bischof Ursinus, dem General-Lotterie-Direktor Geh. Finanzrat Grothe, der als Tapetenunterlage für sein neues Schloß Lotterielose verwandte; 1868 erwarb Kriegsminister Roon Gütergotz, später wurde ein vielgenannter Bankier Herr des ursprünglich zu einer Roonschen Familienstiftung bestimmten Besitztums. Nur noch die breiten Gittertore am Parkeingang, mit den Roonschen Buchstaben und der Grafenkrone darüber, erinnern an vergangene glanzvolle Tage.
Das Gestade des Haussees verläßt uns dann, und rüstig ausschreitend, von vergilbtem Farnkraut und dunklen Wacholderpyramiden im Kiefernwald begrüßt, kommen wir zu guter Stunde nach Jagdschloß Stern, von seinem Erbauer Friedrich Wilhelm I. so genannt, weil hier alle Gestellwege sternförmig zusammenlaufen. Der urgermanische Preußenkönig verweilte gern in dem plumpen roten Gemäuer, von dem er oft um die Morgendämmerstunde zur fröhlichen Hatz aufbrach. Ein schmaler Korridor zeigt uns die drei Räume des Erdgeschosses: Speisehalle, Küche und Schlafzimmer, denen man besonders verschwenderische Ausstattung wahrhaftig nicht nachsagen kann. Der mit Paneelen geschmückte Speise- oder Jagdsaal enthält die vom »großen Hans«, dem riesigen Achtundzwanzigender, Jahr für Jahr abgeworfenen Geweihstücke, oberhalb der Paneelierung hängen entsetzliche, zum Glück schon dunkle Jagdbilder, die von dem Zustand preußischer Kunst unter der strammen Fuchtel des Soldatenkönigs ein beschämendes Zeugnis ablegen. Die Wände der Küche sind ganz mit weißen Kacheln bekleidet. Rauchfang und Herd sprechen in ihrer mächtigen Ausdehnung von dem gesegneten Appetit des als starker Esser bekannten Königs und seiner Jagdgefolgschaft. Im Schlafzimmer steht noch die Betthöhle Sr. Majestät, ein finsterer, schauerlicher Kasten mit einem Loch zum Hinein- und Herauskriechen an der Vorderseite.
Nun auf geraden Gestellwegen zum nahen Ziele der Wanderung. Nebel wallen aus den Seen auf. Im verdämmernden Licht des Tages wird das Andenken jener Tage lebendig, wo Michael Kohlhaas mit seinen Spießgesellen dem kurfürstlichen Faktor Konrad Drahtzieher auflauerte, als er aus dem Mansfeldschen schwere Silberbarren zur Münze nach Berlin brachte. Der Schatz ward ihm von den Räubern entrissen und dann unter der Brücke versteckt; Kohlhaas sah in ihm wohl nur ein Pfand für die Wiedererlangung seines Eigentums. Joachim II. aber war ein gestrenger Herr, der des Roßtäuschers Ausschreitungen und Fehdezüge schon lange mit steigendem Unwillen gesehen hatte, und da man dem kühnen Bandenführer in seinen Wäldern nicht beikommen konnte, lockte man ihn mit gleißnerischen Versprechungen nach Berlin, wo er am 22. März 1540 unter ungeheurem Zulauf der Bevölkerung aufs Rad geflochten wurde. Vierzig seiner Mannen folgten ihm bald auf das Schafott, und die Rache, die Kohlhaas am Junker Tronke genommen, hatte sich nun gegen ihn selbst gekehrt.
In Kohlhasenbrück glaubte man lange die versteckten Silberkuchen aufstöbern zu können, und in der Walpurgisnacht lugte das Volk fleißig nach blauen Flämmchen aus, die den aufsteigenden Schatz verraten sollten. Aber der Spaten stieß nur auf Aschenurnen, Erzwaffen, Steinhämmer, Menschengebeine und Opfergeräte, die bewiesen, daß sich an dieser geheimnisvollen Stätte dermaleinst ein heiliger Altar erhoben hatte. Die alte Rieseneiche, deren Zweige vor Jahrzehnten noch an die Fenster des Kruges klopften, und deren Wipfel sein Dach beschattete, ist längst gefällt und verrät nichts mehr von den düsteren Geheimnissen der Vorzeit.
Die Bäke von Steglitz bis zur Havel, obgleich von der Natur reich mit landschaftlichen Schönheiten bedacht, war stets ein Schmerzenskind des Kreises Teltow. Jahrhundertelange Vernachlässigung hatte aus dem einst so munteren Bach mit seinen tiefen blauen Seen ein träges, fauliges Gewässer gemacht. Sumpf und Moor breiteten sich mehr und mehr aus; was ihrem Bereich verfiel, war dem Untergang geweiht. Mit Schlamm füllten sich die schönen, vordem klaren Seen. Ihre Becken verkleinerten sich allmählich, mehr und mehr wuchsen sie vom Ufer her zu, zunächst durch Schilf, später durch Sumpfpflanzen. Der Sumpf eroberte sich in immer weiteren Umfang das Flußtal. Mangelnde Vorflut brachte unberechenbaren Schaden und Nachteil, der um so größer wurde, je mehr die im Entwässerungsgebiet der Bäke gelegenen Ortschaften anwuchsen. Nuthe und Notte, diese beiden, außer der Bäke, wichtigsten Vorfluter des Kreises, waren längst reguliert; fast schien es schon, als ob der Meister nicht erstehen sollte, dem es gelänge, den Wässern der Bäke Lauf und Bahn zu weisen. Herrn von Stubenrauch, dem unvergeßlichen Landrat und »Vizekönig« des Kreises Teltow, blieb es vorbehalten, hier zu helfen. Während alle früheren Versuche zur Regulierung des Bäketals von dem Grundsatz ausgingen, daß die unmittelbar berührten Anlieger oder Gemeinden gemeinschaftlich diese Aufgabe zu lösen hätten oder daß der Staat im Wege der Gesetzgebung die Beteiligten zu einem gemeinsamen Werke vereinigte, wußte Stubenrauch dem Gedanken Geltung zu verschaffen, daß nur auf baldige und gründliche Hilfe zu rechnen sei, wenn der Kreis, gleichsam als Geschäftsführer der Gemeinden, sich dazu entschließen würde, die Aufgabe des Teltowkanals allein und ohne fremde Hilfe zu lösen.
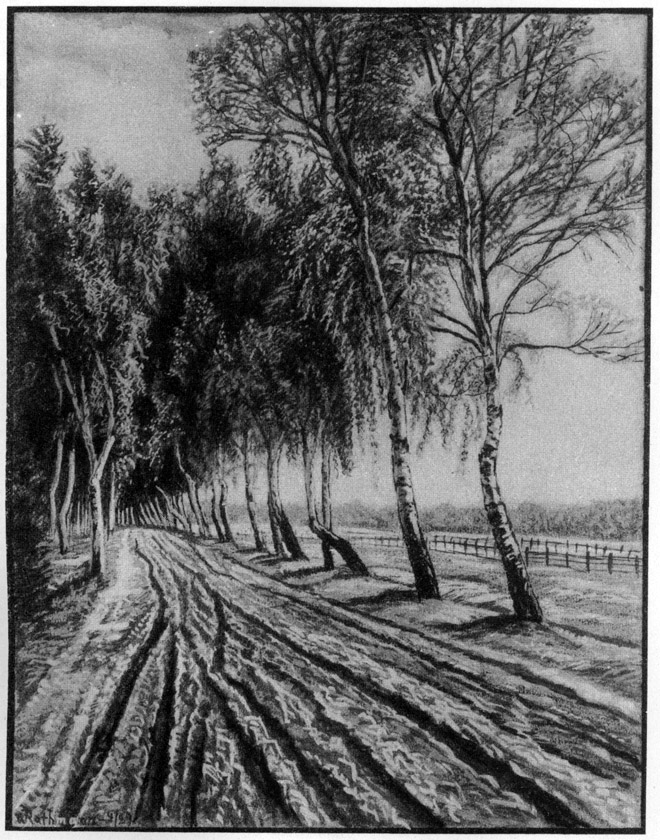
Birkenweg bei Rangsdorf nach einer Schwarz-Weiß-Malerei von Werner Rathmann
War bis dahin nur die Kanalisierung der Bäke das Ziel aller Wünsche und Hoffnungen, so hatte, auf Grund der vom Kreise veranstalteten Vorarbeiten, der Gedanke mehr und mehr Aufnahme gefunden, daß es zweckmäßiger und wirtschaftlicher wäre, statt des kostspieligen Bäkekanals, der dann wegen unzureichender Zuflüsse ohnehin einen Speise- und Spülkanal von der Oberspree her erhalten mußte, einen schiffbaren Kanal von der Spree bis zur Havel zu bauen. Es wurde anerkannt, daß neben der Lösung der Entwässerungsfrage auch das Bedürfnis des allgemeinen Verkehrs zu berücksichtigen sei. Es galt, einen Schiffahrtsweg herzustellen, der imstande war, den übermäßig in Anspruch genommenen, durch Berlin führenden Weg zu entlasten, insbesondere den großen Durchgangsverkehr zwischen Elbe und Oder zu vermitteln, ein Verkehr, der unter dem weiten Umweg durch Berlin mit seinen zahlreichen Schiffahrtshindernissen wenig litt.
So ging man denn, aller Schwierigkeiten ungeachtet, flott ans Werk. Landrat Stubenrauch verstand es, die Freude an der Arbeit stets aufrechtzuerhalten, auch in scheinbar verzweifelter Lage. Der alte Sumpfboden wehrte sich nämlich ingrimmig gegen den Kanal. Besonders das tiefgründige, von Moor und Schlamm durchsetzte Gelände des alten Bäkelaufes verlangte äußerste Vorsicht beim Schütten der Dämme und der Herstellung der Ufer. Bis zu Tiefen von 20 m mußten hier die seitlichen Leinpfade zwecks Erreichung des festen Untergrundes durchgedrückt werden; nur so war es möglich, einen festen Uferschutz zu erzielen und den Kanal vor künftigen Nachpressungen aus dem Nachbargelände dauernd zu schützen.
Indessen, den Widerwärtigkeiten und Hindernissen gelang es nicht, die Arbeit über Gebühr aufzuhalten. Am 17. Dezember 1905 wurde die letzte Sandbank bei Groß-Lichterfelde durchbrochen und am 2. Juni 1906 der Teltowkanal feierlich eröffnet.
Die gesamte Kanallänge beträgt von der Glienicker Lake bis zur Einmündung in die wendische Dahme unterhalb Grünau rund 37 km, die Länge der Verbindungslinie Britz-Kanne rund 3,5 km.
Die einzige Schleuse des Kanals, die den Höhenunterschied zwischen der Spree (gleich dem oberhalb der Dammühlen gestauten Wasserspiegel der Oberspree) und der unteren Havel vermittelt, befindet sich bei Klein-Machnow. Ein vorzügliches Werk moderner Technik. Nichts, nicht einmal die Ruderbootsschleppe fehlt.
Die Schleusenanlage besteht aus zwei nebeneinander liegenden, durch eine 12 m breite Plattform getrennten Kammern, die derart miteinander in Verbindung stehen, daß sie sich gegenseitig als Sparbecken dienen.
Bei regelmäßigem Betrieb wird stets die Hälfte des Wassers gespart, die anderenfalls verloren ginge.
Da der Kanal selbst eine Sohlenbreite von 20 m und bei der gewählten muldenförmigen Gestaltung der Sohle in der Mitte eine Tiefe von 2,50 m hat, so ist er zur Aufnahme von Schiffen von 1,75 m Tiefgang und bis zu 600 t Tragfähigkeit geeignet.
Die Ausführung des Kanals verlangte die Herstellung einer großen Anzahl von Brücken, im ganzen 48. Kreuzt doch die Linie nicht weniger als 8 Eisenbahnen, 14 Chausseen, 14 Wege und Landstraßen, 10 städtische Straßen.
Alle Blütenträume und Hoffnungen, die sich an den Teltowkanal knüpften, sind selbstverständlich noch nicht erfüllt worden. Störend fällt einmal ins Gewicht, daß die Schiffahrt immer nur ungern neue Wasserwege aufsucht, und noch störender ist, daß sich die Grundstücksspekulation von Anfang an mit besonderer Gier auf die Ländereien am Kanal gestürzt hat. Dadurch sind die Bodenpreise zu hoch geworden, um beträchtliche Industrie zur Ansiedlung verlocken zu können, und weil die Industrie sich noch fern hält, will der Verkehr auf dem Kanal nicht recht gedeihen.
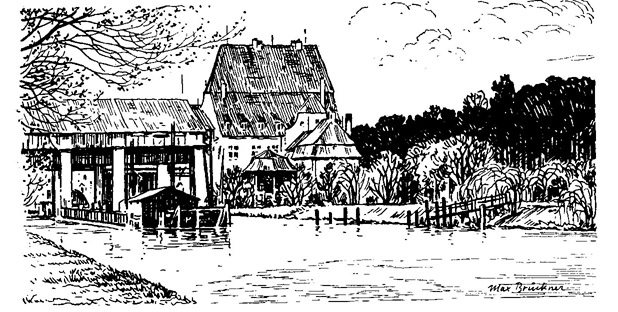
Machnower Schleuse am Teltowkanal.
Von der eigentlichen Leistungsfähigkeit des Kanals ist jedenfalls erst ein sehr kleiner Teil in Anspruch genommen worden. Wie groß diese Leistungsfähigkeit ist, erkennt man schon daran, daß der Außenstehende von dem ziffernmäßig doch schon erheblichen Verkehr kaum etwas merkt. Noch immer liegt für die meisten Zuschauer, die den Kanal von der Brücke aus beobachten, die Wasserfläche anscheinend verkehrslos da. Nur hin und wieder wird die Ruhe durch einen schnell vorüberfahrenden Schleppzug unterbrochen – gleich darauf bemerkt man nichts mehr davon, welch kräftiges Verkehrsleben doch in der dort unten still daliegenden Wasserader pulsiert. Es wird noch eine lange Zeit dauern, bis wirklich der Kanal im vollen Umfange seiner Leistungsfähigkeit befahren wird, und bis auch den Anbeteiligten dieser Verkehr mehr unmittelbar vor die Augen tritt. Aber das muß in Ruhe abgewartet werden. Es ist übrigens auch ganz unmöglich, daß eine solche neue Straße, die sich ihre Quellen erst zu erschließen hat, gleich von vornherein voll ausgenutzt wird. Der Kanal ist erbaut worden für den größten Verkehr, der in den nächsten 20 oder 30 Jahren erwartet werden kann; erst dann wird von einer Vollbelastung die Rede sein können.
Und die Nachfahren werden es dann den unternehmenden und weitausschauenden Vätern danken, daß sie rechtzeitig an eine so stolze und wichtige Kulturarbeit, wie der Bau des Teltowkanals sie darstellt, gegangen sind.
Im November 1516 war's, und über den schneeverwehten Golm raste die Winternacht. Vom ungewissen Licht des grauen Gewölks und der Flockenmilliarden dämmernd erhellt, starrte das weiße, tote Gefild, und wie mächtige Silberbarren blickten die kieferbestandenen Höhen auf die trostlose Heidefläche. Bitterkalt, vernichtend kalt war's dabei, und in das Brüllen des wütenden Sturms mischte sich schaurig das Geheul hungriger Wölfe, die aus dem armen Grunde herdenweis heraufzogen, den benachbarten Dörfern zu. Und nun klang Schellengeläut, Peitschenschlag und Rosseschnauben in den tollen Lärm hinein, zwei rote Lichter flackerten auf und tanzten durch den eisigen, den weißen Wald. Der Dominikanerfrater Tetzel kam mit seinen Getreuen im Schlitten von Frankfurt des Weges daher und wollte nach Wittenberg, den sündigen Seelen daselbst Ablaßbriefe zu verkaufen. Denn, nur mit blankem Gold noch war es zu jener Zeit möglich, Absolution und Gewissensruhe zu erlangen. – Wie aber der Schlitten in einen verschneiten Hohlweg bog und die dampfenden Pferde, von dem Sturm und dem wildrasenden Gestöber erschöpft, trotz Zuruf und Hieb nur langsam weiter trotteten, wetterte plötzlich aus der Schlucht ein Reitersmann daher und warf sich auf die überraschten Mönche, denen er im Hui den wohlgespickten Geldkasten entriß. Der Anfall kam so unerwartet, und die Gegend war so verrufen, daß man an Widerstand nicht dachte und willenlos den Räuber gewähren ließ. »Erinnert euch nur, erst gestern verkauftet ihr mir einen Ablaßbrief für eine Sünde, die ich heute begehen wollte!« schrie der Reitersmann, und mit dröhnendem Gelächter schleuderte er den leeren Kasten von der Höhe in die unten aufgeschichteten Schneeberge hinab. Halbtot vor Schreck entrannen die Mönche nach Wittenberg. Der aber die kecke Tat vollbrachte, die, mit schelmischen Einzelheiten ausgeschmückt, ewig im Volksmunde leben wird, das war Herr Hake von Stülpe, ein lustiger Schalk, der auf Klein-Machnow saß und die Pfaffen haßte trotz Doktor Martin Luther.
In Klein-Machnow stand die Wiege der Hakes, denen früher auch noch Genshagen und Heinersdorf gehörte. Dreihundert Jahre hindurch hatten sie das Erbschenkenamt der Kurmark Brandenburg inne. Es war eine tapfere und schwertgewandte Sippe, die bei keinem Kriege Brandenburgs oder des Reiches fehlte, die ihre Söhne auf den Schlachtfeldern Ungarns gegen die Türken, im Westen und Norden bluten sah, die dem Heere mehrere kommandierende Generäle schenkte. Der Degen saß den Stolzen alleweil locker in der Scheide, und dem Backsteinkirchlein des Dorfes gegenüber sieht man ein Kreuz in die Mauer gelassen zum Andenken daran, daß hier auf offener Straße ein Hake einen Schlabrendorf im Zweikampf erstach.
Eigenartigen Zauber atmet die hübsche Kirche des Dorfes, die zwischen Efeugräbern und Kastanien eingebettet liegt und viele Erinnerungen an die Hakes birgt; Grabsteine, Gedenktafeln, zerrissene Fahnen und vor Alter morsche Banner. An dem Gotteshaus selbst ist nur der Unterbau sehr alt; im übrigen ist es so häufig ausgebessert und erneuert worden, daß selbst die Ziegel nicht immer gleiche Farbe zeigen.
Neben dem Schlosse lärmte früher die Wassermühle, über deren Räderwerk das Teltefließ brausend schäumte. Es lauschte sich lieblich dem Plätschern und Rauschen, wenn der weiße Mehlstaub aufwirbelte und die Mühlenknappen geschäftig hin und her liefen, wenn dunkles Grün den Bach umrahmte und die Amseln flöteten. Seit grauer Vorzeit – schon 993 ward laut Pergament an Stelle der alten zerfallenen Mühle eine neue aufgeführt – drehte sich hier das Wasserrad; ihm verdankten die Hakes Glück und Besitz, und sie haben sich nie ihrer mehlmahlenden Ahnen geschämt. Nun ist die Mühle verschwunden, wie das Glück der Hakes. Eine neue Zeit, neue Menschen streben neuen Zielen nach; ihre Mühlsteine haben »diese Adeliche Frey Mühle« zermahlen, die aus dem Jahre 1695 herübergrüßte, wo sie Ernst Ludwig von Hake »hinwiederumb gantz Neue aus dem grunde erbauet, weilen die alte gantz zerfallen«.
Trotzdem der Teltowkanal es seiner halben Vergessenheit mit derbem Ruck entzogen hat, wirkt Klein-Machnow noch immer wie ein freundliches Idyll der Stille, wie eine baum- und wasserreiche Oase im Sonnenbrand der märkischen Heide. Machenow auf dem Sande ward das Dörfchen früher genannt; vieles hat sich geändert, gebessert. Fleiß und Regsamkeit machten die dürre, geizige Erde fruchtbar, drängten die Wüstenei zurück, aber heute noch feiert märkischer Sand hier an manchen Stellen wahre Orgien. Feingemahlen, schneeweiß und höchster Erhebung fähig, sobald ein Windstoß ihn packt, liegt er in breiten Wellen auf dem Wege, und wenn die Chaussee nicht links und rechts schmächtiger Kiefernwald begleitete, der mit seiner Nadelstreu einen zwar glatten, aber doch gangbaren Pfad herstellt, man möchte in den Verdammungsruf mittelalterlicher Reisender einstimmen. Noch in höherem Grade als Erika und Strandhafer verdient die Kiefer segensreich für uns genannt zu werden; Brandenburgs wirtschaftliche Herrscher erkannten frühzeitig, von welcher ungeheuren Wichtigkeit der genügsame, schlichte Baum für die Befestigung des Sandbodens ist. Die Erika hat weite, wüste Flächen mit Blättern und Blüten überzogen, ihnen den ersten schwachen Halt verliehen, in dem die Kiefer dann Wurzel schlagen konnte. Wo sich dürftiger Boden fand, den man vor der völligen Auslaugung durch die Sonne schützen wollte, pflanzte man Kiefernwälder; und wo man die harzigen Nadelbäume habgierig niederschlug, fiel das Land rasch dem grellgelben Sand zum Raube, der, aller Nährstoffe bar, ohne jede Beimischung von Lehm und Humus, in der Hand wie Staub zerrinnt und auch nicht das bescheidenste Moos zu ernähren vermag. –
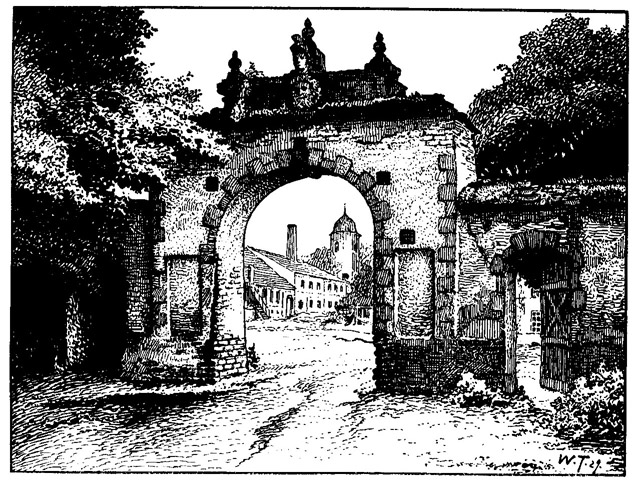
Klein-Machnow.
Feierabend ist gekommen. Durchs märkische Land schreitet die Nacht. Wie die Schleppe ihres Gewandes flattert lichtgrauer, niedriger Nebel über das Stoppelfeld; die Sternkrone blitzt auf ihrem Haupte, das des Himmels schwarzblaue Seide weich und schmiegsam umhüllt. Nicht dunkel und drohend, nein, von trübem Lichte matt umwittert, ein Feenkind, kommt die Sommernacht daher. Weit über das schweigende, schlafende Gefild schweift der Blick, über die mächtigen Schleusengebäude, dies ragende Denkmal des trefflichen Landrats Stubenrauch, über den grauen See, den dunkel glimmenden Streifen des Teltowkanals, den verträumten Wald. So still ist's, daß wir das Rollen des Schnellzugs zu vernehmen glauben, der von dem Dorfe eine halbe Meile weit vorüberhuscht. Oder ist es nicht der eiserne Sklave des 20. Jahrhunderts, ist es vielleicht Ritter Hake von Stülpe, der auf breitschultrigem Gaul mit schmetterndem Lachen durch den Forst galoppiert, heute wie vor 400 Jahren, um Goldmacher und Lügner zu überrumpeln und zu plündern?
An einem leuchtenden Frühlingsmorgen war's, als ich zum erstenmal des Weges nach »Burg Beuthen« gezogen kam. Was überhaupt blütefähig war in Feld und Hag, hatte sein bestes Können daran gesetzt, schön und lenzfreudig auszusehen; der Sand trieb Grashalme, Schmetterlinge flogen auf, und ein paar Krähen überlegten, ob man doch nicht mal den Versuch machen und sich für den Sommer am Nuthestrande häuslich niederlassen sollte. Den Bewohnern Klein-Beuthens, die im Sonntagsstaat vor ihren Häusern saßen, hatte der Frühling etwas wie Wohlwollen und Menschenliebe eingeflößt; sie erwiderten meinen Gruß mit einem unverständlichen, leisen Geknurr, aber sie erwiderten ihn doch wenigstens. Dem Lenz war es geglückt, in dieser Gegend, wo alles müden Schrittes geht, Menschen und Stunden, Gewässer und Wachstum, den Pulsschlag des Lebens zu beschleunigen; die Klein-Beuthener erkannten, daß es doch eigentlich eine Lust war, zu atmen, und selbst die schleichende Nuthe schämte sich ihres geringen Gefälles und begann wie ein munterer Waldbach zu hüpfen. Es schien, als hätten Einsamkeit und Öde, die Herren dieser Landschaft, sie auf einige Stunden aus ihrem Bann entlassen.
Wo der Nuthefluß das Dorf begrenzt, erhebt sich ein stattliches Mühlenhaus; vor der Tür saß ein Backfischlein, vierzehn Jahre jung oder ein wenig darunter, das blickte mit braunen Augen träumerisch in den Bach.
Wie Käferlein im Schoße der Ros,
so ruht' ein Büchlein in ihrem Schoß.
»Guten Tag, Fräulein,« sagt' ich. »Schönes Wetter heute! Gibt es hier in Klein-Beuthen etwas Sehenswertes, dich ausgenommen?«
Sie legte das Buch neben sich auf die Bank, stand auf und barg verschämt die Hände unter der Schürze. Braune, arbeitsfrohe Hände; ein sehr hübsches, braunes Gesichtchen, wie sonnverbrannte Pfirsichblüte, und sehr kluge braune Augen.
»O ja. Die alten Steine da drüben. Zuweilen kommen Herren aus Berlin und nehmen sich welche mit. Was 'n Unsinn!« Sie lachte. Wer so rote Lippen und so weiße Zähne hat, der kann wohl lachen.
»Hat Euch Euer Lehrer nichts davon erzählt?«
»Ach – ich geh' ja gar nicht mehr in die Schule. Ich weiß aber, daß eine alte Burg da drüben stand. Großvater hatte sie noch gesehen. Gut, daß sie weg ist.«
»Weshalb denn, Fräulein?«
»Na, dann kommen doch nicht so viel Fremde her.«
Dann setzte sie sich wieder, durchblätterte das Buch und las halblaut die lehrreiche Mär von der Burg Niedeck im Elsaß:
»Der Sage wohlbekannt,
der Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand,
sie selbst ist nun verfallen, die Stätte wüst und leer,
und fragst du nach den Riesen, du findest sie nicht mehr.«
Genau so ist's der Burg Beuthen ergangen, von der nur der Ort noch und wenige Feldsteine sprechen, und von den märkischen Riesen, die hinter ihren Mauern Kaisern und Landesherren Trotz boten, meldet nur noch eine halb sagenhafte Geschichte.
Zur »Burg« führt vom Bahnhof Ludwigsfelde eine auch an warmen Tagen recht angenehme Landstraße, der es an Waldesschatten und hübschen Ausblicken nicht gebricht. Dorf Siethen durchschreitend, gelangen wir schließlich nach Klein-Beuthen, dem entzückenden Dörfchen Still-im-Land, dessen gebrechliche Häuser zum großen Teil noch aus verwittertem Fachwerk bestehen und auf dessen Binsendächern üppiges, saftgrünes Moos wuchert. Akazien und Weiden schmücken in paßlicher Weise die Dorfstraße – sehen doch diese zermorschten, krüppligen und hohlen Weidenbäume selbst wie hinfällige Greise aus, denen jungenhafter Übermut eine grüne Krone aufs Haupt gedrückt hat. Recht traulich nehmen sich die zahlreichen Zisternen am Wege aus, die mit einem Weidenzaun umgürtet und immer von zwei jungen Akazien behütet sind. Am Ende des Dorfes, links von der Brücke und gegenüber der Mühle, wo meine liebe Freundin wohnt, befinden sich auf einem Landvorsprunge im Nuthebett die Trümmer der ehemaligen Burg Beuthen.
Die Nuthe, vom hohen Fläming kommend, entspringt unweit Dennewitz, des durch Bülow und die Freiheitskriege berühmt gewordenen Fleckens, und darf sich mit Recht zu den historischen Flüßchen Deutschlands zählen. »Nennt man die besten Namen, wird auch der meine genannt.« Durch Jahrhunderte hat sie Wendenland vom Deutschen Reich, Heidentum vom Christentum getrennt, und noch 1813 bildete sie eine Verteidigungslinie gegen Napoleon. – Als der schwere Wendenkrieg zu Ende, Brennabor zum neuntenmal erobert und das Triglaffbild in den Gemarkungen des Teltow für immer gestürzt worden war, türmten die Deutschen am Nutheufer vier Burgen auf, die das unterworfene Volk im Zaum halten sollten. Burg Beuthen fiel nach manchem Besitzwechsel in die Hand der Quitzows, und im Februar 1414, als ein Heerhaufe des Burggrafen Friedrich von Nürnberg gegen sie heranzog, befehligte hier Goswin von Brederlow, ein Quitzowscher Vasall, wohl erfahren in ritterlicher Waffenübung, aber mit dem modernen Feuergewehrwesen schier unbekannt. Als deshalb am Morgen des 25. Februar aus dem Schlund der faulen Grete eine Steinkugel gegen den Burgturm donnerte und das alte Gemäuer erschreckt zu wackeln begann, beugte er sich vor dem brüllenden Ungetüm und übergab die Burg Beuthen.
Wie ihre drei Schwestern ist Burg Beuthen heute vom Erdboden verschwunden. Kurz vor der Schlacht bei Großbeeren haben Bülowsche Truppen die stattlichen Reste der Ruine abgetragen und an ihrer Stelle eine Schanze aufgeworfen, um den Nutheübergang gegen den Feind zu verteidigen. Was man in unseren Tagen noch sieht, beschränkt sich auf unverkennbare Spuren einer früheren Umwallung und armselige Mauerwerksüberbleibsel. Gras und Moos haben die Feldsteine übersponnen, Sumpfunkraut wuchert ringsum, struppiges Gebüsch, Verwahrlosung, wohin man blickt. Ein paar kümmerliche Gänse fischen das Wasser ab, und der historische Boden der alten Burg dient jetzt als Trockenplatz. Nach der Groß-Beuthener Seite indes gewinnt das Bild an eigentümlicher Schönheit: auf den wasserreichen, moorigen Wiesen erheben zahlreiche Weiden ihre grünen Häupter und spiegeln sich in der trüben Flut zu ihren Füßen, so daß man eine kleine Spreewaldlandschaft zu sehen glaubt.
Seltsames Gefühl, das uns an solcher Stätte beschleicht! Jahrhundertelang strahlten hier wie in einem Brennpunkt alle politischen Interessen des Umkreises zusammen; Burg Beuthen beherrschte trutzig die blühenden Niederungen und war gefürchtet bei Freund und Feind. Nun liegen hier wie auf einem Friedhof tausend große Erinnerungen begraben; an Stelle des waffenklirrenden Kriegsgottes thront auf den elenden Trümmern die Gottheit des Verfalls, der Verwesung. Der Himmel hat uns heute einen wetterwendischen Apriltag beschert. Finstere Wolkenmassen flattern über die öde Sumpfstätte hin, über die schwarz blinkenden, träge ruhenden Wasserlachen, und kein Ton dringt in die Grabesstille. Vergangenheit, Tod und Verwüstung. Dort unten aber am Horizont, in der Richtung der Hauptstadt, flammt wie ein Zeichen jungen, triumphierenden Lebens, wie eine Zukunftshoffnung in prachtvollen Farben der Regenbogen auf.
Burg Beuthen, die den Augen wenig, der Phantasie aber unendlich viel bietet, ist natürlich nicht der Glanzpunkt unserer heutigen Fahrt; der liegt noch weiter im Lande draußen. Wir pilgern also rüstig fürbaß. Man muß einigermaßen sehnige Beine haben in dieser Gegend und keine überspannten Erwartungen hegen. Die Chaussee führt zwar immer am Waldesrand entlang, aber die Kiefern sehen doch allesamt recht kläglich und verhungert aus – man kann's ihnen nicht zum Vorwurf machen, bei dem Sande. Anerkennenswert genug, daß die Bäume es hier überhaupt zum Grünen bringen. Selbst die dann und wann aufsteigenden Wegweiser stehen so müd' und schlaff da, so heruntergekommen und zwerghaft klein, daß man's ihnen anmerkt, sie schämen sich ordentlich, solchen Weg zu weisen. Wer die Nuthe hinaufzieht, sammelt in der Tat herzlich wenige erhebende Eindrücke. Es ist immer dasselbe Bild: ein schmales, graues Bändchen, das sich durch rotblühende Wiesengründe schlängelt und allerlei Sumpfgetier willkommenen Unterschlupf bietet. Das Land ist ringsum arm, sandreich, in seinen unkultivierten Strichen eigentlich nur nach starken Regengüssen zu durchstreifen; der aufwirbelnde, hellgelbe Staub verleidet einem fast die Freude an den verborgenen Schönheiten, ehe man zu ihnen gelangt ist. Es gibt Strecken, wo man die kümmerlichste Wolfsmilch am Wege mit ungeheuchelter Begeisterung begrüßt.
Wie wir aber an die Glauer Berge herankommen, ändert sich mit einem Schlage die Szenerie. Den ausgefahrenen Sandpfad liegen lassend, streben wir nach links die Höhe hinauf. Dorf Blankensee im Sonntagsputz erscheint vor uns, ihm zur Linken der silberblanke See, dem es seinen Namen verdankt. Ohne Steg schreiten wir zum Gipfel empor, ins Dickicht hinein. Wir können's wagen, es ist Mittagszeit und der Zauber jetzt wirkungslos, der das Gehölz umwebt.
Der böse, menschenfeindliche Zauber. Nicht aber auch der, den dieses Hochwalds sagenreiche Stätte und seine versteckten Reize auf unser Gemüt ausüben. Und wie wir keuchend in die Vertiefungen hinein und die Anhöhen hinaufklettern, um dann den frohen Blick in die Runde schweifen zu lassen, erinnern wir uns gern daran, was Mutter Noacken, Blankensees Sagenhort, von diesen Bergen erzählt:
Ein mächt'ger König ruhe drin
mit Hofstaat und Gesinde,
mit reichgeschmückter Königin
und mit dem Königskinde ...
Die Schluchten öffnen sich jäh vor unseren Augen, ihre kahlgraue Färbung, die nur hier und da einen schüchternen Versuch macht, sich zu blassem Gelb aufzuschwingen, sticht grell ab von dem tiefgrünen Waldboden. Von hochragenden Fichten und Kiefern eingefaßt, selbst aber des Pflanzenschmuckes völlig bar, scheinen sie unsern Augen viel tiefer als sie in Wahrheit sind. Offenbar sucht bei heftigen Regengüssen das Wasser hier talwärts seinen Weg und tötet mit wuchtigem Prall alles sprießende Leben. Zahlreiche trockene Rinnsale von nicht unbeträchtlicher Tiefe, deren gelben Sand bloßgelegte Baumwurzeln malerisch unterbrechen, durchschneiden den Höhenzug und geben ihm einen ganz unmärkisch wilden Anstrich. Einige weißschimmernde, blattlose Birkenskelette, wunderlich verwachsene Laubhölzer tragen zur Erhöhung dieses Eindruckes noch wesentlich bei.
Auf dem Kapellenberg, dem nächsten Ziel unserer Wanderung, war früher eine von grünem Gesträuch umrankte Ruine zu bewundern. Eine elende Ruine zwar: nur zwei Pfeiler der angeblichen Kapelle, deren Wölbung zusammenbrach, und ein Spitzbogen waren erhalten. Aber wie liebten wir diese Trümmer! Jetzt haben Unverstand und Pietätlosigkeit das alte Baudenkmal völlig zerstört. Und der schmählich beraubte Ort ist nun ärmlicher noch als zuvor.
Unsere geschichtlichen Kenntnisse von der Kapelle, die sieben Meter im Quadrat maß und nach allen vier Seiten offen war, sind allerdings nur gering. Ihrer Bauart nach stammt sie aus dem 14. Jahrhundert, wo sie vielleicht als Wallfahrtsort diente. Der Katholizismus hat auf märkischem Boden keine große Geschichte, man ließ ihm nicht Zeit dazu. Schweigt aber die Historie, so ist die Sage um so geschäftiger. Unter der Kapelle, da, wo dichtes Bocksdorngestrüpp den Einblick verwehrt, liegt ein unermeßlich großer Schatz, jedoch so viele Blankenseer auch schon danach schürften, bisher fand ihn keiner. Ein Thümen – dies Geschlecht ist seit undenklichen Zeiten in Blankensee ansässig und hat sich durch seine Fruchtbarkeit berühmt gemacht, beschenkte doch laut einer in der Kirche noch vorhandenen Grabschrift Frau Sabine Hedwig ihren Gemahl Christian von Thümen mit 18 Sprößlingen – ein Kreisdirektor aus dem erlauchten Stamm war einmal drauf und dran, den Schatz zu gewinnen. Drei Tage und drei Nächte lang hatten seine Leute unter dem Bocksdorn gegraben, da stießen sie auf eine schwere eiserne Tür, und wie der Mutigste durchs Schlüsselloch guckte, sah er drinnen den Teufel auf einer Riesenpfanne voll roten Goldes sitzen. Man merkt, der Bau eisenverwahrter Banktresors in Kellern ist keine neue Idee, sondern von Satan lange erprobt. Herr Thümen gierte nach dem schönen Geld, was bei 18 Kindern und dem knappen Gehalt durchaus zu billigen ist, aber Beelzebub ließ sich nicht beschwören. Endlich fand sich ein Knecht, der Manns genug war, nächtlicherweile einen Brief des Direktors an Satan auf den Kapellenberg zu tragen, und siehe da, pünktlich zur Mitternachtsstunde fand er Antwort zusamt einem blitzblanken Silbergroschen als Trinkgeld. Dieser erbauliche Briefwechsel, in dem der Herr Kreisdirektor mit dem Bösen um den Schatz feilschte, dauerte geraume Zeit, bis endlich Satan die Geduld riß und er sein Ultimatum stellte: Überlassung des unglückseligen Boten und des Wasserarms, der den Blankensee mit seinem Nachbar verbindet. Zum Glück widerstand der menschenfreundliche Herr Kreisdirektor trotz seiner 18 Kinder der Versuchung, und der Schatz blieb ungehoben.
Der Waffenstillstand war am 16. August 1813 abgelaufen, Österreich dem russisch-preußischen Bunde beigetreten, und für Napoleon galt es nun, mit raschen Schlägen an die Hauptmacht und die Hauptstützen der Verbündeten heranzukommen. Zunächst lag ihm daran, die preußische Residenz fortzunehmen. Anders als Bernadotte, der Kronprinz von Schweden und Oberkommandierender der Nordarmee, schlug er die moralische Wirkung einer schnellen Eroberung Berlins recht hoch an.
Am 19. August rückte Oudinot in drei Heerzügen mit 70 000 Mann über die brandenburgischen Grenzen nach Baruth. Er bezog auf der Straße nach Luckenwalde ein Lager, um erst Erkundigungen einzuziehen. Am 21. brach er dann wieder auf. Das Korps von Bertrand, das den rechten Flügel hatte, marschierte über Sperenberg und Saalow zwischen Trebbin und Zossen hindurch, das Korps von Reynier im Zentrum links davon durch den Kummersdorfer Forst über Lüdersdorf und Gadsdorf nach Christinendorf; das zwölfte Korps, der linke Flügel, bog in der Höhe von Luckenwalde gerade nordwärts nach Trebbin aus.
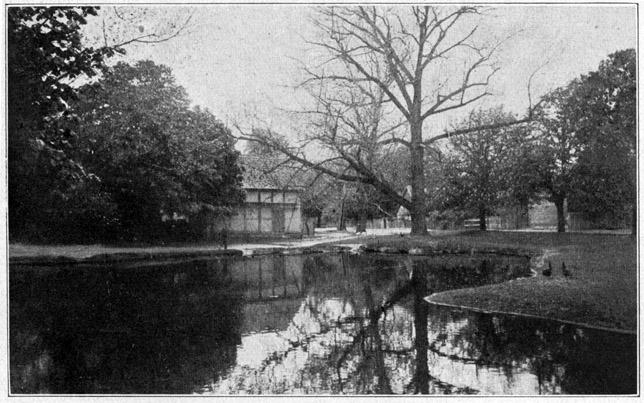
Dorfteich in Wiepersdorf, Kreis Luckenwalde

Hohenau, Westhavelland
Das feindliche Heer kam bei dieser Bewegung den Brigaden Thümen und Borstell, die eine feste Stellung an der Nuthe und Notte eingenommen hatten, sehr nahe, und Pflicht des Kronprinzen von Schweden wäre es nun gewesen, diese mit soviel Aufwand von Zeit und Kräften hergerichtete Stellung um jeden Preis zu verteidigen, indem er hier schnell den größten Teil des Nordheeres versammelte.
Allein der Kronprinz hatte im wesentlichen sein Heer auf weiten Räumen südlich von Berlin zerstreut gelassen, er glaubte diese Stellung nicht mehr erreichen und besetzen zu können, gab sie darum auf und zog sich näher an Berlin heran.
Um die Zusammenziehung der so sehr zerstreuten Streitkräfte ermöglichen zu können, war es notwendig, daß dem Feinde soviel wie möglich durch die Vortruppe Widerstand geleistet wurde. Dies geschah auf heldenmütige Weise.
Bei Trebbin stieß am 21. August die Vorhut des linken französischen Flügelkorps auf Vortruppen der Brigade Thümen. Gleich hier sollten die Franzosen erfahren, mit welch zähen, langausdauernden Gegnern sie zu tun hatten. Volle fünf Stunden lang leisteten die den Ort besetzt haltenden fünf Kompagnien unter Major von Clausewitz drei französischen Regimentern Widerstand, und es gelang ihnen darauf, den Rückzug seitwärts über Löwendorf und Klein-Beuthen über die Nuthe glücklich auszuführen. Ebenso mußten die andern beiden französischen Korps ihr Vorgehen mit den hartnäckigsten Gefechten erkaufen. Das Dorf Nunsdorf wurde durch 1½ Bataillone unter Major von Wedel gegen die sächsische Division des Generals Sahr vom Korps Reynier so lange verteidigt, bis das feindliche Geschütz das Dorf in Brand gesteckt hatte. Auch die Vorhut des Korps von Bertrand wurde durch nur zwei Kompagnien des 1. Pommerschen Regiments unter Kapitän von Kuylenstierna bei Mellen bis in die Nacht aufgehalten.
Dank diesem langen und zähen Widerstand blieb dem Kronprinz Zeit, seine Truppen wenigstens etwas zusammenzuziehen. Doch an energischen Widerstand dachte er auch jetzt noch nicht. Er sah in dem Kampfe gegen Napoleon nur die Gefahren, denen sein Ruf als Feldherr und seine Zukunft als Beherrscher von Schweden ausgesetzt seien. Ihn leiteten politische Rücksichten, und er verbarg sie unter der Bemäntelung von strategischen Bedenken. Auch ist es begreiflich, daß der gewaltige Kriegsruf des Kaisers Napoleon, seines früheren Herrn, und die »Keulenschläge« des Riesen großen Eindruck auf ihn machten. Major Friedrich versucht in seiner sonst trefflichen »Geschichte des Herbstfeldzuges von 1813« eine Ehrenrettung des Kronprinzen, doch nicht mit durchweg tauglichen Mitteln. Was auch immer zur Entschuldigung Johanns von Schweden vorgebracht werden mag, und welche Gründe für sein seltsames Verhalten vor und während der Schlacht auch ausgetiftelt werden mögen: fest steht, daß er sich seiner Aufgabe als Oberkommandierender durchaus nicht gewachsen zeigte. Alles in allem wird deshalb wohl jener preußische Offizier recht haben, der sich wie folgt äußerte: »Bernadotte entwarf beständig Pläne, die durch Kühnheit in Erstaunen setzten. Beispielsweise gedachte er Magdeburg und Stettin mit Strickleitern ersteigen zu lassen. Kam aber der entscheidende Augenblick heran, so nahm er rückwärts Stellungen. Er wurde immer und ausschließlich nur durch eine Rücksicht bestimmt: sich und seine schwedische Hilfstruppe keiner Niederlage auszusetzen.
Er zögerte auch jetzt, mit einem Würfel alles aufs Spiel zu setzen, er mochte vielleicht auch für seine Schweden allzu besorgt sein. Dazu kam noch, daß er bei der Beratung über einen Rückzug nach Norden um das Aufgeben Berlins auf Bülows Einrede ausgerufen hatte: »Was ist Berlin? Eine Stadt, nichts weiter.«
»Aber die Hauptstadt von Preußen,« fiel ihm Bülow ungestüm ins Wort; »kein Preuße wird über die Brücke gehen, die ihn hinter die Stadt führt!«
Fußnote aus technischen Gründen im Text eingepflegt. Re. Major Friedrich nennt den ganzen Kriegsrat legendär und bezweifelt infolgedessen natürlich auch, daß Bülow sich wie angegeben geäußert hat. H. v. Bülow schildert in seiner Biographie des Generalfeldmarschalls die Szene wie nachstehend:
Es ist am 22. August nachmittags, als der Kronprinz von Schweden in seinem Hauptquartiere von Philippstal bei Sargemünd einen Kriegsrat abhält. Seine Generale versammelt er um sich. Für den kommenden Tag beschließt er, dem Gegner eine Schlacht anzubieten. Sodann ergeht er sich sogleich aber wieder in Bedenken und Zweifel über den etwaigen Erfolg und setzt Mißtrauen in die Leistungen der Truppen, insbesondere aber in die Landwehrtruppen, die das erstemal mit dem Gegner zusammentreffen. Sollte es sich aber bewahrheiten, daß Napoleon mit der Hauptarmee auf Berlin, dem Vernehmen nach mit großen Streitkräften vorrücke, so wolle er, der Kronprinz, in diesem Falle den Rückzug fortsetzen, eine Stellung nördlich von Berlin nehmen und das Schlachtfeld dann jenseits der Havel und Spree verlegen. Für diesen Fall solle die Brücke bei Charlottenburg benutzt werden, und damit keine Stockungen eintreten, habe er dicht bei Berlin, in Moabit, noch eine zweite Pontonbrücke schlagen lassen.
»Wäre es möglich!« ruft Bülow, »Eure Königliche Hoheit wollten Berlin ohne Schlacht dem Feinde übergeben!« »Was ist Berlin!« bemerkt der Kronprinz gelassen, geringschätzend, wegwerfend, »eine Stadt, nichts weiter.«
Bei Bülow kocht es. Er braust in seinem heftigen, feurigen Naturell zornig auf.
»Erlauben Königliche Hoheit!« sagt er, mit Gewalt sich mäßigend, »für uns Preußen ist Berlin die Hauptstadt unseres Königs, und ich versichere, daß ich und meine Truppen von den beiden Brücken keinen Gebrauch machen werden. Vor allem wollen wir kämpfen und, wenn es sein muß, mit den Waffen in der Hand fallen, nicht aber hinter Berlin.«
Der Kronprinz lenkt ein und versichert, seine Anordnungen zu der morgigen Schlacht seien schon getroffen, an einen Rückzug denke er zunächst nicht, aber für den äußersten Fall müßten doch noch Vorbereitungen getroffen werden.
H. v. Bülow setzt dann hinzu:
Es ist sowohl über Bülow, wie auch über die Schlacht von Großbeeren viel und sehr Verschiedenes, aber auch oft den Tatsachen nicht Entsprechendes geschrieben und veröffentlicht. So hat man auch unter anderem seinen bekannten Ausspruch in den Tagen vor der Schlacht von Großbeeren: » Unsere Knochen sollen vor Berlin bleichen und nicht rückwärts« in das Reich der Fabel verweisen wollen. Diesen Ausspruch hat Bülow aber tatsächlich getan, und zwar nach dem Kriegsrate in Oranienburg am 13. August, nicht aber, wie irrtümlich behauptet wird, nach dem Kriegsrate von Philippsthal am 22. August. Diese Äußerung am 22. August zu tun, hätte ja überhaupt gar keinen Sinn mehr gehabt, nachdem der Oberbefehlshaber der Nordarmee, der Kronprinz von Schweden, am 22. August endlich auf das wiederholte Drängen Bülows die Dispositionen zu einer Schlacht gab. Schriftliche Quellen über diesen berühmten Ausspruch gibt es leider nicht. Dennoch ist er aber historisch festgestellt. Bülow hat diesen Ausspruch nach dem Kriegsrate von Oranienburg am 13. August im Fortreiten zu seinem Adjutanten, dem Rittmeister v. Auer, der zugleich sein Schwager ist, getan. Die Nachricht darüber hat sich durch mündliche Tradition in der v. Auerschen und v. Bülowschen Familie erhalten. Varnhagen von Ense, der über Bülow schreibt und dieses bestreitet, hat doch auch Kenntnis durch die Mitteilungen jenes v. Auer erhalten und nur durch ein Versehen falsch eingestellt, und zwar nach dem Kriegsrate von Philippsthal am 22. August, wo das Wort, wie vordem schon von mir erwiesen, keinen Sinn mehr gehabt hat.
»Mich bekommt er nicht gutmütig zum Rückmarsche hinter Berlin,« sagte er beim Wegreiten vom Kriegsrate zu seinen Offizieren; »unsere Knochen sollen vor Berlin bleichen und nicht rückwärts.« Wie Bülow sprach, so dachte auch Tauentzien und das ganze preußische Armeekorps: Landwehr und Linie wollten für die Hauptstadt des Landes kämpfen, vor ihren Toren fallen, nicht aber feige die Krone des Landes dem Feinde ohne Schwertstreich überlassen. Diese » Infanterie prussienne«, dies »Gesindel« wollte dem Kaiser Napoleon, der die jungen Truppen so verachtete, zeigen, daß Männer unter dem Befehl Bülows und Tauentziens standen.
Marschall Oudinot beabsichtigte am 22. August weiter vorzudringen. Es galt, die durch weite Moorgründe zusammenhängende, höchst sumpfige und künstlich noch überschwemmte Gegend der Nuthe und Notte zu passieren und weiter vorliegende ausgedehnte Kiefernwälder in der näheren Umgebung der Hauptstadt zu gewinnen. Das französische Heer konnte diesen Marsch nur in getrennten Heereszügen zurücklegen. Das rechte Korps des Generals Bertrand sollte die Richtung über Glienick bei Zossen, Groß-Schulzendorf und Jühnsdorf auf Blankenfelde einschlagen; das Korps des Zentrums von Reynier war beauftragt, bei Wietstock, welches erst erobert werden mußte, den Hauptgraben der Nuthe zu überschreiten und sich auf Großbeeren zu wenden. Hierdurch sollte nach der sehr richtigen Annahme des Marschalls auch die feindliche Stellung bei Thyrow, seinem linken Flügelkorps gegenüber, unhaltbar werden.
Es lag in Oudinots Plan, das linke Flügelkorps zunächst hinter den beiden anderen zurückzuhalten und dann einen Gewaltangriff auf den Thyrower Damm über die Nuthe zu wagen, der gelingen mußte, wenn der Übergang bei Wietstock fast im Rücken genommen war. Das Dorf Wietstock, an der den Franzosen zugekehrten Seite des Nuthebruchs gelegen, war zunächst nur von dem Bataillon Wedell, der Brigade Thümen und zwei Geschützen besetzt, welche Brigade den Thyrower Damm bei Trebbin und diesen Übergang zu verteidigen hatte. Hier erschienen die französische Division Durutte und die sächsische Division Sahr, beide vom Korps von Reynier. Ein lebhafter Kampf entbrannte zunächst um das Dorf Wietstock. Nach tapferem Widerstande wurden die Preußen gezwungen, das Dorf zu räumen und bis an die nahe Nuthe zurückzuweichen. Die Franzosen folgten mit dichten Schwärmen von Schützen, zugleich fuhren sie in der Mitte des Dorfes auf einer Erhöhung eine Batterie auf, die ein heftiges Feuer eröffnete. Doch auch jetzt noch verteidigten die Preußen den 800 Schritte langen Damm und den Übergang über die Nuthe, deren Brücke sie abgebrochen hatten, mit großer Kaltblütigkeit.
Indessen gelang es einem Teil des französischen Heeres, links von Wietstock über die Nuthe zu kommen und in Kerzendorf einzudringen. So mußte die Brigade Thümen von der Verteidigung bei Wietstock allmählich abstehen und den Rückzug durch den Wald nach Großbeeren antreten. Der Thyrower Damm fiel dem Feinde in die Hand.
Ebenso mußte General von Tauentzien den Übergang des Generals Bertrand bei Jühnsdorf über die Sumpfniederung der Nuthe nach heftigem Kampfe geschehen lassen und sich nach Blankenfelde an den Ausgang des Waldes zurückziehen.
Am Abend passierte das ganze Korps von Oudinot von Trebbin aus den Thyrower Damm und die Nuthe und lagerte bei Thyrow; das Korps von Reynier lagerte vorwärts von Kerzendorf, wo der General Quartier nahm, das Bertrandsche Korps blieb die Nacht über bei Jühnsdorf.
Die preußischen Verluste in dem Gefechte bei Wietstock betrugen 22 Offiziere, 334 Mann, 221 Pferde.
So schien der französische Marschall das Schwierigste überwunden zu haben. Großbeeren, der »Schlüssel von Berlin«, war sein. Oudinot brauchte nur noch durch den vorliegenden weiten, teilweise sumpfigen Wald zu marschieren, der sich von Saarmund über Ahrensdorf und Genshagen erstreckt, um dann in der freien Gegend vor Berlin die Entscheidungsschlacht zu liefern und nach derem glücklichen Ausgang in die preußische Hauptstadt einzuziehen.
Nun mußte die Entscheidung nahen. Jedoch noch immer zögerte Bernadotte.
Da riß dem General Bülow die Geduld, und statt dem ihm zugegangenen abermaligen Rückzugsbefehl zu folgen, beschloß der preußische Heerführer mit den ihm zur Verfügung stehenden eigenen Kräften sofort den ihm gegenüberstehenden Feind anzugreifen.
Die Gelegenheit konnte nicht günstiger sein. Der französische Feldherr erwartete die Schlacht erst am 24., da seine einzelnen Korps sich eben erst in Ausführung der Einleitungsbewegungen befanden und hierzu noch durch beträchtliche Entfernungen voneinander getrennt waren.
Die Aufstellung des Kronprinzen nahm von Gütergotz über Ruhlsdorf und Heinersdorf bis Groß-Ziethen eine Front von mehr als zwei Meilen ein. Sein Heer befand sich in dieser Stellung im Angesicht des weiten Waldes, durch den der Feind hervorkommen sollte. Oudinot konnte nicht auf einer Straße durch den Wald marschieren, und auf diesen Umstand bauten die preußischen Generale. Sie hofften mit überlegenen Kräften über die geteilten Kolonnen herfallen und sie schlagen zu können. Wirklich begünstigte die Marscheinteilung des Feindes ihre Absicht: er war in drei Teile geteilt, die sich an zwei Meilen auseinanderhielten. Oudinot hatte General Bertrand befohlen, am frühen Morgen des 23. den General Tauentzien bei Blankenfelde anzugreifen und zu beschäftigen, um den Feldherrn der Verbündeten vom Marsche des mittleren und linken Korps abzulenken. Doch wußte sich dieser mit seinen Landwehren in Blankenfelde, das durch seine Lage am Rande der Jühnsdorfer Heide und zwischen Bruch und See, einen Widerstand allerdings sehr begünstigte, nicht nur zu behaupten, sondern warf sogar den Feind zurück und machte 11 Offiziere und 200 Mann zu Gefangenen. Der Erfolg dieses kurzen Gefechts war bedeutend, der rechte Flügel Oudinots kam dadurch nicht mehr vorwärts.
Der entscheidende Kampf erfolgte freilich an anderer Stelle zwischen Bülow und Reynier. Bülow war am Vormittag von Heinersdorf abgerückt, um General von Borstell entgegenzugehen. Um vier Uhr entwickelte sich die sächsische Division Sahr des Korps Bertrand aus der Genshagener Heide gegen die Windmühlenhöhe von Großbeeren.
Bald nach fünf Uhr nachmittags erfolgte der Befehl zum Vorrücken bei dem preußischen Korps. Seit Mittag war ein heftiger Landregen eingetreten, und bei dem Regendunkel, das die Gegend einhüllte, war eine Erkennung der feindlichen Stellung nicht möglich. Man wußte nur soviel, daß er bei Großbeeren haltgemacht hatte.
Der Plan des preußischen Heerführers war demzufolge auch sehr einfach. Die Division Borstell von seinem Korps erhielt den Befehl, auf dem Wege über Kleinbeeren gegen die rechte Seite des genannten Dorfes vorzugehen, während er selbst mit den drei Divisionen Krafft, Hessen-Homburg und Thümen gegen die Frontseite vorrückte.
Aber nur langsam konnten die durchnäßten Soldaten vorwärts kommen. Erst nach Überwindung größter Mühsal ließen sich bei dem strömenden Regen die Kanonen auf den grundlosen Wegen vom Flecke schaffen, mit äußerster Anstrengung arbeiteten sich die Reiter durch den aufgeweichten Boden.
Sechs Uhr abends war es bereits, als bei Reynier wiederholt Meldungen vom Herannahen der Preußen anlangten. »Die Preußen werden heut nicht kommen, es ist nichts,« sagte er zu dem sächsischen Divisionsgeneral, der ihn warnen wollte. Das Wetter schien ihm zu unfreundlich, zu vorgerückt schon die Zeit, um einen ernsthaften Angriff zu besorgen. Aber horch! Die Preußen kamen doch, sie meldeten sich sofort an.
Von Bülow wurden sechs Bataillone zum ersten Angriff vorgezogen, wovon zwei das Dorf und vier die Windmühlenhöhe erstürmen sollten. Drei andere Bataillone hatten den Rückhalt zu bilden. Eine schwedische Batterie, von zwei Eskadrons Husaren gedeckt, schloß sich der preußischen Artillerie an, so daß diese auf 96 Geschütze anwuchs, denen der Feind nur 68 gegenüberzustellen vermochte.
Die preußische Artillerie erlangte dementsprechend bald ein entscheidendes Übergewicht über die feindliche. Mit dem Schwächerwerden des französischen Feuers ward von dem preußischen General der Befehl zum Vorrücken gegeben. Der Angriff auf das schon in hellen Flammen stehende Dorf glückte um so leichter, als die Borstellschen Truppen den auf dem Wege von Groß- nach Kleinbeeren den Lilobach überbrückenden Steg in ihre Gewalt gebracht hatten und die stürmenden Scharen von hier mit jenen aus der Front zugleich in den Ort drangen. Jetzt gaben Hörner und Trommeln das Zeichen zum Angriff. Gleichzeitig verdoppelten auch die Kanonen ihre Wut und rissen mit ihren Kugeln tiefe Lücken in die Schlachtreihen. Als die Angreifenden nahe genug herangekommen waren, erhob sich ein entsetzliches Handgemenge. Mann focht gegen Mann, die vorderen Glieder fällten die Gewehre, andere drehten sie um, und da keine Flinte bei dem Regen losgehen wollte, so kämpfte man nur mit dem Bajonett und Kolben. »Immer drauf! Hurra!« riefen die Wehrmänner in dem wirren Getümmel. »Es lebe der König!«, » Vive l'Empereur!« brüllte es durcheinander; zwischendrein erscholl der Zuruf der Ermutigung »Hurra! Berlin!« – Hier war es, wo ein tapferer Held, um seinen Kameraden eine Gasse zu bahnen, sich die Bajonette von vier Feinden in die Brust bohrte. Den Namen dieses preußischen Arnold von Winkelried hat leider kein Heldenbuch aus jener großen Zeit aufgezeichnet. Im Sturmschritt gingen die Preußen auf das brennende Dorf los. Mit lautem Hurra stürzte sich vor allem das erste neumärkische Landwehrregiment in den Kampf und auf die Batterien der Feinde.
Der Regen strömte noch fortwährend. Mit Hartnäckigkeit verteidigten die Sachsen das Dorf und die Batterien. Aber die Landwehr drängte sie zurück, stach die Kanoniere neben den Kanonen nieder, und als das Bajonett unter den in dichten Haufen zusammengedrängten sächsischen Garde-Grenadieren nicht schnell genug aufräumte, griff man zum Kolben und schlug drauf los. »Dat fluscht beter!« riefen die Pommern, und die Kolbenschläge drangen durch die hohen Bärenmützen und die mit gelben Kragen geschmückten krebsroten Röcke der sächsischen Grenadiere. In kurzer Zeit war das Dorf in den Händen der Preußen.
Der Rest der Besatzung des Dorfes flüchtete dem Ausgange zu, wo sich die beiden dort gegen die Borstellschen Truppen aufgestellten sächsischen Bataillone den verfolgenden Preußen entgegenwarfen und ihr Vordringen noch einen Augenblick aufhielten.
Im Anschluß an die Infanterie war auch die Borstellsche Kavallerie in Großbeeren vorgedrungen und durch die Quergasse des Dorfes auf das freie Feld links hinausgesprengt. Unterdessen hatte jedoch die Hauptmasse des flüchtenden Feindes schon den schützenden Wald erreicht, nur zwei französische Bataillone konnten noch erreicht werden. Auf diese warfen sich das preußische Ulanenregiment und zwei Eskadrons pommerscher Husaren, zersprengten sie und eroberten zwei Geschütze.
Doch jetzt gingen die sächsischen Ulanen gegen die Preußen vor, griffen sie in der Flanke und im Rücken an und warfen sie gegen die Windmühlenhöhe zurück. Da trabte das bei dem Durchzuge durch Großbeeren etwas aufgehaltene pommersche Landwehr-Kavallerieregiment aus dem Dorfe. Der Feind stutzte und machte halt. Alsbald wurde er durch die jetzt mit voller Gewalt attackierenden Pommern über den Haufen geworfen, wobei die Sachsen ihren verwundet in die Hand der Preußen gefallenen Obersten und 120 Mann verloren und eine dicht am Waldrand vergeblich nach einem Ausweg suchende französische Batterie erbeutet wurde.
Ebenso ruhmvoll und mutig hatte einige Minuten zuvor das zweite Bataillon des 1. neumärkischen Landwehrregiments einen erbitterten Kampf zu bestehen gehabt. Es war als rechter Flügel der die Windmühlenhöhe erstürmenden vier preußischen Schlachthaufen nach Bewältigung des Feindes unverhofft von dem aus der feindlichen Mitte herbeieilenden Regiment Low mit dem Bajonett angegriffen worden. Bei dem furchtbaren Zusammenstoß sanken neun Offiziere, unter ihnen der Kommandeur, dahin, und 100 Mann des preußischen Bataillons bedeckten tot oder verwundet den Boden.
Dennoch aber dachten die wackeren Wehrleute nicht an ein Zurückweichen. Durch die erlittenen Verluste vielmehr zur rasenden Wut entflammt, gebrauchten sie die von ihren kräftigen Armen geschwungenen Kolben statt der Bajonette und warfen unter verzweifeltem Ringen den Feind in die Flucht. Kaum gelang es einem schwachen Überreste des sächsischen Regiments, das den schwerverwundeten Führer der zweiten sächsischen Division, General Sahrer von Sahr, in seine Mitte nahm, sich nach dem Walde durchzuschlagen. Die Dunkelheit begann an dem düstern Regenabend früh herabzusinken, und nach dem zuletzt erfolgten Angriff der pommerschen Wehrreiter befand sich kein Feind mehr auf der tapfer erstrittenen Wahlstatt.
Damit hatte die Schlacht ein Ende. Bald loderten die Wachtfeuer rings um das brennende Dorf, und die ermüdeten Sieger suchten die Ruhe.
Die Berliner hatten mit fieberhafter Spannung den Ausgang der Schlacht erwartet: zu Fuß, zu Roß und zu Wagen kamen einzelne, um sich nach dem Stande des Kampfes zu erkundigen. Und als spät in der Nacht noch die eroberten Kanonen, Pulverwagen und Gefangenen in die Stadt gebracht wurden, da erhob sich unendlicher Jubel; man stürzte aus den Häusern auf die Straßen, umarmte sich, beglückwünschte einander und pries den herrlichen Sieg. Mit dem frühen Morgen des andern Tages aber eilten zahllose Karren und Wagen, Frauen mit Körben, Männer mit großen Paketen nach Großbeeren; denn jeder wollte die Retter der Hauptstadt erfrischen. Freilich zollte man dabei auch diesmal nach schlechter, hoffentlich bald überwundener deutscher Art dem verdienstlosen Fremdling alle Ehre. H. v. Bülow schreibt: Die Vertreter der Stadt erschienen auf dem Schlachtfelde, dem Sieger zu danken. An Bülow aber gingen sie vorbei, den Kronprinzen von Schweden suchten sie auf, der den Dank auch wirklich entgegennahm. Bülow selbst sagte beim feierlichen Einzug in Berlin bitterböse zu den Magistratsherren: »Mich konnten Sie durch Ihr Verhalten nicht beleidigen, aber in Ihrer Seele habe ich mich des gänzlichen Mangels an Nationalgefühl, den Sie zeigten, geschämt.«
Den Verlust des Feindes in der Schlacht kann man auf 4000 Mann annehmen, wovon auf die Sachsen allein 28 Offiziere und 2096 Mann kamen. Die Preußen hatten 29 Offiziere und beinahe 1100 Mann verloren, wovon auf das tapfere neumärkische Landwehrbataillon allein 9 Offiziere und 198 Mann entfielen.
Am 24. August kamen gefangen nach Berlin 66 Offiziere und 1368 Mann Franzosen und Sachsen.
An Geschütz sind 13 Stück, an Fahrzeugen, und zwar fast sämtlich gefüllte sächsische Munitionswagen, 60 an der Zahl genommen worden.
Jochimken, Jochimken, höde Dy,
Wo wy Dy kriegen, do hängen wi Dy!
Wie wir, vom Marktplatz Köpenicks kommend, das Eisentor des alten Hohenzollernschlosses öffnen und in den Hof treten, klingt uns, schelmisch halb und halb ein gelindes Gruseln erweckend, der freche Reim Otterstedts von Süßegrund durchs Gedächtnis, das übermütige Drohwort, das Kurfürst Joachim eines Morgens mit Kreide an seine Schlafzimmertür geschrieben fand, Kurfürst Joachim war trotz seiner großen Jugend weise genug, die rechte Lehre aus dem politischen Epigramm Otterstedts zu ziehen und seinen lieben Spezialfreunden das Schicksal angedeihen zu lassen, das man ihm zugedacht hatte. Wie dies Ereignis, haben alle anderen, die sich auf Schloß Köpenick zutrugen, einen düsteren Anstrich und klingen zumeist wie Tragödien. Und die wasserumschlungene Spreefeste ist nicht arm an Historie. Schloß Köpenick kann mitsprechen, wenn es sich um Brandenburgs Herrscher handelt; seine Mauern sind steinerne Geschichte.
Heute freilich, wo es in die Greisenjahre getreten ist und sich, wie ein gealterter Reitersknecht, zu geringerem Dienst bequemen muß, heute liegt Schloß Köpenick fast vergessen im Winkel, und das Welttreiben flutet an ihm vorbei. Kein Waffenklirren mehr dort oben, kein erlauchter Besuch zieht lärmend bei Fackelschein in den Hof, kein Humpen kreist, keine fürstlichen Jagdlateiner und keine Tabaksrunden machen sich blauen Dunst vor, keine Staatsminister durchschreiten gravitätisch seine Säle, kein Edeldämlein kichert, und kein blauäugiger Page scharmutziert. Auch die ernsten und schlichten Nachfolger der Hofherrlichkeiten sind inzwischen ebenfalls vom Plan verschwunden. Schloß Köpenick diente lange Jahre hindurch als Lehrerseminar. Heute ist auch das vorbei.
Seine jetzige äußere Gestalt hat der Bau seit 1682, wo Rütger von Langenfeld ihn im Auftrage des Großen Kurfürsten neu aufrichtete. Wir wissen von drei Schlössern, die sich an dieser Stelle erhoben: das erste war Jaczos, des edlen Wendenaares, Horst, und stand bis 1550; dann ließ der weidliebende Joachim II. das alte Gemäuer niederreißen und von seinem Baumeister Caspar Theiß ein neues Jagdschloß errichten, das schließlich dem Renaissancebau Rütgers weichen mußte.
Joachim liebte diesen Aufenthalt ebenso wie seine Freundin Aenne Sydow; der Kreis ihrer blondköpfigen Söhne war beständig um ihn. Die schöne Gießerin zeigte sich bei allen Jagdvergnügen und Schloßlustbarkeiten an seiner Seite, und wer sich's angenehm in Köpenick machen wollte, beugte vor ihr wie vor der Kurfürstin selber das Knie. Aber der Tag kam, wo ihr Glück zerbrach. Von einer lustigen Jagd zum Schlosse heimkehrend, ritten der Herrscher und seine Freundin langsam an einer Zuschauermenge vorbei, und Joachim hörte, wie die Bauern, mit den Fingern auf Aenne Sydow weisend, einander zumurmelten: »Das ist des Kurfürsten unrechte Frau! Wie darf er tun, was uns verboten ist!« – »Geh hinein,« sagte er da zur Geliebten, »sie nehmen Ärgernis an dir.« Von dieser Stunde an ward Anna Sydow nicht mehr außerhalb des Schlosses gesehen.
Kurfürst Joachim erlegte noch manchen Hirsch und manches Raubtier in den Müggelforsten, als er aber am 3. Januar 1571 nach einer lustigen Wolfshatz abends an der Tafel saß, um ihn die Großen der Krone, Lichterglanz und Fröhlichkeit, da faßten ihn Todesschauer an, und andächtig malte er ein Kreuz auf den Eichentisch. In derselben Nacht verschied er, 66 Jahre alt, und seine letzten Worte waren Luthers: »Das ist gewißlich wahr!«
Es ist ein Raum im Schlosse, der schon seit langem anderen Zwecken als denen fürstlicher Hofhaltung dient, ein Saal, den wir lautklopfenden Herzens betreten, der Wappensaal.
Karyatiden stützen die Decke; jede trägt auf der Brust je ein Wappen der damaligen preußischen Besitztümer, in wirrem Durcheinander, nach Künstlerlaune. Am Wappensaal ist wenig verändert, all sein Prunk blieb erhalten, selbst die beiden prachtvollen Kamine in der Ecke. Trotz des langgestreckten Raumes aber wirken die Stuckmassen erdrückend und lassen es zu keinem rechten Genusse oder ästhetischen Wohlbehagen kommen. Indessen, dies ist auch nicht der Platz für rasch vergängliche Wandereindrücke. In den Wappensaal hat die Geschichte mit ehernem Griffel ihr Wahrzeichen eingetragen; dieser Boden ist geheiligt. Hier saß am 25. Oktober 1730 das Kriegsgericht, das aburteilen sollte über den »entlaufenen Oberstlieutnant Fritz«, nachmaligen Friedrich den Großen, und seinen Mitschuldigen Hans von Katte.
Nach ernster und langer Beratung gaben die 16 Männer jenes Votum ab, das dem erzürnten König so sehr mißfiel, und das, soweit es den Kronprinzen Friedrich angeht, in der Fassung des alten standhaften Achaz von der Schulenburg hier wiedergegeben sei: »Was den Cron-Printzen betrifft, finde ich mich verbunden, denen sämmtlichen dahingehenden votis beyzufallen, daß aber desselben jetzige Sache nach ihren Umständen von einem Kriegsrecht nicht gesprochen werden könne, sondern Sr. K. M. zu überlassen sey, welchergestalt Sie dessen wiederholte wehmütige Reu Bezeugung, submission und Bitte als König und Vater in Gnaden anzusehen geruhen möchten.« Über Leutnant Katte sagt das Urteil: »Ihn anlangend muß ich denjenigen votis beystimmen, welche ewigen Vestungs-Arrest erkannt haben.« Der König stieß den Spruch der Sechzehn um, vermochte aber das Kriegsgericht nicht wankelmütig zu machen und verurteilte nun von seinem Jagdschlosse Wusterhausen aus am 1. November 1730 durch Kabinettsorder Hans von Katte zum Tode durchs Beil, weil »es besser wäre, daß er stürbe, als daß die Justiz aus der Welt käme«. Ein grausiges Wort, vielleicht auch ein großes. Nur fällt es einigermaßen schwer, sich des Verdachtes zu erwehren, der König habe in diesem Falle persönlichen Zorn und Haß für hohes Gerechtigkeitsempfinden gehalten.
Eine stockdunkle, aber solid gebaute Treppe – mächtiges Kernholz aus der alten Zeit, die damit nicht sparte – führt uns ins Freie, zur Balustrade. Rechts befindet sich der mit Bohlen gedeckte Gang, von den man annimmt, daß er früher als Kegelbahn diente. Beneidenswerter Besitzer solcher Kegelbahn. Der Blick von hier ins Land hinaus ist im Abendlicht von rührender Schönheit. Dahme und Spree umzirken den grünen Schloßgarten, phantastische Lichter flammen und glimmen in ihren Fluten; tausend Schattierungen des blauen Grundtons; Flußläufe von Stahl, in starkem Feuer geglüht, bis unendlich viele, abenteuerliche Farben aufspringen. Spindlersfeld, die Sonntag feiernde Stadt Köpenick und gegenüber der Kietz – wie traulich, wie freundlich und wie märkisch dabei! – Schlanke Ruderboote, Kähne und Schwäne ziehen über das Wasser; hinter den Häusern unermeßliche Waldungen und Seenjuwele. Die Müggelberge schließen nach der Kietzer Seite hin das Bild, daß man mit einiger Phantasie glauben kann, ein Gebirgsstädtchen vor sich zu haben.
Ich ging nur, weil der Kastellan seine Ungeduld schließlich nicht mehr verbergen konnte. Niemals bin ich so ungern geschieden. Meiner Treu, solch eine Kegelbahn wünscht' ich mir auch, und die Welt hätte einen seßhaften Bürger mehr! –
Ein viereckiger Hof, der sich nach vorn zum lauschigen Park erweitert, trennt das Schloß von seiner Kapelle, wo Prinzessin Henriette Marie begraben liegt. Sie lebte als Witwe fast 33 Jahre lang auf Schloß Köpenick, wie man behauptet, »in der Verbannung«. Besonders gewogen war ihr der alte Fritz jedenfalls nicht. Noch vor kurzem wurde in der Kapellengruft ihre Mumie gezeigt, pomphaft mit faltigem Brokatkleid angetan und gut erhalten.

Am kleinen Müggelsee.
Jener »letzte Schlupfwinkel eines untergehenden Volkes«, das mit Wasser und Sumpf bedeckte Inseldreieck, in dessen Mitte die Müggelberge ihr grünes Haupt emporrecken, ist von Friedrichshagen, Köpenick und Grünau mit gleicher Leichtigkeit zu erreichen; in Köpenick vermitteln sogar zwei Brücken den Übergang in das »Land der Sage«. Wir kommen heute von Rahnsdorf, dem uralten wendischen Fischerdörfchen, wo doch nichts seltener und schwerer zu erlangen ist, als ein Gericht Fische. Was die Insassen der so wunderhübsch und traulich unter Erlen und Weiden verborgenen, netzumhangenen, binsengedeckten Hütten tagsüber auf beschwerlicher Jagd erbeuten, muß alles dem gefräßigen Oger, der Großstadt Berlin, in den nimmersatten Rachen geschoben werden.
Über den Wiesen jenseits der Spree tummelt sich trillierend eine Lerchenschar; hoch oben durch die blauen Lüfte schwebt majestätisch ein Reiher dahin. Jetzt senkt er sich tändelnd herab, um gleich wieder jäh emporzuschießen und sich dann vom Winde forttragen zu lassen. Ohne Flügelschlag schwimmt er auf den Luftwellen. Prachtvoll zeichnet sich der schöne Körper von dem leuchtenden Himmelsopal ab. Bis er nordwärts in den Bäumen verschwunden ist, folgen unsere Blicke andächtig seinem Fluge. Ist's doch, als hätte Triglaff, der dreiköpfige Gott, der dort oben auf den Müggelbergen thront, wichtige Kunde mit ihm nach Rhetra gesandt.
Es ist noch früh; das goldene Sonnenlicht fliegt eben über die höchsten Wipfel der Kiefernwand dahin, und ein frischer Morgenwind weht auf dem Wasser. Wir hüllen uns fester in den Mantel, als wir den arg gebrechlichen, lecken Kahn besteigen, der uns ins Müggelland tragen soll. Bedächtig stößt der Fährmann ab. Wie er da vor uns steht, eisgrau, verwittert, eine hagere, hilflose Greisengestalt, gemahnt er fast seltsam an die Tage, da der Semnonen tapferer Stamm in die üppigen Südlande zog, alles zurücklassend, was krank und schwach und kriegsuntüchtig war. Wer ihnen nicht folgte, mußte sich dem nachrückenden Wendenvolk zu Knechtsdiensten verdingen.
Es bläst scharf herüber aus dem Röhricht.
»Ein mühsames Handwerk, Vater,« sag' ich. »Treiben Sie's schon lange?«
Der Fährmann schweigt eine Weile. Viel reden ist nicht Art märkischer Fährleute. »Seit drei Jahren,« antwortet er nach Minutenfrist.
»Und wie alt seid Ihr, Vater?« Man verfällt unwillkürlich auf das »Ihr«, diesem schier vorzeitigen Greise gegenüber.
»Zweiundsiebzig.«
»Aber um alles in der Welt – in Euren Jahren – und so spät damit anzufangen!«
»Hm,« meint der Alte achselzuckend, »man will leben und doch niemandem zur Last fallen.«
Der märkische Bauer ist hart, übersparsam, fast geizig, und dabei von ungemein reizbarem Ehrgefühl. Er verlangt nichts geschenkt und schenkt nichts. Zwingt man ihn durch Gesetze zur Wohltätigkeit, so hat er eine derart nichtswürdige Manier, Almosen zu geben, daß der unglückliche Empfänger gern darauf verzichtet.
Ruckweise nur schwimmt der Kahn über die glitzernde Flut, zwischen schmalen Inselchen hindurch, die sich wie riesige Teichrosenblätter ausbreiten. Das mächtige Becken der Müggel wird für Augenblicke sichtbar und wallt so lebendig in schimmernder Weiße, daß man kochendes Silber zu schauen glaubt.
Der Kahn stößt ans Ufer. Durch Heidekraut und raschelndes Gras, an jungen Schonungen vorbei, folgen wir nach rechts dem Laufe der Spree. Noch verbirgt Tannicht wie eine grüne Kulisse die Stelle, wo sie in die Müggel einströmt, aber schon dringt lautes Rauschen, munterer Wellenschlag an unser Ohr. Und glänzend breitet sich dann die runde Wasserfläche des Königs der märkischen Seen vor uns aus. Flinke Ruderboote durchfurchen ihn, langsam ziehen schwerbeladene Spreekähne vorbei, mit ihren mächtig aufgeblähten, grauen Segeln an das Riesengeschlecht vorweltlicher Flügelechsen erinnernd. Am Ufer drüben erglänzt das stattliche Friedrichshagen; nicht weit davon sind die Wasserwerke, in kokettem Rot und schmucker Bauart. Grellgelbe Dünen säumen den See ein, Heideland dahinter, ganz rechts grüßt mit funkelnden Scheiben und roten Dächern das mit frischem Grün umsponnene Rahnsdorf.
Ein schönes Gewässer, ein ausdrucksvolles Auge der Landschaft, die Phantasie anregend und zum Herzen sprechend, ob es nun finster grollt oder heiter lacht. Wir haben einen der sonnigsten Müggeltage gewählt; heut wirft er wie spielend kurze, kleine Wellen klatschend auf den Strand und atmet ruhig wie ein seiner Kraft sich noch nicht bewußtes Titanenkind. Des Himmels wechselnde Farben in hundert Schattierungen widerspiegelnd, bietet er von Minute zu Minute fast ein anderes Bild. Der See ruht niemals; er kennt keinen Schlaf, immer weiß er zu erzählen, Märchen, Sagen und Historien der Vergangenheit. Und er weiß viel.
Über die Maßen herrlich aber ist's, an Gewittertagen von Rahnsdorf her seine Wasser zu durchfurchen. Dann erwacht der See aus dämmerndem Traume und besinnt sich auf seine große Geschichte. Die alten Müggeldämonen harren in der Tiefe ungeduldig auf die Stunde, wo alle rechtschaffene Christenheit schlummert und zu der allein sie aufsteigen dürfen, seit der Christengott den Tag für sich gewonnen hat. Und es kreist und quirlt und strudelt, kurze Wellen mit dicken Köpfen machen sich auf, wütend am Ufer emporkletternd. Erst gegen Sonnenuntergang pflegt sich das Gewässer ein wenig zu beruhigen.
Und dann scheidet das Tagesgestirn. Mit einem Schlage erbleichen all die prunkenden Farbentöne, Dämmerung umfängt den See; ein kühler Luftzug macht uns zusammenschauern. Wer nun mit scharfem Auge vom Berge hinunterspäht und recht acht gibt auf die tausend kleinen Tücken der Müggel, dem offenbart sich all ihr geheimnisvoller Spuk. Das fahle Licht, die plötzlich grau gewordene Flut, die wallenden, trüben Nebel, sie gebären Hexen und Kobolde. Ziehst du jetzt einsam durch den Wald, so kann es sich ereignen, trotz des 20. Jahrhunderts und der Nähe einer so aufgeklärten Stadt wie Berlin, daß gespenstischer Schein dich auf Irrwege und in Sümpfe lockt, daß häßliche alte Weiber hinter dir herlaufen und dich mit schrillem Lachen, frechen Gebärden verhöhnen. Denn die Stätte, wo du wandelst, ist verwunschenes Land. Mehrere Schlösser liegen in der Tiefe.
Eins bedeckt der Teufelssee, der zwischen dem großen und kleinen Müggelberg, der Müggel zugewandt, sein dunkles Wasser dehnt. Die brutale Neuzeit hat ihm zwar all seine düstere Romantik gestohlen, hat seine Riesenkiefern gefällt und eine lärmvolle Kneipe an sein Ufer gestellt. Aber noch immer umzirkt ihn sein sternmoosbedeckter Sumpfgürtel, schmückt ihn ein leuchtender Kranz gelber Teichrosen. Und wenn zur Sommerzeit weiße Sterne sich in ihm spiegeln und warme Nachtluft ihn umschwellt, Modergeruch, Harzduft und Blumenodem, wenn der Boden rings knistert und blitzt – denn er ist mit Moorgasen reich gesättigt –, dann neigt sich das abergläubische Herz angstvoll vor dem toten Triglaff, dessen Bild dort oben auf der Berghalde stand und der ein gar mächtiger Götze war.
In der Johannisnacht aber steigt ein wunderholdes, verzaubertes Prinzeßlein aus dem Wasser empor und schmückt ihr schwarzes Gewand mit den schwefelgelben Teichblumen und hängt sich smaragdenes Sternenmoos ins blonde Haar. Mit gefalteten Händen sitzt sie auf dem großen Stein am See, und über ihr süßes Gesicht, das der Mondenschein zärtlich küßt, rinnen schwere Tropfen – ist's Feuchte aus dem Sternenmoosbüschel oder sind es Tränen? Vorzeiten hörte ein Kuhhirt aus Müggelheim ihr leises Klagen, und weil er ein verwegener Junge war und hübsch dabei, tastete er sich mutig an den See heran und rief dreimal der Prinzessin Namen, wie's ihn seine Urgroßmutter gelehrt. Die Prinzessin aber ging ihm entgegen, und er nahm sie stracks auf seinen Arm und trug sie, von Gespenstern und Dämonen und Hexen umblafft, durch die Heide nach Köpenick. Aber der gute Bursch, dem bei all dem grauslichen Lärm doch bang im Busen ward, vergaß die strenge Vorschrift, sich nicht umzuschauen. Er drehte entsetzt den Kopf nach hinten, als eine fürchterliche Stimme: »Mädchenräuber! Mädchenräuber! Reißt ihm das Herz aus!« schrie. Im selben Augenblick war die Prinzessin verschwunden.
Oben auf den Müggelbergen stand auch einstens ein Schloß, dessen Herrin in anmaßlicher Überhebung alle Freier zurückwies. Ein Zauberer, von dem Leide so vieler Junggesellen gerührt und offenbar übertriebener Ehefeindschaft abgeneigt, versenkte in einer Schreckensnacht Schlößlein und Prinzeßlein in die Tiefe. Seitdem rollt oft zu später Stunde ein stolzes Gefährt, von vier güldenen Rossen gezogen und von der Prinzessin gelenkt, vom Berge zur Müggel hernieder, aber unterwegs begegnet ihm ein Heuwagen, den vier weiße Mäuse ziehen, und zwingt ihn zur Umkehr.
Ein bequemer, schluchtenähnlicher Gang führt zur Kuppe des großen, von da in vielen Windungen zu der des kleinen Müggelberges. Unterwegs bieten sich wiederholt Rundblicke, Fernblicke von ansprechender Lieblichkeit. Links von uns grüßen das schmucke Müggelheim, die große Krampe und weiter hinaus der saphirene Seddinsee, von ihnen beiden eingeschlossen der halbinselförmige, tiefgrüne Forst. Am andern Ufer liegt auf einer Landzunge Schmöckwitz, das seeumspülte. Dann quadratmeilenweit wasserumgürtete Waldreviere, unzählige, blauglänzende, phantastisch versprenkelte Flußarme, Königs-Wusterhausen und dahinter wieder Wasser und Wald, Wald und Wasser. Am Ausgang des Seddinsees schließt der blendend gelbe Sandberg von Gosen das Bild ab, auf der rechten Seite streckt sich die Köpenicker Heide, die mit Rohrinseln geschmückte wendische Spree, ihre beiden Edelsteine Grünau und Köpenick, dann steigen Fabrikschornsteine auf, Essen und Schlote – ein Riesenheer von flatternden Rauchfahnen.
Plötzlich erweitert sich der Pfad; wir stehen auf einem von trutzig düsteren Kiefern umrahmten Waldplatze, den etwas wie feierlicher, geheimnisvoller Schauer zu durchwehen scheint. Dies ist Triglaffs Reich, hier erhob sich seine von Priestern bewachte Opferstätte. Seine drei Köpfe waren versilbert, Mund und Augen verhüllt, zum Zeichen, daß er das Weltgeheimnis zu wahren wußte und die Sünden der Erdenkinder gnädiglich übersah. In den Händen trug er einen gehörnten Mond. Nächtlicherweile, wenn ihn das Gelüst packte, die Grenzen seines Reiches zu durchsprengen, ritt er ein schwarzes Roß, das tagsüber wahrsagte.
Der Triglaffkult hielt sich verhältnismäßig lange. Aber sein Andenken ist verlöscht, gestorben in den Gemütern unseres Volkes, kein Lied, keine Sage meldet seinen Namen. Den Idolen unterdrückter Völker ist es fast immer so ergangen.
Auf der Kuppe des kleinen Müggelberges stehend, die immerhin 368 Fuß über dem Meeresspiegel liegt, erkennen wir, daß der Stock der Müggelberge, sehr im Gegensatz zu anderen märkischen Bodenerhebungen, überraschend viel Ähnlichkeit mit einem wirklichen Gebirge hat. Es mutet fast wie eine lustige Spielerei des Schöpfers an. Keine der Eigentümlichkeiten im Bau und in der Beschaffenheit mitteldeutscher Höhenzüge fehlt ihm; man könnte, wie Fontane treffend bemerkt, der Flachlandjugend unserer Stadt hier den »Gebirgscharakter ad oculos demonstrieren.« –
Nacht ist's nun. Wir stehen wieder am See. Auf der schwarzblauen Himmelsflur blühen die Sternlilien auf; einer mit Zinnen gekrönten Grenzmauer gleich starrt der Kiefernwald. Summendes Rauschen zieht durch seine Wipfel, von drüben her klingt verhallendes Glockengeläut. Und als beuge sich der begrabene Gott drunten im Wassergrund der Geistesmacht des neuen Gottes, so leis und fast melodisch verebben die Wellen. Dann, unerwartet, mit jähem Anprall, braust ein Windstoß mächtig durch die Luft, gewaltig bäumt sich die Flut auf, heult und schreit; in plötzlichem Schreck treten wir von dem unheimlichen Ufer zurück. Und es rast ein schwarzer Schatten über uns fort, es gellt ein Peitschenschlag und lautes Gewieher. Das sind keine Nebel, sind keine Windesstimmen – das ist Triglaff, der Wendengott, der auf seinem schwarzen Rosse noch einmal in die Lande fährt, bevor denn der große Tag anbricht.
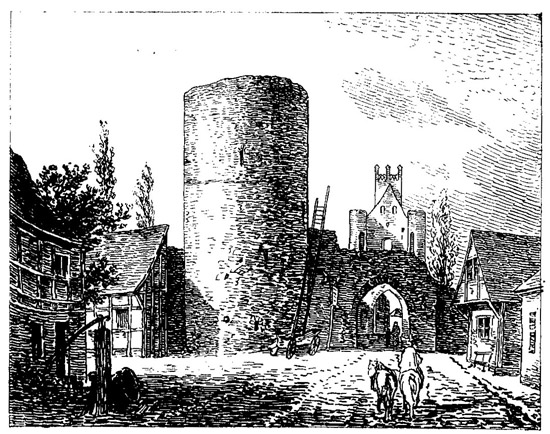
Ehemals Wachlokal der Yorkschen Jäger.
Stadttor in Mittenwalde – Stadtseite. Nach einer Handzeichnung von 1832 im Besitz des Märkischen Museums in Berlin.
Von Dr. Willy Spatz.
Im Jahre 1607 erblickte Paul Gerhardt zu Gräfenhainichen im Kurfürstentum Sachsen das Licht der Welt. Über seine Kindheit und seine Jugendjahre ist nichts Näheres bekannt. In der alten Lutherstadt, in Wittenberg, studierte er die Gottesgelahrtheit. Noch im Alter von etwa 36 Jahren befand er sich auf der Universität. Wann er in die Mark Brandenburg und nach Berlin gekommen ist, läßt sich nicht genau feststellen. Seine Geburtsstadt wurde 1637 von den Schweden in Brand gesteckt. So hatte seine alte wie neue Heimat die gleichen Kriegsdrangsale zu erdulden.
Schon hatte Gerhardt das vierzigste Lebensjahr überschritten, und noch immer war er ein stellenloser Predigtamtskandidat, der sich kümmerlich durch Erteilung von Privatunterricht in Berlin seinen Lebensunterhalt erwerben mußte. Durch einen glücklichen Zufall fand er Aufnahme im Hause des Advokaten Andreas Barthold, eines wohlhabenden, hochgeachteten Mannes, der schon im Jahre 1606 mit der Verpflichtung, Armensachen zu übernehmen, am Kammergericht zugelassen worden war.
In manchen Liedern Gerhardts klingen die trüben Erfahrungen, die er gerade in seinem besten Mannesalter zu machen hatte, nach. Dem Dichter des 119. Psalms konnte er recht nachempfinden:
Was ist mein gantzes Wesen
von meiner Jugend an
als Müh und Not gewesen,
so lang ich denken kann:
hab' ich so manchen Morgen,
so manche liebe Nacht
mit Kummer und mit Sorgen
des Herzens zugebracht.
Er ermahnt seine Seele, nicht so traurig und so betrübt zu sein, weil Gott ihm nicht soviel Glück, Gut und Ehre wie vielen anderen gibt, und tröstet sich in dem Gedanken:
Erden Guth verfällt und bricht,
Seelen Guth, das schwindet nicht.
Schwermut überschleicht ihn, doch er sieht in der Melancholie eine List des Satans, der den durch Jesus Christus ihm erworbenen Trost des Frommen zu dämpfen bestrebt ist. Mag auch noch so sehr die »tolle Welt« sich in dem Gedanken gefallen, Gott sei ihm nicht gewogen – mit berechtigtem Selbstgefühl ruft er aus:
Wäre mir Gott gram und feind,
würd er seine Gaben,
die mein eigen worden seynd,
wol behalten haben.
Und immer kommt er wieder auf den Gedanken zurück, Gott werde die Armen nicht verlassen, weise er ja doch allen Vöglein in den Wäldern ihr bescheidenes Körnlein zu:
Schickt er mir ein Creutz zu tragen,
dringt herein Angst und Pein,
sollt ich drumb verzagen?
Der es schickt, der wird es wenden,
er weiß wol, wie er soll
all mein Unglück enden.
Schon im Jahre 1648 erschienen in dem von dem musikerfahrenen Kantor an der Nikolaikirche Johann Crüger unter dem Titel Praxis pietatis melica herausgegebenen Gesangbuche die ersten Proben von Paul Gerhardts dichterischem Können.
Im März 1651 kam endlich Hilfe in der Not. Die Mittenwalder Propstei war nach dem Tode Caspar Gödes vakant geworden, und der Magistrat wandte sich an die Berliner Geistlichkeit mit der Bitte, ihm eine geeignete Persönlichkeit für die freigewordene Stelle vorzuschlagen. Das Berliner Ministerium antwortete: »Wir sind hierüber einmütig zu Rat gegangen – wiewohl wider sein Bewußt, welches wir daher auch für den aufrichtigsten und besten Dienst halten – den ehrenfesten, vorachtbaren und wohlgelehrten Herrn Paulum Gerhardt, S. S. Theol. Cand., welcher sich allhier bei uns in des Churfürstl. Brandenburgischen Kammergerichts-Advokati Herrn Andreas Bartholds Hause befindet, bester Maaßen Unseren Herren zu solchem Amte anzutragen. Wir versichern, daß wir in diesem wohlgemeinten Vorschlag Ihrer christlichen Gemeinde eine solche Person fürhalten, deren Fleiß und Erudition bekannt, die eines guten Geistes und ungefälschter Lehre, dabei auch eines ehr-, friedliebenden Gemütes und untadelhaften Lebens ist. Daher wird er auch bei Hohen und Niedrigen unseres Ortes lieb und wert gehalten und von uns allezeit das Zeugnis erhalten, daß er auf unser freundliches Ansinnen zu vielen Malen mit seinen von Gott empfangenen werten Gaben um unsere Kirche sich beliebt und wohlverdient gemacht hat.«
Gerhardt wurde zum Probst von Mittenwalde gewählt, und um die Wende des Jahres 1631 fuhr der Dichter von Berlin nach seinem neuen Wohnort ab, die große Heerstraße entlang, die von der Residenz auf Mittenwalde und die Niederlausitz zu führte.
Wenig genug war in der alten »Port gen Lusitz« von der mittelalterlichen Städteherrlichkeit übriggeblieben, denn furchtbare Leiden hatte die Stadt in den letzten Jahrzehnten durchgemacht.
Vom Jahre 1627 an hatten die Truppendurchzüge überhaupt gar nicht mehr aufgehört. Daß der Krieg den Krieg ernährt, mußte die Bürgerschaft am eigenen Leibe oft genug erfahren. Dabei war sie auch noch durch ansteckende Seuchen heimgesucht. Bereits 1628 brachten die kaiserlichen Truppen die »ungarische Krankheit« mit, im folgenden Jahre gar die Pest. Bis zum Jahre 1631 forderte diese 3000 Opfer. Vielen Mittenwaldern hatte gewiß Paul Gerhardt aus der Seele gesprochen, als er schrieb:
Wir gehn dahin und wandern
von einem Jahr zum andern,
wir leben und gedeyen
vom alten zu dem neuen
durch so viel Angst und Plagen
durch Zittern und durch Zagen,
durch Krieg und große Schrecken,
die alle Welt bedecken.
So trat Paulus Gerhardt unter den denkbar ungünstigsten Umständen sein geistliches Amt in Mittenwalde an, und doch erhielt gerade damals, als sich in ihm christlich-religiöse Gesinnung in ihrer reinsten Form offenbarte, das Werk der Christianisierung des 13. und der Reformation des 16. Jahrhunderts seinen Abschluß.
Nur ein halbes Jahrzehnt lang hat er dort gewirkt.
Aber so kurz der Aufenthalt Gerhardts in der »Port gen Lusitz« auch war, für die Geschichte des deutschen Kirchenliedes hatte er doch höchste Bedeutung. Denn es darf als sicher gelten, daß ein großer Teil seiner schönsten Lieder, unter ihnen »Befiehl du deine Wege«, dort entstanden ist.
»Die Stätte, die ein guter Mensch betrat, ist eingeweiht«, dieses Wort aus Goethes Tasso hatte auch für Mittenwalde Geltung. Noch hat sich das Städtchen mit seinem schönen alten Tor und dem friedlichen Mühlrade an der malerischen Nottebrücke ein charakteristisches Gepräge bewahrt. Über York, der in der »Franzosenzeit« hier die Jäger kommandierte, und den Kronprinzen Friedrich, an dessen kurze Rast in Mittenwalde auf seiner Fahrt zum Gefängnis eine Gedenktafel erinnert, schweifen die Gedanken rückwärts in die Zeit des »Großen Krieges«. Die Erinnerung an Paul Gerhardt steigt lebendig in uns auf. Und wenn man von den hinteren Fenstern der Propstei in den lang sich hinziehenden, schmalen Pfarrgarten hinabschaut, fragt man sich unwillkürlich, ob hier nicht vielleicht dem Dichter beim abendlichen Gange die Worte »Nun ruhen alle Wälder« auf die Lippen gekommen sind. Die Umgebung der Stadt – weite, meilenweit sich hinziehende Felder, am Horizont ein Kranz dunkler Wälder – klingt so recht an die Grundstimmung dieses Liedes an.
Bilder aus der Vergangenheit des Kreises Teltow.
Berlin, Rob. Rohde
Von Prof. Dr. F. Solger.
Wenn wir von Königswusterhausen nach Krummensee wandern, dann biegen wir von der Chaussee bei dem Dörfchen Schenkendorf ab, und am Ausgange des Dorfes winken uns zwei hohe Ziegelhäuser von ihrer Front in großen Lettern den fröhlich-ernsten Bergmannsgruß »Glück auf!« zu. Aber vergebens sucht unser Ohr den Klang der geschäftig arbeitenden Fördermaschine, vergeblich unser Auge den rauchenden Schlot des Schachtes, an den sich ein reges Bergmannsleben knüpfen könnte. Tot liegen die Trümmer einstiger Bergwerksanlagen verstreut, und nur die tiefen Mulden, die die herabgebrochenen Erdmassen in dem ehemaligen Grubengebiet geschaffen haben, erinnern uns, daß man hier mit der Erde gerungen hat, um ihr verborgene Kohlenschätze zu entreißen. Es sind die Überreste der ehemaligen Braunkohlengrube »Zentrum«, vor denen wir stehen, und mehr als eine Erinnerung an fehlgeschlagene Hoffnungen und immer erneute unermüdliche Arbeit knüpft sich an diese Trümmer. Die Jahrzehnte, während deren der Bergbau hier bestand, sind unausgesetzter Kampf mit den ungewöhnlich schwierigen Wasserverhältnissen und mit unglücklichen Zufällen gewesen. Die Grube lohnte sich schlecht, so daß man das Unternehmen entmutigt aufgab. Aber wenden wir uns von den Menschenschicksalen, die sich an diese Stelle knüpfen, der Kohle selbst zu, die hier in der Tiefe ruht. Denn als einzige Braunkohlengrube des Kreises Teltow bietet Schenkendorf auch für den Naturfreund ein engeres heimatkundliches Interesse.
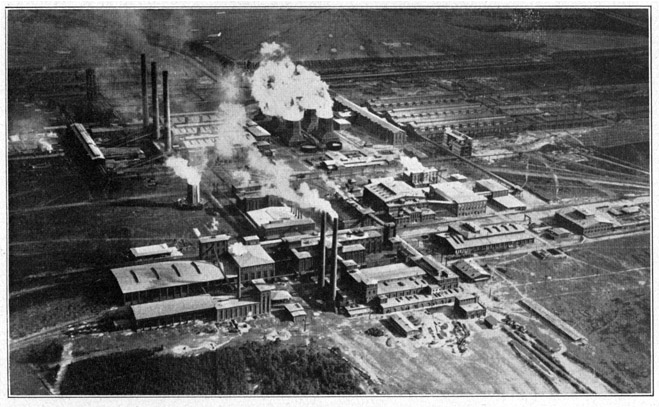
Großkraftwerk Klingenberg an der Oberspree
Was sind Braunkohlen? Wie entstanden sie, wann entstanden sie? Warum sind sie von anderen Schichten bedeckt, und warum treten sie gerade hier auf und nirgends sonst im Gebiete des Kreises? Diese und manche andere Fragen drängen sich auf, und wenn wir sie auch nicht alle lösen können – welche Frage in der Natur ließe sich bis zu ihren letzten Gründen lösen? – so mögen wir doch über einige von ihnen näher nachdenken.
Zuerst: Was sind Braunkohlen? Wir sind gewöhnt, sie fast nur noch in Gestalt der Preßkohlen zu sehen. Da können wir nicht viel mehr unterscheiden, als daß es auf dem Bruche eine mattdunkelbraune, ziemlich weiche Masse ist, die angezündet brennt, aber nicht unerhebliche Mengen Asche zurückläßt. Der Chemiker wird uns erzählen, daß die Brennkraft der Braunkohle durch nahezu dieselben Kohlenstoffverbindungen bedingt wird, die wir im Torfe finden, und vollends, wenn wir in der Braunkohle noch deutlich unterscheidbare Pflanzenreste, vor allem Holzstücke – allerdings gleichfalls in braune, kohlige Masse umgewandelt – finden, dann dürfen wir nicht mehr zweifeln, daß die Braunkohle, ebenso wie wir es heute noch bei der Entstehung des Torfes beobachten können, aus vermoderten – wir können geradezu sagen: vertorften – Pflanzenresten besteht. Lange Zeit stritt man darüber, ob auch die Anhäufung der Pflanzenreste, aus denen die Kohle entstand, ebenso erfolgte, wie in unseren Mooren, d. h. ob die Pflanzen an Ort und Stelle wuchsen, abstarben und vermoderten, von neuen Pflanzen überwuchert wurden, die wieder abstarben usw., oder ob sie zusammengeschwemmt wurden, etwa so wie man das im Mündungsgebiet der großen nordamerikanischen Ströme beobachten kann. Wir dürfen heute sagen, daß solche Zusammenschwemmungen zwar zu allen Zeiten der Erdgeschichte vorgekommen sein mögen, auch mögen hin und wieder Kohlenlager so entstanden sein; aber für die überwiegende Anzahl unserer Kohlenflöze ist die ersterwähnte Entstehung sichergestellt, und gerade im Rahmen unserer Provinz Brandenburg findet sich einer der besten Beweise für diese Auffassung in den Braunkohlentagebauen von Großräschen und Senftenberg. Da gräbt man die Wurzelstümpfe der Bäume, aus denen die Kohle entstand, noch aus ihr heraus, und zwar so aufrecht stehend, wie sie wuchsen. Solche Baumstümpfe, von denen sich ein besonders schöner neuerdings im Märkischen Museum befindet, stehen unregelmäßig zerstreut in allen Schichten der Kohle von der Sohle bis zur Oberfläche, und mit großer Wahrscheinlichkeit dürfen wir für alle größeren Braunkohlenlager Brandenburgs die gleiche Erklärung geben: Sie sind hervorgegangen aus Waldmooren, in denen die Bäume allmählich von der entstehenden Torfmasse umwachsen wurden, abstarben, und bis auf die Wurzelstümpfe verwesten. In den ungeheuren Zeiträumen, die seitdem verstrichen sind, hat sich dieser Torf dann in Braunkohle umgewandelt.
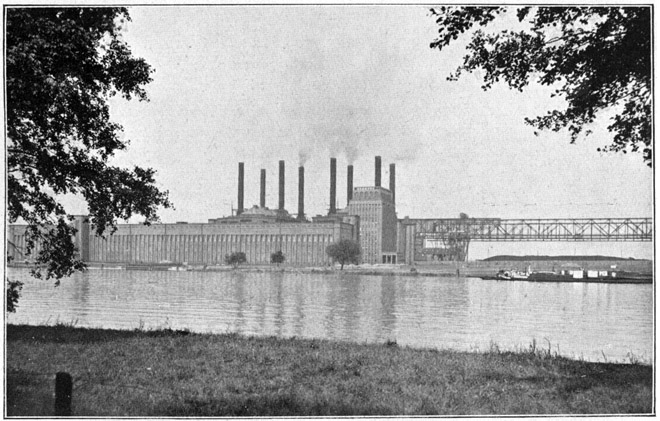
Lautawerk bei Senftenberg
Das größte deutsche Aluminiumwerk mit Kraftwerk der Elektrowerke verbunden
An der Ostküste von Nordamerika finden wir noch heute Moore von großer Ausdehnung, in denen wir den gleichen Vorgang sich abspielen sehen. Da bilden sich vor unseren Augen Lager, die in kommenden Jahrmillionen einmal Braunkohlenflöze ähnlich den unsrigen ergeben werden. Auch die Bäume, die in jenen Mooren leben, sind vielfach dieselben, die wir in unserer Braunkohle finden. Vor allem ist die Sumpfzypresse hervorzuheben, ein Baum, der wie unsere Lärche allwinterlich die hellgrünen Nadeln abwirft, und der in seinem Bau eigentümlich an das Leben im Moor angepaßt ist. Auf einem breiten Wurzelfuße erhebt sich der verhältnismäßig schlanke Stamm. Die Wurzeln spreizen sich gleichsam auseinander, um dem Baum den nötigen Halt zu geben in dem schwankenden Moorboden. Eine Pfahlwurzel kann sich nicht bilden, da die Wurzelfasern Luft brauchen, und der dichte, nasse Torfuntergrund keine Luft durchläßt. So sind die Wurzeln gezwungen, den Halt, den sie in der Tiefe nicht finden können, in der Breite zu suchen. Auch für unsere Moorbäume ist übrigens das Fehlen einer Pfahlwurzel bezeichnend. Bei den Sumpfzypressen, die an der Bildung unserer Braunkohlen so starken Anteil haben, zeigt sich der Lufthunger der Wurzeln noch in anderer Weise an solchen Stellen, die regelmäßigen Überschwemmungen ausgesetzt sind. Die nordamerikanischen Moore geben uns schöne Beispiele dafür. Die Wurzeln, die während der nassen Jahreszeit unter Wasser stehen, treiben da stumpf endigende Sprossen nach oben, sogenannte »Knie«, die auch bei Überschwemmung noch über das Wasser hinausreichen und die Verbindung der Wurzel mit der Luft aufrechterhalten. Von anderen Pflanzen, die wir in unseren Braunkohlen noch erkennen können, sind der Haselstrauch und die echte Kastanie hervorzuheben und eine Sequoia, ein naher Verwandter der riesigen Mammutfichten von Kalifornien, der neben der Sumpfzypresse damals häufig war.
Aber wenn auch jene nordamerikanischen Moore in ihrem Baumwuchs den Mooren am ähnlichsten sind, aus denen unsere Braunkohlenlager entstanden, so brauchen wir doch nicht so weit in die Ferne zu schweifen, um die typischen Erscheinungen der Torfbildung kennen zu lernen. Die Luchgegenden Brandenburgs, die seine sumpfigen Niederungen so häufig ausfüllen und jahrhundertelang fast unüberschreitbare Grenzlinien gebildet haben, zeigen uns, nur aus anderen Pflanzen zusammengesetzt, im Grunde dasselbe Bild, und der Torf, der in ihnen sich bildet, würde nach Jahrmillionen vielleicht eine ebenso gute Kohle liefern, wie heute manches Braunkohlenlager.
Von Schenkendorf brauchen wir ja nicht weit zu wandern, um in Moorgegenden zu kommen. Die Niederung, die vom Notte- und Zülowkanal durchflossen wird, ist reich an Moorwiesen. Sie bildet einen Teil der sumpfigen Niederung, die zwischen Königswusterhausen und Potsdam Dahme und Havel verbindet, im Osten von den Gewässern der Notte, im Westen von denen der Nuthe durchzogen. Solche moorigen Täler sind in der Mark Brandenburg zahlreich vorhanden, in früheren Zeiten bildeten sie mit ihrem unsicheren Sumpfboden schwere Hindernisse für den Verkehr, um so bessere Stellen aber für die Verteidigung. Aus beiden Gründen sind sie die natürlichen Grenzen der kleinen Ländchen gewesen, aus denen die Mark erst im letzten Jahrtausend zusammengewachsen ist. So bildete die Nuthe-Notteniederung einst die Südgrenze des »Hohen Teltow«, dessen Name auf den ganzen Kreis später übergegangen ist, und das Denkmal am Zingelberge bei Wietstock erinnert uns daran, daß auch die preußischen Feldherrn im Jahre 1813 in den Übergängen über diese Moore bei Thyrow und Wietstock die gegebenen Verteidigungspunkte Berlins erblickten, und daß sie die Schlacht von Großbeeren vielleicht hier geschlagen hätten, wenn ihr schwedischer Oberfeldherr nicht zu zaghaft dazu gewesen wäre.
Inzwischen haben die Nuthe- und die Nottesümpfe unter der Hand des Menschen ihr Aussehen wesentlich verändert. Kanäle haben die Niederung entwässert und ihr so den Moorcharakter zum großen Teil genommen, und dadurch, daß die so gewonnenen Wiesen immer wieder gemäht oder vom Vieh abgegrast werden, wird das Aufkommen der Bäume gehindert, das sonst der Gegend einen ganz anderen Ausdruck geben würde.
Überließe man solche Wiesen sich selbst, so würde nach einigen Jahrzehnten die Grasflur von Erlen, Birken und anderen Bäumen unterbrochen sein und schließlich ein kleines Wäldchen, ein Erlen- oder Birkenbruch sich aus ihr gebildet haben, wie wir dergleichen auf kleineren Moorflächen so häufig in unserer Mark finden, z. B. am Rangsdorfer See oder an nassen Stellen des Grunewalds. Das Moor ist an nasse Stellen gebunden, und diese Nässe ist die Hauptbedingung für die Bildung des Torfes, um dessentwillen uns hier die Moore in erster Linie interessieren. Wächst ein Wald auf trockenem Grunde, so fallen die Laubblätter im Herbst ab und bedecken den Boden. Sie bleiben hier wohl einige Jahre liegen, und so bedeckt meist eine dünne Laubschicht dauernd den Untergrund. Aber in diesem Laube leben eine Menge niederer Tiere, vor allen Dingen aber Pilze, die beständig an der Zerstörung der Blättermasse arbeiten. So können wir schon mit dem Stock leicht die Blätterschicht auf dem Waldboden durchstoßen und finden, daß der darunter liegende Sand nur geringe pflanzliche Beimischungen hat. Die Blätter gehen eben bei der Verwesung durch die Pilze, ähnlich wie beim Verbrennen, hauptsächlich in luftförmige Stoffe über, und es bleibt nur wenig festes Material zurück, das sich dauernd dem Boden beimischt. Anders auf wasserdurchtränktem Boden. Das Wasser verwehrt der Luft den Zutritt und raubt den Pilzen, abgesehen von der allerobersten Schicht, die Möglichkeit, sich in den abgestorbenen Pflanzenmassen einzunisten. So kann keine eigentliche Verwesung stattfinden, die Pflanzenteile zersetzen sich nur langsam und unvollkommen, und es häuft sich Schicht auf Schicht, bis wir schließlich ansehnliche Lagen eines Stoffes vor uns haben, der fast ganz aus den abgestorbenen Resten der auf dem Boden wuchernden Pflanzen besteht, sei es von Gräsern, Heidekräutern, Moosen oder Bäumen. Diese unvollkommen zersetzten Pflanzenmassen nehmen bald eine dunkelblaue Farbe an, die zunächst sehr deutliche Zusammensetzung aus Fasern verschwindet mit der Zeit, und in den tieferen, d. h. also älteren Lagen entsteht schließlich ein schwarzer, erdiger Stoff, der nach dem Trocknen leicht brennt. Das ist der Torf. Preßt man solchen Torf stark zusammen und erwärmt man ihn gleichzeitig dabei, so kann man daraus »Preßkohlen« herstellen ganz wie aus der Braunkohle; sie sind auch im Äußeren ihrer Masse nach schwer von Braunkohle zu unterscheiden. Was wir hier durch Hitze und Druck in wenigen Minuten künstlich nachahmen können, das vollzieht sich im Laufe ungeheurer Zeiträume auch ohne solche Gewaltmittel allmählich in der Natur, und auf diesem Wege ist aus ursprünglichen Torfbildungen die Braunkohle entstanden, die der Bergmann heute aus dem Boden gräbt. Diese Umwandlung geht aber sehr langsam vonstatten. Wir kennen Moore, von denen wir sicher sind, daß sie sich bildeten, als zum letztenmal das Eis der großen Eiszeit unsere Heimat bedeckte. Viele Jahrtausende müssen seitdem verflossen sein; aber doch ist der Torf, den wir in solchen untergegangenen Mooren der Eiszeit finden, äußerlich noch kaum verschieden von dem unserer heutigen Moore. Selbst diese lange Zeit hat noch nicht genügt, Braunkohle aus ihm zu machen. Unverhältnismäßig viel längere Zeit muß vergangen sein, seitdem in unseren Gegenden die Sumpfzypressen und alle jene anderen Bäume wuchsen, deren Reste wir heute in den Braunkohlen wiederfinden. Wir tun an diesem Beispiele einen kurzen Blick in die Größe der Erdgeschichte gegenüber der Geschichte des Menschen. Rechnet diese nach Jahrhunderten, so muß jene nach Jahrmillionen gemessen werden.
Teltower Kreiskalender. Berlin, Rob. Rohde.
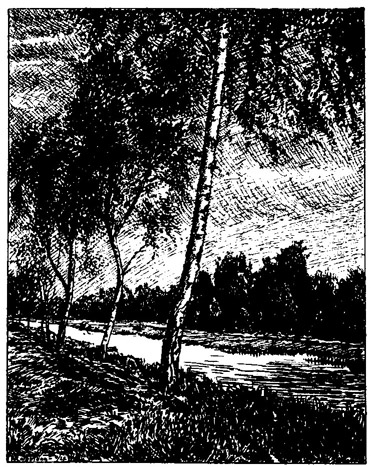
Am Nottekanal bei Königswusterhausen.
Wusterhausen im Schenkenländchen ist in Ehren alt und grau geworden. Ursprünglich ein wendisches Dorf Wustrow, diente es später mit seiner Burg als Grenzschutz wider die Lausitz, wechselte öfter den Besitzer und kam 1683 in die Hand des Großen Kurfürsten, der es für den Kurprinzen Friedrich erwarb. Glanz, Größe und Berühmtheit aber verdankt es allein dem Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. In den tiefen, wildreichen Forsten der Umgegend konnte er nach Herzenslust seiner Jagdlust frönen; im Laufe der Jahre erlegte er hier mit eigener Hand an 25 000 Rebhühner. Anderes Wildpret fand sich in Massen, besonders Sauen und Keiler, von denen das Schenkenländchen wimmelte, wurden während weniger Jagdwochen tausendweis zur Strecke gebracht. Friedrich Wilhelm liebte Wusterhausen vor allen anderen Orten. Seine Streifereien durch Wald und Sand, seine unerwarteten Besuche in Bauer- und Bürgerhäusern, wo er sich zu Tische lud und manchmal – aber freilich nur manchmal! – einfache Mahlzeiten königlich bezahlte, sind noch heute in aller Munde. In der neuen Mühle bei Wusterhausen, erzählt die Sage, tischte ihm einst die Müllersfrau vorzügliches Rührei mit Speck auf, und so gut behagte das Gericht dem Gaumen des Königs, daß er dem Müller einen Wunsch freistellte. Der war denn auch nicht blöde und bat um Anlage einer Schleuse, die ihm zum Betriebe seines Gewerbes unentbehrlich schien. Obgleich der sparsame Fürst eine solche Forderung nicht erwartet hatte und seine Voreiligkeit bereuen mochte, gab er doch seinem Herzen einen Stoß, ließ die Schleuse bauen und stellte als guter Kaufmann nur die Gegenbedingung, daß der Müller und seine Erben auf ewige Zeiten zwei Hunden der königlichen Meute Kost und Wohnung gewähren müßten. So geschah es denn auch. Seit mehreren Jahrzehnten ist diese Verpflichtung allerdings abgelöst.
Solche Geschichten kennzeichnen besser als Urkunden das Wesen des Soldatenkönigs. Wendischwusterhausen wuchs unter seinem persönlichen Regiment, im Schatten seines Krückstockes, zu einem hübschen Städtchen heran; er schmückte es mit Baumgängen und neuen Gebäuden, gab ihm den Ehrennamen »Königswusterhausen« und baute die alte Burg, unter Beibehaltung ihres Rundturmes und ihrer viereckigen Form, zu einem Jagdschlosse aus. Zwei Monate des Jahres pflegte er hier zu verweilen, der Jagd und weidmännischen Festen zu leben. Besonders feierlich wurden der Tag des heiligen Hubertus und der Jahrestag der Schlacht bei Malplaquet, wo er sich seine Sporen geholt hatte, begangen. Dann hallte das Schloß von den rauhkräftigen Scherzen der Jagdkumpane und von dem Gelächter des berühmten Tabakskollegiums wider. Im Schloßhofe ward die Jagdbeute aufgeschichtet, mit der man nachher, sobald die Hunde ihr Jagdrecht empfangen hatten, Berlins Bürgerschaft beglückte; ein Wildschwein kostete, je nach Güte und Alter, bis zu sechs Taler, jeder gute Untertan mußte kaufen. Im Vorhofe des Schlosses saß der König an schönen Sommertagen, von zwei Bären mit abgehauenen Pranken bewacht, seine Pfeife voll scharfen Kanasters rauchend, und examinierte unglückliche zitternde Beamte. Hier errichtete er aus besonders großen Treibern seine Jagdgarde, die er selber einexerzierte und die sich später zu dem historischen »Regiment der langen Kerle« auswuchs. Hier im Schlosse wand er sich, früh alt geworden, unter den schlimmsten Gichtqualen und malte dazu jene bekannten Bilder, mit der Umschrift: Pinxit in tormentis.«
Jagdschloß Wusterhausen erhielt durch ihn Charakter und Stimmung, so im derben Scherz wie im finstern Ernst. Auf Jagdschloß Wusterhausen unterzeichnete er am 1. November 1730 das Todesurteil Hans Hermann Kattes, als der erste und einzige Hohenzoller, der einen Gerichtsspruch nicht barmherzig milderte, sondern überstreng verschärfte.
Kronprinz Friedrich war schon im Ausgang des Jahres 1729 entschlossen gewesen, der unerträglichen, mit Hohn gebeizten Tyrannei des Vaters zu entrinnen. Der König ließ keine Gelegenheit, sich an dem Sohne zu reiben, ungenutzt vorüber und hatte sich in seltsam wilden Haß gegen den »Flötenspieler Fritz« hineingeredet. Gewohnt, jeder Laune die Zügel schießen zu lassen, trieb er den empfindlichen Jüngling mit seinen Spöttereien zur Verzweiflung. In Darmstadt sagte er ihm sogar ins Gesicht: »Ist Er denn immer noch nicht fortgelaufen? Ich hatte Ihn längst in Paris geglaubt.« Der Prinz zögerte nun nicht länger, die Fahrt nach England anzutreten. Alle Einzelheiten des Fluchtplanes waren vorgesehen. Alles versprach besten Erfolg, da wollte es das Schicksal, daß Friedrichs entscheidender Brief an seinen Mitverschworenen Katte irrtümlicherweise in die Hände eines Rittmeisters desselben Namens geriet. Der auf den Tod erschreckte Mann übergab das Schreiben natürlich sofort dem König, dessen Zorn keine Grenzen kannte. Der Kronprinz und Katte wurden verhaftet, der Prinz unter starker Bedeckung nach Wesel gebracht und am 12. Oktober dem Monarchen vorgeführt. »Warum hat Er ausreißen wollen?« donnerte ihm der Ergrimmte entgegen. – »Weil Sie mich nicht wie Ihren Sohn, sondern wie einen Sklaven behandelt haben.« – »Ich habe keinen Sohn mehr. Er ist nichts als ein feiger Deserteur, der keine Ehre im Leibe hat.« – »Ich habe soviel Ehre wie Sie, und ich habe nichts getan, was Sie an meiner Stelle nicht auch getan hätten!« – Sinnlos vor Zorn, riß der König den Degen aus der Scheide und wollte den Kühnen erstechen. Der Generalmajor von der Mosel aber sprang entschlossen vor den Prinzen, ihn mit seinem Leibe deckend, und rief: »Sire, durchbohren Sie mich, aber schonen Sie Ihres Sohnes!«

Flötenkonzert Friedrichs des Großen
nach einem Gemälde von Adolph von Menzel
Das efeuumsponnene, unter Linden und Platanen versteckte Schloß Wusterhausen, wo die Katastrophe in der Katte-Tragödie eintrat, schaut düster und gespenstisch drein im trüben Lichte dieses Ereignisses. Ein übermäßig behaglicher Aufenthalt war es wohl auch vorher nicht. Die Schwester Friedrichs des Großen, die Markgräfin von Baireuth, eine zwar recht boshafte Beobachterin, schildert es uns mit der ihr eignen Vorliebe für die Karrikatur folgendermaßen: »Das Gebäude war von einem (Erdwall und einem Graben umgeben, dessen schwarzes und fauliges Wasser dem Styxe glich. Meine Schwester Charlotte und ich hatten für uns und unser ganzes Gefolge nur zwei Zimmer oder vielmehr zwei Dachstübchen. Um zehn Uhr morgens gingen meine Schwester und ich zu der Mutter, wo wir den ganzen Morgen verseufzen mußten, bis endlich die Tafelstunde herankam. Wie nun auch das Wetter sein mochte, wir aßen zu Mittag immer im Freien unter einem Zelte, das unter einer großen Linde aufgeschlagen war. Bei starkem Regen saßen wir, da der Platz vertieft war, bis an die Waden im Wasser. Wir waren immer 24 Personen zu Tisch, von denen dreiviertel sich mit dem bloßen Geruch begnügen mußten, denn es wurden nie mehr als sechs schlecht bereitete Schüsseln aufgetragen, und zwar so schmal zugeschnitten, daß ein nur halbwegs hungriger Mensch sie mit vieler Bequemlichkeit allein aufzehren konnte.« Theodor Fontane glaubt die Wahrheit dieser Behauptung bezweifeln zu müssen, sowenig er sonst den Geiz des Königs leugnet. In der Tat klingt die Auslassung der am Magen leidenden Prinzessin mindestens übertrieben, wenn man sie mit anderen Berichten über die Tafel des Königs vergleicht, der selbst ein sehr starker Esser war und seine Dienerschaft nicht hungern ließ, sondern beispielsweise alles von ihm geschossene Geflügel in die königliche Küche ablieferte, so daß man oft mit dem besten Willen keine Verwendung dafür hatte. »Nach aufgehobener Tafel«, fährt die Prinzessin in ihrer Schilderung fort, »setzte sich der König in einen hölzernen Lehnstuhl und schlief; bis er aufwachte, mußte ich arbeiten, dann aber zur Mutter gehen und ihr vorlesen. Der König kam auf einige Augenblicke zu uns, ging aber gleich hernach in die Tabagie, aus der er zur Abendbrotzeit zurückkehrte. Auch vom Nachtmahl standen wir meist hungrig auf. In Berlin mußte ich das Fegefeuer, in Wusterhausen aber die Hölle erdulden.«
Nach dem Tode Friedrich Wilhelms I. blieb das Schloß, als ein Ort, der böse Erinnerungen weckte, lange Zeit gemieden. Niemand kümmerte sich darum, daß es zusehends verfiel; man benutzte es bald zu Soldatenquartieren und Lazaretten, bald zur Unterbringung von Registraturen und Bezirkskommandos. Erst Kaiser Wilhelm I. erbarmte sich der historischen Stätte und ließ sie pietätvoll wieder herstellen. Alle Andenken an den Soldatenkönig wurden sorgsam aufbewahrt; die zum Teil auf Schloß Cossenblatt entstandenen Gemälde, Darstellungen von Fuchsprellungen und Parforcejagden; das Pesnesche Bild des Hofnarren Gundling, der keineswegs ein blitzblöder Tropf, sondern ein gebildeter und witziger Mann war, in dieser Umgebung aber, unter ständigen geistigen wie körperlichen Mißhandlungen, halb zum Idioten herabsank; der steinerne Waschtrog des Königs mit dem ungeheuren Abzugstöpsel – dies alles und noch viele andere Kuriositäten sind erhalten. Jagdtrophäen aus drei Jahrhunderten, Feuergewehre und »Saufedern«, eine Nachbildung des Geweihs, das der von Friedrich III. bei Neubrück erlegte Sechsundsechzigender trug, und das gegen eine Kompagnie Riesengrenadiere an August den Starken von Sachsen vertauscht wurde; dann der im littauischen Urwald gemachte unheimliche Fund eines von einem Eichstamm völlig umwachsenen Hirschschädels mit prächtigem Geweih. Alle diese Sehenswürdigkeiten und der Gedanke an ihre Eigentümer erregen ein gewisses Interesse. Hohe Teilnahme aber flößt bei einer Durchwanderung des Schlosses der Raum ein, in dem sich das berühmte Tabakskollegium zu versammeln pflegte. Noch steht der große Kneiptisch mit den mächtigen Tabakstellern, den Tonpfeifen und Kohlenpfannen breitbeinig da, man findet noch die schweren Humpen und Glasgefäße der alten Zeit, die bequemen Schemel der Zechgenossen. Schnell zaubert die Phantasie eins der Festmähler wieder herauf, die von der geistreichen Liederlichkeit und der galanten Frivolität französischen Hoflebens so grell abstachen. Um den mit Zeitungen bedeckten Langtisch sitzen der König und seine Minister, Generäle und Gäste; schweres Ducksteiner Bier schäumt in den Krügen, und wer das Rauchen nicht verträgt, muß wenigstens eine von den langen Tonpfeifen in den Mund nehmen. Dem König galt es alleweil als ein Hauptspaß, fremde Würdenträger bezecht zu machen; heute abend hat er es auf den kaiserlichen Gesandten, Herrn von Seckendorf, abgesehen, der kaum noch die Augen offenzuhalten vermag. Fackelglanz erhellt nur matt das von blauem Tabaksqualm erfüllte Gemach, die Pfeifen dampfen, die Kohlen glühen, und in das laute Geklirr und Geklapper der Krüge dröhnt des Königs Stimme.
Die alten Haudegen mit den breiten Schmarren im Gesicht, die im spanischen Erbfolgekrieg den Franzmann weidlich geklopft oder unter Eugen Wider den Türken gefochten, Stadt und Festung Belgrad erobert haben, lauschen gespannt der derben Schnurre, die Se. Majestät mit Behagen vorträgt. Wüstes Gelächter donnert hinterdrein. Dann springt das Gespräch plötzlich auf politische Fragen über, in die man sich ernsthaft vertieft; zuweilen fällt der Monarch hier seine Entscheidungen. Ist man des trockenen Tones wieder satt, so muß Gundling, der »Freiherr mit 16 Ahnen und Präsident der Akademie der Wissenschaften«, herhalten; jeder übt seinen Witz an ihm, nicht zum mindesten sein unsauberer Nebenbuhler, der Possenreißer Faßmann. Wenn der gelehrte Herr nicht genug witzige Sachen vorzubringen weiß, holt er sich wohl von dem einen oder dem andern einen gelinden Stoß oder Schlag. Sind der Gesellschaft die »geistigen« Genüsse über, dann packt man sich zum Ringkampf oder gibt sonst Proben körperlicher Kraft, wobei es sich herausstellt, daß die Märker den Vergleich mit August dem Starken nicht zu scheuen brauchen. An Schlägereien zwischen Gundling und Faßmann, die sich Stücke glühender Kohle ins Gesicht werfen, fehlt es selten; der König pfeift und klatscht dazu, am Ende riskiert er mit dem alten Dessauer einen flotten Tanz. Inzwischen ist die Tabakswolke immer dichter geworden; schon liegt ein Teil der Kumpanei sanft betäubt an der Schulter des Nachbarn; biermüde stützt man die Häupter auf den Tisch, und selbst Gundlings Puppentheater mit Kanonenschlägen und Feuerregen weckt die Schläfer nicht mehr. Taumelnd trennt man sich endlich und sucht sein enges Kämmerchen im Schlosse auf. Gundling aber ahnt nicht, daß man ihm als besondere Überraschung einen von den riesigen Bären aus dem Schloßhof ins Bett gelegt hat.
Ein seltsamer Ort, ein seltsamerer Fürst. Aber er war der rechte Mann für seine Zeit. Er »stabilierte« das Hohenzollernsche Königtum wie einen rocher von bronze; er eroberte durch Kolonisation, landwirtschaftliche Unternehmungen, unermüdliche Kämpfe mit dem Luch und Bruch Provinzen im Frieden. Ohne seine derbzufassende Hand, ohne seine Sparsamkeit, ohne ihn und das von ihm geschaffene Heer, den von ihm aufgehäuften Kriegsschatz wäre sein Nachfolger nicht Friedrich der Große, Preußen nicht die deutsche Vormacht geworden.
Angenehm war die Witterung eben nicht zu nennen. Offenbar wußte der Himmel nicht recht, ob er ein Gewitter oder einen Landregen niedersenden sollte; so entschied er sich denn für beides. Zernsdorf am Krüpelsee lag in dichtem Nebeldunst, und selbst der Kirchturm von Cablow hatte zu kämpfen, um sich dem Qualm zu entringen. Hinter Cablow, wo die Dahme alle Lust am Seenbilden verliert und als schmales Fließ zwischen Wiesen dahinschleicht, hinter Cablow beginnt die echte Spreewendei. Bis an den Rand des mageren Kiefernwaldes heran wuchert Schilf und Ried; seltener sind üppige Grasplätze, Kornfelder noch seltener. Der Fluß schlängelt sich in weitem Bogen durchs Revier; da und dort begrenzt Erlengebüsch das Ufer und zeichnet seine Grenzen schärfer ab. Und unvermittelt erhebt sich dann ein Fischerdörfchen mit kargen Gärten, dürftigen Obstbäumen und zahllosen Aalkästen. Im Hintergrunde taucht wieder die hungrige Kiefernheide auf, die einen immer von neuem zu nutzlosem Nachdenken darüber zwingt, wie das darin befindliche Wild es wohl anfängt, sich auf redlichem Wege zu ernähren. Und doch sind sogar die Gemeindejagden in dieser Gegend begehrt. In den niederen Wirtshäusern trifft man sehr häufig weidgerecht ausgerüstete Berliner, die mit schrecklicher Stimme von ihren Abenteuern im grünen Tann erzählen und den Förstern Rache schwören. Besteht doch bei ihnen die fixe Idee, daß die Förster ihnen das Wild vergrämen, das Wild, welches nach meiner festen Überzeugung gar nicht vorhanden ist. Einer, den wir in Gussow begrüßen durften, hatte in richtiger Würdigung der brandenburgischen Nahrungsverhältnisse an der Grenze seines Reviers, da, wo es mit dem staatlichen zusammenstößt, Lupinen anfahren lassen und sich dann, von kapitalen Böcken träumend, auf den Anstand gesetzt. Er wähnte, daß die hungrigen Waldbewohner scharenweis heranstürmen, sich blindlings auf die leckeren Lupinen stürzen und ihm so ins Gewehr laufen würden. Der staatliche Förster, der seine mühevoll gehegten Schutzbefohlenen und ihren Appetit wohl kennen mochte, hatte nun nichts Eiligeres zu tun, als ruhelos an der Grenze hin und her zu rennen, Wagenladungen von Patronen zu verknallen und so seine heißhungrigen Zöglinge zu verscheuchen. Fluchend lag der Berliner zwei Tage lang auf der Lauer, dann verkaufte er die Lupinen zur Hälfte des Selbstkostenpreises ...

Die Dubrow.
Für Säugetiere, ganz gleich, ob sie dem Menschen Untertan sind oder frei durch Wald und Heide streifen, ist die Wendet wirklich nicht der geeignete Entfaltungsort. Desto besser gedeihen hier die Fische. Einer von uns fuhr gelegentlich ohne Steuermann über den Dolgensee. Plötzlich haut ihm jemand eins über den Rücken, daß er zusammenfährt und sich fluchend nach dem Attentäter umdreht. Es war kein jemand, es war ein junger Wels, der vor lauter Übermut Freiübungen in der Luft veranstaltet hatte. Vielleicht paßte ihm auch die bunt zusammengewürfelte Gesellschaft in der Tiefe des Dolgensees nicht mehr. Ein Schlag mit der Paddel machte seiner sozialen Unzufriedenheit ein Ende. – Berliner Angler können keine besseren Jagdgründe finden als hier. Trotz der gewaltigen Fischwehre bei Dolgenbrodt, mit deren Hilfe man von Zeit zu Zeit die ganze geschuppte Versammlung aufhebt, mindert und erschöpft sich die Fülle nicht. Der ins Wasser versenkte Schatz, von dem jede Großmutter zu berichten weiß und der die Phantasie des Fischervölkchens erhitzt, ist wirklich vorhanden. Man fördert ihn mit Netzen zutage.
Hinterm Dolgensee verändert die Landschaft ihr Gesicht. Nicht mehr grüßt über weite Wiesenflächen fort der Kirchturm des nächsten Dörfleins. Föhrenwaldungen, die dichter ans Ufer treten, schieben sich dazwischen, und die Dahme hört auf, närrische Zickzacklinien durchs Gelände zu ziehen. Sie beginnt wieder ihr Lieblingsspiel und bildet weite Seen, die durch schmale umgrünte Wassergräben verbunden sind. Jetzt wird es ganz still um uns. Die Dörfer verschwinden, die Wiesengründe schrumpfen ein, knorrige Kienen, prächtige alte Burschen, halten Hochwacht am Ufer. Tiefe, schier sagenhafte Einsamkeit, Weltferne sondergleichen. Über uns ziehen Reiher ihre Kreise, und zuweilen trottet eilfertig durchs dürftige Unterholz ein Rudel Wildschweine. Das ist die Dubrow, das kaiserliche Jagdrevier, von dem früher alljährlich die für die Parforcejagden bestimmten Keiler nach der Saubucht im Grunewald geschafft wurden. Grasbewachsene Höhen hüben und drüben, auf denen schmucke Erlen lustig ihre zierlichen Kronen wiegen; dahinter der ernste, grünschwarze Kiefernwald und unten die schweigende Flut. O welch ein Platz für sommerliche Träume, die wie leichte weiße Wölkchen durch das unendliche Blau segeln! Heute greift der Wind etwas fest zu, und über unserem Lagerplatz steht Regen, sogar sehr viel Regen. Er läßt denn auch nicht lange auf sich warten. Aber die Erlen bieten hinreichenden Schutz, und was sie an Feuchtigkeit durchlassen, das fängt der Mantel auf. Versagt schließlich auch der, dann wird eine neue Pfeife angezündet und der uralte Trostspruch hervorgekramt, daß bei gutem Wetter jeder rudern könne. Erst im Regen entfalte die Dubrow alle ihre Schönheit. Dies graue Licht gehöre zu ihrer absonderlichen, märkischen Romantik – und was dergleichen sinnreiche Bemerkungen mehr sind. Mancher glaubt's und dankt am Ende dem lieben Gott dafür, daß er ihm bei seiner ersten Dubrowfahrt einen so tüchtigen Guß auf den Kopf gegeben hat.
Ich für meinen Teil ziehe es doch vor, wenn warmer Herbstglanz über diese Gewässer rinnt, bläulich goldener Duft den Forst umzieht und alle Armut und Melancholie der wendischen Niederung in seine köstlichen Schleier hüllt. Gewiß, es hat seine Reize, eine halbe Stunde lang im strömenden Gewitterregen unter der Brücke zu liegen und zuzusehen, wie finsteres Gewölk sich immer wuchtiger auf die Eichen und Föhren der Dubrow senkt. Aber im milden Schein der Septembersonne gemächlich die liebe altbekannte Straße hinaufzugleiten, die durch die Schmölde und den Hölzernen See nach Köris läuft, wo durchaus haltgemacht, eine Mandel frisch vom Baum gepflückter Pflaumen gegessen und der besseren Verdauung halber Weißbier getrunken werden muß; dann immer abwechselnd flott durch erlenüberwölbte Gräben, langsam durch verkrautete Modderseen zu rudern, stets im unwiderstehlichen Zauber dieses ergreifenden Landschaftsbildes, seiner Schlichtheit, seiner Innigkeit, seines herben Liebreizes – das ist die reichste Gabe, die die heimatliche Mark uns zu bieten vermag. Zuweilen tauchen noch die roten Dächer eines Dorfes auf, aber wie Traumerscheinungen versinken sie wieder. Blühende Erika, blauschimmernde Wellen, weißer Sand und als Rahmen um das Bild die hochwipfelige Heide. Dann die Enge, welche die Görlitzer Eisenbahn übersetzt: Baum an Baum dicht gedrängt; Unterholz, das kaum noch Atem holen kann; ein wildes, brünstiges Wachstum, das in der Tiefe die Fahrstraße überranken, in der Höhe kein Fünkchen Himmelsblau durchs Blattwerk sickern lassen möchte. Schließlich erweitert sich der Graben noch einmal behaglich zum See. In dieser Bucht ruht er aus, und das endgültig. Wenn wir die Schilfinsel umfahren haben, winken die Türme des Schlosses Teupitz den Wegemüden.
*
Ach, wie melancholisch nimmt sich die Wendei im Regendunst aus! Wahrhaftig, an Wasser fehlt es ihr nie, auch in den Jahren allgemeiner Dürre, so daß sie die vom Himmel niederrauschenden Ströme entbehren könnte. Da scheint der Fluß aus dem gewohnten Bett zu treten, das er in jahrtausendlanger Geduld und Gemütsruhe langsam ausgewühlt und nimmermehr verlassen hat. Die Wiesen an beiden Ufern triefen von Nässe, Gräser und Blumen verwandeln sich in Wasserpflanzen, und wenn die schwarzen Kiefern auf der Sandhöhe in dem allgemeinen Chaos Tiergestalt annähmen, dann würden sie durch Kiemen atmen. So ungefähr wie heute mag die Wendei ausgesehen haben, als Gott sie aus dem Meere schuf. Und seltsam – während wir den launischen Krümmungen der Dahme folgen, meinen wir wieder die Schöpfung bei der Arbeit zu belauschen. Wie der Nadelwald, der oben aus dem schieren Sande losgeht, mit allen Fasern und Wurzeln das köstliche Naß einschlürft, um sich für die trocknen Tage zu versorgen, die doch schließlich auch einmal kommen müssen! Wie das Rohr im Windzuge zur Wiese hinstrebt, als schicke es sich zu einem Eroberungszuge an; wie wehendes Gras sekundenlang blanke Sandstreifen deckt, die es dem Grasreiche gar zu gern einverleiben möchte! Diese Regentage sind heilige Arbeitstage der Natur. In der großen Stadt, wo die himmlische Flut auf unfruchtbaren Asphalt niederfällt, keine Saat segnet und nur schmutzige Lachen bildet, in der großen Stadt scheint der Regen etwas Lästiges, Quälendes, Zweckloses. Hier draußen kommen wir in ein Verhältnis zu ihm. Triglaff, der nicht Swantewits unerbittlicher Feind ist, sondern dem Lichte die Wege und die Ackerkrume bereitet, der über Busch und Baum, Heide und Hag die Säfte ausgießt, die sein schönerer Bruder im Sonnenstrahle kochen macht ... Ich glaube, wenn wir weitere vier Stunden lang im Regen fahren, dann gewinnen wir ihn beinahe lieb.
Das Bindower Fließ liegt nicht immer so grau und farbenarm wie im Dämmer und Dunst dieses angeblichen Sommertages. Ihr hättet zwischen seinen von Brillanten oder Tautropfen funkelnden Ufern in der seligen Frische jenes Morgens hinfahren sollen, der wildes, flackerndes Grün und Blau über Wald und Wiesenland und Fluß ausgegossen hatte und unaufhörlich bemüht war, neue Glut in das Prunkgemälde zu schütten. Silberner Duft umfing die rötlichen Kiefernstämme, aber um ihrer Wipfel prächtiges Grünschwarz lag so viel Gold und saphirenes Leuchten, daß es für einen ganzen Sommer gereicht hätte. Aus der Ferne quoll dabei noch immer neuer Glanz, und die Wasser wußten am Ende nicht mehr, wie sie all den Reichtum spiegeln sollten. Sie gingen in Flammen auf ... Tiefer noch prägt sich das Bild dieses Dahme-Reviers dem ein, der es zum ersten Male im verschwelenden Abendlichte sieht. Ehe die Sonne hinter den Kiefernwald sinkt, sucht sie die dünnen Nebelschleier zu verbrennen, die aus der Flut aufsteigen. Nun umrandet ihn bunte Lohe; die Wolkenfetzen, die überm Forste hinsegeln, bohren wildgezackte Löcher hinein, durch die ihr Feuer in siedenden Lavaströmen quillt: Farben von unheimlicher Pracht, üppige Verschwendung von Illuminationseffekten, die gewiß einem andern, noch nicht zu fester Rinde erstarrten Planeten entstammen. Derweil setzen die Kiefern ihre roten Krönlein auf. Auf dem bewegungslosen Wasser spielt der Widerschein von all der Märchenpracht, so zart und vornehm, in so erfinderischem, sein abgeblaßtem und doch farbensattem Durcheinander, daß man den bewegten Prunk der Kuppel über dieser Nachbildung vergißt ... Zehn Minuten später versinkt das Spiel, graues Violett zieht sich wie eine Decke darüber. Nun brennen die Kiefernstämme in sattem Rot, während ihr Nadelwerk pechrabenschwarz auf dem dunkelblauen Sammet des Himmels steht. Das große Schweigen. Gleich schreitet das Einhorn durch den Wald und steigt zur Tränke hinab ...
Von Karl Fiedler.
Etwa 40 Kilometer südwestlich von Berlin liegt das Dorf Sperenberg, von einem Kranz anmutiger Seen umgeben. Schon vor rund 700 Jahren hat man an dieser Stelle den Gipsstein, früher »Speerkalk« genannt, abgebaut. Wir müssen annehmen, daß bald nach der Kolonisierung dieses südwestlichen Teiles des Teltow, die durch die Meißener Markgrafen erfolgte, der Abbau des Speerkalkes in Angriff genommen wurde. So hat man in der Klosterkirche in Zinna (1226 geweiht), im Turm der St. Johanniskirche in Luckenwalde, in den Gebäuden der alten Burg Zossen, die sämtlich kurz nach 1200 entstanden, Gipsbrocken als Bausteine nachgewiesen. Damit ist der Nachweis erbracht, daß das Gipsgestein bereits weitere als örtliche Verwendung fand. Aber außer der Verwendung als Naturstein zu Bauzwecken hat man wohl bald die Verwendung als Bindemittel in gebranntem Zustande erkannt. So kam es, daß sich die Nachfrage mehr und mehr steigerte. Unter dem Kurfürsten Joachim II. (1535 bis 1571) hatte der Abbau bereits einen solchen Umfang erreicht, daß dieser sich 1368 veranlaßt sieht, die Notte vom Mellnersee aus bis zur Dahme schiffbar zu machen und einen Verbindungskanal vom Krummen See bei Sperenberg, an dem die Brüche liegen, bis zum Mellnersee zu erbauen, um den Gips, auch Brenn– und Nutzholz desto leichter durch die Sane (Notte) in die Spree und ferner nach Berlin und anderswohin fortbringen zu können. Der Gips wurde also damals schon weit innerhalb Deutschlands versandt. So ist anzunehmen, daß er bereits bis Hamburg verfrachtet wurde. Ein Altarleuchter der Sperenberger Kirche, der aus dem Jahre 1617 stammt, hat zum Stifter einen Hamburger Bürger und scheint aus Anlaß jener Handelsbeziehungen verehrt worden zu sein.
Der 30 jährige Krieg mit seinen Schrecken ließ mit der Zerstörung des Dorfes auch den Bruchbetrieb zum Stillstand kommen. Doch bald nach dem westfälischen Frieden muß der Abbau des Gesteins wieder aufgenommen worden sein; denn bereits im Jahre 1655 berichtet uns das Erbregister des Amtes Zossen: »Auch hat das Amt in Sperenberg einen Kalkofen, worin der Speerkalk gebrannt wird. Derselbe wird gen Hoffe geliefert, teils auch zu des Amtes Notdurft verbraucht, auch wer solchen begehret, vors Geld berechnet.« Im Jahre 1690 wird auch bereits wieder die Notte vom Mellnersee aus schiffbar gemacht. Der Wasserweg zwischen Gipsbrüchen und Mellnersee wird nicht wiederhergestellt. Der Gips geht in dieser Zeit bereits wieder nach Hamburg, Pommern und Preußen. Was den Betrieb im Bruch anbelangt, so war dieser in jener Zeit noch recht ursprünglich. Dort, wo der Gipsstein zutage trat, gewann man ihn mit Spitzhacke und Fäustel.
Eine wesentliche Änderung brachte das Jahr 1742 durch die Einführung des Gesteinsprengens. Im vorhergehenden Jahre hatten die ersten Sprengversuche stattgefunden, die derart günstig verliefen, daß man sich 1742 entschloß, einen Gesteinsprenger in der Person des Hallenser Zinniger anzustellen. Die Menge des gebrochenen Gesteins belief sich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts durchschnittlich auf 9000 Zentner im Jahre. Die Preise betrugen damals für den Zentner Gipsstein 2 Groschen 3 Pfennig, während sie sich für den Scheffel gebrannten Gipses auf 3 Groschen beliefen. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erfuhr der Abbau durch die entdeckte Verwendung des Gipses in gemahlenem Zustande als Düngemittel erneute Forderung. Der Zentner Düngegips kostete 1½ Groschen.
Seit der Einführung des Sprengverfahrens ging man in der Gewinnung planmäßiger vor. Man räumte die aus Lehm und Sand bestehende Deckschicht fort, so daß sich der Gipsstein als feste Gesteinswand dem Beschauer darbot. Nun trieb man in diese Wand Stollen, die durch Querstollen verbunden wurden. Es blieben also nur mächtige Pfeiler stehen, die die ganze darüberliegende Bergwand zu tragen hatten. Diese Arbeit war aber nicht ungefährlich, da die Gipsfelsen immer wieder durch Schlotten, das sind durch Verwitterung entstandene Vertiefungen, die durch Lehm, Sand und Ton ausgefüllt sind, unterbrochen wurden. Stieß man nun auf solche Schlotten, so rutschte die lose Füllung nach und begrub oft die im Innern arbeitenden Gipsbrecher. So kam es, daß der Bruch fast in jedem Jahre Menschenleben als Opfer forderte. Hatte man nun endlich die Gipswand unterhöhlt, so wurden die stehengebliebenen Pfeiler angebohrt, die Bohrlöcher mit Sprengstoff gefüllt, und der Zeitpunkt kam so immer näher, an dem der Berg fallen sollte. Man wußte damals aber noch nichts von elektrischer Fernzündung. Die Zündschnüre mußten vielmehr mit der Lunte angezündet werden. Es war immer ein Spiel ums Leben, das die zum Zünden bestimmten Arbeitskräfte unternahmen. Ging ein Schuß zu früh los, so wartete ihrer der sichere Tod unter den stürzenden Felsbrocken. Es hieß also schnell anzünden und dann fluchtartig den Bruch verlassen; denn bald nach dem Zünden stürzte die ihres stützenden Haltes beraubte Wand unter donnerndem Getöse in sich zusammen.
Monate hatte man nun zu tun, um die Gipsbrocken zu zerkleinern und dann fortzuschaffen. Während der Aufräumung derniedergegangenen Gesteinsmassen unterhöhlte man an anderer Stelle ein neues Stück Bergwand. Das ganze Verfahren nannte man Schrämen.
In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts entwickelte sich im Orte eine rege Verarbeitungsindustrie. Zahlreiche Gipsmühlen und Brennöfen entstanden im Orte. So zählte man 6 Dampf– und 9 Roßwerkmühlen. Dazu kamen insgesamt 39 Brennöfen. Der Gips wurde von hier aus nicht nur durch ganz Deutschland, sondern sogar bis in die skandinavischen Länder und weit nach Rußland hinein versandt. Im Jahre 1897 ließen sich dann die Berliner Gipswerke in Sperenberg nieder und erwarben das Ausbeutungsrecht in den Brüchen der Bauern. Eine mächtige Fabrik, dicht am Bahnhof gelegen, entstand. Sie wurde mit den etwa 1½ Kilometer entfernten Gipsbrüchen durch eine Drahtseilbahn verbunden.
Bis zum Jahre 1903 gewann man den Gips immer noch in der Form des geschilderten Schrämens. Von da an ging man dazu über, den Bruch in die Tiefe zu treiben. Gewaltige Pumpanlagen entstanden, um den Bruch vor dem Ersaufen zu bewahren. Da man nun fast nur reines Gestein vorfand, sprengte man es in kleineren Teilen von der Wand los. Durch das starke Pumpen wurde der Grundwasserspiegel der ganzen Gegend gesenkt. Infolgedessen mußte im Jahre 1924 der Betrieb im Tiefbau eingestellt werden. Man ließ ihn ersaufen. Eine mächtige Seefläche dehnt sich jetzt dort, wo noch vor Jahren das Gestein dem Schoße der Erde entrissen wurde. Bis zum Oktober des vorigen Jahres gewann man durch Löffelbagger die Gipssteine. Da die Abraummengen zu groß wurden, stellten die Gipswerke den Betrieb ein.
So ist es nun dort still geworden, wo mehr denn 700 Jahre Menschenhände das Gipsgestein aus den Bergen brachen. Noch immer aber ragen die Gipsfelsen empor und spiegeln sich in den Seeflächen, die zu ihren Füßen entstanden sind. Wer vermag zu sagen, ob sie für alle Zukunft unangetastet bleiben werden, und ob die 700 jährige Geschichte der Sperenberger Gipsbrüche abgeschlossen ist.
Von C. Schmidt und Siegfried Braun.
Lange bevor die Botanik als oberste Polizei– und Registrierbehörde für das Pflanzenreich ihres Amtes waltete, hatte schon der aufmerksame Landmann und Züchter sein Augenmerk auf die Gattung Kohl gerichtet. Er hatte erkannt, daß diese Pflanze höchst wertvolle Charaktereigenschaften besaß und willig genug war, bei bestimmter Wartung, Pflege und Richtung in der Zucht einige ihrer Eigenschaften ganz großartig zu entwickeln.
So war es dem Züchter im Laufe der Zeiten geglückt, der Kohlpflanze einen wohlgewölbten, festeren oder lockeren Kopf anzuzüchten, dessen Blätter grün–weiß, rot oder blasig waren: das war der Rotkohl, Weißkohl und Wirsingkohl. Dann war es ihm gelungen, den Kopf gleichsam in kleine rosenartige Köpfchen zu zerlegen, die an den Seitenknospen der Pflanze wie Perlen aufgereiht waren: das nannte er Rosenkohl. Nun veranlaßte er den Stengel, sich unmittelbar über dem Erdboden zu verdicken: so entstand der Kohlrabi. Er zwang die Blütenstiele und oberen Blätter, sich zu einer weißen, fleischigen Masse umzubilden: so formte sich der Blumenkohl.
Damit noch nicht genug. Er brachte es durch planmäßige Auslese der geeignetsten Pflanzen dahin, daß der Same der Kohlpflanze zu einem natürlichen Behälter wertvollen Öls wurde, und daß sich die Wurzel entweder zu einem dickbauchigen, fleischigen Etwas, der gewöhnlichen Kohlrübe, ausbaute oder aber sich zu einem hochfeinen, aromatischen Leckerbissen von kaum Fingergröße umgestaltete. Dieser letzte Erfolg glückte im Kreise Teltow bei Berlin, und das gewonnene Produkt nannten die dankbaren Züchter Teltower Rübchen, der Botaniker nannte es: Brassica rapa sativa minima.
Bis zum Jahre 1711 wurde das Teltower oder märkische Rübchen ausschließlich von einigen Einwohnern der Stadt Teltow gebaut, die ihre bescheidene Ernte nur metzenweise in Handkörben nach Berlin tragen konnten. Da kam der 16. Juni 1711 und suchte Teltow zum zweiten Male mit einem großen Brande heim, der in wenigen Stunden die ganze Stadt mit Kirche, Rathaus und Schule in einen Haufen Asche verwandelte. Nur vier Häuser blieben stehen.
Dieses Stadtunglück nötigte die guten Teltower, sich nach einer lohnenden »Industrie« umzusehen. Sie verfielen auf ihre Rübchen, kultivierten sie jetzt mit mehr Liebe, Sorgfalt und Verständnis als bisher und brachten bald eine schöne, schmackhafte Ware zu Markte. Die umliegenden Ortschaften sahen den Teltowern dieses Kunststück natürlich sehr rasch ab und in kurzer Zeit erstreckte sich der Rübenbau bis an die Tore Berlins.
Allen diesen verschiedenen Dorfschaftsrüben konnte man neben der großen Ähnlichkeit mit der »echten Teltower« auch eine gewisse Güte keineswegs absprechen; daß sie aber an die echten bei weitem nicht heranreichten, erklärte schon um 1740 ein alter Teltower Patriot mit folgenden Worten:
So viel ist doch auch gewiß, und ein jeder kann sich durch seinen eigenen, seinen, nicht verdorbenen Geschmackssinn von der oft erprobten Wahrheit überzeugen, daß die Teltower Rübe allein von allen Dorfschaftsrüben sich merklich durch ihr Ansehen und aromatischen seinen Geschmack auszeichnet und unterscheidet.
Er klagt aber sogleich weiter:
Es gibt selbst in Teltow und um Teltow herum gewissenlose, niederträchtig geizige Seelen, die Stolpsche oder Mutzsche Rüben aufkaufen, putzen und sie mit echten Teltowern oder guten, am nächsten an uns angrenzenden Landrüben vermischen, oder, wenn sie gewiß wissen, daß sie weit verschickt werden sollen, gar ohne Vermischung für Teltower Rüben verkaufen, den höchsten Preis nehmen und das treuherzige Ausland bübisch betrügen.
Der eigenartige Wohlgeruch der Teltower Rübe ist es, was ihren guten Ruf weit verbreitet und ihr schließlich einen Weltruf verschafft hat. Soll doch Elisabeth Charlotte von Orleans, gestorben 1721 in St. Cloud, die pfälzische Liselotte, die unerschütterlich deutsche Frau, das Teltower Rübchen als besonderen Leckerbissen am französischen Hofe eingeführt haben. Auch kein Geringerer als Goethe, der sonst von der Mark herzlich wenig hielt, ließ sich alljährlich ein Päckchen. Rüben mit der Schnellpost nach Weimar kommen und Papst Pius IX. sogar nach der heiligen Roma. Joh. Heinrich Voß wollte die Sache praktischer anfangen. Er ließ sich nach Heidelberg Samen schicken und hoffte neben der Poesie auch in der Rübenzucht auf lohnende Erträge ... – Allein, allein ... der Same nahm die Ausfuhr aus seiner rauheren Heimat in ein milderes Klima und in eine fette humose Gartenerde gewaltig übel. Er produzierte statt eines gehaltvollen Rübchens eine übergroße und schrecklich verwässerte Riesen-Teltower. Als einst ein Märker unseren Dichter besuchte, zeigte ihm dieser triumphierend seine »verbesserte Teltower«, vergaß aber zu erwähnen, daß, sie den pikanten Geschmack vollständig verloren hatte und fade und madig geworden war.
Ähnliche Erfahrungen haben alle gemacht, die die Rübe »entwurzeln«, der Heimat entfremden oder ihr Geist der Fremde beibringen wollten. Man hat oft von auswärts Samen bezogen und damit in und um Teltow herum Versuche angestellt. Umgekehrt haben auch andere Provinzen echten Teltower Samen erhandelt und mit großen Hoffnungen bei sich ausgesät. Rüben sind wohl in beiden Fällen herangewachsen, aber keine echten Teltower. Der ausgeführte echte Same hat in der Fremde zwar die Rübe vergrößert, aber ihren Geschmack verschlechtert, und der eingeführte fremde Same hat im Teltowschen von Jahr zu Jahr kleinere Rüben ergeben und ihren Geschmack nicht verbessert. So zeigt auch ein so unscheinbares Ding wie das Teltower Rübchen die Anhänglichkeit und Abhängigkeit von seiner engeren Heimat.
Mögen andere Lerchenzungen, Schwalbennester, Austern und Kaviar bevorzugen, uns gilt für alle Zeiten als höchster Leckerbissen ein dampfender Teller von Brassica rapa sativa minima teltoviensis.
Teltower Kreiskalender 1905. Berlin, Rob. Rohde.

Teltow