
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
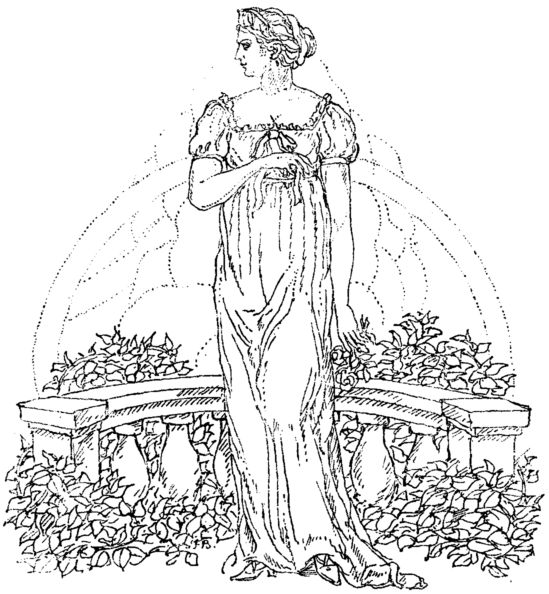
Königin hatte veilchenblaue Augen und eine rosige Gesichtsfarbe. Ihre Geburt fiel in den März (10. März 1776); und noch in demselben Frühlingsmond war ihr Tauftag. Es ging ein Veilchenduft durch die alte Garnisonkirche von Hannover, wo damals ihr Vater, der Herzog Karl von Mecklenburg, im Dienste seines Schwagers Georg III. von England das Kurfürstentum verwaltete. Die Taufpaten trugen Veilchensträuße, das Taufbecken war bekränzt mit Veilchen, und in einem Veilchenschmuck ruhte das Kind. Aber die Königin liebte auch die Rose, die Blume der Liebe. Der Vergleich mit einer Rose stieg oft in Geburtstags- und Preisgedichten auf. Noch Max von Schenkendorf sang zu ihrem Tode: »Rose, schöne Königsrose, hat auch dich der Sturm getroffen?« Und während der Fremdherrschaft erschien Iffland auf der Berliner Hofbühne zum Geburtstag der Königin (1808) mit einer frischen Rose an der Brust, und ihm folgten in ebensolchem Schmuck die übrigen Mitglieder. Es ging ein Jubelsturm durch das Haus, das die Anspielung verstand, was vom französischen Gouverneur als eine feindliche Kundgebung aufgefaßt wurde und dem Schauspieler etliche Tage Hausarrest eintrug.
Veilchen und Rose! Ein frommes, inniges Blau und eine leuchtende Lebenslust! Eine reine Seele und ein heiter-lebhaftes Naturell, das lieben, tanzen, singen, aber auch herzbrechend weinen, zürnen, hassen und verachten konnte: so steht sie vor uns, die Königin der Preußen. die Königin aller Deutschen.
Ihre äußere Gestalt war nicht von einer regelmäßigen, durchaus klassischen Schönheit. Ihr Hals z. B. neigte zu einer leichten Anschwellung, so daß sie oft mit dem bekannten Schleier unter dem Kinn zu Festlichkeiten erschien. Manche fanden ihre Füße und Hände zu groß. Aber ihr Wuchs war herrlich, ihr Gang von einer schwebenden Anmut, ihre Stimme von einem warmen Herzenston: sonnenhafte Blau-Augen strahlten aus einem Gesicht von rosig schöner Farbe, ihr mattblondes Haar war von reichster Fülle, und in ihrem Blick und Benehmen lag bei aller Heiterkeit eine innige Ruhe, Sanftheit und Güte. Dies alles, und eben noch dazu das unbestimmbare Geheimnis wahrer Schönheit, das machte sie zugleich lieblich und majestätisch. Es ging ein Zauber von ihr aus, eine Magie. Von Menschen dieser Art geben daher Bilder nur einen unzulänglichen Begriff: denn ihr Eigenstes entfaltet sich eben in der lebenswarmen, atmenden Bewegung, im Gespräch, in der Handlung, wenn die Strahlungen von innen die Lüge durchleuchten. Aehnliches sagt man von Friedrich dem Großen, den gleichfalls kein Bild einwandfrei wiedergibt.
Welch eine Seele hatte sich hier verkörpert! Prinzessin Luise, früh der Mutter beraubt, wurde in Süddeutschland aufgezogen: am Darmstädter Hof bei der Großmutter. So nahm ihr Deutsch etwas von der pfälzischen Mundart an, was zu der Herzlichkeit ihres Naturells wunderschön stimmte. Man erzog sie und ihre Geschwister einfach, sparsam und vor allen Dingen natürlich; ihr Wesen wurde nicht in Etikettenzwang eingeschnürt oder entstellt. Zwar kam keine bedeutende, keine ebenmäßig durchgeführte Bildung hierbei heraus: aber ihre Herzens-Genialität blieb ungebrochen. Und so blieb Luise ein »Fräulein Husch« bis in die Verlobung und in die Ehe hinein. «Morgen wollen wir tanzen, trinken, singen, spielen und recht lustig sein, et je serai die tolle Luise, votre chère petite promise«, schreibt sie an ihren Verlobten, den Kronprinzen. Französisch war damals die Hofsprache; die junge Braut übersprang die Satzung und stellte ein lustiges Gemisch von Französisch und Deutsch her. » Bientôt herzeliebes Weibchen Louise«, lautet einmal die Unterschrift in einem dieser Briefe. Es ist Geist vom Geiste der Frau Aja, der Mutter Goethes, mit der sie sich bei einem Besuche in Frankfurt vortrefflich verstand. Aber auch ernste Töne tauchen auf. »Sicher wird mir Gott Kraft geben, mich führen und nicht verlassen. Meine heißen Gebete werden ihn rühren und meine frommen und tugendhaften Grundsätze mich vor dem Bösen bewahren. Seien Sie überzeugt, daß ich Sie liebe und verehre, daß ich alles in der Welt tun werde, Ihnen zu gefallen und Sie glücklich zu machen, seien Sie mein Beistand und mein Freund und mein Rat. Sie werden keine Undankbare an mir finden.«
Es wuchs zwischen diesen beiden Menschen – dem trockenen, gewissenhaften, im Umgang schwerflüssigen Kronprinzen und der genial-beweglichen Luise – ein wunderbar inniges Verhältnis. Er brauchte sie zur Ergänzung, wie sie ihm manche ergänzende Einwirkung verdankte. Aber anregender war Luise: sie hatte mehr schöpferische Herzensenergie. Ihre ungeschulte, durch Leiden emporreifende Naturkraft war den meisten Männern, Fürsten, Königen um sie her überlegen, auch dem schwärmerischen, charakterlich nicht ausgeglichenen Alexander von Rußland, der durch eine mehr gefühlsmäßige als besonnen vertiefte Freundschaft dem Königspaar nahestand. Daß die Königin sich in Politik einmischen mußte, lag eben an der geringen Schöpferkraft der Männer ihrer Umgebung. Ihr Gebiet war das Herz.
Man muß bedenken, daß diese königliche Frau schon mit vierunddreißig Jahren gestorben ist, frühe schon in Drangsalen gereift, für ihr Vaterland besorgt bis in den letzten Augenblick. Der König neigte oft zu gänzlicher Entmutigung und Erschlaffung: Luise schwebte als seine beste Freundin um ihn her und widmete ihm den größten Teil ihres Tagewerks. »Opfer und Aufopferung ist mein Leben«, schrieb sie an ihren Vater, »Ich kann und darf in dieser Krisis den König nicht verlassen, er ist sehr unglücklich und bedarf einer treuen Seele, auf die er sich verlassen kann.« Sie zog mit ihm gen Jena; sie wäre dort in den Kriegswirren Thüringens fast gefangen worden: Friedrich Wilhelm III. hatte sich so an ihre Gegenwart gewöhnt, daß er sie kaum von der Seite lassen mochte. Beides waren reine und liebevolle Naturen. Und als sie starb, lag der Gatte vor ihrem Bett und rief schluchzend: »Du bist ja mein einziger Freund, zu dem ich Zutrauen habe!«
Ihrem Gatten und ihren Kindern gehörte sie: aber sie empfand ihre Familie als einen Teil der Nation: und so erweiterte sich ihre Liebesfähigkeit und dehnte sich über die ganze Nation aus. Es war kein Zwiespalt zwischen der Fürstin, der Mutter und der Gattin.
Leicht drängt sich bei der Betrachtung dieser Fürstin der Gedanke an eine andere Fürstin auf: an Frau Elisabeth von der Wartburg.
Auch diese Heilige auf dem Thron hatte in ihrer Jugend ein überaus heiteres, liebend alle Welt umarmendes und dann wieder in tiefer Frommheit sich sammelndes Natur-Temperament. Sie war frühreif, was Genialität der Empfindung anbelangt: sie war von reinem, jungfräulichem Empfinden auch als Mutter: sie hat schwerste Drangsale und Prüfungen erlitten und bestanden: sie hatte einen guten, treuen, fürsorglichen Gatten und Behüter wie Luise. Früh vollendet war auch sie: nur vierundzwanzig Jahre hat sie gelebt. Aber welche Anregungen gingen von ihrer Lebens- und Liebesenergie aus!
Wir Deutschen sollten zwei so seelengeniale Frauen wie Elisabeth von der Wartburg und Luise von Preußen immerdar hochhalten. Es ist Priesterliches um diese Frauen: in ihrem reinen Priestertum ist zugleich Poesie und Seherkraft. Wir brauchen Iphigenie nicht in Hellas zu suchen. Das sind hier Frauen jener unvergänglichen Art, von denen Tacitus sagt, daß ihnen, nach der Empfindung der Germanen, etwas Göttliches innewohne.
Das klassische Zeitalter hat edle Frauen gezeitigt: und unsere großen Dichter haben sie edel gestaltet. Von Klopstocks Meta bis Goethes Marianne von Willemer oder mancher tapfern Braut und Frau der Freiheitskriege lernten wir in Dichtungen, Briefen und Denkwürdigkeiten solche prachtvolle Frauencharaktere kennen, verehren und lieben. Königin Luise ist eine Blüte jener Art von Frauen, die vom Gemüt aus ihre Genialität ausstrahlen und in der Nation das Schöpferische wecken und entflammen helfen. Es ist gar nicht abzumessen – weil es ein zu seiner Faktor ist – wie weil Luisens anmutvolles Dasein, Leiden und früher Tod mitgewirkt haben mag an der seelischen und sittlichen Zornwucht der Befreiungsschlachten.
Sie hat besonders Schiller geliebt und in Weimar (1799) seinen Wallenstein gesehen, wobei sie den Dichter persönlich begrüßte. »Die Königin ist sehr graziös und von dem verbindlichsten Betragen«, schrieb Schiller an Freund Gottfried Körner nach Dresden (9. August 1799). Auch in Berlin (13. Mai 1804) hat ihn die Königin empfangen, umgeben von ihren beiden ältesten Söhnen. Es ist reizvoll, zu bedenken, daß also hier in Gegenwart der königlichen Mutter Luise der künftige erste deutsche Kaiser Prinz Wilhelm, dem Dichter des »Tell« und markantesten Vertreter des schöpferisch-deutschen Idealismus gegenüberstand. Wir spürten im Wesen dieses Edelmanns auf dem Throne etwas nachwirken von dem Geiste, den einst Schiller verkündet und den Königin Luise in Leben umgesetzt hat. Der Dichter und die Königin, beide sind früh gestorben. Aber die jungen Freiwilligen von 1813 hatten Schillers Werke im Tornister. Und Theodor Körner, Schillers Patenkind, der Sohn jenes hilfreichen Dresdener Freundes, feierte in seinen Schlachtliedern immer wieder die Königin. So spricht er vor Rauchs Büste:
»Du schläfst so sanft! Die stillen Züge hauchen
Noch deines Lebens schöne Träume wieder.
So schlummre fort, bis deines Volkes Brüder,
Wenn Flammenzeichen von den Bergen rauchen,
Mit Gott versöhnt die rost'gen Schwerter brauchen,
Das Leben opfernd für die höchsten Güter.
Kommt dann der Tag der Freiheit und der Rache,
Dann ruft dein Volk, dann, deutsche Frau, erwache,
Ein guter Engel für die gute Sache!«
So gehört Luise unmittelbar zu jenen Geistern, die an den Gemüts- und Geisteskräften jenes Zeitalters veredelnd gewirkt haben. Man nannte dies damals «Humanität«; auf deutsch heißt das: Edelmenschentum. Es äußerte sich bei Schiller und Goethe in poetischer Gestaltungs-Energie: bei Kant oder Friedrich dem Großen in Energien der Vernunft und des sittlichen Willens; bei Mozart und Beethoven in musikalischen Rhythmen. Diesen Meistern kongenial war die Gemütskraft der Königin Luise. Solche Gestalten sind Brennpunkte, in denen sich seelische Sonnenstrahlen sammeln: Sonnen-Energie, nach einem schönen modernen Wort des Physikers Ostwald. Sie sind tatsächliche Sonnenkinder; ihr Schutzgott ist Apollo, der Sonnengott, oder der strahlende Baldr, der scheinbar zwar dem düsteren Loki erliegt, in Wahrheit aber siegreich wiederkehren wird.
Am Tag von Tilsit (6. Juli 1807) traten Baldr und Loki sich gegenüber: Engel und Dämon, Luise und Napoleon. Der Geist Europas war in diese zwei Gestalten polarisiert. Hier der geniale Hasser und Vernichter, der Erbe der brutalen Revolution, eiskalt, ganz Verstand, Berechnung, Willen, Egoismus großen Stils; dort die anmutigste aller Mütter, voll von Liebe für ihr Volk, durchdrungen von dem edlen Trieb zu beglücken, Wunden zu heilen, Tränen zu trocknen.
Der Dämon hatte die äußere Macht in Händen und blieb der Stärkere, obwohl die schöne Königin Eindruck machte. Aber der bittere Tag, der zunächst auf eine Demütigung hinauslief, war dennoch nicht umsonst. Das Bild der leidenden und so oft beleidigten Königin hat manches junge Kriegerherz entflammt. Hier trat eine geheime Energie in Kraft, mit der jener Realpolitiker Napoleon zu wenig rechnete: »die deutsche Ideologie«, vor der ihm oft unbestimmt graute, mächtiger als seine Bulletins, mächtiger als seine mathematische Feldherrn-Genialität. Der Königin Geist wirkte mit an den Siegen von 1813. Sie gehört zu Schiller und Goethe, aber auch zu Blücher und Gneisenau. »Ach, hätte das doch die Königin Luise erlebt!« rief Gneisenau nach dem Siege bei Leipzig. Und auf dem Montmartre stellte Blücher (30. März 1814) mit Befriedigung fest: »Luise ist gerächt.«
Denn man stelle sich diese Frau nicht als eine weichlich Seufzende vor; sie war vielmehr, trotz ihrer endlosen Tränen des Kummers, recht sehr der Kraft des Verabscheuens fähig. Nicht freilich im Sinne jener leidenschaftlichen Weiber auf dem Fürstenthron, wie sie die Merowingerzeit oder die Renaissance emporgetrieben hat, nicht im Sinne einer Katharina von Medici oder einer Maria Stuart. Weitab von alledem lag die germanische Art dieser lichten Herrin. Die kalte Brutalität der französischen Diplomatie und Kriegführung entpreßte ihrem Gemüt Tränen der Entrüstung: heiligen Zorn. »Und man lebt und kann die Schmach nicht rächen!« ruft sie, als sie sich von Napoleons Bulletins und dem »Telegraphen« des Berliner Juden Julius Lange beschimpft sah. »Wo sind die Feldherren hin, die sich im Siebenjährigen Krieg unsterblich machten?!... Danzig! Danzig ist dahin, seit gestern in französischen Händen! in diesen verhaßten, über alles gräßlichen Händen!« »Und man bleibt leben bei solchem horreur!« ... »Nun, es lebt doch noch ein Gott, der wird ihm schon den Lohn geben, den er verdient!« ... »Werdet Männer«, ruft sie ihren Söhnen zu nach der Niederlage von Jena und Auerstädt, »und geizet nach dem Ruhm großer Feldherren und Helden! Wenn euch dieser Ehrgeiz fehlte, so würdet ihr des Namens von Prinzen und Nachkommen des großen Friedrich unwürdig sein. Könnt ihr aber den niedergebeugten Staat nicht wieder aufrichten, so sucht den Tod, wie ihn Louis Ferdinand gesucht hat!« ... Es ließe sich eine Blütenlese von Stellen sammeln, in denen sich das Heldische in dieser Königin, die Zornkraft, ebenso temperamentvoll geäußert hat, wie ihre Empfindungsfähigkeit der Liebe. Aber Zürnen war nicht ihr Lebenselement; sie litt bitterlich darunter. Bismarck hat einmal über Luisens politische Betätigung das schöne Wort gesprochen: »Unsere Königin Luise trieb auch Politik, aber eine Politik mit reinem Herzen. Ihr Vaterland wollte sie groß, reich und mächtig machen. Kein irdisches Wesen habe ich höher geachtet. Wenn doch unsere vornehmen Damen solche Politik wieder treiben wollten! Sie sollen dem Manne nicht ins Handwerk pfuschen, aber sie sollen ihn beeinflussen, besänftigen und zum Guten führen.«
Zürnen war nicht ihr Lebenselement. Immer wieder schnellte sie in ihren natürlichen Zustand empor, in fröhliches Lieben und Geliebtwerden. Ihr Wesen war Freudigkeit. Wenige Wochen vor ihrer Todeskrankheit, als sie nach Mecklenburg ins Vaterhaus reisen darf, jubelt sie auf, wie in den Tagen der Brautzeit: »Ich bin so glücklich, wenn ich daran denke, daß ich Euch beinahe acht Tage in Streich sehen werde, daß ich ordentlich Krampolini kriegen könnte. Ich verkneip' mir aber wahrhaft die Freude, weil so oft, wenn ich mich gar so ausgelassen gefreut habe, ein Querstrich gekommen ist, und solche Kreuz- und Querstriche wären vraiment affreux jetzt ... Hussasa, tralala, bald bin ich bei Euch! ... Heute ist es warm und windig, und in meinem Kopfe sieht es aus wie in einem illuminierten Guckkasten. Alle Fenster mit gelben, roten und blauen Vorhängen sind hell erleuchtet. Hussa! Teufelchen. Wir bringen keinen Arzt mit; wenn ich den Hals breche, so klebt mir ihn Hieronimi (der mecklenburgische Leibarzt) wieder ein.« Dies schreibt sie noch im Juni 1810, vier Wochen vor ihrem ungeahnt frühen Tode! Es war die ihr gemäße natürliche Lebenslust, die nach all dem Leid in solchen Augenblicken wieder heraussprang, kindlich, unbefangen und ungebrochen.
Eine wesentliche Grundkraft dieser edlen Frau war ihre Religiosität. »Ich tue nichts als singen und tanzen«, heißt es zwar in einem Brautbriefe. »Die alten Scharteken, nämlich die Wagen fahren vor, und ich, ich habe keine Lust, in die Kirche zu gehen. Gott verzeihe mir's. Adieu Altesse royale de mon coeur. Ich muß fort in die Kirche gehen, sonst schlägt mich mey alt Großmäme!« Und als sie hört, daß ihre künftige Oberhofmeisterin, die treffliche Frau von Voß, als heiter galt, meint sie: »Ich hoffe, man wird an unsrem Hofe mehr lachen als weinen.«
Aber es kam anders. »Die göttliche Vorsehung leitet unverkennbar neue Weltzustände ein, und es soll eine andere Ordnung der Dinge werden, da die alte sich überlebt hat. Wir sind eingeschlafen auf den Lorbeeren Friedrichs des Großen, welcher, der Herr seines Jahrhunderts, eine neue Zeit schuf. Wir sind mit ihr nicht fortgeschritten, deshalb überflügelt sie uns.« Sie empfindet Napoleon als ein »Werkzeug in des Allmächtigen Hand«, als eine »Geißel der Völker«. Sie empfindet ihre und ihres Volkes Leiden als Prüfungen, als Absichten der Vorsehung; sie sucht ihr Leid umzuschmieden in das Gold der Weisheit. Und die tanzlustige junge Königin sitzt am Klavier und spielt Choräle; sie liest den 126. Psalm – »Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird« –; sie liest überhaupt die Bibel, sie holt aus großen Dichtern und Denkern Trost und Kraft. Und so wächst ihr innerer Wert, während sie gleichzeitig eifrig versucht, die Lücken ihrer Bildung auszufüllen. Nicht wehleidig wird sie, dazu hat sie viel zu viel Temperament; ihre tränenvolle Trauer setzt sich in Tat um, in Arbeit, in Mitsorge, in klärendes und energievolles Gebet um Einsicht und Entschlossenheit. Sie bringt (Ostern 1809) »alle weltlichen Angelegenheiten Gott zum Opfer unter tausend Tränen« ... »Ich stehe in seiner Hand; es fällt kein Haar von meinem Haupt, er weiß es. Er wird mich stärken, daß ich ohne Murren als sein Kind, als eine wahre Christin mich finde in seine Ratschlüsse« ... »Nur der Glaube hält mich aufrecht und hindert mich zu murren. Inmitten all dieses Unglücks bitte ich Gott, mein Herz nicht der Menschlichkeit zu verschließen und meinen Charakter nicht zu verhärten, denn dann allein werde ich unglücklich und verloren sein ohne Gnade und Barmherzigkeit.« Und in denselben Wochen (April 1809) schreibt sie an die Kaiserin Elisabeth von Rußland: »Die Krone hat für mich nicht jenen Reiz, den sie wohl für andere besitzt, wie ich zu behaupten wage. Verstehen Sie mich recht! Es ist nicht der große Vorzug, den ich glaube zu besitzen, und wenn es auch sehr stolz und anmaßend klingt, so verzeihen Sie einer sehr unglücklichen Königin, die zu deutlich voraus stehet, daß sie bald in die Lage versetzt sein wird, ganz allein auf ihren innern Wert beschränkt zu sein.«
Das ist demütig und zugleich stolz gesprochen. Die gute Königin hatte einst die Äußerung getan, sie sei »nicht zur Königin geboren«; aber darin hatte sie unrecht. Wie auch die Fachpolitik über die Einzelheiten der damaligen politischen Ratlosigkeit und das Eingreifen der Königin urteilen mag: sie war zur Königin geboren. Sie war selbstlos, sie war groß in ihrer Liebe zum Ganzen. Sie unterzog sich willig jeder Pflicht der Repräsentation, wenn es sein mußte, und verbarg ihren schneidenden Kummer unter einem lächelnden Gesicht. »Das Herz war mir zerfleischt – ich habe getanzt! Ich habe gelächelt, ich habe den Festgebern Angenehmes gesagt, und ich wußte vor Unglück nicht wohin.« So schreibt sie von ihrem vorletzten Geburtstag (1809). Aus diesem Pflichtgefühl ist sie nach Tilsit geeilt; so hat sie sich ihren Pflichten gewidmet als Mutter, als Gattin, als Königin.
Als sie starb (19. Juli 1810) ging ein großer Schmerz durch Deutschland. Blücher war »wie vom Blitz getroffen«. »Gott im Himmel,« rief er, »sie muß zu gut für uns gewesen sind!« Und Steffens, damals in Halle, schrieb: »Der Schmerz malte sich auf allen Gesichtern. Ein Gefühl schien jeden zu durchdringen, als wäre die letzte Hoffnung mit dem Leben der angebeteten hohen Frau entwichen. Der Feind, sagte man sich, habe die Schutzgöttin des Volkes getötet.«
Die Schutzgöttin des deutschen Volkes: – so empfinden wir auch heute diese Edelfrau und gedenken ihrer in Dankbarkeit und Verehrung.
Im »Türmer«. 12. Jahrgang
Manchmal schwebt im schimmernden Abendgold.
Das die Wasser von Potsdam weich durchglüht,
Ein verklärter Geist: eine Königin.
Die mit Muttersorge die neuen Menschen
In der großen deutschen Familie grüßt. Ihre Gestalt ist wie ein stiller Rauch,
Von dem Feuer des Himmels fein umsäumt;
Und ihr zart Gewand, zurückgeweht
Von der begegnenden Luft, ist Glanz im Glanz,
Wie eine weiße Fahne verwallt im Duft.
Havelschwäne schauen verwundert auf,
Träumende Kerzen schlagen erhöht empor,
Schiffe stellen die Flügel, schattenstumm – –
Und aus dem sonnengekrönten Sanssouci
Kommt, mit Geisteraugen, der große König.
Wege nach Weimar

Frau Elisabeth ... In einer Frau, in einer Mutter hat bei uns Deutschen die stärkste seelisch-religiöse Erhebung des Mittelalters Gestalt genommen. Ist das nicht sinnreich für das Volk tiefster Gemütskräfte?
Elisabeth war als Kind voll heiterer Anmut, voll Herzlichkeit. Niemals hat man sie bitter oder scharf gesehen. Es ist, als hätte solches Metall ihrem Blute gefehlt. Sie konnte wohl traurig sein, aber nicht auffahrend oder verletzend. Schon als kleines Mädchen war sie besessen vom Drange, armen Kindern wohlzutun und Freude zu machen. Und bereits mitten in den Kinderspielen fährt plötzlich die Erinnerung an die andere, die überirdische Welt in ihre Seele: sie springt jählings aus den Spielen auf und küßt die Wand der Kapelle, sie wirft sich vor dem Altar auf die Knie, sie sinnt geistesabwesend zwischen Friedhofgräbern der Ewigkeit nach. Für das Herrenbewußtsein der Fürstin hat diese Königstochter viel zu wenig Trotz im Organismus; sie zieht sich von Frau Sophie manchen Vorwurf zu, daß sie zu wenig auf ihre Würde bedacht sei. Mit hingebender, reinster Liebe hängt die kindliche Jungfrau an ihrem großen »Bruder«, ihrem Verlobten Ludwig.
Sie war den Jahren nach Kind, als sie Braut wurde: sie ging als Kind traumhaft hinüber in den Ehestand; sie wurde Mutter – und blieb dem Wesen nach Kind, blieb ihrem Gatten die »Schwester« wie zuvor. Begehrlichkeit und Leidenschaft hatten in solcher Natur keinen Platz; Wohltun und Gutsein war ihr Wesen. In naturhafter Anhänglichkeit begleitete sie zu Pferd ihren Gatten, so oft es sich nur ermöglichen ließ, in Wind und Wetter und Schneefall. Sie tat bei längerer Abwesenheit des geliebten Mannes ihre besseren Kleider ab und legte Trauergewänder an; und wenn er heimkehrte, begrüßte sie ihn im Festgewand.
Noch also nahm ihre Liebeskraft natürlichen Verlauf: sie war in verlangender Zärtlichkeit Geliebte, Gattin, Mutter. Und dieser Vorrat an Frauengemüt reichte aus, ungezählte Kranke oder Arme außerdem zu pflegen, Aussätzige in ungestümer Güte ans Herz zu drücken, an armen Kindern Patenstelle zu übernehmen, in den Hütten der Armen Besuche zu machen, im Jahre der schweren Seuche (1225) zu Eisenach ein Krankenhaus einzurichten – und sogar Äcker und Ortschaften, ja ihre seidenen Kleider zu verpfänden oder zu verkaufen, wenn ausgestreckte Hände Brot heischten. Das war ja wohl Verschwendung, und man hörte Klagen darüber: aber hatte Landgraf Hermann nicht verschwendet?
Verschwendung war es, ja: nicht freilich mehr mit stolzen Helden der Sängerburg, sondern mit den so lange übersehenen Armen im Tal. So hatte sich die Zeit verdüstert und verlangte Mitleid der Höhenmenschen mit den Nöten des Tieflands.
Und diese Verschwendung – das bewundere man wohl! – war die jugendliche Herzensgenialität einer Fürstin von kaum siebzehn oder achtzehn Jahren. »Diese Elisabeth«, bemerkt ein Biograph, »wird ohne Aufhören in der Erinnerung des deutschen Volkes, in der Christenheit fortleben, ein Vorbild für die christlichen Frauen jedes Standes und Alters, erhoben von den empfänglichen Herzen, geliebt von den gleichgesinnten, und denen zur Scham genannt, die, wie weit auch an Jahren voraus, noch nicht vermocht haben, sich über den Genuß hinaus zum Bewußtsein eines christlichen Berufs für die Welt aufzuschwingen.«
Nach Ludwigs Tod aber trat eine Wandlung ein, wodurch allerdings nach und nach eine Kraft ganz erstaunlich zum Erblühen kam, doch auf Kosten aller anderen Organe.
Die Kirche übernahm die Führung dieser ungewöhnlichen Frau. Und diese Führung, in der Gestalt ihres Beichtvaters Konrad von Marburg, verbunden freilich mit persönlicher Anlage und einwirkenden Schicksalen, verwandelte die Landgräfin Elisabeth in die »heilige Elisabeth«.
Wie durch Hypnose ist von nun ab (1227) Frau Elisabeth in wichtigsten Dingen angekettet an einen tatkräftigen und gelehrten Ketzerrichter.
Konrad behandelt die seiner geistigen Führung anvertraute Edelfrau gemäß dem Geiste jener Zeit, wie man widerspenstige Schulknaben behandelt: Geißelhieb. Fasten, Backenstreich sind Hilfsmittel seiner Erziehung! Einer so königlichen Seele gegenüber! Alles in uns empört sich über solche Eingriffe in die seelischen Geheimnisse einer echt fraulichen Persönlichkeit.
Wenn ein großer Geist oder ein großes Herz ein ungewöhnlich Ziel erreichen oder ein weitleuchtend Vorbild aufstellen will, so geht das zwar in der Tat nicht ohne Opfer ab – sei es auch das größte Opfer, das irdische Leben. Das Genie saugt Kräfte aus allen verfügbaren Körper-und Seelengegenden und sammelt sich in die eine Gegend, wo die Schlacht geschlagen werden muß. Der einzelne Leib mag oft erliegen: die Menschheit als Ganzes hat eine Schlacht gewonnen. Solche »Askese« wird allezeit als göttlich-groß Achtung verdienen. Die Mutter, die ihres Körpers beste Kräfte für ihr Kind abgibt und darüber selbst das Leben verliert – sie ist ein Urbild solcher Opferung.
Nun, wenn das im natürlichen Verlauf der Schöpfungsdinge geschieht, wenn sich etwa Frau Elisabeth über all der Kranken- und Armenpflege, über fürstlichen, fraulichen, mütterlichen Pflichten und was sonst im Bereich ihrer so spendefreudigen Lebensbetätigung lag, langsam ihres irdischen Kräftevorrats entäußert hätte, um dafür Tausende zu erquicken; wenn sie, früh aufgerieben, zu Eisenach oder Reinhardsbrunn ihr würdig Grab gefunden hätte: – Deutschland hätte doch wohl auch dann eine »Heilige« gehabt?
Wieviel wertvolle Frauen, aufgezehrt in Hilfeleistung und Pflichterfüllung, sind als ungenannte Märtyrerinnen und unbekannte Heilige über diese leidvolle Erde dahingegangen!
Nun halfen freilich, außer ihrem eingeborenen und von heilsbedürftigen Zeit gesteigerten Heiligungsdrang, äußere Schicksalsschläge mit, diese Fürstin auf ihren besonderen Weg zu drängen. Oder eigentlich nur ein einziger Schlag, aber der traf ins Herz: Ludwigs früher Tod und Elisabeths Vertreibung von der Wartburg.
Hierbei fällt uns etwas recht bitter auf und weckt wehmütige Betrachtungen: Elisabeths große Einsamkeit.
Sollte man denn nicht erwarten, daß eine so großzügige Wohltäterin von einer Leibgarde dankbarer Menschenseelen umgeben sei? »Kein Zeitraum«, heißt es in ihrer Biographie, »sah mehr Beweise ihrer Liebe als die Jahre 1225 und 1226, wo eine Teuerung und in ihrem Gefolge schwere Seuchen ganz Deutschland bedrängten. Unzählige nahmen damals zu der Burg ihre Zuflucht, wo sie eine freundliche Fürsorgerin wußten, und keinen wies sie von ihrer Schwelle. Von dem Sommer, den ihr Gemahl, vom Kaiser nach Cremona gerufen, in Italien zubrachte, wird berichtet, daß sie täglich 300 Arme persönlich versorgte« ... Wohlan, wo blieben nun in ihrem Elend diese »täglich dreihundert«? Keine zwei Jahre nach jener Seuche starb ihr Gatte auf dem Kreuzzug fern im Otranto; der Landesverweser Heinrich Raspe jagte die Witwe noch an demselben Abend, der die Nachricht gebracht hatte, von der Burg: und nicht ein Finger rührte sich im Schloß oder in Eisenach, die Obdachlose liebevoll festzuhalten oder aufzunehmen! In einem stallähnlichen Gelaß findet sie zuletzt Unterkunft. Unbegreifliche Härte! Einer Fürstin und Wohltäterin gegenüber! Was für ein feiges und herzloses Bürgertum, das da zu Füßen der Burg saß! Ist das nicht ein erschreckender Beweis für den Tiefstand der damaligen Herzensbildung? Ist das nicht eine Bestätigung Elisabeths und der Notwendigkeit ihres Wirkens? Oder hatte sie, vor lauter Liebkosung fernhergelaufener Bettler und oft gewiß minderwertigen faulen Volkes, vielleicht die nahe und gesunde Gegenwart zu sehr vernachlässigt? Hatte sie hier in der Nähe an Liebe und Achtung verloren, was sie bei jenen Armen gewann? Tragik des Genies! Oder noch mehr: suchte sie Armut und Entbehrung?
War sie so getrieben von religiösen Armutsidealen, daß sie nur halb gestoßen ward, halb aber freiwillig ging? ...
Wir wissen nicht, was Elisabeths Herz bewegte. Als sie später bei ihrem Oheim Bischof Eckbert zu Bamberg würdige Unterkunft gefunden hatte, als am Sarg ihres toten Gemahls, angesichts der heimgekehrten Ritter unter den beredten Zornworten des Schenken Rudolf von Vargila, der zerknirschte Heinrich Raspe weinend in die Kniee sank und Genugtuung versprach: – da schüttelte sie entsagend das Haupt. Sie nahm zwar ein jährliches Leibgeding an und den Witwensitz Marburg: aber auch diese Einkünfte verteilte sie sofort an dortige Arme, denen sie geradezu ein Fest gab. Sie selbst nahm das Kleid der grauen Schwestern und wohnte so ärmlich wie möglich, widmete sich ganz den Kranken und Elenden, verschärfte ihre geistlichen Disziplinen, vergeistigte sich ganz und gar.
Konrad steht wieder an ihrer Seite, strenger als zuvor. Ihre Augen strahlen von visionären Verzückungen; ihr Gebet ist von magnetischer Gewalt. In der Nacht des 19. November 1231 lag sie im Sterben, mit so leuchtendem Gesicht, »daß man sie kaum ansehen konnte«, nachdem sie vorher in Verzückung eine fremdartige Melodie vor sich hingesungen hatte – Stimmen aus andrer Welt begleitend, wie sie sagte, die, für die Umstehenden unhörbar, der bald in den Himmel einziehenden Schwester entgegensangen.
Stimmen aus andrer Welt ... Ja, solchen Stimmen war sie ihr Leben lang gefolgt, die edle Fürstin, die übergütige traumhaft vorübergehende Fremde. Aber die diesseitige Welt? Die ging ihren wilden und wirren Gang. Elisabeths erstgeborener Sohn Hermann verkam und verging tatlos und früh, dem Gerücht nach durch Gift hinweggeräumt. Erbfolgekriege zerrissen die Thüringer Lande. Die tapfere Sophie, die älteste ihrer drei Töchter, vermählt dem Herzog von Brabant, sicherte sich wenigstens das abgesplitterte Hessenland. Die zwei jüngsten Töchter der Heiligen nahmen den Schleier.
Fast scheint es Naturgesetz, daß sich eine Kraft nur besonders stark entwickelt auf Kosten andrer Organe. Nun, dann mußten die Kräfte die über dem Heiligkeitsideal jener Zeit vernachlässigt wurden, früher oder später wieder ihr Recht erobern. Die herzensgeniale Frau Elisabeth und der herzensgeniale Mann Luther – wir achten und verstehen beide. Wir verstehen erst recht Luther aus Elisabeth. Elisabeth flog hinan und hinweg, leicht und licht, durchgeistigten und überirdischen Leibes, flog empor zum Heiligen Geist. Luther aber stand. Luther rief den Heiligen Geist herab auf diese kraftvoll zu verklärende Erde:
»Komm, heiliger Geist, Herre Gott!
Erfüll mit deiner Gnaden Gut
Deiner Gläubigen Herz, Mut und Sinn!« ...
Dein Reich komme!
Thüringer Tagebuch
