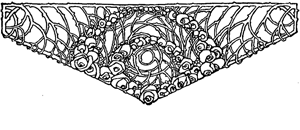|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Geführt auf der Reise von Paris nach Rom im Herbst 1844.
Es ist drei Uhr nachts, ich sitze in Chalons auf dem Dampfschiff, das um fünf Uhr nach Lyon abgehen wird, es regnet so stark, daß der Fall der Tropfen aufs Verdeck sich unten hörbar macht, hier im Saale schlafen einige auf Bänken, nur eine spärlich brennende Lampe gibt mir Licht, von ihr hängt es ab, ob ich meine Reisenotizen bloß anfangen oder zu Ende bringen soll.
Vorgestern nachmittags um fünf Uhr verließ ich Paris, Felix Bamberg, mein Freund und Gefährte, dem ich bei meiner anfangs so dürftigen Kenntnis der französischen Sprache Unendliches zu verdanken habe, begleitete mich auf die Messagerie. Ich kam eben zur rechten Zeit und wurde zum Einsteigen so gedrängt, daß mir kaum zum Abschiednehmen eine schmale Frist blieb; als der Wagen sich in Bewegung setzte, ward mir noch schnell von einem der Arbeitsleute ein Billett und ein sonderbar gesiegeltes Paket überreicht. Es war Bambergs Hand, ich öffnete das Billett und fand ein paar sehr schöne Verse, die in Verbindung mit unsern ernstesten Gesprächen standen; sie lauteten:
Der Klaue, wenn sie das Lebendge faßt,
nimmt selbst der Flügel halb nur ab die Last,
drum, wenn sich schwer Geschaffnes auf dich legt,
denk an den Adler, der die Beute trägt!
Das Paket enthielt eine prächtige Adlerfeder! ich erinnerte mich, daß ich einmal, mit Bamberg durch die Rue de la Paix spazieren gehend, und eine solche Feder an einem Fenster neben andern Sachen ausgestellt erblickend, sagte: die wünschte ich mir, um – und seine Aufmerksamkeit rührte mich tief. Ich dankte dem Freunde noch mit einer Handbewegung, dann verlor ich ihn aus dem Gesicht, und der Wagen rasselte mit einer Eile, die erwünschter sein mag, wenn man der Hauptstadt der Welt entgegenfährt, als wenn man sie verläßt, durch die Straßen dahin. – Die Lampe wollte eben erlöschen und ich zu schreiben aufhören, da kam ein Garçon herein und stachelte sie mit einer Nadel wieder auf; er hatte ein so verdrießliches Gesicht, als ob er schon seit drei Jahren an Leibschmerz litte, aber es sei ihm verziehen, denn ihm verdanke ichs, daß ich fortsehen kann und mich nicht schlaflos auf einer Bank niederstrecken muß. Paris zeigte sich mir noch einmal in seinem höchsten Glanz, auf einige Regentage, die die Wege staublos gemacht hatten, war ein wunderschöner Sonntag gefolgt, es war, als ob die Sonne ihr Gold gespart hätte, um es beim Abschied verschwenden zu können. Die Boulevards, das Palais Royal, das ich am Morgen noch einmal besuchte, die Kais, die Buden, die öffentlichen Gebäude, an denen der Wagen vorüberkam, sie alle hätten als Weihnachtsgeschenke auf den Tisch gesetzt werden können, so glitzerten und funkelten sie. Mir war, als sähe ich sie zum ersten und nicht zum letzten Male; ich hatte mich von ihnen schon losgetrennt, und nun übten sie wieder den Zauberreiz des ersten Eindrucks auf mich aus. Der Jardin des Plantes mit seinen vielen Spaziergängen und der Pont d'Austerlitz, der mich einst zur Julisäule und zu dem riesigen Elefanten geführt hatte, den Napoleon in grandioser Ironie als ein Symbol des die Bastille zerstörenden Volks in Erz gießen lassen wollte, waren die letzten großen Projekte, auf denen mein Auge ruhte.
Bisher bin ich aus Irrtum in der zweiten Kajüte gewesen, ich ging zufällig hinauf, und als ich oben auf dem Verdeck ankam, bemerkte ich einen jungen Geistlichen, ein weißes Kreuz auf der Brust, das trotz der Finsternis gegen den schwarzen Talar deutlich abstach. Er stand da, als ob er das Lamm sei, das alle Sünden der sich Einschiffenden tragen solle, gesenkten Hauptes, aber mit in die Höhe gedrängten Schultern, die ein für allemal entschlossen zu sein schienen, nicht zu erliegen. Ich betrachtete ihn mit Aufmerksamkeit, er wandte sich und stieg eine Treppe hinab, ich folgte ihm und machte die Entdeckung, daß es hier eine erste Kajüte gibt. Schnell ließ ich meine Sachen hinüberschaffen und schreibe nun bei besserer Beleuchtung in einem stattlicheren Salon fort. Die Situation ist pikant, um mich herum sitzen Herren und Damen auf Bänken und Stühlen, einige plaudern, andre halten sich die Ohren zu und versuchen einzuschlafen, auf dem runden Tisch, an dem ich schreibe, steht ein Licht, mir vis-a-vis befindet sich ein alter Abbé und liest in seinem Brevier. Er läßt sich so wenig durch mich, als durch andre stören, beantwortet aber jedes comment vous portez vous mit dem üblichen très bien, merci, und liest dann wieder fort, bald leise bald laut. Es ist, als ob er auf der Himmelfahrt begriffen wäre und nur deshalb nicht anlangt, weil seine Freunde und Bekannten ihn durch ihre Glückwünsche, die zu wohlgemeint sind, als daß er sie zurückweisen dürfte, daran verhindern. Neben ihm sitzt noch ein zweiter Geistlicher, ein echtes Pfaffengesicht, spitze Nase, scharfe Augen, die sich der Brille, unter der sie hervorblitzen, wohl nur bedienen, um sich unter ihr zu verstecken, breiter, sinnlicher Mund. Dieser beobachtet mich unablässig; er würde, wenn der heilige Geist sich herabließe, ihn in seiner Divinationsgabe zu unterstützen, gewiß lieber das Blatt, das ich hier beschreibe, zum Gegenstand seiner Forschung machen, als einen dunklen Bibelspruch. Es ist Tag geworden, erst blauschwarze Dämmerung, dann ein Morgen ohne Sonne, es regnet fort, alles bleibt in der Kajüte, und so schön die Ufer der Saone auch sein mögen, ich muß, wenn ich nicht durchnäßt werden will, dasselbe tun. Man wird doch ein andrer auf Reisen! Ehemals scheute ich mich, aus Furcht vor Ostentation, in Anwesenheit fremder Menschen auch nur eine einzige Notiz zu Papier zu bringen; jetzt fasse ich in einer Gesellschaft, die mir kaum ein Eckchen am Tisch frei läßt, ein ganzes Reisetagebuch ab, und finde mich durch die mit Verwunderung auf mir haftenden Blicke meiner Umgebung so wenig gestört, als ob alle diese neugierigen Augen Schwalben, Spatzen und Tauben angehörten. Und das ist gut, denn der alte Goethe hat recht: Zustände gehen unwiederbringlich verloren, wenn man sie nicht zu fixieren sucht, solange sie noch frisch sind. Es hat sich hier, während ich diese Bemerkung niederschrieb, eine Gruppe gebildet, die ich durchaus zeichnen muß, ehe sie sich wieder verändert. Die beiden Geistlichen sitzen noch immer am alten Platz, der eine hat zu lesen aufgehört, dafür haben aber beide zu beten angefangen, und ihnen vis-a-vis an der entgegengesetzten Kajütenwand haben sich ein paar junge Herren placiert, die neue Romane in der Hand halten. Der ältere der beiden Priester schlägt von Zeit zu Zeit die Augen auf und blinzelt, um zu sehen, welchen Eindruck seine sichtbare Frömmigkeit auf die beiden Weltkinder macht; dann gähnen sie ihn jedesmal an, er sollte sich dadurch eigentlich nicht beleidigt fühlen, denn es kann ja ebensogut ihrer Lektüre gelten, wie ihm, dennoch verdrießt es ihn. Sein Kollege nimmt von der Umgebung nicht die mindeste Notiz, er zwingt mich jedoch, die Frage aufzuwerfen, ob man andächtig sein Gebet verrichten und dennoch Mühe haben kann, das Gähnen zu unterdrücken. Es geht ihm selbst nämlich so; während sein Mund sich bewegt wie eine Mühle, auf der ein Menschengeist zu lauter Paternostern vermählen wird, deuten gewisse in die Quere laufende und nur leise aufzuckende Muskelbewegungen auf unwidersprechliche Weise an, daß er gähnen könnte, wenn er nicht beten müßte.
Ich habe das Verdeck bestiegen, das Wetter wechselt beständig zwischen naß und trocken, und es ist eben jetzt leidlich. Als ich hinaufstieg, wunderte ich mich nicht wenig, ein seltsames Gebäude, das ich erst eine Minute nachher für eine Brücke erkannte, über uns wegsegeln zu sehen. Die Sache verhielt sich aber so, daß der bewegliche Schornstein unsers Schiffes niedergelassen worden war, um das Durchpassieren möglich zu machen; es sah aus, wie eine Höflichkeitsbezeugung des Rauchfangs vor der Brücke und wiederholte sich noch oft. Jetzt schwimmt ein Floß an uns vorbei, auf dem sich nur ein einziger Mensch befindet; dieser steht auf einem der über das Wasser emporragenden Balken, auf einem andern ist ein Feuer angemacht, und über dem Feuer, an einem Staken befestigt, hängt ein Kochtopf: ein vortreffliches niederländisches Bild! Die Ufer der Saone sind bis jetzt nicht schön und können es auch bei Sonnenschein nicht sein. Auf der rechten Seite ziehen sich leise anschwellende Berge hin, hier sieht man viel Wein; auf der linken erblickt man eine flache Ebene, und auf dieser viel Gebüsch und Gestrüpp, in der Ferne zeigt sich dünner Wald. Jene deuten auf Fruchtbarkeit, diese auf das Gegenteil; dort hat die Natur das Gesicht, das eine gute Hausmutter bei festlichen Gelegenheiten zu machen pflegt, hier die Miene, womit sie am folgenden Tage, um den Aufwand wieder einzubringen, die Reste aufsetzt. Eben legen wir bei Macon an, es ist schon die zweite Stadt, die wir passierten, und unser Schornstein verneigt sich abermals ehrfurchtsvoll vor der Brücke, damit sie ihm nicht das Genick breche. Während die Passagiere aus- und einsteigen, nähert sich eine alte Frau mit Weintrauben, der Restaurateur des Dampfschiffes will ihr den ganzen Korb voll auf einmal abkaufen, ich komme ihm aber zuvor und bitte mir für zwei Sous aus. Sie reichte mir in einer Art von Schaufel eine solche Portion, daß ich glaube, sie hat mich mißverstanden, es ist aber alles in Ordnung, und ich habe ein Frühstück, wie man es nicht billiger und auch nicht köstlicher haben kann. Die Trauben sind gar zu schön, einzelne Beeren so groß wie Kirschen; man freut sich ebensosehr, sie zu sehen, wie sie zu essen. Dabei erinnere ich mich lebhaft der ersten Weinbeere – denn mit Beeren fing ich an, an eine ganze Traube war in meinem von Bacchus verfluchten Vaterlande nicht zu denken –, die ich in meiner Kindheit gegessen habe. Ich zitterte vor Wonne, wie mir die Beere geboten ward, und dennoch zögerte ich, zuzugreifen; die Weintraube hatte ihrer Seltenheit wegen einen fast heiligen Reiz für mich, aber es war eine unglückliche, eine unreine Hand, die mir den Erstling reichte, die Hand eines jungen Frauenzimmers, deren Gesicht durch eine scheußliche Krankheit entstellt war, und während meine Gefährten, weniger ekel, mit ihrem Anteil fröhlich davonsprangen, schwankte ich, ob ich die Gabe nehmen sollte oder nicht. Zuletzt siegte die Begierde, ich wusch die Beere jedoch, bevor ich sie genoß, sorgfältig im Wasser ab und tat dadurch auch meinem Widerwillen genug.
Es ist eine neue Gesellschaft an Bord gekommen, drei Nonnen in schwarzen Roben, mit weißen Flügelhauben, auf der Brust ein messingenes Kreuz, an der Seite mächtige Rosenkränze, sie setzten sich mir gerade gegenüber, zwei sind ältlich, obgleich nicht alt, die dritte ist jung, und gerade die trägt eine Brille. Mit französischen Nonnen habe ich ein noch größeres Mitleid wie mit andern, sie können sich nicht so leicht resignieren, wie die deutschen, und sich nicht so glühend enthusiasmieren, wie die spanischen, sie müssen den härtesten Kampf mit dem Fleisch bestehen und werden dafür doch nicht mit einem Heiligentraum belohnt. Wie oft habe ich sie beklagt, wenn ich sie in Paris im Tuileriengarten oder wohl gar auf den Boulevards erblickt! – Jetzt scheint die Sonne schon seit einer Stunde ohne Unterbrechung, und die Ufer des Flusses werden reizender; die Berge, die wir anfangs zur Seite hatten, liegen hinter uns, und links und rechts erblickt man Dörfer und kleine Städte; eine Menge Brücken, von denen man in Deutschland gewiß manche gespart hätte, führen herüber und hinüber.
Jetzt, ein Uhr mittags, sind die Ansichten, welche die Saone darbietet, in Wahrheit wirklich lieblich schön; sie tragen den Charakter des Neckartals und erinnern besonders an Heidelberg. Das Dampfschiff geht lustig, Wind und Wetter begünstigen uns ausnehmend, ich werde heute abend um sechs Uhr in Lyon, ich kann, wenn ich morgen in der Frühe wieder abreise, nachmittags in Marseille sein. Das geht rascher, als ich gedacht habe, auch mein Französisch fließt ganz leidlich, zum eigentlichen Konversieren im deutschen Sinne wäre ich ohnehin nicht aufgelegt, denn ich habe innerlich genug zu verarbeiten und kenne gar keinen süßeren Zustand als denjenigen, in dem man eine Menge von Gedanken und Empfindungen nur halb durchdenkt und durchführt, weil sie zu schnell hintereinander kommen, und das Oberflächliche kann ich sehr gut traktieren. Auf dem Schiff befindet sich ein junger französischer Student, der mir freundlich auf meine Fragen über die Städte und Örter, an denen wir vorbeisegeln, Auskunft gibt; er wird im nächsten Jahr nach Heidelberg gehen, um Deutsch zu lernen, und fragt mich mit Naivität, ob das wirklich so schwer sei, wie man ihm überall sage. Ich gab ihm den Rat, er möge, bevor er mit der Sprache beginne, sich in irgend etwas Deutsches verlieben, in die Literatur, die Geschichte oder ein schönes Mädchen, dann werde es schon gehen.
Wir trafen schon um zwei Uhr in Lyon ein; die Gegend wird immer schöner; Villen, die mehr oder minder stolz von den Bergen herabschauen, kündigen die zweite Hauptstadt Frankreichs an, und bei einer plötzlichen Biegung des Flusses tritt sie selbst hervor. Der Augenblick des Ausschiffens ist immer ein widerwärtiger: Dies Passen aufs Gepäck, das man sich nun einmal nicht stehlen lassen darf, weil man sichs ja gleich wieder anschaffen müßte, dies Kämpfen mit der Unverschämtheit der Träger, dies Suchen nach einem Lokal in einem Moment, wo man die neuen Gegenstände so gern ruhig auf sich wirken lassen möchte, alles dies verwischt den goldenen Duft der Frische, der so unendlich reizend ist, bevor er noch genossen wurde, und erzeugt eine ärgerliche Stimmung.
Lyon liegt ungefähr wie Heidelberg, nur mit dem Unterschiede, daß alles, was es Heidelberg ähnlich macht, sich großartiger zeigt; es ist an der einen Seite ganz, an der andern eine Stunde lang von Bergrücken eingeschlossen; die Rhone fließt mitten durch die Stadt und hat ein äußerst prächtiges Aussehen, imposante Brücken führen über den breiten Fluß, und links und rechts ziehen sich nach Art der Pariser Boulevards Spaziergänge hinunter, die mit Alleen bepflanzt sind. Man sieht es der Stadt an, daß die Kaufleute sie gebaut haben, die Häuser sind alle massiv und von schwindelerregender Höhe, der Place Louis le Grand mit der Statue dieses von den Franzosen naiverweise so hoch gestellten Königs ist imposant, und besonders hier tritt die Ähnlichkeit mit Heidelberg hervor, denn ungefähr wie in Heidelberg das Schloß auf den Karlsplatz, blickt hier ein ähnliches, obgleich nicht so mittelalterlich-romantisches Gebäude auf den Platz von einem ernsten Berge herab. Das Hotel de Ville ist ein bedeutendes Gebäude; Heinrich der Vierte mit seinem gutmütigen Gesicht, der seinen Untertanen nur darum in die Töpfe gucken möchte, um sich zu überzeugen, ob sie Sonntags auch wirklich ein Huhn darin haben, nicht aber, um ein gestohlenes Stück Wild noch auf der letzten Station zum Magen zu ertappen, schaut vom Hauptportal, wie in Paris, zu Pferde auf die Ein- und Ausgehenden herunter, und wenn man das Gebäude durchschreitet, gelangt man ans Theater, dessen Fassade man schon vom Hof aus erblickt. Merkwürdig war mir das äußerst schlechte Straßenpflaster, das aus lauter spitzen Steinen besteht, die für das Zerstechen der Stiefel recht eigentlich geschliffen scheinen; man sollte glauben, daß lauter Schuster und Hühneraugenoperateure im Magistrat sitzen. Ich erhielt im Hotel de Provence, dem ersten der Stadt, ein Zimmer, ließ meine Sachen hineinbringen und ging dann aus. An den Boulevards traf ich ein Café, in dem außerordentlich viel Menschen versammelt waren, ich trat ebenfalls ein und fand gleich auf dem ersten Tisch die Allgemeine Zeitung, ein Beweis, daß sich in Lyon, wie in Paris, viele Deutsche aufhalten, die, um nicht aus der Gewohnheit zu kommen, sich durch die alte Großmutter in Augsburg, der die Giftzähne ausgebrochen sind, ihre politische Speise vorkauen zu lassen. Abends ging ich zeitig zu Bett und schlief so fest ein, daß, als der Garçon mich morgens um vier Uhr fürs Dampfschiff weckte, ich wirklich noch im tiefsten Schlafe lag, was mir auf Reisen selten begegnet; aber ich war so ermüdet, daß ich sogar einnickte, als ich im Café saß. Um halb fünf Uhr bestieg ich das Dampfschiff, das nach Avignon fährt. Gestern, beim Aufsuchen des Hotels, machte ich die Bekanntschaft eines Italieners, der mich, wie es mir zum Schaden meiner Börse oft begegnet, ohne weiteres für einen Engländer genommen hat, denn als ich ihn abends wieder traf, sprach er fortwährend von London und Paris und dem Unterschied, den ich zwischen beiden Städten gefunden haben werde, und heute auf dem Dampfschiff setzt er das Gespräch fort. Ich unterbreche mich auf einen Augenblick, um ein Bild, das sich hier in der zweiten Kajüte zusammengestellt hat, während ich schreibe, abzuzeichnen. Es sitzt mir gegenüber ein junges Ehepaar, ein Offizier mit seiner schwarz verschleierten Frau; sie haben sich zum Schlafen aneinandergelehnt und auf ihrer beider Schoß ruht ein Hund, groß genug, um ein ganzes Dorf zu bewachen, aber so mager, daß es scheint, als ob er nur mit Liebkosungen gefüttert würde; vielleicht ist die Auszeichnung, die er in diesem Augenblicke genießt, sein Diner. Außer dem Italiener, der Schriftsteller ist, wie er mir sagt, und eine Nase hat, wie Michelangelo, nur daß sie dem schmächtigen Männchen mit seinen dünnen Strickbeinen nicht so gut steht, nimmt mich auch noch ein junger Franzose, der nach Korsika reist, für einen Engländer. Er greift Peel an und wundert sich, daß ich ihn nicht verteidige; er fragt mich spitzig, ob England außer seinen parlamentarischen, die er sehr plump finde, noch andre große Redner habe, und erstaunt, daß ich die Frage einfach verneine. Ich lasse mir die Rolle, die man mir ohne Umstände zugeteilt hat, ruhig gefallen, mache aber dabei die sehr schmerzliche Erfahrung, daß jeder, der nicht eben ein Deutscher ist, den Fremden schon durch seine bloße Nationalität imponiert, daß aber der Deutsche dieses historischen Beigewichts entbehrt und bankrott macht, wenn er sich nicht auf persönliche Vorzüge und persönliche Bedeutung berufen kann.
Das Dampfschiff fliegt davon wie eine Nußschale, die ein Knabe in den Fluß warf, wir haben die herrlichste Reise und nähern uns Avignon. Die Berge, die den Fluß lange Zeit eingekeilt hatten, weichen mehr und mehr zurück, alles wird öder, man erblickt viele Ruinen von alten Schlössern, wie in Süddeutschland, die Felsen nehmen seltsame Gestalten an. Der Italiener zeigt mir Savoyen, dessen blaue Gebirge, mit Schnee bedeckt, herüberschimmern; endlich erblicken wir die »Stadt des Papstes«, dem oberen Teil nach, der zuerst ins Auge fällt, auf ein mächtiges Felsenfundament gebaut. Am Ufer, wo wir anlegen, ist eine außerordentliche Menschenmenge versammelt, das deutet aber wohl mehr auf den Sonntag, als auf große Bevölkerung. Ein alter Mann trägt meine Sachen in die Stadt aufs Bureau der Messagerie; ich will sogleich weiter, aber es ist kein Platz mehr, für heute nicht und wahrscheinlich auch nicht für morgen. Schöne Posteinrichtung! Doch in diesem Punkt steht Frankreich überall hinter Deutschland zurück. Ich werde verdrießlich, widerstehe aber nun einem zudringlichen Garçon, der mit seinen Kollegen auf die Reisenden fahndet, nicht länger, sondern lasse mich ins Hotel schleppen. Meine Bekannten vom Dampfschiffe sind glücklicher gewesen, wir dinieren noch zusammen und scheiden auf Nimmerwiedersehen. Nach dem Essen gehe ich, um mir die Stadt zu betrachten; ich komme bald aus dem Tor und finde eine Promenade, die sich am Fluß hinzieht. Sie ist voll von Spaziergängern, man erblickt besonders viele Mädchen, nicht sehr geputzt, aber mit interessanten Gesichtern, italienisch-scharf geschnitten und katholisch zusammengehalten. Um sechs Uhr kehrt alles in die Stadt zurück, ich schließe mich dem Zuge an und sehe mit Verwunderung, daß man nur die eine Promenade mit der andern vertauscht, denn man setzt auf dem Place d'Horloge den Spaziergang fort, obgleich dieser Platz nur klein ist und der schönen Allee vor dem Tore keineswegs vorgezogen zu werden verdient. Der Platz ist von Gebäuden eingeschlossen, ich bemerke die Hauptwache, das Theater, das sich, nicht zu groß und nicht zu klein, recht hübsch und angemessen zeigt, und viele Kaffeehäuser, in denen das Militär zu dominieren scheint. Es wird finster, von den schönen Mädchen verschwinden viele, einzelne schwere Regentropfen fallen, falbblaue Blitze zucken am Himmel auf und verbreiten für eine Sekunde ein gespensterhaftes Licht, das der schwarze Erdspiegel reflektiert. Plötzlich stellt sich ein militärisches Musikkorps zusammen, und meine Verwunderung ist gelöst. Es werden einige Stücke voll Kraft und Leben gespielt, ich wandle unter all den fremden Menschen auf und nieder, meine Brust hebt sich, meine Füße werden elastisch, und doch beschleicht mich, wenn ein Blitz gen Himmel aufreißt und ein Regenguß darauf folgt, ein ganz eignes Gefühl. Ich bin in Avignon, wo mich keiner von meinen Freunden und Bekannten sucht, ich kann sterben, ich kann begraben werden, und sie würden vielleicht nie oder doch erst sehr spät erfahren, wo?
Dennoch ist dies Gefühl kein katzenjämmerlich-wehmütiges. Die Militärmusik ist vorbei, ich gehe in ein Café, ich glaubte, daß drinnen zum Tanz aufgespielt würde, aber ich habe mich getäuscht. Es wird nur Bier und Kaffee getrunken, und zwei phantastisch herausgeputzte Mädchen mit roten Kleidern und spitzigen Vogelgesichtern, die nebst einem kleinen Kinde vor dem »Orchester« stehen, singen in Pausen einen Chanson, der trotz der gläserdürren Stimmen regelmäßig beklatscht wird. Um acht Uhr begebe ich mich nach Hause, um mich schlafen zu legen, ich erhalte ein Zimmer ohne Fenster angewiesen, wie ich den Garçon darauf aufmerksam mache, öffnet er mit Gleichmut die Tür und zeigt mir die Fenster des Korridors. Am andern Morgen stand ich, vom Sonnenlicht abgesperrt, wie ichs war, erst um neun Uhr auf, ich eilte gleich auf die Messagerie, aber es war richtig kein Platz nach Marseille zu bekommen, doch wurde mir die Möglichkeit in Aussicht gestellt, daß auf dem aus Lyon für Marseille zu erwartenden Wagen noch einer vakant sein könne. Was war zu tun? Ich mußte mich der Notwendigkeit fügen und schweife jetzt denn wieder ohne Zweck und Ziel in der Stadt umher. Die schönen Mädchen, die mich gestern begrüßten, lassen sich heute nicht finden, man muß sie sich spinnend, nähend, Kartoffel schälend, schmutzige Teller spülend vorstellen, die Straßen sind schmal und der hohen Häuser und Gartenmauern wegen dunkel wie Kirchenhallen. Das schickt sich für die geistliche Stadt, das Pflaster ist so schlecht, als ob es für wallfahrende Sünder ersten Ranges angelegt wäre, die ihre Füße martern sollen, um ihr Gewissen zu erleichtern, dies macht das Spazierengehen hier zur Arbeit. Ich besah mit einem Deutschen, der mich an einem vaterländischen Fluch als Landsmann erkannt hatte, mehrere Kirchen, er suchte ein Kreuz, und das war leicht zu finden, aber es sollte ein in seinem Wegweiser bezeichnetes elfenbeinernes sein, und das konnte er nirgends aufspüren. In der Kathedrale besahen wir das verwitterte Grabmal eines Papstes, dann trennten wir uns, und ich ging allein in das sogenannte Hotel du Pape. Es ist jetzt zu einer Kaserne hergerichtet, die roten Hosen trommeln und pfeifen, wo die schwarzen Röcke einst gelispelt und gewispert haben; dicht neben dem Konklave wird gekocht, und die Kapelle selbst, die diesen stolzen Namen noch immer führt, ist zu einem ungeheuern Schlafzimmer hergerichtet. Eine Beschließerin führte mich mit einem feierlichen Gesicht herum und sprach mir viel von kostbaren Malereien, die nicht mehr zu sehen waren, ich hätte ihr das Trinkgeld in einer Anweisung auf das Fünffrankstück, das ich in Paris einmal verlor, bezahlen sollen. In einem ganz zerstörten Teil des weitläufigen Gebäudes zeigte sie mir die Spuren der Revolution: Gräber und Keller von Abgrundstiefe, in die man Priester und Adlige zu Hunderten hinuntergestürzt habe; es waren an den Wänden noch in der Tat die Blutspuren zu sehen. Ich machte sie auf den seltsamen Wechsel aufmerksam, der mit dem Gebäude vorgegangen sei; sie seufzte und sagte: Die Soldaten sind allerdings schlechte Heilige. Ich erwiderte: Die Heiligen möchten aber doch noch schlechtere Soldaten sein, denn sie sind im Besitz gewesen und haben sich vertreiben lassen! Die Rede schien ihr nicht zu gefallen, denn sie hielt plötzlich inne, streckte die Hand aus und bemerkte mir, jetzt habe sie mir alles gezeigt.
Drei Meilen von hier liegt Vaucluse mit der berühmten Quelle des Petrarca. Die Spuren eines großen Daseins suchte ich gestern auf, denn sie sind für mich nicht bloß magnetisch, sondern auch elektrisch, aber weil ich nicht weiß, ob ich nicht doch noch heut abend einen Platz für Marseille erhalte, darf ich mich nicht von Avignon entfernen. In einer Straße bemerkte ich vor einem über der Tür eines Hauses in einer Nische angebrachten Madonnenbilde eine der Madonna geopferte Traube; sie war schon welk, das zeigt, daß ein solches Opfer hier vor der Lüsternheit der Schuljugend sicher ist, aber es wird mehr für die Wohlfeilheit der Weintrauben, wie für die Frömmigkeit der Knaben beweisen. Eine dem Place des Armes benachbarte, ungewöhnlich enge Gasse ist ganz mit zerrissener Leinwand überhängt, mit deren Fetzen der Wind spielt, darunter hantieren Schlächter und Krämer. Ein wunderlicher Anblick und eine ganz unsinnige Einrichtung, denn die Leinwand befindet sich in einem Zustande, daß sie so wenig die Sonne als den Regen abzuwehren vermag, sie verschafft den Leuten bloß das Vergnügen, daß sie sich den Himmel als mit Lumpen unterfüttert vorstellen können. Man bemerkt in der Stadt des Papstes viele Steinhauerläden, in welchen Bischofsköpfe mit strengen Mienen und stolzen Mitren feilgeboten werden; alles wird mehr und mehr exklusiv-katholisch. Avignon hat Festungswerke, hohe Mauern mit spitz zulaufenden, zinkenartigen Warttürmen ziehen sich rings um die Stadt herum wie ein Stachelgürtel, aber sie werden schlecht unterhalten, aus Ritzen und Spalten schießt das grüne Unkraut lustig hervor, und die Türme sind nicht mit Soldaten besetzt, sondern arme Familien scheinen darin zu wohnen. Wenigstens bemerkte ich dies an einem, von dem oben ein brauner Mädchenkopf heruntersah, während unten vor der Tür eine alte Frau saß, welche einige Hühner, die aus dem düstern Souterrain ans Tageslicht wollten, zurücktrieb. Meine Gänge hatten keinen andern Zweck, als mir die Zeit zu vertreiben, die für mich, der ich an das Pariser Fahrwasser gewöhnt war, in diesem leblosen Ort ihren Faden noch einmal so lang wie gewöhnlich auszuspinnen schien. Endlich war es fünf Uhr, und ich konnte zum Diner gehen. Kaum aber saß ich, als ein Faktor von der Messagerie mir anzeigte, daß die Lyoner Diligence noch einen Platz für mich habe. Rasch sprang ich auf, er sagte mir jedoch, ich könne gern noch essen; ich verzehrte also noch, was ich bezahlt hatte, trank meinen Wein, steckte mein Dessert zu mir und eilte fort.
In zwei Minuten ging es vorwärts, und nun kehrte das frische Lebensgefühl mir wieder zurück, das mich schon zu verlassen gedroht hatte. Es wurde bald finster, ich kann daher nicht beurteilen, ob der Weg von Avignon bis Marseille wirklich so öde ist, wie er mir auf der Post beschrieben wurde, als ich einige Neigung blicken ließ, ihn zu Fuß zu machen. Was ich am nächsten Morgen sah, die letzte Strecke, entsprach dieser abschreckenden Schilderung durchaus nicht, denn wenn man auch nur wenige Spuren von eigentlicher Fruchtbarkeit entdeckte, wenn die lachenden Weinberge auch ganz verschwunden und kahle Felsen, mit unbekannten Kräutern, namentlich einem breitblättrigen Rohr bewachsen, an ihre Stelle getreten waren, so boten auch diese doch Abwechslung genug dar und ließen keine Ermüdung aufkommen. Die Natur veränderte sich sichtlich und trat in ein neues Stadium. Schon in Avignon hatte ich auf dem Markt allerlei Früchte bemerkt, die ich nicht zu nennen und über deren Gebrauch ich mir nicht Rechenschaft zu geben wußte; neben dem Granatapfel ungeheure Birnen, krumm gezogen und kurzstielig, und andres Obst in gesteigerten Dimensionen und mit erhöhten Farben. Jetzt erblickte ich ganz fremdartige Bäume und Gesträuche, welche mir zudringliche Fragen vorlegten, die ich nicht beantworten konnte, und das ist für mich auf Reisen immer ein höchst wichtiger Moment. Unterwegs in der Nacht wurden uns einmal, während der Wagen eine Minute anhielt, bei dem Flackerlicht einer Laterne gelblich-weiße Trauben mit taubeneiergroßen Beeren angeboten; ich kaufte sie und sah später in Marseille ganze Körbe voll davon auf den Straßen stehen. Am Morgen sah ich einmal bei einer plötzlichen Biegung des Weges im hellsten Sonnenschein das Meer vor uns liegen, schwarzblau, wie angelaufener Stahl, in der tiefen, geheimnisvollen Mutterfarbe, aus der sich alle übrigen sanft in leisen Übergängen auszuscheiden suchen; kreideweiße Felsen umgaben es, eine mit kleinen Häusern und Hütten übersäte Niederung, von der ich nicht begreife, wie sie gegen Sturmfluten gesichert sein kann, lag davor. Aber schnell, wie es aufgetaucht war, verschwand es wieder, mir blieb kaum die Zeit, ihm meinen Gruß zuzurufen. Ganz dicht vor Marseille erblickte ichs zum zweitenmal, ein kleiner hübscher Knabe, der mit seinem Vater neben mir im Coupé saß, jauchzte auf, als er das erste Schiff, das mit vollen Segeln ging, entdeckte, und so naiv der Ausbruch seines Gefühls war, so tief war es begründet, denn das ungeheure Element hat nur dann nichts Erdrückendes mehr für den Menschen, wenn er es bewältigt, wenn er es zum Medium menschlicher Geistestätigkeit herabgesetzt sieht.
Nun fuhren wir in Marseille ein, und ich hatte den letzten Punkt des südlichen Frankreichs erreicht. Marseille hat bei weitem kein so imposantes Ansehen wie Lyon, ich hätte es mir viel größer vorgestellt. Die Häuser sind klein und schmutzig, die Straßen eng, die Hauptpromenade ist zugleich Markt, beim Einfahren bemerkte ich ein schönes, neues Tor mit trefflichen Skulpturen, aber es scheint bloß für die unsichtbar aus- und eingehenden Engel gebaut zu sein, denn Wagen und Fußgänger passieren es nicht, sondern umfahren und umgehen es, da es auf einem bis jetzt freien Platz steht; das sieht denn absonderlich aus. Das Bureau der Messagerie ist am Hafen; ich war auf ein achttägiges Vorankerliegen gefaßt, da ich aus den Zeitungen wußte, daß die Schiffe nach Civitavecchia nur dreimal im Monat gingen, und da ich den Tag der Abfahrt in Avignon gezwungnermaßen versäumt hatte, wie angenehm wurde ich daher überrascht, als ich gleich beim Absteigen erfuhr, daß ich noch denselben Abend abreisen könne. Freilich hatten die Zeitungen recht gehabt, aber das Schiff war nicht abgesegelt, weil zu meinem Glück nicht Passagiere genug vorhanden gewesen waren. Augenblicklich ging ich aufs Schiffsbureau und von dort aufs dänische Konsulat, das durch den Hamburger Konsul mit versehen wird, um das nötige Visum beizeiten einzuholen. Ich traf einen alten Mann, in hechtgraues Tuch gekleidet, mit weißen Haaren und jenem selbstzufriedenen, gegen die ganze Welt abgeschlossenen echt hamburgischen Gesicht, das sich, da es sich selbst nach dem Brande und den Almosen, die man infolgedessen von der ganzen Welt empfing, nicht verändert hat, wohl nie verändern wird. Ich wurde nicht landsmannschaftlich von ihm behandelt, und es war mir doch merkwürdig, daß der einzige ungefällige, ja plumpe, rohe Mensch, den ich in ganz Frankreich traf, ein Deutscher und dann auch wieder ein Hamburger sein mußte.
In meiner übergroßen Eile hatte ich mir mein Hotel nicht gemerkt, es kostete mir nicht wenig Mühe, es wieder aufzufinden, da ich so wenig das Wahrzeichen als die Straße wußte, es gelang mir jedoch. Nun frühstückte ich und ging dann aus, die Stadt zu besehen. Ich ging durch die Rue de Paradis bis an den Cours Bonaparte, es war Mittag, die Hitze lag wie sichtbar auf den Bergen und brütete ihre Ungeheuer aus: in dem ihrer nicht gewohnten Nordländer den Wahnsinn und in dem Südländer jene Wut der Leidenschaft, die man die vernünftige nennt. Der Cours Bonaparte führte mich langsam aufwärts, einem kastellartigen Gebäude entgegen, um das ich kleine Kapellen und Kreuze in Menge herumgesät sah, und das mit Soldaten besetzt war. Ich wußte nicht, ob das Ersteigen erlaubt sei oder nicht, und grüßte, um ein gutes Vorurteil für mich zu erwecken, auf das andächtigste einige Muttergottesbilder, was ich um so lieber tat, als es an heißen Tagen sehr angenehm ist, von Zeit zu Zeit den Hut abzunehmen. Dabei stieg ich immer höher, erreichte den Gipfel und trat nun, ohne von der Wache gehindert zu werden, in das Gebäude selbst ein. Es ist ein Glockenhaus, die Besuchenden erfahren es aus einer an der Wandglocke angebrachten Aufforderung, für die Notglocke U. L. F. beizusteuern, zugleich dient es zur Wohnung einer Familie, wahrscheinlich des Telegraphenwärters, denn auf der Höhe dieses felsichten Berges thront ein Telegraph. Man hat von hier aus eine wunderbar schöne Aussicht auf das Meer und die Stadt; tiefblau liegt jenes da, zackige Felsen ziehen sich noch weit hinein, aber endlich verschwinden sie, und das erhabenste Bild der Unendlichkeit wird durch nichts mehr gestört.
Lange genoß ich den köstlichen Anblick und glaubte, obgleich ich nur das Auge badete, den ganzen Körper zu erfrischen, indem ich die Hitze nicht mehr so spürte wie vorher, dann stieg ich wieder herunter und streifte noch in der Stadt umher. Im Hafen sah ich Gondeln, die ersten, die ich jemals erblickte; vor der Börse, die aus Holz ausgeführt ist und einem Bretterverschlage ähnlich sieht, stand ein Trompeter und blies, wie bei uns vor den Buden der Equilibristen geblasen wird; wahrscheinlich war der Schluß nah. Darauf kehrte ich in mein Hotel zurück, um zu dinieren; kaum hatte ich mich im Speisesaal an einen Tisch gesetzt, als eine Familie erschien, die in demselben Gasthof wohnte und, wie mir ein Kellner später vertraute, nach Nizza reiste. Ein Papa, ganz comme il faut, um die Schlecker und Lecker fernzuhalten, ohne zugleich die Schwiegersöhne in spe, die honetten jungen Leute mit ernsthaften Absichten, zu verscheuchen, eine freundliche, gesprächige Mutter und ein sehr holdselig-zartes Wesen von Tochter mit kastanienbraunen Haaren und leuchtenden Augen, das Köpfchen anmutig gesenkt. Das Mädchen kam mir vis-a-vis zu sitzen und schenkte mir so viele Blicke, als wollte sie mich dafür entschädigen, daß ich sie nur einmal und dann niemals wiedersehen sollte.
Nach dem Essen wechselte ich mir Gold ein, und dann gings zu Schiff. Auf dem Verdeck umherwandelnd und, während alles um mich herum arbeitete und die Abfahrt vorbereitete, die letzten Eindrücke in mir zum Brennpunkt sammelnd, sowie das in leisen Umrissen aufdämmernde Kommende ahnungsvoll im voraus genießend, empfand ich jetzt stundenlang eine solche Seligkeit des gesättigten Daseins, wie ich sie noch nie empfunden habe und vielleicht auch nie wieder empfinden werde. Es war fünf Uhr, die Sonne senkte sich ins Meer, es war noch hell, aber nicht mehr heiß, dann nahm auch das Licht ab, und es wurde durch einen wunderbaren Duft, in dem alle Farben sich aufgelöst zu haben schienen, ersetzt, zuletzt verlor dieser sich in ein tiefes, schönes Rot, das unten am Horizont anschoß und erst sehr spät, als das Schiff den Hafen schon verlassen hatte und in die offene See hinauseilte, verlosch. Ich ging, ohne aufhören zu können, auf und nieder, ich hatte das Gefühl, daß ich den höchsten Augenblick meines Lebens genieße, und daß seine längere oder kürzere Dauer sogar von der durch das Gehen bedingten Rhythmik meines Leibes abhänge, es war ein ganz einziger Zustand, der wohl darin seine Erklärung finden mag, daß ich nur durch eine Art von Wunder zu einer Reise nach Italien, von der ich früher kaum träumen durfte und auch wirklich nicht träumte, gekommen war. Dann Souper, komische Unterhaltung auf dem Verdeck mit englischen Bedienten, die mit ihrer Herrschaft die ganze Welt durchstreift sind und die verschiedenen Länder und Völker auf ihre Weise charakterisierten, und endlich eine ruhige Nacht ohne Anwandlung von Seekrankheit im bequemen Bett.
Das war der erste Oktober, das Schiff heißt Elba, es geht trotz der Anwesenheit englischer Damen schon sehr italienisch darauf zu, die Leute, die unten bei den Maschinen arbeiten, kommen zuweilen splitternackt herauf und ziehen, wenn sie oben verweilen sollen, höchstens Hosen an. Am nächsten Tag erblickte ich vormittags die Küste von Korsika, und nachmittags kamen wir ihr so nah, daß wir in die wilden, schauerlichen Bergschluchten, woraus sie besteht, deutlich hineinschauen konnten. Auch einige Mühlen und an die Felsen angebaute Hütten bemerkte ich; etwas von der Küste entfernt, wie durch einen titanenhaften Vorfahren Napoleons ins Meer hineingeschleudert, liegt ein einzelner Felsblock, auf dem ein halbverfallener Turm steht. Eben jetzt, abends gegen fünf Uhr, wenn ich nach den Vorbereitungen zum Diner schließen darf, fahren wir an der Insel Caprera vorbei, die ganz so aussieht wie Korsika, und die Insel Elba liegt gerade vor uns. Die Gedanken und Empfindungen, womit man diese welthistorischen Punkte erblickt, verstehen sich von selbst, vor Korsika habe ich den Hut abgezogen, oder vielmehr die mir von Bamberg geschenkte Mütze, die ich der Bequemlichkeit wegen auf dem Schiffe trage.
Eine schönere Reise, wie die meinige, kann nie gemacht sein, der Wind ist fortwährend der günstigste, wir kommen aufs schnellste vorwärts und müssen es nicht mit dem geringsten Unwohlsein bezahlen. Indem ich dies schreibe, erweist ein Engländer seiner Dame auf wunderbare Weise einen Kavalierdienst, er hält ihr, weil sie von der Sonne inkommodiert wird, seine plumpe Bärentatze als Parasol vor, es sieht unbeschreiblich komisch aus. Als wir bei der Insel Elba ankamen, stand hell und klar der Abendstern darüber, der einzige, der noch am Himmel hervorgetreten war; ich wollte einige Bemerkungen in mein Diarium eintragen, fand meine Bleifeder aber nicht mehr, so daß mir von jetzt an das Mittel fehlte, die Eindrücke in ihrer Frische gleich auf dem Papier festzuhalten, nun muß ich hier in Rom denn, wo ich dieses schreibe, aus der Erinnerung nachhelfen, so gut es geht.
Ich hatte wieder eine ruhige, nicht von der leisesten Anwandlung der Seekrankheit gestörte Nacht, was freilich nicht jeder Passagier von sich rühmen konnte, und wie ich kaum erwacht war, stand das Schiff still, und ich hörte, daß wir angekommen seien, hurtig eilte ich aufs Verdeck, Civitavecchia lag vor mir unter einem reinen, übermäßig blauen, von keiner Wolke getrübten Himmel, der Anblick erinnerte mich, so seltsam das klingen mag, an eine Theaterdekoration aus der Victor Hugoschen Lucrezia Borgia, in der ich zu Paris die Georges gesehen hatte. Wir wurden rasch ans Land gesetzt, und ebenso rasch wurde ich trotz meiner verbotenen Bücher mit der Douane fertig, ein kleines Trinkgeld, unaufgefordert gereicht, erlöste mich von ihr. Nun belegte ich mir für den Mittag einen Platz auf der nach Rom gehenden päpstlichen Diligence, dann ging ich aus und besah das Städtchen. Es ist eng und knapp zwischen das Meer und das gleich hinter diesem emporschwellende Land hineingekeilt und bietet, außer einem neugebauten, unverhältnismäßig groß erscheinenden Theater, an öffentlichen Gebäuden nichts Merkwürdiges dar. Auf dem Markt war ein reges Treiben, vor allem fiel mir die große Zahl der Geistlichen und Mönche und ihr von dem Wesen ihrer französischen Brüder grell abstechendes Benehmen auf; wenn diese das heilige Haupt bescheiden senkten, hoben jene es keck empor, wenn diese sich eines Bauchansatzes und strotzend-feister Backen schämen, sind jene stolz darauf.
»Pfaffen sah ich in Frankreich und sah in Italien Pfaffen,
jene beugen das Haupt, diese erheben es stolz.
Dort, ach, sind sie verdammt, den Herrn zu tragen, und das ist
schwierig, hier trägt sie der Herr, das ist denn sanft und bequem!«
Ich kaufte mir für drei Bajocco eine Weintraube, die so groß war, daß sie aus dem Lande Kanaan zu kommen schien, und daß ich sie ebensogut unter dem Arm wie in der Hand hätte tragen können. Diese verzehrte ich und spazierte dabei, nicht des Schattens, sondern des Spaßes wegen, in einer Art von Miniaturallee, die man am Meeresstrand angelegt, die aber ein erbärmlich schlechtes Gedeihen hat und eigentlich nur aus vertrocknetem Gesträuch besteht, das in den dürren Sandboden gesteckt ist. Alle Augenblicke raschelte eine Eidechse mit ekelhaft-bunten Farben über den Weg, und ich trat vorsichtig auf, weil ich dachte, daß der werten Cousine die Schlangenmuhme folgen könne. Bei einer in der Ferne liegenden Villa erblickte ich die erste Palme, die aus dem Treibhaus, in dem sie mir bis jetzt nur vorkam, ins Freie hinausspaziert war; abermals ein neues Stadium der schaffenden Natur.
Mittags um zwölf Uhr fuhr ich, mit noch fünf anderen Passagieren, ins Innere der Diligence gepackt, von Civitavecchia ab und kam abends zwischen acht und neun Uhr mit einem vor Migräne fast zerspringenden Kopf vor den Toren von Rom an. Unterwegs eine nur von Büffelochsen belebte Wüstenei; auf den Poststationen elende, verfallene Häuser und bettelnde Postillone; ich sah aus allem, daß ich mich dem Scherbenberg der Welt näherte.
Es war völlig finster, wie wir in Rom einfuhren, kümmerliche Laternen, die nichts beleuchteten als sich selbst, wurden eben langsam angezündet, ich bemerkte einmal, aus dem Wagen schauend, eine Reihe kolossaler Säulen, St. Pierre! näselte ein Franzose, ich hatte die Peterskirche im Fluge erblickt.