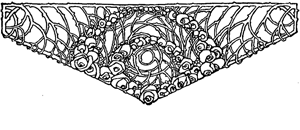|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
September 1836 bis März 1839
Die Übersiedelung nach München ward Hebbel nur dadurch ermöglicht, daß Elise Lensing ihn mit hundert Talern unterstützte. Gemeinsam mit seinem Freunde Rendtorf legte er die Reise zu Fuß zurück. Dann begann sein fast dreijähriger Aufenthalt in der ihn anheimelnden Stadt, eine an bitteren Entbehrungen überreiche Zeit. Abgesehen von einem einzigen Sommer, in dem Hebbel warm zu Mittag zu essen pflegte, mußte er, meist auf nur zwanzig Gulden im Monat angewiesen, sich mit Kaffee und Brot behelfen. Ohne Elisens mit rührendster Liebe gebotene, oft mit Widerstreben angenommene Unterstützungen hätte er nicht leben können, fehlte ihm doch jede Fähigkeit zum leichten, feuilletonistischen Produzieren, jeder Journalistenfleiß; die einzige Geldarbeit, zu der er sich unter Seufzen verstehen konnte, seine Korrespondenz für das »Stuttgarter Morgenblatt«, brachte kläglich wenig ein.
Durch Vorlesungen bei Schilling und Görres, hauptsächlich aber durch mannigfachste Lektüre, eifriges Studium der verschiedensten Gebiete, suchte er alles an seiner Bildung Versäumte nachzuholen und sich ein umfassendes Wissen anzueignen. In der beständigen Gefahr, zu verhungern, bewältigte er eine Fülle geistiger Materien, kämpfte er schwerste Kämpfe mit sich und der Welt, immer wieder an seinem Dichterberuf und daran zweifelnd, ob er die Spuren einer im Elend verkümmerten Kindheit, einer in Demütigungen erstickten Jugend jemals würde tilgen können. Von allen Menschheitsfragen bestürmt und gequält, von der Wucht lange gehemmter Entwicklung fortgerissen, litt er an öden Zeiten innerer Dürre und Leere wie unter den immer wieder erneuten Aufschwüngen zu seelischem Rausch und mächtigen Stürmen des Herzens. In solchen Kämpfen stand ihm in unbedingter Treue ein Freund zur Seite: Rousseau, der ihm nach München gefolgt war, in unerschütterlichem Glauben an Hebbels Bedeutung und Zukunft, die eigene Individualität dem Überlegenen opfernd. Auch der liebenden »Beppi« (Josepha Schwarz), der Tochter seiner Wirtsleut, sei nicht vergessen, deren Anmut, Hingabe und Originalität ihn in manchen schweren Stunden getröstet hat.
Tagebuch 1837.
Auf dem Münster in Strasburg, auf der fröhlichen Fußreise von Heidelberg über Straßburg, Stuttgart, Tübingen, Reutlingen, Ulm nach München. »Das braust und schäumt durch alle Adern, wenn man mit jedem neuen Tag eine neue Welt um sich sieht; eine schönere ist garnicht einmal nötig, schöner ist alles, was nur anders ist. Ich habe das Leben eingeatmet wie frische Luft, und ich weiß, daß es etwas in mir hervorbringen wird.« dacht ich nur an Goethe. Ich stand vor der kleinen Tafel, worauf sein Name eingehauen ist. Ich sah ihn, wie er mit seinem Adlerauge hineinschaute in das reiche, herrliche Elsaß, und wie Götz von Berlichingen vor seiner Seele auftauchte und ihn um Erlösung anflehte aus langem Tod zum ewigem Leben. Ich sah ihn unten im Dom, wo die Idee der reinsten, himmelsüßesten Weiblichkeit, des Gretchens, vor ihm aufging. Mir war, als ergösse sich der Strom seines Lebens durch meine Brust – es war ein herrlicher, unvergänglicher Tag!
17. Okt. 1836.
... Sehr gefreut hat es mich, endlich einmal von meinem Bruder einige Zeilen wieder zu sehen; ich hatte mich danach gesehnt. Auch gegen ihn habe ich so manches gut zu machen; er ist eine treue und gar nicht unbedeutende Natur, und ich bin oft so hart gegen ihn gewesen, daß michs noch in die Seele schneidet. Ach, das ists überhaupt; der ungerechte, wenigstens voreilige oder zu scharfe Schlag, den ich mit jähzorniger Hand erteile, schmerzt andere einmal und mich ewig, und doch kann ich mich nicht zurückhalten. Ich bin in diesem Punkt ein wahrer Schwächling, sogar darin, daß ichs bekenne.
So muß ich offen gestehen, daß ich selbst in bezug auf Alberti kein ganz reines Gewissen habe, wenn auch seine Natur nie und nimmer Auswüchse treiben durfte, wie sie Auswüchse getrieben hat; wenn auch nur die bella donna Wolfskirschen ansetzt: ist die Erde ganz ohne Schuld? Er hätte sich vielleicht nicht so unwürdig geoffenbart, wenn ich ihn nicht für so würdig gehalten hätte; jener Knappe stahl sich die Rüstung, als ihn einer für einen Ritter ansah. Oft hat es mir schon nah gelegen, einen Zettel, nachstehenden Inhalts: »Lieber Alberti; es wird Dich überraschen, einen Brief von mir zu erhalten, aber es darf Dich nicht wundern. Schreibe mir über Dein Innerstes; was und wie Du willst, aber – bei allem, was Dir und mir heilig ist – treu, aufrichtig und wahrhaftig!« abzusenden; ich weiß nicht, ob ichs tun soll; ich leg es in Deine Hand; schreib Du mir darüber, Du wirst das Beste erkennen, sieh aber das Beste nicht in dem, was mir am zuträglichsten, sondern in dem, was mein am würdigsten ist. Ich will kein Opfer bringen, aber ein Mensch sein ...
19. Okt. 1836.
... Ich lebe jetzt in München, um hier die Antike zu studieren. Sie sind wahr geworden, die Träume meiner frühsten, die Phantasien meiner späteren Jugend; ich bin Künstler und habe so einen schönen Beruf. Der Sirokkowind, der über mein Jünglingsalter seinen Pesthauch ergoß, hat vieles eingetrocknet, aber nichts vergiftet; in Hamburg fing es wieder an, zu blühen und jetzt ergießt sich mir der Strom des geistigen Lebens durch alle Adern, brausend und überschäumend, als wäre er nie gefesselt gewesen. Können wir denn nun auch nicht zusammen sein, wird mich vielleicht der weiteste und Dich ein enger Kreis verschlingen, so werd ich doch all mein Sein in Werken des Gemüts und des Verstandes getreu und wahrhaftig ausprägen und an diesem Abendmahl wirst Du immer willkommenster Gast sein, auch vielleicht, da Du den aufgeschossenen Baum schon im Keim (am herbsten, doch auch am reinsten) geschmeckt hast, nicht ungern erscheinen ...
Tagebuch 1836.
Entschuldige sich nur keiner damit, daß er in der langen Kette zu unterst stehe; er bildet ein Glied, ob das erste oder das letzte, ist gleichgültig, und der elektrische Funke könnte nicht hindurchfahren, wenn er nicht da stände. Darum zählen sie alle für einen und einer für alle, und die Letzten sind wie die Ersten ...
Schlafen, schlafen, nichts als schlafen!
Kein Erwachen, keinen Traum!
Jener Wehen, die mich trafen,
leisestes Erinnern kaum,
daß ich, wenn des Lebens Fülle
niederklingt in meine Ruh,
nur noch tiefer mich verhülle,
fester zu die Augen tu!
29. Nov. 1836.
... Fester und fester wird das Freundschaftsband zwischen mir und jenem jungen Bayern (Rousseau), von dem ich Dir schon aus Heidelberg geschrieben zu haben vermeine. Er ist noch dort; es hat sich aber eine ziemlich lebhafte Korrespondenz zwischen uns angesponnen, und seine Briefe geben mir Zeugnis, daß sein Sinn, all seines poetischen Strebens ungeachtet, auf das Ewige, das Wahrhaftige, gestellt ist; sie geben mir Hoffnung, daß er Kraft genug haben wird, falls jenes kein erwünschtes Ziel finden sollte, sich zusammen zu fassen und das Leben an einer ihm zugänglicheren Seite zu packen ...
... Mich peinigt nichts, als meine nächste Zukunft, diese aber auch stark. Solange ich in München bin (seit reichlich zwei Monaten), hab ich noch nicht fünfmal warm zu Mittag gegessen, sondern, um nur möglichst lange mit dem Gelde zu reichen, mich beständig mit Brot beholfen. Da gilts denn Kniffe und Schliche, daß die Hausleute nicht hinter die frugale Mahlzeit kommen; es ist – ich habs erfahren – die größte Torheit, sich in deren Augen Blößen zu geben. Bis jetzt gelt ich für einen wohlhabenden Herrn, der sich nichts grämen läßt; man schließt das hauptsächlich daraus, daß ich jeden Mittag Kaffee trinke, was ich muß, wenn ich meine Gesundheit nicht gänzlich ruinieren will. Übrigens befind ich mich bis dato wohl bei der Lebensweise und will dem Himmel danken, wenn er mir soviel gibt, daß ich sie auch den Sommer hindurch fortsetzen kann. Sehr fehlt mir eine ordentliche Hose; jene weiße, die mir dazu auffallend niederträchtig saß, hat ihrem Ansehen wenig entsprochen; das Zeug hat sich allenthalben selbst durchstochen; jetzt trag ich meine schwarze, die auch bereits gewaltig abgenutzt ist und schwerlich über den Frühling hinaus vorhalten wird. Ach, dieser Frühling! Wie zittre ich vor ihm! Über all diese Dinge sag niemandem, auch Kistings nicht, ein Wort; nur Dir beicht ich meine Not, sonst keinem in der Welt ...
Tagebuch 1836.
Aus einem Briefe an Elise: Ich bin körperlich nicht gar wohl und geistig noch weniger; die Cholera wütet in der Stadt, dennoch scheints mir unmöglich, daß ich sterben könne. Ob ein mystisches Gefühl im Menschen liegt, was ihm sagt, ob die ökonomisch-umsichtige Natur ihr schon in ihre Pläne verwendet hat, oder nicht?
Die im Leben glücklich Gestellten sollten wissen oder bedenken, daß die Not die Fühlfäden des inneren Menschen nicht abstumpft, sondern verfeinert; dann würden sie sich ihrer Stellung nicht so oft überheben; denn gewiß geschieht dies weniger aus Vorbedacht, als aus Dummheit
Aus dem Innersten heraus!
14. Dez. 1836.
... Da krabbelt dieser geistige Pöbel die Liliputer Turmleiter, die er Wissenschaft nennt, mit Schneckenfüßen, die noch dazu gichtbrüchig sind, hinan und hält jeden Zoll, den er zurücklegt, für eine Meile, weil er nach seiner Mühe mißt und nicht nach der Länge; sieht er dann über sich in ungemessener Ferne den Adler schweben, so denkt er: du bist freilich nicht völlig so hoch gedrungen, wie der da, aber (hierbei streichelt er die Leiter) du stehst, und auf Holz, und er hat nichts unter sich, als Luft und nichts über sich, als höchstens Wolken; unleugbar bist du im Vorteil. Er könnt noch hinzusetzen: »Fällst du, so fällst du jedenfalls nicht hoch und immer auf den Hintern, also aus dem Stehen ins Sitzen hinein; Aussichten sondergleichen!« Ich denke hauptsächlich an jenen Mohr Der Kirchspielvogt zu Wesselburen., der als ekelhafte Blattlaus über meine frische Jugend hinkroch und sich als jämmerliches juste milieu zwischen mich und die sogenannte bare, blanke Not, deren Anhauch mich mehr gekräftigt hätte, als das Hocken unter seinem kümmerlichen Regenschirm, hinstellte; o weh, wie hat der Mann mich in meiner tiefsten Menschheit gekränkt: mög ers nimmer empfinden ...
19. Dez. 1836.
... Am Weihnachtsabend werd ich bis 12 Uhr nachts Kaffee trinken und ein Phantasiestück schreiben, um 12 Uhr in eine katholische Kirche gehen und die schöne Weihnachtsmusik hören. Redlich und gern werd ich Dein gedenken. Mögest Du an jenem Abend recht klar und innig fühlen, daß wir uns wiedersehen werden, und daß Du in mir ewig Deinen wärmsten Freund haben wirst, der dich an seinem höchsten würdigsten Leben Anteil nehmen läßt und Dir den Blick in die Tiefen seiner Seele frei stellt, dafür denn aber auch wohl verlangen darf, daß Du nimmer von ihm forderst, was er, als all seinem Denken und Empfinden widerstreitend, nicht gewähren kann. Was Deine Zukunft betrifft, so ist sie freilich nicht sicherer, aber jedenfalls ebenso sicher, als die meinige, und wenn ich einst etwas hab, so werd ich gewiß nicht vergessen, daß Du mit mir teiltest, als Du hattest. Dies ist mein Männerwort. Das zwischen uns bestehende Verhältnis ist auf einen sittlichen Felsen, auf gegenseitige Achtung, gegründet; trat ein Sinnenrausch dazwischen, so wollen wir das nicht bedauern, denn es war natürlich, ja, bei der Lage der Dinge, unvermeidlich; aber noch weniger wollen wirs bedauern, daß er vorüber ist. Wie in der physischen, so gibt es in der höheren Natur – wie wärs bei der Ökonomie, die der Welt als erstes Konstitutionsgesetz zum Grunde liegt, auch anders möglich? – nur eine Anziehungskraft, die Menschen an Menschen kettet; das ist die Freundschaft; und was man Liebe nennt, ist entweder die Flammenvorläuferin dieser reinen unvergänglichen Vestaglut, oder der schnell aufschlagende und schnell erlöschende abgezogene Spiritus unlauterer Sinne. Die Metamorphosierungsmethode mag, da die edlere Seele dann ihren eigenen Großinquisitor machen und sich Wankelmut, Unbeständigkeit, wenigstens innere Unzulänglichkeit, vorwerfen wird, gar schmerzlich sein; um so mehr wollen wir uns freuen, wenn wir ohne Weg ans Ziel gelangen können. Ahnst Du, daß über mich am Ende etwas Höheres schwebt, so ahne auch das daraus Folgende, daß ich, ganz anders konstruiert, als andere, selbst da recht haben kann, wo die Welt nicht unrecht hat! Keinem Menschen in der Welt schreibe ich Briefe, wie Dir; Du genießest mit mir mein geheimstes Leben; ja, noch unklar über manche innere Zustände, bringe ich sie mir selbst dann zu An- und Überschauung, wenn ich sie vor Deinen Augen abwickle – – frage Dich einmal ernsthaft, ob wohl innigere Verbindung möglich ist? Mußt Du aber (und es kann nicht anders sein, oder ich wäre Dir nie gewesen, was ich Dir zu sein glaubte und glaube) die Frage mit Nein beantworten, so erfreue Dich Deines Glücks, wenn Du es Glück nennen willst, das erlangt zu haben, warum sich gar viele schon umsonst beworben und noch bewerben werden, Männer, wie Weiber ...
Tagebuch 1836.
Ich habe oft ein Gefühl, als ständen wir Menschen (das heißt jeder einzelne) so unendlich einsam im All da, daß wir nicht einmal einer vom andern das Geringste wüßten, und daß all unsere Freundschaft und Liebe dem Aneinanderfliegen vom Wind zerstreuter Sandkörner gliche.
Das nächste Ziel mit Lust und Freude und aller Kraft zu verfolgen, ist der einzige Weg, das fernste zu erreichen.
Tagebuch 1836.
Am Schlusse dieses 1836. Jahres mag ich mir sagen, daß das heranrückende 1837. mehr, wie irgend ein vorhergegangenes, Entscheidung für mich mit sich führen muß. Äußerlich handelt es sich um Begründung einer Existenz durch literarische Bestrebungen; auch innerlich kann dieser zwischen überflutender Fülle und gräßlicher Leere hin- und her schwankende und gleich dem eines Trunkenbolds auf und ab steigende Zustand nicht lange mehr fortbestehen. Eine Erfahrung von Bedeutung glaube ich über mich selbst im letzten Jahr gemacht zu haben, nämlich die, daß es mir durchaus unmöglich ist, etwas zu schreiben, was sich nicht wirklich mit meinem geistigen Leben aufs innigste verkettet. Ebenfalls fühl ich mich jetzt – das war früher nicht der Fall – vom Innersten heraus zum Dichter bestimmt; irrt ich dennoch darin, so wäre mir mit dem Talent zugleich jede Fähigkeit, das in der Kunst Würdige und Gewichtige zu erkennen, versagt; denn das Zeugnis, mich deslich um den höchsten Maßstab bemüht und diesen streng an die Dokumente meines poetischen Schaffens gelegt zu haben, darf ich mir geben. Die Kunst ist das einzige Medium, wodurch Welt, Leben und Natur Eingang zu mir finden; ich habe in dieser ernsten Stunde nichts zu bitten und zu beten, als daß es mir durch ein zu hartes Schicksal nicht unmöglich gemacht werden möchte, die Kräfte, die ich für sie in meiner Brust vermute, hervorzukehren!
... Durch nichts greif ich die Unverletzbarkeit eines Menschen mehr an, als durch meine nichtswürdige, alle Grenzen überschreitende Empfindlichkeit, denn gegen sie kann er sich so wenig schützen, als verteidigen, weil er in ihr Krankheit oder Krankhaftigkeit schonen zu müssen glaubt. Es ist nicht wahr, daß ich durch sie ebensoviel, oder gar mehr leide, als andere; der Mensch fühlt in seinen Fehlern wie in seinen Tugenden nur sein Wollen und seine Kraft, und reißt er die schönsten Blüten von seinem Lebensbaum ab, so dünkt er sich wunder wie groß dabei. Wärs auch wahr, so entschuldigte es nichts, sondern verdoppelte nur die Sünde. So pflegt mir die alles duldende Josepha des Morgens die Landbötin Zeitung »Die bayrische Landbötin«. zu bringen, heute morgen unterbleibts. Tausend Ursachen kanns haben, die alle nicht in der Macht des armen Mädchens stehen; ich weiß es, sag es mir, dennoch schau ich, sowie sie sich, liebevoll und freundlich, wie immer, an ihrem Fenster blicken läßt, mit einem Gesicht zu ihr hinauf, das sie im tiefsten schmerzen muß. Zuletzt kommt sie mit dem Blatt; die Mutter war auf den Markt gegangen und hatt es aus Versehen eingeschlossen. O Schlaffheit! Selbstzwist! Wie recht hatte Herder, wenn er gegen euch beide unversöhnlich war!
17. Jan. 1837.
Mit unendlicher Sehnsucht, teuerste Elise, hab ich längst Deinem Brief entgegengesehen. Gestern abend (Sonntag) erwartete ich ihn mit Sicherheit, heut ist er endlich eingetroffen und hat mir einen reichen Augenblick, einen innigen Genuß verschafft.
Wenn Du Ursach hast, meinem Dichtertalent Achtung zu zollen, und ich fühle, daß ich die verdiene, so hab ich ungleich mehr Ursach, die reine, sittliche Höhe, auf der Du stehst, zu bewundern, so mußt Du fühlen, daß Dir höchste Achtung niemand versagen darf. Du hast einen Punkt erreicht, den ich mit allen Kräften und bei allem Streben vielleicht nie erreichen, gewiß aber nicht übersteigen werde. Dadurch aber muß ein Zusammenhang, ein Friede in Deine Natur gekommen sein, gegen die alles andere gering ist. Denn das ist das letzte Ziel des Menschen, und daran allein ist seine Beruhigung auf Zeit und Ewigkeit geknüpft, daß er aus sich heraus ein dem Höchsten, Göttlichen, Gemäßes entwickle, daß er sich selbst ein Bürge sei für die seinem Bedürfnis entsprechenden Verheißungen.
Das Heiligste und Wahrste, was an Verehrung, an Liebe, in meiner Brust liegt, ist Dir zugewandt, ist Dein auf immer. Dein hab ich in der Weihnachts-, in der Neujahrsnacht gedacht, Dein gedenk ich stets, wenn ich mein selbst am würdigsten bin, und unter allem Wünschenswerten, was ich von der Zukunft erwarte, ist mir das Wünschenswerteste, wieder mit Dir zusammen zu leben und, was die Stunde bringt, in Gemeinschaft mit Dir zu genießen, oder zu verscheuchen.
... Ach, würde mir dies eine nur vergönnt, meiner Mutter, die in Wahrheit bis jetzt nur von Hörensagen weiß, daß auf Erden eine Sonne scheint, ein ruhiges Alter zu verschaffen! Es gehört bei dieser armen, genügsamen Frau, für die ein warmer Unterrock ein Krönungsmantel und eine Stube, worin sie nicht zugleich wohnen und schlafen muß, das köstlichste Fragment eines Palasts ist, so außerordentlich wenig dazu, daß ichs allein darum dem Schicksal, wenn es mir diesen meinen liebsten und letzten Wunsch vereitelte, nicht vergeben könnte. Schmerzlicheres hat nie einen Menschen getroffen, als Jean Paul der Tod seiner Mutter, die ihn so lange Jahre hindurch mit unermüdlicher Geduld durch ihrer Hände Arbeit ernährt hatte, und die eben da starb, als er sich zum erstenmal imstande sah, einen Teil seiner Schuld an sie abzuzahlen. Wie ers aushielt, begreif ich kaum; doch mocht ihn das Gedächtnis der ihr fort und fort bewiesenen Liebeszeichen trösten ...
24.-30. Januar 1837.
... Alles fällt mir gegenwärtig schwer, auch das Verfertigen der Korrespondenzberichte; sowie ich eine Zeile geschrieben habe, fühl ich mich nicht zu der zweiten aufgelegt, sondern dazu, die erste wieder auszustreichen. Wie das enden soll, weiß ich nicht. Dennoch denk ich über meine geistigen Kräfte, wie früher, um nichts geringer; aber alles, was ich an der Welt, am Leben, am Menschen schätzte, verläuft sich mehr und mehr ins Nebelhafte, und der einzelne Mensch wurzelt nur im Gefühl von der Würde der Menschheit, der Zweckmäßigkeit des Lebens, des Reichtums der Welt. Sonst war es Erbitterung, Haß, Verachtung, die in mir aufstiegen, wenn mir ein verderbter Mensch in den Weg kam, oder, wenn ich an gewisse Sünden der Zeit dachte; jetzt ist es reiner Schmerz, tiefstes, ungemischtestes Weh; mir ist, als hätt ich alles mit getan, und ich fühle mich mit jedem Nackenden nackt. Ach, daß die Natur sich nicht begnügte, Bäume hervorzubringen mit Zweigen, voll Blüten, und Vögel, die sich hineinsetzten! Der Mensch ging über ihre Kräfte. Sie wollte auch einmal wagen; da hat sies nun! Im Menschen liegt nichts Konsequentes; er ist ein Hasardspiel; er wird, wozu die Dinge ihn machen, oder, wenn er ihnen widerstreben will, gar nichts.
Zweimal ist das Leben schön gewesen. Einmal, als Griechenland blühte; doch jener Zustand ist meinem Innersten fremd; ich kann nicht glauben, daß soviel Helles, Frisches, Fertiges, mich glücklich gemacht hätte. Das zweitemal während des Mittelalters. Da gabs soviel, an das man sich klammern konnte. Freilich lauter Irrtum, und Irrtum, der von dem Wahren – das heißt Möglichen und Notwendigen – noch weiter, viel weiter, als unsre jetzigen Irrtümer, abstand. Aber, der Irrtum hat Kolorit und Gestalt und schlingt sich heiter und lustig durch den Reigen des Lebens; die Wahrheit ist unsichtbar, wie ein Gott, und unheimlich, wie ein Gespenst. Wär man doch damals geboren! Schon das ist ein großes Unglück, daß man nicht mehr an den Teufel, und noch weniger an seine Sippschaft glauben kann; der Sturm, der eben jetzt (es ist elf Uhr) draußen sein Wesen treibt, sagt mir nichts, als daß er von den Bergen kommt und die Luft reinigt; hielt ichs für den wilden Jäger, so würd ich nicht mit dieser niederträchtigen Ruhe fortschreiben. Der Aberglaube ist für diese Welt, was (nach christlichen Begriffen) der Glaube für jene. Die Menschheit mag wollen oder nicht, sie muß sich noch einmal wieder ein goldenes Kalb machen, vor dem sie sich beugt. Gute Nacht!
12. Febr. 1837.
Dein Brief, liebe Elise, ist endlich gekommen und hat auf mich gewirkt, wie immer. Dein ganzes Leben, Deine Art, zu sein, tritt mir daraus entgegen; Leidenschaftlichkeit und Ruhe in buntem Gemisch. So lieb ichs; sich bei Briefen irgend eine Art von Zwang antun, heißt in das Herz Methode bringen und Händedruck und Umarmung nach Regeln betreiben.
Was ich über Dich gesagt, das laß Du Dir nur immer gefallen. Was ich über mich gesagt, muß ich mir auch gefallen lassen. Laß Dich nicht durch die verdächtige Tugend der Demut zu einer Unredlichkeit gegen Dich selbst, gegen Dein Gefühl, wärs auch nur im Ablehnen einer verdienten Anerkennung, verleiten. Demut hat die Welt nicht gebaut, aber Demut – wenn sie möglich wäre – könnte sie zugrunde richten.
Die Natur strebt nach einem Gipfel, und da der Mensch fühlt, daß er dieser Gipfel nicht ist, so muß es ein ihm korrespondierendes höheres Wesen geben, in dem das Weltall zusammenläuft und von dem es eben darum auch ausgeht. Dies Wesen ist Gott. Ich abstrahiere ihn aus meiner eigenen Unzulänglichkeit und aus der Konsequenz der Natur.
Ich beuge mich jedem Höheren und also gewiß dem Höchsten. Aber nur dadurch, daß ich ihn möglichst zu entbehren suche, kann ich mich in ein würdiges Verhältnis zu ihm setzen. Er will nicht die Krücke des Menschen sein, darum hat er ihm Beine gegeben. Fordert das Leben von mir das Unmögliche, so erdrückt es mich entweder, oder – es ist nicht das Unmögliche gewesen. In jedem Fall soll ich alles aufbieten, was an Kraft in mich gelegt ist; diese Kraft macht mich gewiß frei, ist es nicht nach außen, indem sie das Hindernis überwältigt, so ist es nach innen, indem sie die Körperketten zerreißt ...
April 1837.
... An welcher Todeskrankheit ich und Gravenhorst in Heidelberg darnieder gelegen wären? Liebes Kind, es gibt nur einen Tod und nur eine Todeskrankheit, und sie lassen sich nicht nennen; aber es ist die, deretwegen Goethes Faust sich dem Teufel verschrieb, die Goethe befähigte und begeisterte, seinen Faust zu schreiben; es ist die, die den Humor erzeugt und die Menschheit (das heißt die wenigen Menschen, in denen etwas Weniges vom Menschen ausschlägt und in die Blüte tritt) erwürgt; es ist die, die das Blut zugleich erhitzt und erstarrt; es ist das Gefühl des vollkommenen Widerspruchs in allen Dingen; es ist mit einem Wort die Krankheit, die Du nie begreifen wirst, weil – Du danach fragen konntest. Ob es für diese Krankheit ein Heilmittel gibt, weiß ich nicht; aber das weiß ich, der Doktor (sei er nun über den Sternen oder im Mittelpunkt meines Ichs), der mich kurieren will, muß zuvor die ganze Welt kurieren, und dann bin ich gleich kuriert. Es ist das Zusammenfließen alles höchsten Elends in einer einzigen Brust; es ist die Empfindlichkeit, daß die Menschen so viel von Schmerzen und doch so wenig vom Schmerz wissen; es ist Erlösungsdrang ohne Hoffnung und darum Qual ohne Ende.
Von diesem Punkt kommen wir so leicht und ohne Umstände auf Religion, als von der Auszehrung auf einen Wunderdoktor. Die Religion der meisten Leute ist nichts weiter, als ein »Sichschlafenlegen« und es ist wirklich zu fürchten, Gott möge sie für ihre Gottesfurcht noch einmal scharf ansehen, denn es ist keine Kunst, zu Bett zu gehen, wenn man müde ist, oder gar – der Fall ist noch häufiger – niemals aufzustehen, und die Natur mit all ihren Unbegreiflichkeiten und den Menschengeist mit all seinen Rheinfällen und Gewittern im Schlaf – das heißt im Glauben an sich vorüberziehen zu lassen. Es ist wahr, ein Gott, wie ihn der »wahre Christ« sich denkt, paßt so vortrefflich in die große, krause Maschine, wie eine Welle in die Windmühle, aber eben, weil er so ganz erstaunlich gut paßt, möcht ich einen solchen Gott bezweifeln. Es wär doch etwas mehr, als ein Wunder, wenn der menschliche Geist, der durchaus niemals eine Ursach durchdringt, die erste Ursach alles Seins wirklich so weit erfaßte, daß er sich ohne Frechheit herausnehmen dürfte, an sie, auf sein eigenes Zeugnis hin, zu glauben und also jede andere mögliche mit grenzenloser Keckheit zu verneinen; ich sage, es wäre mehr, als ein Wunder, mithin weniger, als eine Möglichkeit ...
12. Mai 1837.
... Was Du meine Krankheit nennst, ist zugleich die Quelle meines, wie jedes, höheren Lebens. Für das, was den Menschen Glück heißt, hab ich niemals viel Sinn gehabt und verliere ihn mehr und mehr; dafür gibt es einzelne Stunden, die mich mit einem überschwenglichen Reichtum innerer Fülle überschütten; dann löst sich mir irgend ein Rätsel; ich fühle mich selbst in meiner Würde und meiner Kraft; ich erkenne, daß meine größten Schmerzen nur die Geburtswehen meiner höchsten Genüsse sind. Anderen Stunden vergönn ichs um so lieber, daß sie mich martern, als ich weiß, daß sie mich, wenn sie mir auch ihren ganzen Inhalt, der so manchen selig macht, bringen wollten, doch nicht erquicken könnten; die Erde hat ihre Rechte, aber, wenn ich auch mit den Wellen kämpfen und ringen muß, so reicht das Haupt doch über sie hinaus und mein Blick erfaßt die ewigen Sterne. Ich lebe (dies ist bei mir seit einem Jahre kein leeres Wort mehr) schon im Weltall, und je inniger ich von der Nichtigkeit alles irdischen Treibens (nur nicht im sogenannten christlichen Sinn) überzeugt werde, je mehr freue ich mich, daß es mir gestattet wird, von einem Grad zum andern nicht, nach dem allgemeinen Schicksal, hinüber zu kriechen, sondern hinüber zu springen ...
25. Mai 1837.
die Hebbels Übersiedlung von Wesselburen nach Hamburg ermöglicht hatte.
... Ich will meiner Not nichts verdanken, als höchstens meinen Charakter; ich werde meine Geisteskräfte für gering achten, wenn sie, nun sie entwickelt sind, zur Begründung meiner Existenz nicht ausreichen; ich werde, falls ich im Weltmeer untergehen sollte, darin nicht, wie vielleicht früher, einen Privathaß des Schicksals gegen mich sehen, sondern bloß den Beweis, daß ich nicht schwimmen konnte. Sie werden, teure Freundin, die Wahrheit dieser Gefühle nicht darum bezweifeln, weil ich sie zufällig am besten in einer Metapher ausdrücken zu können glaube; ich bin überzeugt, aufs innigste überzeugt, das Leben ist auf die Dauer gegen niemanden ungerecht, und wer es so schilt, der verwechselt Gerechtigkeit mit Billigkeit und will sich ein Geschenk als einen Tribut ertrotzen; wehe aber, oder vielmehr pfui dem, der zugrunde geht, weil er nicht beschenkt wird. Ich gebe allerdings zu, daß der Mensch vor Entscheidung des Prozesses, der zwischen dem Leben und einer falsch gestellten hohen Erscheinung mit Bitterkeit und Strenge geführt wird, erkranken kann; ich gebe aber nicht zu, daß solch eine Krankheit heilbar ist, und verlange von dem Kranken, daß er (eben in Betätigung seiner höheren Natur) dies beizeiten fühlen und an ein Sterbebett keinen Arzt fesseln soll. Auch ich bin krank; ich irrte mich, als ich beim Austritt aus der Gifthölle mich, einen Freiheitsrausch mit Gesundheit verwechselnd, den Alten glaubte; ich schreibe Ihnen also nicht so (und dies ist für die Würdigung meines Geständnisses ein wichtiger Punkt), weil ich viel hoffe, sondern nur, weil ich nichts fürchte. Ich bin hypochondrisch im höchsten Grade; mein Leben ist ein tolles Gemengsel von Rausch und ekler Nüchternheit; ich würde, selbst, wenn ich ein Recht hätte, zu hoffen, kaum mehr wünschen können. Als die Aufgabe meines Lebens betrachte ich die Symbolisierung meines Innern, soweit es sich in bedeutenderen Momenten fixiert, durch Schrift und Wort; alles andere, ohne Unterschied, hab ich aufgegeben, und auch dies halte ich nur fest, weil ich mich selbst in meinen Klagen rechtfertigen will ...
18. Juni 1837.
... Ich bin nicht gegen viele Menschen wahr, ich kanns nicht sein, denn sie würden mich nicht verstehen und (was das Schlimmste wäre) doch zu verstehen glauben; doch mach ich es nicht, wie Moses, der seinen Aussatz hinter dem Schleier für göttlich-blendenden Glanz gab und seine Krankheit anbeten ließ. Aber, gegen Dich bin ich wahr, so wahr, wie gegen mich selbst; man kann es sein gegen einen umfassenden Geist, man muß es sein gegen ein umfassendes Gemüt ...
An den Tod Juni 1837.
Halb aus dem Schlummer erwacht,
den ich traumlos getrunken,
ach, wie war ich versunken
in die unendliche Nacht!
Tiefes Verdämmern des Seins,
denkend nichts, noch empfindend!
Nichtig mir selber entschwindend,
Schatte mit Schatten zu eins!
Da beschlichs mich so bang,
ob auch, den Bruder verdrängend,
Geist mir und Sinne verengend,
listig der Tod mich umschlang.
Schaudernd dacht ichs und fuhr
auf, und schloß mich ans Leben,
drängte in glühndem Erheben
kühn mich an Gott und Natur.
Siehe, da hab ich gelebt:
Was sonst, zu Tropfen zerflossen,
langsam und karg sich ergossen,
hat mich auf einmal durchbebt.
Oft noch berühre du mich,
Tod, wenn ich in mir zerrinne,
bis ich mich wieder gewinne
durch den Gedanken an dich!
Zwei Wanderer November 1837.
Ein Stummer zieht durch die Lande,
Gott hat ihm ein Wort vertraut,
das kann er nicht ergründen,
nur einem darf ers verkünden,
den er noch nicht geschaut.
Ein Tauber zieht durch die Lande,
Gott selber hieß ihn gehn,
dem hat er das Ohr verriegelt,
und jenem die Lippe versiegelt,
bis sie einander sehn.
Dann wird der Stumme reden,
der Taube vernimmt das Wort,
er wird sie gleich entziffern,
die dunkeln göttlichen Chiffern,
dann ziehn sie gen Morgen fort.
Daß sich die beiden finden,
ihr Menschen, betet viel.
Wenn, die jetzt einsam wandern,
treffen einer den andern,
ist alle Welt am Ziel.
7. Dez. 1837.
Gestern, beste Elise, hab ich Deine Sendung erhalten. Brief und Paket sind schon fünf bis sechs Tage hier gewesen; Du hattest auf der Adresse nicht hinzugefügt, daß ich über drei Stiegen wohne. Die Sachen sind köstlich, Rock, Hose, Weste, Binde, mit einem Wort alles, über meine kühnste Erwartung, nicht allein fein und modern, sondern fast brillant; in meinem Leben hab ich solch einen Anzug nicht gehabt. Jetzt bin ich auf zwei Jahre mit Garderobe versehen; meinen alten Rock kann ich für gewöhnlich noch lange tragen; mein Frack ist noch ganz gut und höchstens werd ich in der besseren Jahrszeit einer Sommerhose bedürfen, die sich leicht anschaffen läßt. Einer der größten Sorgen bin ich überhoben; ein guter Rock entscheidet auf der Polizei über die Erteilung der Aufenthaltsbewilligung und vergoldet den Menschen in allen Verhältnissen – dennoch muß ich gestehen, daß ich meinen Wunsch unterdrückt hätte, wenn ich es auch nur hätte ahnen können, daß Du ihn auf eine so glänzende Weise befriedigen würdest. Ich weiß es wohl, Du gibst nicht, um wieder zu empfangen; Du willst durch eine Wohltat nicht fesseln, sondern befreien; aber um so mehr drückt mich mein Unvermögen, Dir meinen Dank zu bezeigen. Ich darf es wahrlich für das größte Glück meines Lebens halten, daß ich mit Dir zusammengekommen bin; Du gewährtest mir in Hamburg, wo mich niemand verstand, Teilnahme, Anregung und Trost; Du standest mir zur Seite in meinen schlimmsten Stunden und riefst meine schönsten – daß ich mich nirgends, als in Deinem Hause wohl befand, weißt Du! – hervor, und Du warst es ebenfalls, die bis jetzt, wie ein freundlicher Genius, in der Ferne alles für mich tat, was für mich getan werden kann. Und ich – kann ich etwas anderes tun, als meinen Mund zum Echo Deines Herzens machen? O, wahrlich, es schmerzt mich im Innersten meiner Seele, daß ich meine heiligste Schuld in der Scheidemünze, deren sich jeder Lump und jeder Schuft bedient, abtragen muß ...
Tagebuch Mai 1838.
Und ist ein bloßer Durchgang denn mein Leben,
durch deinen Tempel, herrliche Natur,
so ward mir doch ein schöner Trieb gegeben,
vom Höchsten zu erforschen jede Spur,
so tränkt mich doch, bin ich auch selbst vergänglich,
ein Quell, der ewig ist und überschwenglich!
Beppi erzählte mir: Als sie klein war, stieg sie, wenn ihre Mutter krank im Bette lag, zu ihr auf dem Schemel hinauf, schaute sie lange an und machte ihr dann mit den Händen die Augen auf! Wie tief rührt mich jeder menschliche Zug, der die Unergründlichkeit, die unschuldige, spielende Tiefsinnigkeit des Lebens ausdrückt, und wie kalt läßt mich jeder Seiltänzersprung der Spekulation!
Gott teilt sich nur dem Gefühl, nicht dem Verstande mit; dieser ist sein Widersacher, weil er ihn nicht erfassen kann. Das weist dem Verstande den Rang an.
Nur das ist Sünde, was so wenig aus einer Leidenschaft als aus der Tugend hervorgeht.
14. Aug. 1838.
... Du sprichst davon, Du wolltest Deine Einrichtung verpfänden, um mir Geld senden zu können. Ich beschwöre Dich (o Gott, ich kann Dich aus der Ferne ja nur durch Bitten von übereilten Entschlüssen abhalten) dies nicht zu tun; ich bin noch nicht in so großer Verlegenheit, ich habe Kredit, weil ich so lange richtig bezahlte, und brauche wenig; vom Morgenblatt kann ich, wofern nur mein neulicher großer Bericht abgedruckt wird, soviel erwarten, als ich brauche, um die bisher entstandene Schuld abzutragen; dann hab ich abermals Kredit, und alles wird mir ja wohl nicht schief gehen. Auf keinen Fall würde ich nun noch, da ich Deine verzweiflungsvollen Verhältnisse kenne, einen Heller von Dir annehmen; Du mußt selbst fühlen, daß dies Sünde wäre; schreibe nur ums Himmels willen nicht einer in diesem Fall lächerlichen Empfindlichkeit einen Anteil an dem allein würdigen Entschluß zu; Du würdest mir im höchsten Grade unrecht tun und Dir selbst weh. Sei überzeugt, meine Gesinnungen gegen Dich haben sich nicht geändert und werden sich nicht ändern; Du bist mir eine Freundin, wie ich nie eine zweite finden kann, und wofern ich selbst noch etwas zu hoffen habe, was ich zwar nur in wenig Stunden wage, so wirst auch Du noch dereinst aus Deiner jetzigen zerquetschenden Kümmernis erlöst werden. Also noch einmal: verpfände Deine Sachen nicht, ich brauche kein Geld; könnt ich mir durchaus nicht mehr helfen, so (dies verspreche ich Dir) werd ich mich Dir vertrauen; jetzt nehme ich nicht um den Preis der Welt etwas an ...
12. Sept. 1838.
Ich weiß nicht, liebe Elise, womit ich soviel Liebe verdiene, oder vielmehr, denn das andere ist wohl immer der Fall, ich weiß, daß ich sie nicht verdiene. Eine solche Schuld läßt sich nur mit dem Herzen zahlen, aber mein Herz ist längst bankerott; es ist leer und dürftig, wie eine Wüste, durch die nur selten ein frischer Hauch, der erquickende Tropfen bringt, hindurchzieht. Ich schaudere oft, wenn ich mich dort, wo die eigentlichste Quelle des Lebens entspringt, erstarrt fühle; doch, das Tote beklagen und es wiedererwecken, ist leider zweierlei. Freilich habe auch ich hohe Stunden, wo das Eis schmilzt und die himmlischen Gefühle aus ihrem Schlummer erwachen; dann dünke ich mir reich genug, um jedem, und ob es Gott selbst wäre, zu vergelten, was er an mir getan; dann scheine ich mir ein Brunnen, der nur darum aus allen Adern der Erde die holden Gewässer einsaugt, damit er erquicken kann, was ringsum dürstet und schmachtet. Aber, der leiseste Zugwind tötet diesen treibenden Frühling in meiner Brust, und ein solcher Zugwind ist schon der Gedanke: »Heuchler, bist du auch mit der Peitsche hinter das Gefühl her; legst du auch deinem Herzen Kontribution auf?« Und etwas Wahres ist wohl nicht allein an meiner Empfindung in solchen Augenblicken, sondern auch an jenen Gedanken. Nur dessen bin ich mich bewußt, daß ich niemals eine Heuchelei irgend einer Art (die sich leider, wenn der Mensch nur aufrichtig sein will, auf tausend geheimen Wegen ins Leben hineinschleicht) wissentlich fortsetze. Ach, es liegt so unendlich viel Zweideutiges in unsrer Natur, und ich bin so zusammengequetscht, daß ich nicht weiß, was ich meinem eignen Ich, und was ich meinen Verhältnissen zurechnen muß. Dies hindert mich eben so oft am Steinigen meiner selbst, wie am Bekränzen und Bekomplimentieren. Der Teufel sage die Wahrheit, wenn er kann, und Gott, wenn er muß, sonst um keinen Preis!
Übrigens, liebe Elise, irrst Du, wenn Du meinst, daß ich wohl immer trübe gestimmt sei. Das ist noch nicht der rechte Schmerz, der ein Aushängeschild im Gesicht hat; der wurzelt nicht im Ganzen, sondern nur im Einzelnen; der wird geheilt. Ich bin ernst und stolz; der König, der die Welt beherrscht, und der Einsiedler, der ihr entsagt und sie verachtet, sehen sich gleich, wie zwei Brüder. Auch kann ich noch immer recht heiter sein und bins jedesmal, wenn die Gelegenheit nur irgend dazu auffordert. Jene Schüchternheit hat sich natürlich verloren; sie gehörte nicht mir, sondern dem tyrannisierten Schreiber an und ist längst in den Fluten des Meeres untergegangen. Über Gegenstände des Empfindens äußerte ich, wie Du weißt, mich früher selten, jetzt nie. Neue Bekanntschaften zu machen, ist mir widerlich. Doch, wozu Dir dies alles schreiben; ist es nicht lächerlich, ein Kollegium über sich selbst zu lesen? Und dennoch sollten wir Menschen lieber etwas mehr eitel erscheinen, um es etwas weniger zu sein; wer über sich selbst spricht, sagt gewiß die Wahrheit, entweder mit Absicht, oder unbewußt.
... Meine Buchstaben geraten, wie Du bemerken wirst, nicht zum besten; es kommt daher, weil mein kleines Hündchen, welches, wenn ich schreibe, nicht eher ruht, als bis ichs vor mich auf den Schoß nehme, mir die schreibende Hand und mitunter auch die Feder leckt. Es ist ein allerliebstes Tierchen, kastanienbraun mit weißen Pfötchen und weißer Brust, schönen Ohren, glänzenden Augen, und von unbegrenzter Anhänglichkeit. Ich bringe es mit nach Hamburg, Du wirst es gewiß hätscheln; es zieht hier, wenn ich ausgehe, wegen seiner Schönheit und Munterkeit die Aufmerksamkeit aller Damen auf sich.
... Du machst viel zu viel Ansprüche an Dich, beste Elise, und noch mehr glaubst Du, daß ich zu viel Ansprüche mache, wenn Du meinst, erst dann seist Du die wahre Freundin für mich, wenn Du imstande wärest, in das geheimste Adern- und Nervengeflecht meiner Gedichte einzudringen. Das ist durchaus nicht nötig; der Anteil, den eine reine Seele an mir, als Menschen, nimmt, hat in meinen Augen einen viel höheren Wert, als der Anteil, der meinen Hervorbringungen als Tribut dargebracht wird ...
... Ich kenne gottlob die Konstitution meiner Mutter und fürchte nicht, daß die Krankheit Bedeutung hat; ich kann es mir auch gar nicht denken, daß der Himmel mir meine schönste Freude rauben und mir die Hoffnung, ihr das Leben zu verschönern und wert zu machen, vernichten mag. Dennoch bin ich so lange in Angst, bis ich genauere Nachrichten habe, die Du mir, beste Elise, erteilen wirst, sobald Du kannst.
Statt der so sehr ersehnten Nachricht von der Genesung der Mutter kam die ihres Todes. Hatte Hebbel seinen heißen Wunsch nicht mehr verwirklichen können, den Lebensabend seiner Mutter zu verschönen, so hatte Elise deren letzten Jahre durch Weihnachtsgeschenke und andere Gaben, die sie im Auftrage des Sohnes zu überreichen vorgab, glücklicher gemacht. Einen Tag nach der Trauerkunde aus Wesselburen hörte Hebbel von der Erkrankung seines kürzlich zum Doktor promovierten und heimgereisten Freundes Emil Rousseau, und bald darauf von seinem Tode. Das war der herbste Schmerz, der ihn je getroffen. Es zog ihn jetzt mit aller Gewalt zu Elise, dem einzigen Menschen, der ihm geblieben war. Aber da ihm Hamburg keinerlei Aussichten bot, zumal er den Doktortitel noch nicht erlangt hatte und das zur Promovierung erforderliche Geld fehlte, zögerte er seinen Entschluß über den Winter hinaus, entschied sich jedoch schließlich für die Reise nach Hamburg, die er im Frühling des neuen Jahres zu Fuß antrat.
17. Sept. 1838.
Gestern, liebe Elise, empfing ich den Brief meines Bruders. Ich war schon vor seinem Eintreffen krank, und bin es jetzt in noch höherem Grade. Ich hatte eine schlechte Nacht voll wüsten Schlafs; der Kopf brennt mir fieberisch, und ich bin kaum eines klaren Gedankens fähig. Das Schreiben greift mich an, dennoch darf ich es nicht aufschieben, um so weniger, als sich mein Zustand wohl schwerlich in ein paar Tagen verbessern wird.
Der rechte Schmerz um meine Mutter hat mich noch nicht erfaßt. Auch zum Schmerz gehört Kraft, und die meinige liegt in Ohnmacht, mein Herz steht still, mein Geist ist gefesselt. Der rechte Schmerz wird erst kommen, wenn ich wieder ich selbst bin, wenn ich in Erinnerungen aus der Vergangenheit und in Träumen der Zukunft webe. Dann, wenn das Glück mir eine Blüte nach der andern zuwirft, werd ich lächeln und fragen: wozu? Jetzt bin ich selbst halb tot.
Nimm aber Du meinen heißen Dank für alles, was Du für die Entschlafene getan! Du hast ihr doch so manchen Tag zu einem vergoldeten gemacht, und ihr Leben war so dürftig, daß auch noch geringere Kleinigkeiten es ihr versüßen konnten.
Daß sie mir gerade jetzt, wo ich hoffen durfte, sie wiederzusehen und wo mein Schicksal sich endlich entscheiden muß, entrissen ward, macht mir den Verlust doppelt herb. Und dennoch: was bürgt mir denn für die Verbesserung meiner Lage? Ist nicht vielleicht ihr Tod ein Wink der Gottheit, daß ich von der Zukunft nichts erwarten soll? Seis, wie es sei, leichter werd ich von jetzt an alle Widerwärtigkeit ertragen, da sie mich allein trifft. Ich habe, ich bekenne es, nur selten an meine Mutter gedacht; es war mir zu peinlich, mich in ihre trüben Zustände zu verlieren, in die ich keinen Sonnenstrahl fallen lassen konnte; es griff ins Räderwerk meines ohnehin nicht mehr kräftig getriebenen Lebens zu störend ein. Nun macht mir mein Herz Vorwürfe, die ich nicht verdient zu haben glaube. Es tötet den Menschen, wenn er sich nach irgend einer Seite hin oft in seiner Ohnmacht fühlt. Daß die Mutter sterben würde, schien mir unmöglich; als ich Deinen vorletzten Brief empfing, fühlte ich mich keineswegs stark beunruhigt. Es gibt Geschicke, vor denen man, aller Wandelbarkeit des Irdischen ungeachtet, sicher zu sein glaubt; dahin gehörte für mich dieser frühe Tod meiner Mutter. Von nun an will ich glauben, daß auch ich sterben kann, ein Gedanke, der mir, wie Du weißt, fern blieb, als die Cholera hier rings um mich her unzählige Opfer darniederstreckte ...
Tagebuch 18. Sept. 1838.
Sonntag, den 16. dieses Monats, als ich kaum zu Mittag gegessen hatte, erhielt ich einen Brief von meinem Bruder, worin er mir anzeigte, daß meine Mutter, Antje Margaretha, geborene Schubart, in der Nacht vom 3. auf den 4. um 2 Uhr gestorben sei. Sie hat ein Alter von 51 Jahren 7 Monaten erreicht und ist, was ich für eine Gnade Gottes erkennen muß, nur vier Tage krank gewesen; vier Tage ganz leidlich, so daß sie noch selbst aufstehen konnte, den fünften sehr bedeutend mit Krämpfen geplagt, die ein Schlagfluß mit dem Leben zugleich (auf sanfte Weise, wie der Arzt sich aussprach) endete. Sie war eine gute Frau, deren Gutes und minder Gutes mir in meine eigene Natur versponnen scheint: mit ihr habe ich meinen Jähzorn, mein Aufbrausen gemein, und nicht weniger die Fähigkeit, schnell und ohne weiteres alles, es sei groß oder klein, wieder zu vergeben und zu vergessen. Obwohl sie mich niemals verstanden hat und bei ihrer Geistes- und Erfahrungsstufe verstehen konnte, so muß sie doch immer eine Ahnung meines innersten Wesens gehabt haben, denn sie war es, die mich fort und fort gegen die Anfeindungen meines Vaters, der (von seinem Gesichtspunkte aus mit Recht) in mir stets ein mißratenes, unbrauchbares, wohl gar böswilliges Geschöpf erblickte, mit Eifer in Schutz nahm und lieber über sich selbst etwas Hartes, woran es wahrlich im eigentlichsten Sinne des Worts nicht fehlte, ergehen ließ, als daß sie mich preisgegeben hätte. Ihr allein verdanke ichs, daß ich nicht, wovon mein Vater jeden Winter, wie von einem Lieblingsplan sprach, den Bauerjungen spielen mußte, was mich vielleicht bei meiner Reizbarkeit schon in den zartesten Jahren bis auf den Grund zerstört haben würde; ihr allein, daß ich regelmäßig die Schule besuchen und mich in reinlichen, wenn auch geflickten Kleidern öffentlich sehen lassen konnte. Gute, rastlos um deine Kinder bemühte Mutter, du warst eine Märtyrin, und ich kann mir nicht das Zeugnis geben, daß ich für die Verbesserung deiner Lage immer so viel getan hätte, als in meinen freilich geringen Kräften stand! Die Möglichkeit deines so frühen Todes ist meinem Geist wohl zuweilen ein Gedanke, doch meinem Herzen nie ein Gefühl gewesen; ich hielt mich in Hinsicht deiner der Zukunft für versichert; ich legte an deine Zustände meinen Maßstab und tat oft nichts, weil ich nicht alles zu tun vermochte. Ich war nicht selten, als ich dir noch näher war, rauh und hart gegen dich; ach, das Herz ist zuweilen ebensogut wahnsinnig, wie der Geist; ich wühlte in deinen Wunden, weil ich sie nicht heilen konnte; deine Wunden waren ein Gegenstand meines Hasses, denn sie ließen mich meine Ohnmacht fühlen. Vergib mir das, was du jetzt in seinem Grunde wahrscheinlich tiefer durchschaust, als ich selbst, und vergib es mir auch, daß ich, verstrickt in die Verworrenheiten meines eigenen Ichs und ungläubig gegen jede Hoffnung, die mir Licht im Innern und einen freien Kreis nach außen verspricht, deinen Tod nicht beklagen, kaum empfinden kann. Diese Unempfindlichkeit ist mir ein neuer Beweis, daß der eigentliche, der vernichtende Tod die menschliche Natur so wenig als Vorstellung noch als Gefühl zu erschüttern vermag, und daß er eben darum auch gar nicht möglich ist; denn alle Möglichkeiten sind in unserm tiefsten Innern vorgebildet und blitzen als Gestalten auf, wenn eine Begebenheit, ein Zufall, an die dunkle Region, wo sie schlummern, streift und rührt. Auch Klagen, auch Tränen werden dir nicht fehlen, wenn ich einmal wieder ich selbst bin, und ewig wird dein stilles, freundliches Bild in aller mütterlichen Heiligkeit vor meiner Seele stehen, lindernd, beschwichtigend, aufmunternd und tröstend. Wenn ich an dich denke, an dein unausgesetztes Leiden, so wird mir jede Last, die mir das Schicksal auflegt, gegen die deinige leicht dünken; wenn ich mich deiner kümmerlichen Freuden erinnere, die dein Herz dennoch in sanfter Seligkeit auftauen ließen, so werd ich mich nie freudenleer dünken. So wirst du mir noch über das Grab hinaus Mutter sein; du wirst mir vergeben und ich dich nimmer, nimmer vergessen!
20. Sept. 1838.
Hochwohlgeborener, hochverehrter Herr Regierungsrat! So erfreulich es mir war, einen Brief von Ihnen zu empfangen, so sehr mußte mich der Inhalt desselben betrüben. Mein Freund schrieb mir zwar, daß er an Kopfweh leide und sich ermattet fühle; doch hielt ich diese Übel für ganz natürliche Folgen seiner letzten Anstrengungen, die sich bald wieder legen würden, keineswegs für Vorboten einer gefährlichen Krankheit. Ihre entgegengesetzte Nachricht beunruhigt mich außerordentlich; ich mußte mir gestern von einem ärztlichen Bekannten sagen lassen, daß gastrische Fieber hier äußerst gefährlich seien, weil sie nicht selten in Nervenfieber ausarteten, und ich weiß, wie reizbar das Nervensystem meines Freundes ist. Was mich einigermaßen tröstete, ist, daß er sich im Schoß der Liebe bei seiner Familie befindet, und daß er dasjenige Lebensziel, welches alle andern Bestrebungen in gewissem Betracht fundamentiert, wenigstens äußerlich unterstützt, auf die rühmlichste Weise erreicht hat. Der menschliche Geist kehrt nun gar zu gern (meine eigene Erfahrung hat es mich vielfach gelehrt) gegen sich selbst das Schwert, womit er, von körperlicher Ohnmacht gebunden, die harte, spröde Welt nicht öffnen kann; er ist ein wahnsinniger Schiffer, der den ungünstigen Wind sich selbst auf die Rechnung setzt, der jede Klippe, statt sie zu umfahren, nieder segeln oder daran scheitern will. In diese Stimmung kann mein Freund jetzt, gottlob, nicht hineingeraten; er hat erlangt, was er erlangen wollte, und den Faden weiter zu spinnen, hatte er keine Zeit; denn nur das Angefangene, was nicht zu Ende gebracht ward, stiehlt sich als Gespenst in die Träume und Phantasien eines Kranken ein, nicht das noch unergriffen Fernstehende. Ist er aber nun vor inneren Stürmen gesichert, so wird seine gesunde Natur, wie ich zuversichtlich hoffe, dem Fieber schon Trotz bieten.
Was mich selbst betrifft, so habe ich am Sonntag die schmerzlichste Nachricht erhalten, die ich auf Erden erhalten konnte. Meine Mutter ist schon am 4. dieses Monats nach einem sehr kurzen Krankenlager verschieden. Ich habe sie seit dritthalb Jahren nicht gesehen, und ich hatte sie sehr lieb; sie war für mich der Punkt, an den ich alles, was ich von der Zukunft erwartete, anknüpfte. Ich bin von Ihrer freundlichen Teilnahme überzeugt und bitte Sie, meinem teuren Freunde dies Ereignis zu verschweigen. Ich lege für ihn ein paar Zeilen an, die ganz unverfänglichen Inhalts sind, ja eigentlich ohne allen Inhalt. Sie werden selbst ermessen, ob sie ihm übergeben werden können, oder ob sie ihm, ihrer Unbedeutendheit ungeachtet, vorenthalten werden müssen.
Ich sage Ihnen, hochgeehrter Herr, für die Wiederholung Ihrer so zuvorkommenden Einladung meinen herzlichsten Dank, und sehne mich unendlich, die Schriftzüge meines Freundes recht bald wieder zu erblicken. Sollte sein Zustand, was Gott verhüten wollte, sich verschlimmern, so werde ich von Ihrer Güte wohl einer kurzen Benachrichtigung entgegensehen dürfen. Mit der Bitte, mich unbekannterweise Ihrer Frau Gemahlin und Ihren Fräulein Töchtern empfehlen zu wollen und unter viel tausend Grüßen an den teuren Kranken ...
30. Sept. 1838.
... Um meinen Freund bin ich in der größten Angst. Seine Krankheit ist lebensgefährlich; das gastrische hat sich in ein Nervenfieber verwandelt, und er ist so reizbar, daß dieses Fieber bei ihm einen noch schlimmeren Charakter annehmen muß, als es ohnehin schon hat. Zum Glück befindet er sich bei den Seinigen; wäre er von dem Nervenfieber in München befallen worden, so könnte er kaum genesen. Erst heute morgen erhielt ich einen Brief von seinem Vater; danach hat er den einundzwanzigsten Tag (an den sich in der Regel eine wichtige Krisis knüpft) glücklich überstanden; das Bewußtsein ist zurückgekehrt und eine Hinneigung zur Besserung bemerkbar; die Gefahr ist aber noch immer sehr groß. Wie dies auf mich wirken muß, kannst Du Dir nur zum Teil denken, da Du meinen Freund nicht kennst. Er schloß sich schon in Heidelberg mit größter Wärme an mich und war die Hauptursache, daß ich nach München ging; seitdem ist er mir im vollsten Maß gewesen, was in solchem Verhältnis ein Mensch dem andern irgend sein kann. Du weißt, ich bin so schwer anzufassen, wie ein Stechapfel, und ich setze gerade das, was mir am wertesten ist, am leichtesten aufs Spiel, um den Gedanken, als könnten mich Rücksichten bestimmen, ja nicht aufkommen zu lassen. Seine Geduld und Langmut, die Sorgfalt, die ihn jeden Dorn, statt ihn abzuhauen, mit Baumwolle umwickeln läßt, sind mir zuweilen selbst ein Gegenstand des Erstaunens gewesen; er ist mir von ganzer Seele ergeben, wie noch niemals ein anderer; seine Teilnahme für mich ist unbegrenzt und fast weiblicher Art. Und sein Blut ist heiß, über jede Kleinigkeit regt er sich auf; in Heidelberg hat er sich (das Zeichen trägt er auf der Wange) wegen einer geringfügigen Ursache geschlagen; wenn er sich also bekämpft, so geschieht es mit Freiheit, und weil er glauben muß, daß an mir dies oder jenes zu schätzen sei, keineswegs aus Mangel an Feuer und Schwungkraft. Freilich ist er auch mir manches schuldig geworden, vorzüglich den wichtigsten Teil seiner poetischen Bildung; was ich ihm in drei Stunden des Gesprächs überlieferte, hätte ihm vielleicht, wenn er es selbst hätte finden sollen, Jahre zu schaffen gemacht. Gott wird mir ihn erhalten; die Bekümmernis um ihn läßt mich fast meine Mutter vergessen; er wäre mir nicht weniger unersetzlich, wie diese.
30. Sept. 1838.
Mein teuerster Rousseau! Wie sehr ich Deinetwegen in Angst gewesen bin, kann ich Dir gar nicht sagen. Mit der größten Ungeduld sehe ich den Briefen Deines Vaters entgegen, und wenn sie eintreffen, so wage ich sie kaum zu öffnen. Gott sei gelobt, heute erfahre ich, daß Du Dich auf dem Wege der Genesung befindest. Wenn der Himmel mir Dich nur erhält, so will ich ihm die Erfüllung meiner übrigen Wünsche erlassen; ohne Dich wären sie mir ohnehin gleichgültig.
Es sind dies martervolle Wochen für mich gewesen, und dennoch, wenn ich zurückblicke, scheint es mir, als ob ich eigentlich niemals die Hoffnung aufgegeben hätte. Nur dann, wenn ich einen Brief in Händen hielt, zitterte mein Herz. Ich habe eine große Kraft, meinen Schmerz zu verschieben, oder vielmehr mich in einen Zustand der Dumpfheit zu versetzen; doch läuft alles am Ende auf Täuschung hinaus; man macht die Augen vor dem Feind zu, aber man fühlt seine Stöße.
Noch einmal, Gott sei gelobt. Hat er Dich wieder so weit gebracht, so wird er Dich auch weiter bringen. Das ist gar nicht anders möglich, möcht ich sagen. Du hältst das Leben an mehr als einem Faden fest.
Worum ich Dich aber bitte: bedenke jetzt nichts, als Deine Krankheit; nicht Deine Lebenspläne, nicht mich. Wäre ich bei Dir, so wollt ich mein bißchen Witz und Erfindungsgabe auf die Folter spannen, um Dich fortwährend lachen zu machen. Doch, freilich, sobald Du irgend wieder ein Bedürfnis der Unterhaltung fühlst, kannst Du ganz andere Leute kommandieren: den Don Quixotte, den Katzenberger, den Schmelzle und so weiter. Im höchsten Ernst: mach durch diese Bücher Deine Nachkur; das Lachen ist die Elektrizität des Geistes und hat wenigstens mich vor der Cholera bewahrt. Du siehst, wie voreilig ich bin, ich spreche schon von der Nachkur.
Auf keinen Fall laß Dich vor Ablauf von vier bis fünf Wochen auf Briefschreiben ein; jede Zeile von Dir, die ich früher erhielte, würde mich erschrecken. Rückfälle sind gar zu häufig und zu fürchterlich und werden durch die geringste Anstrengung hervorgerufen. Ich dagegen werde Dir fleißig schreiben, sobald ich weiß, daß Du meine Briefe ohne Schaden lesen kannst ...
5. Okt. 1838.
Am gestrigen Morgen erhielt ich die Nachricht, daß mein Freund am 2. dieses Monats früh um 1 Uhr sanft und bewußtlos entschlafen ist. Ich habe kaum Kraft, Dir dies zu schreiben; woher soll ich die Kraft nehmen, es zu ertragen?
Erst jetzt ist die Welt mir öde. Wenn ich aus meinem Fenster sehe und mir denke: er kommt nie mehr vorüber, er winkt nie mehr herein, er öffnet die Tür nicht wieder und fragt mit seiner sanften innigen Stimme, wie geht es Dir? ach, da scheint es mir unmöglich, daß ich fortleben kann. Ich weiß nicht, wohin ich mich vor meinen Gedanken und Erinnerungen flüchten soll; jeder Weg, den ich wandle, zeigt mir sein teures, jetzt in ewige Nacht versunkenes Bild; denn Arm in Arm mit ihm habe ich ihn unzählige Male gemacht; jedes Buch, das ich ergreife, erinnert mich an auf immer vergangene reiche Stunden, deren Honig mich jetzt vergiftet; denn wir haben darüber gesprochen, daran empfunden. Unleidlicher Schmerz ergreift mich, und ich bin erbittert auf mich selbst, daß er zuweilen aussetzt, daß er nicht noch größer und gewaltsamer ist.
O, Elise, das war der beste Mensch, den die Erde je getragen hat. Ich weiß, ein jeder sagt das im Augenblick eines solchen Verlustes, aber ich sage nichts, als was ich immer gefühlt habe. Du kennst mich, Du weißt, wie schwer es mit mir zu leben ist; drittehalb Jahre sind wir Freunde gewesen, zwei Jahre waren wir ununterbrochen zusammen, und niemals, niemals haben wir uns entzweit. An mir lag es nicht, wenn es nicht geschah, aber seine himmlische Sanftmut, seine Kraft, alles, was ihn verletzen mußte, still in sich zu verschließen, seine Großmut, meinem geringen, nichtswürdigen Talent jede Herbheit meines Wesens zu vergeben, ach, alle jene hohen Eigenschaften seines Herzens, die mich ihn jetzt in der Glorie eines Heiligen erblicken lassen, ließen nie einen Zwist aufkommen.
Er war mir alles, was ein Mensch in dem höchsten, würdigsten Verhältnis dem andern sein kann; wehe mir, daß ich mir nicht das gleiche Zeugnis geben darf. Ich konnte mich, elenderweise, nie entschließen, ihn als ganz ebenbürtig zu betrachten; ich mißbrauchte meinen Geist nicht selten, und eben dadurch, daß ich ihn zur unrechten Stunde gebrauchte; ich munterte ihn nicht genugsam auf; ich hob immerwährend den Medusenschild der Wahrheit, und bedachte nicht, daß ich ihren Anblick in früheren Jahren wohl auch nicht hätte ertragen können. Ich war nicht strenger gegen ihn, als gegen mich; doch, ich bin sechsundzwanzig und er war zweiundzwanzig. Wenn ich dies alles bedenke, wenn ich mir vorstelle, wie sehr die innere Verzweiflung, die die Brust jedes Künstlers beklemmt, durch dergleichen in ihm genährt werden mußte, wenn ich mich erinnere, daß mir Gedanken dieserart auch früher schon gekommen sind, daß ich aber desungeachtet in meiner Strenge fortfuhr, da, Elise, möcht ich mich für einen schlechten Kerl halten, und mein Gewissen sagt fast Ja dazu.
Könnte ich ihn aus dem Grabe zurückkaufen: kein Preis wäre mir zu hoch. Aber nichts ist mir geblieben, als die Hoffnung, daß ich von jetzt an, wenn nicht die äußere Unmöglichkeit eingetreten wäre, besser handeln würde, nichts, als ein Grund mehr, das Leben zu verachten und den Tod zu lieben.
»Schlummre sanft!« Das war der Gruß, mit dem er mich des Abends (ich brachte die Abende meistens mit ihm in seinem Zimmer oder im Freien zu) gewöhnlich entließ. Seine Stimme war so innig, so unendlich weich und mild, mir däucht jetzt, ich habe niemals etwas Süßeres gehört. Dies »Schlummre sanft« klingt mir immerwährend in der Seele fort; ich glaubte es die ganze, letzte Nacht zu hören, es tönte in meinen Schlaf hinein. Ja, schlummre sanft, mein liebster, teuerster, unvergeßlicher Rousseau, schlummre sanft, vergib mir, oder, wenns sein muß, vergiß mich, und bitte Gott, daß er dies verfluchte, harte, starre Herz so zerquetsche, zerdrücke, martre, bis es wieder zu fühlen anfängt, oder zu schlagen aufhört; Dir aber gebe er die Seligkeit des reinsten Daseins und die Kraft, Deinen Geliebten, Deinen armen Eltern und Geschwistern noch als Geist zu nahen und sie zu trösten.
Ich kann jetzt nicht weiter schreiben.
Nachmittags.
Wie undankbar bin ich gegen den Himmel gewesen; ich klagte, ich murrte, und hatte einen solchen Freund! »An mich will ich gar nicht denken, ich habe nichts geleistet, aber Du!« Mehr als einmal hat er das gesagt. Wie glücklich konnte ich ihn machen, wenn ich einmal fröhlich war; welch einen tiefen Anteil nahm er an meinen Schmerzen, meinen Fatalitäten, ja sogar meinen Grillen. Es wäre meine Pflicht gewesen, mich von ihm, wie von aller Welt, zurückzuziehen; in der trüben Atmosphäre, worin ich atme, muß frisches, freies Leben ersticken. Ich habe das zuweilen zu ihm gesagt, dann lächelte er und drückte meine Hand. Ach, er wollte es nicht besser haben, als ich es hatte, er hätte mich in die Hölle hinein begleitet. Uhlands »treuer Kamerad« war sein Lieblingsgedicht; oft zitierte er einige Strophen davon, wenn wir miteinander gingen. Den Gedanken, daß er mehr an meinem, als an seinem Kummer gestorben ist, kann ich nicht los werden. Welch ein Maß von Liebe setzt dies voraus; Liebe, die Mann gegen den Mann trug! Und ich habe ihn gequält, mit ihm gerechtet; was mich hätte beseligen sollen, hat mir oft ein widerwärtiges Gefühl einflößen können. So unsinnig war ich, daß ich zuweilen mit der Quelle dieser Liebe nicht zufrieden war; es verdroß mich, daß sie mehr aus Achtung vor meinem Geist, als aus Neigung zu mir, dem Menschen, entsprang. Ich bin gestraft. Gott hat mir ihn genommen, und mein Leben ist ein dunkles Gemisch aus Reue, Dumpfheit und Sehnsucht. Was ich hatte, wußte ich nicht zu schätzen; es ward mir entrückt und ist nun der einzige Gegenstand meines Verlangens. Für eine Stunde, noch mit ihm verbracht, gebe ich so viel Jahre, als das Schicksal begehrt. Vergönne mir, liebe Elise, daß ich über ihn rede; es erleichtert mich, wenn nicht Gott allein, wenn auch ein Mensch meine Sünden kennt.
Und stelle es Dir in seiner ganzen Entsetzlichkeit einmal vor. Am 28. August promoviert er mit Ruhm und Glanz; ich mache die Bekanntschaft seines Vaters, der in Geschäftsangelegenheiten hierher kam; wir verleben einige Tage in Freude und Heiterkeit, und voll frischen Jugendmuts, mit dem süßen Gefühl, daß er nun alle Zwangsarbeit hinter sich hat und jetzt sich Aufgaben stellen kann, wie er will, reist er am 2. September, einem Sonnabend, nach Ansbach ab. Ich stand des Morgens in der Frühe um 4 auf und ging noch zu ihm; wie mich das jetzt erfreut, kann ich Dir kaum sagen; wir waren doch noch bis 6 Uhr, wo der Wagen vorfuhr, beisammen. Ich umarme ihn, der in Kraft und Gesundheit blühend vor mir steht; es war unter uns abgemacht, daß ich in 4 Wochen nachkommen sollte; noch ein Handschlag, »Grüße an die Deinigen«, und der Wagen rollt fort. Acht Tage später erhalte ich einen Brief von ihm, worin er mir einige Notizen über das Morgenblatt mitteilt; er klagt über Kopfschmerz und starke Ermattung; ich finde das natürlich und denke, es wird schon wieder verschwinden; ich bedaure ihn in meiner Antwort so kühl, wie es bei geringen Unpäßlichkeiten zu geschehen pflegt. Bald darauf zeigt sein Vater mir an, daß Emil mir zurzeit nicht antworten könne, weil er an einem gastrischen Fieber darniederliege, daß er zwar sehr verlange, mich bei sich zu sehen, daß aber die Ärzte die dadurch entstehende Aufregung fürchteten, und daß ich also noch nicht kommen möge. Die Nachricht erschreckt mich freilich, doch hoffe ich das Beste. Ich erhalte einen zweiten Brief; das gastrische Fieber ist ein Nervenfieber geworden. Jetzt packt mich die ungeheuerste Angst; ich weiß mich nicht zu lassen, ich stecke den Brief in die Tasche und gehe aus dem Hause. Im Hofgarten setze ich mich auf eine Bank, ich bete, viele Menschen gehen an mir vorüber; ich halte die Hand vor die Augen und denke: was du nun zuerst siehst, soll dir ein Zeichen sein. Ich öffne die Augen und – stelle Dir mein Grauen vor! – eine in tiefste Trauer gekleidete Dame fällt mir ins Gesicht. Ich kann den Zustand nicht ertragen; es ist nichts! sag ich zu mir selbst; er ist stark und kräftig, es kann ja gar nicht sein! Die Ruhe kehrt wieder zurück. Ich erhalte am letzten Freitag einen dritten Brief; der kritische einundzwanzigste Tag ist überstanden, es bessert sich mit ihm; sein Vater bittet mich, die Ausfertigung des Doktordiploms zu betreiben. Ich habe gar keine Furcht mehr; ich gehe zu dem Dekan, Hofrat Ast, dieser verspricht mir, daß ich das Diplom so schnell, als möglich erhalten soll; mir ist ganz leicht ums Herz. Am Mittwoch (gestern) erhalte ich einen vierten Brief, ich zittre, wie ich den Postboten nur höre; das Siegel ist schwarz; er, dem ich schon wieder ein paar scherzhafte Zeilen (zu seiner Erheiterung) zugesandt hatte, ist tot!
18. Okt. 1838.
Was ich oben unter häufigen Tränenergüssen (die bei mir seltener sind, als die sie erzeugenden Schmerzen) niedergeschrieben habe, weiß ich nicht mehr; wie ich es niederschrieb, weiß ich noch wohl. Mein Freund verdient im vollsten Maße jedes Lob, das ich ihm beilegte; aber ich verdiene nicht den Tadel, den ich im ersten Aufruhr der Gefühle maßlos gegen mich selbst richtete. Es ist keine Sünde, es ist Bedingung des Lebens, daß der Mensch seine Kräfte gebraucht; Kraft gegen Kraft; in Gott ist die Ausgleichung. Ich fühle es jetzt nicht bloß, ich weiß es, daß ich jenen Tadel nicht verdiene; die Gründe dieses Wissens, zum Teil aus der Sache an und für sich, zum Teil aus den hinterlassenen Briefen und Papieren meines Freundes hervorgehend, kann ich hier nicht weiter auseinandersetzen ...
9. Okt. 1838.
... Unsere Freundschaft war ein Verhältnis seltener Art. Wir hatten uns nicht zum Spaziergang die Hand gegeben, wir waren mit unserm Herzblut aneinandergeleimt. Wir drückten nicht vor dem Ernst der Welt die Augen zu, um ungestört mit ihren Blumen zu tändeln; wir feierten ein Bacchanal des Schmerzes. Wir hatten unsere ganze Zukunft verkreuzt, und so wird er mir selbst da, wo der Mensch doch meistens alleinsteht, im Kreise meiner Tätigkeit, bis ans Ende meiner Tage fehlen.
Wohl Wenige werden sich rühmen können, ihn so ganz in allen schönen Eigenschaften seines Herzens und seines Geistes gekannt zu haben, wie ich. Diese himmlische Sanftmut bei der höchsten Energie, diese unbegrenzte Seelengüte bei dem heftigsten Unwillen gegen Heuchelei und Lüge, werden mir ewig unvergeßlich sein. Streben nach Wahrhaftigkeit in Sein und Wirken war das erste, was ich schon bei oberflächlicher Bekanntschaft an ihm schätzen lernte; und dies Streben, welches von jeher nur die Vorzüglichsten auszeichnete, ist doppelt hoch anzuschlagen in einer Zeit, wie die unsrige, die in der Wahrheit einen Basilisken sieht.
Es war kein unüberlegter, vermeidbarer, es war ein nach allen Seiten durchdachter und aus den tiefsten Bedürfnissen seiner Natur hervorgehender Schritt, wenn er sich entschloß, die Jurisprudenz aufzugeben und fortan nur der Literatur und Philosophie zu leben. Er verhehlte sich nicht, daß dies auf den Genuß des Lebens Verzicht leisten heiße; aber er fühlte sich jedes Opfers, jeder Anstrengung fähig; er empfand, daß er – worauf es vor allem ankam – selbst dem kargen Lohn, der heutzutage im günstigsten Falle solche Bestrebungen krönt, zu entsagen vermöge, wenn es ihm nur vergönnt sei, still und schlicht in diesen höchsten Kreisen menschlicher Tätigkeit das Treffliche zu fördern. Er erkannte aber desungeachtet, daß die Notwendigkeit jenes Schritts, eben, weil sie durchaus nur eine innere war, auch von dem besten teilnahmsvollsten Freunde schwer zu erkennen sein werde; er wußte daher das würdige Benehmen des edelsten der Väter, welcher der Empfindung des Sohns mehr vertraute, als dem Achselzucken des unzufriedenen Verstandes, hochzuschätzen und zu verehren.
Er sah in der Kunst, was sie ist: die erste Priesterin am Altar, und er liebte sie mit der Begeisterung, welche die Erkenntnis ihrer Göttlichkeit immer begleiten wird. Er begnügte sich auch hier nicht mit dem Schein, und er würde, wenn ihm das Schicksal eine längere Bahn beschieden hätte, als Dichter gewiß das Bedeutende hervorgebracht haben, denn er verlangte es von sich selbst, und niemand macht eine Forderung an sein Ich, die es nicht befriedigen kann.
Wohl mögen wir wehklagen und weinen, wenn wir ihn hinweggenommen sehen in dem Moment, wo er das eigentliche Werk seines Lebens beginnen wollte! Aber zugleich müssen wir bedenken, daß nur wir durch diesen dunklen Wendepunkt verloren haben, daß er selbst jedoch kein einziges Samenkorn verlieren kann, und daß seine Ernte in den lichten Sphären, wo die Kraft wächst und der Widerstreit verschwindet, nur um so früher reifen und um so glänzender und reicher ausfallen muß. Es gibt eine doppelte Wirkung, eine äußere und eine innere; jene erprobt sich an der Welt und zerbricht oft an ihrer steinernen Schale, diese ergießt sich, wie ein Feuerstrom, in die Quelle, aus der sie entsprang, in die menschliche Seele, zurück, und sie ist in meinen Augen die eigentlichste Bürgschaft der Verheißung, denn sie wirkt das Wunder, daß der Mensch aus sich selbst die Unsterblichkeit, aus der Zeitlichkeit die Ewigkeit schöpft. Wir aber, wollen wir nicht gern verlieren, wenn wir nur wissen, daß er gewinnt? Nicht tot, nicht begraben wollen wir ihn uns denken, sondern umgürtet mit Engelkraft, umkleidet mit himmlischem Licht; und jener geweihten Stunde, wo er uns armen geknickten und zerquetschten Erdesklaven in verklärter Gestalt entgegentritt; wo er uns sagt, was und wieviel er gewonnen hat, wollen wir uns entgegenfreuen! ...
14. Nov. 1838.
in Ansbach, Emils Schwester.
Verehrtestes Fräulein! – – – Der Tod eines heißgeliebten Menschen ist die eigentliche Weihe für eine höhere Welt, das hab ich in der letzten Zeit aufs innigste empfunden. Man muß auf Erden etwas verlieren, damit man in jenen Sphären etwas zu suchen habe! Und in diesem Sinne darf man wohl sagen: der Schmerz ist der größte Wohltäter, ja der wahre Schöpfer des Menschen ...
Abendgefühl 17. Oktober 1838.
Friedlich bekämpfen
Nacht sich und Tag.
Wie das zu dämpfen,
wie das zu lösen vermag!
Der mich bedrückte,
schläfst du schon, Schmerz?
Was mich beglückte,
sage, was wars doch, mein Herz?
Freude wie Kummer,
fühl ich, zerrann,
aber den Schlummer
führten sie leise heran.
Und im Entschweben,
immer empor,
kommt mir das Leben
ganz wie ein Schlummerlied vor.
Tagebuch November 1838.
Jetzt habe ich schon zum zweitenmal von meinem Rousseau geträumt. Er lebte noch, aber ich wußte recht gut, daß er bald sterben würde; ich hatte ihn unendlich lieb und suchte ihm dies auf alle Weise an den Tag zu legen. Ich wüßte nicht, daß ich jemals eine Empfindung von so wunder Süßigkeit (ich finde kein anderes Wort) gehabt hätte.
Es ist sehr schlimm, mit äußeren Hindernissen kämpfen und daran die Hälfte der geistigen Mitgift vergeuden zu müssen; am schlimmsten aber ist, daß ein Mensch, der das wußte, nie über sich ins klare kommen, daß er nie wissen kann, ob sein Ich, sein ursprüngliches, unverfälschtes, oder sein verschrobenes Verhältnis zur Welt in ihm wirksam ist, wenn er zuweilen nicht aus noch ein weiß. Dunkelheit über diesen Punkt kann zur Verzweiflung führen; ich wollte mich an jegliche, an die abscheulichste Erscheinung gewöhnen, die aus meinem Innern auftaucht, wenn ich mir sagen dürfte: auch in solcher Gestalt mußtest du eine Zeitlang einhergehen, wenn du überhaupt existieren solltest; doch der Gedanke: es ist nicht deine eigne Krankheit, es ist fremdes Gift, was dich entstellt, ist fürchterlich, um so fürchterlicher, da er ganz und gar täuschen kann.
Das Gebet des Herrn ist himmlisch. Es ist aus dem innersten Zustande des Menschen, aus seinem schwankenden Verhältnis zwischen eigener Kraft, die angestrengt sein will, und zwischen einer höheren Macht; die durch erhobenes Gefühl herbeigezogen werden muß, geschöpft. Wie hoch, wie göttlich hoch steht der Mensch, wenn er betet: vergib uns, wie wir vergeben unsern Schuldigern; selbständig, frei steht er der Gottheit gegenüber, und öffnet sich mit eigner Hand Himmel oder Hölle. Und wie herrlich ist es, daß diese stolzeste Empfindung nichts gebiert, als den reinsten Seufzer der Demut: führe uns nicht in Versuchung! Man kann sagen: wer dieses Gebet recht betet, wer es innig empfindet, und soweit es die menschliche Ohnmacht gestattet, den Forderungen desselben gemäß lebt, ist schon erhört, muß erhört werden. Das Amen geht unmittelbar aus dem Gebet selbst hervor; so ist es im höchsten Sinne ein Kunstwerk.
Ich will nicht, daß mein Schönes und Treffliches anerkannt werde, ich will nur, daß das Schöne und Treffliche überhaupt anerkannt werde. Findet aber das Schöne und Treffliche überhaupt Eingang, so muß auch das Gute, was von mir ausgeht, eine gute Statt finden, und darum darf ich, ohne Egoist zu sein, es immer mit Schmerz empfinden, wenn etwas, das mir gelingt, nur für mich selbst, nicht auch für andere, existiert. Ich glaube, bescheidener kann und darf keiner denken, der kein Narr ist.
Je tiefer wir in die Natur und ihren Reichtum eindringen, um so größere Ansprüche machen wir an sie. Ehemals waren die Erwachsenen, wie die Kinder; wie hoffnungslos sind die Zeiten, wo die Kinder wie die Erwachsenen sind. Worum lernen wir so viel und so schnell!
Du ahnst nicht, liebe Elise, wie unendlich gern ich das Weihnachtsfest bei dir und in Hamburg zubrächte! Gerade dieses Fest, wie jeden anderen Tag, gleichgültig und ungenossen an sich vorübergehen zu lassen, ist so schmerzlich. Das hat wohl jedem Kinde, und auch mir etwas gebracht; dann wurde von den blauen Hirschtellern – so genannt, weil in ihrer Mitte ein Hirsch, den mein Vater gewöhnlich mit Kreide auf den Tisch nachzuzeichnen pflegte, gemalt war – gegessen, es gab einen Mehlbeutel, zuweilen wohl gar mit Rosinen oder Pflaumen gefüllt, später ward guter Tee getrunken, hauptsächlich der lieben Mutter wegen, die ohne Tee nur halb vergnügt sein konnte; bevor das Essen kam, sang der Vater in Gemeinschaft mit mir und meinem Bruder ein geistliches Lied; nachher mußte ich aus der ehrwürdigen dickbäuchigen Postille mit den vielen Holzschnitten, die mich so seltsam-fremdartig begrüßten, das Evangelium und eine Predigt vorlesen; darauf erschien der Nachtwächter mit seiner weitdröhnenden Knarre unter dem Fenster, sang einen Vers und erhielt durch mich oder meinen Bruder den schon längst bereitgehaltenen, nicht selten geborgten Schilling, wofür er ein fröhliches Fest anwünschte; die Eltern waren heiter, auch der Vater, den wir fast das ganze Jahr nicht heiter sahen; die dumpfen, erstickenden Gespräche über die Schwierigkeit, Brot herbeizuschaffen, (lagen doch meistens zwei oder drei köstliche weiße breite Wecken im Schrank!) unterblieben; Scherz und Lachen waren erlaubt, und wir Kinder däuchten uns im Himmel. Dazu am Weihnachtsabend der schöne Gedanke: diese Herrlichkeit dauert zwei volle Tage! Ich bin immer sehr traurig, wenn – was besonders im vorigen Jahre geschah – Weihnachten mir nicht die geringste Freudenblume zuwirft; an wenig andere Feste mach ich ähnliche Prätensionen, von meinem Geburtstag weiß ich z. B. fast nie, wann er ist.
Beppi erzählte, sie sei einmal, als wir uns entzweit hätten, entschlossen gewesen, mich ganz zu verlassen. »Aber da fiel mir auf einmal ein, wie viele zerrissene Strümpfe du hättest, und ich fühlte so ein Mitleid mit dir, daß ich mich gleich anders entschloß.«
10. Febr. 1839.
... Es ergreift mich jedesmal stark, wenn ich mich erinnere, daß ich etwas zum letztenmal tue; so gestern, als ich mir Postpapier kaufte, und jetzt, da ich diesen Brief schreibe. Ich sehne mich, Hamburg wiederzusehen und meine Lebensverhältnisse aufzufrischen; aber ich scheide desungeachtet ungern und mit Schmerzen von München. Diese Stadt ist in Deutschland einzig und ohnegleichen; man kann in ihr leben, wie man will; wem es gefällt, der stürzt sich ins rauschende, großstädtische Treiben, und wem dies nicht behagt, der zieht sich in die Einsamkeit zurück; eins ist so gut Mode und anständig, wie das andere. Wenn ich mich hier nicht immer behaglich fühlte, so lag es nur an mir; mit wundem Rücken liegt es sich selbst auf Rosen schlecht, vielleicht schlechter, als mit heilem auf Dornen. Eine bedeutende Lebensperiode knüpft sich für mich an meinen hiesigen Aufenthalt, die bei minderer Vereinsamung wahrscheinlich nicht so bedeutend geworden wäre: hier, wo ich ganz auf mich selbst gestellt war und mir das mir sonst immer von außen aufgedrungene Verhältnis zu meiner Umgebung selbst bilden mußte, hat sich mein Charakter und mein ganzes Wesen in innerster Eigentümlichkeit entwickelt, von der ich nur hoffen will, daß sie nicht gar zu schroff und abstoßend sei. Du weißt nur zu gut, wie wenig ich mir sonst in der Gesellschaft, und Unbekannten gegenüber, Geltung zu verschaffen wußte; Gott sei Dank, jenes Schwanken und Zagen hat sich ganz verloren und ein günstiges Geschick gab mir auch in München Gelegenheit, die Probe zu machen ...
Tagebuch März 1839.
O, wie süß sind die Schmerzen des Abschieds! wer könnte scheiden, wenn sie nicht wären! Das Herzblut schießt hervor,
wir glauben in Wehmut zu verfließen, uns ist, als sollten
wir sterben, und so gehts fort. Fort!
Kein Lebewohl, kein banges Scheiden!
Viel lieber ein Geschiedensein!
Ertragen kann ich jedes Leiden,
doch trinken kann ichs nicht wie Wein.
Wir saßen gestern noch beisammen,
von Trennung wußt ich selbst noch kaum!
Das Herz trieb seine alten Flammen,
die Seele spann den alten Traum.
Dann rasch ein Kuß vom lieben Munde,
nicht schmerzgetränkt, nicht angstverkürzt!
Das nenn ich eine Abschiedsstunde,
die leere Ewigkeiten würzt.
... Ich machte einen Spaziergang – den letzten – im Englischen Garten; da entstand in bezug auf das schon vorhandene erste ein zweites Scheidelied:
Das ist ein eitles Wähnen,
sei nicht so feig, mein Herz!
Gib redlich Tränen um Tränen,
nimm tapfer Schmerz um Schmerz!
Ich will dich weinen sehen,
zum ersten und letztenmal;
will selbst nicht widerstehen,
da löscht sich Qual in Qual.
In diesem bittren Leiden
hab ich nur darum Mut,
nur darum Kraft zum Scheiden,
weil es so weh uns tut!
Dann stieg ich den Monopteros Ein von Ludwig I. im Englischen Garten erbauter Aussichtstempel. hinan und übersah noch einmal den großen Garten und die Stadt. Ich habe dort gebetet, um Segen für München, das mich in seinem Schoß so freundlich aufnahm, und um Segen für mich selbst. »Mach etwas aus meinem Leben« – rief ich aus – »es sei, was es sei!« Auch für meine liebe Beppi habe ich den Segen des Himmels herabgerufen. Und, da dieses Blatt doch beschlossen werden muß: warum soll ich es nicht mit ihrem Namen beschließen?
Durch Schlaflosigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen und Brustbeklemmungen, die ihn in den letzten Monaten infolge schlechter Ernährung und seelischer Erregungen gequält hatten, geschwächt, trat Hebbel seine furchtbare Fußreise an. Beppi begleitete ihn ein Stück, dann nahmen sie unter vielen Tränen Abschied. Hebbel wanderte, von seinem Hündchen begleitet, über Pfaffenhofen, Ingolstadt, Eichstädt, Wasserburg, Roth und Schwabach nach Nürnberg. Nachdem er von Nürnberg bis Fürth seine erste Eisenbahnfahrt gemacht hatte, fuhr er mit dem Postwagen nach Bamberg. Ohne Mantel, kalter oder regnerischer Witterung ausgesetzt, meist gehend, hier und da mit nassen Füßen auf einem Wägelchen sitzend, wobei er immer noch mehr die blutigen Füße seines frierenden Hündchens als sich selber bedauerte, gelangte er schließlich über Koburg, Suhl, Gotha, Mühlhausen, Heiligenstadt nach Göttingen. Dort logierte er bei einem ihm bekannten Studenten, dem später so berühmt gewordenen Rudolf v. Ihering. Bei Regen und Schneegestöber ging es weiter über Eimbeck, Hannover und Celle. Am 23. März traf er in Harburg ein, wo Elise auf ihn wartete. »Beklemmendes Gefühl, als ich die Türme von Hamburg, die mir bei einer Biegung des Weges plötzlich in die Augen sprangen, wieder erblickte; lauter halbe, zerrissene, in sich nichtige und bestandlose Verhältnisse; ein Wolkenheer und nur ein einziger Stern: Elise.« »Schmerzlich-süßes Wiedersehen, denn auch wir standen nicht zueinander, wie wir sollten, und schlecht vergalt ich ihr ihre unendliche Liebe, ihre zahllosen Opfer, durch ein dumpfes, lebefaules Wesen.«