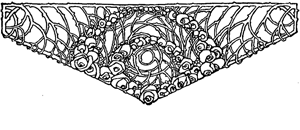|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
14. 11. 42 b. 27. 4. 43 und 28. 4. 43 b. 9. 9. 43
Zunächst mußte Hebbel in Kopenhagen, bevor er zu Christian VIII. gelangte, antichambrieren: er stellte sich verschiedenen Herren des Hofes, der Regierung und der Kanzlei vor, wurde weiterempfohlen, spielte bei Diners, zu denen man ihn einlud, infolge seiner gesellschaftlichen Ungeschicklichkeit eine unglückliche Rolle und hatte es endlich erreicht, den Hofmarschall zu sprechen, der ihm am 13. Dezember eine Audienz beim Könige verschaffte. Der Erfolg der Audienz war völlig unbestimmt, wenn der Dichter auch durch sein charaktervolles Auftreten auf den kunstsinnigen Fürsten ersichtlich Eindruck gemacht hatte.
Die Bekanntschaft mit dem Dichter Adam Öhlenschläger brachte Zuversicht in Hebbels ungewisse und bedrückte Stimmung. Der gute Mann kam ihm freundschaftlich entgegen und wurde in einem Briefe an den König sein warmer Fürsprecher. Durch Öhlenschläger lernte Hebbel den Bildhauer Thorwaldsen kennen; der Eindruck dieser Persönlichkeit und ihrer Schöpfungen war für ihn ein tiefgreifendes Ereignis. Inzwischen hatte sich Hebbel auch überzeugen können, daß seine Dichtungen unter der künstlerischen und literarischen Jugend der dänischen Hauptstadt bekannt geworden und nicht ohne Wirkung geblieben waren.
Die zweite Audienz Hebbels beim Könige fiel durch Öhlenschlägers Schreiben sehr günstig aus, der König erklärte sich bereit, den Dichter zu unterstützen. Während Hebbel noch Monate auf das Ergebnis warten mußte, fiel ihn ein langwieriges rheumatisches Leiden an. Endlich erhielt er die Nachricht, daß ihm der König ein Reisestipendium von 600 Reichstalern (1440 Mark) jährlich auf zwei Jahre bewilligt habe. Erlösten Herzens schrieb er die Freudenbotschaft der treuen Elise, mit der er sich während der Kopenhagener Zeit ganz besonders innig verbunden fühlte, und reiste einige Wochen später nach Hamburg zurück.
11. Dez. 1842.
Briefe geraten am besten, wenn man sie tagebuchmäßig schreibt. Gestern abend führte ich wieder ein Heldenstück aus und kaufte ein Brot; ich war durch die Lektüre zweier Dramen von Friedrich Halm sehr lustig gestimmt und wollte Dir noch schreiben, aber mein Zimmer war kalt, und weil ich einen kleinen Schnupfen habe, so wage ich nicht, sitzenzubleiben. Eben sah ich aus dem Fenster und erblickte mir schräg gegenüber einen allerliebsten kleinen Blondkopf, der von hinten mit seinem Rücken niederwallenden Locken dem Mäxchen so ähnelte, daß ich ihn zu sehen glaubte. Gewiß werde ich nun öfter, wie bisher, zu meinen Nachbarn hinüberschauen. Über Nacht träumte ich schauerlich und süß. Ich und Du schaukelten etwas, es war stürmisch und finster, der Wind strich eiskalt durch die Haare und Du sangest mit heller Stimme ein ganz wunderschönes Lied. Sonntag-Abend. Heute nachmittag um 5 Uhr, als ich eben ins Athenäum gehen wollte, erhielt ich ein Billet von Levetzou, des Inhalts, daß der König mich morgen empfangen wolle, und daß ich mich demnach um 10 im Vorgemach desselben einfinden möge. Es rollte mir kein Blutstropfe schneller, als ich die Nachricht empfing, und ich glaube nicht, daß ich morgen befangener sein werde, wie heute. Ich gehe zu einem Mann, den ich allein treffe, nicht in einer großen Gesellschaft; es kommt auf Worte an, nicht auf Verbeugungen. Für kein gutes Zeichen halte ichs, daß ich auf den allgemeinen Audienztag beschieden, nicht besonders berufen bin. Nun will ich mich schlafen legen! Morgen mittag ausführlich die ganze Unterhaltung, ihr Resultat schon jetzt! Doch nein, ich will meinen Genius nicht reizen! –
13. Dez. 1842.
Die Rücksicht auf meinen Genius hat nichts geholfen, das Resultat – doch, ich will ausführlich erzählen und nicht mit dem Letzten zuerst kommen. Um 10 Uhr verfügte ich mich an den vorgeschriebenen Ort. Ein ungeheuer großes Zimmer war von Menschen aus allen Ständen gedrängt voll. Rote Soldaten, Generale und Gemeine; blasse Theologen; feiste Beamte; kummervolle Bürger; Etatsräte, die unter der Last ihrer Orden erlagen; Bettler, die ihre Lumpen kaum zusammenhalten konnten; genug, ein tolles verworrenes Gemisch. Ich ging, solange noch Platz dazu vorhanden war, im Hintergrund auf und nieder; mir war, als ob ich in der Komödie sei und selbst eine kleine Rolle übernommen habe. Der Hofmarschall Levetzou erschien, ich machte ihm meine Verbeugung, er ersuchte mich, ihm zu folgen und steuerte durch die Menge, die ihm ehrfurchtsvoll auswich; ich, wie die Jolle dem stolzen Jachtschiff hinterdrein. An der Tür, die ins Allerheiligste führte, stellte er mich dem Adjutanten du jour vor, der meinen Namen anschrieb; eine Unterhaltung mit mir erlaubte die kammerherrliche Vornehmigkeit nicht, doch erhielt ich hin und wieder einen gnädigen Blick. Ich besah mir mit Muße seine Uniform, besonders gefiel mir der goldene Schlüssel auf dem Rockschoß, dies höchste Ziel menschlicher Bestrebungen. Einmal flüsterten Seine Exzellenz mir zu: es ist jeder zu bedauern, der hier warten muß, es ist aber derjenige noch mehr zu bedauern, der sie alle sprechen soll! Über diesen mir vor der ganzen großen Versammlung gegebenen Huldbeweis hätte ich außer mir selbst geraten und in stummem Entzücken zerfließen sollen; da ich aber unverschämt genug war, die Äußerung als eine Aufforderung zur Konversation zu betrachten und etwas darauf zu erwidern, so zogen Seine Exzellenz sich wieder von mir zurück. Die Uhr war halb elf, die Tür des Kabinetts ging auf und der Hofmarschall trat mit den Akten, die er mitgebracht hatte, ein. Feierliche Pause. Endlich ist der Küchenzettel in Ordnung, die Exzellenz tritt wieder heraus und eilt mit amtseifrigem Gesicht zum Wagen; der Wagen rollt fort, die Pferde müssen galoppieren; Seine Majestät haben ein neues Gericht befohlen, das im Winter schwer aufzutreiben ist. Der Adjutant du jour winkt einem General, der General tritt ein. Noch ein General. Nun komme ich. Ich weiß das schon. Nicht etwa, weil ich empfohlen bin, noch weniger, weil ich ein Dichter bin, nur weil ich ein Fremder bin. Ich halte mich bereit und wundere mich über mein Herz, das oft so unruhig schlug, wenn ich Julius Campe um ein Darlehn ansprechen sollte, und das jetzt so gleichmäßig Takt hält, als ob ich einen König im Wachsfigurenkabinett, nicht einen wirklichen zu sehen ginge. Woher diese Ruhe? Der zweite General bleibt lange, wir haben noch so viel Zeit, uns diese Frage zu beantworten. Daher: Erstlich, weil man gewisse Dinge – ich meine das kleinliche Treiben an den Höfen – ganz in der Nähe sehen muß, um sie in ihrer totalen Hohlheit und Nichtigkeit zu durchschauen und nicht bloß durch den Gedanken, sondern auch durch das Gefühl darübergestellt zu werden; zweitens, weil ein einziger Blick auf die Versammlung mich belehrt hat, daß ein König, der mich mit so vielen zugleich zu sich ruft, mich in nichts vor den übrigen Hunderten, die sich zum Thron drängen, distinguiert, und weil ich demnach erkenne, daß es sich nicht mehr darum handelt, einen Fetzen des Glücksmantels, um den sich alle reißen, an mich zu bringen, sondern nur darum, meine Mannesehre und Dichterwürde zu bewahren. Der General tritt heraus, der Adjutant winkt mir, ich trete ein. Ein unscheinbares kleines Zimmer, der König steht in der Mitte desselben; er trägt Uniform und Degen und ist dick, sein Gesicht, en face gesehen, ist etwas verschwommen, en profil betrachtet, zeigt es imponierende Züge. Ich bleibe an der Tür stehen und verbeuge mich, er tritt auf mich zu und fragt »Ihr Name?« Ich nenne ihn und trete weiter vor. Er: »Sie haben mir Ihre Werke gesandt.« Ich: Ich war so frei, Eurer Majestät meine Dichtungen vorlegen zu lassen. Er: »Es ist mir sehr angenehm gewesen, dieselben kennen zu lernen.« Er schweigt und sieht mich erwartungsvoll an. Ich: Ich bin allerdings nicht ohne Pläne und Wünsche nach Kopenhagen gekommen. Er: »Und diese bestehen in –?« Ich: Nur unter einer Bedingung kann ich sie aussprechen, nur dann, wenn die dichterischen Arbeiten, die ich Eurer Majestät vorlegen ließ, auf Eure Majestät einen anderen, als den ganz gewöhnlichen Eindruck gemacht haben, denn wäre dies nicht der Fall, so würde ich den Hunderten und aber Hunderten, die sich zum Thron drängen, nur noch eine Null hinzufügen, und das möcht ich nicht; denn dazu bin ich, wenn nicht zu stolz, so doch zu klug. Ohne Zweifel haben Eure Majestät noch nicht Muße gefunden, meine Sachen anzusehen. Er: »Wenn ich sie noch nicht ganz gelesen habe, so kann ich es ja noch tun.« Diese Antwort nahm ich wahr, um zu prüfen, ob meine Schriften oder meine Persönlichkeit ein wirkliches Interesse bei ihm erregt hätten; er hat sich, wie Wienbarg mir sagte, von Gardthausen vorlesen lassen, ich erwiderte daher: Mein nächster Wunsch ist, Eurer Majestät meine Judith vorlesen zu dürfen. Er: »Ich kann sie ja auch allein lesen.« Ich – wußte genug und verbeugte mich. Er: »Worin bestehen denn Ihre Wünsche?« Ich: Eure Majestät haben für Kunst und Wissenschaft manches getan, die dänische Regierung hat sich dadurch überhaupt immer ausgezeichnet, und einige Ihrer Vorfahren haben sich namentlich in der deutschen Literatur ein höchst ruhmwürdiges Andenken gestiftet. – Dies waren allgemeine Reden, es sollten keine andere sein, ich wollte ausweichen. Er: »Ja, aber nennen Sie mir die Richtung Ihrer Pläne und Wünsche!« Ich: Als ich aus Deutschland abreiste, hörte ich, daß in Kiel der Lehrstuhl der Ästhetik und deutschen Literatur wieder besetzt werden solle; dieser Professur fühle ich mich gewachsen. Er: »Das ist noch sehr ungewiß.« Ich: So hörte ich bereits, auch vernahm ich, daß Eure Majestät für den Fall der Wiederbesetzung schon bestimmte Absichten hätten; da will es sich denn geziemen, daß ich zurücktrete. Dagegen möchte ich bei Eurer Majestät die Erlaubnis nachsuchen, in Kiel als Privatdozent lesen zu dürfen. Er: »Bedarf es dazu meiner Erlaubnis?« Ich: In meinem Fall allerdings. Ich habe erstlich nur im Ausland studiert und in Anlaß ganz besonderer Verhältnisse die Landesuniversität allganz nicht besucht. Er: »Ist das denn gesetzlich vorgeschrieben?« Ich: Ja. Er: »Das wird aber nicht viel bedeuten.« Ich: Wenn Eure Majestät es sagen, so bedeutet es gar nichts mehr. Aber noch eins. Ich bin in Kiel nicht examiniert. Er: »So können Sie sich ja nur examinieren lassen.« Ich: Das ist, wenn man die Universität vier Jahre hinter sich hat, immer eine schwierige Sache und bei meinem exklusiven Studien- und Lebensgange so gut, wie unmöglich. Er: »Wenn die Gesetze es aber verlangen –« Ich: Eure Majestät wissen ohne Zweifel, wie es in den Examen hergeht. Man mag mich mit Schimpf und Schanden vom akademischen Lehrstuhl wieder verjagen, wenn ich nicht in einer Frist von ein bis zwei Jahren durch ein wissenschaftliches Werk vor dem öffentlichen foro meine Kompetenz, die Ästhetik vorzutragen, und meine Befähigung, sie zu erweitern, darlege. Ich habe der Wissenschaft einige neue Begriffe zu vindizieren, und es sei mir erlaubt, dies zu sagen; ich bin aber nicht imstande, ein mikrologisches Examen zu bestehen und werde mich dem nicht aussetzen. Er: »Warum sollte die Universität Ihnen ein solches nicht erlassen? Ich begreife, daß Ihnen ein Studentenexamen zuwider sein muß. Disputieren Sie! Ein Disputanz – –« Ich (ihn unterbrechend): Kostet viel Geld, und ich bin nicht der Mann, der viel Geld hat. Er: »Wenden Sie sich an die Herren von der Kanzlei. Reichen Sie ein Gesuch ein! (nun ohne Übergang) Ihre Judith kann aber nicht gespielt werden. Ich habe mit dem Theaterdirektor darüber gesprochen. Es geht nicht an. (Dies war sein Ausdruck; verhört habe ich nicht, wie der König aber dazu gekommen sein sollte, mit dem Theaterdirektor über die Ausführbarkeit meines Stücks zu sprechen, ist und bleibt mir unbegreiflich.) Ich: Ich bitte Eure Majestät um Vergebung, aber dieser Ausspruch ist längst durch die Tat widerlegt worden; die Judith ist in Berlin und in Hamburg gespielt. Er: »Es stehen aber doch greuliche Sachen darin.« Ich: Eure Majestät meinen, es stehen starke, ungewöhnliche Dinge darin, solche, die man im konventionellen Sinn indezente nennt. Er: »Ja, ja!« Ich: Die sind bei der Aufführung weggeblieben. Er: »Sehen Sie? Die sind weggeblieben, das konnte ich als Leser aber nicht wissen.« Ich: Freilich nicht. Er: »Es ist überhaupt wohl Zweierlei, ein Stück zum Lesen und ein Stück zum Spielen zu schreiben!« Ich: Eigentlich nicht, aber so wie die Zeiten sind, allerdings. – Eine Pause entstand, und um der bekannten Handbewegung zuvorzukommen, verbeugte ich mich und ging. – Hier ist die ganze Unterredung; der Evangelist Lucas, wenn er anwesend gewesen wäre, hätte sie nicht treuer wiedergeben können, denn nie in meinem Leben war ich so völlig Herr meiner selbst, so ganz Reflexion, möcht ich sagen, wie in jenem Moment. Ich sagte Dir dies übrigens schon in Hamburg voraus, denn ich hatte den Instinkt davon, vielleicht hätte ich nicht so viel Ruhe gehabt, wenn ich das Spiel nicht aus den obengedachten Gründen von vornherein verloren gegeben hätte. Dem König fiel mein Benehmen auf, ich sah es, ob es aber angenehm oder unangenehm auf ihn wirkte, wüßte ich nicht zu sagen. Jedenfalls ist es besser, ein eckiges Etwas gewesen zu sein, als ein rundes Nichts. –
18. Dez. 1842.
Das einzige, worum ich mich mit Schicklichkeit bewerben kann, ist ein Reisestipendium; eine Pension kann der König wohl aus eigener Bewegung bewilligen, aber man kann doch als junger Mann nicht darum supplizieren. Auch Oehlenschläger fand, daß ich, ohne mir im geringsten etwas zu vergeben, um ein Reisestipendium bitten könne; er meinte, ich solle gleich ein Gesuch aufsetzen, er würde es dringend empfehlen, und er sei, wie mir auch sehr wohlbekannt ist, dem König nicht gleichgültig ...
1. Jan. 1843.
Hätte ich einen Freund gehabt, der, statt mich immerwährend aufzuhetzen und mich zu übereilten Schritten zu verleiten, meine Leidenschaften, wenn sie zu wild aufloderten, auszulöschen gesucht hätte, wie viel besser würde es um mich stehen! Ich kann sagen, daß ich Janens drei Jahre meines Lebens völlig geopfert habe; geopfert, indem ich seiner Grillen wegen Menschen, die mir mit Herzlichkeit und Anerkennung entgegentraten, zurückstieß; geopfert, indem ich im beständigen einseitigen Umgang mit ihm den Tod, Fäulnis und Verwesung, einsog. Ich tat es, weil ich ihn nicht fallen lassen konnte und wollte, solange er selbst nur noch den geringsten Trieb verriet, sich geistig frisch zu erhalten, oder, als diese Periode vorüber war, sich wieder aufzuraffen. Zuletzt jedoch wurde es völlig unerträglich; er spottete aller Gesetze des Lebens, meine Freundschaft war ihm wie ein Napf, in den hinein man sich erbricht, mein Umgang regte ihn nur noch zum Gähnen und zum Anekdotenerzählen an. Du weißt, was ich in diesem Verhältnis gelitten habe. Ich kann meinem Freund im Kampf beistehen, ich kann ihm ein Grab mit meinen Nägeln aufwühlen, wenns sein muß, ich kann mich mit ihm zugleich erschießen, aber ich kann nicht neben ihm verfaulen, und so weit soll er, wenn nicht mich, so doch die Freundschaft achten, daß er dies nicht verlangt. Ich habe hierin gewiß recht. Wer so störend in mein Leben eingreift, daß er mir das Weiterleben unmöglich macht, wer es mit Verdruß ansieht und es auf alle Weise zu hindern sucht, wenn ich neue Verhältnisse, die mich auffrischen und ermuntern können, anknüpfe, wer sich selbst aufgegeben hat und nun von mir fordert, daß auch ich mich aufgeben soll, den kann ich, da ich wohl weiß, daß es nicht absichtlich, sondern unbewußt geschieht, tief beklagen, aber ich kann mich ihm nicht fügen; der Gesunde kann vom Kranken, der junge Soldat kann von dem auf allen Gebieten zurückgeschlagenen Invaliden nicht Vorschrift und Gesetz annehmen. Es ist mir dies ein sehr schmerzlicher Punkt, und ich werde mit der höchsten Schonung verfahren ...
22. Jan. 1843.
Heute morgen schickte mir Oehlenschläger durch seinen Bedienten die Empfehlung. Sie ist dänisch abgefaßt und lautet übersetzt ungefähr folgendermaßen: »Allergnädigster König! – Der deutsche Dichter Doktor Hebbel, welcher sich diesen Winter hier aufhält und Eure Majestät um ein Reisestipendium ersucht, hat mich gebeten, dieses Gesuch mit einer alleruntertänigsten Empfehlung zu begleiten, welche ich ihm mit Freuden und von ganzem Herzen gebe. Herr Hebbel ist gewiß ein Dichter mit seltenen Talenten, mit echtem Genie. Dieses Zeugnis haben ihm auch bereits viele Kunstrichter gegeben, sowohl für seine Tragödien Judith und Genoveva, wie für seine lyrischen Gedichte. Sollte er in den angeführten Dramen noch allzu stark zu dem Gewaltsamen hingerissen sein, so zeigen doch diese Werke zugleich den gesunden kräftigen Keim zur reifen Schönheit und Meisterschaft in künftigen Arbeiten. Es würde daher jammerschade sein, wenn dies schöne Talent nicht gedeihen und bei seinem Fürsten Hilfe und Unterstützung finden sollte. Glücklicherweise ist Hebbel ein Untertan Christians des Achten, und wird daher Beistand und Pflege gewiß so wenig entbehren, wie seine dänischen Brüder im Apollo diesseits der Ostsee. Es war schon lange der Ruhm dänischer Könige, daß sie deutsche Dichter unterstützten, welche das große Germanien Not leiden ließ; Klopstock in dem reichen Hamburg, Claudius in Wandsbeck, dankten dänischen Königen ein sorgenfreies Leben; der große Schiller in Weimar dänischen Adligen die nötige Hilfe und Trost in seiner Krankheit. Aber Hebbel ist als Dithmarscher ein unter dem Szepter Eurer Majestät geborner Untertan und hofft daher mit dem freudigen Mut eines Sohnes, daß sein Landesvater, der königliche Freund der Poesie, zum Wohl seiner und zum Gedeihen seiner Kunst etwas tun wird. – Alleruntertänigst Adam Oehlenschläger.« Bist Du zufrieden? Sag es mir! Oehlenschläger meint, ich muß den König jedenfalls selbst sprechen. Morgen das Weitere.
Dieser Tag ist der glücklichste, den ich bis jetzt in Kopenhagen erlebt habe. Wärst Du doch bei mir, teuerstes Wesen! Wie lange dauert es nun, daß Du erfährst, was sich ereignet hat! Laß Dir erzählen! Ich ging heute morgen wieder zum König, machte aber zuvor dem Hofmarschall meine Aufwartung. Ich ward nicht vor ihn gelassen, das konnte ich denken, aber ich war nun doch bei ihm gewesen. Als er ins Vorgemach des Königs eintrat, machte ich ihm eine Verbeugung; er trat auf mich zu und entschuldigte sich, daß er mich nicht angenommen habe, er sei eben mit Ankleiden beschäftigt gewesen. Ich ersuchte ihn, mir noch einmal Audienz zu verschaffen; er stellte mich sogleich dem Adjutanten vor, und als er aus dem Kabinett des Königs kam, sagte er mir, er habe dem König gesagt, daß ich dort sei und der König werde mich sehen. Nun mußte ich freilich noch von 11 bis 2 Uhr warten und war der Allerletzte, der Zutritt erhielt, aber ich kam doch zum Ziel, während fünfzig bis sechzig andere Personen auf nächsten Montag bestellt wurden. Die Audienz war kurz, aber, wenn ein königliches Wort ein Wort ist, gewiß folgenreicher, wie die erste. Der König war sehr freundlich, als ich eintrat und rief mir zu: »Nun? wie stehts mit Ihrer Angelegenheit?« Ich: Die habe ich aufgegeben, dagegen wage ich, Eurer Majestät ein Gesuch um ein Reisestipendium zu überreichen. Er (immer freundlich): »Zu welchem Zweck wollen Sie denn reisen?« Ich: Eure Majestät werden aus einer Empfehlung, die mir Oehlenschläger gegeben hat, vielleicht das Nähere ersehen. Er (nachdem er die Empfehlung gelesen hatte): »Die ist höchst vorteilhaft. Nun, das wird sich tun lassen. Aber augenblicklich kann ich die Entscheidung nicht gut abgeben.« Ich: Das ist auch durchaus nicht nötig. Ich bleibe den Winter hier. Er: »Es wollen freilich viele reisen. Es handelt sich darum, auf wie lange Zeit Ihnen das Stipendium bewilligt werden kann.« Ich: wenn ich nur über einige Jahre hinaus bin, so werde ich ganz anders dastehen. Er: »Dann haben Sie Namen und Ruf!« Ich: Wenigstens so viel, um von meiner Arbeit leben zu können! Er (mich mit einer Handbewegung entlassend): »Nun, gern werde ich unterstützen!« – Dies ist nicht alles, aber es ist viel. Nun muß ich die nötigen Visiten machen. Ich werde auch die unangenehmste nicht scheuen. Als ich, in hohem Grade erfreut, zu Hause kam, brachte mir der Briefbote einen Brief von Campe. Der ist freundlicher, wie er mir je geschrieben. Den Roman nimmt er, zahlt 40 Louisdors und ist erbötig, das ganze Honorar vorauszugeben; ich müsse ohne Sorge sein, um arbeiten zu können. Das ist doch höchst ehrenhaft. Nun kann ich für Dich und mich mit Ruhe in die Zukunft des nächsten Jahres schauen. Gott sei Dank! Ich bin vor Freude und Wehmut dem Weinen nah gewesen, denn ich habe die letzten Monate mehr Angst gelitten, als ich Dich merken ließ. Nun will ich ruhig aufatmen und schaffen. Über den neuen Plan mit der Reisebeschreibung äußerst Campe sich so: »Drei Werke verlegte ich von Ihnen, das vierte und fünfte ist im Anzug. Sie schließen sich fest an mich – soll ich es etwa nicht erwidern? Noch ist an Ihnen kein Gewinn zu machen, aber die Zukunft bietet Aussichten, nicht allein für mich, auch für Sie. Sie kennen meine Ansichten, – in solchen Voraussetzungen ist ja keine Frage nötig – es versteht sich von selbst, daß ich dasjenige drucke, was Sie mit Ihrem Namen der Literatur zu übergeben sich gedrungen fühlen!« Was will ich mehr? Kann ich mehr Bereitwilligkeit und Liberalität verlangen ...
... Meine Seele ist voll Frieden und Dank gegen den Allgütigen. Küsse mir den Max mit seinen süßen Augen und den kleinen rührenden Armen, womit er um sich strebt. Je besser es mir geht, mit um so größerer Liebe und Innigkeit denke ich an ihn; aber wenn ich mich dem Ertrinken nahefühle, ist es mir ein furchtbarer Gedanke, auch noch ein anderes Wesen mit in den Abgrund zu reißen.
Januar 1843.
Eurer Königlichen Majestät wage ich mich in tiefster Untertänigkeit mit der Bitte um ein Reisestipendium zu nahen. Der Wunsch, mich als Dichter weiterentwickeln und zugleich zu meiner Zukunft einen Grundstein legen zu können, drängt mich zu diesem Schritt; das Vertrauen, welches Eure Königliche Majestät mir eingeflößt haben, gibt mir Mut zu demselben. Ich bin zwar kein Däne, sondern ein Dithmarscher, aber ich weiß, daß Eure Königliche Majestät zwischen den Untertanen des Königreichs und der übrigen Landesteile in keiner Beziehung einen Unterschied machen, und ich glaube mich deshalb zuversichtlich der Hoffnung ergeben zu dürfen, daß mir, da ich so gut ein Landeskind bin, wie die übrigen jungen Talente, denen vom Thron herab aufmunternde Förderung zuteil wurde, und da ich, was die Begabung betrifft, denselben nach der mir bereits gewordenen öffentlichen Anerkennung in nichts nachstehe, ein Königlicher Huldbeweis nicht versagt werden wird. Ein mäßiges Reisestipendium, für drei Jahre bewilligt, würde meiner Gegenwart, und dadurch zugleich meiner ganzen Zukunft, eine freundlichere Gestaltung geben; ich würde mich, wenn ich es erhielte, in meiner geistigen Entwicklung nicht durch tödliche Sorgen gehemmt oder durch die Not zu Unterhaltungsschreibereien gezwungen sehen; ich würde Muße finden, meine Ideen auszuführen, und die Dissonanzen, die in meinen ersten Arbeiten noch vorkommen mögen, zu lösen; ich würde nicht weniger Zeit und Gelegenheit erhalten, mich in Deutschland nach einem, meinen Kräften und der Richtung meines Geistes angemessenen Wirkungskreis umzutun. Ich kam nach Kopenhagen, weil mir in Hamburg bekannt geworden war, daß in Kiel der Lehrstuhl der Ästhetik und deutschen Literatur wieder besetzt werden solle, und weil ich mich um diese Professur, der ich mich gewachsen fühlte, zu bewerben gedachte; ich vernahm aber bald, und hatte die Ehre, es allerhöchst-unmittelbar durch Eure Königliche Majestät bestätigen zu hören, daß die Wiederbesetzung noch äußerst zweifelhaft sei. Anfänglich faßte ich nun den Entschluß, mich um die licentia legendi bei der Universität Kiel zu bewerben, aber die über die dortigen Verhältnisse von mir eingezogenen Erkundigungen haben mich überzeugt, daß sich in Kiel als Privatdozent nur ein solcher Gelehrter halten kann, der bereits Subsistenzmittel besitzt und sie nicht erst durch seine Vorlesungen verschaffen soll, indem die Frequenz der Universität nicht so stark ist, daß ein ästhetisches Kollegium auf eine hinreichende Anzahl von Zuhörern rechnen dürfte; ich habe diesen Entschluß daher aufgeben müssen. Meine Jugend ist eine hartgeprüfte gewesen; erst spät bin ich zum Studieren gekommen; volle sechsundeinhalb Jahre habe ich bei einem dithmarsischen Kirchspielvogt als Schreiber zugebracht, und, da der Tag den Geschäften gehörte, nur nachts für meine wissenschaftliche Ausbildung tätig sein können. Eure Königliche Majestät geruhen vielleicht in das beigefügte Zeugnis meines damaligen Prinzipals einen Blick zu werfen, nicht, um daraus zu entnehmen, daß ich in jener Zeit meine Pflicht getan habe, was sich ja von selbst versteht, sondern nur um die Überzeugung zu gewinnen, daß ich, dem das Leben von früh auf so schwer gemacht wurde, jetzt, wo ich ins Mannesalter eingetreten bin und eines Anhaltspunkts bedarf, einige Förderung verdiene. Über meine dichterischen Leistungen erlaube ich mir, indem ich mich hinsichtlich Deutschlands auf die in den geachtetsten Journalen, sowie in mehreren Literaturgeschichten abgegebenen öffentlichen Stimmen berufe, das Urteil eines Mannes, den Eure Königliche Majestät schätzen und in dem Dänemark den Repräsentanten seiner modernen Literatur anerkennt, nämlich Oehlenschlägers, beizuschließen. Dänemark hat – ich erinnere nur an Klopstock und Schiller – den deutschen Genius mehr als einmal einer bedrückten Lage entrissen, und ihn in den Stand gesetzt, Werke hervorzubringen, die nur in einer sorgenfreien Atmosphäre gedeihen; auch ich hoffe, daß Eure Königliche Majestät mich keine Fehlbitte tun lassen, sondern mich durch allergnädigste Bewilligung eines Reisestipendiums in den Stand setzen werden, meine dichterische Ausbildung zu vollenden.
1. Febr. 1843.
... Die Kopenhagnerinnen nehmen sich sehr gut aus, und besonders hat das dänische Nationalgesicht, das heißt das weibliche, für mich etwas Wunderbares, das nicht zu meiner Seele, aber gewaltig zu meiner Phantasie spricht. Ich darf Dich hiervon unterhalten, denn Du weißt, daß der Dichter redet, nicht der Mensch. Die scharf gezackten stolzen Züge erinnern mich an Korallen, wie sie tief unten im Meeresgrunde wachsen; der blasse klare Teint scheint, wie ein Grenzdamm, die rote Lebensblume nach innen gedrängt zu haben, um sie frisch und unvergänglich zu erhalten, aber auf den roten Lippen knospet sie in ihrer Fülle doch hervor, wie wohl eine einzelne naive Kirsche die unter dem Blätterschmuck des Baums verborgenen still gereisten Schwestern an den lüsternen Knaben verrät; das Auge dagegen, nicht blau und nicht grau, hat einen seltsamen trockenen Glanz, es scheint darauf zu deuten, daß das Zauberwesen, dem es angehört, sich zuweilen in die Flut niedertauchen muß, wenn die Luft, die scharfe, schneidende, es nicht auszehren soll. Man sieht solche echt-dänische Gesichter, die mich in frühster Jugend schon aus einer alten Chronik angeschaut haben, hier übrigens sehr selten, die meisten Weiber sind hübsch auf deutsche Weise, wenn ich aber eins erblicke, so fühle ich mich wirklich in eine phantastische, nächtliche Welt entrückt und der versiegelte Brunnen der Poesie sucht den Bann zu sprengen ...
6. Febr. 1843.
Die du, über die Sterne weg,
mit der geleerten Schale
aufschwebst, um sie am ewgen Born
eilig wieder zu füllen:
Einmal schwenke sie noch, o Glück,
einmal, lächelnde Göttin!
Sieh, ein einziger Tropfen hängt
noch verloren am Rande,
und der einzige Tropfen genügt,
eine himmlische Seele,
die hier unten in Schmerz erstarrt,
wieder in Wonne zu lösen.
Ach! sie weint dir süßeren Dank,
als die anderen alle,
die du glücklich und reich gemacht?
laß ihn fallen, den Tropfen!
27. Febr. 1843.
... Dein Brief hat mich innig erquickt, er war so schön, so voll von stammelnder Poesie (möchte ich sagen), daß ich einer tiefen Dichterseele ins Auge zu schauen glaubte, die nur darum nicht singt, weil sie ihr Innerstes durch Blicke auszudrücken vermag. Du hast eine ganze Handvoll Perlen gesammelt und sie in meine Brust hinabgeworfen. Was sind alle Schnörkeleien gegen Deine einfach-schönen Darstellungen und Schilderungen. Ganz allerliebst fand ich Dein kleines Männchen; käme es doch, wie freundlich wollte ich es willkommen heißen! Vor allem aber sind Deine Träume (ich meine die früheren) im höchsten Sinne dichterisch, so daß ich den einen ja auch nur ganz einfach in die Judith hineinzusetzen brauchte; es ist kein wüstes, phantastisches Durcheinander, sondern jeder ist in sich abgeschlossen und bringt seinen goldenen Rahmen gleich mit. Von keinem Menschen in der Welt würde ich als Dichter das Geringste entlehnen oder borgen; denn je älter ich werde, je mehr lerne ich den hohen Wert der ursprünglichen Erfindung schätzen, je klarer sehe ich ein, daß darin, und nur darin, die eigentliche vis liegt; Du jedoch bist ausgenommen, Deine Edelsteine und Kleinodien werde ich immer gern, ja mit Stolz, in das Gold meiner Form fassen, und warum? weil Du durchaus mit zu meinem Wesen gehörst, weil zwischen uns gar keine Grenzen bestehen. Ob ich Dich glücklich machen, ob ich Dir für so vieles, was Deine Liebe und Dein über die gewöhnliche negative Weibertugend so hoch erhabener Edelmut mir opferte, Ersatz bieten kann, weiß ich nicht; aber dies weiß ich, daß mir im Pantheon der Geister ein Denkmal gewiß ist, und daraus soll wenig von mir, aber viel von dem Wesen zu lesen sein, das ich nicht bloß am innigsten geliebt, sondern auch am meisten verehrt habe. Ich sollte dies in einem Brief an Dich nicht aussprechen, ich will es aber, und Du mußt es mir verzeihen!
... Das tiefste Bedürfnis meiner Natur ist, zu verehren und zu bewundern; die Stunden, die ich bei dem herrlichen Alten Thorwaldsen. zubringe, sind voll andächtiger Wollust, man genießt und wird zugleich aufgelöst, aber nur, um was Besseres zu werden. Denn der letzte Eindruck der Kunst ist immer ein tief-sittlicher, ein maßgebietender und klärender; nur dann ist er es nicht, wenn sie es darauf anlegt, denn dann (ich meine, wenn sie die Elemente nicht in ihrer Gärung hinzustellen wagt und uns, statt der tobenden See, die sie mit ihrem Öl besänftigen soll, nur prahlerisch ihr Öl selbst vorzeigt) erstickt sie das Leben im Keim und verfährt, wie etwa eine unkluge Polizei verfahren würde, die die Embryonen würgte, um den Räubern und Mördern, die darunter sein könnten, den Eingang in die bürgerliche Gesellschaft zu verschließen, oder, noch besser, wie ein feiger Duellant, der dem Gegner vor Beginn des Kampfs ein Opiat beibringt und ihm nun im schlaftrunkenen, ohnmächtigen Zustand auf den Leib rückt ...
... Ehe ich es vergesse: Ihr werdet mein Mäxchen doch nicht schon in Wamms und Hosen stecken? Das wünsche ich nicht. Ich muß ihn wiedersehen, wie ich ihn verlassen habe. Die Hosen löschen das Poetische aus. Laß ihn ja sein Röckchen behalten. Mir gegenüber sitzt oft ein blondes Kind am Fenster. Jedesmal, wenn ich es erblicke, rufe ich den Segen Gottes auf das unsrige herab.
23. März 1843.
... Die Schachtel und ihr Inhalt haben mir so viele Freude gemacht, als unter den Umständen, worin ich sie erhielt, nur irgend möglich war. Wäre sie an meinem Geburtstag eingelaufen, so würde ich wie ein Kind gejubelt haben. Aber sie blieb aus, Dein Brief blieb aus und die fürchterlichsten Gedanken stellten sich bei mir ein. Ich dachte, und mit Recht: wenn sie dir zu deinem Geburtstag nicht einmal ein paar Zeilen schickt, muß was vorgefallen sein! Nie in meinem Leben habe ich eine Angst erlitten, wie die vier Tage Freitag, Sonnabend, Sonntag und Montag ...
26. März 1843.
... Krank zu sein in der Fremde ist eine harte Prüfung. Welche Tage und Nächte! Mein Arzt ist wieder hier gewesen, er hat mir Tropfen verordnet, aber ich kann sie nicht nehmen, denn sie greifen mir den Magen fürchterlich an und ich bekomme Fieber danach. Ich bin auf seinen Rat zweimal in die freie Luft geführt worden, gestern und vorgestern; Herr Möller Peter Ludwig Möller, ein dänischer Dichter, der sich Hebbel verehrend genähert hatte. führte oder vielmehr schleppte mich. Es hat mir nicht geschadet, aber auch nicht genützt. Keine Nacht Schlaf! Schmerz in den geschwollenen Füßen! Immer Schwitzen! Keine Wäsche! Heute zum Beispiel gehe ich ohne Hemd und es ist nicht das erstemal ...
4. April 1843.
Wenig, aber herzlich! Das war die Devise der Tasse, aus der ich den ersten Kaffee bei Dir trank.
Wenig, aber mehr, wie je! Das sei die Devise dieses Briefs. Gott hat mir in seiner Gnade heute ein Pfand für die Zukunft gegeben, das dreißigste Jahr, der neue Lebensabschnitt, beginnt unter den herrlichsten Auspizien. Der Rheumatismus war wirklich, wie ich Dir schrieb, der Wermut, nun haben wir auch den Honig.
Heute nachmittag um 5 Uhr brachte mir der alte herrliche Oehlenschläger einen Brief von Collin an ihn, des Inhalts:
»Seine Majestät, der König, haben Hebbel allergnädigst ein Reisestipendium von 600 Reichstalern jährlich auf zwei Jahre bewilligt!«
Oehlenschläger las mir das Billet mit Tränen in den Augen vor, seine Freude ist so groß, wie die meinige.
Ich habe Gott aus tiefster Seele gedankt und zugleich beschämt die Hände vors Gesicht gehalten.
Der einzige Schmerz, der sich in diese Freude mischt, ist, daß ich Dir die Nachricht nicht über die Nordsee zurufen kann. Was möglich ist, soll wenigstens geschehen, dieser Brief geht gleich morgen zur Post ...
... Tu auf Dein Herz und laß den lieben Gott einziehen, beleidige ihn nicht durch übertriebene Sorge um mich, sei fest überzeugt, daß es mir – obgleich langsam, langsam, wie die Östreicher marschieren – von Tage zu Tage besser gehen wird, freue Dich, aber mäßige Dich den ersten Augenblick und verlange kein Mitgefühl von Menschen, die, wenn sie von Geld hören, gleich zu rechnen anfangen. Ich bin so heiter, so still-vergnügt, wie ein Kind, sei Du es auch! Auf Deinen Brief freue ich mich sehr!
Tagebuch 4. April 1843.
Heute ist ein großer, wichtiger Wendepunkt meines Lebens, denn ich weiß jetzt mit Bestimmtheit, wenn auch noch nicht offiziell, daß der König mir auf zwei Jahre ein Reisestipendium von 600 Reichstalern jährlich ausgesetzt hat, und – sollte mans begreifen? – ich wäre fast zu Bett gegangen, ohne diesen großen, entscheidenden Tag auch nur mit einer Silbe in meinem Tagebuch anzuzeichnen. Nun, ewiger Vater über den Wolken, der du den ohnmächtigen Hader des blöden Kranken nicht angesehen, sondern mir in Gnaden die Brücke zur Zukunft gebaut und mir ein schönes Pfand des Gelingens gegeben hast, ich fühle die Größe deiner Gnade und die Schwere der Pflichten, die sie mir auflegt, und ich werde redlich ringen und streben. Der alte herrliche Oehlenschläger brachte mir mit Tränen in den Augen die Nachricht – ihm bin ich unter den Menschen den meisten Dank schuldig! Könnt ich es doch dir, teuerste Elise, aus meiner Krankenstube über den Ozean zurufen! Möchte ein Traum dir es ins Ohr flüstern und deiner Seele zugleich ein Zeichen der Beglaubigung geben, daß du ihn auch noch am Tage festhieltest! Ich bin doch so matt, daß das Schreiben mich angreift!
13. April 1843.
Meine teuerste Elise! Meinen innigsten Dank für die schöne Leibwäsche, die Du mir gesendet hast. Ich beklage das ohne Zweifel bedeutende Porto, aber die Hemden und die warme wollene Hose kommen mir trefflich zustatten ...
... Zwei sorgenfreie Jahre habe ich vor mir, es gilt, diese auf die rechte Weise zu nützen. Dem Genuß werde ich mich nicht überlassen dürfen, im Winkel auf dem Lotterbett wird die schöne Zeit bald verträumt und das Erwachen ist Verzweiflung. Ich muß frisch in die Welt hinaus und mir tausend Dinge erwerben, die mir fehlen. Oehlenschläger meint, wenn ich nur wirklich reiste, so würde ich sehr leicht auch noch ein drittes Jahr die 600 Reichstaler erhalten; das sei ihm, das sei auch anderen gelungen. Später erlangte ich dann bei erhöhter Ausbildung und Erweiterung meiner Kenntnisse gewiß auch in Kiel oder Kopenhagen eine Professur, denn die dänische Regierung läßt keinen wieder fallen, mit dem sie sich befaßt hat, so wie ein Gärtner den Baum, den er einmal begossen hat, auch zum zweitenmal begießt. Freilich kommt es darauf an, den König und die einflußreichen Herren in guter Stimmung zu erhalten.
Ich habe nun viele Pläne, denke an Paris und Italien. Das besprechen wir mündlich. Daß ich an einen langen Aufenthalt in Hamburg nicht denken darf, wirst Du selbst finden. Ich befrage nicht mein Herz und meine Neigung, sondern meinen Verstand ...
... Ich könnte nun so fröhlich, so glücklich sein, aber dieser Teufel von Rheumatismus läßt mich nicht von der Kette los. Alles, was ich über meine Abreise von hier geschrieben habe, ist daher unbestimmt und drückt bloß meine Wünsche aus. Denn was soll ich armer invalider Mensch machen; das Herz zieht mich fort, aber die elenden Glieder halten mich zurück. Wirklich, es hält schwer, geduldig zu bleiben. Es sind nun bald neun Wochen, vom Ausgehen sollte es besser werden, aber weit entfernt, die greulichsten Schmerzen kehren zurück, sobald ich die Füße gebraucht habe ...
Tagebuch Mai 1843.
Den 27. April, abends 6 Uhr, reiste ich mit dem Dampfschiff Christian VIII. von Kopenhagen ab. Die Sonne vergoldete die Stadt, die mir ewig teuer sein wird. Wir hatten die herrlichste Reise von der Welt. Das Schiff schwamm dahin, wie auf einem Spiegel, auch keine Spur von Seekrankheit. Am nächsten Morgen um halb 11 Uhr schon in Kiel, wo mich die wärmste Luft begrüßte, die ich wie Medizin einatmete; blühende Bäume. Abends nach 9 Uhr in Hamburg; Elise auf der Post.
Den Sommer verbrachte Hebbel noch in Hamburg, von Vorkehrungen für die Reise und Elisens heißem Wunsch, die Gegenwart des Geliebten nicht so bald zu verlieren, und ihn womöglich zum Bleiben zu veranlassen, zurückgehalten. Im September erst reiste er nach Paris ab.
Tagebuch Hamburg 29. Aug. 1843.
Gestern sah ich Emma Schröder wieder. Nicht ohne Wehmut, denn dieses Mädchen, das ausgezeichnetste, das ich kennen lernte, neigte sich mir vor Jahren in Liebe entgegen, und wenn sich nicht nichtswürdige Dinge zwischen sie und mich gestellt hätten, so würde ich das höchste Glück der Erde auch einmal gekostet haben, und das hätte mein Leben vielleicht in der innersten Wurzel wieder aufgefrischt. Das sollte nicht sein; der Neid eines alten Weibes wußte uns auseinanderzubringen, ja, er wußte noch mehr zu tun, er wußte ihr Bild in meiner Seele zu verdunkeln, indem er ihr Reden über mich und Elise in den Mund legte, die sich mit einem edlen jungfräulichen Gemüt nicht vertrugen. Sie hat sich gestern gegen Elise ausgesprochen, alles ist Lüge und Verleumdung, und mir tut es unendlich wohl, daß ich nun doch wenigstens ihr Bild gerettet habe. Eine Erscheinung von wunderbarem Liebreiz, dämmernd wie der Sternenhimmel in einer duftigen Nacht!
August 1843.
Bildung ist ein durchaus relativer Begriff. Gebildet ist jeder, der das hat, was er für seinen Lebenskreis braucht. Was darüber, das ist vom Übel.
Sept. 1843.
Nicht darf der Staub noch klagen,
der glühend und bewußt
die ganze Welt getragen
in eigner enger Brust;
worin ich mich versenke,
das wird mit mir zu eins,
ich bin, wenn ich ihn denke,
wie Gott, der Quell des Seins.