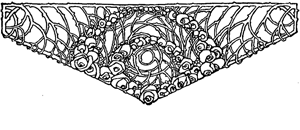|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
14. September 1843 bis 26. September 1844
Über Havre und Rouen reiste er nach Paris und zog zunächst auf den törichten Rat eines Bekannten in den Vorort St. Germain en Laye, wo er mehrere Wochen, von der so dürstend ersehnten Großstadt abgeschnitten, in müßiger Einsamkeit und Langeweile verlebte. Kaum war er im Oktober nach Paris übergesiedelt, als ihm Elise schrieb, sein Sohn Max sei an einer Gehirnentzündung gestorben. Hebbel steigerte seinen furchtbaren Schmerz durch grausame Selbstanklagen, indessen Elise, für alle Trostversuche des Freundes unzugänglich, sich in stets erneuerten Qualen verzehrte, denn sie fühlte sich um den Inhalt ihres Lebens, um das einzige Gut, das ihr durch den Mann, der ihre Liebe nicht erwidern konnte, wahrhaft zuteil geworden war, betrogen. »Ich bin nicht besser,« so lautet eine Aufzeichnung von ihrer Hand, »als so viele zärtliche Mütter, die ihr liebes Kind geben müssen, aber sie stehen nicht so allein wie ich – an mein Kind wollt ich mich ketten mit grenzenloser Liebe, er sollte es fühlen, würde es fühlen und dafür mich lieben und darum auch gut werden und bleiben, er sollte ein festes Band werden, so dacht ich – andere Mütter haben Kinder, bekommen eines wieder und mit ihm ist Freude da – ich mit meinem eine neue Schande, neue Qualen und Wirren.« Sie erwartete nämlich wieder ein Kind, Hebbel hieß es willkommen und suchte die Angst der schwer Geprüften zu verscheuchen. Der zweite Sohn wurde im Mai 1844 geboren und erhielt den Namen Ernst.
Die in den ersten Schmerzen um den Tod seines Max an Elise gerichtete Aufforderung, sie solle sofort nach Paris kommen, nahm Hebbel nach einiger Überlegung zurück, denn sein Geld hätte nicht im entferntesten ausgereicht, sie beide zu ernähren, mußte er doch selber eine so ärmliche Wirtschaft führen wie nur je zuvor. Noch unter dem Eindruck der Todeskunde vollendete er sein in Kopenhagen begonnenes und in Hamburg fortgesetztes bürgerliches Trauerspiel » Maria Magdalena«.
In Paris lernte er Heinrich Heine kennen. Wenn sich die beiden Männer gemäß ihrer allzugroßen Verschiedenheit auch nicht näher traten, so war ihre Begegnung doch ein gegenseitiges Grüßen zweier bedeutender Geister, die sich erkannten. Ferner verkehrte Hebbel mit Arnold Ruge, dem Herausgeber der »Hallischen Jahrbücher«, und mit Dr. Felix Bamberg, der ihm ein treuer Freund wurde und der später seine Tagebücher und seinen Briefwechsel herausgegeben hat. Von Paris aus bemühte er sich endlich auch bei der Universität in Erlangen erfolgreich um seine Promotion, konnte aber wegen seines augenblicklichen Geldmangels das Doktordiplom erst zwei Jahre später einlösen.
Trotz aller inneren und äußeren Nöte und Wirrnisse war sein französischer Aufenthalt in mancher Beziehung eine glücklichere Zeit. Das große Treiben der Weltstadt mit rauschendem Verkehr und bunten Volksfesten, der rasche Wechsel von Eindrücken in Straßen und Museen, ein historischer Boden – dessen bedurfte sein rasch und gewaltig arbeitender Geist und seine mächtige und nie zu sättigende Phantasie zu ihrer vollen Elastizität.
»Götter, ich fordere nicht viel! Ich will die Muschel bewohnen, aber ich kann es nur dann, wenn sie der Ozean rollt.«
6. Okt. 1843.
... Nun standen wir auf einmal vor der Notre Dame de Paris. Ein wahrhaft mittelalterliches Gebäude, schwarz, finster, schnörkelhaft, das ungefähr wie eine Krähe aussieht, die sich verspätet hat und die mit blinden Augen in den rings umher aufgeblühten Mai hineinstiert. Nicht weit davon ist der in der Geschichte der Revolution so berühmte Justizpalast, den Robespierre zu Gefängnissen einrichten ließ. Jetzt werden die Assisen darin gehalten. Diesen benachbart das Gefängnis, worin Marie Antoinette weinte, bis sie ihre schönen Augen zugleich mit dem Kopf einbüßte. Hierauf kamen wir zur Kirche der heiligen Genoveva. Wir gingen hinein und sahen das Grab der Heiligen, das durfte ich unmöglich versäumen. Nun waren wir am Ziel, wir standen vor dem Pantheon. Welch ein Gebäude! Einen solchen Eindruck hat noch kein Werk der Architektur auf mich gemacht. Es verdient allein eine Reise nach Paris; wenn einer hierher käme, sich unmittelbar nach dem Pantheon fahren ließe, und nachdem er ein Bild von diesem in den Schrein seiner Seele aufgenommen hätte, wieder abreiste, er würde belohnt sein! Von außen treten dem Auge die einfachsten, edelsten Verhältnisse entgegen; Säulen wie Eichen, Wände wie geglättete Felsen. Im Innern ein ungeheures, heiter-stilles Oval; die Kämpfe sind abgetan, die Kraft ist erprobt, hier darf die Größe in ungestörtem Frieden sich selbst genießen. In der Mitte, wo eine Säulengruppe in dem großen Oval ein kleineres abschneidet, sind Tafeln angebracht, auf denen die Namen der in der Julirevolution Gefallenen verzeichnet stehen; oben erblickt man vier Fresken: die Göttinnen des Todes, des Vaterlandes, der Freiheit und des Ruhms, letztere, wie sie Napoleon umarmt. Ganz oben die Apotheose Ludwigs des Sechzehnten, die man glücklicherweise nicht deutlich genug sieht, die also auch nicht stört, was sie sonst bei dem nichtigen Gegenstand leicht könnte. Im Hintergrund steht eine kolossale Statue der Göttin des Ruhms, die die Spitze der Kuppel zieren soll. Nun wurden wir in die Gewölbe hinabgeführt, die, nicht ganz finster und nicht ganz hell, jene Dämmerung, worin man sich die Schatten der Abgeschiedenen immer unwillkürlich denkt, ergreifend vergegenwärtigen. Rechts beim Eintritt ruht Jean Jacques Rousseau, links Voltaire. Dann kommt das Monument des Baumeisters, dem der Platz wohl zu gönnen ist. Hierauf eine Masse untergeordneter militärischer oder Senatoren-Berühmtheiten; Kork auf den Wellen der Zeit. Nun unterbrach der Kastellan die ernste Stimmung, in der ich mich befand, durch – ein Echo, das wir bewundern sollten, dann sollten wir den Rückweg antreten. Ich fragte nach Mirabeau. »Der ist nicht mehr zu sehen!« Mirabeau nicht mehr zu sehen? Ich erstaunte. Der Kastellan führte uns jetzt an den Ort, wo seine Asche ruht. Der Name war überpinselt, man konnte ihn nicht mehr lesen! Denke Dir! Ich würde den Zeitungen dies Faktum nicht geglaubt haben, aber ich habe es gesehen. Das ist Louis Philipp! Nun bestiegen wir die Kuppel, bis in die höchste Spitze. Eine göttliche Aussicht! Hierauf gingen wir in den Jardin des pantes. Dort sah ich eine Zeder vom Libanon, zwei Giraffen, zwei Elefanten, Kamele, Renntiere, Bären, Löwen, Adler, genug alles, was aus dem Tierreich interessieren kann. Besonders imponierte mir der große Elefant; das ist kein Tier, sondern ein Chaos von vielen Tieren. Jetzt machten wir uns auf den Rückweg. Unterwegs sah ich noch das Stadthaus, wo Robespierre sich zu erschießen suchte, den Greveplatz, wo die Guillotine gewirtschaftet, den speziellen Ort an der Seine, wo sie gestanden hat. Das war doch wohl genug für einen Tag? Dies war aber auch der erste Tag, den ich wirklich in Paris verlebte. Es ist eine fabelhafte Mannigfaltigkeit ...
23. Okt. 1843.
Meine allerteuerste Elise! Gestern mittag, als ich um 1 Uhr sorglos von einem Spaziergang zu Hause kam, fand ich Deinen Brief vor. Ich freute mich, als er so dick war. Wie ward mir zu Mute, als ich ihn öffnete und nur einen Blick hineintat! Es war mir nicht möglich, ich konnte ihn nicht lesen. Ich setzte mich augenblicklich nieder und schrieb Dir im ungeheuersten Schmerz einige Zeilen. Ich wußte nicht, was ich schrieb, ich sah es nicht, vor meinen strömenden Tränen konnte ich meine eigenen Buchstaben nicht sehen. Ich schrieb Dir nichts weiter, als die drei Worte: ich komme, Gott tröste Dich! Ich siegelte das Blatt ein und eilte damit auf die Post. Aber sie war schon geschlossen, ich mußte meinen Brief wieder zurücktragen. Es ist gut, daß Du dies Blatt nicht erhältst.
Ich sage Dir nichts davon, welch einen Tag ich verlebt habe. Ich irrte durch die Straßen der Stadt, ich sah die Steine an und freute mich, daß sie stumm sind. Erst spät, um 5 Uhr, hatte ich die Kraft, Deinen Brief zu lesen. Wohl kannst Du denken, daß es nicht in einer Folge geschah. Was ein Vater bei dem Tode seines Sohnes empfinden kann, das habe ich empfunden, das empfinde ich. Ich habe in die Luft gegriffen nach Deiner Hand, aber ich habe nicht das Bewußtsein in mir gehabt, sie zu erfassen, ich fühlte mich allein, schrecklich allein. O mein Max, mein holdes, lächelndes Kind! So bist Du dahin? Eins hast Du nun vor mir voraus: Dir kann kein Sohn sterben! Laß mir nur Deine Mutter! Umschwebe sie, flüstre ihr zu, daß ich sie jetzt nötiger brauche, als Du!
Nein, ich hatte keine Ahnung, nicht die geringste. Nur Sonnabendabend zwischen 8 und 9 Uhr überkam mich auf einmal eine tiefe Angst, meine Knie fingen an, zu schlottern, es überlief mich kalt. War das die Wirkung Deines Briefes, der sich Paris näherte? Oder war es – ich denke mir das Entsetzlichste, ich mag es nicht schreiben! Wenn Gott einen Funken Erbarmen für mich hat, so muß ich mich täuschen.
Ja, Elise, ich zittre jetzt für Dich. Die übermenschliche Kraft, die Du in und nach der Krankheit aufgeboten hast, die mich selbst in Deinem Brief noch mit Schaudern erfüllt, läßt mich im Geist vor einem Verlust zittern, gegen den selbst dieser verschwindet. Wenn ich noch eine Antwort auf diesen meinen Brief von Dir erhalte, und wenn Du mir schreiben kannst, daß Du gesund bist, so will ich meine Hände falten und sprechen: Gott hat mir meinen höchsten Wunsch gewährt, er ist mir nichts mehr schuldig.
O, erhalte Dich mir! Auf meinen Knien flehe ich Dich an: bekämpfe Deinen Schmerz! Wenn Du es nicht tust, so bereitest Du mir ein Weh, welches das Deinige noch übertrifft. Dies bedenke! Du bist das einzige Band, das mich an das Leben noch fesselt, nicht das Leben hat Wert für mich, nur das Band. Du weißt, wie ich in Kopenhagen litt, als Dein Brief nur drei Tage ausblieb. Danach nimm das Maß für das, was ich jetzt leide. Aber fürchte nicht für meine Gesundheit; die wird dadurch nicht angegriffen, ich werde nur innerlich immer mehr getrübt!
Liebste, Teuerste, Einzige, wie kannst Du Fußbäder nehmen! Es ist ja das höchste Glück, und Du willst es als Unglück begrüßen? Ich würde aufjauchzen, wenn ich – schreckliches Wenn ich! – noch einen Brief von Dir erhalte, und Du mir Deine Ahnung darin bestätigst.
... Ich zweifle nicht, daß er an der Gehirnentzündung gestorben ist, suche den Grund aber nicht in äußeren Dingen, sondern in seiner zu rasch vorschreitenden geistigen Entwicklung. Ach, der Grund gilt nun gleich. Sezieren haben sie ihn wollen und haben geglaubt, ich würde es gestatten? Die Hunde! Mit einer Ohrfeige hätte ich auf eine solche Frage geantwortet. Dank, Dank Deiner Mutter, Deinem Vater, allen, allen! Was mit Geld zu erstatten ist, das erstatte ich. Wenn nur Du mir bleibst, ist mir um die Zukunft nicht bange!
Du hast Dich abgequält, mir sogar meinen Brief zu beantworten. Teuerste! Einzige! Das wenigstens hättest Du Dir ersparen sollen! Um Gottes willen keine Fußbäder mehr! Du bist meine Frau, sobald Du willst. Wer Deinen Brief liest, muß sagen: so schreibt nur das reinste, edelste Wesen! Demjenigen meiner Freunde, den ich am höchsten achte, werde ich einen Blick in das Heiligtum verstatten. Keinem sonst ...
Tagebuch 24. Okt. 1843.
Mein Max, mein holdes, lächelndes Engelkind mit seinen tiefen blauen Augen, seinen süßen blonden Locken, ist tot. Sonntag, den 22., mittags um 1 Uhr erhielt ich die Nachricht. Da liegt seine kleine Locke vor mir, die ich schon nach Kopenhagen mitnahm und die ich seither – es stehe hier! – noch nie betrachtete; sie ist das einzige, was mir von ihm übrig blieb. O, wenn ich mir das denke, daß dies Kind, das keiner – mich selbst, den Vater, den großen Dichter ausgenommen, es stehe auch hier! – ohne Freude und Entzücken betrachten konnte, so schön, so anmutig war es, daß dies Kind nun verwesen und sich von Würmern fressen lassen muß, so möcht ich selbst ein Wurm werden, um mitzuessen, um als scheusäliges Tier meinen Anteil dahinzunehmen, den ich als Mensch, als Vater verschmähte. Ich könnte diese Locke hinunterschlingen, ich könnte noch Ärgeres tun, ich könnte sie verbrennen, weil ich sie nicht verdiene! O mein Max, umschwebe mich nicht, auch keine Minute, bleibe bei deiner Mutter, tröste sie, lindere ihren Schmerz durch deine geisterhafte Nähe, wenn du es vermagst, nur nicht meinen, nicht meinen! »Ich habe mich versteckt, sucht mich, der wird mich nie wieder finden, der mich nicht genug geliebt hat!« Das ist der Trost, der aus der Ewigkeit zu mir herüberklingt. Ich sehe dich, Kind, süßes aufquellendes Leben, wie du mittags an deinem kleinen Tisch saßest und mir zunicktest und sagtest: ich mag auch Wein! und wartetest, ob ich einen Tropfen für dich übrig ließe. Und das Gesicht, das süße, süße Gesicht! O Gott, o Gott! Du stelltest den Engel vor meine Tür, und er lächelte mich an und sagte: willst du mich? Ich nickte nicht ja, aber er kehrte doch bei mir ein, er dachte: sieh mich nur erst recht an, dann wirst du mich schon behalten, mich nicht wieder lassen wollen. Aber ich hatte selten einen anderen Gedanken, als den: wie soll ich ihn ernähren, und in meiner unmännlichen Verzagtheit war ich stumpf und dumpf gegen das Glück, das sich um mich herum bewegte, das ich nur in die Arme zu schließen brauchte, um einen Schatz für alle Zeiten zu haben. Da rief Gott ihn wieder ab, und er ging doch nicht gern, denn er hatte eine Mutter, die ihm zum Ersatz für den Vater zweimal Mutter war. Nun helfen keine Klagen, keine Schmerzen, keine Tränen! O, es ist wahr, ich zittere vor der Zukunft, ich weiß nicht, woher ich den Bissen Brot nehmen soll, dessen ich bedarf; ich habe eine größere Angst, als der Bettler am Wege, denn ich fürchte das zu werden, was er schon ist. Aber ich hätte mich auf das Ärgste gefaßt machen, ich hätte den Entschluß fassen sollen, das Kind mit Betteln durchzubringen und ihm den Bettelstab, als Erbteil, zu hinterlassen, dann hätt ich meine Pflicht getan, dann braucht ich mich nicht vor jedem Arbeitsmann, der mir im Schweiß seines Angesichts begegnet, zu schämen, dann könnt ich jetzt ruhig sein und sprechen: der Herr hat ihn gegeben, der Herr hat ihn genommen, der Name des Herrn sei gepriesen! Und wie oft war ich hart, grausam gegen das Kind, wenn es mir in meinen finstern Stimmungen in seiner rührenden unschuldigen Lebenslust entgegentrat! O, daß ich nie geboren wäre! Der Seufzer kommt mir aus tiefster Brust! Und nicht einmal den kleinen Trost hab ich, daß er leicht gestorben ist, daß er seine Seele spielend ausgehaucht hat! Er hat furchtbar gelitten, acht Tage lang, an der Gehirnentzündung, gequält von zwei privilegierten Mördern, deren einer, Doktor Krämer, die Mutter sogar einmal, als sie in Person zu ihm eilt, und er noch nicht mit der Toilette fertig ist, in ihrer Todesangst empörend angefahren hat! Und nun, in meinem tiefen Weh, in meiner durch kein Bewußtsein erfüllter Pflicht und bewiesener reiner Menschlichkeit gelinderten Verzweiflung muß ich einen noch härteren Schlag fürchten! Was hat Elise ausgehalten! Welch einen Brief hat sie mir geschrieben! So schreibt kein Held! Diese Fassung flößt mir Entsetzen ein! Gott, Gott! Du hättest ihr das Kind lassen sollen, als du sahst, was sie litt, was sie tat, was sie ertrug! Hätte sies durchgebracht, so wollt ich hoffen; kann und wird sies jetzt überwinden? Wenn ein Funke Erbarmens für mich übrig ist, wenn alle Geschöpfe versorgt sind, und es blieb noch ein Rest, so muß ich mich täuschen! Ich bin solange, bis ich wieder einen Brief aus Hamburg erhalte, wie einer, der mit dem Kopf auf dem Block liegt – fünf Tage läuft mein eigner Brief, fünf Tage die Antwort, also zehn solcher Tage stehen mir bevor, und dann werd ich ersehen, ob das Haupt mir abgeschlagen wird oder ob ich es wieder aufrichten darf. Am 2. Oktober starb mein Max; vor vier Jahren starb an demselben Tage mein Freund Rousseau. Du hast recht, Elise, September, Im September war seine Mutter gestorben. Oktober, das sind für mich verhängnisvolle Monate! Erst am 22. Oktober, nachdem er längst zur Erde bestattet war, erfuhr ichs. Ich hatte nicht die geringste Ahnung gehabt, und weil ich erst von St. Germain nach Paris hineinziehen mußte und also die Adresse veränderte, konnte Elise mir nicht eher schreiben. O Gott, fröhlich war ich in der Zeit nicht, aber ich arbeitete doch, ich dichtete an meinem Trauerspiel; ich tat mir vielleicht in demselben Augenblick auf eine gelungene Szene etwas zugute und freute mich, als das Kind mit dem Tode kämpfte. Schrecklich! Ja, ich erinnere mich, den Abend des 1. Oktobers war ich auf einem Ball und sah den Cancan tanzen! Freilich gefiel mir nicht der Tanz, aber doch die Musik! Einmal haben sie dem Kind mein Bild gereicht, da hat das Süße es mit Lebhaftigkeit erfaßt und es an seine heißen Lippen gedrückt und geküßt und wieder geküßt. Ach, alle Liebe der Mutter wohnte in ihm, ich hab es wohl gemerkt. Und auch das hat nicht in der Ferne auf mich gewirkt. Nein, Elise, es gibt keine Ahnung. Darf das ein Trost, ein kleiner Trost in meiner Angst um dich sein? O du teures, liebevolles Kind! Könnte ich wenigstens dein Bild in mir hervorrufen! Ich kanns nicht, ich habs nie gekonnt. Allmächtiger Gott, sie! sie! Ginge sie auch dahin, und ich könnte nicht wieder gut machen, was ich an ihr verbrochen habe, könnte ihr nicht wenigstens meinen Namen geben, wenn ich denn nichts anderes zu geben habe, dann wollt ich, der Schmerz um sie sengte mir den Geist bis auf den letzten Gedanken aus dem Gehirn, und ich müßte Gras fressen, wie ein Tier. Die Donner rollen über mir – mir ist, als ob ich schon getroffen bin, indem ich erst getroffen zu werden zittere. Und da geht der Bamberg an mir hin und her und spricht: Fassen Sie sich, bedenken Sie, was Sie sich und der Welt schuldig sind! Mir! Mich in allen Tiefen aufzuwühlen und mich zu zernagen, solange der letzte Zahn noch nicht verstumpft ist. Der Welt! Ein Mensch zu sein, nicht ein solcher, der sich durch das, was man Kraft und Talent nennt, über die einfach-ewigen sittlichen Gesetze hinauszuschrauben sucht, sondern ein solcher, der sich dahin stellt, wo ihm alle Messer mitten durch die Brust schneiden. O, ich bilde mir nicht ein, daß ich durch meinen Schmerz etwas abbüßen kann. Aber ich werde mir auch nie einreden lassen, daß Gefühllosigkeit Kraft ist, und daß man Fassung hat, wenn man seine Tränen im Glase auffängt und nachzählt und spricht: es ist genug, nun schone deine Augen, denke daran, daß du blind werden kannst und dann eines Führers bedarfst, der Welt also eine Last aufbürdest, indem sie den Führer hergeben muß. Hör auf!
25. Okt. 1843.
O Elise, Du hast dies Glück doch wenigstens genossen! Aber ich! Dem die Angst vor der Zukunft die Freude an der Gegenwart fast immer trübt! Denke Dir, wie mich dieser Schlag getroffen hat. Ich sage Dir: Rousseaus Tod war nichts dagegen. Da hast Du das Maß. Später, später über diese Tage! Jetzt wäre es Mord an Dir, an mir selbst! Herausziehen kann man das Schwert nicht wieder. Warum es umkehren in der Wunde!
O, warum reichen die Gedanken der Menschen so weit und doch nicht weit genug! Warum hinaus über die Stunde und doch nicht in die Ewigkeit hinein! Auf das Leben dieses Kindes habe ich sicherer gerechnet, als auf mein eignes.
Und nun das Zittern, das Bangen um Dich! Mögest Du über den Toten den Lebendigen nicht vergessen! Der Tag, an dem ich wieder einen Brief von Dir erhalte, wird mir der heiligste meines Lebens sein! Daß Du dies jetzt fühltest, daß Du mir schriebest, ohne erst meine Antwort abzuwarten! Doch, es gibt keine Ahnung. Wir wissen es nun! Und in diesem Augenblick ist es ein Trost für mich!
Mach Dir nur, wenn Du diesen Brief empfängst, keine Sorge um mein Physisches. Darin bin ich anders organisiert, wie viele. Bei mir führen Körper und Geist eine getrennte Wirtschaft. Ich kann essen und trinken, ich kann sogar einigermaßen schlafen; aber ich fühle den Schmerz bis zur Vernichtung, ich fühle ihn bis zu dem Punkt, wo er die arme Menschenseele wieder selbst von sich befreit, indem er größer wird, als sie und ihr das Bewußtsein raubt, was sie ist und daß sie ist. Ich folge Doktor Bambergs freundschaftlichen Bemühungen um mich, ich gehe mit ihm in die Galerien und durch die Straßen, aber es ist doch nicht viel anders, als ob man aus Gefälligkeit die Augen schließt, um andere glauben zu machen, daß man schlafe. Dies alles ist eben so natürlich bei mir, als die entgegengesetzte Erscheinung, daß ich in Krankheiten, die bei den meisten alle Geistesfunktionen aufheben, mit einer fast noch größeren Lebhaftigkeit, wie in gesunden Zuständen, Ideen entwickle und darstelle; mein Geist nimmt wenig Notiz vom Leib, mein Leib wenig vom Geist.
Teuerste Elise, bei Dir ist es anders, aber zwinge Dich zum Essen und Trinken, zum Schlafen! Man kanns, man kann sich ins Öde, Dumpfe hineindrängen, wo nicht der innere Mensch aufatmet, aber doch der äußere sich stärkt. Tus um meinetwillen! Auch ich mach es so! Deinen Brief kann ich nicht ansehen, oder die Tränen springen mir aus den Augen und mein Herz krampft sich, und das ist immer noch süßer, als das wüste Brüten über dem Nichts, aber ebendeshalb habe ich ihn weggeschlossen. Nimm Bücher zur Hand! Stelle die Gegenstände, die Dich zu lebhaft erinnern, beiseite! Und vor allem: gedenke mein, vergiß nicht, daß Du, wenn Du dem Schmerz über das Kind zu sehr nachhängst, mir einen Schmerz bereiten kannst, der alles, was mich sonst treffen könnte, übersteigt. Denn das ist im Leben das Entsetzlichste, daß eben das, was die Quelle unsrer Seligkeit ist, die Quelle einer ewigen Qual werden kann! Und das willst Du mir doch gewiß nicht werden!
O, hätte ich erst wieder einen Brief von Dir! Um mich ängstige Dich nicht! Und am wenigsten dann, wenn Du weißt, daß ich mich um Dich nicht mehr zu ängstigen brauche.
Welchen Entschluß wirst Du fassen? Berücksichtige, auf den Knien beschwöre ich Dich, nichts, als Dich selbst und Deine Gesundheit. Eine Seereise wird kaum möglich sein! Zu Lande? Wenn es irgend geht! Es koste, was es wolle, wir müssen uns aufs schnellste sehen! Nach Berlin? Zerstreuen würde auch das Dich. Oder soll ich nach Hamburg zurückkehren? Nur einen Wink! Ließe es sich einrichten, so wäre es für Dich immer am heilsamsten, nach Paris zu kommen. Nur, noch einmal: bedenke Deine Gesundheit und tu nichts ohne den Rat unserer Freunde. Zur See, ist wohl kaum denkbar; jedenfalls in der ersten Kajüte, der Unterschied ist ohnehin sehr gering, und die Bequemlichkeiten sind bedeutend größer. Kämst Du, so würdest Du vielleicht meine Briefe und den Homer mitbringen können; mehr von Büchern ja nicht. Wir würden uns sogleich verheiraten und uns als Neuverehelichte in den Hamburger Nachrichten empfehlen. Zum Frühjahr gingen wir dann von Paris nach Berlin, woselbst ich meine neue Tragödie – sie ist bis auf zwei Szenen vollendet – zur Darstellung einreichen und, wenn ich in Person anwesend wäre, gewiß auch aufs Theater bringen würde, denn die zwei Szenen werden mir ja wohl kommen, wenn ich diese Katastrophe überstanden habe ...
Ach, meine Angst um Dich! Daß ich nicht bei Dir bin! Liebste, Teuerste, schone Dich, schone Dich! Daß ein Gott es Dir in die Seele geflößt haben möge! Daß mein Brief es Dir nicht zuerst zu sagen brauchte!
Lies, nimm meine Bücher, Romane von Scott, Sachen von Hoffmann, aus der Leihbibliothek! Ich bitte Dich dringend darum! Du mußt Dich mit Gewalt zerstreuen, ich weiß wohl, daß Du das entgegengesetzte Bedürfnis fühlst! Und zum drittenmal: bedenke nichts, als Dich und Deine Gesundheit, wenn Du unter meinen Vorschlägen wählst, verliere ich Dich, so habe ich einen Stachel in der Seele, den die Ewigkeit selbst nicht wieder herauszieht! ...
Tagebuch 26. Okt. 1843.
Allmächtiger Gott! Wie mir jetzt die Tage verstreichen! Eine namenlose Angst erfüllt mich, ich weiß mich nicht zu lassen! Ein Jahr meines Lebens für einen Brief von Elise! Schon zweimal habe ich ihr geschrieben, kurz hintereinander, damit, wenn der erste Brief zu wirken aufhört, der zweite wieder anfange! Wenn ein Funke Erbarmen bei Gott für mich vorhanden ist, so werde ich nicht so schrecklich bestraft, alles, was ich liebe, auf einmal zu verlieren. Auf ihren Brief antworten, hieß sprechen nach der Hinrichtung! Ich habe mich möglichst gefaßt, als ich ihr schrieb. O Gott! O Gott!
... Unser Kind ist schlafen gegangen, ehe es müde war. Ein schlimmeres Schicksal ist es, müde zu sein und nicht schlafen gehen zu dürfen. Ja, mein Max, mein teurer, ewig geliebter Max, wenn mich irgend etwas über das trösten kann, was du jetzt bist, so ist es der Gedanke an das, was ich selber bin. Über dich hat die Sonne geleuchtet, die Früchte der Erde hast du gekostet und am Herzen der besten Mutter bist du entschlafen! Wer hat mehr gehabt und muß nicht sagen: dies Mehr war vom Übel! ...
3. Nov. 1843.
Gestern mittag erhielt ich einen Brief von Elise. Gott sei Dank! Er ist zwar wenig tröstlich, denn noch immer spricht die fürchterliche Aufregung aus ihm; aber es ist doch ein Brief von ihr. Nun will ich ihr Bild wieder über meiner Kommode aufhängen. Ich hatte es abgenommen, weil ich fürchtete, die Menschen, die in meiner Abwesenheit das Zimmer reinigen, könnten es zerbrechen. O Elise, denke an den Schmerz um dein Kind, wie du ihn fühlst, und dann frage dich, ob es an einem Leben, worin solche Schmerzen möglich sind, viel verloren hat! Und doch – das sind Reden!
6. Nov. 1843.
... Es ist eine Wollust, sich selbst zu zerstören, die Wunden, wenn sie sich zu schließen anfangen, wieder aufzureißen und das edelste Lebensblut als Totenopfer dahinströmen zu lassen; ich kenne sie, und habe oft auf diese Weise gefrevelt; bin Gott oft in meinem eigenen Ich als Teufel, dem schaffenden und bindenden Prinzip als vernichtendes und lösendes, entgegengetreten; auch kann der Mensch im ersten Augenblick nicht anders, wenn ihm das Teuerste entrissen ist, weil er sein über Tod und Grab hinausreichendes Liebesbedürfnis nur noch so zu befriedigen vermag. Aber endlich muß man widerstreben, und dies gelingt am ersten, wenn man auf das zurückblickt, was einem noch blieb, und wenn man bedenkt, daß man dies mit zerstört, wenn man sich selbst aufreibt. Sieh, Elise, ich habe Gott auf den Knien gedankt, als ich mit Deinem ersten Brief die Gewißheit dahinnahm, daß er mir Dich gelassen hatte, und ihm meinen Schmerz geopfert; wenn ich Dir etwas bin, so wirst Du es ebenso machen. Und vielleicht führt in diesem Fall für Dich, wie für mich, das Trostlose etwas Tröstliches mit sich, darum will ich Dich auffordern, unsere Lage, meine Zukunft ins Auge zu fassen. Über mir wölbt sich ein Himmel, wie von Backsteinen, den Sonne, Mond und Sterne nicht mit ihren Strahlen durchdringen; ich habe nicht so viele Aussichten, wie der gemeinste Tagelöhner, denn seine Geschicklichkeiten besitze ich nicht, und die meinigen helfen mir zu nichts; es ist kein Gedanke daran, daß ich, selbst wenn eine solche mir angetragen würde, jemals eine Professur übernehmen könnte; ich habe mich nun geprüft und gefunden, daß ich durchaus unfähig bin, noch irgend etwas zu lernen; mir bleibt also nichts, gar nichts, als mein Dichtertalent, und damit werde ich mir, kein Hund wird zweifeln, die Unsterblichkeit, das heißt einen Platz am Kreuz neben meinen Vorgängern, erobern, aber auch nicht die unscheinbarste bürgerliche Existenz, von diesem Gesichtspunkt aus betrachte Dir das Grab unseres Kindes noch einmal und dann frage Dich, ob Du es lieber ruhig unter den Rosen, die meines Freundes edle Hand pflanzte, schlafen, oder als gehetztes Wild, von Pfeilen bedeckt, durch die Reihen der Menschen, die, wenn sie nicht selbst mitschießen, doch wenigstens ruhig oder mit einem: Gott erbarme sich! zuschauen, hinkeuchen sehen möchtest. Wenn seine süßen blonden Locken Dir einfallen, so erinnere Dich, daß er sie sich als Mann in Verzweiflung vielleicht ausgerauft hätte, wenn sie nicht von selbst ausgegangen wären; wenn seine roten Wangen Dir vorschweben, so bedenke, wie bald sie das Leben gebleicht haben würde. Wer kann ohne die tiefste Erschütterung daran denken, daß ihm Ausgang und Eingang so schwer gemacht wurden; spielend hätte es bei einem so kurzen Dasein in die Welt hinein, spielend hinaus hüpfen sollen! Aber, was es auch erlitten hat, die Leiden waren körperlicher Art, sie haben seinem unsterblichen Geist die Flucht aus dem Kerker des Leibes erschwert, aber sie haben ihm selbst keine Wundenmale aufgedrückt. Wer tilgt aus eines Mannes, wer tilgt aus meiner Seele alle die Risse und Blutspuren wieder weg, die sie nun schon seit zwanzig Jahren entstellen! Ich glaube mit Dir, daß Max auch geistig begabt gewesen ist, denn so rasch entfaltet das Leben sich nicht in einem Kinde ohne mächtig treibende Grundkraft; aber um so schlimmer für ihn! Mir hat die Natur viel, sehr viel gegeben; solange die Welt steht, sind mir in meinem Kreise nicht viele gleich, wenige überlegen gewesen; in einem Augenblick, wo ich wünsche, ich wäre der Geringsten einer, darf ich es sagen; ich spreche davon, wie ich von meinen Hühneraugen sprechen würde. Wozu hilft es mir? Ich will die Erde herausfordern, ob sie einen Unglücklicheren trägt, wie mich; sie soll mich verschlingen, wenn sie mir ihn zeigen kann. Geisteskraft ist das Höchste, ja, aber nur dann, wenn das Niedrigste sich damit vereinigt, das heißt, wenn das Lächeln des Glücks die Gunst der Natur vergoldet, im entgegengesetzten Fall aber verstärkt sie nur das Empfindungsvermögen für die Schläge des Geschicks, und führt zu verdoppeltem Elend. Nun gib dem Kinde alles, was ich habe, und gib ihm mehr dazu, gib ihm aber auch das, worin er, da er mein Sohn und so ganz mein leibliches und geistiges Ebenbild war, mir gewiß auch gleich gewesen wäre, gib ihm meine ungeheure Reizbarkeit und den possierlichen Segen des Glücks, alles nur darum empfangen zu haben, um auch nicht das Geringste damit auszurichten: dann frage Dich, ob nicht eine einzige Stunde, wie Du solche Stunden bei mir kennst, worin er dies so recht bis zur Vernichtung, bis zur innersten Selbstverhöhnung, gefühlt hätte, mehr der Qual enthalten haben würde, als die Krankheit, die ihn in Gottes Arme zurückgeführt hat. Dieses alles kam zusammen, wenn ich mich des Kindes ehemals nur halb freute, denn das ist der Fluch des Mannes, daß er über den Moment hinaussieht und sich den edelsten menschlichen Empfindungen nicht hinzugeben wagt, wenn er nicht weiß, wie er sie in Zukunft durch treue Pflichterfüllung bezahlen soll; aber zweifle nicht, Deinen Schmerz habe ich ganz geteilt; wenn Du mein Tagebuch läsest, Du würdest schauern vor den Bandwürmern, die dieser Sturm aus der Tiefe meiner Seele heraufgewühlt hat; in einem solchen Moment wütet der Mensch, es bleibt ihm keine Wahl, entweder gegen Gott oder gegen sich selbst, und ich biß mit meinen Zähnen in mich selbst hinein. Acht Tage lang habe ich geweint? ich habe meinen Zustand in den Briefen an Dich verhehlt, obgleich es mich erleichtert haben würde, mich auszuschreien, und ich spreche auch jetzt nur davon, damit Du nicht etwa glaubst, daß der nur halb Getroffene Dich auffordert, Deine Wunden zu verbinden und Dich zu fassen. – Mehr kann ich Dir nicht sagen, jetzt muß Deine Brust sich erleichtert fühlen oder die ewige Wahrheit hat ihre Kraft verloren. Lies diesen Brief bis zu dieser Stelle Jahnens vor, und zwar ohne Auslassungen, er ist der einzige, der mich, außer Dir, versteht und den ich bis in mein Innerstes hinabschauen lassen mag, auch hat er es wohl um mich verdient!
Deine Briefe, wie sie einer nach dem anderen bei mir eingetroffen sind, haben mich erfreut, aber sie haben mich nur für den Augenblick beruhigt. Du bist noch furchtbar aufgeregt und aus Deinen Briefen selbst sehe ich, daß Du diese Stimmung eher in Dir unterhältst, als unterdrückst denn sowie Du nur des Kindes Namen nennst, rufst Du Dir mit Gewalt eine Reihe von Bildern zurück, die Dich nicht zur Ruhe kommen lassen können. Tu es nicht, teuerste Elise, denk an mich, denk an das zarte Leben, das sich in Deinem Schoß entwickelt und zwinge Dich, Deine Gedanken auf andere Gegenstände zu lenken. Man kanns, wenn man will. Glaube mir, auch ich, wenn ich Kinder erblicke, oder wenn ich im Louvre vor einem Gemälde stehe, worauf Kinder abgebildet sind, muß die Augen abwenden, aber ich tu es auch! ...
7. Nov. 1843.
... über Nacht sah ich das süße Kind im Traum, ganz wie er war und doch etwas anders, von seinen Locken gingen Strahlen aus, er war unendlich freundlich, bemühte sich um Dich und suchte Dich zu erheitern, ich stand hinter ihm und drückte ihm Küsse auf sein leuchtendes Köpfchen. O gewiß, mein Max, du bist noch anderswo, als im Grabe, und ob du noch zehn Brüder bekommst, keiner wird mir das werden, was du mir warst und bist! Und weißt Du was, Elise? Nur die Guten sterben früh! Nie ein Böser! ...
Tagebuch Nov. 1843.
Heute war ich in der Bibliothek des Konservatoire und las Mozarts Biographie. Ach, mein Max, wie schmerzlich sollte ich an dich erinnert werden! Da wird von Mozart als Beweis seines tiefen Liebesbedürfnisses erzählt, er habe als Kind jeden Menschen wohl zehnmal des Tags gefragt, ob er ihn auch lieb habe. Das tat mein Kind auch, immer noch höre ich sein: magst mich auch heiden? Das L konnte er noch nicht aussprechen, dafür gebrauchte er das H. O, wie tief hat es mich gerührt! Ich sah ihn, ich hörte ihn!
Die Erde könnte mit lauter Augen, wie mit Perlen, übersät werden, wenn man überzählt, wieviele Augen in ihr schon zu Staub zerfallen sind. Auch deine wunderschönen blauen Augen, mein Kind!
Gestern morgen, nachdem ich kaum aufgestanden war, holte mich ein Bekannter ab, um im großen Saal des Konservatoire der Probe eines Berliozschen Konzerts beizuwohnen. Ich hörte, freilich zerhackt und zerstückelt, schöne Musik und wurde durch die dämmernden Lampen, die von ihrem Licht rötlich beglänzten Gesichter der Orchestermitglieder und den im Anfang noch halb finstern Saal in meine Jugend zurückversetzt; sogar der Frost in den Füßen trug das Seinige dazu bei. In meinem Geburtsort wurden in der Adventzeit und an den hohen Festtagen der Christenheit Kirchenmusiken aufgeführt: der Stadtmusikus dirigierte sie; Waldhörner, Hoboen, Posaunen, Pauken ergossen, von den breiten Orgeltönen, die der sehr geschickte Organist in voller Gewalt hervorzulocken verstand, getragen, ihre wunderbaren, fremdartig-feierlichen Klänge durch das dämmernde Oval der Kirche; der Rektor, dessen quäkend-piepige Stimme ich damals als ebenso zur Sache gehörend betrachtete, wie das Schneidende der Violintöne und das Schmelzende der Flöten, sang mit seltsam verzogenem Gesicht eine Arie, und die Chorknaben, die ich so lange beneidete, bis ich selbst ihnen beigesellt wurde, schlossen mit einem Choral. Lampen, die mit der Finsternis zu kämpfen schienen, weil ihre matten Flammen zitterten, verbreiteten ein rötliches Licht, das all den wohlbekannten Gesichtern in meinen Augen etwas Überirdisches verlieh und sie hoch über die anderen Menschen, die sich nach und nach hustend und räuspernd unter und neben mir einfanden, hinaushob, jede Bewegung, die sie machten, das Taschentuch, das der Organist zog, die Brille, die der Stadtmusikus aufsetzte, vor allem aber die Notenbücher, wenn sie auf die Pulte gelegt wurden, hatten für mich etwas Religiöses; wenn die Knaben miteinander flüsterten, so war es mir, als ob ich sie vor der Himmelstür Scherz treiben sähe, sogar über den die Bälge tretenden Schuster mit dem ungeheuren Mund konnte ich nicht mehr lachen, wenn er so ernsthaft um die Ecke sah, und an den über dem Orgelwerk schwebend abgebildeten Engeln verwunderte es mich ordentlich, daß sie ihre Flügel nicht bewegten. Wenn ich mich jener Empfindungen jetzt erinnere, so muß ich sagen: ich schwamm im Element der Poesie, wo die Dinge nicht sind, was sie scheinen, und nicht scheinen, was sie sind, das Wunder der weltlichen Transsubstantiation vollbrachte sich in meinem Gemüt, und alle Welten flossen durcheinander. Gar abscheulich nüchtern ward mir hinterher zumut, wenn die Lampen ausgelöscht und die Notenpulte weggesetzt wurden, wenn die Musiker sich zurückzogen, wenn ordinäre, verschnupfte Menschen die Orgel füllten und sich mit ihrem Gesangbuch blöckend dahinstellten, wo kurz zuvor Hörner und Hoboen im Lampenschein geheimnisvoll geblinkt und geklungen hatten, wenn dann der kleine pausbäckige Pastor auf die Kanzel stieg und allein das Wort nahm, und wenn noch obendrein Emilie ausblieb, Emilie in ihrem blauen Kleide, in die ich von meinem vierten Jahre an verliebt war!
21. Nov. 1843.
... Dein Brief ist so schön, so außerordentlich schön, daß ich Zeile für Zeile küssen möchte, besonders was Du von dem werdenden kleinen Wesen sagst, daß Dir sei, als ob es schon bitten könne. O, hätte ich Worte, lind wie Rosenblätter, an denen der Morgentau hängt, um Deine Seele zu kühlen und zu erfrischen! Wenn ich an Dich denke, an das, was Du erlitten und wie Du es ertragen hast, so möchte auch ich noch wieder hoffen, nicht meinet-, sondern Deinetwegen ...
Tagebuch Nov. 1843.
Es gibt nur eine Notwendigkeit, die, daß die Welt besteht, wie es aber den Individuen darin ergeht, ist gleichgültig; ein Mensch, der sich in Leid verzehrt und ein Blatt, das vor der Zeit verwelkt, sind vor der höchsten Macht gleichviel, und so wenig dies Blatt, als Blatt, für sein Welken eine Entschädigung erhält oder erhalten kann, so wenig der Mensch für sein Leiden; der Baum hat der Blätter im Überfluß und die Welt der Menschen.
5. Dez. 1843.
... Liebe Elise, was sollte ich dagegen haben, daß Dein Zustand unseren Freunden mitgeteilt werde? – Daß Du so ungebührlich sparst, kann ich durchaus nicht billigen; in Deiner Lage ist sogar manches sonst Überflüssige notwendig, bedenke das doch und versage Dirs nicht, für das nächste Jahr stehts ja noch gut mit uns ...
... Über Paris ein andermal, es ist eine herrliche Stadt und selbst im Herbst und Winter ein köstlicher Aufenthalt – so sehr meine Seele verfinstert ist, so trage ich dennoch Früchte für mein ganzes Leben davon ...
15. Dez. 1843.
... Über Paris habe ich Dir noch wenig gesagt, dafür steht einiges in meinem Tagebuch. Wäre ich im Sommer hergekommen, ich würde einen göttlichen Aufenthalt gehabt haben, aber auch jetzt, trotz der großen Verfinsterung meines Gemüts, fühle ich wohl, was es heißt, in dieser Stadt zu leben. Man hat einen elastischen Boden unter sich, der einen nicht bloß trägt, sondern emporschnellt, es ist ganz eigen. Zum Teil kommt es bei mir wohl mit daher, daß ich, dem die Jugend und die beste Jünglingszeit so trist verfloß, daß ich nicht einmal zu träumen wagte, mich innerlich unbewußterweise selbst darüber wundre, nun doch hier zu sein. Es ist bei mir wirklich, wenn ich diese Straßen durchwandre oder in eins dieser weltberühmten Gebäude eintrete, ein zugleich stolzes und demütiges Gefühl, das mich jedesmal erfaßt, und sehr oft rufe ich laut aus: ich freue mich! ...
... Gewöhnlich gehe ich alle Tage eine Stunde, die zwischen 3 und 4, ins Louvre, und die vorzüglichsten Meisterwerke stehen mir jetzt schon so deutlich, wie diese Buchstaben, mit denen ich es Dir schreibe, vor Augen. Es sind Sachen darunter, die nicht gesehen zu haben und aus der Welt gehen zu müssen, ein Unglück ist, um ein tiefes Wort der Alten über den Jupiter des Phidias anzuwenden; o gesegnet ist der Mensch, der mit seinen eignen Sinnen und Organen dem Vortrefflichen gegenübertreten und sich ein Verhältnis dazu begründen darf; er lernt auf diese Weise nicht bloß die Fülle und Tiefe der Welt, sondern auch sich selbst kennen. Segen über den Fürsten, der mir die Mittel dazu gegeben hat! Ich gedenke seiner sehr oft, und jedesmal, wenn ich so recht schwelge in diesen höchsten Genüssen ...
Tagebuch 3. Jan. 1844.
An Elise habe ich gestern geschrieben; ich hatte schon in der Nacht, wo ich nicht schlafen konnte, einen Brief fertig gemacht, aber ich zerriß ihn wieder, denn nicht bloß die unsichere Handschrift, sondern auch einige Worte, die ich über meine Erkältung hatte fallen lassen, hätten ihr Angst eingejagt, und obgleich ich sonst auch in diesen Dingen die Wahrheit für das Beste halte, so verlangt doch ihr jetziger Zustand eine Ausnahme. Sie ist wieder schwanger; wenn Gott ihr eine glückliche Entbindung schenkt, so mag dies das einzige Mittel sein, sie über den Verlust unseres Sohnes zu beruhigen, und dann will ich das Schicksal preisen, das ihr den Ersatz schon zu einer Zeit zuführte, wo wir den Verlust noch nicht ahnen konnten. Aber ihre erste Entbindung war so außerordentlich schwer, sie litt so über alles Maß, daß ich, wenn ich mich hieran erinnere, mir etwas Entsetzliches als möglich denken muß. Gott sei ihr und mir gnädig!
21. Jan. 1844.
... Eine Ehe ohne alles Fundament! Alle die unumgänglichen Notwendigkeiten, die damit verbunden sind, und, die nächsten zehn Monat abgerechnet, kein Geld und keine Aussichten! Du wirst mich nicht inkonsequent finden, wenn Du diesen Brief mit dem vergleichst, den ich Dir im ersten Schmerz schrieb. Beim Erdbeben faßt man das, was man liebt, bei der Hand und zieht es zu sich heran; aber wenn das Erdbeben überstanden ist, treten die Verhältnisse wieder in ihre Rechte ein und man schaudert, die Reise in eine Wüste anzutreten, wo man fürchten muß, nicht Wasser noch Brot anzutreffen. Denn, wenn man gar nichts hat, so kommt man auch mit dem Einschränken nicht durch, und was das Einschränken selbst betrifft, so steht es damit nach der Verheiratung auch ganz anders, als vor derselben. Elend im Hause und Geringschätzung außer demselben, die nicht ausbleibt, wenn man nicht einigermaßen seinem Stande und seiner Bildungsstufe gemäß leben kann – das ist eine Last, die weder ein Gott, noch ein Mensch erträgt. Unsere Freunde haben hierüber kein Urteil. Sie setzen bei mir, wie bei Dir – und dies ist der wichtigste Punkt! – voraus, was wir nicht haben: bei mir Gelehrsamkeit, bei Dir Geld! Ich weiß viel, sehr viel, aber ich habe es aus mir selbst geschöpft, ich habe es nicht gelernt, ich habe die Resultate, nicht den Weg, wenn ich aber lehren soll, so muß ich gelernt haben. Schütz denkt nun aber: mein Gott, er ist Doktor der Philosophie; er nimmt sein Diplom, geht nach Kiel und eröffnet seine Vorlesungen; bei so viel Geist muß das Erfolg haben, das Wissen setzt er voraus. Nicht meine Schuld ist es, wenn es anders mit mir steht, ebensowenig, als es meine Schuld ist, daß ich kein reicher Mann bin; in meinem zweiundzwanzigsten Jahre war ich schon über die Zeit des Sprachenlernens hinaus, und dieser Mangel steht mir nun allenthalben im Wege. Was Dich betrifft, so sagen sie: mein Gott, sie besitzt ja so viel Kapital, daß sie von den Zinsen leben kann; mögen sie, wenn die Zinsen für beide nicht ausreichen, das Kapital angreifen, das muß ja auf Jahre vorhalten und in der Zeit macht es sich mit seiner Professur. Hier ist denn der Punkt, wo jede Lüge, nicht bloß die von dem Menschen selbst ausgegangene, sondern auch diejenige, der er nur nicht widerspricht, sich rächt. Und doch, sollten wir ehemals, als die Leute für gut fanden, bei mir wissenschaftliche und bei Dir irdische Schätze vorauszusetzen, ein Duett anstimmen: Nein! Nein! Wir sind arme Teufel? Das war uns in dieser niederträchtigen Welt, wo der Pöbel jeden auf die Füße tritt, der seinen Gott, den Silberling, nicht in der Tasche beherbergt, nicht zu verlangen. Ob aber nicht jetzt der Moment gekommen ist, wo wir die Börse bloßstellen, damit der Charakter nicht leide? Das überlasse ich Deinem Ermessen. Zunächst hättest Du, nach meiner Meinung, die Sache Deiner Mutter von dieser Seite vorzuführen; es ist diejenige, die auch sie begreifen muß. Janens – danke ihm herzlich in meinem Namen für seinen schönen, teilnahmvollen Brief und sage ihm: für den Inhalt könne er ja nicht, und mir wäre jedes Wort, ob erhebend oder niederschlagend, gleich willkommen! – schreibt mir, die Madame Ruschke habe ihm Deinen Zustand mit diesen Worten eröffnet, »daß, wenn Du auch Kraft gehabt hättest, alles zu überstehen, doch der Spott und Hohn des Pöbels um Dich her Dich töten würde!« Er selbst setzte hinzu: »ich wage ihr nicht zu widersprechen!« Wenn dem so ist, liebe Elise, wenn die Frau nicht etwa denkt, wie tausend andere denken würden: »er muß jetzt heiraten, oder er heiratet nie!«, wenn sie Dich nicht durchaus gemißdeutet und mißverstanden hat, so vertraue mir Deinen Gemütszustand offen an, und sei sicher, daß ich, ohne irgend etwas, außer Dir, zu berücksichtigen, kommen und mich verheiraten werde. Ich denke, da Gott uns in Kleinigkeiten, bei Herrn von Cotta und dem Theater Die Berliner Bühne hatte die Aufführung der »Maria Magdalena« wegen der Schwangerschaft der Heldin und Cotta den Verlag sowie die von Hebbel für das Morgenblatt angebotenen Reisebriefe abgelehnt. nicht beisteht, so wird er seine Gnade zusammenhalten und Dir in der Hauptsache beistehen wollen. Ich denke ferner, daß Du, da Du mit dem Pöbel vom Stadtdeich zusammenzukommen nicht nötig und von keinem anderen etwas zu leiden hast, wenn Du Dich in der neuen Wohnung gleich für verheiratet ausgibst, was Du ja auch wirklich bist, denn es gibt bekanntlich auch Gewissensehen; ich denke, sag ich, daß Du nach meiner Meinung vor Hohn und Spott sicher bist. Ich muß es daher aus Deinem eignen Munde wissen, ob die Madame Ruschke recht hat; ist es aber der Fall, so ist alles abgemacht. Was dann die Wohnung betrifft, so ist mir jede recht; ich brauche gar kein Separatzimmer, denn ich werde niemand besuchen und also auch niemand bei mir sehen, und mein bißchen Arbeiten kann allenthalben geschehen. Ich bitte Dich aber dringend, diese außerordentlich ernste Frage mit Entschiedenheit zu beantworten und mir, wenn Du etwa sagst, daß die Frau Dich nach sich, und also verkehrt, beurteilt habe, zu schwören, daß Du mir Dein Innerstes nicht verbirgst. Ich fordre dies deswegen, weil ich wohl weiß, daß der Adel Deiner Gesinnung Dich hier zum Ausweichen verleiten können. Ich habe Vertrauen auf Gott und auf die Zukunft, ich halte den entsetzlichsten aller Fälle für durchaus unmöglich, sonst verstände es sich ja von selbst, daß ich mit dem ersten Schiff wieder in Hamburg einträfe. Du schreibst mir in Deinem letzten Brief: »Alles kann ich ertragen, nur nicht die Trennung von Dir, die würde mich töten!« Wie hast Du das verstanden? Du wirst doch nicht zweifeln, daß wir im wahren Sinne des Worts nie getrennt werden können? Oder meintest Du damit meine Abwesenheit? Mehr wüßte ich Dir über diesen wichtigsten aller wichtigen Gegenstände nicht zu sagen.
Mit Johann Hebbels Bruder. bin ich im höchsten Grade unzufrieden. Was? Jetzt wiederhergestellt von der Wassersucht? Und Du schreibst ihm noch, wenn die von Dir selbst bezweifelte Krankheit sich verschlimmere, so pp. und schickst ihm Geld? Ein für allemal: jeden Brief uneröffnet zurück! Wir haben nichts, und wir müssen uns nicht schämen, dies einzugestehen. Es wäre Sünde, wenn Du die verfluchten, unverschämten Briefe wieder annähmst. Ich habe es ja im vorigen Jahr schon so gemacht, weil ich mir nur dadurch Ruhe zu verschaffen wußte ...
... Mit Heine ist schon alles ausgeglichen. Eine kleine Verstimmung zwischen Heine und ihm. Über den ersten Besuch bei Heine schreibt Hebbel: »... Es kam nun gleich ein lebhaftes Gespräch zwischen uns in Gang, wir wechselten die geheimen Zeichen, an denen die Ordensbrüder sich einander zu erkennen geben, und vertieften uns in die Mysterien der Kunst. Mit Heine kann man das Tiefste besprechen, und ich erlebte einmal wieder die Freude einer Unterhaltung, wo man bei dem andern nur anzuticken braucht, wenn man den eigensten Gedanken aus seinem Geist hervortreten lassen will ... Daß er Dichter ist, tiefer, wahrer Dichter, ein solcher, der sich nicht bloß auf gut Glück ins Meer hinunter taucht, um einige Perlen zu stehlen, sondern der unten bei den Feen und Nixen wohnt und über ihren Reichtum gebietet, das tritt aus seiner Gestalt wie aus seiner Rede hervor.« Heine erklärte, nachdem er »Judith« gelesen, Hebbel für den größten Dichter der jüngeren Generation; er gehöre mit seiner außerordentlichen Gestaltungskraft noch unserer großen Literaturepoche an. Wir begegneten uns in der Dämmerung in der Rue Richelieu und grüßten uns fast zu gleicher Zeit. Er sagte: ich habe an Sie sehr viel gedacht, wohin gehen Sie, gehen Sie mit mir? Ich: ich habe einen anderen Weg. Er: dann geh ich mit Ihnen. In dem Augenblick aber bekam er etwas in den Hals, das er im Mund gekäut hatte, konnte nicht weitersprechen und mußte sich zu Hause verfügen, lud mich aber natürlich ein, ihn zu besuchen. Ich tats, er erkundigte sich mit großem Interesse nach meinen Arbeiten und hatte, als ich ihm von der Existenz meiner neuen Tragödie sprach, die große Aufmerksamkeit, mich um Mitteilung derselben zu ersuchen; er müsse dazu aber einen Tag abwarten, wo er hell im Kopf sei, weil ihm sonst zuviel in dem Werke entgehen würde; er klagt nämlich über Kopfweh und mag auch wohl sehr damit geplagt sein. Wir verabredeten nun, daß er zu mir schicken solle; das ist noch nicht geschehen, aber er spricht gegen dritte Personen mit der größten Achtung von mir; ich sei einer der ersten Dichter, nicht bloß der Gegenwart, sondern die Deutschland je gehabt habe. Du siehst, ein Genie ist gegen Seinesgleichen immer gerecht, nur die Halb-, Dreiviertel- oder Ganztalente, die ihm zwischen die Beine geraten, zerstampft es. Er hatte gestern zu Bamberg, der ihn um 1 Uhr noch im Bett getroffen, gesagt, er sei nur seines Kopfwehs wegen noch nicht bei mir gewesen; er denkt mir also alle Visiten zu erwidern, und das ist, da er niemand besucht, sondern sich nur besuchen läßt, alles Mögliche ...
... Gott wird geben, daß Du Deinen Husten wieder los bist, wenn dieser Brief eintrifft; daß Du nicht essen magst, ängstigt mich. Beste Elise, vor allem: übertreibe Deine Sparsamkeit nicht! Bedenke, daß Du Kräfte brauchst und also welche ansammeln mußt; kauf Dir doch Wein! Wir haben ja noch Geld und bekommen etwas wieder, sobald wir es gebrauchen ...
30. Jan. 1844.
Ich ließ mein Auge auf dem deinen ruhn,
da ward zur Purpurflamme dein Gesicht;
du warst ein Kind, ein Mädchen bist du nun,
so weigre auch die Mädchenfrucht mir nicht.
Dein Mund ist reif jetzt für den ersten Kuß,
er gleicht der Herzenskirsche, die zersprang
vor aller Feuersäfte letztem Schuß
und nun verspritzt, was sie so heiß durchdrang.
Ich hab ein Recht auf ihn, ich hab in dir
die Glut, die ihn gezeitigt hat, geweckt,
drum raub ich ihn mit kecker Lippe mir,
wie Vögel Beeren, die kein Laub mehr deckt.
Vielleicht vollendet dieser Kuß mein Glück,
du wirst durch ihn dir deiner ganz bewußt,
und wie du Mädchen wardst vor meinem Blick,
so wirst du auch noch Weib an meiner Brust!
24. März 1844.
... Glaube mir, Elise, der Schmerz um ein geliebtes Kind, das der Tod entrückte, ist nicht der größte, er reduziert sich doch zuletzt, wenn man ihn in seine Bestandteile zersetzt, auf den Egoismus, daß man ein Leben, das dem Weltganzen angehört und das aus diesem nicht verschwinden kann, apart für sich allein haben will. Aber in sich selbst hineinstarren und sich selbst als Ruine niederbrennen sehen müssen, das will etwas sagen, denn so lange ich dieser spezielle Mensch bin und in dieser speziellen Haut stecke, lebe ich nur, wenn ich mich entwickle, wenn das aber nicht geschieht, wenn alles in mir mit einer eisernen Faust zusammengedrückt wird, ist mein Leben nur noch ein langes, langes Sterben, und dieser Todeskampf, diese innere Wut, wenn so einzelne Blüten, schlamm- und schmutzbedeckt, wieder auftauchen, dieser Trotz, dieses Versinken in die greulichsten Untiefen der Sinnlichkeit, um den Zustand nur einmal zu vergessen, ist noch bittrer, wie der leibliche, wenn das Band zerreißt, das die Elemente zusammenhielt und nun Feuer, Wasser, Luft und Erde miteinander hadern. Ich bin ja kein Narr, der sich in innere Lücke durch ein Wenn – So – ausflickt, ich habe die Beweise meiner Kraft, denn keine Kraft geht zugrunde, was zugrunde geht, ist eben nur die Ohnmacht, gegeben und gebe sie täglich, aber die Früchte sind bitter, ich selbst schmecke den steinernen Boden, aus dem der Baum wuchs, das naßkalte Wetter und so weiter heraus, und ich fürchte sehr, dies bringt mich auch noch um das letzte Resultat meines jämmerlichen Daseins: um eine gesunde und wahrhaft bedeutende Poesie. Das Weltverachtungswesen, so sehr es sich ausspreizt, ist gar nichts und hat nicht mehr Wahrheit und Bedeutung, als eine Fieberraserei, mag man es nun bei Lord Byron, bei mir, oder wo sonst finden; O, Au und Ach ist keine Musik ...
April 1844.
... Die menschlichen Individuen, und also auch die Dichter, sind verschieden; es hat Dichter gegeben, die sich in ein Lerchennest hätten verkriechen mögen, ich gehöre nicht zu denen. Ich habe Organe für die Welt und bedarf der Welt; ich wäre, das weiß ich gewiß, bei einer freundlicheren Jugend ein ganz anderer geworden, und da sich die Grundfäden der Genesis nun einmal nicht mehr abändern lassen, so habe ich wenigstens für einen möglichst bunten und mannigfaltigen Einschlag zu sorgen, damit sich nicht alles in Nacht und Nebel verliere. Darum ist es nach so vielem Unglück das erste wahre Glück für mich und mein Talent, daß ich reisen darf, denn wenn ich mich auch niemals zu einer sogenannten heiteren Ansicht des Lebens, die auch meistens nur aus der oberflächlichen Auffassung desselben hervorgeht, erheben werde, so ist es doch etwas ganz anderes, ob man bloß die allgemein-menschlichen Schmerzen, die selbst das Auge des Apolls vom Belvedere trüben, oder ob man sie zugleich mit seinem speziellen Jammer sich herumschleppt, und dessen wird man los und ledig, wenn man aus sich selbst heraus- und in die Welt hineingerissen wird ...
2. April 1844.
Besäße ich Fausts Zaubermantel, so würde ich jetzt zu Dir eilen und Dich auf einmal aus der Hamburger Eis- und Schneeluft in den Pariser Frühling entrücken. Wundern würdest Du Dich, wenn Du säßest, wo ich jetzt sitze, in meinem Zimmer nämlich, Du würdest auf den Balkon heraustreten, Dir das ungeheure Häusermeer, von der juliwarmen Morgensonne in bleiches Gold gefaßt, betrachten und ausrufen: ich hätt es für unmöglich gehalten. Es ist auch fast unmöglich, aber es ist wirklich. In Venedig liegt noch jetzt der Schnee, in Neapel und Sizilien sind, den Zeitungen zufolge, noch ganz in der letzten Zeit Menschen verhungert, weil sie wegen der durch den strengen Winter unpassabel gemachten Wege die mildtätigen Klöster nicht erreichen konnten, und hier blühen die Bäume! Seit vorgestern ist der volle Frühling da; ein einziger Regenguß, und alles ist grün. Die Fische heben ihre Köpfe aus den Wellen empor, die Mädchen stecken sie aus den Fenstern heraus, die Glücklichen sind noch einmal so glücklich, die Unglücklichen nur halb so unglücklich, wie zuvor ...
12. April 1844.
... Jetzt bleibt denn wohl kaum etwas anderes übrig, als hierzubleiben, die Nachricht über die glückliche Ankunft des lieben Maikindes, das ich im Geist schon küsse, abzuwarten und dann die Schritte weiterzulenken ...
... Dein Brief, meine teuerste, edelste Elise, ist da, wo Du Dich über Dein Inneres aussprichst, wieder so himmlisch-schön, daß er mich beim Wiederlesen bis zu Tränen rührt. Ja, gewiß verdienst Du die Gnade der höchsten Macht, und, ob Du Dir es auch nicht selbst sagen kannst, mehr noch durch das, was Du bist, als durch das, was Du erlitten hast. Ich bin auch ganz fest überzeugt, daß sie Dir nicht fehlen wird, es wird diesmal viel besser gehen, denn Bewegung ist in einem solchen Fall von unberechenbar wohltätigen Folgen, gesund und kräftig bist Du, und das zweitemal hat vor dem erstenmal, wenn dieses nicht in die erste Blütenzeit fällt, immer viel voraus ...
Beste Elise, Du hättest meine Briefe ganz mißverstanden, wenn Du glauben könntest, daß Du Deinen Schmerz und Deine Wehmut um Dein Kind nicht gegen mich ausströmen dürftest. O, tu es viel lieber, als daß Du alles in Dich verschließest! Ich sehe, jetzt ist die Periode eingetreten, wo Du so weit gefaßt bist, als man überhaupt gefaßt werden kann, es ist nicht das verzweiflungsvolle Aufwühlen mehr, es ist die Klage, und die wird nie verstummen. Glaubst Du, ich hätte meinen Max vergessen? O Gott! Ich werfe nur immer einen Schleier über seinen Schatten, wenn er vor mir aufsteigt, denn dies kann der Mensch, aber den Schatten hervorrufen, und dann gelassen bleiben, das kann er nicht! ...
Tagebuch 16. Mai 1844.
Heute, am Himmelfahrtstag, erhalte ich zwei Briefe, einen aus Berlin und einen aus Hamburg von Elise. Jener benachrichtigt mich, daß mein neues Stück von der Intendanz abgelehnt worden ist; das Schreiben der Intendantur, lithographiert, also so gut an die Herren Töpfer, Friedrich und so weiter, als an mich gerichtet, belehrt mich, daß die Vorzüge meiner Arbeit nicht verkannt worden sind; ein Brief der Crelinger Schauspielerin. gibt mir die Versicherung, daß sie mich in allen und jeden Fällen mit der ganzen Energie ihres Willens unterstützen will, diejenigen natürlich ausgenommen, wo mir ihre Unterstützung von Nutzen sein könnte. Elise, in Erwartung ihrer nahen Krisis, schreibt mir Dinge, die mir das Herz zerreißen und umkehren; wie es nach ihrem Tode verhalten werden soll, wohin sie meine Bücher, meine Papiere getan hat, und so weiter. Edelste Seele, hast du nicht gefühlt, daß deine Liebe, die noch über ein Extrem hinaus, das, wenn es einträte, mir alles gleichgültig machte, für mich sorgen wollte, dies nicht aussprechen konnte, ohne mir bis ins Innerste wehe zu tun? Nein, nein, dies wird nicht geschehen, oder wenn – mein Gott, wie erbärmlich ist der Mensch, daß er noch eine Wahl hat!
22. Mai 1844.
Gestern bei Regenwetter bis 4 Uhr nachmittags zu Hause. Als ich ausging, fand ich unten bei dem Concierge zwei Briefe vor, die vielleicht schon lange dagelegen hatten. Sie waren von der Madame Ruschke und meinem alten vortrefflichen Schütze und brachten mir die Nachricht, die ich noch nicht erwarten durfte, der ich aber mit der höchsten Angst entgegenharrte. Elise ist glücklich und leicht von einem kleinen Sohn mit großen Augen und schwarzen Haaren entbunden; sie befindet sich wohl und kann selbst stillen! Da mir das Leben ein so großes Geschenk gemacht hat, so will ich dem Tod denn nun auch entschieden den Rücken wenden. Dem Himmel sei Dank! Noch hatte ich nur im allgemeinen, nicht im besonderen gefürchtet, und die Marterzeit der Erwartung ist vorüber, bevor sie noch recht anfing! Nun will ich ausgehen und den Mont Martre, den ich so deutlich von meinem Zimmer aus sehe, ohne ihn noch bestiegen zu haben, aufsuchen und besteigen.
22. Mai 1844.
... Willkommen sei das Kind, und doppelt willkommen der Knabe! Und dreifach preise ich mich glücklich, daß ich die Freudenbotschaft diesmal nicht erst durch Angst und marternde Erwartung habe erkaufen dürfen! Ich erwartete sie erst gegen Ende des Monats ...
Ich war diese fünf Tage hindurch, denn am 21. trafen die Briefe ein, so heiter, so in mir selbst vergnügt, daß ich eigentlich gar nicht daran dachte, meiner Freude Worte zu geben. Ich sah Dich immer mit Deinem kleinen Schwarzhaar liegen, ich sah, wie Du ihn selig betrachtetest, ich konnte mir denken, daß Du sein Gesichtchen sorgfältiger, wie ein Antiquar eine bei Herkulaneum aufgegrabene Münze, studieren würdest, um irgend eine Ähnlichkeit mit mir aufzufinden. Daß er mir nicht gleicht, ist mir so ziemlich einerlei, aber daß er auch Dir nicht gleicht, ist mir nicht ganz recht. Will er uns beschämen, und uns zeigen, daß wir alle beide nicht nach der rechten Maske gegriffen haben, als wir das Welttheater betraten? ...
Der Madame Ruschke habe ich heute geschrieben. Es ist buchstäblich wahr, daß ich aus ihrem und Schützes Brief zugleich die Nachricht entnommen habe. Es war also keiner von beiden überflüssig, und wenn die Botschaft selbst mich glücklich machte und mein Herz von seiner schwersten Last befreite, so rührte mich die Teilnahme, womit meine Freunde sie mir mitteilten, bis zu Tränen. Leider mußte ich mein Gefühl ganz in mich verschließen, da ich hier niemand habe, gegen den ich es hätte aussprechen können.
... Küsse mir den kleinen Bengel, bis er prustet und sage: das tut dein Vater! ...
14. Juni 1844.
... Ich trenne mich mehr und mehr von meiner allerdings finstern Vergangenheit los; ich überzeuge mich mehr und mehr von dem hohen und einzigen Wert des Lebens und von der Kraft des Menschen, seine Befriedigung darin zu finden, und Sie wissen, wenn die Wunden geheilt sind, so rühmt man sich der Narben, leugnet aber freilich dabei, daß man sich im Schmerz jemals ungeduldig gebärdet habe. Ich will nicht prahlen, ich will noch weniger die Färbung eines Moments für die des ganzen Lebens geben, und ich will also gleich hinzufügen, daß meine größere Ruhe nicht daher rührt, weil ich nun die fürchterlichsten Rätsel, die das Dasein aufgibt, besser zu lösen weiß, wie früher, sondern nur daher, weil ich jetzt besser verstehe, sie mir aus dem Sinn zu schlagen ...
7. Aug. 1844.
... Neuilly liegt sehr schön und besonders die große Brücke gewährt einen imposanten Anblick. Ich wandte mich, als ich sie passiert hatte, von der Straße ab und ging links an die Seine hinunter, um sie von unten zu betrachten. Ich setzte mich auf ein sich am Fluß hinziehendes hölzernes Geländer und genoß an dem heißen Sonntagnachmittag, der mich aber an dem gewählten Platz gar nicht inkommodierte, einmal die so seltene reine Freude am Dasein; Furcht und Angst, sonst so lebendig in meiner Seele, waren eingeschlafen, Begierden, ungeduldige Wünsche, die jene gewöhnlich ablösen, waren noch nicht aufgewacht, die süße Ermattung meines ganzen Wesens hielt sie zurück, und mich bewegte nichts, als der stille Gedanke, daß mich nichts bewegte. Weiße Schmetterlinge spielten um mich herum, gelbliche Blumen wiegten sich im Winde, auf dem grünen Fluß schossen Boote, von raschen Ruderern gelenkt und von Herren und Damen angefüllt, vorüber, über die Brücke spazierte oder eilte, was von Paris kam oder nach Paris wollte, ein Fabrikschornstein blies seine dicke, schwarze Rauchwolke, dem Wind entgegen, in die Luft hinaus und schloß den Prospekt. Hinter mir eine Häuserreihe mit Gärten, die sich unschuldig hervordrängten, vor mir am anderen Ufer der Seine ein waldähnlicher Park mit seinem bald helleren, bald dunkleren Laub, alles fromm und idyllisch, bis auf die famosen Anschlagszettel des Doktors Charles Albert, der sich »geheimen Kranken« empfiehlt und dessen rote Annoncen mit ihren ellenlangen Buchstaben man nicht bloß in Paris und der Umgegend, sondern schon in Rouen, ja sogar in Havre, antrifft. Ich blieb lange sitzen, dann ging ich an den Gärten vorbei und lauschte hinein. Brennende Blumen nickten mir zu, aber die Gitter, die mich am Eintritt verhinderten, machten es mir unmöglich, sie zu pflücken, doch ich tröstete mich, denn es geht mit allen Blumen so, sogar mit den inneren, auch diese sieht man lange vorher, ehe man sie zum Kranz widmen kann.
17. Aug. 1844.
Wenn ich bedenke, wie viel Güte und Liebe Sie und Ihre ganze verehrte Familie einem Menschen, den Sie gar nicht kennen und der Ihnen zu seinem großen Schmerz auch gar nichts sein kann, da ihn wenigstens bis jetzt die Verhältnisse nicht so weit begünstigt haben, Ihnen auch nur die allergeringste Gefälligkeit erzeigen zu können, schon erwiesen haben und nicht aufhören, zu erweisen, so erfaßt mich tiefe Rührung, und ich sehe hierin einen Ersatz für manches, was mir nicht ganz mit Recht auferlegt worden ist und fortwährend auferlegt wird ...
Tagebuch 3. Mai 1844.
Beifolgend, Herr Doktor Krämer, erhalten Sie den Betrag Ihrer Arztrechnung mit 20 Talern. Sie haben mir, obgleich ich mich, wie allgemein und aus den Zeitungen bekannt ist, im Auslande befinde, diese Rechnung mit beleidigender Ängstlichkeit in Zeit von fünf Monaten zweimal gesandt. Ich will Ihrer Ängstlichkeit den Namen, den sie verdient, nicht geben, aber ich will Ihnen bemerklich machen, daß man sie nur dem notorischen Bettler, kaum dem wissenschaftlichen Handwerker, verzeiht.
Ich würde Ihrer Ängstlichkeit begegnet sein, wenn ich nicht den Wunsch und die Hoffnung gehegt hätte, von Paris vor meiner Weiterreise nach Rom auf vier Wochen nach Deutschland zurückzukehren und dann bei persönlicher Bezahlung dieser Kleinigkeit noch einen ganz anderen Punkt zwischen Ihnen und mir berichtigen zu können. Aber Verhältnisse, deren Modifikation nicht von mir abhängt, scheinen mir die Realisierung dieses sehr dringenden Wunsches nicht gestatten zu wollen, und da ich, wenn ich die immer noch zweifelhafte Entscheidung abwarten wollte, in den Fall kommen könnte, von Ihnen noch eine dritte Rechnung zu erhalten, so muß ich mich in dieser Angelegenheit schriftlich äußern, die ich mündlich, Stirn gegen Stirn, mit Ihnen zu erörtern angemessener fände.
Als mein armes Kind in Todeskämpfen lag, und die Mutter, die zu Ihnen, dem von Gott und Gewissen, ja von dem Staat, verpflichteten und verantwortlichen zweiten Arzt dieses Kindes geschickt hatte, ohne daß Sie gekommen waren, sich in ihrer Verzweiflung selbst aufraffte und Sie, in Ihre Tür tretend, mit den Worten: Herr Doktor, mein Kind stirbt! zur Beschleunigung Ihres Besuches antrieb, haben Sie, nicht im Anziehen, sondern im Toilettemachen unterbrochen, sich unterstanden, mit dem Fuß zu strampfen und sie anzufahren. Das ist ein Benehmen, das sich in einer solchen Situation gegen eine Mutter, die in Angst um ihr Kind vergeht, kein Mann, er sei, wer er wolle, gestatten wird, wenn er noch einen Rest von Menschlichkeit in seiner Brust verspürt; es ist ein Benehmen, das die öffentliche Meinung sogar dem nur aus Not als Ersatzmann herbeigerufenen und sich selbst als bloßen Handwerker betrachtenden fremden Arzt, der in einem Sterbenden nur den aus der Welt gehenden Kunden eines Kollegen, der ihm nichts zu verdienen gab, erblickt, nicht ohne Verdikt hingehen lassen würd; es ist ein Benehmen, das Sie sich gegen meine Frau, die es darum nicht weniger ist, weil ich bis jetzt in der nicht bloß von der Gesellschaft, sondern bis auf einen gewissen Grad auch von der Kirche sanktionierten Form der Gewissensehe mit ihr lebe, nicht erlaubt haben sollen, ohne dafür die gebührende Strafe, zunächst durch das mündliche Bekanntmachen in einem engeren, und dann durch ein ganz anderes im weiteren und weitesten Kreise zu empfangen, wenn Sie sich nicht noch jetzt bequemen, meiner Frau schriftlich Abbitte zu tun.
Einer meiner Freunde wird Ihnen diesen Brief, den er gelesen hat, persönlich und unversiegelt überreichen, damit er später, wenn ich in den Fall komme, von der zurückbehaltenen Abschrift Gebrauch zu machen, bezeugen kann, daß Sie ihn richtig empfangen haben.
Ergebenst
Dr. Fr. H.
Tagebuch 26. Sept. 1844.
Morgens früh vorm Einpacken. Zweiundzwanzig Jahre auf einem Fleck im Dithmarschen und jetzt doch im Begriff, nach Rom zu gehen! Es ist wie ein Traum! Ich fuhr mit diesem Gedanken aus dem Schlaf auf, sprang aus dem Bett und kleidete mich an. Heute nachmittag um fünfe reise ich. Es war ein paar Tage Regenwetter, aber jetzt scheint die Sonne wieder so freundlich, als wollte sie mir die Stadt, die ich verlassen muß, noch einmal im glänzendsten Licht zeigen, damit ich sie nicht vergesse. Das ist unnötig, Paris wird immer der Mittelpunkt aller meiner Wünsche bleiben. Lebe wohl, du schöne, herrliche Stadt, die mich so gastfreundlich aufnahm! Empfange meinen wärmsten Segen! Blühe länger, als alle Städte der Welt zusammengenommen!
31. Aug. 1844.
Ich sah des Sommers letzte Rose stehn,
sie war, als ob sie bluten könne, rot;
da sprach ich schauernd im Vorübergehn:
so weit im Leben ist zu nah am Tod!
Es regte sich kein Hauch am heißen Tag,
nur leise strich ein weißer Schmetterling, doch
ob auch kaum die Lust sein Flügelschlag
bewegte, sie empfand es und verging!