
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die letzte Woche in Colombo. – Abschied von Ceylon. – Der österreichische Lloyddampfer Aglaja. – Herrliche Rückfahrt durch den indischen Ozean. – Sokotora. – Ankunft in Suez. – Rosenquelle. – Zehn Tage in Kairo. – Der große versteinerte Wald. – Vergleichung von Ägypten und Ceylon. Dattelpalme. und Kokospalme. – Englische Politik in Ägypten. – Die britische Weltherrschaft. – Rückreise von Alexandrien nach Triest. – Ankunft in Jena.
Die prachtvolle Reise durch das Hochland, die mit der Talfahrt auf dem schwarzen Flusse ihren reizenden Abschluß fand, hatte das Programm meiner wichtigsten Wünsche und Ziele auf der Wunderinsel Ceylon geschlossen, und ich mußte mich nun zur bevorstehenden Heimreise rüsten. Allerdings hätte ich sehr gern noch das interessante und besonders in zoologischer Hinsicht so reiche Trinkomalie gesehen, und auch den alten Ruinenstädten im Norden der Insel, dem berühmten Anaradjahpura und Pollanarua einen Besuch abgestattet. Aber mein halbjähriger Urlaub ging zu Ende; das letzte Lloydschiff, das mich noch rechtzeitig nach Europa zurückführen konnte, sollte schon am 11. März von Colombo abgehen, und ich will nicht Verschweigen, daß trotz allen genossenen Herrlichkeiten doch das Heimweh sich immer mehr geltend machte und die glückliche Rückkehr nach der teuren deutschen Heimat mir immer mehr das Begehrenswerteste erschien.
So begann ich denn alsbald nach der Rückkehr nach Colombo den Rest meiner Sammlungen zu packen und alle übrigen Vorbereitungen zu treffen. Einen sehr hübschen Ausflug machte ich noch mit Dr. Trimen nach Henerakgodde, einer Filiale des Peradenia-Gartens, die an der Colombo-Kandy-Bahn im heißesten Teile des feuchten Tieflandes liegt und für die Kultur derjenigen Pflanzen bestimmt ist, die den höchsten Hitzegrad des Tropenklimas verlangen. Ich sah hier Prachtexemplare von Riesenbäumen, Palmen, Lianen, Farnen, Orchideen usw., die mich nach allem Vorhergegangenen noch in Erstaunen versetzten. Ein paar sehr angenehme Tage verbrachte ich bei dem guten alten Mr. Staniforth Green und seinem Neffen in der lieblichen »Villa der Tempelbäume«; und mit besonderem Vergnügen denke ich noch an eine reizende abendliche Kahnfahrt, die ich mit denselben auf dem spiegelglatten See der Zimtgärten machte. Ein paar andre lehrreiche Tage widmete ich dem Studium des Colombo-Museums, dessen jetzt anwesender Direktor, Dr. Haly, mir auf das freundlichste die lehrreichen Schätze desselben erläuterte. Sodann machte ich eine Anzahl Abschiedsbesuche bei audren Engländern, die meine Zwecke während meines hiesigen Aufenthaltes in freundlicher Weise gefördert hatten. Mr. William Ferguson bereicherte noch am letzten Tage meine Sammlung mit einigen prachtvollen, riesengroßen Tigerfröschen ( Rana tigrina) und andren Amphibien; und Freund Both krönte die Reihe seiner zoologischen Geschenke durch einen erwachsenen »Negombo-Teufel«, das große, von den Singhalesen abergläubisch gefürchtete Schuppentier, das allein die Ordnung der Edentaten auf der Insel vertritt ( Manis brachyura). Es kostete einige Mühe, dieses zählebige Ungetüm vom Leben zum Tode zu bringen, da die Prozesse des Hängens, des Bauchaufschneidens und des Einspritzens von Karbolsäure sich durchaus ungenügend erwiesen hatten; erst eine größere Dosis Cyankalium führte das Ende herbei.
Alle freien Augenblicke, die nur das böse Geschäft des Einpackens übrig ließ, verwendete ich noch täglich auf den Genuß des geliebten Whist-Bungalow, von dessen schönsten Punkten ich noch mehrere Photographien aufnahm. Der Abschied von diesem lieblichen Paradiese und von den braven Landsleuten, deren Gastfreundschaft ich hier genossen, wurde mir natürlich besonders schwer, und ich empfand in seltener Stärke jenes drückende Gefühl, das der Trennung von einem geliebten Erdenflecke vorausgeht. Freilich wurde aber diese gedrückte Abschiedsstimmung wesentlich aufgehoben durch den einen Zukunftsgedanken: Heimwärts! In den Tropen hat dieses teuere Wort für jeden Europäer noch einen ganz andren Kang, als irgendwo in Europa. Das Gefühl, von einer glücklich beendigten und erfolgreichen Tropenreise in die geliebte Heimat zurückzukehren, läßt sich nur mit demjenigen vergleichen, mit dem der Soldat aus einem siegreichen Feldzuge heimkehrt. Ich durfte es in der Tat als ein besonderes Glück preisen, daß ich während meines fünfmonatigen Aufenthaltes in den Tropen, trotz aller Anstrengungen und Strapazen, nicht einen einzigen Tag krank gewesen war und daß ich allen drohenden Gefahren glücklich entgangen war.
Aber dieses Glück und jene Widerstandsfähigkeit haben auch ihre Grenzen, und ich hatte das instinktive Gefühl, nahe an diesen Grenzen angelangt zu sein. Die tausend wunderbaren und großartigen Eindrücke, mit denen die vier letzten Monate mich in überreichem Maße beschenkt hatten, waren fast allzu mächtig und hatten mich dergestalt übersättigt, daß ich die lebhafteste Sehnsucht nach Ruhe und Erholung empfand. Besonders während der letzten Woche in Colombo, wo zudem schon der drückende Einfluß des nahenden Monsunwechsels sich bemerkbar machte, fühlte ich mich ermatteter und mitgenommener als je zuvor. Ich sehnte mich zuletzt wahrhaft nach den kommenden ruhigen Wochen auf dem Dampfschiffe und nach der stillen Muße, die mir dasselbe zur Bewältigung jener massenhaft zusammengerafften Eindrücke gewähren würde.
Und diese erhoffte Muße, diese Sonntagsstimmung ruhigen Genusses, gewährte mir das schöne Schiff, ans dein ich von Colombo zurückkehrte, in vollstem Maße. Niemals habe ich eine schönere Seefahrt gehabt, als auf der prächtigen » Aglaja«, dem vortrefflichen Dampfer des österreichischen Lloyd, der mich in achtzehn Tagen von Ceylon nach Ägypten hinüberführte. Derselbe kam bereits von Kalkutta so schwer beladen an, daß er den größten Tiefgang hatte und daß meine Kisten in Ermangelung andren Raumes im »Rauchzimmer« untergebracht werden mußten. Selbst bei stürmischem Wetter würde das vollgeladene Schiff nur wenig geschwankt haben. Unter dem prachtvollen wolkenlosen Frühlingshimmel, dessen wir uns während der ganzen Fahrt erfreuten, den günstigen Nordost-Monsun im Rücken, war die Bewegung des Dampfers kaum wahrnehmbar, und die zehntägige Reife über den indischen Ozean, von Colombo bis Aden, glich einer heiteren Sonntagsfahrt über einen stillen Landsee.
Zu dieser großen Annehmlichkeit gesellte sich noch die andre, daß die Reisegesellschaft die willkommenste war. In der ersten Kajüte waren außer mir mir drei Passagiere, drei deutsche Landsleute, die von Kalkutta heimkehrten und mit denen ich mich vortrefflich unterhielt. Der alte Kapitän, Herr N., war der liebenswürdigste, den ich je getroffen habe, und dabei ein humoristischer Philosoph, der alle Lebensweisheit von Sokrates und Aretschi in sich vereinigte. Das schöne Geschlecht war auf dem ersten Platze gar nicht vertreten, was die Bequemlichkeit unsrer Fahrt nicht wenig erhöhte. Verzeihe mir, gütige Leserin, dieses frevelhafte Geständnis! Sowohl wir vier Passagiere, als die freundlichen Schiffsoffiziere, mit denen wir unsre Mahlzeiten teilten, genossen die mancherlei Vorrechte, die uns die gänzliche Abwesenheit der Damen erteilte, in ausgiebigster Weise, und wir kamen während der ganzen Fahrt aus dem angenehmsten indischen Negligé nicht heraus. Weder Halskragen noch Krawatte schnürten unsre Kehle ein; bequeme gelbe indische Hausschuhe ersetzten die schwarzgewichsten Stiefel, und das ganze übrige Kostüm bestand aus jener unvergleichlich leichten und angenehmen weißen Baumwollenkleidnng, die in Indien als »Pundjama« allgemein üblich ist.
Von entzückender Schönheit waren die Nächte während dieser Fahrt. Wir schliefen stets oben auf dem Verdeck, von der mildesten tropischen Seeluft umspült, unter den: tiefdunkeln Zeltdache des reinen Firmamentes, von dem die Sterne in unübertroffener Pracht herabfunkelten. Ich lag oft stundenlang in der Nacht wach und atmete mit vollstem Behagen die balsamische kühle Brise ein, im Vollgenusse des paradiesischen Friedens, der achtzehn Tage lang weder durch Briefe noch durch Korrekturen, weder durch Studenten noch durch Pedelle gestört wurde. Pflichtschuldigst bewunderte ich sodann allnächtlich den »milden Glanz des südlichen Kreuzes« und lange Zeit schaute ich oft in das funkelnde Kielwasser hinab, das hinter dem Schiffe einen langen feurigen Schwanz bildete, aus taufend leuchtenden Medusen, Krebschen, Salpen und andren Leuchttieren des Meeres zusammengesetzt.
Tagsüber beschäftigte mich größtenteils das Ordnen und Ergänzen meiner Reisenotizen und Aquarellskizzen; und wenn ich des Schreibens, Malens und Lesens müde war, wanderte ich hinüber auf den zweiten Platz, wo eine indische Menagerie von Affen, Papageien, Waldtauben und andren Vögeln uns unerschöpfliche Unterhaltung bot. In meiner eigenen kleinen Menagerie war das Interessanteste ein Halbaffe von Belligemma ( Stenops gracilis); ein höchst amüsanter kleiner Geselle, dessen fabelhafte Turnkünste wir jeden Abend in der Kajüte bewunderten.
Von den Einzelheiten unsrer Rückreise ist wenig zu berichten. Am 10. März, mittags 12 Uhr, hatte ich nach herzlichsten: Abschiede von den Bewohnern des Whist-Bungalow Colombo verlassen. Am 12. passierten wir die Malediveninseln und fuhren ziemlich nahe an den Kokoswäldern des Koralleneilandes Minikoi vorüber. An: 18. morgens steuerten wir längs der malerischen Küste der großen Insel Sokotora hin, von deren zerklüfteten: Gebirgsrücken sich mächtige schneeweiße Sandfelder, Gletschern ähnlich, in das Meer senken. Am 20. abends langten wir in Aden an. Da wir jedoch wegen der fortbestehenden Choleraqnarantäne keine Pratika erhielten, dampften wir schon um 9 Uhr weiter, in das Rote Meer hinein. Am 21. März passierten wir das Tränentor, Bab et Mandeb, und am 22. die Guanoinsel Geb et Tebir. Ungeheure Massen von braunen Seeraben oder Kormoranen umschwärmten hier unser Schiff. Am 25. morgens überschritten wir, dem Kap Berenici gegenüber, den Wendekreis des Krebses, fuhren am 27. längs der Sinaiküste hin und ankerten am 28. in der Morgenfrühe auf der Reede von Suez.
Da ich noch ein paar freie Ferienwochen vor mir hatte und von Alexandrien jede Woche mehrmals Fahrgelegenheit nach Europa fand, beschloß ich vierzehn Tage in Ägypten zu bleiben, hauptsächlich, um den schroffen Wechsel des Klimas zu vermeiden, den gerade zu dieser Jahreszeit die plötzliche Ubersiedelung aus dem heißen Indien nach dem kalten Nordeuropa mit sich bringt. Auch reizte mich der Gedanke, die Natur von Unterägypten, die mir bei meinem erster: Besuche, vor neun Jahren, so sehr imponiert hatte, mit meinen indischen Eindrücken zu vergleichen. Und dieser Vergleich war in der Tat lohnend: denn es kann kaum einen größeren Gegensatz irr jeder Beziehung zwischen zwei Ländern der heißen Zone geben, als den Kontrast zwischen Ceylon und Ägypten.
Ich verließ demnach am Morgen des 28. März die treffliche »Aglaja« nach herzlichem Abschiede von den freundlichen Reisegefährten. Am folgenden Tage machte ich von Suez zu Esel eine Exkursion nach der »Mosesquelle«, einer interessanten kleinen Oase in der arabischen Wüste, einige Stunden östlich vorn Eingang in den Suezkanal.
Am 30. März fuhr ich auf der Eisenbahn in neun Stunden von Suez nach Kairo, wo ich in dem freundlichen deutscher! »Hotel du Nil« meine Wohnung nahm. Zehn Tage in Kairo, diesem »Märchen aus tausend und Einer Nacht«, benutzte ich, teils um die schönen Erinnerungen meines ersten Besuches aufzufrischen, teils um dieselben durch einige neue Exkursionen zu ergangen. Unter diesen war mir besonders ein weiterer Ausflug in die Wüste von Interesse, nach dem sogenannten » großen versteinerten Walde«. Unter der sachkundigen Führung eines freundlichen deutschen Landsmannes, des seit lange in Kairo ansässigen Apothekers und Botanikers Sickenberger, brach ich in Gesellschaft mehrerer andrer deutscher Landsleute am 5. April, früh 6 Uhr, dorthin auf. Wir hatten uns alle gut mit Proviant und mit recht tüchtigen Eseln versehen, da der Ritt hin und zurück einen vollen Tag in Anspruch nimmt. Der Weg führte uns gegen Osten, zuerst durch die wunderbare Totenstadt der Kalifengräber, weiterhin längs der nördlichen Abhänge des Mokkatamgebirges hin. In vier Stunden scharfen Trabes mitten durch die Sandwüste hatten wir unser Ziel erreicht. Mitten in der pflanzeuarmen Wüste liegen hier, zwischen deren Sandhügel versteinert, eine große Menge stattlicher Baumstämme von 70-90 Fuß Länge, 2-3 Fuß Durchmesser. Die meisten gehören einen: Balsambaume ( Nicolia) aus der Familie der Sterkuliazeen an. Die Mehrzahl der Stämme sieht glänzend schwarzbraun oder rotbraun, wie poliert aus, und ist in Stücke von zwei bis sechs Fuß Länge zerbrochen, die im Sande halb vergraben, zum Teil aber auch ganz frei hintereinander liegen. Am zahlreichsten sind sie in der Nähe des Kohlebrunnens ( Bir el Fahme), eines sechshundert Fuß tiefen Schachtes, den Mohammed Ali 1840 hier mitten in der Wüste graben ließ, in der vergeblichen Hoffnung, Kohlen zu finden.
Den Rückweg vom versteinerten Walde nahmen wir durch das Wadi-Dugla, ein großartiges und malerisches Felsental, durch das die nach Mekka bestimmte Pilgerkarawane von Kairo nach Suez zieht. In den mannigfachen Schlangenwindungen dieser wilden Schlucht, deren nackte gelbweiße Felseinwände beiderseits fast senkrecht emporsteigen, ritten wir mehrere Stunden abwärts, ehe wir wieder das Niltal erreichten, zwischen Wadie-Turra südlich und den Mokkatam-Höhen nördlich. Erst spät abends trafen wir wieder in Kairo ein.
Dieser Wüstenritt, der einen recht guten Einblick in den Charakter der arabischen Wüste gewährt, regte mich lebhaft zu Betrachtungen über den merkwürdigen Gegensatz an, in dem die ganze Natur von Unter-Ägypten zu derjenigen von Ceylon steht. Dieser ungeheure Kontrast betrifft in erster Linie das Klima und die Vegetation, in zweiter Linie aber auch die gesamte übrige Natur und die Menschenwelt. Während der alte Meeresboden, der jetzt die gelbe ägyptische Wüste bildet, reich an schönen Versteinerungen ist, die sein verhältnismäßig jugendliches geologisches Alter bezeugen, ist der uralte Felsenleib des grünen Ceylon aus Urgestein gebildet, in dem Versteinerungen vollständig fehlen. Während dort die größte Trockenheit der Atmosphäre kaum den dürftigsten Pflanzenwuchs gestattet, bedingt hier die vollkommene Feuchtigkeit der Luft eine Üppigkeit der Vegetation, die von keinem andren Teile der Erde übertroffen wird. Heftige atmosphärische Niederschläge, die dort sehr selten sind, gehören hier zu den alltäglichen Ereignissen. Die täglichen Temperaturschwankungen find dort bekanntlich so groß, daß sie nicht selten gegen.30° R betragen: mitten in der Wüste bildet sich in der Nacht bisweilen eine dünne Eiskruste, während um Mittag das Thermometer im Schatten auf 35° und mehr steigt. Im heißen und dampfenden Treibhausklima der Lüste von Ceylon sind umgekehrt jene Schwankungen so gering, daß sie gewöhnlich nur 4-5° betragen (21-26° R).
Nicht minder auffallend als diese extreme Verschiedenheit in bezug auf Boden, Klima und Vegetation ist diejenige der Menschenwelt, die diese beiden Länder bewohnt. Dort in Ägypten die lauten und lebhaften Araber mit ihrem unverschämten, aufdringlichen und anmaßenden Charakter, fanatische Mohammedaner von hamitischer Rasse: hier in Ceylon die sanften und stillen Singhalesen, indolente Buddhisten von arischem Ursprunge, mit durchaus friedlichem, bescheidenem und furchtsamem Wesen. Während Ägypten mit seiner einzigen zentralen Lage, mitten zwischen drei alten Weltteilen, seit uralter Zeit die größte Rolle in der Völkergeschichte gespielt hat und der Zankapfel der mächtigsten Nationen, der Spielball der heftigsten Leidenschaften gewesen ist, hat das stille Paradies von Ceylon gleichsam außerhalb der großen Kulturgeschichte gestanden, und seine politische Geschichte hat niemals ihre lokale Bedeutung überschritten.
Als botanisches Symbol dieses merkwürdigen Gegensatzes kann ein einziger Baum dienen. In Ägypten wie in Ceylon ist es eine Palmenart, die an national-ökonomischer Bedeutung alle andren Produkte der Pflanzenwelt übertrifft: dort die Dattelpalme, hier die Kokospalme. Obgleich nun diese beiden edlen Gaben der Flora fast gleich hohen Wert besitzen und jeder einzelne Teil derselben seine Nutzanwendung hat, so ist diese doch im einzelnen ebenso verschieden, wie der äußere Charakter beider Palmen und ihre Bedeutung für die Landschaft. In der ägyptisch-arabischen Landschaft ist die Dattelpalme ebenso unentbehrlich, wie die Kokospalme in der Küstenlandschaft von Ceylon.
Der Nordländer, der die Alpen überschreitet und in Italien zum ersten Male die Dattelpalme kennen lernt, bewundert sie als ersten Vertreter der edlen Palmenfamilie; und diese Bewunderung steigt noch, wenn er weiter südwärts nach Ägypten kommt und hier dieselbe massenhaft in viel vollkommenerer Form vorfindet. So hatte auch ich selbst sie früher mit besonderer Andacht verehrt.
Wie anders jetzt, wo die ungleich edlere und vollendetere Form der Kokospalme sich mir in Ceylon so fest eingeprägt hatte, daß ich die Dattelpalme daneben unansehnlich fand! Der schlanke, glatte und weiße Stamm der Kokos ist stets anmutig gebogen und erhebt sich gewöhnlich zu der doppelten Höhe des plumpen, struppigen, graubraunen Stammes der steifen Dattel. Und ebenso übertreffen die mächtigen, schön geschwungenen, gelblich grünen Fiederblätter der Lotos an Größe und Schönheit um mehr als das Doppelte die steifen und starren, graugrünen Wedel der Dattel. Der ganze malerische Wert der Kokos übertrifft denjenigen der Dattel in ähnlichem Verhältnisse, wie die mächtige, kopfgroße Nuß der ersteren die kleine, unansehnliche Frucht der letzteren.
Während der Osterwoche, die ich in Kairo zubrachte, warfen die großen politischen Umwälzungen in Ägypten, deren Zeuge wir gegenwärtig sind, ihren Schatten bereits voraus. Der Haß der Ägypter gegen die Europäer, durch fanatische mohammedanische Priester aufgestachelt, machte sich wiederholt in Angriffen geltend. Ich selbst wurde zweimal insultiert, einmal durch einen Derwisch beim Besuche der Moschee el Abka, der Universität von Kairo; das andre Mal durch einen Soldaten, während ich am Nilufer saß und eine Skizze aufnahm. Nur durch einen günstigen Zufall entging ich beide Male dem Schicksale, noch am Ende meiner Reise in ernstliche Lebensgefahr zu geraten. Ein englischer Maler war kurz zuvor beim Zeichnen der Kalifengräber, ebenfalls ohne jede Veranlassung, von einem Soldaten angegriffen und gefährlich verwundet worden. Die englische Regierung hätte viel erspart, wenn sie frühzeitiger mit Energie eingegriffen hätte. Man sagte scholl damals, daß Arabi Pascha diese Konflikte systematisch fördere. In diesem ehrgeizigen Soldaten verkörpert sich die Todfeindschaft des Islam gegen europäische Kultur. Er vor allen verschuldete die Greuel des Aufstandes, der bald nach meiner Abreise in Ägypten ausbrach und so schwere Folgen nach sich zog. Wie mußte ich daher erstaunen, als nach Unterdrückung des letzteren die englische Regierung aus Rücksichten der »höheren Politik« (– oder vielleicht aus Dankbarkeit? –) Arabi Pascha nicht allein der wohlverdienten Todesstrafe entzog, sondern ihn zur lebenslänglichen Verbannung in das Paradies von Ceylon begnadigte! Fürwahr eure harte Strafe!
Da gegenwärtig vielfach die Erfolge der Engländer in Ägypten mit mißgünstigen Augen angesehen werden, will ich hier meine entgegengesetzte Ansicht nicht verhehlen. Mir scheint, daß wir dieselben eher sympathisch begrüßen sollten, ebenso vom Standpunkte der allgemeinen Humanität als von demjenigen eurer vernünftigen Politik. Die Ägypter selbst sind noch weit davon entfernt, ein modernes Kulturvolk zu sein, und so lange der Islam seinen kulturfeindlichen, lähmenden Einfluß ausübt, ist daran auch nicht zu denken.
Anderseits liegt das Land selbst so mitten an der großen Weltstraße zwischen Orient und Occident, und speziell am direkten Wege von England nach Indien, daß Großbritannien den Besitz des Suezkanals nicht mehr entbehren kann, will es seine großartige Weltherrschaft aufrecht erhalten. Diese letztere selbst verdient Bewunderung. Denn die Engländer verstehen es weit besser, als alle andren Nationen, Kolonien zu gründen und zu verwalten. Gerade die eigene Anschauung, die ich auf dieser Reise sowohl in Bombay als in Ceylon von der englischen Kolonialherrschaft erhielt, hat meine aufrichtige Bewunderung derselben erhöht. Nur dadurch, daß Großbritannien das ungeheure indische Reich ebenso zweckmäßig als wohlwollend regiert, vermag es mit einer unverhältnismäßig geringen Beamtenzahl dasselbe sich zu erhalten.
Statt daher die Erweiterung und Verstärkung der britischen Weltherrschaft grollend mit den Augen des Neides anzusehen, sollten wir von ihrer klugen Politik lernen, deren Erfolge der ganzen zivilisierten Menschheit zugute kommen. Hätte Deutschland, dem Beispiele des stammverwandten England folgend, rechtzeitig Kolonien gegründet, wie anders könnte der veredelnde Einfluß der deutschen Kultur sich in der Welt geltend machen; wie viel größer würde unser Vaterland dastehen!
Meine Rückreise von Ägypten nach Triest verlief ohne erwähnenswerte Erlebnisse. Ich verließ morgens am 12. April auf dem österreichischen Lloyddampfer »Castor« den Hafen von Alexandrien und traf am 18. April morgens wohlbehalten in Triest wieder ein. Hier fand ich bei meinen lieben alten Freunden das herzlichste Willkommen. Dann eilte ich über Wien direkt nach Jena. Eine schmerzliche Neuigkeit ereilte mich unterwegs, der Tod meines hochverehrten Freundes und Meisters Charles Darwin, dem ich erst vor wenigen Monaten, am 12. Februar, auf dem Gipfel des Adams-Pik einen Glückwunsch zu seinem 73. Geburtstag geschrieben hatte!
Am 21. April, nachmittags 5 Uhr, traf ich glücklich und wohlbehalten in meinem lieben alten Jena wieder ein. Da ich meine Ankunft erst auf den folgenden Tag angemeldet hatte, überraschte ich meine teure Familie und genoß nach schwerer halbjähriger Trennung das glücklichste Wiedersehen. Mit Dank gegen das gütige Geschick, das mir noch so spät die Erfüllung meines sehnlichsten Jugendwunsches gewährt hatte, zog ich wieder in das traute Daheim ein, reich beladen mit Schätzen von Erinnerungen, die mir für meine ganze übrige Lebenszeit eine unerschöpfliche Quelle des Genusses und der Erkenntnis bleiben werden!
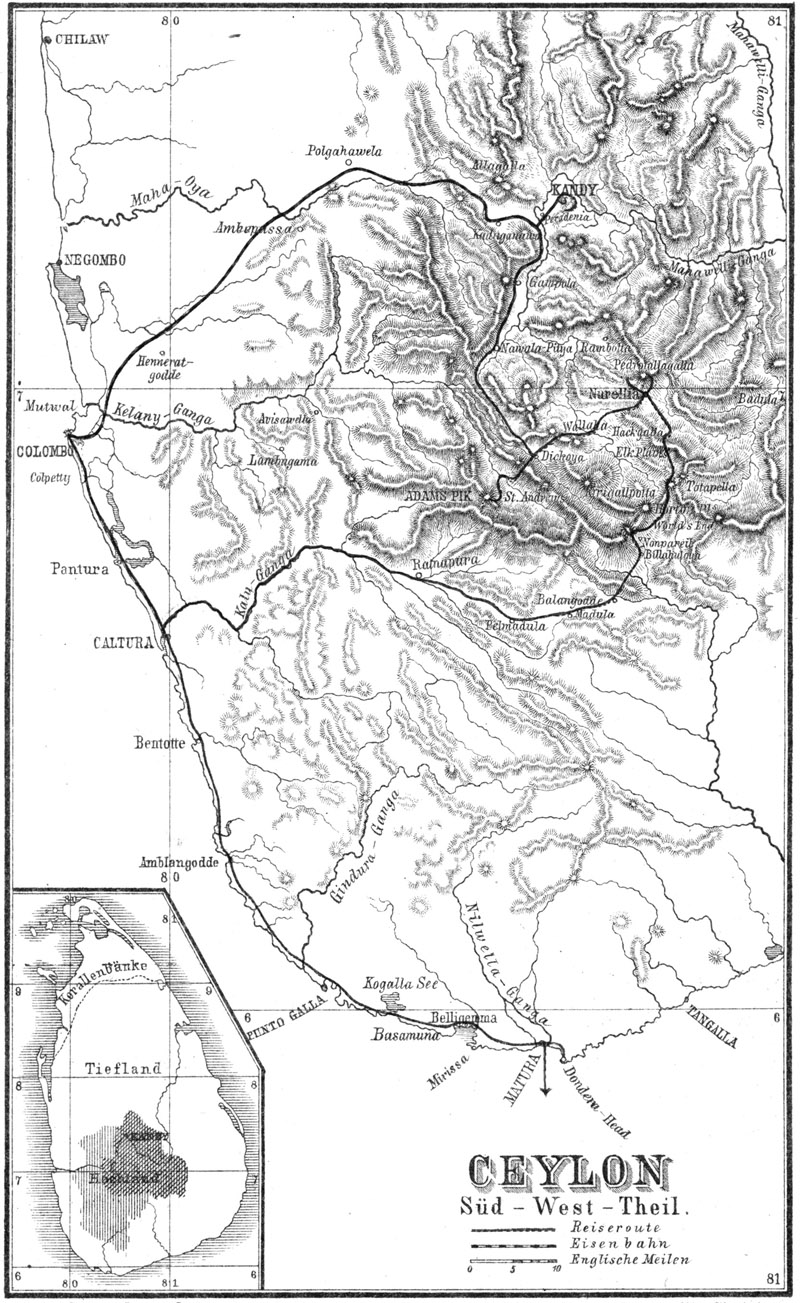
Druck von G. Bernstein in Berlin.
Erklärung der Illustrationen zu den Indischen Reisebriefen.
[Die Erklärungen wurden zu den Bildern gestellt.
Der Urheberrechtshinweis unter den jeweiligen Bildern lautet: Verlag von Gebrüder Paetel in Berlin. Reprod. Albert Frisch, Berlin Re. für Gutenberg]
Sämtliche zwanzig Bilder beziehen sich auf Landschaft und Bewohner der Insel Ceylon: die Landschaften sind nach Aquarellskizzen des Verfassers, die Personen nach Photographien in Lichtdruck ausgeführt.