
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die ersten Tage der Ueberfahrt brachten entsetzliche Leiden, die Kälte in der offenen Zelle war fast nicht mehr zu ertragen, der Schlaf in der Hängematte beinahe eine Unmöglichkeit. Ich erhielt als Nahrung die Ration der Sträflinge, in Konservenbüchsen serviert. Tags hatte ich einen eigenen Wächter, der mich nicht aus den Augen lassen durfte, nachts wurden mir zwei Wärter mit Revolver an der Seite beigegeben, denen streng verboten war, ein Wort mit mir zu wechseln.
Nach dem fünften Tag durfte ich unter doppelter Bewachung eine Stunde auf der Kommandobrücke zubringen, nach dem achten Tage wurde die Temperatur milder, dann sehr warm. Ich fand heraus, daß wir uns dem Aequator näherten; wohin die Fahrt ging, wußte ich aber immer noch nicht.
Nach einer vierzehntägigen, unsäglich traurigen Ueberfahrt langten wir am 12. März 1895 in der Rhede der Salut-Inseln an, ich ahnte, wo wir uns befanden, da ich hie und da einmal ein Wort der Wärter aufgefangen hatte, die sich darüber unterhielten, wo sie stationiert sein würden. Sie nannten dabei öfters Oertlichkeiten von Guayana.
Ich hoffte so sehr, daß man mich sogleich ausschiffen werde. Aber vier Tage lang mußte ich in meiner Zelle in einer wahren Bruthitze aushalten, ohne auch nur die Brücke betreten zu dürfen, denn man war auf mein Kommen auf der Insel gar nicht vorbereitet gewesen und mußte nun in aller Eile alles organisieren.
Am 15. März vertauschte ich die Zelle im Schiff mit einer Zelle für Galeerensträflinge auf der Königsinsel und wurde dort einen Monat in strengster Einzelhaft gehalten. Am 13. April endlich kam ich nach der Teufelsinsel, einem kahlen Felsen, auf dem man früher die Aussätzigen interniert hatte.
Die Salut-Inseln bestehen aus drei kleinen Inseln: der Königsinsel, wo der oberste Kommandant der Verbrechercolonie seinen Sitz hat, der Insel Sanct Joseph und der Teufelsinsel.
Ich stand dann von dem Augenblick meiner Ankunft bis 1895 unter folgenden Vorschriften:
Die mir angewiesene Behausung aus Stein maß vier Meter im Geviert und hatte vergitterte Fenster. Die Thüre hatte eine einfach vergitterte Oeffnung, welche auf einen Vorraum von 2 Meter Breite und 3 Meter Länge ging und dieser Vorraum war durch eine schwere massive Holzthüre abgeschlossen. Dort war ein Wächter stationiert, der alle zwei Stunden abgelöst wurde. Weder Tag noch Nacht durfte man mich aus den Augen verlieren, und ich hatte zu diesem Zweck sogar nachts Licht in meiner Zelle.
Plan meiner ersten Zelle vor Errichtung der Pallisade
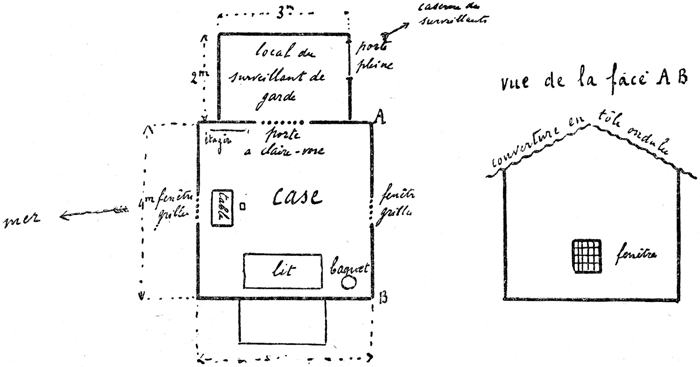
Gegen Westen die See ( mer), dahin geht ein vergittertes Fenster ( fenêtre grillée), dem ein gleiches in der entgegengesetzten Wand entspricht. An der Südwand stehen das Bett ( lit) und die Toilette ( baquet), unter dem westlichen Fenster der Tisch ( table), in der nordwestlichen Ecke das Regal ( étagère); dann führt die durchbrochene Thüre ( porte à claire-voie) nach dem Wachtraum ( local de surveillant), von wo aus die massive Thüre ( porte pleine) nach der Caserne der Wärter geht. Die zweite Figur ist der Aufriß meiner Zelle und zwar die Façade AB; das Dach ist mit welligen Ziegeln bedeckt, unten das Fenster ( fenêtre).
Nachts wurde die Vorraumthüre von innen und außen geschlossen, so daß alle zwei Stunden, bei der Ablösung, ein infernalisches Geräusch von Schlüsselrasseln und Eisenklirren entstand.
Fünf gewöhnliche Wärter und ein Oberwärter hatten den Dienst bei mir. Unter Tags war mir gestattet, mich auf einem Raum von circa 200 Quadratmetern, von der Landungsstelle bis zu dem Thälchen, in welchem früher das Campement der Aussätzigen gewesen, frei zu bewegen; ich durfte diese Grenze nicht überschreiten, wenn ich nicht riskieren wollte, Zellenhaft zu bekommen. Auch auf dem Spaziergang wurde ich von meinem Wärter auf das schärfste bewacht, man hatte ihn mit einem Revolver, später noch mit Gewehr und Patronengürtel ausgerüstet. Es war mir officiell untersagt worden, irgend einen Menschen anzureden.
Zuerst bekam ich die Ration der Colonialtruppen ohne Wein, ich mußte mir selber kochen und überhaupt mich in jeder Beziehung allein bedienen.
Die folgenden Blätter sind eine vollständige Wiedergabe des Tagebuches, das ich in der Zeit vom April 1895 bis zum Oktober 1896 für meine Frau niederschrieb. Dieses Tagebuch wurde mit allen übrigen Papieren 1896 confisciert und gelangte nie in die Hände meiner Frau. Ich erhielt es erst beim Proceß in Rennes 1899 wieder.
Die Teufelsinsel bei meiner Ankunft
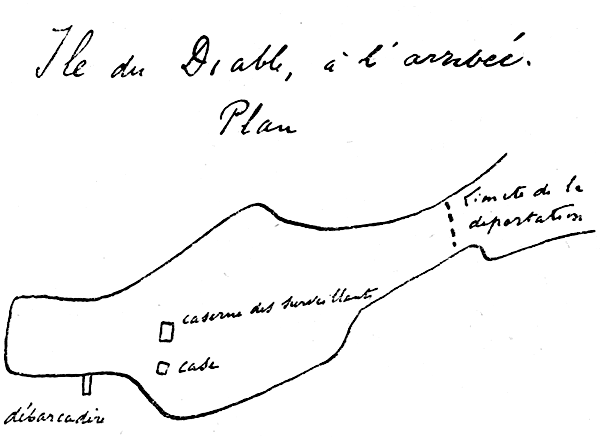
Im Südwesten die Landungsstelle ( débarcadère), etwas mehr östlich meine Zelle ( case) und nördlich davon die Caserne der Wärter ( caserne des surveillants). Im Osten die punctierte Linie die Grenze des Deportationsterrains.
(Für meine Frau bestimmt.)
Salut-Inseln.
Sonntag, 14. April 1895.
Mit dem heutigen Tage will ich beginnen, ein Tagebuch über mein elendes Leben zu führen, denn erst heute erhielt ich Papier, freilich numerierte und gezeichnete Blätter, damit ich ja keines unterschlagen könne. Ich bin auch verantwortlich für die Art und Weise, in der ich es verwende. Was in aller Welt sollte ich denn mit dem Papier anstellen können? Wem sollte ich es übergeben? Kann ich dem Papier Geheimnisse anvertrauen? Rätsel über Rätsel.
Bis dahin hatte ich die Ueberzeugung gehabt, daß allen Erscheinungen logische Ursachen zu Grunde liegen, ich habe auch an die menschliche Gerechtigkeit geglaubt. Alles, was außerordentlich und extravagant war, war mir nur schwer verständlich. Nun stürzt alles zusammen, mein Glaube und das Vertrauen in meinen gesunden Menschenverstand.
Was habe ich für schreckliche Monate hinter mir und wieviele traurige Monate erwarten mich noch?
Ich war entschlossen gewesen, mich nach meiner Verurteilung zu töten. Wenn ein Mensch, dem seine Ehre über alles geht, daraufhin des schändlichsten Verbrechens schuldig befunden wird, daß man ein Schriftstück fand, dessen Schrift meiner ähnlich oder nachgemacht war, so geht es sicherlich fast über Menschenkraft, ein derartiges Unrecht zu ertragen. Da war es meine Frau in ihrer unwandelbaren Liebe, in ihrem unerschütterlichen Mut, die mich überzeugte, daß ich gerade, weil ich unschuldig war, stand halten müsse und meinen Posten nicht verlassen dürfe. Ich empfand ja schon, daß sie recht hatte, aber andererseits fürchtete ich mich – ja, ich kann es nicht leugnen, ich fürchtete mich – vor den unsäglichen moralischen Qualen, die mir bevorstanden. Ich fühlte mich körperlich stark, und das Bewußtsein meines reinen Gewissens verlieh mir übermenschliche Kräfte. Aber die körperlichen und seelischen Qualen zusammen waren doch viel schlimmer, als ich sie mir in meinen düstersten Befürchtungen vorgestellt, und heute bin ich ein an Leib und Seele gebrochener Mann.
Ich habe den flehentlichen Bitten meiner Frau Gehör gegeben, ich habe also den Mut zum Leben gehabt! Zuerst habe ich die unerhörteste Züchtigung ertragen, die über einen Soldaten verhängt werden kann, eine Züchtigung, die schlimmer ist, als hundertfacher Tod. Schritt für Schritt bin ich meinen Leidensweg durch das Gefängnis der Santé in dasjenige der Insel Ré gegangen, bis ich hier anlangte. Ich ertrug, ohne mit der Wimper zu zucken, Beschimpfungen und Rachegeheul, aber auf jeder Station habe ich ein Stück meines Herzens zurückgelassen.
Mein Gewissen stützte mich, meine Vernunft sagte mir, die Wahrheit wird triumphierend ans Licht kommen; in einem Jahrhundert, das so fortgeschritten ist, wie das unsrige, muß die Wahrheit auch bald erkannt werden. Aber ach, jeder Tag brachte eine neue Enttäuschung. Es wurde nicht Licht, und in der Welt that man das Menschenmögliche, damit es nicht Licht werden konnte.
Ich wurde und werde immer noch vollkommen isoliert gehalten, meine Correspondenz wird überall gelesen und im Ministerium controliert und oft überhaupt nicht abgeliefert. Man hatte mir sogar verboten, meiner Frau irgendwelche Ratschläge über die Mittel und Wege, die zu unserem Ziele führen könnten, zu geben. Es wurde mir unmöglich gemacht, mich zu verteidigen.
Ich dachte, daß ich, wenn ich erst einmal in der Verbannung sein würde, wenn auch nicht Ruhe – die wird mir nicht werden, solange mir meine Ehre nicht wiedergegeben ist – so doch einen gewissen Frieden für meinen Geist und für mein tägliches Leben finden werde, die mir die Zeit des Wartens erträglich machen könnte. Wieder eine neue bittere Enttäuschung!
Nachdem ich vierzehn Tage lang in meinem Käfig die Ueberfahrt ertragen mußte, hatte ich auch noch vier Tage bei tropischer Hitze in meine Zelle eingesperrt, ohne auch nur die Brücke betreten zu dürfen, in der Rhede der Salut-Inseln ausharren müssen. Mir war, als fließe mein Gehirn auseinander und als löse sich mein ganzes Wesen in eine unsagbare Verzweiflung auf.
Bei meiner Ausschiffung wurde ich ins Zuchthaus gebracht, sogar die Jalousieen öffnete man nicht, zu keinem Menschen durfte ich eine Silbe äußern, ich war allein mit den quälenden Gedanken, gehalten, wie ein Sträfling. Meine Correspondenz mußte erst nach Cayenne geschickt werden, ich weiß nicht einmal, ob sie angekommen ist.
Einen langen Monat blieb ich in dieser Weise in meiner Zelle eingesperrt, ohne daß ich auch nur hätte frische Luft schöpfen dürfen, und ich hatte doch eben erst die furchtbare Ueberfahrt hinter mir, die mich zu Tode erschöpft. Oft war ich nahe daran, verrückt zu werden, ich hatte Congestionen nach dem Gehirn, und mir graute so sehr vor dem Leben, daß ich ernstlich erwog, ob ich nicht dadurch den Tod herbeiführen wolle, daß ich jede Nahrung zurückwies. Das wäre die Erlösung gewesen, das Ende meiner Leiden, und ich wäre eines natürlichen Todes gestorben, da ich ja nicht Hand an mich gelegt hätte.
Aber auch in diesen Augenblicken richtete mich die Erinnerung an meine Frau, das Pflichtgefühl ihr und den Kindern gegenüber wieder auf: ich wollte nicht meinerseits ihren Anstrengungen entgegenarbeiten und sie auf diese Weise verlassen, während sie ihre Mission erfüllt und nach dem Schuldigen sucht. Ich ließ auch den Arzt rufen, so sehr mir jedes neue Gesicht verhaßt ist.
Als die dreißig Tage der Einzelhaft vorüber waren, wurde ich endlich nach der Teufelsinsel gebracht, wo ich doch eine scheinbare Freiheit genoß. Ich kann mich während des Tages auf einer Fläche von einigen hundert Quadratmetern in Begleitung eines Wärters frei bewegen; beim Einnachten (so zwischen 6 und 6½ Uhr) schließt man mich in ein Gemach von circa 4 Quadratmetern Flächenraum, das durch eine vergitterte Thüre abgeschlossen wird, durch welche ich von den Wärtern controliert werde. Die Wärter werden alle zwei Stunden abgelöst.
Es sind ein Oberwärter und fünf Wärter zu meiner Bewachung da; die Ration besteht aus einem halben Brot per Tag, 300 Gramm Fleisch, dreimal die Woche, sonst Conservenfleisch oder geräucherten Speck; als Getränk Wasser.
Diese Existenz unter beständiger Ueberwachung, beständiger Verdächtigung, ist beinahe unerträglich für einen Menschen, der seine Ehre so hoch hält, wie irgend wer auf der Welt.
Immer noch keine Nachricht, also drei Wochen lang, von Frau und Kindern, und doch weiß ich, daß seit dem 29. März Briefe für mich in Cayenne liegen. Ich ließ nach Cayenne telegraphieren, ließ ein Telegramm nach Frankreich schicken, um Nachrichten von den Meinigen zu erhalten – keine Antwort.
Ah, wie heiß wünsche ich, zu leben bis zu dem Tag, an dem ich rehabilitiert sein werde, um die Kunde von meinem Leiden in die Welt hinaus zu schreien, um mein zerrissenes Gemüt zu entladen. Werde ich das erleben? Ich zweifle oft daran, denn mein Herz ist gebrochen und meine Gesundheit schwankend.
Sonntag Nacht, vom 14.–15. April 1895.
Ich kann nicht schlafen. Vor meinem Käfig wandelt wie ein Gespenst, das in meine Träume hineingreift, der Wachtposten, die Haut juckt mir von all dem Ungeziefer, das sich an mich gemacht, dumpf grollt in meinem Herzen die Empörung darüber, daß ich mich in einer solchen Lage befinde, ich, der ich immer und überall meine Pflicht gethan; das alles spannt meine überreizten Nerven aufs äußerste an und vertreibt den Schlaf. Wann werde ich wieder einmal eine ruhige, friedliche Nacht haben? Vielleicht erst im Grabe, wenn der ewige Schlaf mich umhüllt. Wie wird das wohlthun, wenn man nicht mehr an die Gemeinheit und Feigheit der Menschen zu denken braucht.
Draußen brüllt unter meinem Fenster die See, und das klingt mir wie ein Zauberlied. Sie wiegt, wie einstmals, meine Gedanken leise ein, aber heute sind diese Gedanken traurig und düster. Und wenn sie so rauscht, so steigt die Erinnerung an vergangene, glückliche Stunden vor mir auf, die ich mit meiner Frau und meinen Kindern verlebt.
Wieder erfaßt mich die intensive Empfindung, die ich schon auf dem Schiffe gegenüber dem Locken der See hatte, da mir war, als müßte sie mich zu sich ziehen, und als riefen mir ihre brüllenden Wasser Trostesworte zu.
Ich stehe so sehr unter dem Bann der See, daß ich auf dem Schiff die Augen schließen und mir das Bild meiner Frau in die Erinnerung zurückrufen mußte, um nicht dem Locken nachzugeben.
Was ist aus meinen Jugendträumen und aus den Hoffnungen meiner Mannestage geworden? Alles in mir ist tot, und die Anstrengung des Denkens verwirrt mein Gehirn. Wo nur ist der Schlüssel zu dieser Tragödie? Noch heute verstehe ich nicht, was vorgegangen ist. Verurteilt werden, ohne faßbare Beweise, auf ein Schriftstück hin! Ein Mensch kann noch so stark, noch so reinen Herzens sein, das ist mehr, als nötig wäre, ihn aus der Fassung zu bringen.
Meine Nerven sind durch meine Leiden so sensitiv geworden, daß jeder, auch nur rein äußerliche Eindruck mich verwundet.
In der selben Nacht.
Ich hatte versucht zu schlafen, ich schlummerte ein wenig, erwachte dann aber mit hohem Fieber; und so geht es seit einem halben Jahre jede Nacht. Wie konnte mein Körper dieses Zusammenwirken von physischen und seelischen Qualen so lange aushalten? Es scheint, daß ein gutes, sicheres Gewissen unüberwindbare Kräfte zu verleihen vermag.
Ich öffne die Jalousie, die meine Fensterluke verschließt, und betrachte wieder die See. Dicke, dunkle Wolken bedecken den Himmel, aber der Mond bricht doch zuweilen durch und wirft sein Licht auf das Wasser, so daß es silbern leuchtet. Die Wogen zerschellen machtlos an den Felsen, die die Insel umgeben; immer wieder klatscht das Wasser gegen die Wand und bricht sich die Brandung, gleichmäßig, kurz abgebrochen, und der fast brutale Rhythmus thut meinem kranken Herzen wohl.
Und in dieser Nacht, in dem tiefen Schweigen um mich her, sehe ich die geliebten Bilder meiner Frau und der Kinder vor mir. Wie muß meine arme Lucie unter einem so ungerechten Schicksal leiden, sie, die alles besaß, um glücklich zu sein. Ihre Gradheit, ihr vornehmer Charakter, ihr zärtliches und aufopferndes Gemüt, geben ihr aber auch ein gutes Recht auf Glück. Armes, geliebtes Weib; wenn ich an sie und die Kinder denke, so löst sich alles in mir auf, und ich schluchze wie ein Kind; aber dennoch hält der Gedanke an sie meinen Mut aufrecht.
Ich will nun versuchen, etwas Englisch zu treiben, hoffentlich kann ich mich in der Arbeit ein wenig vergessen.
Montag, 15. April 1895.
Heute gießt es in Strömen. Als erstes Frühstück erhalte ich nichts. Die Wärter haben Mitleid mit mir und geben mir etwas schwarzen Kaffee und Brot.
Während es ein wenig aufhellt, mache ich meinen Spaziergang und wandere das kleine Stückchen auf der Insel, das für mich reserviert ist, ab. Die Insel ist trostlos öde: einige Bananen, einige Cocospalmen, dürrer Grund, aus welchem überall Basaltfelsen emporragen.
Um 10 Uhr bringt man mir die Lebensmittel für den Tag, ein Stück geräucherten Speck, einige Körner Reis, etwas ungerösteten Kaffee und etwas Farinzucker. Ich werfe alles in die See Ich warf das ins Meer, weil der Speck ungenießbar, der Reis unappetitlich war. Aus purem Hohn hatte man mir grünen Kaffee gebracht, denn ich besaß nichts, worin ich denselben hätte rösten können., und bemühe mich, Feuer zu machen. Nach einigen vergeblichen Versuchen gelingt es mir, ich koche mir das Wasser für meinen Thee. Mein Frühstück besteht aus Thee und Brot.
Alle meine Kräfte sind aufs höchste angespannt. Was habe ich für ein Opfer gebracht, indem ich am Leben blieb! Nichts an moralischen und physischen Leiden ist mir erspart worden.
Da draußen zu meinen Füßen brüllt das Meer ohne Rast und Ruh. Ah, wie das in meiner Seele wiederklingt! Der Schaum der Wogen, der sich am Felsen bricht, ist weiß wie Milch, ich möchte mich hinein stürzen und darin versinken.
Montag, 15. April abends.
Zu Mittag war meine Nahrung wieder auf ein Stück Brot reduciert, da brach ich zusammen. Die Wärter sahen, wie schwach ich war, und gaben mir von ihrer Brühe ab.
Ich rauche dann, ich rauche, um mein Gehirn und das Knurren meines Magens zu beruhigen. Ich wiederhole meine Bitte an den Gouverneur von Guayana, was ich schon vor vierzehn Tagen zwar gethan, mir zu erlauben, wie es auch gesetzlich gestattet ist, mir meine Nahrung in Form von Conserven auf eigene Kosten von Cayenne kommen zu lassen.
Und Du, mein Liebling, denkst Du in diesem Augenblick auch an mich, klingt ein Widerhall meines Denkens auch in Dir? Empfindest Du ahnend, was ich leide? Ja, sicher fühlst Du mit mir, denn Du trägst doch dasselbe Leid.
Es ist ein vernichtender, entsetzlicher Gedanke, wegen eines so verabscheuungswürdigen Verbrechens verurteilt worden zu sein, ohne den Vorfall begreifen zu können.
Wenn es eine Gerechtigkeit auf dieser Welt giebt, so muß ich meine Ehre wieder erlangen können, und der Schuldige, dieses Ungeheuer in Menschengestalt, muß seine Strafe finden.
Dienstag, 16. April.
Endlich habe ich einmal geschlafen, da ich vollkommen erschöpft war.
Mein erster Gedanke beim Erwachen ging zu Dir, meine geliebte, angebetete Frau. Ich fragte mich, was Du wohl in diesem Augenblick thun werdest. Wahrscheinlich bist Du mit unsern Kindern beschäftigt, mögen sie Dir Trost gewähren, damit Du Deine Mission erfüllen kannst, wenn ich vor der Zeit erliegen sollte.
Dann gehe ich Holz hacken. Nach zweistündiger ungeheurer Anstrengung, der Schweiß strömte mir aus allen Poren, hatte ich mir einen genügenden Holzvorrat hergerichtet. Um acht Uhr bringt man mir ein Stück rohes Fleisch und Brot. Ich mache Feuer, endlich brennt es. Aber der Rauch wird von der Brise, die vom Meer her weht, niedergeschlagen und mir in die Augen geblasen, daß sie übergehen. Sobald ich genug glühende Kohlen habe, lege ich mein Fleisch auf einige Eisenstäbchen, die ich da und dort zusammengefunden, und brate mir's auf dem Rost. Heute ist mein Essen etwas besser, als gestern, aber das Fleisch ist hart und trocken. Das Menu des Diners war einfacher: Brot und Wasser. Diese Anstrengungen haben mich völlig erschöpft.
Freitag, 19. April 1895.
In den letzten Tagen habe ich nicht geschrieben. Meine ganze Zeit mußte im Kampf um mein Leben aufgeboten werden, ich leiste Widerstand, so lange noch ein Tropfen Blut in mir ist, sie mögen mir anthun, was sie wollen. Die Behandlung ist nicht verändert worden, man wartet immer auf neue Ordre.
Heute habe ich mir aus meinem Fleisch Fleischbrühe bereitet. Salz und Gewürz dazu fand ich auf der Insel. Drei Stunden dauerte das Kochen, und der Rauch hat meine Augen furchtbar mitgenommen. Dieses Elend!
Und immer noch keine Briefe von meiner Frau. Sollten die Nachrichten abgefangen worden sein?
Meine Nerven waren ganz zerrüttet, ich wollte mich mit Holzhacken etwas beruhigen und in der Küche das Beil holen. Als ich mich der Küchenthüre näherte, schrie mir ein Wärter entgegen: »In die Küche wird nicht gegangen!« Stumm entferne ich mich, aber ich trage den Kopf hoch. Wenn ich nur in meinen vier Mauern bleiben dürfte und keine Seele sehen müßte! Essen muß der Mensch leider trotzdem.
Manchmal versuche ich Englisch zu treiben, Uebersetzungen zu machen, um mich durch Arbeit zu zerstreuen. Aber mein Gehirn ist zu sehr heruntergearbeitet, ich kann höchstens eine Viertelstunde lang bei der Sache bleiben.
Und ich finde es unerhört, unmenschlich, daß man meine Correspondenz abfängt. Ich verstehe ja, daß man alle erdenklichen Vorsichtsmaßregeln ergreift, um meine Flucht zu verhindern, das ist das Recht, sogar die stricte Pflicht der Verwaltung. Aber, daß man mich lebendig begräbt, daß man jeden Verkehr sogar mit offenen Briefen mit meiner Familie verhindert, das geschieht gegen alles Recht. Man glaubt um viele Jahrhunderte zurückversetzt zu sein; ein volles halbes Jahr bin ich nun gefangen gehalten, ohne daß man mir die Möglichkeit gewährt, an der Arbeit zur Rettung meiner Ehre mitzuhelfen.
Sonnabend, 20. April, 11 Uhr morgens.
Ich habe schon für den Tag gekocht. Heute teilte ich mir mein Fleisch in zwei Portionen, die eine wurde als Suppenfleisch verwendet, die andere als Beefsteak. Ich habe mir vermittelst eines Stückchens Blech, das ich auf der Insel gefunden, einen Bratrost construiert. Mein Getränk: Wasser. Und alles wird in alten rostigen Blechbüchsen zubereitet, ich habe nichts, um das Gefäß zu reinigen, keinen Teller, nichts, gar nichts. Ich muß meinen ganzen Mut zusammen nehmen, um ein derartiges Leben auszuhalten, um so mehr, als dazu noch mein seelisches Leiden kommt.
Ich bin ganz erschöpft, und will mich einige Minuten auf meinem Lager ausruhen.
Am selben Tag, 2 Uhr nachts.
Ist es zu glauben, daß in unserem Jahrhundert, in einem Land wie Frankreich, das doch ganz erfüllt ist von freiheitlichen und gerechten Ideen, derartige Vorkommnisse Folgt noch: aussi profondément immérités. möglich sind? Ich habe an den Präsidenten der Republik geschrieben, ich habe an die Minister geschrieben und nichts verlangt, als daß man der Wahrheit nachforsche. Man hat nicht das Recht, die Ehre eines Officiers und seiner Familie zu Grunde zu richten, wenn man keine anderen Beweise hat, als ein Schriftstück, und wenn eine Regierung thatsächlich die Macht besitzt, Aufklärung zu schaffen. Ich verlange Gerechtigkeit mit Pauken und Trompeten, ich verlange sie im Namen meiner Ehre.
Ich war heute mittag so hungrig, daß ich, um meinen knurrenden Magen zu beruhigen, eine Hand voll roher Tomaten aß, die ich auf der Insel gefunden. Die Aussätzigen hatten auf der Insel einzelne Culturen angelegt, von denen noch Ueberbleibsel vorhanden waren. Wilde Tomaten wuchsen in Menge.
Nacht vom Sonnabend, 20. auf Sonntag, 21. April 1895.
Eine Fiebernacht; ich habe von Dir geträumt, Lucie, und von den Kindern, wie jede Nacht.
Wie sehr mußt Du leiden, mein armer Liebling.
Glücklicherweise sind unsere Kinder noch klein, was müßten sie sonst für eine bittere Lehrzeit für's Leben durchmachen. Ich für mich habe die Pflicht, trotz meines Martyriums bis an die Grenzen meiner Kraft auszuhalten, ohne schwach zu werden. Ich werde aushalten.
Ich habe soeben an Major du Paty geschrieben, um ihn an seine beiden Versprechen zu erinnern, die er mir nach der Verurteilung gegeben: Erstens im Namen des Ministers, daß man die Nachforschungen fortsetzen werde, zweitens in seinem eigenen Namen, daß er mich sofort benachrichtigen werde, wenn im Ministerium die Fährte wieder aufgenommen würde.
Der Elende, der das Verbrechen begangen hat, ist aber schon zu sehr auf der schiefen Ebene, er kann nicht mehr zurück.
Sonntag, 21. April 1895.
Der Oberbefehlshaber der Inseln hatte die Güte, mir mit dem Fleisch zwei Büchsen condensierter Milch zu senden. Jede Büchse giebt ungefähr drei Liter Milch. Wenn ich nun täglich eineinhalb Liter trinke, so reiche ich damit vier Tage.
Ich lasse nun das Siedefleisch beiseite, denn ich konnte es doch nie ordentlich genießbar zubereiten. Ich habe mein Fleisch wieder in zwei Schnitten geteilt, die werden zum Frühstück und zum Abendbrot gebraten.
In den Augenblicken, in welchen ich nicht durch die Besorgung meiner Lebensbedürfnisse abgelenkt werde, denke ich an meine Lieben zu Hause und an das, was sie ihrerseits leiden müssen.
Wird der Tag der Gerechtigkeit bald anbrechen?
Die Tage sind so lang, die Minuten Stunden. Ich bin zu jeder körperlichen Arbeit unfähig, und dazu ist die Hitze von 10 Uhr morgens bis 3 Uhr mittags so unerträglich, daß ich nicht aus meiner Behausung gehen kann. Ich vermag auch nicht den ganzen Tag Englisch zu lernen, mein Gehirn versagt dabei. Und es ist nichts zu lesen da. Immer allein mit meinem Kopf und seinen verzweifelten Gedanken.
Ich wollte mir eben Feuer machen, die Jolle kommt von der Königsinsel her, ich muß ins Haus, so lautet die Ordre. Ob sie wohl fürchten, daß ich mich mit den Sträflingen in Verbindung setze?
Montag, 22. April 1895.
Ich bin bei Tagesanbruch aufgestanden, um meine Wäsche zu waschen und sie nachher an der Sonne zu trocknen. Bei diesem unglücklichen Nebeneinander von Hitze und Feuchtigkeit verschimmelt hier alles. Es giebt nur Sturzregen und darauf wieder tropische Hitze.
Ich bat den Commandanten um einen oder zwei Teller, gleichgültig aus welchem Material, er antwortete, er habe keine. Ich muß mich nun erfinderisch behelfen, indem ich von Papier oder alten Blechfetzen esse, die ich auf der Insel finde. Ich verzehre das Unglaublichste an Unreinlichkeit. Ich aber widerstehe allem und jedem um meiner Frau und der Kinder willen. Und immer bin ich mit meinen schwarzen Gedanken allein, auf mich selbst angewiesen. Was ist das für ein Martyrium für einen Unschuldigen!
Immer noch keine Briefe von Hause, ich habe verschiedene Male reclamiert. Zwei Monate habe ich nun nichts gehört.
Ich habe soeben getrocknete Gemüse in alten Conservenbüchsen erhalten. Ich wusch die Büchsen und bearbeitete sie, damit ich mir Teller daraus machen könne, dabei schnitt ich mich in die Finger.
Man teilte mir auch mit, daß ich meine Leibwäsche selber zu waschen habe. Ich habe aber gar keine Geräte dazu. Ich helfe mir nun zwei Stunden lang, wie's geht, die Arbeit gelingt nicht sonderlich. Aber wenigstens hat die Wäsche wieder einmal Wasser gesehen.
Ich bin am Zusammenbrechen. Werde ich schlafen können? Ich zweifle daran. Es ist in mir eine so starke Verquickung von körperlicher Schwäche und nervöser Ueberreizung, daß mich, sobald ich mich niederlege, meine Nerven beherrschen, und daß meine Gedanken voller Angst nach Hause wandern.
Dienstag, 23. April 1895.
Immer der Kampf um das nackte Leben. Noch nie habe ich so stark geschwitzt, wie heute beim Holzhacken.
Ich habe mir meine Mahlzeiten noch vereinfacht. Ich bereitete mir heute ein Ragout von Rindfleisch und weißen Erbsen, die Hälfte aß ich und die andere spare ich mir zum Abend auf. So habe ich nur einmal im Tag zu kochen.
Doch verursacht mir diese Kocherei in altem, verrosteten Blechzeug stets heftige Magenschmerzen.
Mittwoch, 24. April 1895.
Heute geräucherter Speck. Ich werfe ihn weg. Ein Topf voll gedörrter Erbsen, das wird meine Ration sein.
Meine Magenschmerzen hören nicht auf.
Donnerstag, 25. April 1895.
Streichhölzerschachteln erhalte ich nur Stück für Stück. Ich habe freilich noch nicht begriffen warum, denn es sind phosphorfreie Streichhölzer, und ich muß immer die leere Schachtel vorzeigen. Heute früh fand ich die leere Schachtel nicht, sogleich gab es eine Scene und Vorwürfe. Schließlich steckte sie in einer Tasche.
Nacht vom Donnerstag auf Freitag.
Diese schlaflosen Nächte sind grauenvoll. Die Tage lassen sich noch ertragen, ich vertreibe sie mir durch tausendfache Beschäftigung für meine leibliche Existenz. Ich muß meine Behausung reinigen, kochen, Holz hacken und meine Wäsche waschen.
Wie müde ich auch sein mag, so haben die Nerven wieder die Oberhand, und das Gehirn fängt an zu arbeiten, sobald ich mich hinlege. Ich denke an meine Frau und ihren Kummer, ich denke an die Kleinen, und ihr sorgloses Geplauder.
Freitag, 26. April 1895.
Heute wieder Speck, wird wieder weggeworfen. Hierauf kommt der Commandant der Inseln und bringt mir Thee und Tabak. Ich hätte an Stelle des Thee lieber condensierte Milch gehabt, ich hatte auch deshalb nach Cayenne geschrieben, meine Kolik will nicht weichen. Man überreicht mir auf Borg vier flache und zwei tiefe Teller, zwei Kochtöpfe, aber nichts, um es hineinzuthun.
Man übergiebt mir auch die Zeitschriften, die mir meine Frau zuschickt. Aber immer noch keine Briefe. Das ist wahrhaftig zu unmenschlich.
Ich schreibe an meine Frau und habe dabei einen meiner wenigen ruhigen Momente. Ich ermahne sie immer wieder, Mut und Energie nicht zu verlieren, denn unsere Ehre muß allen, allen ohne Ausnahme, so erscheinen, wie sie immer gewesen, rein und fleckenlos.
Die entsetzliche Hitze zehrt furchtbar an meiner Körperkraft.
Sonnabend, 27. April 1895.
Ich habe meine Zeiteinteilung verändert, da es schon morgens um 9 Uhr unerträglich heiß wird. Ich stehe mit dem Tag auf (5½ Uhr), mache Feuer für meinen Thee oder Kaffee, dann setze ich mein getrocknetes Gemüse auf, bringe mein Bett in Ordnung und vervollständige so überhaupthin meine Toilette.
Um 8 Uhr bringt man mir meine Tagesration. Ich nehme die Gemüse vom Feuer, setze an Fleischtagen hierauf das Fleisch auf und koche mein Essen. So gegen 10 Uhr bin ich damit fertig. Abends esse ich kalt, was mir vom Mittag übrig bleibt, es ist mir wirklich nicht darum zu thun, auch nachmittags wieder drei Stunden in der Nähe des Feuers zu verbringen.
Um 10 Uhr nehme ich das zweite Frühstück, dann lese ich, schreibe, träume und leide vor allem, bis um 3 Uhr. Hierauf mache ich gründlich Toilette, wenn die Hitze gewichen ist, so gegen 5 Uhr abends, gehe ich Holz hacken, Wasser holen, oder ich wasche etc. Um 6 Uhr esse ich die Reste vom Mittag auf, dann schließt man mich ein. Dann kommt die längste Stunde des Tages. Ich habe nicht durchsetzen können, daß man mir die Benutzung einer Lampe gestattet. Es ist zwar eine Laterne im Wachtraum, aber die giebt zu wenig Licht zu mir herein, als daß ich arbeiten könnte. Es bleibt mir nichts übrig, als mich hinzulegen, und dann drehen sich alle meine Gedanken in grausamem Wirbel um die wenigen Puncte, die mich immer beschäftigen, ich suche die Erklärung für das entsetzliche Drama, dessen Opfer ich bin; ich denke an Hause und an das Leid meiner Frau und meiner Kinder, meiner Lieben. Wie müssen sie alle gleich entsetzlich leiden.
Sonntag, 28. April 1895.
Draußen ist Sturm. Die Windstöße erschüttern das ganze Haus, so daß alles aneinander klirrt. Wie gleicht der Sturm in meiner Seele so oft dem Toben des Windes. Ich möchte stark und mächtig sein, wie der Wind, der die Bäume schüttelt, ich möchte wie er, Wurzeln ausreißen, und die Hindernisse niederwerfen, die sich der Wahrheit in den Weg legen.
Hinausschreien möchte ich das Lied von meinem Leiden in alle Welt, und die Empörung, die in mir tobt, sollte widerhallen, daß man über einen Unschuldigen und seine Familie solche Schändlichkeit ergossen hat. Ah, welche Züchtigung ist grausam genug für den, der dieses Verbrechen ausgeheckt! Er ist ein Verbrecher an seinem Land, an einem Unschuldigen, an einer ganzen Familie, die er in die Verzweiflung treibt, er kann kein Mensch sein.
Nun habe ich auch gelernt, das Küchengeschirr zu reinigen. Bis dahin spülte ich es nur mit warmem Wasser aus und verwendete meine Taschentücher als Scheuerlappen. Trotzdem blieben die Töpfe fettig und schmutzig, da dachte ich daran, meine Holzasche zu benutzen und die Pottasche zu verwenden. Es ist mir prächtig geglückt, aber in was für einen Zustand sind nun meine Hände und die Taschentücher.
Man berichtet mir soeben, daß bis auf weiteren Befehl meine Wäsche im Spital gewaschen werden soll. Das ist ein wahres Glück, meine Wollwäsche ist durch mein starkes Schwitzen so mitgenommen, daß sie dringend einer gründlichen Reinigung bedarf. Hoffentlich wird dieses Provisorium zur Regel.
Am selben Tage um 7 Uhr abends.
Ich denke viel an Dich, Du geliebte Frau, und an die Kinder. wir verbrachten thatsächlich den ganzen Sonntag gemeinsam. Wie aber so langsam, langsam, der Tag vorrückte, wurden auch meine Gedanken wieder düsterer.
Montag, 29. April, 10 Uhr morgens.
Ich war noch nie so müde, wie heute früh, und das Holzhacken und Wasserholen war mir herzlich lästig. Das Frühstück, das mich erwartet, besteht aus alten Erbsen, die schon seit vier Stunden auf dem Feuer sind und nicht weich werden wollen, und Wasser. Trotz aller Energie werde ich nicht bei Kräften bleiben, wenn diese Behandlung beibehalten wird, besonders in diesem mörderischen Klima.
Mittags.
Vergeblich versuchte ich zu schlafen. Sobald ich mich niederlege, auch wenn ich totmüde bin, kommt mir mein ganzes Unglück vor die Seele; ich bin voller Bitterkeit über ein Schicksal, das ich nicht verdient, und die Bitterkeit steigt vom Herzen in den Mund. Die Nerven sind zu gespannt, als daß ich den Schlaf finden könnte, der mich erfrischen würde.
Zudem ist stürmisches Wetter, der Himmel ist bedeckt, und eine bleierne Hitze lastet über uns.
Wenn sich doch die Wolken öffnen möchten, um die ewig weichliche Atmosphäre zu erfrischen. Das Meer erscheint graugrün, schwer und dicht wälzen sich die Wogen heran, als wollten sie sich auf einen großartigen Zusammensturz vorbereiten. Was wäre doch der Tod für eine Wohlthat im Vergleich zu diesem langsamen Dahinsiechen, zu dem seelischen Martyrium jedes Augenblicks. Aber ich habe das Recht, zu sterben, um Lucies und der Kinder willen nicht, ich muß kämpfen bis an die Grenzen meiner Kraft.
Mittwoch, 1. Mai 1895.
Oh, diese entsetzlichen Nächte. Und ich bin doch gestern um 5 Uhr aufgestanden, habe mich den ganzen Tag abgemüht, habe mir keine Siesta gestattet, habe beinahe eine Stunde lang Holz gesägt, bis mir alle Glieder zitterten, und dennoch konnte ich nicht schlafen vor Mitternacht.
Wenn ich doch wenigstens abends arbeiten könnte, aber ich werde von 6 oder 6½ Uhr an ohne Licht eingeschlossen. Die Laterne im Vorraum giebt nicht genügend Licht zum Arbeiten und viel zu viel zum Schlafen in meine Zelle.
Donnerstag, 2. Mai, 11 Uhr.
Der Courier von Cayenne ist gestern abend gekommen. Werde ich endlich meine Briefe erhalten? Ich habe heute morgen nur noch diese eine Frage im Kopf. Ich erlitt aber in den letzten Monaten so viele Enttäuschungen, ich habe so viele, die menschliche Gewissenhaftigkeit compromittierende Dinge vernommen, daß ich an allen und allem zweifle, außer an meiner Familie. Ich hoffe, ich bin überzeugt, daß sie meine Sache aufklären werden, denn sie halten meine Ehre so hoch wie ich, sie werden nicht ruhen und rasten, bis nicht meine Ehre wieder hergestellt ist.
Ich frage mich, ob wenigstens meine Briefe an meine Frau gelangen. Was ist das doch für ein entsetzliches Leiden für uns beide, für uns alle!
Ich muß aber stark bleiben, ich muß meine Ehre und diejenige meiner Kinder wieder haben.
Ich bin so mutterseelenallein, daß mir oft scheint, ich liege lebendig im Grabe.
Am selben Tag, mittags 5 Uhr.
Die Jolle von der Königsinsel ist angekommen. Mein Herz ist zum Zerspringen voll. Werde ich die Briefe von meiner Frau erhalten, die, wie ich weiß, schon seit mehr als einem Monat in Cayenne liegen? Werde ich ihre treuen Gedanken lesen und daraus den Widerhall ihrer Liebe vernehmen?
Ich empfand eine unsagbare Freude, als ich gewahrte, daß wirklich Briefe für mich da waren, um dann um so schwerer, grausamer enttäuscht zu sein, als es Briefe waren, die noch nach der Insel Ré adressiert waren und aus der Zeit stammten, da ich Frankreich noch nicht verlassen hatte. Man fängt also meine hierher gerichteten Briefe ab? Vielleicht schickt man sie nach Frankreich zurück, damit sie dort gelesen werden. Könnte man denn nicht wenigstens meine Familie benachrichtigen, ihre Briefe beim Ministerium zu deponieren?
Trotz alledem weinte ich heiße Thränen, als ich die Briefe in der Hand hielt, die um zwei ein halb Monate zurückdatierten. Kann man sich denn eine solche Tragödie in allen ihren Einzelheiten auch nur auszudenken? Die ganze Nacht werde ich von Lucie träumen und von den geliebten Kindern, um deren willen ich leben muß.
Keine Spur außerdem von den Dingen, Küchengeräten, Lebensmitteln, die ich in Cayenne bestellt habe, und ich habe doch ein gutes Recht darauf.
Sonnabend, 4. Mai 1895.
Wieder diese endlosen Tage, wo ich mit mir allein bin und nichts von den Meinigen höre. Beständig frage ich mich, was sie wohl thun, was aus ihnen wird, wie sie sich befinden und wie unsere Sache steht. Der letzte Brief, den ich erhalten, trägt das Datum vom 18. Februar.
Die Vormittage sind noch erträglich, ich fülle sie mit den Beschäftigungen aus, die mir mein Kampf um das nackte Leben auferlegt, das dauert so von 5½ Uhr bis 10 Uhr. Aber die Kost, die mir gegeben wird, ist natürlich nicht im stande, meine Kräfte zu erhalten. Heute wieder Speck, ich frühstücke getrocknete Erbsen und Brot. Menu des Diners: dasselbe.
Ich zeichne mir manchmal die kleinsten Begebnisse meines täglichen Lebens auf, und doch verschwindet ja alles vor der einen höchsten Sorge: der Sorge um meine Ehre.
Ich leide nicht nur meinetwegen, ich leide auch um Lucie, um meine Familie. Ob sie wenigstens meine Briefe erhalten? Wie müssen sie sich um meinetwillen grämen und haben doch ihr gut Teil Sorgen daneben.
Am selben Tag, abends.
In meiner Einsamkeit, die nur durch das Rollen der brandenden Wogen unterbrochen wird, erinnerte ich mich der Briefe, die ich in der ersten Zeit meines Aufenthaltes hier an Lucie geschrieben, in denen ich ihr mein Leiden schilderte. Meine arme Frau hat doch wahrhaftig genug durch unsere entsetzliche Lage zu tragen, und ich komme noch und mache ihr das Herz mit meinen Klagen schwer. Ich muß all meinen Mut zusammenraffen, ich muß ihr durch mein Beispiel die Kraft zum Ausharren verleihen, damit sie ihre Mission zu erfüllen vermag.
Montag, 6. Mai 1895.
Immer allein mit meinen Gedanken, immer ohne Nachricht von den Meinigen.
Und ich muß mit all diesen Schmerzen weiterleben, ich muß sie mit Würde tragen, ich muß auf diese Weise meiner Frau und meiner ganzen Familie Mut einflößen, denn sicherlich leiden sie ebenso sehr wie ich. Keine Schwachheit mehr. Trage Dein Los bis zu der Stunde, wo es Licht werden wird, Du mußt es thun für Deine Kinder.
Vergeblich suche ich meine Nerven durch körperliche Arbeit zu beruhigen, aber weder das Klima noch meine Kräfte ermöglichen mir das.
Dienstag, 7. Mai 1895.
Seit gestern strömender Regen und zwischen hinein Intervalle voll warmer, ermattender Feuchtigkeit.
Mittwoch, 8. Mai 1895.
Heute war ich durch die Grabesstille, die mich umgiebt, so niedergeschlagen, durch das Monate lange Schweigen meiner Familie so verzweifelt, daß ich meine Nerven mit einer Roßcur beherrschen wollte. Fast zwei Stunden lang habe ich Holz gehackt und gesägt.
Mit Anspannung meiner ganzen Willenskraft habe ich es dazu gebracht, wieder Englisch treiben zu können. Ich beschäftige mich zwei bis drei Stunden täglich damit.
Donnerstag, 9. Mai 1895.
Heute früh, nachdem ich mich, wie gewöhnlich, bei Tagesanbruch erhoben und meinen Kaffee bereitet hatte, überkam mich ein heftiger Anfall von Schwäche mit sehr starker Transpiration. Ich mußte mich wieder zu Bett legen.
Ich muß mit meinem Leibe kämpfen, er soll nicht erliegen, bevor ich meine Ehre wiederhabe. Dann erst darf ich schwach werden.
Obgleich ich mich nach Kräften zusammengenommen, hatte ich heute beim Gedanken an Frau und Kinder eine Weinkrisis. Die Sache muß, muß aufgeklärt werden, ich muß meine Ehre wieder erlangen, sonst wollte ich lieber alle beide Kinder tot vor mir sehen.
Es war ein entsetzlicher Tag, Nervenkrisis, Weinanfall, nichts blieb aus. Aber die Seele muß den Körper beherrschen.
Freitag, 10. Mai 1895.
Heftige Fieber die letzte Nacht. Die Taschenapotheke, die mir meine Frau gebracht, ist mir nicht wieder zugestellt worden.
Sonnabend, 11., Sonntag, 12., Montag, 13. Mai.
Sehr schlimme Tage. Fieber, Magenverstimmung, Ekel vor allem. Was geschieht unterdessen in Frankreich? Wie weit sind die Nachforschungen gediehen?
Dazu noch Sonnenbrand an einem Fuß, weil ich zu früh und barfuß einige Augenblicke das Bett verließ.
Donnerstag, 16. Mai 1895.
Beständig Fieber. Gestern abend heftigerer Anfall mit Congestion zum Gehirn. Ich habe den Arzt holen lassen, denn ich will so nicht weichen.
Freitag, 17. Mai 1895.
Der Arzt ist gestern abend gekommen, er hat mir 40 Centigramm Chinin per Tag verordnet, und wird mir zwölf Büchsen condensierte Milch und doppelkohlensaures Natron schicken. Endlich kann ich mich mit Milch ernähren und brauche nicht mehr diese fürchterliche Kost, die mich schon so sehr anekelt, daß ich viele Tage lang nichts zu mir genommen. Ich hätte nie gedacht, daß der menschliche Körper eine solche Widerstandskraft haben könnte.
Sonnabend, 18. Mai 1895.
Die Milch aus dem Krankenhaus ist nicht allzu frisch. Es ist aber immer besser, als gar nichts. Vor einigen Minuten habe ich die 40 Centigramm Chinin eingenommen.
Sonntag, 19. Mai 1895.
Ein trostloser Tag; Tropenregen, der nicht aufhört. Das Fieber ist dank dem Chinin gefallen.
Ich habe die Bilder meiner Frau und der Kinder vor mich auf den Tisch gestellt, damit ich sie beständig vor Augen habe und Mut und Kraft daraus schöpfe.
Montag, 27. Mai 1895.
Immer die gleichen trüben, einförmigen Tage. Soeben habe ich an meine Frau geschrieben und ihr gesagt, daß meine moralische Kraft stärker ist als je.
In diese dunkle Sache muß vollständige Klarheit gebracht werden, und ich fordere sie auch.
Oh, ihr meine Kinder, mir geht es, wie einem Tier, das erst über seine Leiche den Weg zu seinen Jungen frei giebt.
Drückendes, erstickendes, entnervendes Wetter. Ach, was mir meine Nerven für Leiden bereiten! Und sich vorstellen, daß ich meine ganze große Energie nicht einmal entfalten kann, um, wenn nicht zu leben, doch zu vegetieren!
Aber jedem schlägt seine Stunde. Der Elende, der dieses ungeheuerliche Verbrechen begangen, wird entlarvt werden. Wenn ich ihn nur fünf Minuten in meinen Fingern hätte, er müßte alle die Todesqualen durchmachen, die ich durch ihn erduldet habe, mit meinen Händen würde ich ihm das Herz und die Eingeweide aus dem Leibe reißen.
Sonnabend, 1. Juni 1895.
Der Postdampfer von Cayenne fährt an mir vorbei. Werde ich heute Nachricht von Frau und Kind erhalten? Seit ich Frankreich verlassen, seit dem 20. Februar, kein Wort von den Meinigen. Ich muß wirklich alle nur erdenklichen Leiden und Qualen ertragen.
Sonntag, 2. Juni 1895.
Nichts, gar nichts. Auch keine Instructionen in Bezug auf mich, immer Grabesstille um mich her.
Aber ich halte doch stand, ich habe mein reines Gewissen und mein gutes Recht und bin stark.
Montag, 3. Juni 1895.
Ich sah, wie der Postdampfer nach Frankreich vorüberkam. Mein Herz war zum Zerspringen voll, und ich zitterte vor Aufregung. Die Post wird Dir meine letzten Briefe bringen, Liebste, und ich spreche Dir darin immer nur Mut zu, Mut. Ganz Frankreich muß erfahren, daß ich ein Opfer und nicht ein Schuldiger bin.
Bei dem bloßen Wort Verräter steigt mir das Blut zu Kopf, ich bebe vor Zorn und Entrüstung; ein Verräter, der elendeste aller Schurken! Nein, nein, ich muß leben, ich muß meine Leiden beherrschen, damit ich den Tag erschaue, wo meine Unschuld ihren vollen Triumph feiert.
Mittwoch, 5. Juni 1895.
Diese langen Stunden! Kein Schreibpapier mehr, obschon ich wiederholt darum gebeten, schon seit drei Wochen nichts zu lesen, nichts, das meine Gedanken ablenken könnte.
Seit dreieinhalb Monaten keine Berichte von den Meinigen.
Freitag, 7. Juni 1895.
Nun habe ich wieder Papier und Zeitschriften erhalten.
Heute gießt es in Strömen.
Unter dieser fortwährenden fürchterlichen Spannung leidet mein Kopf unsäglich.
Sonntag, 9. Juni 1895.
Alles verwundet mich, mein Herz blutet bei jeder Kleinigkeit. Der Tod wäre mir Erlösung, aber ich habe nicht das Recht, daran zu denken.
Immer noch keine Nachricht von den Meinigen.
Mittwoch, 12. Juni 1895.
Endlich habe ich Briefe von meiner Frau und meiner Familie, sie sind hier Ende März angelangt, dann sicher nach Frankreich zurückgeschickt worden und haben drei Monate gebraucht, um mich zu erreichen.
Wie lese ich den Schmerz, den Kummer aller zwischen den Zeilen heraus. Ich mache mir noch mehr Vorwürfe darüber, daß ich in den ersten Tagen hier meiner Frau jene herzzerreißenden Briefe gesandt habe. Ich hätte allein leiden müssen, und nicht ihnen, die so schon schwer genug zu tragen haben, noch meine Last aufbürden sollen.
Und dann liegt eine weitere, unerhörte Verdächtigung meiner Person in der Luft, die mein so schon wundes Herz rasend quält.
Als mir der Commandant die Briefe übergab, sagte er:
»Man fragt mich in Paris an, ob Sie nicht ein Conventional-Wörterbuch Zusammenstellung verabredeter Ausdrücke. besitzen.«
»Suchen Sie doch,« antwortete ich, »was will man denn noch von mir?«
»Nun,« meinte er, »man scheint dort nicht allzusehr an Ihre Unschuld zu glauben.«
»Oh, ich hoffe doch, lange genug am Leben zu bleiben, um auf alle die infamen Lügen die richtige Antwort geben zu können, auf die Lügen, die in den Köpfen von Leuten entstanden sind, deren Urteil durch Haß und Leidenschaft geblendet wurde.«
Wir müssen volle Aufklärung haben, nicht nur um der Verurteilung, sondern um all der Dinge willen, die mir noch nachher angethan, zu mir gesprochen worden sind.
Ich erhielt auch mein Küchengerät und zum ersten Mal Conserven aus Cayenne. Das Materielle ist von geringer Bedeutung für mich, aber ich werde auf diese Weise doch meine Kräfte stützen können.
In diesen Tagen arbeiteten Sträflinge hier, da schloß man mich in meine Behausung ein, damit ich mich nicht mit ihnen in Verbindung setzen sollte. Wie häßlich doch die Menschen sein können!
Ich unterbreche hier mein Tagebuch, um einige Auszüge aus den Briefen meiner Frau zu geben, die ich am 12. Juni erhalten. Es war leicht ersichtlich, daß dieselben Ende März in Cayenne angekommen, nach Frankreich zurückspediert und dort im Colonialministerium und im Kriegsministerium gelesen worden waren. Später teilte man meiner Frau mit, daß sie je am 25. des Monats ihre Briefe an mich im Colonialministerium abgeben müsse. Es war ihr verboten, von meiner Sache oder von diesbezüglichen Ereignissen zu sprechen, auch wenn dieselben veröffentlicht und bekannt waren. Dort wurden die Briefe gelesen, peinlich controliert, gingen durch viele Hände und wurden sehr oft nicht an mich abgeschickt. Natürlich hatten sie keinen intimen Charakter. Meine Frau wußte, wie streng sie überwacht wurde, und sie wollte mir keine Mitteilung von den Schritten, die sie unternommen, machen, da sie fürchten mußte, daß ihr von denen, die ein Interesse daran hatten, uns zu vernichten, zu ersticken, ihr Vorgehen wieder erschwert werden würde.
Paris, 23. Februar 1895
Mein lieber Alfred,.
es hat mich sehr mitgenommen, als ich sofort nach meiner Rückkehr erfuhr, daß Du die Insel Ré verlassen hattest. Du warst ja dort schon weit von mir entfernt, aber ich konnte Dich doch jede Woche sehen, und darauf richtete sich meine ganze Sehnsucht. Ich las in Deinen Augen, wie sehr Du littest, und mein einziger Traum war, Dir etwas Erleichterung zu bringen. Jetzt habe ich nur noch die eine Hoffnung, den einen Wunsch, daß ich Dir werde nachfolgen, Dich zur Geduld ermahnen können, daß ich mit meiner Zärtlichkeit und Fürsorge Dir beizustehen vermag, in Ruhe den Augenblick zu erwarten, wo Deine Ehre wieder hergestellt sein wird. Nun bist Du wohl an der letzten Etappe Deiner Leidenstage angelangt, hoffentlich hast Du auf der langen Ueberfahrt Menschen angetroffen, die gütig gegen Dich waren, weil sie in Dir einen Unschuldigen, einen Märtyrer sahen …
Ich bin immer bei Dir, geliebter Mann, kein Augenblick vergeht, wo meine Gedanken Dich nicht begleiten. Meine Tage und Nächte verbringe ich in beständiger Herzensangst um Deine Gesundheit und um Dein seelisches Befinden. Stelle Dir doch vor, daß ich nichts von Dir höre und bis zu Deiner Ankunft dort nichts erfahren werde …
Paris, 26. Februar 1895.
Tag und Nacht bin ich in Gedanken bei Dir, ich teile Deine Leiden, ich dulde Todesqualen, wenn ich mir vorstelle, wie Du Dich so immer weiter und weiter von uns entfernst, auf dem Meer, das vielleicht tobt und wütet, so daß zu Deinem Seelenschmerz noch körperliches Unbehagen hinzukommt. Was ist das doch für ein entsetzliches Verhängnis, das so grausam über uns hereingebrochen? …
Ich bin ungeduldig, bis ich bei Dir sein werde, damit wir unseren Kummer leichter tragen können, wenn ich Dich erst mit meiner Liebe und Zärtlichkeit umgebe. Ich habe den Colonialminister um Erlaubnis gebeten, Dir nachreisen zu dürfen, da das Gesetz den Frauen und Kindern der Deportierten gestattet, sie zu begleiten; ich sehe nicht ein, was man mir dagegen einwenden könnte; ich erwarte die Antwort in fieberhafter Aufregung …
Paris, 28. Februar 1895.
Es wäre unmöglich, Dir zu schildern, wie meine Herzensangst zunimmt, je mehr Du Dich von uns entfernst; tags grüble ich über all das Grauenhafte nach und nachts legt sich unser Leid wie ein Alb auf meine Brust. Nur die Kinder mit ihrem reizenden Wesen heitern mich auf; ihrer unberührten Seele gelingt es, mich daran zu erinnern, daß ich eine Mission zu erfüllen habe, und daß mir nicht das Recht zusteht, mich gehen zu lassen. Ich nehme mich dann wieder zusammen und thue mein Bestes, um sie so zu erziehen, wie Du es hast thun wollen, Deine guten Ratschläge zu befolgen und sie zu vornehmen Menschen zu machen, so daß, wenn Du zurückkehrst, Du sie so wiederfindest, wie Du Dir sie einst in Deinen Träumen gedacht.
Paris, 5. März 1895.
Mit meinem letzten Brief habe ich Dir Zeitschriften geschickt, die Dich interessieren werden, und die Dir so viel als möglich helfen sollen, die Stunden zu verkürzen, während Du warten mußt, bis der Schuldige gefunden wird. O Gott, wenn nur das Leben dort Dir nicht allzuschwer gemacht wird, wenn Du nur wenigstens das Allernötigste für Deinen körperlichen Unterhalt bekommst, so daß Du physisch die Leiden aushalten kannst, die Dir auferlegt werden …
Seit Du Frankreich verlassen, leide ich doppelt und dreifach, es läßt sich wirklich nichts mit dem Jammer vergleichen, der meine Seele erfüllt. Ich wäre tausendmal weniger unglücklich, wenn ich bei Dir wäre, wenigstens wüßte ich dann, wie es Dir geht, wie Du Dich körperlich und seelisch befindest, und eine Angst wäre doch von mir genommen …
Sonnabend, 15. Juni 1895.
Die ganze Woche durfte ich wegen der Sträflinge, die an der Caserne der Wärter arbeiten müssen, meine Behausung nicht verlassen.
Immer neue Qualen.
Diese Nacht Unterleibskrämpfe, so daß ich mich vor Schmerz auf meinem Lager wand.
Mittwoch, 19. Juni 1895.
Trockene Wärme; die Regenzeit geht ihrem Ende entgegen. Ich bin durch die Stiche der Mosquitos und anderer Insecten ganz mit Bläschen bedeckt.
Aber das ist nicht der Beachtung wert. Was bedeuten physische Leiden im Vergleich zu seelischen? Nichtigkeiten.
Mein Kopf, mein Herz leiden und winseln vor Schmerz. Wann nur wird der Schuldige entdeckt werden, wann wird man die Wahrheit in dieser traurigen Affaire erfahren? Werde ich es noch erleben? Ich zweifle manchmal daran, ich fühle, wie sich mein ganzes Wesen in entsetzliche Verzweiflung auflöst. Und Lucie, die Arme, Liebe, und die Kinder! Nein, ich werde sie nicht im Stiche lassen, ich werde sie mit der ganzen Glut meiner Seele unterstützen, so lange ich noch ein Atom von Kraft besitze. Ich muß meine ganze Ehre wieder haben, die ganze Ehre meiner Kinder.
Sonnabend, 22. Juni, 11 Uhr nachts.
Es ist mir unmöglich, zu schlafen. Seit 6½ Uhr bin ich ins Zimmer eingeschlossen und habe nur das Licht von der Laterne der Wachtstube her. Ich kann auch nicht die ganze Nacht Englisch treiben, und die wenigen Zeitschriften sind rasch durchgelesen.
In der Nacht hört man ein beständiges Hin und Her der Wachtmannschaft, ein immerwährendes Geräusch von Thüren, die rasch geöffnet und verriegelt werden. Erstens werden die Wachen alle zwei Stunden abgelöst, und dann zeigt der Rondeofficier der Mannschaft immer die Stunde an. Das ewige Kommen und Gehen, dieses Knarren und Pfeifen der Thüren ragt wie toller Gespensterspuk in meine zerquälten Träume hinein.
Wann wird dieses schreckliche, unverdiente Martyrium zu Ende sein?
Dienstag, 25. Juni 1895.
Wieder arbeiten die Sträflinge auf der Insel, ich werde also auch wieder eingeschlossen.
Freitag, 28. Juni 1895.
Immer noch eingeschlossen, wegen der Anwesenheit der Sträflinge.
Mit Anstrengung aller Willenskraft gelingt es mir, drei bis vier Stunden täglich Englisch zu treiben, aber die ganze übrige Zeit beschäftigt sich mein Geist ausschließlich mit meiner Leidensgeschichte. Mir ist oft, als müßte mein Herz und mein Kopf zerspringen.
Sonnabend, 29. Juni 1895.
Ich habe den Postdampfer, der von Frankreich kommt, vorbeifahren sehen. Beim bloßen Namen meines Vaterlandes vibriert meine Seele. Mein Vaterland, dem ich alle meine Kräfte, meine ganze Intelligenz geweiht, ist im stande, mich für einen elenden Schurken zu halten! Es geht wirklich oft über Menschenkraft, diesen Gedanken zu ertragen.
Donnerstag, 4. Juli 1895.
Ich hatte in den letzten Tagen nicht die Kraft zu schreiben, ich war ganz außer mir vor Erregung, als ich endlich nach so langem Warten verhältnismäßig naheliegende Briefe von meiner Frau und von meiner Familie in den Händen hielt; die letzten Briefe sind vom 25. Mai datiert, man hatte schließlich doch meine Familie davon verständigt, daß alle Briefe durch das Ministerium gehen müssen.
Noch haben sie nichts erreicht; der Schuldige ist noch nicht entdeckt. Ich trage das Leid meiner Familie, wie ich mein eigenes trage. Ich mag nicht einmal mehr von den tausend kleinen Miseren meines täglichen Lebens sprechen, sie bedeuten für mein verwundetes Gemüt ebenso viele Nadelstiche.
Aber ich weiche nicht, ich muß meiner Frau Mut einflößen, ich will die Ehre meines Namens, meiner Kinder wieder haben.
Hier einige Auszüge aus den Briefen, die ich in jener Zeit von meiner Frau erhielt.
Paris, 25. März 1895.
Hoffentlich trifft dieser Brief Dich gesund an. Ich meinerseits erwarte sehnsüchtig die Nachricht, daß Du angekommen bist, das muß doch jeden Augenblick geschehen, Du bist ja schon drei Wochen unterwegs. Was hast Du für einen Leidensweg hinter Dir, und was wirst Du noch erdulden müssen, bis wir die Wahrheit ans Licht gebracht haben …
Mathieu kann sich nicht entschließen, wegzureisen. Ich weiß, wie sehr Du ihn immer geliebt hast und wie hoch Du seinen schönen Charakter schätztest …
Paris, 27. März 1895.
Mein Herz blutet, wenn ich an Deine Leiden denke und an den Schmerz, den Du tragen mußt, allein, verbannt, ohne eine Seele, die Dich stützt, Dir Hoffnung und Mut einflößt. Wie gerne wäre ich bei Dir und würde durch meine Gegenwart Deinen Schmerz lindern. Ich kann Dir versichern, daß meine Gedanken mehr dort sind, als hier, daß ich mein Leben eigentlich auf den Salut-Inseln lebe und immer wieder versuche, mir Dich in dieser weltverlassenen Insel vorzustellen und auszudenken, wie Dein Leben sich gestalten mag.
Paris, 6. April 1895.
Heute früh las ich tief bewegt den Bericht über Deine Ankunft auf den Salut-Inseln, der in der Zeitung stand. Diesen Berichten zufolge hat man Dir die Teufelsinsel reserviert. Wenn jene also schon Nachricht haben, so müßte ich doch auch schon Briefe von Dir erhalten haben. Ich kann Dir nicht sagen, wie sehr ich leide, so allein, getrennt von Dir, geliebter Mann, ganz ohne Nachricht, ohne auch nur zu wissen, wie Du Dein Los zu ertragen vermagst. Wenn wir an Deine bewundernswerte Selbstlosigkeit, an Deinen heldenhaften Mut und an Deine ungeheure Energie denken, so schöpfen wir immer wieder frische Kraft, die Pflicht zu erfüllen, die uns auferlegt worden. Wir werden auch ans Ziel gelangen, des bin ich sicher …
Paris, 12. April 1895.
Es ist entsetzlich, wir haben noch keine Nachricht. Zwei Monate sind es schon, seit ich Dich gesehen, und seit da auch nicht ein Laut, nicht eine Zeile, die mir etwas von Dir bringt, das ist unsagbar hart.
Ich leide Todesqualen, wenn ich Dich so unglücklich weiß; mein Herz, mein ganzes Wesen ist voll von Verzweiflung bei diesem Gedanken …
Paris, 21. April 1895.
Der 21. April! Welche liebe Erinnerungen dieser Tag in mir wach ruft! Heute vor fünf Jahren fing unser Glück an, vier und ein halbes Jahr kannten wir nichts als Sonnenschein und Glück. Da brach plötzlich der Blitzstrahl herein, und alles stürzte zusammen. Ich hatte Dir so oft wiederholt, daß ich mir auf der weiten Welt nichts wünsche, daß ich alles besitze, was ich wünschen könnte. Und heute habe ich Wünsche, nicht nur kleine Wünsche des Augenblicks, sondern ein heißes Flehen, ein Gebet zu Gott, daß uns in diesem Jahr unser Glück wiedergegeben werden möge, daß wir unsere Ehre, die uns gestohlen worden, wiedergewinnen, damit Du mit der Kraft auch Fröhlichkeit, Glück und Gesundheit wiedererlangst …
Paris, 24. April 1895.
Noch nichts von Dir, ich verzweifle fast. Jeden Morgen erwache ich voller Hoffnung und warte und warte … Jeden Abend lege ich mich mit derselben Enttäuschung zu Bett. Ach, wie weh thut mir mein armes Herz.
Paris, 26. April 1895.
… Ich habe den entsetzlichsten Tag meines Lebens verbracht. Eine Zeitung berichtete, daß Du krank seiest. Es ist unbeschreiblich, was ich litt, seit ich das gelesen. Du bist dort draußen krank und allein, und ich kann nicht bei Dir sein, Dich pflegen und Dir Liebes erweisen, das ist grauenhaft. Mein Herz und jede Fiber meines Körpers schmerzte unsagbar. Und ich hatte Dich angefleht, am Leben zu bleiben, ich hatte nur noch die eine Hoffnung, Dich einmal wieder glücklich zu sehen und Dir Glück geben zu können; die düstersten Gedanken bestürmten mein Gehirn. Ich war außer mir und wendete mich an den Minister; die Nachricht war falsch …
Wann wird Dein erster Brief zu mir gelangen: Ich bin ungeduldig darauf, wie ein Kind …
Paris, 5. Mai 1895.
Dein Brief, den ich mit so freudiger Sehnsucht erwarte, ist heute noch nicht hier. Seit ich weiß, daß der Postdampfer angelangt ist (23. April), habe ich Herzklopfen, wenn ich den Briefträger kommen höre, und jedesmal erleide ich dieselbe Enttäuschung. Mit der Bewilligung, Dich besuchen zu dürfen, geht es ebenso, der Colonialminister hat auf meine beiden Anfragen vom Februar noch nicht geantwortet. Was soll ich thun, was denken?
Pierre betet jeden Abend inbrünstig, daß Du bald zurückkehren mögest. Der arme kleine Bursche, der daran gewöhnt ist, daß ihm alles freundlich entgegenkommt, begreift nicht, warum gerade dieser Wunsch ihm nicht erfüllt werden soll. Er wiederholt ihn dann stets noch einmal, weil er Angst hat, er habe ihn das erstemal vielleicht nicht gut genug ausgedrückt …
Paris, 9. Mai 1895.
Nun habe ich einen Brief von Dir erhalten. Ich kann Dir gar nicht sagen, wie mir dabei zu Mute war, und wie mein Herz klopfte, als ich Deine geliebte Schrift wieder sah und die Zeilen las, die Du an mich geschrieben, die ersten, die seit Deiner Ankunft dort, also seit beinahe zwei Monaten, in meine Hand gelangten. Und ich teile Deine Leiden, Deine Dualen mit Dir …
Lucie.
Sonnabend, 6. Juli 1895.
Immer dasselbe Leben voller Verdächtigungen, unter beständiger Ueberwachung, unter hundert Nadelstichen. Mein Herz bäumt sich vor Zorn und Entrüstung, und ich muß um meiner selbst und um meiner Würde willen mich stets beherrschen.
Sonntag, 7. Juli 1895.
Die Sträflinge sind mit ihrer Arbeit fertig. Gestern und heute habe ich meine Lappen gewaschen, mein Geschirr mit heißem Wasser sauber gemacht und mein Wollzeug gestopft, das in einem schrecklichen Zustand war.
Mittwoch, 10. Juli 1895.
Quälereien aller Art sind an der Tagesordnung. Ich darf nicht mehr um meine Behausung herum wandern, ich soll mich nicht mehr hinter derselben niedersetzen, dem einzigen Ort, dem Meer gegenüber, wo es schattig und kühl war. Dann hat man mir die Behandlung der Galeerensträflinge auferlegt, kein Kaffee, und kein Zucker mehr; jeden Tag ein Stück Brot zweiter Qualität und nur noch zweimal die Woche 250 Gramm Fleisch. An den übrigen Tagen Büchsenfleisch oder geräucherter Speck. Wahrscheinlich hängt es auch mit diesen verschärften Verordnungen zusammen, daß ich keine Lebensmittel mehr von Cayenne erhalte.
Ich werde nicht mehr aus meinen vier Wänden heraustreten, ich werde von Brot und Wasser leben; das geht dann eben, so lange es geht.
Freitag, 12. Juli 1895.
Scheint's bin ich doch nicht auf die Sträflingsration gesetzt, sondern habe meine eigenen Vorschriften. Es hat dies also nichts mit der Unterdrückung der Lebensmittelsendung von Cayenne zu thun.
Aber das sind Kleinigkeiten.
Meine Nerven, mein Kopf, mein Herz leiden ununterbrochen.
Nun kann ich mich nicht einmal mehr auf das einzige Plätzchen setzen, wo untertags ein wenig Schatten war, und wo der Seewind, der mich umpfiff, den Accord zu den Vibrationen meines Innern spielte.
Am selben Tag, abends.
Ich erhalte soeben Lebensmittel von Cayenne. Aber an der körperlichen Nahrung liegt mir nichts, man quält mich unsäglich. Man bewacht mich, um Fluchtversuche zu verhüten, als ob ich je etwas derartiges versucht hätte, da ich doch nichts weiter will, als meine Ehre wieder erlangen – ich werde überall verfolgt, und was ich auch thue, erweckt Verdacht. Wenn ich zu rasch gehe, sagt man, ich wolle den Wärter ermüden, wenn ich dann erkläre, daß ich überhaupt meinen Käfig nicht mehr verlassen wolle, droht man mir mit Strafe. Schließlich muß ja doch der Tag der Aufklärung kommen.
Sonntag, 14. Juli 1895.
Ich sah überall die Tricolore flattern, meine Fahne, der ich ehrlich und redlich gedient. Die Feder entfällt meiner Hand vor Jammer, es giebt Empfindungen, die über allen Worten stehen.
Dienstag, 16. Juli 1895.
Die Hitze wird unerträglich. Derjenige Teil der Insel, auf dem ich mich bewegen darf, ist vollständig baumlos; die Cocospalmen wachsen auf der anderen Seite.
Den größten Teil des Tages verbringe ich in meiner Behausung. Und nichts zu lesen. Die Revuen des letzten Monats sind nicht in meine Hände gelangt.
Und was wird unterdessen aus meiner Frau und den Kindern.
Grabesstille, ununterbrochene, tiefe Grabesstille um mich her. –
Sonnabend, 20. Juli 1895.
In grauenvoller Eintönigkeit vergehen hier die Tage in der Erwartung, daß das Morgen besser sein wird. Meine einzige Beschäftigung sind die englischen Studien.
Ein Grab! nur um so grauenvoller, als mein Herz noch lebt.
Abends immer Platzregen und nachher drückende, warme Windstille. Das bedeutet für mich Fieber.
Sonntag, 21. Juli 1895.
Die ganze letzte Nacht Fieber, beständiger Brechreiz. Die Wärter scheinen durch das Klima eben so niedergedrückt, wie ich.
Dienstag, 23. Juli 1895.
Wieder eine schlimme Nacht. Neuralgische Schmerzen, die sich bald zwischen den Rippen bald zwischen den Schultern festsetzten. Aber ich werde auch gegen meinen Körper kämpfen, ich will leben und das Ende der Tragödie sehen.
Mittwoch, 24. Juli 1895.
Ich bekomme noch den Spleen. Kein Wunder, nie sehe ich ein sympathisches Gesicht, nie darf ich den Mund öffnen, Tag und Nacht heißt es Herz und Kopf zusammenpressen.
Sonntag, 28. Juli 1895.
Soeben kommt der Courier von Frankreich. Aber meine Briefe kommen erst nach Cayenne, und dann hierher, obgleich sie schon in Frankreich gelesen und controliert wurden.
Montag, 29. Juli 1895.
Ach, immer dasselbe! All die Tage und Nächte hindurch kämpfe ich gegen mich selber an, dämpfe das Gähren meines Gehirns, ersticke die Ungeduld meines Herzens, suche die Gräuel des Lebens zu überwinden.
Abends.
Ein Tag, so erdrückend und beklemmend und im höchsten Grad entnervend. Meine Nerven sind gespannt, wie Violinsaiten. Wir stehen in der trockenen Jahreszeit und in der Weise wird es fortdauern bis zum Januar. Hoffentlich ist bis dahin alles vorbei.
Dienstag, 30. Juli 1895.
Ein Wärter ging eben ab, das Fieber hat ihn ruiniert. Das ist der zweite, der seit meiner Ankunft entlassen werden mußte. Es thut mir leid um ihn, denn er war ein anständiger Mensch, erfüllte zwar seine Pflicht gewissenhaft aber doch tact- und maßvoll und menschlich.
Mittwoch, 31. Juli 1895.
Ich die letzte ganze Nacht von Dir geträumt, geliebte Lucie, von Dir und unsern Kindern. In fieberhafter Ungeduld erwarte ich den Courier, der von Cayenne kommt. Ich hoffe, daß er Briefe für mich haben wird. Wird er gute Botschaft bringen? Ist man dem Elenden, der das ungeheuerliche Verbrechen begangen, endlich auf der Spur?
Donnerstag, 1. August, mittags.
Die Post aus Cayenne ist heute früh 7¼ Uhr hier eingetroffen. Werden Briefe für mich dabei sein und was für Berichte? Bis jetzt habe ich noch nichts erhalten.
4½ Uhr.
Immer noch nichts. Diese entsetzlichen Stunden der Erwartung!
9 Uhr, abends.
Ich habe nichts erhalten, welch bittere Enttäuschung!
Freitag, 2. August 1895, morgens.
Ich habe eine entsetzliche Nacht hinter mir. Und ich muß immer noch weiter kämpfen. Oft packt mich eine wahnsinnige Lust, vor ungeheuerem Schmerz laut aufzuschluchzen, aber ich würge meine Thränen hinunter, denn ich schäme mich meiner Schwäche vor den Wächtern, die mich Tag und Nacht beobachten.
Nicht einmal einen Augenblick des Alleinseins mit meinem Leid.
Diese Erschütterungen erschöpfen mich vollständig und heute fühle ich mich an Leib und Seele gebrochen. Ich will aber trotzdem an Lucie schreiben, ihr mein Leiden verheimlichen und ihr Mut zurufen. Unsere Kinder müssen stolzen, erhobenen Hauptes ins Leben treten können, was immer auch mit mir geschehen mag.
7 Uhr, abends.
Meine Post war gekommen, soeben hat man mir dieselbe überbracht. Immer noch nichts. Ich werde aber die Geduld besitzen, deren es hier bedarf. Die Umtriebe, deren Opfer ich geworden, sollen und müssen entdeckt werden.
Ich vermag auch noch länger mein Leiden zu ertragen.
Hier einige Auszüge aus den Briefen meiner Frau, die ich am Abend des 2. August erhielt:
Paris, 6. Juni 1895.
Mit lebhafter Besorgnis erwarte ich Deine lieben guten Briefe und Berichte, die mich über Deine Gesundheit beruhigen, denn darum ist mir sehr bange … Das Schiff ist am 23. Mai angekommen, heute haben wir den 6. Juni, und noch besitze ich keine Briefe von Dir. Der Briefträger versetzt mich immer wieder in Aufregung; solch eine zwecklose Aufregung! Meine Gedanken sind nur auf Dich gerichtet, ich lebe mein Leben nur für Dich …
Paris, 7. Juni 1895.
Ich werde während des Schreibens an Dich durch die Ankunft Deiner herrlichen Briefe unterbrochen. Aus Deiner Energie schöpfe ich meine Kraft, Du stützest mich … Andererseits vermag ich es nur dank meiner unendlichen Hoffnung und meiner vollkommenen Zuversicht in die Zukunft, so getrennt von Dir zu leben, und Deine Qualen mit Dir zu tragen. Ich leide aber so sehr unter der Trennung von Dir, daß ich nochmal ein Gesuch eingereicht habe, damit ich Dein Exil mit Dir teilen kann. Ich würde dann wenigstens das Glück empfinden, so zu leben, wie Du, bei Dir zu sein und Dir meine unendliche Liebe beweisen zu können.
Stundenlang, und immer wieder, lese ich Deine Briefe, sie sind mein Trost, während ich auf das Glück warte, daß ich zu Dir kommen kann …
Ich sah deutlich genug, wie sich meine Lage auf den Salut-Inseln gestaltete, um mir Illusionen über den Erfolg des Gesuches meiner Frau, zu mir kommen zu dürfen, zu machen. Ich begriff, daß man sie immer zurückweisen würde.
Sonnabend, 3. August 1895.
Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Diese Aufregungen vernichten mich.
Sehen müssen, wie sich so viel Jammer ungerechterweise um einen herum aufstaut, und nichts thun können, um ihn zu zerteilen!
Sonnabend, 4. August 1895.
Gerade habe ich zwei Stunden, von 5½ bis 7½ Uhr, damit zugebracht, meine Scheuerlappen, meine Stoffbeinkleider und mein Geschirr zu waschen. Diese Kraftanstrengung erschöpft mich, thut mir aber trotzdem gut. Ach, ich kämpfe mit aller Kraft gegen das Klima, gegen meine Qualen, denn ich möchte noch bevor ich zusammenbreche, erfahren, daß mir meine Ehre wieder zurückgegeben worden ist.
Wie sind doch diese Tage, diese Nächte so lang!
Seit zwei Monaten habe ich keine Revuen mehr erhalten, ich habe nichts zu lesen.
Ich öffne den Mund nie, bin schweigsamer, als ein Trappist.
Ich hatte in Cayenne um einen Werkzeugkasten bitten lassen, damit ich mich ein wenig körperlich beschäftigen könne. Sie haben mir das verweigert Warum? Wieder ein Rätsel, das ich nicht versuchen will, zu lösen. Seit neun Monaten stehe ich vor so vielen Rätseln, die meinen Verstand verwirren, daß ich vorziehe, mein Gehirn abzustumpfen und ohne klares Bewußtsein so hinzuleben.
Montag, 5. August 1895.
Die Hitze wird entsetzlich, ich fühle mich von dem furchtbaren Martyrium, welches ich seit drei Vierteljahren ertrage, so erschöpft, so matt.
Sonnabend, 10. August 1895.
Ich weiß nicht, wie lang ich's noch aushalte, so viel Leiden bereiten mir Herz und Kopf, so sehr verwirrt diese entsetzliche Tragödie meinen Verstand, so völlig ist mein Glaube an die menschliche Gerechtigkeit, an die Ehrlichkeit und an das Gute vor den furchtbaren Thatsachen zusammengebrochen.
Wenn ich denn, geliebte Lucie, erliegen sollte, und wenn diese Zeilen Dich erreichen, glaube mir nur, daß ich alles aufgeboten habe, was in Menschenkraft lag, diesem langen und schmerzlichen Martyrium stand zu halten.
Sei dann mutig und stark und Deine Kinder mögen Dein Trost werden und Dir das Bewußtsein Deiner Pflicht eingeben.
Wenn man sein gutes Gewissen, daß man immer und überall seine Pflicht gethan, für sich hat, so darf man sich allerorts erhobenen Hauptes zeigen, man muß sein Gut, unsere Ehre reclamieren.
Montag, 2. September 1895.
Ich habe schon lange meinem Tagebuch nichts mehr hinzugefügt.
Wozu auch? Ich kämpfe um zu leben, obschon meine Lage entsetzlich und mein Herz zermalmt ist, ich möchte gemeinsam mit Frau und Kindern den Tag erschauen, an dem mir meine Ehre wiedergegeben sein wird.
Ich wünsche nur, daß all das bald ein Ende nehme, mein Herz ist krank. Gestern überkam mich eine Ohnmacht vom Herzen aus, es hörte plötzlich zu schlagen auf. Ich fühlte, wie es mit mir ohne Leiden zu Ende ging. Ich bin mir aber nicht klar geworden, was dieser Anfall wirklich war.
Ich warte auf meine Correspondenz.
Freitag, 6. September 1895.
Ich habe immer noch keine Briefe; es giebt keine Worte, die ein solches Leiden zu bezeichnen vermöchten. Wie glücklich sind die Toten!
Und verpflichtet sein, bis zum letzten Atemzug, bis zum letzten Herzschlag am Leben bleiben zu müssen!
Sonnabend, 7. September 1895.
Ich habe soeben Briefe erhalten. Der Schuldige ist noch nicht entdeckt.
Einige Auszüge aus den Briefen meiner Frau, die ich an diesem Tag erhalten.
Paris, 8. Juli 1895.
Deine Briefe vom Mai und vom 3. Juni sind in meine Hände gelangt. Sie haben mir unendlich wohl gethan. Mir war, als hörte ich Dich sprechen, als ob Deine liebe Stimme an mein Ohr klinge; endlich erreichte mich etwas von Dir, Deine schönen, edeln Gedanken spiegeln sich in meinem Geist wieder. Ich würde lügen, wenn ich Dir sagte, ich habe nicht geweint, als ich die sehnsüchtig erwarteten Zeilen erhielt; aber ich habe in tiefinnigem Glück erkannt, daß Du Dich wieder gefunden hast. Du bist so tapfer, daß Du uns alle stützest. Dein Beispiel stärkt uns in der Erfüllung der Aufgabe, die wir uns vorgezeichnet …
Dein Brief an Pierre hat mich in tiefster Seele gerührt; er war entzückt darüber und sein Kindergesichtchen leuchtet auf, wenn ich ihm Deine Zeilen immer wieder vorlese, er weiß sie auch schon auswendig. Er legt sein ganzes Herzchen hinein, wenn er von Dir spricht.
Paris, 10. Juli 1895.
Ich spreche Dir wieder Mut und Geduld zu; mit festem Willen und großer Energie werden wir alle Schwierigkeiten überwinden und das schreckliche Geheimnis, das uns so tief betroffen, in die Hand bekommen. Das Ziel, der einzige Wunsch, die fixe Idee von mir, Mathieu und uns allen geht dahin, Dir jenes höchste Glück zu bereiten, daß Deine Unschuld leuchtend zu Tage tritt. Ich will es dahin bringen, daß die Schuldigen, die eine derartige Infamie, eine solche beispiellose Ungeheuerlichkeit begangen, entlarvt werden. Wenn wir nicht selber die Opfer dieses Verbrechens wären, so würde ich es nicht glauben können, daß es thatsächlich Menschen giebt, die schlecht, feige und ruchlos genug sind, einer Familie, die auf ihren reinen Namen stolz war, ihre Ehre zu entreißen, einen untadeligen Officier verurteilen zu lassen, ohne daß im entscheidenden Augenblick ihr Gewissen ihnen den Schrei eines Geständnisses ausgepreßt hätte.
Lucie.
22. September 1895.
Die ganze letzte Nacht Herzklopfen. Ich bin auch heute morgen sehr müde.
Man steht wahrhaftig verblüfft vor solchen Thatsachen.
Auf eine Schriftprobe hin verurteilt, fordere ich nun schon seit einem Jahr Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die ich fordere, ist nicht eine Discussion über die Schrift, sondern Untersuchung, Entdeckung des Elenden, der den niederträchtigen Brief geschrieben. Dazu besitzt die Regierung alle Mittel. Wir stehen nicht einem gewöhnlichen Verbrechen gegenüber, wobei man die näheren Umstände nicht kennt. Die Umstände sind bekannt, also kann man Licht in die Sache bringen, wenn man nur erst will.
Auf welche Weise das geschieht, ist einerlei.
Warum man aber dieses Licht noch nicht aufgesteckt, die grauenhafte Tragödie noch nicht aufgeklärt hat, das ist der Punct, wo mein Geist und Verstand versagen.
Ah, ich brauche diese Gerechtigkeit, ich fordere sie für meine Kinder, für die Meinigen, und ich werde bis zum letzten Atemzug aufrecht bleiben und sie fordern, wenn ich auch Höllenqualen erdulde.
Aber, was ist das für ein Leben für einen Menschen, dem keine Ehre höher steht, als seine eigene!
Der Tod wäre sicherlich eine Wohlthat für mich gewesen, aber ich habe nicht das Recht, daran zu denken.
27. September 1895.
Schließlich übersteigt ein solches Leiden die Grenzen der menschlichen Kräfte. Es ist, als ob man jeden Tag einen neuen Todeskampf durchzukämpfen hätte, es ist, als ob man einen Unschuldigen lebendig ins Grab versenken würde.
Oh, ihr Gewissen möge sie richten, jene, die mich auf eine Schriftprobe hin verurteilen ließen, ohne faßbare Beweise, ohne Zeugen, ohne Motive, die eine so schändliche Handlung plausibel gemacht hätten.
Wenn man wenigstens nach meiner Verurteilung, wie es mir im Namen des Kriegsministers versprochen worden, entschieden und thatkräftig die Nachforschungen fortgeführt hätte, um den Schuldigen zu entlarven!
Dann ist doch auch noch der diplomatische Weg da.
Eine Regierung verfügt über alle notwendigen Mittel und Wege, ein solches Geheimnis aufzuklären, und das zu thun, ist ihre stricte und unbedingte Pflicht.
Ach, die Menschheit mit ihrem Haß und ihrer Leidenschaft, mit ihrer moralischen Häßlichkeit!
Und die Menschen mit ihren persönlichen Interessen, die sie in allem leiten; was kümmern sie sich um das Uebrige!
Gerechtigkeit ist eine ganz schöne Sache, wenn man Zeit hat, oder wenn man keinen dadurch behindert, oder keinem schadet.
Oft bin ich so trostlos, so ermattet, daß ich mich am liebsten lang auf die Erde hinstrecken und mich völlig gehen lassen möchte, um auf diese Weise ein Ende zu machen, ohne Hand an mich zu legen. Dieses Recht habe ich leider nicht und werde es nie haben.
Die Qual wird zu entsetzlich.
Das muß ein Ende nehmen. Meine Frau muß sich Gehör verschaffen, sie fordert ja Gerechtigkeit im Namen der Unschuldigen.
Wenn ich nur um mein Leben zu kämpfen hätte, dann würde ich wahrhaftig nicht so erbittert ringen, aber ich lebe um meiner Ehre willen, und ich werde sie mir Schritt für Schritt erkämpfen.
Die körperlichen Schmerzen bedeuten nichts, die seelischen sind furchtbar.
29. September 1895.
Heftiges Herzklopfen diesen Morgen. Ich glaubte zu ersticken. Die Maschine wehrt sich, wie lange wird sie es noch aushalten?
Heute Nacht hatte ich auch noch einen furchtbaren Traum, in welchem ich laut nach Dir rief, arme, geliebte Lucie.
Ach, wenn es sich nur um mich handelte, so ist mein Ekel vor Menschen und Dingen so tief, daß ich nur noch die große Ruhe, die ewige Ruhe herbeiwünschen würde.
1. October 1895.
Ich weiß nicht mehr, wie ich meine Empfindungen umschreiben soll, die Stunden scheinen mir Jahrhunderte.
5. October 1895.
Ich habe Briefe von meiner Familie erhalten. Immer noch nichts. Aus allen diesen Briefen stieg ein solcher Schrei der Verzweiflung und des Leidens zu mir empor, daß mein ganzes Wesen davon aufs tiefste erschüttert ist.
Ich habe nun auch den folgenden Brief an den Präsidenten der Republik gerichtet:
»Auf eine Schriftprobe hin des gemeinsten Verbrechens, das ein Soldat begehen kann, angeklagt, und dafür verurteilt, habe ich erklärt und erkläre nochmals, daß ich den Brief, den man mir zuschreibt, nicht geschrieben, und daß ich mich nie gegen die Ehre verfehlt habe.
Seit einem Jahr kämpfe ich, allein mit meinem Gewissen, gegen das furchtbarste Verhängnis, das sich an eines Menschen Ferse heften kann.
Ich spreche nicht von den körperlichen Leiden, die bedeuten nichts, die seelischen Leiden aber alles.
Es ist schon entsetzlich genug, selber so zu leiden, es ist aber grauenhaft, wenn eine ganze Familie mitleiden muß. Das bedeutet die Agonie einer ganzen Familie um eines schändlichen Verbrechens willen, das ich nie begangen habe.
Ich will weder um Gnade, noch um Begünstigung oder um moralische Ueberzeugungen bitten, ich bitte, ich flehe nur, daß man die Machinationen voll und ganz aufkläre, deren unglückliche und bedauernswerte Opfer meine Familie und ich geworden.
Wenn ich bis heute am Leben geblieben bin, Herr Präsident, wenn ich noch fernerhin am Leben bleibe, so geschieht es nur, weil das Bewußtsein einer heiligen Pflicht gegen die Meinigen mich erfüllt und beherrscht, denn sonst wäre ich unter einer solchen Last, die zu schwer für menschliche Schultern ist, schon zusammengebrochen.
Im Namen meiner Ehre, die mir durch einen entsetzlichen Irrtum entrissen worden, im Namen meiner Frau, im Namen meiner Kinder – Herr Präsident, beim bloßen Rühren an diesen Gedanken ächzt und stöhnt rugit et hurle. mein Herz, das Herz eines Vaters, eines Franzosen, eines Ehrenmannes – verlange ich, von Ihnen Gerechtigkeit; die Gerechtigkeit, um die ich Sie von ganzer Seele, mit allen Kräften meines Herzens, mit gerungenen Händen anflehe, ist, daß Sie die Tragödie aufklären, und auf diese Weise dem unerhörten Martyrium eines Soldaten und dessen Familie, denen die Ehre über alles geht, ein Ende machen.«
Ich schrieb auch an Lucie, daß sie energisch von sich aus handeln solle, denn schließlich wirft uns dieser Jammer doch noch alle zu Boden.
Man sagt mir, daß ich mehr an die Leiden der anderen denke als an meine eigenen. Das ist freilich so, wäre ich allein auf der Welt, würde ich nur an mich denken, so wäre mein Grab schon längst gegraben.
Der Gedanke an Lucie und an meine Kinder giebt mir meine Kraft.
Oh, ihr meine lieben Kinder. Sterben ist mir gleichgiltig. Bevor ich aber sterbe, will ich wissen, daß Euer Name von diesem Makel gereinigt ist.
Auszüge aus den Briefen meiner Frau, die ich im October erhielt:
Paris, 4. August 1895.
Ich habe nicht mehr die Geduld, das Datum des Postabgangs zu erwarten, es ist mir ein Bedürfnis, ein wenig mit Dir zu plaudern, mich Deiner großen, geprüften Seele zu nähern und aus Dir wieder einen frischen Vorrat von Kraft und Mut zu schöpfen.
Paris, 12. August 1895.
Endlich habe ich Deine Briefe erhalten, ich verschlinge sie und lese sie mit unersättlicher Gier immer und immer wieder.
Wann wird es mir möglich sein, durch meine Besorgtheit und Liebe die Erinnerung an die grauenhaften Tage, die schrecklichen Jahre zu vertreiben, die Deinem Herzen eine so tiefe Wunde geschlagen? Ich möchte meine Kräfte verdreifachen, um den heiß ersehnten Augenblick rascher herbeiführen zu können und der ganzen Welt zu zeigen, daß wir gereinigt sind von dem schändlichen Schmutz, den man uns ins Gesicht geworfen.
Paris, 19. August 1895.
Wenn ich die Ermattung des Wartens vermindern will oder das Fieber der Ungeduld dämpfen, so komme ich zu Dir, um mir Ruhe und frische Kräfte zu suchen. Es zerreißt mir das Herz, daß Du allein, fern von allen denen, die Du liebst und die Dich von ganzem Herzen lieben, in schrecklichem Warten verzehrst. Du zermarterst Dir den Kopf, um das Geheimnis aufzuklären und Dein armes, gutes Herz, Dein rechtliches Gewissen können an so viel Niedertracht nicht glauben …
Lucie.
6. October 1895.
Eine entsetzliche Hitze, die Stunden lasten wie Blei.
14. October 1895.
Heftiger Wind. Unmöglich auszugehen. Ein Tag von schrecklicher Länge.
26. October 1895.
Ich weiß nicht, wie ich lebe. Mein Gehirn ist wie zerschmettert. Ich würde lügen, wenn ich nicht eingestehen wollte, daß ich oft unaussprechlich leide, daß ich noch etwas anderes wünsche, als die ewige Ruhe, daß der Kampf zwischen meinem (EM vor den Menschen und meiner Pflicht grauenhaft ist. Wenn ich in den langen Nächten, in den einsamen Tagen, mich in meinem erschütterten Verstande frage, wie es denn nur möglich ist, daß ich nach einem ehrenvollen Leben voller Arbeit bis zu diesem Punct habe gelangen können, wenn ich dann die Augen schließen möchte, um nicht mehr zu denken, nicht mehr zu sehen, nicht mehr zu leiden, so raffe ich mich doch mit gewaltiger Kraftanstrengung wieder auf und rufe mir zu: »Du bist nicht allein, Du bist Vater, Du mußt Deine Ehre, die Ehre von Frau und Kind verteidigen.« Ich nehme einen Aufschwung, der mich ein Weilchen trägt, um dann wieder zusammenzubrechen und mich nochmals aufzuraffen.
So verfließen meine Tage.
30. October 1895.
Heftige Herzkrämpfe.
Drückendes Wetter, das alle Energie lahm legt. Uebergangsperiode vor der Regenzeit, auch in Guayana äußerst gefährlich, wird dieses mich nun endgiltig zu Boden werfen?
Nacht vom 2. zum 3. November 1895.
Der Courier von Cayenne ist angekommen, hat aber keine Briefe gebracht.
Ich glaube, daß sich ein Dritter unmöglich die schmerzliche Enttäuschung vorstellen kann, die einen überkommt, wenn man einen ganzen Monat lang sehnsüchtig Nachrichten von Hause erwartet, und dann nichts erhält.
Meine Seele hat aber seit mehr als einem Jahr so viel Schmerzliches über sich ergehen lassen müssen, daß ich die Wunden meines Herzens nicht mehr zu zählen vermag.
Und dennoch hat diese Erregung, die ich doch wahrhaftig nun schon kennen sollte, so oft ist sie mir zu teil geworden, mich so gebrochen, daß ich keinen Schlaf finden kann, obschon ich seit halb sechs Uhr auf bin und mindestens sechs Stunden marschierte, um meine Nerven zu beruhigen.
Was ist das doch für eine Qual, wie lange wird sie noch andauern?
4. November 1895.
Eine entsetzliche Hitze, mindestens 45 Grad.
Es giebt nichts, was so sehr die Kräfte des Gemüts und der Seele unterminiert, wie solch ein ununterbrochenes, angsterfülltes Schweigen, in das nie ein menschliches Wort, nie ein freundliches, oder auch nur ein sympathisches Gesicht hineindringt.
7. November 1895.
Was ist nur aus meiner Korrespondenz geworden? Wo ist sie hängen geblieben? In Cayenne oder Paris? Fast in jeder Stunde des Tages frage ich mich in meiner Herzensangst dasselbe.
Noch glaube ich oft zu träumen, so unglaublich, unerklärlich ist all das, was ich seit einem Jahr erlebe.
Da hat man seine Heimat, das Elsaß, eine unabhängige Stellung inmitten der Familie verlassen, hat seinem Vaterland mit ganzem Herzen, mit ganzer Intelligenz gedient, und das Ende ist, daß man eines schönen Tages auf das Zeugnis eines verdächtigen Papieres hin, eines ebenso infamen, wie verabscheuungswürdigen Verbrechens angeklagt und dafür verurteilt wird, das ist doch wahrlich genug, um einen Menschen für sein ganzes Leben zu Grunde zu richten.
Ich bin aber verpflichtet, zu widerstehen, zu kämpfen, um meiner geliebten Lucie und der Kinder willen.
9. November 1895.
Ein entsetzlich langer Tag. Der erste Regen. Ich muß in meiner Zelle bleiben. Nichts zu lesen. Die Bücher, die mir im Brief vom August avisiert wurden, sind noch nicht hier.
15. November 1895.
Endlich habe ich meine Correspondenz erhalten. Der Schuldige ist noch nicht gefunden.
Nun, ich gehe eben weiter, so lange mich meine Kräfte halten, sie nehmen aber täglich ab. Mein Leben ist ein beständiger Kampf, damit ich diese tiefe Vereinsamung, das ewige Schweigen zu ertragen vermag, dazu noch in einem Klima, das alle Kräfte lähmt, ohne Beschäftigung, ohne Lectüre, allein mit meinen deprimierenden, traurigen Gedanken.
Auszüge aus den Briefen meiner Frau, (erhalten am 15. November 1895):
Paris, 5. September 1895.
Was haben wir für lange Stunden, für bange Tage verlebt, seit dem Tag, an dem unser entsetzliches Unglück wie ein Keulenschlag auf uns niederschmetterte! Wir können nur hoffen, daß wir den Höhepunct unseres Leidensweges überschritten haben; wir haben die entsetzlichste Seelenangst erlitten, und dennoch in unserem Gewissen die Kraft gefunden, das furchtbare Martyrium zu ertragen; Gott, der uns die grausame Prüfung auferlegte, wird uns auch die Willenskraft verleihen, bis zum Ende auszuhalten …
Ich verstehe Deine Qualen so gut und ich teile sie mit Dir; es geht mir aber, wie Dir, ich habe schreckliche Zeiten, wo ich die Geduld verliere; die Stunden des Harrens scheinen mir unendlich lang und unendlich grausam; dann aber denke ich an Dich, an das hohe bel. Beispiel von Standhaftigkeit und Willensstärke, das Du uns giebst und ich schöpfe aus Deiner Liebe zu mir wieder frischen Mut.
Paris, 25. September 1895.
Das ist der letzte Brief, den ich Dir vor Abgang der Post schreibe; es ist mein heißer Wunsch, daß er Dich gesund und immer noch stark und tapfer antreffen möge; ich kann nicht zu Dir kommen, denn ich habe die Autorisation noch nicht erlangt. Das Warten darauf ist so grausam, eine neue bittere Enttäuschung zu all den andern …
Am Fuße des Briefes fanden sich die folgenden paar Zeilen von meinem Bruder Mathieu.
Ich habe Deine guten Briefe, lieber Bruder, erhalten, und es ist ein großer Trost, Folgt noch: un grand reconfort. Dich so stark und mutig zu wissen. Ich sage Dir nicht: hoffe, sondern: glaube, vertraue! Es ist unmöglich, daß ein Unschuldiger die That eines Verbrechers entgelten muß.
Es vergeht kein Tag, wo ich nicht mit meinen Gedanken und mit meinem Herzen bei Dir bin.
30. November 1895.
Ich will nicht von den täglichen Nadelstichen sprechen, denn ich verachte sie. Wenn ich auch nur die allergeringste, unbedeutendste Sache, das Allergewöhnlichste, dessen ich bedarf, von meinem Oberwärter verlange, so wird es mir abgeschlagen. Ich wiederhole auch nie eine Bitte, ich will lieber alles entbehren, als mich vor irgend jemandem demütigen.
Aber schließlich wird mein Verstand doch unter diesen unglaublichen Martern zusammenbrechen.
3. December 1895.
Noch habe ich die Correspondenz vom October nicht erhalten. Düsterer Tag, unaufhörlicher Regen. Mein Kopf geht in Stücke, mein Herz bricht.
Der Himmel ist schwarz wie Tinte! Die Atmosphäre voller Nebel, zum Sterben und Beerdigen so der richtige Tag.
Wie oft kommt mir der Ausspruch Schopenhauers in den Sinn, der angesichts der menschlichen Ungerechtigkeiten ausrief:
»Wenn Gott die Welt erschaffen hat, so möchte ich nicht Gott sein.«
Es scheint, daß die Post von Cayenne angekommen ist, aber sie hat mir nichts gebracht. Was leide ich nicht alles!
Nichts zu lesen, nichts, wodurch ich meinen Gedanken entrinnen könnte; ich erhalte weder Bücher noch Revuen mehr.
Ich marschiere während des Tages bis zur Erschöpfung, um nur meinen Kopf zu beruhigen und meine Nerven zu dämpfen.
5. December 1895.
Ich frage mich thatsächlich, welchen Wert denn heutzutage das Gewissen hat.
Es ist nicht zu glauben, daß sogenannte ehrliche Leute, wie so ein Bertillon, ohne Vorbehalt, zu beschwören wagen, daß, sobald die Schrift des Briefes überhaupt Aehnlichkeit mit der meinigen habe, nur ich allein den niederträchtigen Brief geschrieben haben könne, psychologische Beweise galten ihnen nichts. Ich hoffe nur, daß an dem Tage, an dem der Schuldige entlarvt werden wird, diesen Leuten wenigstens noch so viel Anstand bleibt, daß sie eine Pistole finden und sich eine Kugel durch den Kopf jagen, um sich selber dafür zu richten, daß sie einem Menschen, einer ganzen Familie ein solches Martyrium bereiteten.
7. December 1895.
Ach, wie bin ich oft dieses Lebens überdrüssig, wo man mich mit beständigen Verdächtigungen verfolgt, und wie ein wildes Tier oder den elendesten Sträfling unter ununterbrochener Bewachung hält.
8. December 1895.
Die Neuralgie im Kopf nimmt immer zu und plagt mich furchtbar. Alle Stunden, alle Minuten sind voller Qual.
Und immer dieses Grabesschweigen, von keiner menschlichen Stimme unterbrochen.
Oft ist ein mitleidiges Wort, ein freundlicher Blick wie Balsam für die grausamsten Wunden und betäubt wenigstens auf eine Weile die brennenden Schmerzen. Hier giebt's das nicht.
9. December 1895.
Noch immer keine Briefe. Wahrscheinlich sind sie in Cayenne geblieben und verzögern sich dort um vierzehn Tage. Ich habe den Postdampfer von Frankreich am 29. November vorbeifahren sehen, seit da müssen Briefe in Cayenne liegen.
Am selben Tag, 6 Uhr abends.
Der zweite Courier von Cayenne ist heute um ein Uhr gekommen. Bringt er mir nun meine Correspondenz, und was für Nachrichten?
11. December, 6 Uhr abends.
Immer noch keine Briefe. Mein Herz ist zerquält, zerrissen.
12. December 1895.
Meine Post ist thatsächlich nicht angekommen. Wo bleibt sie? Ich habe deshalb nach Cayenne telegraphieren lassen.
Am selben Tag, abends.
Meine Correspondenz ist in Frankreich zurückgeblieben. Mein Herz leidet, als ob man es mit Dolchstichen tractierte.
Wie das Meer unaufhörlich klagt: ein Widerhall meines blutenden Herzens.
Manchmal packt mich eine dumpfe, herbe Wut gegen die menschliche Ungerechtigkeit, so daß ich mir am liebsten die Haut vom Leibe reißen möchte, um im körperlichen Schmerz das seelische Leiden zu vergessen.
13. December 1895.
Das Ende vom Liede wird sein, daß man mich durch alle diese Qualen zu Tode martert, oder daß man mich dazu bringt, selbst Hand an mich zu legen, um nicht wahnsinnig zu werden. Ich werde diesen Schandfleck Major du Paty, Bertillon und allen denen vermachen, die sich mit solcher unerhörter Ungerechtigkeit besudelten.
Jede Nacht träume ich von meiner Frau und den Kindern. Wie entsetzlich ist dann aber das Erwachen. wenn ich noch im Halbschlummer die Augen öffne und mich dann in dieser Zelle sehe, erfaßt mich einen Augenblick lang eine so furchtbare Todesangst, daß ich die Augen für immer schließen möchte, um nicht mehr zu sehen, nicht mehr zu denken.
Abends.
Heftige Herzkrämpfe und zahlreiche Erstickungsanfälle.
14. December 1895.
Ich bitte um ein Bad, der Arzt hat mich dazu autorisiert. Nein, läßt mir der Oberaufseher antworten, und einige Augenblicke später nimmt er selber eins. Ich weiß wirklich nicht, warum ich ihn überhaupt noch um etwas bitte, bis jetzt hatte ich nur keine Bitte wiederholt, von nun an werde ich auch keine mehr stellen.
16. December 1895.
Die Zeit von zehn bis drei Uhr ist furchtbar, ich habe nichts, das meine niederdrückenden Gedanken vertreiben könnte.
18. December 1895.
Wie sehe ich Luch alle drei, Dich, Du geliebter, kleiner Junge, Dich, mein herziges Töchterlein, Dich, geliebte Lucie in meiner Erinnerung, wie giebt mir der Gedanke an Luch die Kraft, alles zu erleiden, alles zu erdulden!
20. December 1895.
Es wird mir kein Schimpf erspart. Wenn ich meine Wäsche, die auf der Königsinsel gewaschen wird, zurückerhalte, so nimmt man sie auseinander, untersucht sie nach allen Seiten und wirft sie mir dann hin, als wäre ich der gemeinste Verbrecher.
Wenn ich aber das Meer betrachte, so steigt in mir immer wieder die Erinnerung an schöne, frohe Stunden auf, die ich mit Frau und Kindern an der See verbracht. Ich sehe mich, wie ich mit Klein-Pierre am Strand spazierte, mit ihm spielte und herumrannte, und für ihn die schönsten Zukunftsträume spann.
Dann werde ich mir wieder der entsetzlichen gegenwärtigen Lage bewußt, der Schande, die man meinem und meiner Kinder Namen angethan, meine Augen werden trübe, das Blut steigt mir in den Kopf, das Herz klopft zum Zerspringen, und die Entrüstung wird Herr über mich. Die Wahrheit muß, muß entdeckt werden, es muß Aufklärung geschafft werden, wie groß auch unsere Leiden sein mögen.
22. December 1895.
Noch nicht die geringste Nachricht von zu Hause. Grabesstille. Was für eine schreckliche Nacht liegt hinter mir! Dieses Kommen und Gehen der Wärter nach der Wachtstube, die Lichter, die die ganze Nacht hin- und herflackern machen meine schweren Träume noch beängstigender.
25. December 1895.
Ach Gott, immer dasselbe, keine Briefe! Vor zwei Tagen ist der englische Postdampfer vorbeigefahren, wahrscheinlich sind meine Briefe nicht angekommen, sonst hätte man mir sie doch übergeben, was muß ich nur denken und glauben?
Es regnet beständig.
Wie es etwas aufheitert, gehe ich hinaus, um mich ein wenig zu erholen. Es fielen noch einige Tropfen. Der Chef sagt zu dem Wärter, der mich begleitet: »Man darf nicht draußen bleiben, wenn es regnet.« In welcher Instruktion mag nun das wieder stehen? Aber ich halte es unter meiner Würde, zu antworten, ich stelle mich doch über all diese Kleinlichkeiten und Gehässigkeiten des täglichen Lebens.
Nacht vom 26. zum 27. December 1895.
Unmöglich, zu schlafen.
Seit fünfzehn Monaten lebe ich in diesem quälenden Traum, wann wird er zu Ende sein?
28. December 1895.
Ich bin totmüde, und mein Kopf ist wie zermalmt, was geht vor? warum sind die Briefe vom October nicht an mich gelangt? O, Lucie, wenn ich erliege, bevor das entsetzliche Martyrium zu Ende ist, und Du diese Zeilen liesest, so wirst Du ermessen können, was ich gelitten.
So oft, wenn ich zusammenbreche, wenn mich ein tiefer Ekel vor allem erfaßt, erwecken mich die drei Namen: Lucie, Pierre, Jeanne, die ich vor mich hinflüstere, wieder, richten meine Energie auf und geben mir immer neue Kraft
Am selben Tag, 11 Uhr vormittags.
Ich sah soeben den französischen Postdampfer vorbeifahren. Ach, aber meine Briefe gehen erst nach Cayenne. Doch hoffe ich, daß der erste Courier von Cayenne mir sie bringen wird, und daß ich endlich Nachrichten von meiner geliebten Frau, den Kindern, den Meinigen erhalte; ich werde auch erfahren, ob das Rätsel der ungeheuerlichen Begebenheit gelöst ist, ob ich endlich ein Ende meines entsetzlichen Leidens absehen kann.
Sonntag, 29. December 1895.
Ich habe Sonntags inmitten der Meinen einen köstlichen Tag verlebt, und habe mit meinen Kindern gespielt.
Klein-Pierre ist nun schon fast fünf Jahre alt, also beinahe ein großer Junge. Ich hatte so ungeduldig diesen Zeitpunct herbeigewünscht, um das Kind auf Spaziergängen mitzunehmen, um mit ihm zu plaudern, um seinen jungen Geist für das Schöne und Wahre zu öffnen, um seine Seele so hoch zu entwickeln, daß die Häßlichkeit der Welt sie nicht beflecken könne; wohin ist das alles? Dieses ewige Warum!
30. December 1895.
Meine Haut ist glühend heiß, das Fieber verzehrt mich, wann wird endlich diese Qual vorüber sein?
Am selben Tag abends.
Meine Nerven quälen mich derart, daß ich mich fürchte, mich niederzulegen. Diese Grabesstille, seit drei Monaten keine Nachrichten von zu Hause, der Mangel an Lectüre, das alles vernichtet mich, drückt mich zu Boden.
Ich muß alle Kraft zusammennehmen, um immer noch zu widerstehen, und mir leise die drei Namen, meinen Talisman, vorhalten: Lucie, Pierre, Jeanne!
31. December 1895.
Was für eine entsetzliche Nacht! Seltsame Träume, ungereimte Schreckbilder, übermäßige Transpiration.
Ich sah heute in den ersten Tagesstunden das Schiff von Cayenne ankommen. Ich bin auch seither in merkwürdiger Aufregung, und frage mich jeden Augenblick, ob ich nun endlich Nachrichten von den Meinen erhalten werde.
Während dieses angstvollen Harrens klopft mein Herz zum Zerspringen.
1. Januar 1896.
Ich habe endlich gestern die October- und Novemberbriefe erhalten. Immer noch nichts, die Wahrheit ist noch nicht aufgedeckt.
Was habe ich Lucie mit meinen letzten Briefen für Schmerzen bereitet, wie zerfleische ich ihr Herz durch meine Ungeduld, und die ihrige ist doch eben so groß, wie meine!
Auszüge aus den Briefen meiner Frau (erhalten am 1. Januar 1896):
Paris, 10. October 1895.
Mein geliebter Mann, diese Post hat mir nur einen Brief von Dir gebracht; derjenige, den Du am 5. August geschrieben, gelangte nicht in meinen Besitz. Die lieben Zeilen, von Deiner Hand geschrieben, dieses einzige Lebenszeichen, das ich von Dir habe, trösteten mich wie immer, Dein Mut belebt den meinigen, Deine Kraft verleiht mir Kräfte, um den Kampf durchzuführen …
Paris, 15. October 1895.
Dieses Datum erweckt so traurige Erinnerungen in mir, daß ich nicht anders kann, als einen Augenblick zu Dir zu kommen. Mir wird dabei wohler, und mir ist, als ob ich Dir damit auch wohl thue. Ich will nicht mehr von den schrecklichen Tagen zu Dir sprechen, die wir, jedes für sich leidend, zugebracht; es ist besser, nicht daran zu denken, die Wunde ist immer noch offen, und es ist nicht nötig, daß man sie noch brennender macht; ich will Dir dagegen sagen, daß wir voller Hoffnung und Vertrauen sind, daß unsere Willenskraft auch den Sieg über die Hindernisse erringen wird, daß wir endlich die Oberhand erlangen werden über die Elenden, die das abscheuliche Verbrechen begangen …
Paris, 25. October 1895.
Die Monate sind lang, wenn man so entsetzlich leidet; sie gleichen sich alle in ihrer Monotonie und Trauer. Da hast Du Deine Briefe wieder, wie immer sollen sie Dir Worte des Trostes bringen, sie sollen Dir ein Widerhall unserer großen, tiefen Zärtlichkeit sein … Das Warten ist lang und schmerzlich, aber zähle auf uns, es wird nicht umsonst sein …
Paris, 10. November 1895.
Ich lese den einzigen Brief, den ich von Dir habe, immer und immer wieder, er wurde mir heute früh erst zugestellt. Es ist zwar herzlich wenig, aber ich bin doch so glücklich, wenigstens dieses armselige Echo Deines geliebten Wesens zu besitzen. Ich zweifle nicht daran, daß Du oft mit mir geplaudert hast, obschon es Dir peinlich genug gewesen sein mag, zu schreiben, da Du mir nichts sagen konntest und Dein Herz nicht ausschütten wolltest, aus Besorgnis, mir zu sehr wehe zu thun.
Warum erhalte ich die Briefe nicht, die doch mein einziger Trost sind? Warum verschärft man noch die traurige Lage zweier Geschöpfe, die schon unglücklich genug sind? …
Unsere Kleinen, Pierre und Jeanne, sind immer gute, artige Kinder, gemütvoll und liebenswürdig gegen jedermann; sie sehen auch beide gut aus und werden täglich größer und kräftiger, was wird das für Dich für ein Glück sein, wenn Du, nachdem wir endlich die Wahrheit verkündet haben werden, diese teuren kleinen Geschöpfe, die Du so innig liebst, um derentwillen Du so grausam leidest, in Deinen Armen halten kannst, und wenn sie Dir durch ihre Liebe Dein Leben glücklich und freundlich gestalten werden …
Paris, 25. November 1895, mitternacht.
Ich muß die Briefe morgen früh befördern, wenn sie mit dem Dampfer vom 9. December abgehen sollen, und trotzdem es schon spät in der Nacht ist, kann ich doch nicht anders, als noch mit Dir plaudern. Es ist mir ein wahrer Herzenskummer, daß ich diese leblosen, alltäglichen und kühlen Zeilen an Dich senden muß, die meinen Gedanken, meiner Zärtlichkeit, meiner Liebe so gar nicht entsprechen. Ich kann Dir nicht sagen, was ich Dir gegenüber empfinde, mein Gefühl ist zu intensiv, als daß ich es Dir ausdrücken könnte; aber mir scheint, als sei ich nur noch ein Teil meiner selbst: meine Seele, mein Geist sind dort drüben auf den fernen Inseln, bei Dir, geliebter Mann. Meine Gedanken begleiten Dich Tag und Nacht, das hilft mir auch als mächtige Stütze das Leben zu ertragen …
Lucie.
1. Januar 1896.
Tage und Nächte vergehen trostlos, eintönig, und endlos langsam, bei Tag erwarte ich ungeduldig die Nacht und hoffe im Schlaf einige Ruhe zu finden, bei Nacht erwarte ich nicht weniger ungeduldig den Tag, und hoffe, durch ein wenig Thätigkeit meine Nerven beruhigen zu können.
Wie ich so die Briefe der letzten Post immer wieder las, wurde mir klar, was für ein schwerer Schlag es für die Meinigen sein würde, wenn ich vom Schauplatz verschwände, daß meine Pflicht gegen alle es erfordert, bis zum letzten Atemzuge Stand zu halten.
12. Januar 1896.
Antwort des Herrn Präsidenten der Republik auf mein Gesuch, das ich am 5. October 1895 an ihn gerichtet hatte:
»Ohne Motivierung abgewiesen.«
24. Januar 1896.
Ich habe nichts weiter hinzuzufügen, die Stunden gleichen sich alle, in angstvollem, gequältem Hoffen auf ein besseres Morgen.
26. Januar 1896.
Endlich habe ich nach langen Monaten des Wartens ein ordentliches Packet Bücher erhalten.
Wenn ich nun meine Gedanken fixieren muß, so hat mein Gehirn wenigstens auf Augenblicke Ruhe, aber ich kann leider nicht lange lesen, es ist alles in mir viel zu sehr erschüttert.
2. Februar 1896.
Der Courier von Cayenne ist angekommen, er hat keine Briefe für mich.
12. Februar 1896.
Eben erst habe ich meine Post erhalten. Immer noch nichts, ich muß eben weiter kämpfen, weiter stand halten.
Auszüge aus den Briefen meiner Frau (erhalten an jenem Tag):
Paris, 9. December 1895.
Wie immer haben mich Deine heißersehnten Briefe tief bewegt und mir meinen Sonnenstrahl gebracht, es ist der einzige Augenblick der Erholung und Freude in den langen Monaten, in den schmerzlichen, lastenden Tagen, wenn ich diese Zeilen lese, aus denen so viel Energie und Willenskraft spricht, so empfinde ich, wie Dein Wesen in meinem schwingt; Deine seelische Thatkraft stützt auch meine Kräfte, mir scheint, als verdoppelten sie sich unter der Macht Deines Willens …
Paris, 19. December 1895.
Voriges Jahr um diese Zeit hofften wir, am Ende unseres Leidenswegs zu sein, wir hatten unser volles Vertrauen in die Gerechtigkeit des Gerichtshofes gesetzt, wir waren über den grauenhaften Irrtum, der begangen worden war, entsetzt. Nun liegt ein ganzes Jahr hinter uns, das uns sowohl durch die nichtswürdige Kränkung, die man uns angethan, als auch durch das unerträgliche Leben, das man Dir körperlich und seelisch bereitete, die entsetzlichsten Leiden gebracht …
Paris, 25. December 1895
Es drängt mich, vor Abgang der Post noch einmal mit Dir zu plaudern. Ich sage Dir immer wieder dasselbe, aber das macht nichts, ich spreche doch mit Dir, ich komme Dir auf einen Augenblick näher und das thut mir wohl …
Ich habe sozusagen garnicht von den Kindern gesprochen und doch sind sie es, die uns ans Leben knüpfen, ihretwegen ertragen wir diese unerträgliche Lage, und Gott sei Dank, daß sie nichts ahnen. Ihnen ist noch alles Freude, sie singen und lachen und schwätzen und erfüllen das Haus mit frischem Leben …
Lucie.
28. Februar 1896.
Nichts mehr zu lesen. Tage und Nächte sind sich gleich. Ich öffne nie den Mund, ich verlange nie mehr etwas. Mein Gespräch beschränkte sich auf die Frage, ob die Post angekommen sei oder nicht. Man verbot mir zu sprechen, oder, was auf eins heraus kommt, man untersagte den Wärtern, mir auf die ganz gewöhnlichen, unbedeutenden Fragen zu antworten, die ich an sie richtete.
Ich möchte eben doch den Tag erleben, wo die Wahrheit entdeckt sein wird, um meinen Schmerz, die Qualen, die man mir auferlegt, in die Welt hinaus schreien zu können.
3. März, abends 6 Uhr.
Der Courier von Cayenne kam diesen Morgen. Habe ich Briefe?
4 März 1896.
Keine Briefe. Wie so oft, viel zu oft, wiederholt sich diese Pein.
8. März 1896.
Düstere Tage. Es ist mir alles untersagt worden, ich stehe immer nur meinen Gedanken gegenüber.
9. März 1896.
Heute sehr früh sah ich die Jolle des Commandanten der Strafcolonie ankommen. Sollte etwas für mich da sein?
Ach, es war nichts, es handelte sich nur um eine Visitation.
Ich lebe nur noch durch eine unerhörte Anspannung der Nerven, in der angstvollen Erwartung auf das Ende dieser namenlosen Qualen.
12. März 1896
Meine Correspondenz ist gekommen; ach, immer noch nichts.
Auszüge aus den Briefen meiner Frau, (erhalten an diesem Tag):
Paris, 1. Januar 1896.
Der erste Januar ist noch länger, noch schmerzlicher als die anderen Tage. Warum? frage ich mich. Die Ursache unserer Leiden ist dieselbe, Tag oder Nacht, so lange Deine Unschuld nicht anerkannt ist; das Gewicht, das uns bedrückt, ist zu schwer, als daß wir irgendwie am Leben der Außenwelt teilnehmen könnten und einen Unterschied zwischen irgend welchen Tagen zu machen vermöchten. Und dennoch stehn wir dann im Bann noch traurigerer Empfindungen. Das hängt ohne Zweifel damit zusammen, daß diese Tage unter Menschen, welche sich lieben, Zeitpuncte größten Glückes, höchster Freude sind, und wir Geprüfte, Unglückliche empfinden noch tiefer das Bedürfnis, uns gegenseitig zu nähern, uns zu stützen und unsere Kräfte durch eine tiefgründige Zuneigung zu stärken …
Paris, 7. Januar 1896.
Ich habe eben Deine Briefe erhalten, wenn ich nur schon Deine Schrift sehe, bin ich immer bis in die tiefste Seele ergriffen, und wenn ich Deine Gedanken in mich aufnehme, so überkommt mich eine intensive Freude und Rührung …
Deine Briefe verraten mir Deine starke Willenskraft, aber ich lese doch Deine Ungeduld heraus, die ich so sehr gut begreifen kann. Wie könnte es auch anders sein, wo Du in vollständiger Einsamkeit so ganz Dir selber überlassen bist, wo beständig Todesqualen an Dir nagen, wo Du nichts von dem Schurkenstreich begreifst, der uns alle so unglücklich gemacht, wo Du aus dem vollen Glück heraus den Deinigen entrissen wurdest; Deine Lage ist sicherlich die entsetzlichste, die man sich vorstellen kann …
Lucie.
Dem letzten Brief vom Januar waren folgende Zeilen von meinem Bruder beigefügt:
Mein lieber Bruder,
meine ganze Willenskraft, meine ganze Intelligenz sind wirklich, wie Du in Deinem Brief vom 20. November sagst, auf ein Ziel concentriert: die Wahrheit zu entdecken. Wir werden es auch erreichen.
Ich muß so lange mich nur immer wiederholen, bis ich Dir werde sagen können: die Wahrheit ist erkannt, die Sache ist aufgeklärt. Du mußt aber bis zu jenem Tag am Leben bleiben, Du mußt alle Kräfte Deines Wesens anspannen, um den körperlichen und seelischen Qualen stand zu halten, und ich weiß, daß das nicht über Deinen Mut geht …
Mathieu.
15. März, 4 Uhr früh.
Unmöglich, zu schlafen. Mein Kopf ist durch diese geistige und körperliche Unthätigkeit entsetzlich ermüdet.
Die Bücher, die mir Lucie in den letzten drei Briefsendungen avisierte, sind noch nicht hier. Mein Kopf ist auch so ermüdet, so erschüttert, daß es mir unmöglich ist, längere Zeit nacheinander zu lesen. Aber dennoch verschaffen mir die kurzen Augenblicke, in denen ich meinen Gedanken entfliehen kann, einige Erleichterung.
27. März 1896.
Endlich habe ich die Bücher erhalten, die am 25. November 1895 abgeschickt wurden.
1. April 1896.
Die Februarpost ist angelangt, der Schuldige ist immer noch nicht entlarvt.
Was ich auch leiden möge, die Aufklärung muß herbeigeführt werden; darum: keine Klagen!
Auszüge aus den Briefen meiner Frau (erhalten am 5. April):
Paris, 11. Februar 1896.
Ich habe Deine Briefe vom December noch nicht; ich will nicht über die Qualen klagen, die mir diese Verzögerung verursacht, es kann sich niemand vorstellen, wie lebhaft man unter Unruhe und Besorgnis leidet. Es giebt nichts Entsetzlicheres, als ohne Nachricht zu sein, von einem Wesen, das man sehr unglücklich weiß, und dessen Leben man höher wertet, als das eigene …
In den ruhigen Stunden frage ich mich oft, warum nur wir so geprüft worden, aus welchem Grunde wir berufen sind, eine Marter zu ertragen, gegen die der Tod ohne Schrecken wäre …
Paris, 18. Februar 1896.
Immer noch bin ich ohne Nachricht; und doch weiß ich, daß Deine Briefe schon seit drei Wochen beim Ministerium liegen. Ich bin so ungeduldig, bis ich sie erhalte, und mir dadurch der Trost zu teil wird, den Du mir jeden Monat bietest; jede Verspätung der Post bringt mich in die schmerzlichste Aufregung …
Paris, 25. Februar 1896.
In dem Augenblick, als ich meinen letzten Brief an Dich beendigte, wurden mir endlich Deine Briefe überbracht. Ich danke Dir dafür, daß Du so bewundernswürdig stand hältst, ich danke Dir für die tröstlichen Zeilen, die Du mir sendest …
Lucie.
5. Mai 1896.
Ich habe nichts mehr zu berichten. Es gleicht sich alles an Fürchterlichkeit.
Was ist das für ein entsetzliches Leben Tag und Nacht, nicht einen Augenblick Ruhe. Bis vor kurzem blieben die Wärter nachts in der Wachtstube sitzen, und ich wurde nur alle Stunden geweckt. Jetzt müssen sie ununterbrochen patrouillieren, und die meisten tragen Holzschuhe.
Während mehr als zweier Monate wurde das Tagebuch nicht mehr benutzt. Die Tage vergingen alle gleich traurig, gleich gequält, aber ich bewahrte mir den festen Willen, zu kämpfen, und mich durch keine der mir auferlegten Qualen niederdrücken zu lassen. Außerdem hatte ich im Juni heftige Fieberanfälle, die sogar Gehirncongestionen hervorriefen.
Einige Auszüge aus den Briefen meiner Frau (erhalten im Mai und Juni 1896):
Paris, 29. Februar 1896.
Deine Briefe vom December kamen gerade, als ich meine Post fertig gestellt hatte; die wenigen Zeilen, die ich noch hinzufügen konnte, haben Dir nur schwach das Glück, die ungeheuere Freude wiederspiegeln können, die ich durch sie empfangen. Deine zärtlichen Worte haben mich tief gerührt. Wenn man so recht betrübt ist, wenn das Herz blutet und die Seele trauert, so giebt es nichts Wohlthuenderes, als das Bewußtsein, daß uns über all dem Kummer eine feste Zuneigung, eine intensive Hingebung sicher ist, die ihre ganzen verfügbaren Kräfte, ihren ganzen Willen, ihre ganze Intelligenz concentriert und anspannt, um uns zu stützen. Und wenn sie auch keine thatsächliche Hilfe bringen kann, so giebt sie uns doch eine seelische Stütze, die, da wir sie immer um uns wissen, unsere Kräfte verzehnfacht und uns verhindert, in den Augenblicken allzugroßen Schmerzes feige zusammenzubrechen …
Paris, 20. März 1896.
Du kannst Dir vorstellen, wie entsetzlich mir zu Mute ist, wenn ich die zweite Hälfte des Monats herankommen sehe, die für mich die Absendung der Post bedeutet. Bis zum letzten Augenblick hoffe ich, daß ich Dir das Ende Deiner Leiden, das Ende unseres Kummers werde verkünden können. Und dann gehen die Briefe ab, wie immer, ohne Nachrichten, und mir ist, als zerrisse es mir das Herz, wenn ich an die Enttäuschung denke, die Du dadurch erleiden mußt …
Paris, 1 April 1896.
Ich habe die letzte Post mit großer Trauer abgehen sehen, bis zum letzten Augenblick hoffte ich, Dir einige Trostesworte beifügen zu können …
Mut, Mut! Wieder und wieder bitte ich Dich darum, mit aller Kraft, mit dem ganzen Flehen der Frau, die Dich anbetet, im Namen Deiner geliebten Kinder, die Dich in ihren Herzchen schon so innig lieb haben, und die einst eine unendliche Dankbarkeit empfinden werden, wenn sie die Größe des Opfers zu ermessen imstande sind, das Du ihnen gebracht. Ich kann Dir meinerseits nie genug sagen, welche Bewunderung ich Dir gegenüber empfinde, mit wie viel Zärtlichkeit Dich meine Gedanken Tag und Nacht begleiten, wie furchtbar ich leide, weil Du unglücklich bist. Alle Deine Kümmernisse, Dein Schmerz, alle die Empfindungen, die Dich quälen, hallen in meiner Seele wieder und verursachen mir das bitterste Leid. Nichts kann mich darüber trösten, daß ich nicht bei Dir leben kann, daß ich nicht dort bin, um Dich zu stützen, um den Augenblicken der Mutlosigkeit vorzubeugen, um Deine Leiden zu mildern. Es wäre für mich in unserem entsetzlichen Jammer eine große Beruhigung gewesen, wenn ich hätte um Dich sein können, wenn ich Dir hätte das Bewußtsein verleihen können, daß neben Dir eine liebende Seele wacht, die immer bereit ist, Deine Klagen anzuhören, das Uebermaß Deines Schmerzes, Deiner Leiden in sich aufzunehmen. Und diese intensive Zuneigung, mit der ich Dich während Deiner Leiden so gerne umgeben hätte, nimmt, wenn das überhaupt möglich ist, immer noch zu durch die furchtbaren Qualen, die die große Entfernung zwischen uns, das Ausbleiben von Nachrichten, das trostlose, einsame Leben, das Du führen mußt, verursacht … Ich will es gar nicht mehr versuchen, dieses Zusammenfließen von Empfindungen zu schildern, es ist zu traurig, als daß ich Dich damit behelligen wollte, zu intensiv, zu tief, als daß ich sie diesem kalten, banalen Papier anvertrauen möchte …
Lucie.
26. Juli 1896.
Es ist schon lange her, daß ich nichts in mein Tagebuch eingetragen.
Meine Gedanken, meine Gefühle, meine Traurigkeit sind sich gleich geblieben; wenn auch die physischen und geistigen Kräfte immer schwächer werden, so bleibt doch mein Wille sich an Stärke gleich.
Ich habe diesen Monat nicht einmal Briefe von meiner Frau erhalten.
2. August 1896.
Endlich brachte man mir meine Post von Mai und Juni. Immer noch nichts; das schadet nichts. Ich werde eben fortfahren, gegen meinen Körper, gegen mein Gehirn, gegen mein Herz zu kämpfen, so lange auch nur noch ein Schatten von Kraft in mir ist, so lange man mich noch nicht in die Grube geworfen, denn ich habe den festen Willen, das Ende dieser Tragödie zu schauen.
Ich wünsche für uns alle, daß dieser Augenblick nicht mehr ferne sei.
Auszug aus den Briefen meiner Frau, (erhalten am 2. August 1896):
Paris, 16. Juni 1896.
Noch bin ich ganz erregt von Deinen lieben, guten Briefen, die ich soeben erhalten. Im ersten Augenblick, wenn ich Deine liebe Handschrift erblicke, wenn ich Deine Zeilen lese, die mir Deine Gedanken zutragen, die einzigen Berichte, die ich während eines langen Monats von Dir habe, bin ich wie wahnsinnig vor Schmerz; mein übervoller Kopf ist nicht mehr im stande, irgend etwas zu verstehen, und heiße Thränen entströmen meinen Augen. Dann nehme ich mich wieder zusammen, ich schäme mich meiner Schwäche, schäme mich, daß ich mich habe von der Erregung meistern lassen, und ich hole mir neuen Vorrat an Mut aus Deiner Festigkeit, aus Deiner Energie, aus meiner mächtigen, kraftvollen Liebe zu Dir. Trotzdem thun mir Deine Briefe unsäglich wohl und wenn die Erregung mich überwältigt, so habe ich doch das Glück, Deine Worte zu lesen und einige Augenblicke lang mich der Illusion hingeben zu können, daß ich Deine geliebte Stimme höre …
Paris, 25. Juni 1896.
Ich füge meinem Brief vor Abgang der Post noch einige Zeilen bei; es liegt mir daran, Dir zu sagen, daß ich stark bin, daß mein Wille unerschütterlich fest steht, daß es mir gelingen wird, Dir Deine Ehre wiederzuerlangen, und ich flehe Dich an, daß Du gemeinsam mit mir diese Hoffnung, diesen Glauben für die Zukunft aufrecht hältst, der uns in den Stand setzt, die schlimmste Lage zu ertragen, um unseren Kindern einen fleckenlosen, geachteten Namen zu hinterlassen …
30. August 1896.
Wieder stecke ich in der nervenzerreibenden Periode, in der ich meine Post erwarte, wo ich mich frage, an welchem Tag ich sie erhalten werde, und was für Nachrichten sie enthalten mag.
Wie schwer muß für meine arme Lucie der Monat August gewesen sein! Da hatte sie vorerst meinen Brief vom Anfang Juli, den ich mitten im Fieber, das mich seit zehn Tagen nicht los ließ, und unter dem Eindruck, meine Correspondenz nicht erhalten zu haben, geschrieben. Es traf wieder alles zusammen, um mein Leiden zu verschärfen. Ich vermochte nicht, mich zurückzuhalten, zu beherrschen, ich habe ihr noch meine Verzweiflung, meinen Schmerz entgegengeschrieen, als ob sie nicht schon genug litte, als ob ihre Ungeduld, das Ende des furchtbaren Dramas zu erleben, nicht ebenso groß wäre, als die meinige. Arme, geliebte Frau! Wie traurig muß auch ihr Geburtstag verflossen sein. Ich glaubte nicht mehr leiden zu können, als es schon der Fall war, und doch war jener Tag noch schlimmer, als die anderen. Wenn ich mich nicht mit ingrimmiger Willensanstrengung zurückgehalten und mein Herz, mein ganzes Wesen in Fesseln geschlagen hätte, so hätte ich vor Schmerz aufgeheult, so herb, so lebhaft, so ungestüm war meine Pein.
Durch den Weltenraum, geliebte Lucie, grüße ich Dich in diesem Augenblick, aus meiner tiefen Liebe, aus meiner ganzen Zärtlichkeit heraus, und rufe Dir immer wieder denselben unveränderlichen, feurigen Ruf zu: Mut und wieder Mut.
Vor dem Ziel, das uns bevorsteht, die ganze Wahrheit, die ganze Ehre unseres Namens an den Tag zu bringen, müssen alle Leiden, alle unsagbaren Qualen verschwinden und sich verwischen.
1. September 1896.
Ein grausam langer Tag mit der jeden Monat wiederkehrenden Erwartung auf die Post, mit der Frage, was sie mir bringen wird.
Ich bin sozusagen in meinem Schmerz crystallisiert; ich muß alle Kräfte concentrieren, um nicht mehr zu denken, nicht mehr zu sehen.
Was ist das doch für ein Schmerz, eine Qual für eine ganze Familie, deren Leben in Ehren, Rechtlichkeit und Gradheit verfloß!
Mittwoch, 2. September 1896, 10 Uhr morgens.
Meine Nerven haben mir diese Nacht furchtbare Leiden bereitet, ich hätte sie gerne heute morgen etwas durch Wandern beruhigt. Aber wir haben Platzregen, was in der trockenen Jahreszeit, in der wir uns jetzt befinden, nur ausnahmsweise vorkommt.
Und wieder nichts zu lesen.
Von all den Büchern, die mir Lucie seit März geschickt hat, ist mir kein einziges mehr zugekommen. Ich habe nichts, um die grausame Länge der Stunden totzuschlagen, Ich hatte vor langer Zeit um irgend eine körperliche Arbeit gebeten, damit ich mich etwas beschäftigen könne, man hat mir darauf nicht geantwortet.
Aufmerksam beobachte ich den Horizont durch mein Gitterfenster, um zu sehen, ob ich nicht ein Rauchwölkchen entdecken könne, das mir die Ankunft des Postdampfers von Cayenne verkündet.
Am selben Tag, mittags.
Ich erblicke gegen Cayenne hin eine Rauchwolke am Horizont, das muß der Postdampfer sein.
Am selben Tag, 7 Uhr abends.
Der Postdampfer ist um ein Uhr in die Rhede eingelaufen, man hat mir nichts gebracht, wahrscheinlich hatte er keine Briefe für mich. Welche Höllenqualen!
Aber über allem schwebt unbeweglich die Sorge um unsere Ehre; das Ziel ist gesteckt, unveränderlich, was wir auch immer zu leiden haben mögen.
Donnerstag, 3. September, 6 Uhr morgens.
Eine entsetzliche Fiebernacht mit Delirium.
9 Uhr morgens.
Die Jolle ist angelangt, hat mir aber keine Briefe gebracht. Es ist also klar, daß sie in Cayenne geblieben sind, wo sie seit dem 28. vorigen Monats liegen.
Freitag, 4. September 1896.
Gestern erhielt ich die Post, die also doch angelangt war, es war nur einer der Briefe dabei, die mir meine geliebte Lucie geschrieben. Wie fühlt man doch bei allen ein entsetzliches Leiden, eine grimmige Verzweiflung darüber heraus, daß sie mir noch nicht von der Entdeckung des Schuldigen berichten können, die für uns alle das Ende dieser Marter bedeutet.
Der Schweiß tropfte mir beim Lesen der Briefe von Hause von der Stirne, mir zitterten die Knie.
Ist es denn wirklich möglich, daß menschliche Wesen unverdienterweise derartig leiden müssen?
Vor einer so furchtbaren Lage verlieren die Worte ihre Kraft, man leidet nicht einmal mehr, so groß ist die Verblüffung.
Arme, arme Lucie, geliebte, gute Kinder!
Möge an dem Tage, wo die Wahrheit erkannt, der Schuldige entlarvt sein wird, die Last dieser namenlosen Leiden auf diejenigen zurückfallen, die einen Unschuldigen und seine Familie derart verfolgt haben!
Sonnabend, 5. September 1896.
Ich habe nach einander drei lange Briefe an Lucie geschrieben, um ihr zu sagen, daß sie sich nicht niederdrücken lassen, daß sie handeln und alle Mittel in Bewegung setzen soll, denn eine derartige Lage, die man so lange schon erduldet, wird zu grauenhaft. Es handelt sich um die Ehre unseres Namens, um das Leben unserer Kinder; vor diesem Ziel muß alles, was in unserem Herzen grollt, was in unserm Kopfe kocht, was in uns als Bitterkeit emporsteigt, schweigen.
Ich spreche nicht einmal mehr von meinen Tagen, meinen Nächten, es gleicht sich alles in seiner Furchtbarkeit.
Sonntag, 6. September 1896.
Man teilt mir soeben mit, daß ich nicht mehr auf dem Teil der Insel spazieren darf, der für mich reserviert war; ich soll nur noch rund um meine Behausung wandern dürfen.
Wie lange werde ich noch widerstehen? Wie kann ich's wissen?
Ich hoffe, daß diese Tortur bald zu Ende ist, sonst hinterlasse ich meine Kinder als Vermächtnis Frankreich, dem Vaterland, dem ich immer treu und redlich gedient, und flehe von ganzer Seele und mit aller Kraft diejenigen an, die an der Spitze des Landes stehen, daß sie diese schreckliche Tragödie vollkommen aufklären. Und dann ist es an ihnen nachzufühlen, was für unverdiente Qualen menschliches Wesen erduldet, und auf meine Kinder das Mitgefühl zu übertragen, das ein solches Unglück verdient.
Am selben Tag, 2 Uhr mittags.
Mein Kopf thut mir so weh; ach, wie wäre mir der Tod willkommen.
Teuere Lucie, Ihr meine armen Kinder, Ihr alle, meine Lieben!
Was habe ich denn hienieden gethan, um auf diese Weise leiden zu müssen?
Montag, 7. September 1896.
Gestern hat man mich in doppelte Eisen gelegt.
Warum? Ich weiß es nicht.
Solange ich hier bin, habe ich ganz genau den Weg verfolgt, der mir vorgeschrieben war, und die Vorschriften, die mir gemacht wurden, vollkommen beobachtet.
Daß ich in dieser langen, furchtbaren Nacht nicht verrückt geworden bin! Was giebt uns doch das Gewissen und das Pflichtgefühl gegenüber unseren Kindern für Kraft!
Da ich unschuldig bin, ist es meine Pflicht, bis an die Grenze meiner Kraft zu gehen; solange man mich nicht umgebracht hat, werde ich eben einfach diese Pflicht erfüllen.
Jenen, die sich zu meinen Henkern gemacht, ah, jenen hinterlasse ich ihr Gewissen zum Richter an dem Zeitpunct, an dem es Licht werden, an dem die Wahrheit entdeckt werden wird, denn früher oder später im Leben kommt alles an den Tag.
Am selben Tag.
Es ist fürchterlich, was ich alles erleide, aber ich bin sogar nicht mehr zornig über diejenigen, die einen Unschuldigen auf diese Weise foltern, ich bin nur voller Mitleid für sie.
Dienstag, 8. September 1896.
Diese Nächte in Eisen! Ich will nicht einmal von der körperlichen Qual sprechen, sondern nur von der seelischen. Und das, ohne Erklärung, ohne daß ich weiß, warum oder um welcher Sache willen! In was für einem fürchterlichen, grauenhaften Traum lebe ich denn seit zwei Jahren?
Nun denn, es ist meine Pflicht, bis an die Grenzen meiner Kraft zu gehen, und ich werde einfach so weit gehen.
Was ist aber das für eine Todesqual für einen Unschuldigen, schlimmer, als jede körperliche Marter.
Aus der tiefen Verzweiflung meines ganzen Wesens heraus grüße ich Euch immer noch mit meiner Zärtlichkeit, meiner Liebe, Dich, liebe Lucie, Euch, geliebte, teuere Kinder.
Am selben Tag, 2 Uhr nachts.
Mein Geist ist so betroffen, so außer Fassung gebracht durch all das, was seit fast zwei Jahren mit mir vorgeht, daß ich nicht mehr weiter kann, daß alles in mir zusammenbricht.
Es ist wahrhaftig zu viel für menschliche Schultern.
Warum liege ich nicht im Grabe? Oh, ewige Ruhe.
Ich wiederhole, wenn es Licht geworden sein wird, vermache ich meine Kinder Frankreich, dem geliebten Vaterland.
Glaubt mir nur, Du mein lieber, kleiner Bub, Du mein Töchterlein, und Du, geliebte Lucie, Ihr, die ich aus der tiefsten Tiefe meines Herzens, mit der ganzen Glut meiner Seele liebe, wenn Euch diese Zeilen in die Hand kommen, daß ich alles gethan habe, was in Menschenkraft liegt, um stand zu halten.
Mittwoch, 9. September 1896.
Der Commandant der Inseln ist gestern abend hergekommen. Dieser Commandant, der sich immer correct verhalten und dessen Name ich nie erfuhr, wurde bald nachher durch Deniel ersetzt. Er teilte mir mit daß die Vorschriften, die in Bezug auf mich gemacht worden waren, nicht eine Strafe, sondern »eine Vorsichtsmaßregel« seien, denn die Verwaltung habe sich in keiner Weise über mich beklagt.
Eine Vorsichtsmaßregel, wenn man mich in Eisen legt! Wenn ich doch schon wie ein wildes Tier Tag und Nacht von einem Wärter mit Revolver und Gewehr bewacht werde! Nein, nein, man muß das Kind beim Namen nennen! Das ist eine Maßregel, des Hasses, der Folter, die jene in Paris angeordnet, die, weil sie eine Familie nicht zu treffen vermögen, einen Unschuldigen schlagen, zur Strafe dafür, daß weder er noch die Seinigen sich vor dem entsetzlichsten Rechtsirrtum beugen wollen, beugen dürfen, der jemals begangen worden.
Ich bin nicht im stande zu sagen, wer sich in der Weise zu meinem Henker, zum Henker meiner Familie aufwirft.
Man empfindet wohl, daß die Localverwaltung (mit Ausnahme des Oberaufsehers, der extra von Paris geschickt worden ist) selber entsetzt ist über diese unmenschlichen, willkürlichen Maßregeln, daß sie aber verpflichtet ist, dieselben auf mich anzuwenden, da es nicht ihre Sache ist, über Verordnungen, die ihr auferlegt werden, zu discutieren.
Nein, die Verantwortlichkeit liegt weiter oben, beim Urheber oder den Urhebern dieser unmenschlichen Vorschriften.
Aber, wie groß auch die Qual, die körperliche und seelische Marter sein mag, die man mir auferlegt, meine Pflicht, die Pflicht der Meinigen bleibt sich immer gleich: wir verlangen und wollen die allergründlichste Aufklärung über das entsetzliche Drama, denn wir sind Unschuldige, die nichts zu fürchten haben und die auch nichts fürchten, da sie nur Eines fordern, die Wahrheit.
Wenn ich das alles so überdenke, werde ich nicht einmal mehr zornig, ich empfinde nur ein ungeheueres Mitleid mit denen, die so viele menschliche Wesen auf diese Weise quälen. Was für Gewissensbisse bereiten sie sich für den Zeitpunct vor, an dem die Wahrheit an den Tag gekommen sein wird, denn die Geschichte, sie kennt keine Geheimnisse.
Es ist alles in mir so traurig, mein Gemüt so zerquält, mein Gehirn so zerschmettert, daß ich nur noch mit Mühe meine Gedanken zusammenraffen kann; das ist wahrhaftig zu viel des Leidens, und immer steht das entsetzliche Rätsel noch vor mir.
Donnerstag, 10. September 1896.
Ich bin so an Leib und Seele erschöpft, daß ich heute mit dem Tagebuch aufhöre, da ich noch nicht vorher sehen kann, wie weit meine Kräfte noch reichen, wann mein Gehirn unter der Last so vieler Martern bersten wird.
Ich schließe es, indem ich an den Herrn Präsidenten der Republik, für den Fall, daß ich erliegen sollte, bevor das Ende dieses entsetzlichen Dramas erreicht ist, eine letzte, höchste Bitte richte:
Herr Präsident der Republik,
ich gestatte mir, Sie zu ersuchen, daß dieses Tagebuch, das ich ohne weitere Absicht geschrieben, meiner Frau übergeben werde.
Herr Präsident, man findet darin vielleicht den Schrei des Zornes und Entsetzens gegenüber der grauenhaftesten Verurteilung, die je ein menschliches Wesen, und dazu noch ein menschliches Wesen, das seiner Ehre nie etwas vergeben, betroffen hat. Ich habe nicht mehr den Mut, es nochmals durchzulesen und die furchtbare Reise ein zweites Mal zu machen.
Ich erhebe heute gegen niemanden eine Gegenklage; jeder war der Ansicht, in vollem Recht und aus reinem Gewissen zu handeln.
Ich erkläre nur einfach, daß ich an diesem schändlichen Verbrechen unschuldig bin, und daß ich nur immer das Eine, dasselbe, fordere, daß man nach dem wirklichen Schuldigen, dem Urheber dieser unerhörten Missethat fahnde.
Und dann fordere ich, daß an dem Tage, an dem die Wahrheit aufgedeckt worden, man meiner geliebten Frau, meinen teuren Kindern das Mitgefühl zu teil werden läßt, das ein so großes Unglück einzuflößen vermag.
Faksimile der Bemerkung, die Daniel unter das fertige Heft setzte.
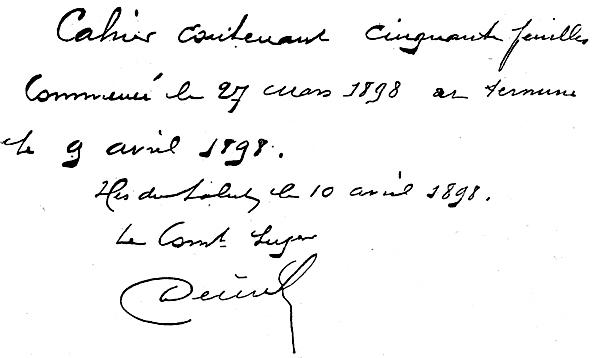
Sobald ein Buch vollgeschrieben war, wurde es dem Oberwärter übergeben, der es sofort dem Commandanten der Strafcolonie, Deniel, aushändigte.