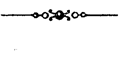|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Und sie war eine Wittwe.« Wie manchem stillen Gesicht sind in wehmüthigen Zügen diese inhaltschweren Worte eingeschrieben! Wie tiefe Geltung das Wittwenleid hat, zeigt die Sitte fast aller Zeiten und aller Völker, bei denen ein Funke geistigen Lebens schimmert, die Sitte, die den Wittwenstand als einen eigenen, durch die Weihe des Schmerzens geheiligten achtet. Wie viele der schönsten Frauentugenden sind nicht erst in der Prüfungsglut des Wittwenstandes zu reinem Gold geläutert worden! Welche Schule für junge und alte Frauen könnten die Wände eines Wittwenstübchens werden, wenn sie reden könnten von den innigen Abbitten, von den leisen Seufzern sühnender Reue, von den frommen Gebeten voll Liebe und Vergebung, die an ihnen verhallten! Wie viel Entschuldigungsgründe für so manche oft schwer gerügte Fehler der Wittwen, ihr zu zaghaftes Sorgen, zu ängstliches Sparen, ihr zu häufiges Klagen, zu reizbare Empfindlichkeit liegen nicht in den kleinen Steinen und unsichtbaren Dornen, die den einsamen Pfad der Wittwe erschweren! Wie verzeihlich ist ihre allzunachsichtige Mutterliebe! Lacht nicht, wenn eine Wittwe ein recht ordinäres Söhnchen als einen Inbegriff der Vortrefflichkeit, als den Sproß einer reichen Zukunft ansieht, wenn sie selbst über seine Fehler noch mit geheimem Stolz klagt, ihr Unentbehrliches, opfert, um seine oft unnöthigen Wünsche zu befriedigen, wenn kein Mädchen ihr erlesen und würdig genug scheint, ihren Liebling zu beglücken! Lacht nicht und denkt, wie viel begrabene Liebe und Treue, wie viel Sühne für Versäumnisse, deren nur sie sich bewußt ist, nun zu verschwenderischer Güte wird gegen dieses Abbild des Verlornen. Spottet nicht, wenn eine Wittwe mit dem Munde sich glücklich preist, ihr Töchterlein noch um sich zu haben, während ihr Herz sich sehnt nach dem Augenblick, wo sie sie an der Seite eines guten Mannes aus dem Wittwenstübchen entlassen könnte, oder wenn sie nicht müde wird, durch allerlei bescheidene Wendungen die Tugenden dieses Töchterleins in's Licht zu stellen; spottet nicht, sondern bedenkt, in wie rosigem Licht ihr selbst das nun versunkene Glück der Ehe erscheint, wie schmerzlich sie selbst empfinden gelernt hat, was es heißt, allein und schutzlos zu sein.
Eine Wittwe war es denn auch, die alle Liebesfülle eines einst schlecht belohnten Herzens, alle noch übrige Kraft eines durch langes klageloses Leid geknickten Geistes auf die Erziehung ihres einzigen Töchterleins verwendete. In Anna hoffte sie all die Blüthen aufgehen zu sehen, die ihr selbst in der Knospe gewelkt waren, in ihrer Zukunft wollte sie das Glück finden, das sie selbst nur in Jugendträumen genossen hatte. Nie ist ein Pflänzchen zärtlicher gepflegt, sorgsamer von Unkraut gereinigt, liebevoller an Licht und Luft getragen worden, als dieses schwarzäugige Annchen. Auch war der Mutter Pflege nicht vergeblich; ein so unruhiges und vorlautes Kind das Annchen war, ein so hübsches, gescheidtes und anstelliges Mädchen wurde die Anna. Es war der Mutter gar nicht übel zu nehmen, wenn sie mit stillem Entzücken ihr rühriges Walten sah, ihren muntern Einfällen lauschte, und wenn sie bei sich dachte, der sei unter einem glücklichen Stern geboren, der einmal dieses Kleinod davontrage.
Aber das Kleinod war nicht in Gold gefaßt, nicht einmal in Silber, und die Welt wird so reel; die Männer sind so zartfühlend und rücksichtsvoll: ehe sie ein edles Wesen der Möglichkeit aussetzen, einst im Alter darben zu müssen, heirathen sie lieber gar nicht, oder eben eine Reiche. So schaute denn mancher gern in die hellen schwarzen Augen Annas, aber einer um den Andern ging an der Wittwe Thür vorüber, den stattlichen Portalen reicher Häuser zu. Das Myrthenbäumchen, das seit Annas sechzehntem Geburtstag ihr Fenster schmückte, und das die Mutter ganz heimlicherweise viel sorgsamer pflegte, als das Töchterlein, grünte und sproßte; Anna hatte schon manchen Zweig davon zum Brautkranz einer Freundin geschnitten, aber blühen wollte es nicht. Die Mutter war zu feinfühlend und zu stolz, um irgendwelche der geschickten Veranstaltungen zu treffen, durch die gewandte Mütter blöde, junge Leute mit sanfter Gewalt ihrem Glück entgegenführen. So ergab sie sich allmählig darein, ihr Röslein ungepflückt daheim verblühen zu sehen, und tröstete sich mit dem Gedanken, wenn ihr nun auch das Glück versagt bleibe, das sie für sie geträumt, so werde sie doch mit den Dornen verschont bleiben, die ihr selbst so bald aus den Knospen des bräutlichen Glücks erwachsen waren, und sie lernte ohne Sorgen und Fragen ihres Kindes Zukunft in die Hand legen, die die Vögel unter dem Himmel versorgt.
Anna war ein Mädchen, ein ächtes und ein stolzes Mädchen, und alle solche Plane, Wünsche und Hoffnungen lagen bei ihr noch viel viel tiefer im Grund ihres Herzens. Wenn sie auch da und dort ein leises Gefühl von Kränkung und Zurücksetzung nicht unterdrücken konnte, so trug sie doch ihr Mädchenstolz und guter Jugendmuth darüber weg. Es gibt sehr stille Erlebnisse, so still, daß zwei Menschen, die auf's innigste vereint sind, sie zusammen erfahren, zusammen tragen und zusammen überwinden können, ohne daß ein Wort darüber auf ihre Lippen tritt. Erlebnisse der Art waren vielleicht auch schon an Mutter und Tochter vorübergegangen; Anna hatte sich in ihren stillen Thränen die Augen hell gewaschen und sah die Mutter frisch und freundlich an; auch fehlte ihr's zu keiner Zeit an muntern Einfällen und witzigen Ausfällen; es sind nicht immer dornenlose Rosen, die der Thränenthau befeuchtet.
Es gibt ein Alter, wo man eine wahre Passion hat zu resigniren, wo Ergebung und Entsagung die großen Schlagwörter sind; unsere ganze große Literatur hat diese Krankheit durchgemacht, da ist sie an einem einzelnen Menschenkind gar nicht verwunderlich. Solche junge Entsagungen gemahnen mich an jenes Trauerspiel, wo im dritten Akt alle Personen erschlagen sind und in den zwei letzten nur noch ihre Geister spielen sollen. Anna war dreiundzwanzig Jahre alt und ganz und gar resignirt, ergeben in den Gedanken, der Mutter Stütze zu sein bis an ihren Tod, rein fertig und abgefunden mit allen Jugendhoffnungen und Wünschen, und kam sich so ruhig vor wie gefrorenes Wasser.
Aber langweilig schien's Anna doch manchmal, gewaltig langweilig, sie konnte nichts dafür; wenn so ein Tag um den andern aufmarschirte und wieder abzog und jeder auf's Haar seinem Vorgänger glich, wenn sie alle Morgen Punkt sieben Uhr mit der Mutter am Nähtisch saß und ihre Augen, so oft sie sie erhob, auf nichts fielen als auf die Inschrift an der Tafel des Nachbarhauses: »Seifen- und Lichterverkauf von I. I. Schnazkobel,« falls sie nicht etwa ein Stockwerk höher schaute, wo ein gemalter Stiefel und ein grasgrüner Schuh die Werkstätte eines Schuhmachers bezeichneten; wenn sie Tag für Tag nach Tisch einen Spaziergang mit der Mutter machte, einmal zum obern Thor hinaus durch die Krautäcker, das anderemal durch das untere über die Gemeindewiese. Freilich wurde diese Einförmigkeit hie und da durch eine Visite oder eine Landpartie unterbrochen, auch fand alljährlich ein Fastnachtsball statt, auf dem sich fünf Musikanten, sieben Tänzer und fünfzehn tanzlustige Damen einfanden, und Anna konnte acurat ausrechnen, welcher der sieben sie nach einigen unfreiwilligen Sitzungen zum Tanze führen werde. Aber das waren doch nur magere Freudenblümchen für ein junges, lebenswarmes Herz. Einmal, nur einmal, meinte sie, sollte doch auch etwas Besonderes geschehen.
Nun ja, einmal kam denn auch der Postbote und brachte einen Brief vom Herrn Onkel Schneck; das war doch so eine Art von Begebenheit. Der Herr Onkel war eigentlich ein Stiefonkel von Anna; er und seine Frau hatten, da sie kinderlos waren, nach dem frühen Tode von Annas Vater der Wittwe das großmüthige Anerbieten gemacht, die Kleine zu sich zu nehmen. Daß die Wittwe sich dazu nicht entschließen konnte und lieber ihr schmales Brod mit dem Kinde theilen wollte, das hatten sie ihr schwer verübelt und seither den Verkehr fast ganz abgebrochen. Jetzt aber war der Onkel übel von der Gicht geplagt und die Tante hatte sich den Fuß verstaucht, so daß sie für Wochen an's Bett gebannt war und ihrer Magd die Schlüssel lassen mußte. Da erinnerten sie sich denn gnädigst der Nichte und baten die Mutter, sie auf einige Wochen zur Hülfe zu senden; »viel sei freilich nicht geholfen mit so jungen Mädchen, aber es sei dann doch eine eigene Person.«
Die Mutter, die die Herrlichkeit in Onkel Schnecks Hause wohl kannte, und der es so schwer wurde, sich von ihrem Kleinod zu trennen, hatte wenig Lust, der Einladung Folge zu leisten. Anna aber bewies ihr eifrigst, wie empfindlich die Leute über eine abschlägige Antwort sein würden, und wie nützlich es für sie wäre, sich auch in einer andern Haushaltung umzusehen. Diesmal täuschte sich die gute Mutter ein wenig, wenn sie diese Bereitwilligkeit für lautern Edelmuth und Lerneifer hielt. Sie nahm es fast übel, daß Anna die Trennung nicht schwerer wurde und sie mit so glänzenden Augen in die Welt hinausfuhr in dem bescheidenen Einspänner, der sie auf die nächste Poststation bringen sollte, die resignirte, kühle Anna! Wie kurz war ihr der lange Weg durch diese neue Welt, mit wie hübschen Bildern malte sie sich die neuen Verhältnisse aus, und wie kläglich wurde sie getäuscht!
Der erste Eindruck, Onkel Schneck in seiner Zipfelmütze und einem Schlafrock, der ein wahres Kaleidoskop von verschiedenen Flecken war, und die Tante in kattunener Nachtjacke und stahlgrünem Rock, hatte noch etwas von einem niederländischen Stillleben; aber es ward gar bald laut, und der Reiz der Neuheit verflog außerordentlich schnell.
Gern hätte sich Anna in das Amt einer barmherzigen Schwester gefunden, des Onkels Fontanelle und der Tante Fuß verbunden, gern dem Harthörigen die Zeitung vorgeschrieen und daneben Küche und Keller besorgt, wenn nicht ein Geist zänkischen Unfriedens, erbärmlicher Klatscherei, ruhelosen Mißtrauens und fabelhaften Geizes im Hause gewaltet hätte, der alles versäuerte. Es war nicht eben so schlimm gemeint, aber es konnte doch keiner Seele wohl werden in dieser Atmosphäre, und recht sehnsüchtig verlangte Anna zurück an der Mutter Arbeitstisch, wo ihr Myrthenbäumchen vor dem Fenster stand und Luft und Sonne herein durften, wenn sie in der dumpfen, nie gelüfteten Stube die wenig anziehenden Strümpfe der Tante flicken mußte. Wie viel lieber hätte sie des Herrn Schnazkobels zierlich gemalte Seifenpyramide gesehen, als auf der Tante Befehl aufgelauert, ob die Nachbarin wieder Kaffee mache, wenn ihr Mann fort war! Welch' ein Vergnügen schien ihr jetzt der Spaziergang durch die Krautäcker an der Mutter Seite, hier, wo sie nicht weiter kam, als in den schmutzigen Hof, um die Hühnernester auszunehmen! Und vollends die traulichen Leseabende mit der Mutter, während sie jetzt jeden Abend mit dem Onkel Brett spielen mußte, und wohl aufpassen, um nicht dumm zu spielen und doch zu verlieren! Sie kam sich oft vor, wie auf eine wüste Insel verbannt, und fürchtete, ihr Lebtag nicht mehr von da wegzukommen. Ihr einziger Trost war Frau Fischer, eine freundliche, junge Frau, ehemalige Hausgenossin der Tante, die bei dieser wohl gelitten war und manchmal einsprach. Aber diese kam in die Wochen, und so war's aus mit den Besuchen.
Nach drei langen Wochen ward es mit dem Fuß der Tante besser und Anna sah ihrer Erlösung entgegen. Zunächst sollte nun eine große Wäsche angestellt werden, bei der man sie noch verwenden wollte, und dieses daheim sonst gefürchtete Ereigniß war ihr eine wahre Freude, da es doch einigen Wechsel in das trübselige Einerlei brachte.
Zwar weckte die Tante Anna schon Morgens um drei Uhr, aus Angst, die Wäscherinnen möchten allerlei Unterschleif treiben, zwar lief dieselbige Tante den ganzen Tag mit ungeheuern Salbandschuhen in schlimmster Laune im Haus herum und folgte der Anna auf jedem Schritt und Tritt, zwar steigerte sich diese üble Laune zu einer wahrhaft gefährlichen Höhe, als am zweiten Tag Regenwetter drohte; aber das ging vorüber, die Sonne drang siegreich durch und Anna bekam den erfreulichen Befehl, auf dem Rasen vor dem Stadtthor die Wäsche aufzuhängen, wozu sie sich fröhlichen Herzens anschickte.
Die dem weiblichen Geschlecht zugewiesenen Arbeiten sind, abgesehen von Nutzen und Notwendigkeit, gar nicht so lästig und nicht so verflachend, wie die emancipirte Frauenwelt sie darstellt, und wer sie um irgend eines Zweckes willen gänzlich aufgeben wollte oder müßte, würde einen wesentlichen Reiz des weiblichen Lebens verlieren. Es läßt sich so lieblich träumen, so behaglich plaudern beim Näh- oder Strickzeug, so liebe Gedanken lassen sich in eine zierliche Arbeit verweben, die zu einem Geschenk bestimmt ist, und die ächte Lust des Schaffens liegt darin, ein gutes Gericht zu bereiten, und seiner wohlgefälligen Aufnahme bei Tische sich zu erfreuen. Unter die angenehmsten dieser Geschäfte gehört denn auch das Trocknen des Leinenzeugs, sei es nun auf einem Dachboden, dessen geheimnißvollen Reiz Justinus Kerner so anmuthig beschreibt, oder im Freien, wo es die liebe Sonne gar nicht übel nimmt, daß man sie zu prosaischen Zwecken benützt, wo die frischen kühlen Lüfte gern in des Menschen Dienst treten und einen lustigen Tanz mit den weißen Flaggen beginnen.
Wie ein Vogel aus dem Käfig flog Anna in's Freie, sog in vollen Zügen die frische Frühlingsluft ein, schickte Magd und Wäscherin heim und machte sich mit rüstigem Muthe an ihr Tagwerk. All' ihre Lieder, die schon lang verstummt waren, kamen ihr wieder zu Sinn, und während sie die vielfach geflickten Tisch- und Leintücher der Tante als Gardinen um sich zog, sang sie mit heller Stimme: »Mein Herz ist im Hochland!«
»Nun, wo singt man denn?« fragte auf einmal eine sonore, etwas fremd klingende männliche Stimme, und aufblickend sah Anna ein landfremdes Gesicht über die volle Leine hereinschauen. Erröthend, erstaunt, befangen schlüpfte sie durch die Wäsche hervor und stand vor einer schlanken, hochgewachsenen Männergestalt, blondhaarig und blauäugig, aber so kraftvoll und männlich schön, wie sie einmal auf einem schönen Bilde den blondlockigen Gott Odin gesehen hatte.
»Mein liebes Fräulein,« sagte der Fremde nun etwas schüchtern mit fremdlautendem Accent, »können Sie mir nicht sagen, ob ich da auf dem Weg zur Stadt bin und wo der Kaufmann Fischer wohnt?« Anna schüttelte die Waschklammern aus der Schürze und begleitete den Fremden ein paar Schritte, so weit es nöthig war, um ihm den Weg zu zeigen. Der Fremde sprach nicht mehr, schien aber die hübsche Schaffnerin recht mit Interesse zu betrachten, und nachdem er mit höflichem Gruße von ihr geschieden war, traf sich's seltsam, daß just so oft Anna beim Rückkehren den Kopf drehte, sie allemal gerade seinem Blick begegnen mußte, so daß sie sich zuletzt eiligst hinter ihre Waschgardinen zurückzog. Gesungen hat sie aber an dem Tage nicht mehr.
Das war nun etwas anderes! und gar zu gern hätte sie etwas über die wundersame Erscheinung gewußt, die ihr mehr Denkstoff gab, als in der Zoller'schen Handfibel enthalten ist, aber mit der Tante hätte sie um keinen Preis davon sprechen mögen. Am zweiten Tag aber war großer Bügeltag. Die Büglerin, die stets die eine Hälfte des Tags dazu verwendete, Neuigkeiten auszukramen, und die andere, wieder neue einzusammeln, erzählte mit großer Wichtigkeit, daß nun bald bei Fischers Taufe sei, und daß ein landfremder Vetter der Frau aus Preußen oder England dazu gekommen, der zu Gevatter stehen werde. »Behüte!« rief die Tante, welche die Fischer'schen Familienverhältnisse aufs genaueste kannte, »das ist der Sohn einer Mutterschwester der Fischerin, die in jungen Jahren einen Kaufmann in Schweden oder sonst so geheirathet hat; es hat schon lang Eines von ihnen kommen wollen, aber der Fischer hat geschrieben, sie sollen noch ein wenig warten. So, so, der ist gekommen? Ja, man hört doch auch gar nichts, wenn man eine Wäsche hat.« Die Erörterungen über die Anzahl der Biscuittorten und Butterkuchen, die wahrscheinlich zur Taufe gebacken würden, wurde durch Herrn Fischers Erscheinung selbst unterbrochen, der in Frack und Glacéhandschuhen erschien, um die Tante als Pathin, den Herrn Schneck nebst Fräulein Anna als Privatgäste auf folgenden Sonntag zur Taufe zu laden. Der gute Herr Fischer hätte diesen Gang gewiß viel lieber gethan, wenn er hätte ahnen können, in welch' freudige Bewegung er durch seine Einladung Anna's resignirtes Herz versetzte.
Nun war sie nicht mehr auf einer wüsten Insel! Trällernd und singend ging sie ihren Arbeiten nach, pflegte den Onkel und besorgte die Tante so pünktlich und treulich, damit sie doch ja gewiß am Tauftag ausgehen könnten. Als der Sonntag Morgen selbst erschien, fand sie das Wetter so prächtig, und als sich der Himmel verdüsterte, schien ihr's erst recht angenehm zum Ausgehen. Sie legte den Staat für Onkel und Tante zurecht, flog Treppen hinauf und hinunter, räumte auf und rüstete, daß nirgends ein Hinderniß im Wege stehe, es war, als ob sie zehn Hände hätte; der Onkel selbst sah ihr wohlgefällig zu und die Tante meinte mürrisch, es werde nicht so pressiren. Daß sie sich dergestalt rühre und rege und freue wegen einer landfremden Mannsperson, die sie kaum drei Minuten gesehen, davon wußte natürlich Anna selbst kein Sterbenswort und hätte es hoch übel genommen, wenn ihr Jemand das zugetraut hätte; sie lebte nur glückselig in den Tag hinein.
Ein rechtes Glück war's, daß die Mutter Anna doch ihren einzigen Staat, das schwarzseidene Kleid, mitgegeben hatte. Sonst stand ihr nicht viel zu Gebot, um elegante Toilette zu machen, aber mit ihrem sammtglatten gescheitelten Haar, dem kleidsamen schwarzen Kleid und der lichten Pelerine mit einer rosenrothen Schleife nahm sie sich wirklich recht hübsch aus, wenn sie auch zur Rose zu blaß und zur Lilie zu brünett war.
Mit fast hörbarem Herzklopfen trat sie hinter Onkel und Tante in's Fischer'sche Haus, wo die Elemente des Festes noch in ziemlich gestaltlosem Chaos umherstanden und lagen. Frau Fischer, schon ziemlich erholt, bewegte sich in einem gar nicht eleganten Morgenmantel, Chokolade servirend, wobei sie Herr Fischer unterstützte und sich etwas ungeschickt zeigte. Im Nebenzimmer besorgte die Wärterin die Toilette des Täuflings unter höchst unziemlichem Geschrei desselben. Der Fremde, der, wie sich später ergab, ein Norweger, Sohn eines Kaufmanns in Bergen und Geistlicher war, erschien erst, als der schon geordnete Zug sich zur Kirche bewegte, und begrüßte mit freudigem Erstaunen seine Wegweiserin, die er auch in ihrer vortheilhaften Umgestaltung sogleich erkannte.
Still wallte der kleine Zug in die Kirche; neben dem vergilbten Antlitz der Tante stand die männlich schöne Gestalt des Norwegers, fromm und andächtig wie eine der Rittergestalten auf alten Kirchenbildern, mit dem Kindlein auf den Armen. Der feierliche Hauch der heiligen Handlung verwandelte auch Anna's auf und ab wogende Gedanken in stille Gebete und selige Ahnungen. Das Kindlein war getauft, Christian, weil die Tante Christiane hieß; Knud, der Name des Pathen, war dem Vater gar zu heidnisch vorgekommen.
Daheim hatte sich indeß das Chaos gelichtet; die Wöchnerin lag nun in schneeweißem Ornat hinter den Gardinen und empfing mit Freudenthränen ihr gesegnetes Kindlein. Die Tafel war zierlich geordnet, sogar mit Blumenvasen geschmückt. Es traf sich ganz von selbst, daß der Norweger neben Anna zu sitzen kam, und die zwei hatten keine Langeweile. Wie von frischer reiner Bergluft fühlte Anna sich angeweht von der lebendigen gesunden Seele, die aus des Norwegers einfachen Worten sprach; ein ganz anderes, tiefes Verständniß über den Sinn des Lebens ging ihr auf, als er ihr von einer seiner Schwestern erzählte, die als Pfarrfrau in tiefster Einsamkeit reich und glücklich in ihrem häuslichen Frieden und frommen Wohlthun lebte, und sie schämte sich, wenn sie bedachte, wie manchmal sie den Werth und Reiz ihrer Jugend in dem gesucht hatte, was man Jugendfreuden nennt, so wenig sie auch je davon befriedigt worden war. »Das ist Leben!« rief's in ihrer tiefsten Seele, und der Nachmittag an der Seite des Norwegers schien ihr wie eine Stunde im Vorhof des Himmels. So war sie wie aus den Wolken gefallen, als Onkel und Tante zum Aufbruch trieben; Widerspruch hätte nichts geholfen, sie war auch viel zu glücklich dazu, und der Norweger begleitete sie ja heim!
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, auch den Abend nicht vor dem Morgen. Als Anna am andern Morgen leichten Trittes, ein Liedchen summend, die Treppe herab kam, brachte man ihr einen Brief von daheim, nicht von der Mutter, sondern von dem Doktor, ihrem Hausarzt und Hausfreund, der ihr schrieb, daß ihre Mutter erkrankt sei und sie zu schleuniger Rückkehr aufforderte. Das war ein kalter Guß auf das junge Freudenlicht! »Eine Mutter hat man einmal nur.« Unter heißen Thränen packte Anna ihre Sachen und nahm Abschied von Onkel und Tante, deren lederne Herzen durch dieses lebensvolle Element in der That etwas geschmeidiger worden waren, und die sie mit aufrichtigem Bedauern scheiden sahen. Erst als Anna am Fischer'schen Hause vorüber fuhr, kam ihr der Norweger und ihre kurze Seligkeit zu Sinne und machte ihr das Herz noch schwerer.
Die Mutter traf sie recht krank, doch nicht so hoffnungslos, wie ihre Aengstlichkeit sich vorgestellt hatte. Nach langen sorgenvollen Tagen und endlosen Nächten kam es besser, und endlich konnte sie Anna mit Freudenthränen wieder auf den einst so verschmähten Spaziergang durch's Wiesenthal führen, und das Leben kam wieder in's alte Geleise.
Der Aufenthalt beim Onkel und der Lichtpunkt desselben, das Fischer'sche Tauffest, waren natürlich häufiger Gegenstand der Gespräche von Mutter und Tochter. Welche Bedeutung der nordische Gast für das Herz der Tochter gewonnen, davon war nie die Rede, aber es müßte ein blödes Mutterauge sein, das nicht zwischen den Zeilen lesen könnte.
Anna hatte, sobald es der Mutter Befinden erlaubte, pflichtschuldigst an Onkel und Tante geschrieben, am Schluß eine Empfehlung an Frau Fischer beigefügt und die beiläufige Bemerkung eingeschoben, der fremde Gast werde wohl abgereist sein. Auch hatte der Onkel wieder geschrieben (die Tante war des Schreibens unerfahren), hatte der Anna zum Präsent für ihre Bemühungen ein hübsches Kleid geschickt und sich nach dem Befinden der Frau Schwägerin erkundigt, vom Norweger aber kam kein Wort; das war vergessen worden, da die Tante, die nicht viel auf's Sammeln der Korrespondenzen hielt, mit Anna's Brief alsbald ein widerspenstiges Feuer angezündet hatte.
So blieb es still vom Norweger, und still ward's in Anna's Herzen; mit dem Resigniren sollte es nun Ernst werden. Anna verlangte nach nichts Neuem mehr: sie hatte genug an ihrer Gedankenwelt, und vergeblich wollte sie den Norweger nicht gekannt haben; er hatte ein Licht in ihr angezündet, das nicht erlöschen sollte, wie das Flämmchen ihrer Hoffnungen; wenn sie ihn auch nie wieder sah, so wollte sie seiner doch werth werden.
Bald ein Jahr war vergangen seit jener Reise zum Onkel Schneck, da fand in der Residenz eine große Einzugsfeierlichkeit statt. Der freundliche Doktor lud Anna, deren abnehmende Munterkeit er schon lang bemerkt hatte, ein, mit ihm hinzugehen. Anna hatte wenig Lust, nur der Mutter dringendes Zureden bewog sie dazu. Nun, da war's eben wie bei all solchen Herrlichkeiten: bekränzte Häuser, Soldatenspaliere, überfüllte Gasthöfe, ein gräßliches Gedränge, das ein rechtes Drangsal wäre, wenn nicht ein warmer Hauch wirklicher Festfreude, lebendigen Antheils, erquicklich durch alles wehte, und wenn nicht nachher jeder behauptete, alles am besten gesehen zu haben.
Anna hatte sich auf eine Haustreppe retirirt, wo sie zwischen zwei Soldatenmützen durch hoffen konnte, den Zug zu sehen; da rief eine helle Stimme: »Ei, sind Sie's, Fräulein Anna?« – »Nein, ich bin's nicht,« sagte Anna, ärgerlich über die Störung. – »Ei, freilich sind Sie's!« rief wieder eine freundliche Frau. Jetzt erkannte sie Anna und grüßte sie und machte ihr Platz und vergaß Fest- und Hofwagen über der angelegentlichen Unterhaltung mit ihr: es war ja Frau Fischer! »Denken Sie nur, der Herr Onkel haben einen ganz erträglichen Sommer, die Frau Gevatterin sind aber immer recht übel auf und haben jetzt eine Hausjungfer, und der Christian, bei dessen Taufe Sie waren, steht schon auf die Füße und hat vier Zähne, kann auch schon Papa sagen.« Anna verwunderte sich gehörig, hätte aber gar gerne noch mehr gewußt; Frau Fischer war jedoch nicht gesonnen, den Anblick des herannahenden Wagenzugs zu versäumen, aber sie bestellte Anna nachher in einen Kaufladen, wo sie Einkäufe zu machen hatte.
Da konnte sie sich recht nach Herzenslust mit der Frau ausplaudern, und endlich kam auch das ersehnte Thema. »Ja, denken Sie, ich habe erst in den letzten Tagen an Sie gedacht. Der Knud aus Norwegen, wissen Sie, der Vetter, der damals auch bei meines Christians Taufe war –« – Ja, ja, Anna wußte. – »Warten Sie, ich habe vielleicht den Brief noch bei mir – er schreibt so schöne Briefe; er ist vielleicht in meiner Kleidertasche.« Richtig, da war er, und mit einigem Buchstabiren las Frau Fischer der Anna vor: »Wißt ihr denn gar nichts mehr von meiner liebenswürdigen Tischnachbarin? Ist sie wieder bei ihrer Mutter? ist sie noch bei ihrer Mutter? Nie werde ich den frohen Tag vergessen, den ich an ihrer Seite verlebt.« – »Ich auch nicht!« rief Anna mit glühenden Wangen; und so aus ihrem innersten Herzen kam das Wort, daß Frau Fischer sie erstaunt ansah und das verrathene Mädchen alle Diplomatie aufbot, um mit kühlen Redensarten den Eindruck dieser Worte zu schwächen.
So viel hatte aber Frau Fischer sich, scheint es, doch gemerkt, Daß sie ein geneigtes Ohr finden würde, wenn sie der Anna noch ein Weiteres vom Vetter Knud und seinen Vorzügen erzählte, wie er die Handlung seines wohlhabenden Vaters hätte übernehmen sollen, aber aus innerem Herzenszug Pfarrer geworden, wie es gekommen, daß seine Mutter, ihre Tante, sich so weit weg verheirathet u. s. w. Anna hätte ihr zugehört bis Mitternacht, und viel zu früh kam ihr der Doktor, der sie abrief. »Ich schreibe dem Knud bald einmal, darf ich einen Gruß von Ihnen schreiben?« fragte leise, in schalkhaftem Tone Frau Fischer beim Abschied. »Eine Empfehlung,« stotterte Anna in großer Verlegenheit, machte sich aber nachher selbst große Complimente über ihr kluges zurückhaltendes Benehmen. Verliebte Herzen sind wie der Vogel Strauß, der den Kopf in einen Busch steckt und dann meint, man sehe ihn nicht.
In tiefen Gedanken fuhr Anna durch die sternhelle Nacht mit ihrem alten Freunde heim. Wie viel hatte sie nun der Mutter zu sagen! Die Mutter wußte aber auch eine Neuigkeit: »Weißt Du, Anna, daß Dein Myrthenbäumchen Knospen hat?« – »Hat es Knospen?« rief Anna fröhlich und versteckte ihr glühendes Gesicht an der Mutter Brust. In dieser Nacht hatten Mutter und Tochter so viel zu besprechen, daß der Morgen dämmerte, bis sie zum Schlummern kamen.
Ja, die Myrthe knospete, und mit stiller Freude belauschte die Mutter ihr Entfalten. Noch ehe die Blüthen aufgegangen waren, saß an einem sonnenhellen Morgen Anna an ihrem Fenster und hielt in zitternder Hand einen Brief und las ihn mit glühenden Wangen und gab ihn der Mutter und eilte in ihr Stübchen und kniete nieder und drückte ihre überströmenden Augen in die gefalteten Hände. Was dieser Brief enthielt und was ihre Antwort war, das wird nicht schwer zu errathen sein: es war eine neue Variation auf das alte, ewig schöne Thema, das in tausend jungen Herzen wiedergeklungen hat und wiederklingen wird.
Der Norweger hatte sie nicht vergessen gehabt, und doch hätte er vielleicht nicht versucht, die flüchtige Erscheinung, die doch so oft wieder vor seine Seele trat, fest zu halten für's Leben, wenn nicht die freundliche Cousine ihm einen so lieblichen Bericht von ihrem Zusammentreffen mit Anna gesendet hätte, durch den ihm erst so recht klar wurde, wie lieb ihm das deutsche Mädchen sei. Da saßen nun die Wittwe und ihre Tochter im alten Stübchen, das jetzt für Anna ein so ganz anderes war. Und Anna sah die Mutter an mit glückseligen Augen, und die Mutter lächelte unter Thränen und saugte den Freudestrahl aus der Tochter Blicken ein, um sich zu stärken gegen den Gedanken an die Trennung.
Anna vergaß, daß sie einst so resignirt gewesen; was Ergebung, was ein seliges Selbstvergessen ist, das weiß nur ein Mutterherz. Und der Norweger ist gekommen und hat sein glückliches Bräutchen heimgeführt. Seine warme Liebe hat sie vergessen gemacht, daß sie den sonnenhellen Neckarstrand mit dem kalten Norden vertauscht. Der Zug des Herzens, der schon so manche junge Seele irre geführt, hat hier sich als eine gütige Schicksalsstimme bewiesen.