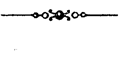|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Der verwittweten Frau Stadtschreiber Krollin mußte es in ihrem Ehestand recht gut ergangen sein; denn es gab Niemand, der so aufgelege gewesen wäre, Heirathen zu stiften, als sie. Wo sie einen »Angestellten« wußte, der noch nicht so glücklich war, verlobt oder vermählt zu sein, da schwebte ihr gleich eine ganze Liste heirathsfähiger Frauenzimmer (Damen war damals noch keine übliche Bezeichnung) vor Augen, und sie war unerschöpflich in Entdeckung neuer Kanäle, durch die sie an verhärtete Hagestolzenherzen zu gelangen wußte. Man mußte sie sehen, wenn sie mit ihrer Dose neben sich und einer Kaffeetasse vor sich bei irgend einer Frau Base oder gar bei der Mama eines Ehestandskandidaten saß, mit welch strahlendem Gesicht sie die Töchter des Landes die Musterung passiren ließ, und nicht nur von Jeder wußte, wie viel sie besaß, sondern auch die Quellen davon. »Ich sage Ihnen, jedes der Mädchen bekommt dreitausend Gulden gleich mit, außer der achtzehnfachen Aussteuer! Die Mutter hab' ich noch ledig gekannt, die ist eine geborne Bernerin, und der alte Berner hat einen ledigen Bruder geerbt mit wenigstens achtzigtausend Gulden.« – Und nicht nur reiche Erbinnen hatten sich ihrer Fürsorge zu erfreuen, sie hatte auch Herzen zu herabgesetztem Preis in Petto, gesetzte Frauenzimmer für Wittwer mit drei, fünf, sieben bis neun Kindern, resolute Personen, die in ein strenges Geschäft taugten, kurz: »der Jüngling und der Greis am Stabe, ein Jeder ging beschenkt nach Haus.« – Waren dann die Leute versorgt, so ließ sie sie ruhig ihrer Wege ziehen, ohne ihre Verdienste geltend zu machen, wenn es gut, oder sich verantwortlich zu fühlen, wenn es schlimm ging; erst wenn sie verwittwet wurden, gewannen sie wieder Interesse für sie.
Die Lebenszeit ihres seligen Mannes, wo sie als Genossin seiner Würde an seiner Seite regiert hatte über die Schaar der Schreiber und Substituten, hatte sie redlich benützt. Sie selbst war leider weder mit Töchtern noch mit Söhnen gesegnet, aber sieben Nichten und drei Pathen waren nach und nach glücklich an Pfarrer, Schreiber und anderweitige Subjekte untergebracht worden und konnten in verschiedenen Theilen des Landes die fürsorgliche Güte ihrer Tante rühmen. Für den Augenblick aber schien die Frau Stadtschreiberin genöthigt zu sein, auf ihren Lorbeeren auszuruhen. Alle Wittwer nah und fern in der Runde waren versorgt, alle Aktuare und Vikare versprochen, einen hartnäckigen Amtspfleger, der, recht ihr zum Trotze, gerade gegenüber mit einer uralten Haushälterin seine ledige Wirthschaft führte, hatte sie als hoffnungslos längst aufgegeben. So saß sie denn eines Morgens in unfreiwilliger Ruhe, wie ein thatendurstiger Krieger zur Friedenszeit, in ihrem wohlgewärmten Stübchen beim Kaffee, als ihr der Hausherr wie gewöhnlich die Zeitung heraufschickte.
Den politischen Theil des Blattes ließ sie stets unberührt; ob's Krieg oder Frieden in der Welt geben werde, das konnte sie doch nicht herausbringen; und von der Zollvereinsfrage wollte sie nichts mehr hören, seit sie fand, daß Zucker und Kaffee doch nicht wohlfeiler wurden. Ihr Lebenselement waren erst die Traueranzeigen, die Beförderungen. Ueber die Heirathsanträge entsetzte sie sich sehr, sie fand das einen höchst unschicklichen Weg und konnte nicht begreifen, wie ein Frauenzimmer sich entschließen möge, so einen »Zeitungsmann« zu nehmen.
So durchlief sie denn wieder begierig die Reihe der Traueranzeigen, das war aber magere Ausbeute, kein bekannter Name. »Gegenwärtig stirbt doch auch gar Niemand Rechtes,« sagte sie verdrießlich, ohne zu ahnen, welche Grausamkeit in diesem Verdruß liege. Bald aber traf sie auf ein erfreulicheres Feld: »Seine königliche Majestät haben geruht: Zuerst Hauptleute, Ober- und Unterlieutenants ec.; das war ihr gleichgültig, um Militärpersonen hatte sie sich noch nie bekümmert; gleich darauf aber kam's besser: »die evangelische Pfarrei Schniezingen dem Pfarrer Brommeler von Bergmühl.« Das fiel wie Thau auf trocken Land und eine Welt von Gedanken quoll aus diesen dürren Worten. War nicht Schniezingen in der nächsten Nähe, kaum eine Stunde entfernt von ihrem Wohnsitz? und war's nicht gut, daß der langweilige Amtsverweser von dort wegkam, der so frech gewesen, sich eine Braut auf eigene Hand auszuwählen, eine Ausländerin aus dem Badischen, von der kein Mensch wußte, wem sie gehörte? War nicht der Pfarrer Brommeler ein naher Vetter, das heißt ein Schwager von einem Drittekind ihres seligen Mannes, und seit drei Jahren Wittwer? Welche Aussicht! welche Reihe von Planen! Das einfältige Bergmühl lag fast am Ende des Landes, da hatte man dem Brommeler mit keinem vernünftigen Vorschlag beikommen können; nun war's recht gut, daß er noch nirgends unvorsichtig »hineingetappt« war, daß man noch für ihn sorgen konnte.
Flugs setzte sie sich hin, um dem Herrn Vetter die Verwandtschaft in's Gedächtnis zu rufen, zu der guten Pfarrei zu gratuliren und ihre Dienste zu etwaigen Anordnungen wegen Hausputzen, Kunstherdsübernahme, Gartenbesorgung ec. anzubieten. Nachdem sie mit vieler Anstrengung diese Epistel zu Stande gebracht, konnte sie sich getrost weitern Operationsplanen überlassen. Ein Wittwer ohne Kinder auf einer so guten Pfarrei! sie wußte noch gar nicht, wem sie diesen leckern Bissen zuwenden sollte. Dazu mußte der Brommeler noch ein ganz stattlicher Mann sein in seinen besten Jahren. Das brauchte reifliche Erwägung. Aber war sie denn auch gewiß, daß er noch Wittwer war? Vor zwei Jahren war er's noch gewesen, aber sie hatte damals schon gehört, daß seine Haushälterin sich scharf um ihn bemühe; konnte es nicht sein, daß die Bemühungen dieser schlechten Person – jede Heirath war unstatthaft, die nicht durch ihre Vermittlung zu Stande kam – indeß gelungen waren? Das mußte ermittelt werden.
Glücklicherweise fiel ihr ein, daß in der fünf Stunden entfernten größern Stadt die Frau Kammerdiener Rutscher wohne, ein leiblich Geschwisterkind des Brommeler, und ihr durch diese Verwandtschaft von lange her bekannt. Sie hätte schon lange in die Stadt sollen, um sich dunkeln Kattun zu einem Ueberrock zu kaufen, da sie durch die fünf Musterpäcke, die ihr zugesandt worden waren, noch nicht zur Entscheidung hatte kommen können. Da war's denn am besten, sie faßte den Entschluß, selbst auszuwählen und zugleich bei der Frau Rutscher Erkundigungen einzuziehen. Demzufolge wurde ein Platz im Deckelwagen des Stadtboten bestellt. Damals gab es weder Eisenbahnen noch Omnibusse, und man traf Anstalten, als gälte es eine Reise um die Welt.
Eine Reise mit dem Stadtboten hatte die Unannehmlichkeit, daß man schon Morgens um vier Uhr bereit sein mußte, für eine alte Frau eine harte Zumuthung. Salome, die alte Magd, hatte den ganzen vorhergehenden Tag zu laufen, bis alles gehörig besorgt war. Da mußte ein halb Pfund Kaffee geholt werden, um nach alter guter Sitte der Frau Rutscherin eine kleine Verehrung mitzubringen, ferner Milchbrod gebäht zum morgigen Frühstück, da so früh noch nichts beim Bäcker zu haben war, sodann der Bäckerjunge bestellt, daß er eine Stunde vor der Aufbruchszeit am Hause schelle, um zu wecken; auch mußte die Staatshaube noch zur Putzmacherin und das feine Merinokleid gehörig gebürstet werden. Endlich legten sich Frau und Magd um sieben Uhr Abends zur Ruhe, um gewiß Morgens zur Zeit wach zu sein.
Nach einer endlosen Fahrt, eingezwängt mit dem Nachbar Kupferschmied, zwei Mägden, die Dienste suchten, und der Familie des Boten, zwischen Kisten, Schachteln und Koffern, kam die Frau Stadtschreiberin matt und müde, wie gerädert in der kleinen Residenz an. Sie hätte gern unterwegs den versäumten Morgenschlaf nachgeholt, aber bei jedem Nicken war ihr Kopf in bedrohliche Berührung mit dem Kessel gekommen, den der Kupferschmied in die Residenz lieferte und der im Fond des Wagens aufgepackt war. Es war nahe an zehn Uhr, als sie ausstieg, um sich zu Frau Rutscher zu begeben, die sie, wie sie hoffte, in Kaufläden begleiten solle, um den Kattun auszuwählen.
Ein Regenguß drohte, als sie eben die Pforte der Rutscher'schen Wohnung erreichte, sehr verlangend nach einem guten Kaffee und einer warmen Stube. Siehe, da stand Thür und Thor weit offen, die hochaufgeschürzte Magd war zwischen Kübeln und Sandscherben in vollster Putzarbeit und gab kurzen Bescheid. Herr Rutscher war im Schloß und kam heute nicht heim, die Frau war über Land bei ihrer Tochter, der sie im Wochenbett wartete. Die Magd traf nicht die mindeste Anstalt zur Aufnahme und Bewirthung der Frau Stadtschreiberin. Seufzend schickte sich diese an, ihren Stab weiter zu setzen, ohne zunächst zu wissen wohin. Da kam eine sehr sorgfältig gekleidete ältliche Frau so eben mit nassem Regenschirm zur Hausthüre herein und hörte noch das Gespräch. »Ach, das wird der Frau Rutscher gar leid sein, so einen raren Besuch zu versäumen! Sie hat mir schon manchmal von Ihnen erzählt. Aber Sie werden doch nicht in dem Wetter fort wollen? Bemühen Sie sich in mein Stübchen.« So nöthigte sie die höfliche Frau, die, wie die Magd der Frau Stadtschreiberin bei Seite sagte, Frau Pfarrer Senner war, die im obern Stock wohnte.
Nach unzähligen Complimenten ließ sich die Frau Stadtschreiberin bewegen, mit der Frau Pfarrerin in ihr recht nett gehaltenes Mansardenstübchen zu gehen und dort ein Täßchen Chokolade zu trinken, das diese in Ermanglung einer Magd unter unendlichen Entschuldigungen wegen ihres öftern Ab- und Zugehens selbst bereitete. Zuletzt ließ sich die Frau Stadtschreiberin sogar noch nöthigen, zum Essen zu bleiben, wobei es freilich etwas knapp zuging, da sich die Frau Pfarrerin aus einer Menage speisen ließ: aber dafür besserte sie mit einem guten Kaffee nach, so daß die beiderseitigen Herzen vollständig aufgingen. Es ergab sich, daß der Vater der Frau Pfarrerin Diaconus im Ort gewesen, wo der Vater der Frau Stadtschreiberin als Dekan gelebt; somit war es eine alte Bekanntschaft.
Die Frau Pfarrerin war überaus sorgfältig, wenn auch in billige Stoffe gekleidet, hatte sogar etliche Blümlein in ihrer Haube und ein himmelblaues Band darauf, zum Zeichen, daß sie noch für jung gelten wollte, was ihr aus einiger Entfernung auch gelingen konnte, wenn man ihre falschen Haare und ihren zahnlosen Mund übersah. Sie hatte der Frau Stadtschreiberin viel zu klagen über ihre bedrängte Lage, in der sie sich seit ihres Mannes Tod befinde. Bisher habe sie zwei Söhne eines wohlhabenden Vetters bei sich gehabt und mit deren Kostgeld ihre Haushaltung bestritten; jetzt aber habe dieser sie heimgenommen und halte ihnen einen Hofmeister, und ihr bleibe keine Wahl, als zu einem Stiefsohn ziehen, was sie bitter ungern thue.
Die Frau Stadtschreiberin hatte großes Mitleid mit ihrer Wirthin, und als diese Nachmittags mit ihr in sechs Kaufläden herumzog, wo sie das halbe Waarenlager herabreißen ließen, bis sie im letzten endlich über den dunkeln Kattun einig wurden, da war die neue Bekanntschaft bei ihr auf den Gipfel der Gunst gestiegen. Es war ein vortrefflicher Einkauf, dieser dunkle Kattun, so fein im Boden, so ächt in der Farbe, so modest und doch freundlich, so einfach und doch simpel. Ueber diesem gelungenen Handel und einem vortheilhaften Einkauf in Reis, den sie um einen halben Kreuzer wohlfeiler bekam, als daheim, und von dem sie daher einen Achtelscentner aufpackte, vergaß sie fast ganz den eigentlichen Zweck ihres Besuchs, und nachdem sie den Stadtboten dreiviertel Stunden hatte warten lassen, weil der Metzger die guten und billigen Würste, die ihr die Frau Pfarrerin verrathen, noch nicht fertig hatte, fuhr sie ganz befriedigt ab und berechnete unterwegs, wie viel sie auf dieser Reise profitirt habe.
Die Frau Stadtschreiberin hatte nun freilich nichts Näheres über den Pfarrer Brommeler erkundet; das war aber auch nicht nöthig, denn nach vier Tagen erhielt sie bereits einen Brief von ihm selbst, in dem er sich schönstens bedankte für ihr freundliches Zuvorkommen, seiner einsamen Lage erwähnte und meldete, daß seine Haushälterin den Kunstherd übernehmen wolle, wenn auch ein Backöfele dabei sei und die Töpfe alle in gutem Zustand. Also war er noch Wittwer!
Das war das große Fundament, auf das sich weiter bauen ließ, und jetzt erst kam ihr eine lichte Idee: die Frau Pfarrerin, das war ja die allerbeste Frau für den Brommeler, sie brauchte dann nicht zu ihrem Stiefsohn zu ziehen, und beide hatten keine Kinder; das paßte alles vortrefflich. Ein bischen alt war sie freilich, aber sie stellte doch noch etwas vor. Ja, es gestaltete sich immer fester in ihrem Kopf, so mußte es werden!
Als nach sechs Wochen der Herr Vetter Brommeler kam, um seinen neuen Dienst anzutreten, ward er von der Frau Base zuvor mit Kaffee bewirthet, ehe ihn eine Deputation der Gemeinde in sein vollkommen gerüstetes und bereites Pfarrhaus einführte, und mit dieser Stunde begann die Frau Stadtschreiberin die Ausführung ihres Operationsplans. Jungfer Philippine, die Haushälterin, die stets höchst besorgt um ihren Gebieter herumscherwenzelte, hatte nicht so ganz Unrecht mit dem instinktartigen Widerwillen, den sie bald unverkennbar gegen die Frau Stadtschreiberin an Tag legte; denn allerdings mußte diese ihr Werk damit beginnen, daß sie die Herrschaft der Philippine untergrub und dem Pfarrer die Nothwendigkeit einer Frau recht zum Bewußtsein brachte. Zu dem Ende wunderte sie sich gewaltig über den bisherigen Holz-, Zucker- und Kaffeeverbrauch des Herrn Vetters, fand seine Hemden etwas vergilbt, das Tischzeug nicht schön gewaschen, und der Schlußseufzer bei allem war stets: »freilich, wo eben keine Frau ist!«
Der Pfarrer ließ hie und da ein Wörtchen fallen von einer gesetzten Pfarrtochter der Gegend, von der und jener jungen Wittwe, von Jungfer Philippine selbst; da wußte aber die Frau Stadtschreiberin so gegründete Einwürfe, so wichtige Gegengründe, daß er an Keine mehr zu denken wagte. Endlich nach Wochen- und mondenlangem Streben hatte sie's zum großen Ziel gebracht, daß der Herr Vetter sagte: »Ja, wenn Sie mir eine taugliche Person wüßten, Frau Base!« Nun war der Damm gebrochen: »Ja, denken Sie, Herr Vetter, ich wüßte Jemand, der ganz für Sie geschaffen wäre.« – »Doch nicht zu jung?« – »Bewahre, was denken Sie! Ein recht gestandenes Frauenzimmer, eine Wittfrau.« – »So? – aber wissen Sie, Frau Base, aber – ich sehe zwar nicht aufs Aeußerliche – aber so eine ältere Person hat oft schon allerlei an sich; ich sollte Jemand haben, der mich aufheitert; auch eine Person, die noch sauber ist, wissen Sie, schon wegen der Gemeinde.« – »Ja, das wäre es gerade: eine so lebhafte Person, sie weiß von allem zu sprechen, und noch so gar wohl erhalten, weiß sich so nett zu kleiden; ich glaube, sie wird kaum etwas über vierzig sein.« Die Frau Stadtschreiberin beruhigte ihr Gewissen in der Stille mit dem Gedanken, daß nirgends bestimmt sei, wie viel etwas sei. »Und dann,« meinte der Herr Pfarrer, »werde ich doch allmählig auch älter (er war in den Sechzigen); da sollte sie mich auch in kranken Tagen wohl verpflegen können; es kann an den kräftigsten Mann etwas kommen.« – »Ach, das wäre da gerade die Hauptsache: ihr erster Mann ist zehn Jahre kontrakt gewesen und hatte die Kopfgicht.« Kurz, die Frau Stadtschreiberin kam so in Eifer, daß Frau Pfarrer Senner sich am Ende zu einer Perle sonder Preis verklärte und der Pfarrer kaum erwarten konnte, bis er dieses Kleinod zu Gesicht bekommen konnte.
Nun war die gute Frau in ihrem Element; schon auf kommenden Montag versprach sie eine Zusammenkunft einzuleiten und zog glorios ab, indem sie den schnippischen Abschiedsknix der Jungfer Philippine mit einem Blick voll triumphirenden Hohns erwiderte. Rüstig, als ginge sie selbst auf Freiers Füßen, wandelte die siebenundsechzigjährige Frau heim.
Viel flinker als das letztemal rüstete sie sich jetzt zur Reise in die Stadt und der dunkle Kattun wurde dabei in die Welt eingeführt. Frau Rutscher war diesmal daheim, aber die Frau Stadtschreiberin hatte nur mit halbem Ohr den sonst so interessanten Bericht von ihrer Tochter Wochenbett und dem Gedeihen des Säuglings, obgleich die Heirath dieser Tochter auch eine ihrer wohlthätigen Stiftungen gewesen war. Sie suchte so bald als möglich zur Frau Pfarrerin hinauf zu kommen, die schon nach vier Wochen den sauren Zug zu ihrem Stiefsohn antreten wollte. Als die begleitende Frau Rutscher abgerufen war, konnte die Frau Stadtschreiberin endlich herausrücken mit ihrem Projekt, obgleich sie in der Stille denken mußte, Frau Senner könne eben so gut etwas über fünfzig sein. So ganz mit offenen Armen, wie sie erwartet, eilte ihr Protégé dem verheißenen Ehestandshimmel nicht entgegen. »Wenn es eben ein zu alter Mann sei und kränklich, so wisse sie wirklich nicht – Sie sei der Ruhe so bedürftig, leide so viel im Magen, daß sie selbst Pflege brauche; wenn sie wüßte, daß sie in große Unruhe käme – u.s.w.« – »Bewahre! das ruhigste Leben von der Welt, ein ganz rüstiger Mann und ein schönes Vermögen! Da könne sie sich die besten Tage machen; jeden Winter werden acht Gänse gestopft, und eine so schöne Haushaltung!« Kurz der Frau Pfarrerin wässerte am Ende der Mund nach der geschilderten Herrlichkeit, und sie versprach, sich am Montag einzufinden, obwohl sehr verschämt und verlegen. Die Frau Stadtschreiberin kaufte noch ein Viertelpfund Anisbrod auf diesen großen Tag und fuhr im Triumph nach Hause.
Der Montag kam. Salome und die Frau Stadtschreiberin waren eine Stunde früher als sonst aufgestanden, hatten frischen Kaffee geröstet, Gugelhopfen gebacken und die Stube aufs schönste gerüstet. Um eilf Uhr kam die Frau Pfarrerin, die auf dem Fuhrwerk eines Briefpostillons bis eine halbe Stunde vor dem Städtchen hatte fahren können, auf's schönste geputzt, im schwarzseidenen Kleide und der Haube mit himmelblauem Band. Von der großen Frage des Tages ward gar nichts gesprochen, dazu waren sie zu diplomatisch; sie verzehrten in Eintracht einen Kalbsbraten unter neutralen Gesprächen. Salome, die natürlich im Geheimniß war, musterte die Kandidatin scharf, schien aber nach ihren halblauten Monologen in der Küche nicht sehr erbaut. »Hm, hm, da hat meine Frau nichts Besonderes herausgelesen: steinalt, und hat erst nichts; da hätt' ihn meine Frau fast selber nehmen können.«
Um zwei Uhr hielt die Kalesche des Herrn Pfarrers, für eine Pfarrkutsche noch ein ganz respektables Möbel. Die Frau Stadtschreiberin stieß ihre Schützlingin bedeutsam an, und diese verspürte fast etwas wie Herzklopfen, obgleich ihr Herz ein wenig eingerostet war für derartige Bewegungen. Der Herr Pfarrer, der die Damen am Fenster bemerkt hatte, wollte sich ganz jugendlich aus dem Wagen schwingen, welcher Versuch aber ohne die Beihülfe seines alten Mathes, des Pfarrkutschers, fast schwer mißlungen wäre. Er war etwas steif auf den Beinen, sonst noch ein sauberer Mann, und hatte eine kurze Uhrkette mit einer Menge goldener Cachets auf seiner schwarzseidenen Weste hängen.
Oben begrüßte er die Damen mit der zierlich steifen Galanterie seiner Jugend, war aber etwas betroffen beim Anblick des alternden Weibes, das den ihm beschiedenen Engel vorstellen sollte, und flüsterte der Frau Stadtschreiberin bedenklich zu: »Aber hören Sie, mit den vierzig Jahren–« »Nun ja, vielleicht kann sie auch fünfzig sein,« meinte die Frau Base begütigend und ordnete ihren Kaffeetisch. Sehr belebt wurde die Unterhaltung nicht, da die Frau Pfarrerin um ihren gänzlichen Zahnmangel nicht zu offenbaren, meist etwas undeutlich sprach, und der Herr Pfarrer, um sein übles Gehör zu verbergen, nur mit: »Ja, ja, o freilich,« u. dgl. antwortete.
Nachdem die Frau Stadtschreiberin ihre ganze Unterhaltungskunst erschöpft, in verschiedenen gewandten Wendungen die Geschicklichkeiten der Frau Pfarrerin so wie die Vorzüge der Pfarrei Schniezingen in's Licht gestellt hatte, beschloß sie, als letztes propates Mittel, das Paar allein zu lassen. – Da ward die stille Unterhaltung noch stiller, bis aus purer Verlegenheit der Herr Pfarrer sich an's Fenster stellte mit der Bemerkung: »Eine recht freundliche Aussicht.« Die Frau Pfarrerin gesellte sich zu ihm und stimmte höflich bei, wodurch Beide einen sehr bescheidenen Geschmack an Tag legten, denn man sah in der engen Gasse nichts als die gegenüberliegende Schmiede mit einem struppigen, verwahrlosten Gärtlein. Die ungeduldige Frau Stadtschreiberin schaute nach einer Weile zur Thür herein, und als sie die Beiden so schweigsam beisammen stehen sah, konnte sie nicht anders denken, als es sei nun auf dem Punkt der Erklärung, und um den glücklichen Augenblick zur Reife zu bringen, rief sie mit heller Stimme: »Aber, Herr Vetter, geben Sie doch Ihren Gefühlen auch Worte!« und verschwand wieder.
Das war eine harte Zumuthung, und der Herr Vetter wäre gern in ein Mausloch geschlüpft, wenn's angegangen wäre, da seine Gefühle dermalen in nichts als in einer gewissen Unbehaglichkeit und in dem Wunsch bestanden: »Wenn ich nur mit heiler Haut draußen wäre!« Der Zuruf der Frau Base gab aber der Sache eine bedenkliche Wendung. Die Frau Pfarrerin schien es anders aufzunehmen, denn sie hob mit sittsam niedergeschlagenen Augen an: »Es hat mich freilich viel Ueberlegung gekostet – – Wenn man einen so rechtschaffenen Mann gehabt hat. – Aber meine Lage ist freilich sehr einsam.« Was wollte der gute Pfarrer machen? Er hatte noch zu viel chevalereske Gesinnung aus der guten alten Zeit, um unter solchen Umständen eine Dame im Stich zu lassen; so ergänzte er denn die halben Worte der Frau Pfarrerin, und als die Frau Stadtschreiberin wieder eintrat, stellte er ihr seine Frau Braut vor, deren Hand er zierlich an die Lippen führte.
Die Ehestifterin war überglücklich und konnte nicht müde werden, jedem der Beiden zu Gemüth zu führen, wie vortrefflich sie gewählt hätten. Ja sie holte eigenhändig ein paar Flaschen vom langgesparten köstlichen Elfer, den sie noch aus ihres Mannes Glanzzeiten besaß, um des Bräutigams Feuer zu beleben und um seinen Muth zu stählen für den kritischen Augenblick, wo er der Jungfer Philippine die Neuigkeit mitzutheilen hatte.
Die Frau Pfarrerin war eine äußerst glückliche Braut und dankte Gott für das gute Plätzchen, das er ihr für ihre alten Tage bescheert hatte. Der Herr Bräutigam erlaubte sich während der Brauttage noch einmal die Bemerkung gegen die Frau Stadtschreiberin: »Frau Base, ich meine, sie müßte auch über fünfzig sein.« – »Nun, und was ist's denn, wenn sie auch fünfundfünfzig ist?« – So dachte am Ende der Herr Pfarrer selbst und wurde noch so zärtlich wie nur irgend ein getrösteter Wittwer, als welche Zärtlichkeit mich stets an aufgegossenen Thee mahnt, den man recht süß einschenkt, um das mangelnde Aroma des ersten Gusses zu ersetzen.
Die Hochzeit ward nicht lange verzögert; da sich aus dem Taufschein ergab, daß die Frau Braut bereits an den Sechzigen war, so hatte das Pärchen allerdings nicht viel Zeit zu verlieren. Jungfer Philippine zog mit stillbeleidigter Würde und allerlei dunkeln Prophezeihungen ab, und die Frau Braut mit ihrem bescheidenen Hausrath ein. Die Pfarrkalesche wurde neu lakirt und der Herr Pfarrer führte seine junge Frau darin zu allen Pfarrkränzen und sonstigen anständigen Gelegenheiten und sorgte auch stets dafür, sie mit modernem Putz zu versehen, wie er sich mit ihren Jahren vertrug.
Mit der Verpflegung wurde es nun freilich nicht viel; hatte der Mann einen Rheumatismus im Rücken, so hatte die Frau das Reißen in den Gliedern, klagte er Ohrensausen, so klagte sie Magenweh, so daß sich am Ende die Rolle umkehrte und der Pfarrer als rüstiger Greis einherschritt, während sie als zitternde Alte an seinem Arm hing. Das ließ er sie aber nicht entgelten, und er nahm ein armes, demüthiges Bäschen in's Haus, das mit dankbarer Geduld sich den beiderseitigen Launen des alten Paares fügte.
So lebten sie neben all' ihren Klagen über schlechten Magen und schlechte Zeiten in großer Eintracht zusammen, und es war der Mühe, die sich die Frau Stadtschreiberin gegeben, die Verbindung zu Stande zu bringen, immerhin noch werth gewesen. Sie feierten noch die silberne Hochzeit zusammen, und als der Pfarrer, gesättigt von langem Leben, in seinem neunundachtzigsten Jahre entschlief, drückte ihm das Mütterchen in gewisser Aussicht baldiger Nachfolge getrost die Augen zu.