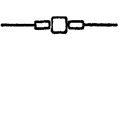|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Mr. Brown von England ist wenig erbaut von französischen Gerichtsmethoden und hätte seinen Verteidiger am liebsten umgebracht. Ueberraschungs-Feuerwerk: Hochzeit in Sicht. Schluß.
Der Tag der Schwurgerichtsverhandlung war da. In ihren Meldungen über die Verhaftung und die Untersuchung waren die Zeitungen sehr diskret gewesen (wie es bei französischen Zeitungen Sitte ist) und hatten nichts weiter gebracht, als daß Monsieur H. B. – der sich längere Zeit als angeblicher Tourist in Mouleville aufgehalten habe, als gefährlicher cambrioleur verhaftet worden sei, zusammen mit einer Diebsbande, der die Polizei schon lange auf der Spur war. So sagte ihm sein Verteidiger, und Brown atmete auf. Man konnte also in Brixton nichts wissen von seiner Schande! Die Oeffentlichkeit schien sich überhaupt nicht besonders zu interessieren für die Verhandlung; nur die gewöhnlichen habitués des Kriminalgerichts waren anwesend, die Bummler, die man in allen Gerichten der Welt findet. Nach den einleitenden Formalitäten aber bemerkte Brown, daß Mr. White im Hintergrund des Zuhörerraums auftauchte, und daß die Reporter am Pressetisch sehr emsig zu schreiben anfingen. Und es dauerte nicht lange, so wurde Mr. White vom Vorsitzenden zur Ruhe verwiesen, denn er setzte den Umstehenden mit allzu lauter Stimme die Vorzüge englischer Gerichtsmethoden gegenüber den französischen auseinander.
Brown kamen die französischen Gerichtsmethoden allerdings auch furchtbar sonderbar vor. Sie verwirrten ihn noch mehr, als er es so wie so schon war. Die Richter (drei an der Zahl) schienen wenig Autorität und noch weniger Würde zu besitzen. Sie stritten sich fortwährend mit den Verteidigern herum, die, so schien es Brown, sich die größte Mühe gaben, die Richter fortwährend zu ärgern, sich aber auch ohne Unterlaß unter sich selbst in die Haare gerieten. Sie waren sich offenbar spinnefeind, und jeder versuchte nur, seine eigene Persönlichkeit zur Geltung zu bringen. Brown war ganz geknickt. Ihre Klienten schienen diesen französischen Advokaten etwas furchtbar Nebensächliches zu sein. Die einzige offizielle Persönlichkeit, die eine wirklich würdevolle Haltung bewahrte, war der Procureur de la République, der Staatsanwalt, der in seiner seidenen Robe sehr großartig aussah und Richter und Verteidiger und Geschworene mit einer gewissen Verachtung behandelte. Die Gefangenen beachtete er erst dann, als er die Anklage formulierte, und diese Anklage formulierte er mit einer sprachlichen Bösartigkeit und Wucht, die für den armen Brown eine vorzügliche Lektion im Französischen bedeutete.
Brown, der chef de la bande, saß zusammen mit den anderen Mitgliedern der Bande auf der Anklagebank, zwischen Duveen und Monsieur Georges. Neben Monsieur Georges saß la duchesse, und neben Duveen der rotbärtige Marquis. Hinter und neben den Angeklagten wachten bewaffnete Gendarmen.
Gendarmen!
Browns Gefühle lassen sich schwer beschreiben; bald hätte er gerne geflucht, bald war er den Tränen nahe. Und dann war es doch ein infames Pech, ausgerechnet neben Monsieur Georges zu sitzen! Nun erst sah Brown, welches Verbrechergesicht dieses Subjekt hatte! Neben diesem Menschen zu sitzen, zusammen mit ihm angeklagt zu sein, das genügte den Geschworenen wahrscheinlich schon vollkommen, um ihn zu verurteilen, was nun die Anklage auch sein mochte. Noch mehr aber regte Brown sich über Thérèse auf. In den Wochen der Gefängniseinsamkeit hatte er kaum an sie gedacht; seine zärtlichen Gefühle jedenfalls waren wie weggeblasen. Nun aber machte sie wieder einen unbeschreiblich tiefen Eindruck auf ihn. Sie trug das weiße Kostüm, in dem er sie zuerst im Kasino gesehen hatte; sie war Königin wie immer. Schweigend, hochmütig, gleichgültig, vornehm. Auch auf die Geschworenen schien ihre Erscheinung Eindruck zu machen; jedenfalls musterten sie die weiße Dame mit Blicken, die für gestrenge Richter viel zu sehr glänzten. Thérèse hielt dieses Anstarren aus, ohne auch nur einen Muskel in ihrem Gesicht zu bewegen.
Die Verhandlung begann.
Zuerst verhörte der vorsitzende Richter die einzelnen Angeklagten; einen nach dem andern. Das heißt, er verhörte sie eigentlich nicht, denn von Rede und Gegenrede war keine Spur, und keiner der armen Sünder auf der Anklagebank hatte auch nur die geringste Gelegenheit, nur ein Wörtchen anzubringen. Der Herr Vorsitzende hielt ihnen einfach vor, was sie getan hatten, was für Spitzbuben sie seien …, Er hielt einfach eine wuchtige Rede in sehr elegantem Französisch.
Brown versuchte mindestens zehnmal, seine Unschuld zu beteuern – ohne den geringsten Erfolg. Und dann verstand er auch den dahinjagenden Redefluß nur teilweise –
»Ja, aber –«
»Lügen Sie nicht! Sie sind mit der Absicht nach Mouleville gekommen, ein Verbrechen zu begehen und –«
»Nein.«
»Sie begehen durch Ihr freches Leugnen ein weiteres Verbrechen – ein Verbrechen an der Intelligenz der Herren Geschworenen und …,«
Brown gab überhaupt keine Antwort mehr, denn sein Verteidiger flüsterte ihm zu, die Verteidigung doch um Gotteswillen ihm zu überlassen. Brown knaxte zusammen wie eine geknickte Lilie und nahm sich vor, später einmal diesem Richter einen ganz niederträchtigen Brief zu schreiben. Wenn er wieder sicher in England war! Am allerliebsten hätte er den Herrn Vorsitzenden sofort, im Gerichtssaal, in Grund und Boden geboxt, aber er fürchtete, daß dies seiner Sache nur wenig helfen würde, und bezwang sich. Mit diesen vorbereitenden Formalitäten war schon über eine Stunde vergangen. Nun begann der Staatsanwalt seine Rede.
Brown, der zwar nicht alles, aber doch ein gut Teil verstand, hörte mit unbeschreiblichem Entsetzen die Lebensgeschichte seiner Freunde und Kollegen auf der Anklagebank.
»Ich beginne,« sagte der Procureur de la République, mit der am wenigsten interessanten Persönlichkeit dieser Bande von Verbrechern.« (Dabei deutete er mit seinem Taschentuch, das er überhaupt gern in seinen Gesten verwandte, auf den rotbärtigen Marquis.) »In dieser speziellen Affäre scheint sein Verbrechen nur darin zu bestehen, daß er den anderen Verbrechern Unterschlupf gewährte und das Diebsgut in Empfang nahm, als die Tat geschehen war. Ich bitte jedoch die Herren Geschworenen zu berücksichtigen, daß er diese passive Verbrecherrolle sein ganzes Leben lang gespielt hat; sein Haus ist schon immer das Rendezvous von Dieben gewesen, das Geschäft des Hehlers ist sein eigentlicher Beruf. Wir vermuten, daß dieser alte Spitzbube mit verschiedenen Hehlern in den verschiedensten Ländern in Verbindung steht, und so unauffällig über Diebsgut disponiert. Es ist höchste Zeit, daß die bürgerliche Gesellschaft vor diesem gefährlichen Menschen geschützt wird. Bis jetzt war er schlau genug, sich nicht in den Maschen des Gesetzes zu verfangen; aber die Polizei hat ihn schon lange beobachtet. Es ist nunmehr Ihre angenehme Pflicht, meine Herren, diesem Menschen Gelegenheit zu geben, über seine Sünden nachzudenken; ihn auf lange Zeit hinaus zu verhindern, sein anrüchiges Gewerbe weiter zu betreiben.«
Brown schnappte nach Luft. Wenn der Marquis wirklich ein solcher Gauner war und trotzdem die am wenigsten interessante Persönlichkeit der Bande, so mußten ja die anderen – – – Er schauderte. Das war ja reizend! Und es fiel ihm ein, daß er, Brown, Brown von Brixton, Mr. Brown von England, ja der Anführer dieser Bande war! Was würde dieser giftige Staatsanwalt wohl über ihn sagen? – – –
Vom Marquis wandte sich der Staatsanwalt Duveen zu, den er als eine Pestbeule des Bades Mouleville bezeichnete; der davon lebte, arglose Touristen zu plündern, der nur mit der verbrecherischen Schicht der Bevölkerung von Mouleville verkehre. Nur ein geradezu unerklärliches Glück habe ihn davor bewahrt, schon früher mit einem französischen Zuchthaus Bekanntschaft zu machen. An seiner Schuldigsprechung könne ja kein Zweifel sein, und für eine exemplarische Strafe werde der hohe Gerichtshof zweifellos sorgen.
Dann kam Monsieur Georges an die Reihe, und der Staatsanwalt öffnete die Schleusen seiner bissigsten Dialektik. Ah, dieses infame Subjekt! Ein Erpresser, ein Rowdy, ein gefährlicher Dieb. In Paris war er ein gefährlicher Apache und der Schrecken der Nachbarschaft gewesen. Nach Mouleville sei er gekommen, um zu sehen, was sich in der Saison machen ließe. Und der Staatsanwalt schickte sich an, in glühenden Farben den Charakter und das Vorleben von Monsieur Georges zu beschreiben.
»God bless my soul«, murmelte Brown entsetzt und rückte unwillkürlich so weit als möglich von Monsieur Georges ab, wenn das auch nicht sehr weit war. Seine Haare sträubten sich, als er weiter zuhörte.
Dieser Monsieur Georges war, wie der Staatsanwalt ausführte, unzählige Male mit schweren Gefängnisstrafen vorbestraft; er stand im dringenden Verdacht, mehrere Personen ermordet zu haben! Ferner sei, nebensächlich zwar, doch bezeichnend, auf seinem linken Arm eine Guillotine tätowiert und darunter die Legende: »Mimi est à moi«.
Im großen und ganzen schien es Brown, als er die Liste von Monsieur Georges' Verbrechen hörte, als sei er selbst ungewöhnlich billig davongekommen. Das schien auch die Meinung von Monsieur Georges zu sein, denn er grinste Brown mit einem unverschämten Lächeln an, als wolle er sagen: »Sehen Sie! Ihnen gegenüber bin ich doch eigentlich sehr nett gewesen!«
»Wir kommen nun zu der Dame auf der Anklagebank«, fuhr der Staatsanwalt fort. »Nach unserem französischen Motto: »Place aux Dames« hätte ich eigentlich mit ihr beginnen müssen, zog es jedoch vor, bei der logischen Reihenfolge zu bleiben. Wir haben hier eine Dame, meine Herren Geschworenen, die sich der verschiedensten Namen bedient, deren korrekte bürgerliche Bezeichnung jedoch ist: la fille Durand. Wie ich schon angedeutet habe, scheint sie in diesem Falle nur das Werkzeug des Mannes Georges zu sein. Sie steht vollkommen unter seinem verderblichen Einfluß, und nur dieser Einfluß ist daran schuld, daß sie das ist, was sie ist. Im Gegensatz zur modernen Frauenbewegung bin ich noch immer der altmodischen Ansicht, daß Männer es sind, die Frauenschicksale entscheiden; daß Frauen nicht in dem gleichen Maße verantwortlich für ihre Handlungen sind wie Männer. Ich hoffe deshalb, daß der hohe Gerichtshof Madame milder beurteilen wird, als die Männer, wenn ich auch für sie eine längere Gefängnisstrafe beantragen muß.«
Der Staatsanwalt machte eine Pause und fächelte sich Kühlung zu. Brown fing an, trotz seines Entsetzens neugierig zu werden. Was würde dieser energische Herr nun wohl über ihn sagen? Die leise Hoffnung stieg in ihm auf, daß man ihm nun vielleicht gerecht werden würde – nun, da man sah, in wessen Hände er gefallen war. Jawohl. Alan würde ihn vielleicht ob seines Leichtsinnes abkanzeln, aber – – –
Doch –? was war das …, Die Haare standen ihm zu Berge …,
Mit ausgestrecktem Zeigefinger deutete der Staatsanwalt auf Brown. Seine Augen funkelten. Neue Energie lag in seiner Stimme:
»Dies ist der Rädelsführer. Messieurs les jures, wir haben hier den Anführer dieser verbrecherischen Bande; das Hirn, das dieses Verbrechen ersann, die Hand, die es ausführte – denn dieser Mann ist es zweifellos gewesen, der die Witwe Polin beraubt hat! Trotz Erkundigungen in seinem Heimatland – ich bedauere, konstatieren zu müssen, daß der Angeklagte ein Angehöriger der befreundeten Nation jenseits des Kanals ist – ist es uns nicht gelungen, seine Persönlichkeit festzustellen.«
»Aha!« dachte Brown. »Gott sei Dank!«
»Er weigerte sich, Auskunft über sich selbst zu geben; weigerte sich sogar, einen Rechtsanwalt seines eigenen Landes mit seiner Verteidigung zu betrauen, wenn er auch klug genug gewesen ist, einen der geschicktesten jungen Anwälte unserer Stadt mit der Wahrnehmung seiner Interessen zu beauftragen.«
Brown freute sich außerordentlich, zu hören, daß sein Verteidiger so geschickt sein sollte.
»Wer ist Brown? Ah, meine Herren Geschworenen, ich kann es Ihnen sagen: Brown ist eines jener Geschöpfe, die im Rinnstein aufgewachsen sind, dorthin geschleudert aus einer erbärmlichen Stube in einem jener fürchterlichen Häuser in den Slums der Riesenstadt London!«
»Well, I 'll be damned,« murmelte Brown.
»Er ist zum Verbrecher geboren, und wir gehen wohl nicht fehl, meine Herren, wenn wir annehmen, daß er niemals etwas anderes gewesen ist, als ein Verbrecher. England mag ihm zu klein geworden sein für seine verbrecherischen Talente, und er beschloß, ein Gastspiel in Frankreich zu geben. Doch das Glück war ihm nicht hold in Frankreich! Wir haben ihn!«
Brown platzte beinahe vor Wut und war im besten Zuge, endlich einmal seine Meinung hinauszubrüllen (der Dolmetsch würde schon übersetzen), als ihm einfiel, daß es viel klüger sein würde, seinem Verteidiger zu vertrauen. Ihm würde man ja doch nichts glauben! Aber nun tat es ihm doch furchtbar leid, daß er seinen Stolz nicht in die Tasche gesteckt und sich nach Brixton um Hilfe gewandt hatte …,
Der Staatsanwalt fuhr fort. Er beschrieb den Geschworenen ausführlich, wie Brown das Verbrechen begangen hatte, genau so, wie es der Untersuchungsrichter getan hatte, und verfehlte nicht, ihn als ein wahres Monstrum von Gemeinheit und Brutalität hinzustellen. Er führte aus, daß Brown trotz der erdrückenden Beweise kein Geständnis abgelegt habe und bemerkte, ein Gefängniswärter würde bezeugen, daß Brown einen Versuch gemacht habe, den Mitangeklagten Duveen zu bestechen. Und dann folgte ein leidenschaftlicher Appell an messieurs les jurés, diesem gefährlichen Verbrecher ein für allemal sein Handwerk zu legen!
Damit endete der erste Verhandlungstag.
Brown wurde in seine Zelle zurückgeführt, in höchst aufgeregtem Zustande. (Unterdessen war ihm wieder eine Einzelzelle angewiesen worden.) Er fluchte zweieinhalb Stunden lang und schickte dann, was klüger war, nach seinem Verteidiger. Aber der junge Rechtsanwalt, den die Komplimente des Staatsanwalts noch selbstbewußter gemacht hatten, wollte von nichts hören.
»Meine Verteidigungsrede ist vorbereitet, und ich bin mir über die Methode Ihrer Verteidigung vollkommen klar«, erklärte er Brown. »Mehr kann ich nicht für Sie tun. Ich hoffe jedenfalls, Sie frei zu bekommen. Vertrauen Sie nur auf mich!«
»Aber ich habe ja gar nichts getan – confound it!« schrie Brown. »Glauben Sie mir doch gefälligst, daß ich unschuldig bin!« Beinahe hätte er geheult. Nicht einmal sein eigener Rechtsanwalt wollte ihm glauben!
»Ob Sie unschuldig sind oder nicht, ich werde mein Bestes für Sie tun«, lächelte der Verteidiger. »Ich kenne meine Geschworenen, und ich weiß genau, was ich sagen muß, um Eindruck auf sie zu machen und Ihnen ihre Sympathie zu erwerben.«
Und damit mußte Brown sich zufrieden geben. Das fürchterlichste war, daß er keine Ahnung hatte, welche Taktik sein Verteidiger eigentlich einzuschlagen gedachte! Vertrauen hatte er gar keines zu ihm. Wie konnte man einem Mann vertrauen, der einem nicht einmal glaubte, daß man unschuldig war!
»– es ist häufig ein schwerer Fehler für einen Angeklagten, sich nichtschuldig zu bekennen«, bemerkte dieser talentierte Rechtsanwalt noch. »In diesem Fall würde es sehr gefährlich sein, und ich kann die Verantwortung dafür nicht übernehmen. Meine Methode ist besser. Sie müssen mir eben vertrauen …,«
* * *
Diesmal war der Zuhörerraum des Schwurgerichtssaales bis zum letzten Plätzchen besetzt. Die anwesenden Damen wollten sich diesen schrecklichen Engländer einmal ansehen; die Herren natürlich Madame – la fille Durand. Unter den Zuschauern bemerkte Brown auch White. Neben ihm saß Fiddle, die ihn mitleidig aber vorwurfsvoll anblickte. Brown schauderte wieder einmal. Hielt sie ihn dieses Verbrechens etwa gar für fähig? Glaubte sie ihn schuldig? Welche Situation! Und doch hatte Brown während all dieser Gefängniswochen geglaubt, daß es lächerlich leicht sein werde, seine Unschuld zu beweisen, denn er war doch wirklich unschuldig! Er vergaß ganz, daß man mit der Wahrheit nicht weit kommt, wenn man diese Wahrheit nicht mit sehr plausiblen greifbaren Gründen unterstützen kann: im Gerichtssaal wie im Leben! Als er seinem Verteidiger immer wieder versichert hatte, er wolle ja nur die Wahrheit aussagen und nichts als die Wahrheit, da hatte dieser gescheite Mann nur gelächelt und geantwortet, Beweise wären ihm lieber. Lieber Lügen als Wahrheit ohne Beweise. – Diese Bemerkung war Brown damals als unangenehm originell ausgefallen, aber nun schien es ihm doch, als sei etwas Wahres daran …,
Die Verhandlung begann mit der Verlesung der kommissarischen Aussage der Witwe Potin, die noch immer zu krank war, um persönlich vor Gericht zu erscheinen. Diese Aussage ließ an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Sie beschrieb den Raub und den Räuber – Brown, wie er leibte und lebte!
Dann wurde Mr. White als Zeuge aufgerufen. Er gab sich anscheinend alle Mühe, nichts Ungünstiges über Brown zu sagen, bemerkte sogar, daß er auf ihn einen sehr günstigen Eindruck gemacht habe, mußte aber zugeben, daß Brown das Hotel verlassen habe, ohne seine Rechnung zu bezahlen.
Brown warf Duveen einen vorwurfsvollen Blick zu und sofort stand dieser auf und teilte dem Gerichtshof mit, Brown habe ihm das Geld zur Bezahlung der Rechnung gegeben, er habe dieses Geld aber für sich behalten.
»Ganz richtig«, lächelte der Staatsanwalt. »Diese Aussage haben wir erwartet. Brown hat Duveen bestochen, ihn zu entlasten!«
Und der Gefängniswärter wurde als Zeuge vernommen – –
Brown war am Verzweifeln. Was hatte sein Verteidiger gesagt? Das war nun wieder etwas Wahres gewesen und hatte die Geschichte doch nur noch schlimmer gemacht. Sein Verteidiger beugte sich zu ihm nieder und flüsterte ärgerlich:
»Sagte ich es nicht! Wenn Sie nicht den Mund halten, und Ihr Freund neben Ihnen nicht ebenfalls seinen Mund hält, so bekomme ich Sie gewiß nicht frei.«
Brown nickte traurig. Er war eben eine Puppe, die jeder Narr tanzen lassen durfte! Von nun an hörte er nur geduldig zu und tröstete sich damit, unhörbare Bemerkungen über Richter, Staatsanwalt und Verteidiger vor sich hinzumurmeln, Bemerkungen, die diese Herren in weißglühende Wut versetzt hätten, wären sie ihnen zu Ohren gekommen.
Die Verteidigungsreden begannen. Zuerst kam der Marquis an die Reihe, den sein Verteidiger als einen ehrlichen alten Fischer hinstellte, der im Leben nichts Unrechtes getan und das Diebsgut nur aus lauter Gutmütigkeit aufbewahrt hätte.
Der Verteidiger Duveens wälzte, ganz gegen die Instruktion, die Duveen ihm gegeben hatte, alle Schuld auf Brown und konstatierte, daß der arme Duveen dem Banne Brownscher Ueberredungsgabe und Liebenswürdigkeit erlegen sei. Was Georges anbetraf, so gab sich sein Verteidiger gar nicht erst die Mühe, den Geschworenen zu erzählen, die Juwelen seien seinem Klienten geschenkt worden, sondern behauptete nur, Monsieur Georges wisse überhaupt nichts von der ganzen Sache. Im übrigen appellierte er leidenschaftlich an die Geschworenen, sie möchten seinen unschuldigen und daher bedauernswerten Klienten seine unglückliche Vergangenheit nicht entgelten lassen.
Bis jetzt hatten die Verteidigungsreden gerade keine hervorragenden Leistungen gebracht, und das Interesse weder der Richter noch der Geschworenen schien auch nur im mindesten geweckt worden zu sein. Nun aber erhob sich der Verteidiger von la duchesse, und ein Murmeln gespannter Erwartung ging durch den Gerichtssaal. Und die Rede war auch wirklich sehr interessant. Mit Tatsachen beschäftigte sich der Verteidiger gar nicht; er erwähnte kaum, was es war, das la fille Durand, oder »dieses unglückliche junge Weib«, wie er sie nannte, vor die Schranken des Gerichts führte. Er appellierte nur an die Ritterlichkeit der Geschworenen, an ihre Herzen als Söhne und Gatten. Er erbat ihr Mitleid für ein armes Weib, das vier raffinierten Gaunern in die Hände gefallen sei. Er erwähnte die Tatsache, daß la duchesse vier Söhne hatte –
Brown fuhr auf wie von einer Tarantel gestochen …,
– vier Söhne, die dereinst einmal für ihr französisches Vaterland kämpfen würden, und um dieser vier Söhne willen müsse man Madame verzeihen; um dieser vier Söhne willen, die nur den einen Wunsch hätten, dereinst für la patrie zu sterben. So ging es fort. Die Geschworenen waren offenbar gerührt, und dieser und jener wischte sich eine heimliche Träne ab. Schließlich blieb niemand im Gerichtssaal ungerührt – außer la duchesse, die vornehm und melancholisch aussah, wie immer, und Monsieur Georges, der zynisch lächelte.
Als der Verteidiger fühlte, daß er aus der Situation herausgeschunden hatte, was nur herauszuschinden war, nahm er unter großem Applaus Platz.
Dann erhob sich Browns Verteidiger, und der arme Brown wünschte sich in irgend ein Mauseloch. Nein, lieber nicht – er war doch allzuneugierig auf die famose Methode seines talentierten Rechtsbeistands. Er fühlte instinktiv, daß die Stimmung unter Richtern und Geschworenen sehr gegen ihn war, und daß sein Verteidiger einen harten Stand haben würde. Und dann vergaß er sich selbst und seine furchtbare Lage und die Menschen um ihn her in dem einen Bestreben, so viel als möglich von dieser schicksalschweren Rede zu verstehen. Er lauschte und lauschte.
Der Herr Verteidiger begann damit, seinen Vorredner zu beglückwünschen und den Herren Geschworenen zu versichern, daß niemand Frauen mehr bewundern und Frauen größere Hochachtung zollen könne als er. Madame, die er unglücklicherweise auf der Anklagebank erblicken müsse, sei zweifellos eine Zierde ihres Geschlechtes in Schönheit und Liebenswürdigkeit und Anziehungskraft. Davon hätten sich die Herren Geschworenen ja sicherlich schon überzeugt und er denke nicht im Traum daran, diese Tatsachen bestreiten oder messieurs les jurés gegen die bedauernswerte Dame beeinflussen zu wollen.
Brown verstand jedes Wort. Was zum Teufel hatte das mit ihm zu tun?
Er jedoch wie die Geschworenen hätten Pflichten gegen seinen Klienten, und weder Ritterlichkeit noch Galanterie dürfe ihn und die Herren Geschworenen verhindern, diese Pflichten zu erfüllen. Denn diese Dame sei nicht nur bezaubernd schön, sondern auch, eben durch ihr bestrickendes Wesen gefährlich. Die Geschworenen würden sich aus den Feststellungen des Herrn Staatsanwalts erinnern, daß sie im Moment der Verhaftung eine Perlenkette und eine Tiara aus Diamanten getragen hatte – Schmucksachen, die aus dem an der Witwe Potin begangenen Raub stammten. Darin liege der Schlüssel der Situation. Er gedenke den Diebstahl nicht abzuleugnen –
»Oh Lord!« stöhnte Brown entsetzt.
– aber die Bürde allzu schwerer Verantwortung müsse er von den Schultern dieses armen, irregeleiteten Fremden nehmen, dieses unglücklichen Fremden auf französischem Boden. Er dürfe ja der Sympathie der Herren Geschworenen sicher sein für einen Angehörigen der befreundeten Nation, der nur im Impuls gesündigt habe.
»Ah, meine Herren Geschworenen, ich brauche Ihrem feinfühligen Verständnis ja kaum zu schildern, was sich zugetragen hat und wie es sich zugetragen hat! Ein junger Mann, der unser schönes Bad Mouleville in der unschuldigsten Absicht besucht. Plötzlich taucht vor seinen in dieser Hinsicht so gar nicht verwöhnten Augen ein Bild französischer Schönheit auf, – Madame! Heiße Liebe schleicht sich in sein Herz mit all der beharrlichen, zähen Leidenschaft seines nordischen Temperaments. Ah, meine Herren Geschworenen, mein unglücklicher Klient ist nicht der erste Mann, der über einer Frau das Gefühl moralischer Verantwortung verloren hat. Als Männer von Welt werden Sie das begreifen, messieurs les jurés, und ich erbitte nun Ihre Erlaubnis, Ihnen die Erlebnisse dieses armen Fremden mit dem Griffel der Sympathie und des Verständnisses ausmalen zu dürfen.«
Brown zitterte vor Wut und Entrüstung. Aber er war ja hilflos!
Zunächst beschrieb der talentierte junge Rechtsanwalt die Gemütsverfassung seines armen Klienten in diesem Stadium; eine Schilderung, die weder tragischer Höhen noch pikanter Tiefen entbehrte. Mit glühenden Worten, in der Technik sich etwas an Bourget anlehnend, malte er aus, wie Liebe und Leidenschaft wuchsen und wuchsen, bis das Opfer weiblicher Verführungskunst so weit war, auch ein Verbrechen zu begehen, um sich die Gegenliebe der Angebeteten zu erringen. Er sprach vom Garten des Paradieses und von ewigalter und ewigneuer Versuchung, und kein Auge blieb trocken.
(Auch Brown heulte beinahe, aber aus ganz anderen Motiven).
– Er bat die Herren Geschworenen, sich doch in die Lage seines Klienten hineinzuversetzen, was diese anscheinend auch ganz gerne taten. Und dann ließ er sich von seiner Beredsamkeit fortreißen und sprach gar nicht mehr von seinem Klienten, sondern nur noch von der furchtbaren Macht der Leidenschaft und ihren unübersehbaren Konsequenzen. Im Schwurgerichtssaal war es totenstill. Richter und Geschworene hingen ihm förmlich an den Lippen –
»Ich flehe Sie an, meine Herren Geschworenen,« so schloß die Rede, »wohl zu erwägen, daß in Ihren Händen das Schicksal dieses Opfers der Leidenschaft liegt. Richten Sie selbst; überlassen Sie ihn nicht der Gnade des Gerichtshofes. Ziehen Sie alles in Betracht. Nicht nur die Tat, nein, die besonderen Umstände, die schwere Versuchung, die geheimen Motive, das Verhängnis, das ihn vorwärtstrieb auf der schiefen Bahn. Sind Sie in Ihrem Gewissen überzeugt davon, – und nur Ihrem Gewissen sind Sie verantwortlich, meine Herren Geschworenen – daß Liebe und Leidenschaft diesen Mann blendeten; fühlen Sie, daß die Liebe stärker war in ihm als Vernunft und Pflicht – dann müssen Sie ihn freisprechen! Ich bitte Sie, in Ihrem Wahrspruch zu bedenken, daß mein unglücklicher Klient nur die eine Schuld auf sich lud, allzu empfänglich gewesen zu sein für die Reize der Schönheit. Ich bitte Sie, ich flehe Sie an, ihn als freien Mann hinauszusenden in diese wunderschöne Welt, damit er seine Vernunft wiederfinde und seine starken Impulse bezähme. Im Namen der Menschlichkeit, meine Herren! Im Namen jener Menschlichkeit, die Menschliches feinsinnig versteht: ich verlange den Freispruch meines Klienten, messieurs les jurés!«
Der arme Brown hätte seinen schlauen Verteidiger am liebsten gleich im Gerichtssaal, sofort, augenblicklich, langsam und qualvoll vom Leben zum Tode befördert – kein Tod konnte schlimm genug sein für diesen Rechtsbeflissenen! – aber auf Richter und Geschworene schien die Rede merkwürdigerweise einen tiefen Eindruck gemacht zu haben, denn als der junge Rechtsanwalt sich setzte, wurde ihm allgemeiner und anhaltender Beifall gespendet. Auch diese beifallspendenden Individuen hätte Brown gerne umgebracht. Sein Verteidiger dagegen war außerordentlich zufrieden. Wußte er doch genau, daß diese Schwurgerichtsverhandlung einen großen Schritt vorwärts in seiner Karriere bedeutete – einen bedeutenden Erfolg. Und dann war es ja auch sehr gut möglich, daß Brown wirklich freigesprochen wurde. Brown jedoch war anderer Meinung. Und selbst wenn man ihn freisprach – aus solchen Gründen wünschte er gar nicht freigesprochen zu werden. Wenn das Frankreich und französische Gerechtigkeit war, dann pfiff er auf Frankreich …, Er pfiff nachgerade überhaupt auf Frankreich! Seinetwegen mochte der Teufel Frankreich holen, so schnell es ihm irgendwie paßte!!
Da – wachte er, träumte er? – hörte er eine Stimme – eine Stimme – eine englische Stimme, die ihm wie ein Märchentraum sein gutes altes England und sein liebes Brixton und allerlei Glückseligkeit vorzauberte – eine Engelsstimme …,
»Harold!«
Eine junge Dame drängte sich durch die Reihen der Zuhörer, energischen Gebrauch von ihren zierlichen Ellbogen machend.
»Harold!«
»Amelia!« jubelte Brown.
Es war Amelia, seine Amelia, die Amelia, die er so treulos verlassen hatte, und es schien Brown, als habe er im Leben nichts Schöneres gesehen, nie eine größere Seligkeit verspürt. Seine Amelia! Wie alt und müde sah der duchesse gekünstelte Schönheit auf einmal aus neben diesem lebensjungen und lebensfrischen Geschöpf –
»Harold!«
Richter und Geschworene und Zuschauer reckten die Hälse und staunten und starrten …, In irgend einem andern Lande würde die junge Dame von energischen Gerichtsdienern sehr rasch zur Türe hinausbefördert worden sein; aber französische Gerichtshöfe haben ihre eigene Art, die schließlich auch zu den Zielen der Gerechtigkeit führt, wenn auch auf einigen Umwegen. Richter und Geschworene betrachteten sich die junge Dame sehr interessiert und sehr eingehend – da – –
Eine Ueberraschung!
Ein eleganter Herr, im feierlichen Gehrock, einen Seidenhut in der Hand haltend, drängte sich zur Barriere durch und flüsterte hastig dem Verteidiger Browns einige Worte zu. Und wieder reckte der Vorsitzende den Hals; der Herr war ihm wohlbekannt; es war seiner Großbritannischen Majestät Konsul in Mouleville. Und neben ihm stand ein anderer Herr, der sehr wichtig und sehr würdig aussah. .. Als Duveen diesen Herrn erblickte, duckte er sich unwillkürlich zusammen und legte sein Gesicht in möglichst fremdartige Falten, um ja nicht erkannt zu werden; denn dieser Herr war Mr. Hodgekinson, Generaldirektor des Brixton-Emporiums. Dieser Mr. Hodgekinson hatte noch gerade zur rechten Zeit einen gewissen anonymen Brief erhalten, geschrieben von einem gewissen Duveen!
Browns Anwalt erhob sich. (Er tat dies sehr ungern; denn er fürchtete den Eindruck zu zerstören, den seine großartige Rede gemacht hatte! Aber er mußte!)
»Ich habe dem Hohen Gerichtshof einen neuen Zeugen für meinen Klienten namhaft zu machen, Herrn Generaldirektor Hodgekinson aus Brixton, England, und ich beantrage die sofortige Vernehmung dieses Herrn. Ich darf vielleicht hinzufügen, daß Seiner Großbritannischen Majestät Konsul sich mir gegenüber für die Persönlichkeit des Herrn Zeugen verbürgt hat.«
Hodgekinson wurde vereidigt und, mit Hilfe des Dolmetschers, verhört.
»Ihr Name?«
»George William Hodgekinson.«
»Ihre Stellung?«
»Generaldirektor des Emporiums, eines Warenhauses in Brixton, England.«
»Sie kennen den Angeklagten Brown?«
»Jawohl. Es scheint mir überhaupt unbegreiflich, daß Mr. Brown sich auf einer Anklagebank befinden kann. Ich kenne Mr. Brown seit seiner Kindheit. Er nimmt einen verantwortungsvollen Posten in dem Unternehmen ein, das zu leiten ich die Ehre habe, und er ist einer verbrecherischen Handlung oder auch nur einer ungesetzlichen Handlung unfähig. Ich höre, daß es sich um eine Anklage wegen Raubes handelt. Das ist lächerlich. Es muß ein Justizirrtum vorliegen.«
Bei dem Wort Justizirrtum machten die Richter nervöse Gesichter. Seit dem Dreyfus-Prozeß fällt dieses Wörtchen jedem französischen Richter auf die Nerven.
»– und ich darf wohl noch bemerken, daß Mr. Brown für englische Verhältnisse ein wohlhabender, für kontinentale Verhältnisse ein sehr reicher Mann ist!«
»Sind Sie sicher – –?« wandte sich der Vorsitzende fragend an den Verteidiger.
»Absolut, – der Herr Konsul war sehr bestimmt in seinen Ausdrücken.«
Der Vorsitzende schüttelte den Kopf. »Eine eigentliche Zeugenaussage dürfte dies kaum darstellen. Ueber das Verbrechen selbst wissen Sie nichts, Monsieur Hodgekinson?«
»Nein.«
»Bitte, nehmen Sie am Tisch des Herrn Verteidigers Platz. Meine Herren Geschworenen! So ungewöhnlich mein Vorgehen auch ist, so halte ich mich unter diesen Umständen für verpflichtet, den Angeklagten Brown nochmals zu vernehmen. Angeklagter Brown!«
Brown hatte auf einmal sein Selbstbewußtsein wiedergefunden, denn jetzt konnte ihm ja gar nichts passieren: seinem Chef traute er es zu, Welten versetzen zu können, geschweige denn, ein französisches Schwurgericht umzustimmen. Und nun bekam der Dolmetscher Arbeit. –
»Was haben Sie zu sagen?«
»Ich bin nicht schuldig. Die unerhörte Verteidigungsmethode meines Herrn Anwalts ist in keiner Weise von mir autorisiert worden!«
»Sie sind sehr geschickt verteidigt worden, junger Mann!« sagte der Vorsitzende stirnrunzelnd.
»Ich bin aber unschuldig, und mein Verteidiger hatte keinerlei Recht, meine Schuld als erwiesen anzunehmen. Niemand glaubte mir, ich habe darin sehr unangenehme Erfahrungen mit dem Herrn Untersuchungsrichter gemacht, und so vertraute ich dem Anwalt ohne weiteres meine Verteidigung an, ohne die Einzelheiten mit ihm durchzusprechen.«
Der talentierte junge Rechtsanwalt war unterdessen grün und blau im Gesicht geworden, und der Vorsitzende horchte auf.
»Erzählen Sie, was Sie seit Ihrer Ankunft in Mouleville erlebt haben. Erzählen Sie ausführlich,« befahl er.
Und Brown erzählte! Die ausführliche Geschichte der napoleonischen Verschwörung, von der sein Verteidiger nichts hatte wissen wollen, und über die der juge d'instruction sich so geärgert hatte. Und als der Dolmetscher Satz für Satz übersetzte, da zeigte sich zuerst Amüsement auf den Gesichtern von Richtern und Geschworenen, und dann brauste ein wahrer Orkan von schallendem Gelächter durch den Schwurgerichtssaal. Brown fühlte sich plötzlich um zehn Jahre jünger; jetzt wußte er: er war gerettet! Und er erzählte und erzählte und machte sich keinen Deut besser oder klüger, als er war. Die Geschworenen fielen beinahe in Lachkrämpfe, und selbst la duchesse lächelte ein melancholisches Lächeln …,
»Ich bezeuge, daß diese Darstellung in allen Punkten der Wahrheit entspricht,« rief Duveen, als Brown schloß.
»Sie sind nicht gefragt worden,« antwortete der Vorsitzende scharf.
Nun erhob sich der Procureur de la République. Wenn Brown wirklich unschuldig sei – und er sei der erste, der sich darüber sehr freuen würde – so handle es sich doch hier nicht darum – er bitte die Herren Geschworenen, dies nicht zu vergessen –, welche Zwecke die Mitangeklagten Browns mit der Erfindung dieser phantastischen napoleonischen Verschwörung verfolgten – diese Zwecke lägen ja klar auf der Hand –
Hier grinste Monsieur Georges.
– und seien im übrigen nicht erreicht worden; wenn Brown unschuldig gelitten und viel ausgestanden habe, so bedaure er, dagegen sagen zu müssen, daß ihm dies ganz recht geschehen sei. Als Fremder durfte er sich niemals in eine politische Verschwörung einmischen, eine Verschwörung gegen das Land, dessen Gastfreundschaft er genoß. Nein, darum handelte es sich jetzt gar nicht. Die Frage war: die Juwelen wurden geraubt, ohne Zweifel. Wer war dann der Räuber? Und durfte man die sehr bestimmte Beschreibung des Täters seitens der Witwe Potin vergessen!«
Da – eine neue sensationelle Ueberraschung!
Eine wankende Frau wurde von zwei Gerichtsbeamten vor den Richtertisch geführt, eine kranke, nervöse Frau, die weder jung noch schön war, an der man aber doch noch Spuren früherer Schönheit erkennen konnte. Sie war bepudert und bemalt. Ein Gemurmel erhob sich im Gerichtssaal, denn diese Frau war die Witwe Potin.
Sie wurde vereidigt und machte ihre Aussage mit sehr leiser Stimme, als fürchte sie sich. Sie habe, so sagte sie aus, ja keine Ahnung gehabt, welche Konsequenzen ihr Tun nach sich ziehen würde. Die Juwelen und die Schmucksachen, um die sich die Anklage drehe, habe sie Monsieur Georges geschenkt, dem sie die wärmsten Gefühle entgegenbringe. Sie fürchtete jedoch die Vorwürfe ihres Neffen, der sie am nächsten Tage besuchen wollte, und erfand daher die Geschichte mit dem Raub, nachdem sie vorher Monsieur Georges veranlaßt hatte, sie zu fesseln und sie an das Bett festzubinden. Monsieur Georges aber besorgte diese Arbeit allzugut, so gut, daß sie, als ihr Neffe, der viel später kam, als erwartet, sie fand, völlig erschöpft und sehr krank war. Noch jetzt sei sie schwer leidend. Sie hoffe, das Gericht werde ihr ihre unwahren Angaben verzeihen, denn sie habe ja so schwer gelitten und sei hart bestraft durch diese öffentliche Bloßstellung. Sie habe gewußt, daß Brown ein Engländer sei und das Haus verlassen habe. Sie hätte sich gedacht, er sei nach England abgereist und ihn daher als Räuber beschrieben, in der Meinung, man würde nie wieder etwas von ihm hören. Sie habe nicht einmal seinen Namen gewußt! Als man aber von ihr verlangte, sie solle den Dieb beschreiben, da habe sie den Kopf verloren und eben den Engländer beschrieben!
Der Staatsanwalt wurde blau und grün im Gesicht.
Browns Verteidiger bekam einen hochroten Kopf!
Die Richter lächelten – die Geschworenen lachten – –
Der Herr Untersuchungsrichter, der am Tisch der Herren Verteidiger Platz genommen hatte, drückte sich schleunigst …, Brown aber grinste offensiv seinen Verteidiger an! Wenige Minuten später hatten die Geschworenen, der Instruktion des Vorsitzenden gemäß, sämtliche Angeklagten freigesprochen.
»Vive la justice! Vive la France!!« brüllten die Zuschauer begeistert und ließen es sich nicht nehmen, jedem einzelnen der Angeklagten durch solennes Beifallsklatschen ihre Sympathie zu bezeugen. Den größten Applaus heimste natürlich la duchesse ein, die jedoch nicht eine Miene verzog und genau so melancholisch und genau so gleichgültig aussah, wie immer. Sie konnte nichts in Aufregung bringen! Nur einmal – als die Witwe Potin bekannte, daß sie Monsieur Georges die wärmsten Gefühle entgegenbringe – hatte sie dieser Dame einen Blick zugeschleudert, der an Leidenschaftlichkeit und Haß nichts zu wünschen übrig ließ. Thérèse wäre es viel lieber gewesen, hätte Monsieur Georges diese Juwelen wirklich gestohlen, anstatt sie sich schenken zu lassen! Von einer Dame, die ihm wärmste Gefühle entgegenbrachte! Diesen ihren Standpunkt setzte sie übrigens Monsieur Georges sofort nach Beendigung der Schwurgerichtsverhandlung mit größter Deutlichkeit und staunenswerter Energie auseinander! Für Brown hatte sie einen liebenswürdigen Blick. Sie reichte ihm ihre Hand im Vorbeigehen und sagte:
»Va donc pour Amélie, petit imbécile. Good-bye et bonne chance.«
Im Vorzimmer wurde Brown von sämtlichen Gerichtsbeamten beglückwünscht, und sein Verteidiger stürzte auf ihn los:
»Ich sagte Ihnen ja, daß ich Sie freibekommen würde!« Brown, der keinerlei Lust zu Argumenten in sich verspürte, schüttelte dem talentierten jungen Rechtsanwalt die Rechte und hielt im übrigen seinen Mund. Er sehnte sich nach frischer freier Luft und nach Amelia. Endlich war er allein und auf der Straße und dort stand, sehnsüchtig wartend, Amelia. Sie sanken sich in die Arme, in höchst unenglischer Gemütsbewegung und vergoßen heiße Tränen (Brown am meisten). Und nun trat Hodgekinson heran und schüttelte ihm die Hände.
»You confounded fool!« sagte der große Mann herzlich, – »Sie unbeschreiblicher eigelber Narr!«
»Yes, sir, you are quite right sir,« antwortete Brown gerührt.
* * *
Die ganze Gesellschaft fuhr zum Hôtel des deux Globes und wurde von Mr. und Mrs. White, Fiddle und Amelia Nummer zwei begeistert empfangen und setzte sich zu einem wundervollen Diner hin, bei dem kein Mensch etwas aß, denn vor lauter Reden hatte man gar keine Zeit zum Essen. Dann machte Brown sich seelenvergnügt auf den Weg, um seine Schulden in Mouleville zu bezahlen. Die Rechnung des talentierten jungen Rechtsanwalts war sehr saftig, aber Brown bezahlte sie, ohne eine Miene zu verziehen und bedankte sich sogar noch bei dieser Zierde der französischen Advokatur. Dies war nicht der Moment, kleinlich zu sein! Es galt, sich mit Anstand von Mouleville loszumachen, und da kam es wirklich nicht auf Geld an. Dann endlich konnte er ja definitiv auf Frankreich pfeifen!
Des weiteren besuchte Mr. Brown von England das Gefängnis, um seine Sachen zu holen und zerbrach sich dabei den Kopf, ob es Sitte sei, den Wärtern Trinkgelder zu geben, so etwa, wie wenn man ein Hotel verließ. Schließlich beschenkte er die verschiedenen Persönlichkeiten, die ihn jeweilig eingesperrt und sehr darauf gesehen hatten, daß er seine Zelle selbst und zwar sehr gründlich reinigte, mit je einem Fünffrancsstück, was den Herren Gefängniswärtern durchaus nicht unangenehm zu sein schien. Heimlich schüttelten sie die Köpfe und wünschten sich mehr solcher englischer Narren.
Und beim Gefängnistor traf er Duveen, der soeben sein bescheidenes Köfferchen geholt hatte. Duveen machte ein erschrockenes Gesicht und schwenkte sofort links ab, um sich zu drücken. Das rührte Brown – Duveen war ihm schließlich beigestanden, wenn auch zu spät, und dann war er doch schließlich von Brixton.
»Halloh, Duveen!«
Duveen blieb stehen.
»Kommen Sie doch mit!«
Brown ließ sich einen Wagen holen, und der Spitzbube und der Geprellte fuhren einträchtiglich nach einem Café (nicht nach der Vache Enragée …,).
»De quoi écrire!« befahl Brown in miserablem Französisch. Und als Tinte und Feder gebracht wurden, zog er sein Scheckbuch hervor, das gleiche Scheckbuch, dem der berüchtigte Scheck über dreitausend Pfund hätte entnommen werden sollen, schrieb und überreichte Duveen das wertvolle Stückchen Papier. Der Scheck lautete über den Betrag, den der Spitzbube dem Emporium noch schuldete.
Und diesem Spitzbuben kamen Tränen in die Augen. – »Sie sind ein guter Mensch,« stammelte er. »Und ich freue mich nur, daß ich noch zur rechten Zeit an Hodgekinson schrieb …,«
»Sie haben – Sie hätten …,« stotterte Brown.
»Natürlich! Damals in der Gefängniszelle. Glaubten Sie etwa, Hodgekinson sei ganz zufällig in den Schwurgerichtssaal geschneit? Sie sind ein lieber Mensch, Mr. Brown, aber doch furchtbar naiv!«
»Das scheint mir auch so,« murmelte Brown. »Hm, Sie haben also geschrieben! Hm, das war reichlich unverschämt! Sollte es Ihnen aber jemals besonders schlecht gehen, so schreiben Sie mir gefälligst eine Zeile. Hm, ja, und die Geschichte mit dem Emporium werde ich für Sie, abgesehen von dem Gelde, in Ordnung bringen. Hodgekinson hat mir vorhin mitgeteilt, einer Kapitalbeteiligung meinerseits stehe nichts im Wege, und ich würde zu einem der Direktoren des Emporiums ernannt werden …,«
Duveen schnappte nach Luft. Sein Leben war ein sonderbares Leben gewesen, unter sonderbaren Leuten, und es gab nur wenig Dinge, die er noch irgendwie respektierte. Aber ein Direktor des Emporiums!
»Good-bye, Duveen!«
»Good-bye, Mr. Brown – und ich danke Ihnen – und –«
So schieden sie.
– – – Am nächsten Morgen gingen Mr. Hodgekinson und Mr. Brown und Amelia an Bord des Kanaldampfers. Auf dem Weg zum Landungsplatz erklärte Mr. White mittelst eines Taschenmessers und eines Stückchens Schnur den Mechanismus der neuen Turbinen-Maschinen und bemerkte nebenbei, er persönlich habe eine ganz eigenartige und besonders vorzügliche Turbinenanlage erfunden, die er demnächst zu patentieren gedenke. Er versuchte, diese geniale Erfindung näher zu beschreiben, aber sie war für den Laien nicht recht verständlich.
Mr. Brown und Amelia standen nachdenklich da, an die Reeling gelehnt, während Mr. Hodgekinson sich diskret seitwärts hielt. Nun, da er diesen vertrackten Brown glücklich auf dem Dampfer hatte, war er ganz beruhigt. Es war der gleiche Dampfer, mit dem Mr. Brown vor langen Wochen die Ueberfahrt gemacht hatte, und er gestand seufzend, daß er seitdem enorm viel über Frankreich und französische Dinge gelernt hatte. Er verstand recht gut Französisch und sprach, wenn auch nicht fließend, so doch mit ganz gutem Akzent. Er pfiff jedoch auf diese Kenntnisse. Er fühlte, sie taugten nichts. Er hatte keine Verwendung für sie.
»Und du wirst nie wieder ins Ausland reisen, ohne mir eine Adresse zu hinterlassen?« flüsterte Amelia.
»Nie wieder! Ich geh überhaupt nicht wieder ins Ausland. Ich danke verbindlichst.« Und als Nachgedanken fügte er hinzu: »Du wirst mich aber auch nie wieder so unglücklich machen, wie – du weißt schon!«
»Hab ich es nicht wieder gut gemacht?«
»Ja, Amelia dear. Wollen wir nicht lieber diese kleinen Mißverständnisse ein für allemal unmöglich machen und gleich heiraten?«
»Das sollt' ich meinen,« flüsterte Amelia errötend.
Pause. …,
Langsam tauchten die Küstenfelsen von Mouleville ins Meer. Da kniff Mr. Brown von England die Augen ein und winkte ironisch hinüber, und seine Lippen murmelten:
»Du kannst lange warten! Einmal und nicht wieder!«
– Ende. –