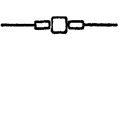|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Verschwörer von Mouleville versammeln sich im Restaurant zur wütenden Kuh, und der kluge Leser merkt etwas.
Es mochte etwa zehn Uhr sein, als Brown am nächsten Morgen erwachte. Schläfrig rieb er sich die Augen und wunderte sich zuerst sehr, wo denn der große Spiegelschrank hingekommen sein mochte und die hellgrüne Tapete – da kam wie ein Blitz die Erleuchtung über ihn: er lag ja in des Kaisers Bett. Er war im Zimmer des Kaisers. Zunächst konstatierte er vergnügt, daß das Bett des Kaisers sehr warm und sehr behaglich sei; nur ein bißchen kurz. Es gibt jedoch bekanntlich nichts Vollendetes in dieser Welt.
Die nächste halbe Stunde verging ihm in luxuriösem Hinträumen, halb wachend, halb schlafend. Brown träumte, das Leben sei eine Hühnerleiter und er sei das glückliche Huhn, das die Sprossen erklomm. Gestern noch war Mr. Brown von Brixton untergebracht in einem gewöhnlichen, kleinen anglo-französischen Hotel, und heute schon schlief er in des Kaisers eigenem Bett – wohnte in einem Zimmer, das einst der große Napoleon mit seiner Gegenwart beehrt hatte. Wie wohltuend doch dieses Gefühl war!
Es war Mr. Brown von England, als habe er gestern den entscheidenden Schritt seines Lebens im Ausland getan. Er hatte mutig das Engländertum seiner ersten Tage in Mouleville von sich abgeschüttelt; er war der englischen Atmosphäre entronnen. Jetzt gehörte er zu Mouleville. Er gehörte Frankreich an; er lebte unter Verschwörern, deren Taten ungeheure Folgen haben – die Machtverhältnisse der Welt ändern würden. Das war ihm zwar an und für sich sehr gleichgültig. Ihn interessierte nur das rein Persönliche; daß er einer Existenz in langweiligem Grau und Grau entronnen war, daß er endlich den Weg neuen Lernens und neuen Sehens betreten hatte.
In der rosigsten aller Launen drückte er auf den kleinen weißen Knopf an der Wand beim Bett. Dieser Knopf tat ihm wohl, als Zeichen einer modernen Zeit. Wenn auch Pietät elektrisches Licht verbot, so schien sie wenigstens elektrischen Klingeln gegenüber einen milderen Standpunkt einzunehmen!
Auf das Klingelzeichen trat ein nicht gerade sauberes altes Weib ins Zimmer, und Brown bestellte einen café complet. Soviel hatte er während fünf Tagen in Frankreich schon gelernt.
Als das alte Weib gegangen war, sprang er aus dem Bett, eilte ans Fenster und zog die Vorhänge zurück. Ah, da war ja die Mauer! Alles fiel ihm ein. Das war die Mauer, die der Kaiser hatte errichten lassen, und dank dieser Mauer konnte Brown ungeniert im Nachthemd im Zimmer herumspazieren, ohne die geringste Furcht vor unsittlichen Folgen. Gar nicht übel, diese Mauer. Weniger gefiel ihm der Teppich. Er war sehr hart und furchtbar kalt. Er war so abgenützt, daß Brown sich wunderte, ob wohl die alte Garde in genagelten Kanonenstiefeln auf diesem Teppich exerziert hatte. Oder wenigstens eine Korporalschaft der alten Garde – denn der Teppich war, wie das Zimmer, sehr klein. Ueber dem offenen Kamin hing ein Spiegel an der Wand. Das Gold seines Rahmens war in ehrlichem Kampf gegen den Zahn der Zeit unterlegen. Daraus machte Brown sich auch nichts. Als er jedoch in den Spiegel guckte, erschrak er: Das Quecksilber war dem Beispiel des goldenen Rahmens offenbar gefolgt, und Brown sah sein Spiegelbild nur stellenweise. Der erste Versuch ergab ein Bild von einem Stück Nase, einem Stück Ohr und einer Idee Kinn. Durch geschicktes Lavieren konnten natürlich auch andere Teile der Gesichtsoberfläche reproduziert werden; aber dennoch gefiel der Spiegel Brown gar nicht. Er mochte ja ehrwürdig genug sein; doch ein moderner Spiegel plus Quecksilber für vier Shilling und Sixpence wäre ihm lieber gewesen.
»Wie unpraktisch doch Reliquien sind!« brummte Brown.
Der Spiegel des armoire war wenigstens von allem Anfang an ehrlich; er war so blind, daß nur ein Irrsinniger den Versuch gemacht hätte, sich in ihm zu erschauen. Ferner stand da in der Ecke ein winziger Gegenstand, anscheinend für eine Puppe berechnet.
Brown fing zu fluchen an – aber – es war ja des Kaisers Zimmer!
An der Wand waren hölzerne Pflöcke zum Kleideraufhängen eingeschlagen, sie hatten aber so dicke Köpfe, daß sie für jeden normalen Aufhänger aussichtslos waren. Einige dieser Köpfe fehlten jedoch und es gelang Brown, seine bescheidene Garderobe unterzubringen. Ferner waren noch zwei Stühle da.
Damit war die historische Einrichtung des Raumes erledigt; außer dem Bett natürlich.
Dieses Bett! Brown hatte in seinem Leben schon verschiedene gefälschte Empire-Bettstellen gesehen. Aber erst jetzt erkannte er, wie gefälscht diese Betten gewesen sein mußten! Keine Spur von Eisen war an ihnen gewesen! Aber da hörte er die Schritte der alten Frau und sprang schleunigst wieder ins Bett. Sie stellte das Tablett mit dem Frühstück auf einen der wackeligen Stühle, fragte Brown irgend etwas auf Französisch (Brown verstand nicht eine Silbe) und zog sich wieder zurück. Einen Augenblick später fiel es ihm ein, daß er ja heißes Wasser brauchte, aber erstens hatte er keine Ahnung, wie man auf Französisch heißes Wasser verlangte, und zweitens war es ihm viel zu viel Mühe, noch einmal zu klingeln.
Er widmete sich also zuerst dem Kaffee. Das Frühstück schmeckte ihm ausgezeichnet – es war so französisch! Die, zentimeterdicken Wände der Tasse imponierten ihm und das Brot war so frisch und knusperig. Brosamen fielen zwar ins Bett, aber er wischte sie hinweg und machte sich ernsthaft daran, noch einmal einzuschlafen. Es schien ihm, als sei er kaum eingeschlafen (in Wirklichkeit war eine Stunde vergangen), als er erwachte und Duveen an seinem Bett stehen sah.
»Halloh, alter Junge! Gut geschlafen, wie ich sehe. Guten Morgen! Der Gedanke daran, in wessen Bett Sie lagen, hat Ihnen also doch nicht den Schlaf geraubt?«
»Nein!« sagte Brown, vollkommen der Wahrheit gemäß. »Ich war nämlich sehr müde«, fügte er entschuldigend hinzu.
»Und tut Ihnen die Veränderung leid? Sehnen Sie sich nach Amelia und Fiddle und nach der ganzen Gesellschaft?«
»Oh nein. Durchaus nicht! Ich will ja französisches Leben kennen lernen!«
»Sollen Sie auch, mein Junge! Vom Bett aus können Sie das aber nicht. Also stehen Sie lieber auf.«
Während Brown sich anzog, fragte er Duveen so nebenbei, was das Zimmer eigentlich koste. Jedenfalls würde er wesentlich billiger leben als im Hotel. Brown wußte ja, daß Touristen überall schauderhaft ausgebeutet wurden, – besonders in den kleinen französischen Küstenstädten; wenn man aber Frankreich von der intimen Seite sah, so wie er, wenn man das Land kannte, so konnte man beinahe umsonst leben. Er wollte durchaus nicht besonders sparen, oh, nein; es war im Gegenteil seine löbliche Absicht, einen Teil der Erbschaft der seligen Tante zu verjuxen. Jawohl, zu verjuxen. Wenn er jedoch billig lebte, so lebte er wie ein Franzose, sagte er sich, und nicht wie ein öder Tourist, der notgedrungen mit Geld um sich werfen mußte, weil er Land und Leute nicht kannte.
Er war daher nicht nur überrascht, sondern geradezu entsetzt, als Duveen ihm trocken mitteilte, des Kaisers Zimmer koste zehn Francs pro Tag.
»Donnerwetter – wie viel?« schrie Brown.
»Zehn Francs!«
»Aber das ist ja mehr als gesalzen!«
»Finden Sie? Für des Kaisers Zimmer und des Kaisers Bett? Es tut mir leid, aber das ist der festgesetzte Minimalpreis.« Als er bemerkte, daß Brown nicht nur überrascht, sondern auch ärgerlich aussah, so, als ob er im Begriff sei, im nächsten Augenblick auf die gesamte kaiserliche Herrlichkeit zu pfeifen, fügte er hinzu: »Sie begreifen, das Zimmer ist das Eigentum des V. W. K.; es gehört dem Verband und von den zehn Francs fließen acht in die Verbandskasse. Und außerdem ist noch ein Vorteil dabei: Wenn Sie lange genug hierbleiben und der Traum des Kaiserreichs wird zur Tatsache, dann würden Sie zum kaiserlichen Kammerherrn ernannt werden. Das ist eines der Privilegien, die der Bewohner von des Kaisers Zimmer genießt. Zehn Francs sind daher wirklich nicht zu viel!«
»Kammerherr. Gentleman des kaiserlichen Schlafgemachs.«
»Aber –«
»Große Ereignisse stehen bevor!«
Brown war durchaus kein Snob und von äußerlichen Ehren hatte er kaum einen Begriff. Dennoch – Kaiserlicher Kammerherr klang entschieden hübsch!
»Zehn Francs täglich sind teuer!« bemerkte er zögernd. »Aber – aber es ist schließlich des Kaisers Zimmer, wie Sie sagen, wenn ich auch mit einem anderen Zimmer zufrieden gewesen wäre. Es ist auch nicht hervorragend schön und bequem!«
»Aber –«
»Ich weiß; ich weiß schon – es ist das Zimmer des Kaisers. Also wenn die Partei, der Verband, wollte ich sagen, wirklich Geld braucht, so will ich gerne mein bescheidenes Scherflein beisteuern. Daß Verbände nicht existieren können ohne Geld, weiß ich!«
»Sie können sich darauf verlassen, daß man Sie nicht vergessen wird, wenn die Zeit erfüllt ist.«
»Sagen Sie – Sie sprechen so, als ob diese Zeit nicht ferne wäre? Steht irgend etwas bevor? Ich meine, in nächster Zeit?«
»Wir leben in einer Aera des Uebergangs und des Wechsels,« antwortete Duveen ausweichend. »Ich darf nichts Näheres sagen. Man kann nicht wissen, was von Tag zu Tag geschehen wird. Wir sind nicht ungeduldig; wir haben so lange gewartet und sind darauf vorbereitet, noch länger zu warten.«
»Aber was würden denn meine Pflichten sein als kaiserlicher – als Gentleman des kaiserlichen Schlafgemachs? Müßte ich den Kaiser zu Bett bringen?«
»Oh dear, no; es ist ein Ehrentitel.«
»Was ist das für eine alte Frau, die mir den Kaffee brachte?« fragte Brown, während sie die Treppe hinabstiegen. »Sieht gar nicht vertrauenerweckend aus – gehört sie auch dem V. W. K. an?«
»Nein; selbstverständlich nicht. Sie hat nichts mit uns zu tun – sie ist ehrlich.«
Duveen ärgerte sich, als er merkte, wie zweideutig er sich ausdrückte. Aber Brown hatte kein Ohr für derartige Feinheiten. Sie aßen zu Mittag in einem kleinen Restaurant in der Nähe, nicht in dem, wo sie den Abend zugebracht hatten, und Brown schlug vor, das Kasino zu besuchen.
»Das Kasino!« rief Duveen in einem Ton der Verachtung. »Ich glaubte, Sie wollten Frankreich kennen lernen! Ins Kasino gehen nur Engländer und Touristen. Außerdem könnten Sie dort den Whites begegnen und das wäre doch unangenehm.«
»Daran habe ich gar nicht gedacht …,«
Brown machte zuerst ein sehr enttäuschtes Gesicht. Das paßte ihm gar nicht. Hätte er doch die Dame des Kasinos gar zu gerne wiedergesehen!
»Dann und wann können Sie ja hingehen,« tröstete Duveen. »Das tue auch ich, gelegentlich. Ich jedoch besuche das Kasino nur in Geschäften; um dieses oder jenes Vorstandsmitglied aufzusuchen – das Kasino ist ein so unverdächtiger Treffpunkt! Manchmal finden wir auch dort jemand, den wir suchten, den wir bestrafen mußten; auch bei uns gibt es leider Verräter, wissen Sie!«
»Und wie bestrafen Sie Verräter?«
Duveen lachte unwillkürlich. »Das möchte ich Ihnen lieber nicht sagen!«
Eine Gänsehaut lief Brown über den Rücken. Doch er gedachte ja nicht, etwas zu verraten. Eine gefährliche Gesellschaft! Er wollte sich da doch lieber nicht zu weit einlassen …,
Als Ersatz für das Kasino lehrte Duveen ihn Domino spielen, denn die Kenntnis dieses Spieles sei eines der ersten Erfordernisse, wenn man in intimes französisches Leben blicken wolle. Die Dominos interessierten Brown sehr. Das Lehrgeld war auch gar nicht teuer; er verlor höchstens acht oder neun Francs. Die Zeit verging ihm wie im Flug und er war erstaunt, als Duveen auf die Uhr sah und lächelnd bemerkte, die Stunde des Absinths sei da.
Die Stunde des Absinths – die goldene Stunde des Absinths!
Brown, die gestrigen Wonnen noch frisch in der Erinnerung, sah der Dosis Nummer zwei in freudiger Erwartung entgegen. Sie gingen in das gleiche Café wie gestern zu der feierlichen Zeremonie, und die gleiche alte Dame begrüßte sie, diesmal mit großer Freundlichkeit von allem Anfang an. Dann kam der Absinth. Wieder wirkte er seine Wunder …, Die Seele des Mr. Brown von England sprengte ihre irdischen Fesseln und schwebte in einem Himmel von Glückseligkeit. Weshalb ins Kasino gehen? Das Kasino war lächerlich. Nur langweilige Touristen und Narren verschwendeten dort ihr Geld, während kluge Leute (wie er) das intime Frankreich studierten – und seinen Absinth. Er war glücklich; er wollte Duveen die Hände schütteln, ermangelte jedoch der notwendigen Energie. Mit großem Stolz gedachte er des Kaisers Bett, und die wehe Befürchtung stieg in ihm auf, er betrüge diesen bewundernswürdigen Verband, indem er für das Zimmer des Kaisers nur zehn Francs täglich zahlte. So wenig! Dann sah er wie in einer Vision das Gesicht der Dame des Kasinos vor sich aufsteigen – die Blässe, die wundervollen dunklen Augen, die glühenden Lippen. Ah, er würde sie bestimmt wiedersehen, auch wenn er nicht ins Kasino ging. Das war ja Kismet, mußte ja Kismet sein. Und man konnte dem Kismet ja ein wenig nachhelfen; vielleicht konnte er sich doch einmal ins Kasino schleichen, ohne daß Duveen etwas merkte! Alles wollte er ja gerne aufgeben, um Frankreichs Intimitäten kennen zu lernen – nur die Dame des Kasinos nicht. Er betete Frankreich an. Und sie personifizierte ihm Frankreich!
Das Diner fand die beiden Freunde im Café de la Vache Enragée und diesmal saßen sie nicht allein. Duveen stellte Brown in oberflächlicher Form leichthin vor. Er hatte ihn gewarnt, daß allzugroße Steifheit verdächtig erscheinen würde. Man war ja unter sich in der Gesellschaft des ancien régime. Am Nebentisch dinierten zwei Herren und zwei Damen, und Brown bemerkte allerdings sofort, daß deren Manieren gar nicht an Steifheit litten, im Gegenteil. Sie genierten sich bemerkenswert wenig. Die Herren behielten die Mützen auf dem Kopf und aßen mit den Messern, während die Damen zerzaust aussahen und Brown mit merkwürdigen Blicken betrachteten.
»Sind das auch Mitglieder?« fragte er Duveen leise.
»Nein, nicht Mitglieder,« antwortete dieser. »Aber Freunde. Die Verbandsmitglieder kommen gewöhnlich erst viel später.«
»Und was sind das für Leute am Nebentisch?« wiederholte Brown energisch.
»Freunde aus einem nahen Provinzstädtchen. Sie müssen sich diese englische Manier abgewöhnen, Leute nur nach ihrem Aeußeren zu beurteilen, sonst lernen Sie Frankreich nie kennen. Wir beurteilen hier einen Mann nach dem, was er ist, nicht nach seinem Aussehen!«
Und in diesem Augenblick trat, ein lebendiger Protest gegen das, was Duveen soeben gesagt hatte, ein Mann ein, der sicherlich wie ein Dichter aussah mit seinem blassen Gesicht und den schwarzen Haarmassen, die ihm über die Schultern fielen. In der Hand balancierte er einen wunderschönen Empire-Spazierstock.
Brown, der sich über Duveens Bemerkung ärgerte, sagte:
»Der Mann sieht wie ein Dichter aus; ich vermute also, er ist ein Lokomotivführer?«
Duveen lachte, nicht im geringsten beleidigt. »Er ist ein Dichter,« sagte er.
So war es. Das freute Brown sehr. Es hätte ihn enttäuscht, in Frankreich enttäuscht, wäre dieser Mann nicht ein Dichter gewesen. Er hatte Kunden im Emporium, von denen man ihm sagte, sie seien Dichter. Diese Kunden kauften Suède-Handschuhe und sahen genau so aus wie andere Leute. Er mißtraute daher ihren Dichtungen. Dieser französische Dichter aber kaufte sich bestimmt keine Suèdes oder Odol oder Pixavon. Das war ein richtiger idealer Dichter.
»Es ist einer von uns,« sagte Duveen. »Manchmal schreibt er Verse für die gute Sache. Wir sprechen aber nie darüber – aus Furcht, eine andere Partei könnte ihn kaufen. Man darf diesen Poeten nie trauen; sie haben keine Ahnung vom Wert des Geldes.«
Die Gesellschaft am Nebentisch bezahlte und ging. Der Dichter blieb in seiner Ecke sitzen, sich dann und wann durch das Haar fahrend und herüberschielend, ob Brown ihn auch bewundere. Nach dem Diner stand Duveen auf und sagte, sie wollten ihren Kaffee im Hinterzimmer trinken. Er erklärte Brown, dies sei der geheiligte Raum, in dem der Verband nächtige; in dem die Führer der Verschwörung sich versammeln. Nur ganz ausnahmsweise und in ganz besonderem Entgegenkommen habe er die Erlaubnis erhalten, Brown einzuführen; andere Leute in Mouleville würden viel darum geben, den gleichen Vorzug zu genießen. Nur für Brown sei eine Ausnahme gemacht worden, und zwar vor allem in Hinsicht auf seine Persönlichkeit; dann auch, weil er des Kaisers Zimmer bewohne.
»Stellen Sie ja keine Fragen an mich,« bat Duveen, »während wir im Hinterzimmer sind. Warten Sie ruhig ab, und ich werde Ihnen später alles erklären. Wenn Sie nur die Augen ordentlich offen halten, dann werden Sie intimes französisches Leben sehen, wie Sie sich es besser nicht wünschen könnten. Und wundern Sie sich ja nicht, wenn Sie ungeschliffenen Diamanten begegnen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, und die Franzosen sind die besten Schauspieler der Welt. Urteilen Sie ja nicht nach Aeußerlichkeiten!«
Mit diesen geheimnisvollen Worten führte er Brown in das Hinterzimmer.
Das Zimmer war sehr dunkel und von so dichten Wolken grauen und blauen Zigarettenrauchs erfüllt, daß Brown zuerst überhaupt nichts unterscheiden konnte. Dann entwickelten sich aus den Rauchwolken vier Männer, die an einem Tisch saßen und Karten spielten. Hinter einem der Männer stand eine junge Dame, sich zu ihm herabbeugend, die Arme liebevoll um seinen Hals geschlungen. Das Mädel ließ sich durch den Eintritt der Herren nicht im geringsten stören, denn sie fuhr ungeniert in ihrer zärtlichen Beschäftigung fort, die darin bestand, in regelmäßigen Zeitabständen – fünf Sekunden ungefähr – den Mann bald auf das linke, bald auf das rechte Ohr zu küssen. Der Geküßte brummte dann immer irgend etwas, was Brown durchaus nicht verstand. Die Herren selbst machten gerade keinen hinreißenden Eindruck auf ihn. Der eine war sehr klein und sah aus wie ein Junge, der es über der Dringlichkeit seiner Affären ganz vergessen hatte, zu wachsen; denn seine knabenhaften Züge mit dem weichen, kaum sichtbaren Flaum auf Lippen und Wangen hatten etwas fürchterlich Weltweises, etwas unheimlich Altes. So müde sah er aus, so traurig, so wie ein Baby aussehen würde, könnte man ihm mit einem Schlage die ganze Schlechtigkeit dieser schlechten Welt enthüllen. Ein anderer der Männer, derjenige, dessen Ohren die junge Dame so liebevoll behandelte, war so häßlich, ein solcher Verbrechertyp, daß er auf Brown den Eindruck des Gekünstelten machte. Als sei er ein Schauspieler, der sich für eine bestimmte Rolle zurechtgeschminkt hätte (für eine Verbrecherrolle!) und nun hinter den Theaterkulissen Karten spielte, auf sein Stichwort wartend, das ihn auf die Bühne rief, um einen Helden zu töten, die junge Frau zu entführen, und drei Häuser auf einmal anzuzünden. Von den beiden anderen Männern war der eine jung und blond und ein wenig weibisch aussehend, als lege er großes Gewicht auf seine werte persönliche Erscheinung. Sein Haar war mit unendlicher Sorgfalt gekämmt und mit weithin riechenden kosmetischen Mitteln liebevoll zurechtgepappt. Der andere Mann war eine sehr auffallende Erscheinung, ein interessanter Typus der Männerschönheit gewisser Klassen. Auf dem Kopfe trug er eine merkwürdige ballonartige Mütze. Starke Augenbrauen überschatteten stahlharte blaue Augen mit langen Wimpern; die Nase war gerade und wohlgebildet und der Mund hatte geradezu klassische Formen. Unter einem flotten blonden Schnurrbart lugte eine halbverlöschte Zigarette hervor. Als er aufstand, was er einen Augenblick später tat, nachdem Duveen und Brown eingetreten waren, zeigte es sich, daß er weit über Mittelgröße war, trotz seiner nachlässig gebückten Haltung. Interessanter Mensch. Gute Figur. In jeder Beziehung auffallend. Mit der einen Hand in der Hosentasche, die andere begrüßend ausgestreckt, kam er auf Brown und Duveen zu.
»C'est le type en question?« sagte er zu Duveen, und obgleich natürlich Brown keine Ahnung hatte, was die Frage bedeutete, so berührte ihn die metallische und doch weiche Stimme angenehm. Der Mann übte durch seine bloße Erscheinung eine gewisse Anziehungskraft aus, die ihre Wirkung auf Brown nicht verfehlte. Den gleichen Eindruck hatte einmal in seinen Knabenjahren ein Junge auf ihn gemacht, der der Anführer aller Dummheiten war, und der später als Mann ein höchst betrübliches Ende nahm …,
Duveen stellte Brown vor, dem Manne zublinzelnd.
»Dies ist mein Freund, Mr. Brown; Mr. Brown, dies ist mein Freund Monsieur Georges.«
Monsieur Georges schüttelte Brown freundlich die Hand und dann stellte er ihn den anderen drei Herren vor. Es kam Brown dabei ein wenig sonderbar vor, daß die junge Dame sich gerade den Moment dazu aussuchte, in dem er ihrem Herrn vorgestellt wurde, diesen sehr energisch abzuküssen.
Ein Kellner eilte herbei, als Brown und Duveen an dem Tisch Platz nahmen. Monsieur Georges setzte sich wieder zu den Kartenspielern und das Spiel nahm seinen Fortgang.
»Monsieur prend?« fragte der Kellner.
»Was trinken Sie?« übersetzte Duveen, mit einem bezeichnenden Seitenblick auf die Gesellschaft am Tisch.
Brown verstand sofort, bestellte einen Benediktiner für sich selbst und bat die Herren am Tisch auf englisch, seine Gäste zu sein. Monsieur Georges mußte englisch verstehen, denn er bestellte sich einen eau-de-vie de marc, ohne von den Karten in seiner Hand aufzusehen und übersetzte Browns Einladung den anderen Herren.
»Und Madame?« fragte Brown. Er hatte ein Gefühl, als fingen nun die Intimitäten französischen Lebens an; französische Höflichkeit, französische Galanterie.
»Un bock,« antwortete sie kurz (sie war zu sehr mit den Ohren ihres Herrn beschäftigt).
»Ist das nicht reizendes Familienleben?« erklärte Duveen im Flüsterton. »Ist es nicht entzückend? So gar keine falsche Bescheidenheit, so gar keine Zimperlichkeit. Wir sind ja alle so enge Freunde!«
»Ist die junge Dame seine Frau?« Brown wunderte sich, welche Anziehungskraft der häßliche Mann wohl für das junge Mädchen besitzen mochte, das wirklich sehr hübsch war.
»Seine Frau? Nein, das nicht gerade! Aber auch sie gehört der guten Sache an. Die beiden sind – hm – na, sie sind verlobt, wissen Sie, und nach der Wiederherstellung des Kaiserreichs werden sie sich heiraten. Jawohl!«
»Komisch!« murmelte Brown. »Man hat mir doch immer gesagt, französische Mädchen seien so unendlich steif und – na, vorsichtig, solange sie nicht verheiratet sind!«
»Ganz richtig – die Mädchen der Mittelklassen. Diese junge Dame jedoch gehört dem ancien régime an. Ebenso die Herren. Sie mögen nicht so aussehen, aber in ihren Adern fließt das edelste Blut Frankreichs. Jetzt, im Unglück, mögen sie sich noch ein wenig mehr gehen lassen, als sonst in vornehmer Nonchalance – aber sie repräsentieren wirklich das edelste Blut Frankreichs – sie sind die Getreuen des Kaisers.«
»Komisch – –« dachte sich Brown.
Es fiel ihm ein, daß in Brixton eine alte Frau lebte, die furchtbar gern zu viel Whisky trank, und die dann jedem, der es hören wollte, höchst ausführlich erzählte, sie sei die rechtmäßige Königin von Griechenland, und eines Tages werde sie in Glorie auf dem Throne einer Königin sitzen. Freilich müsse das bald sein, sonst sei es zu spät. So ging es anscheinend auch dem edelsten Blut Frankreichs. Offenbar – wenn das Kaiserreich nicht sehr bald errichtet wurde, dann war es zu spät für diese Herren!
»Französische Aristokraten sind furchtbar exklusiv,« bemerkte Duveen des weiteren. »Wissen Sie, Sie könnten Monate lang im Lande sein, und Sie würden keine Gelegenheit dazu finden, mit einem Aristokraten des ancien régime zu sprechen. Die Leute bleiben politisch und gesellschaftlich vollkommen unter sich. Wenn sie aber unter sich sind, wie diese Herrschaften hier, dann sind sie furchtbar gemütlich!«
»Aber der junge Mensch da drüben am andern Ende des Tisches,« flüsterte Brown und deutete auf den kleinen Kartenspieler mit dem üblen Babygesicht, »gehört der etwa auch dem edelsten Blut Frankreichs an?«
»Nein, der nicht. Das ist ein Mitglied der Unterklasse, der jedoch der Idee des Kaiserreichs treu geblieben ist. Er ist ein Diener und ein guter Kerl, wie ich Sie versichern kann.«
Brown saß da und wunderte sich. Wie einem doch das intime Leben Frankreichs die Augen öffnete. Wie es einem den Horizont erweiterte! Wie es einem Neues lehrte – im Leben hätte er diese Leute nicht für das gehalten, was sie waren. Eine höchst gewöhnliche Gesellschaft – das wäre sein Urteil gewesen. Aber freilich, in einem neuen Land hatte man viel Neues zu lernen, und man lernt ja überhaupt nie aus. Brown hätte sich selbst umarmen können vor Freude, wenn er sich vorstellte, daß er eigentlich jetzt schon mehr von Frankreich kenne und gelernt hatte, als in seinem ganzen Leben von seinem heimischen England. Niemals war er in Brixton in solche Gesellschaft geraten, und mit Geheimnissen hatte er wahrhaftig in seinem ganzen Leben noch nichts zu tun gehabt.
Es dauerte nicht lange, so fragte Monsieur Georges unseren Helden mit bestrickender Liebenswürdigkeit, ob er sich denn vielleicht am Spiel beteiligen wolle? Brown freute sich sehr über die Aufmerksamkeit. Er mußte zwar zögernd eingestehen, daß er keine Ahnung von dem Spiel hätte, das da gespielt wurde. Aber die Liebenswürdigkeit dieses edelsten Blutes Frankreichs kannte keine Grenzen. Ma foi, man würde ihn das Spiel lehren. Es war manille; ein sehr einfaches Spiel, hätten sie langsam gespielt und Englisch gesprochen. Aber nachdem man Brown in ein paar Worten die notwendigsten Kartenwerte und den Gang des Spieles nicht gerade sehr deutlich erklärt hatte, schien man – das edelste Blut Frankreichs – der Meinung zu sein, das genüge vollkommen, und es wurde darauf losgespielt wie vorher. Brown tat sein Bestes, aber der Kopf schmerzte ihn. Sie schnatterten darauf los, gestikulierten kolossal, die Karten fielen mit enormer Geschwindigkeit, und Brown kam sich vor wie ein kleiner Junge, der sich aus Leibeskräften abmüht, neben einem erwachsenen Mann herzulaufen, dem aber mit jedem Schritt mehr und mehr der Atem ausgeht. Um seine neuen Freunde ja nicht zu beleidigen und den Gang des Spieles nicht zu stören, spielte er prinzipiell, jedesmal, wenn die Reihe an ihn kam, was für Karten er auch hatte. Da er mit diesem einfachen System prompt und regelmäßig verlor, so tat er niemanden weh als sich selbst. So spielte er denn fortwährend, als ob er zu nichts anderem auf der Welt sei, und machte dazu auch noch ein Gesicht, als amüsiere er sich wundervoll. Denn er war ja unter Gentlemen. Und Gentlemen pflegen Geld zu verlieren, ohne eine Miene zu verziehen. Merkwürdigerweise taten das die anderen Herren nicht; sie waren sogar sehr aufgeregt und gebrauchten Ausdrücke, die Brown zwar nicht verstand, von denen er aber sehr richtig annahm, sie seien starke Ausdrücke …,
Jedenfalls war es, sagte er sich, seiner Mühe und seines Geldes wert, schon so rasch mit den Mitgliedern des Verbandes zur Wiederherstellung des Kaiserreiches Karten spielen zu dürfen. Das war schon ein großer Erfolg. Und alle Erfahrung in diesem Leben kostet ja Geld. Das wußte Brown. Und außerdem war es noch lange nicht so teuer, wie die kleinen Pferdchen. Bei den petits chevaux hatte er freilich den Vorzug genossen, genau zu verstehen, weshalb und wieso er sein Geld verlor, was hier nicht der Fall war. Dafür ermangelten die kleinen Pferdchen der persönlichen Seite. Ach ja, das war doch sehr persönlich und intim hier. Er verstand zwar nicht, was gesprochen wurde, aber bei bloßem Zuhören kam sich Brown schon sehr französisch vor.
Endlich hörte das Spiel auf, und zwar hörte es einigermaßen plötzlich auf. Die Dame mit der Vorliebe für das Küssen von Männerohren hatte Spiel für Spiel sehr genau beobachtet und beschuldigte nun plötzlich einen der Spieler, zu betrügen. So kam es wenigstens Brown vor, und er war sich nicht ganz klar darüber, ob nicht er selbst der Angeschuldigte sei. In der nächsten Sekunde war der Skandal los; ein fürchterlicher Skandal. Ein Lärm, daß die Ohren ihm klangen. Er fing an, sich zu fürchten, denn die Männer sahen so wütend aus. Einen Augenblick lang stieg in ihm der lästerliche Gedanke auf, das edelste Blut Frankreichs benehme sich unglaublich geschmacklos. Aber nur einen Augenblick lang; dann fiel ihm die Lösung ein; das war ja das keltische Temperament – es sah nur so aus. Es war auch wirklich nicht so gefährlich. In England hätte sich eine solche Szene schon längst in eine wohlgefällige Prügelei aufgelöst; hier, so riesig auch der Lärm war, tat keiner dem anderen etwas zu leide. Brown fürchtete sich also nicht, sondern hörte sehr interessiert zu, ohne etwas zu verstehen, bis endlich der Wortstrom langsam verrieselte.
Das Spiel hörte jedoch auf und neue Getränke wurden bestellt, für die der Kellner merkwürdigerweise das Geld von Brown verlangte. Mr. Brown jedoch glaubte, in solcher Gesellschaft einen so kleinen Irrtum nicht korrigieren zu dürfen. Dann lehnten sich die Männer in ihre Stühle zurück und rauchten, pafften enorm. Und wenn die Wahrheit gesagt werden soll: sie spuckten auch sehr viel.
Und dann erhielt Brown den Ueberraschungs- shock seines Lebens. Er überlegte sich gerade, ob dieses intime französische Leben nicht doch zu intim für seinen bescheidenen Geschmack sei, als sich die Türe auftat und – die Dame des Kasinos eintrat …,
Brown starrte, starrte – – –
Da war sie. Ernst, blaß, melancholisch. Da war das weiße Kostüm und da war das rabenschwarze Haar ( à la Cléo de Mérode), die glühenden Lippen, die dunklen Augen. Wie eine Königin sah sie aus, und ihre königliche Haltung stand in sonderbarem Gegensatz zu der Umgebung hier. Browns Herz hörte beinahe zu schlagen auf. Was suchte sie hier? Wie hatte sie nur jemals den Weg durch das Labyrinth von Gäßchen finden können und wie kam sie in solch ein gewöhnliches und obskures Café? In der stolzen Haltung einer Königin stand die Dame des Kasinos da. Und dennoch, so schien es Brown, schien sie sich hier sonderbar heimisch zu fühlen. Sie warf ihre Federboa auf ein Tischchen, als sie eintrat, und setzte sich in eine Ecke. Monsieur Georges sah auf.
»Te voilà, duchesse«, sagte er.
»Duchesse«, sie war also doch eine Dame von Rang!
Ah, Browns feiner Instinkt hatte ihn doch nicht getäuscht. Aber war es nicht sonderbar, daß diese Dame von Rang in ein derartiges Restaurant ging? Aber wer war er, zu urteilen über fremde Dinge in einem fremden Land? In diesem Land der Kontraste und Ueberraschungen durfte man über gar nichts erstaunen!
»Me voilà!« rief die Dame des Kasinos.
Beinahe wäre Brown aufgefahren vor Ueberraschung und Schrecken. Denn der Klang ihrer Stimme war so gar nicht das, was er erwartet hatte, so gar nicht wie sie selbst. Diese Stimme hatte so gar nichts Königliches. Zwar schien sie sehr müde zu sein und nicht in allerbester Laune. Aber wenn Brown dies auch in Betracht zog, so erklärte das noch lange nicht jenen blechernen Klang der Stimme seiner Königin. Blechern, kratzig, disharmonisch; keine Stimme, die von diesen süßen, glühenden Lippen hätte kommen dürfen. Sie schien mit Verachtung auf die Gesellschaft herabzusehen, ja mit Ekel. Dann fielen ihre Blicke auf Brown. Und ihn starrte sie an, als sei sie sehr überrascht. Das Anstarren dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde, denn la duchesse verfügte über eine vollkommene Selbstbeherrschung. Aber Brown hatte ihre Ueberraschung doch bemerkt und war im siebenten Himmel. Wenn er nur ihr Interesse erregte, mehr wünschte er ja gar nicht. Innerlich hoffte er nur, daß sie gegen sein Hiersein nichts einzuwenden haben würde; denn klugerweise erriet er, daß auch sie zu den Verschwörern gehörte. Was sonst hätte sie hier gesucht? Und Duveen hatte ihm ja erzählt, daß der Verband überall Freunde hatte. Es war etwas Bewunderungswürdiges für solch eine Dame, ihre Zeit und ihre Schönheit und ihre Energie einer verlorenen Sache zu opfern. Und dann sah er, wie Duveen ihn anstarrte. Der Mann verwandte kein Auge von ihm. Wollte er ihn warnen?
Monsieur Georges stand auf, schritt zu der Dame hin, und sie sprachen ein paar Worte in leisem Flüsterton. Für Browns Geschmack benahm sich Monsieur Georges dabei viel zu vertraulich; seiner Ansicht nach durfte man dieser Frau nur mit gebeugtem Knie nahen. Freilich, er erschrak noch mehr als vorhin, als er ihre Stimme hörte – sie war wirklich blechern und gar nicht schön. Vielleicht war la duchesse etwas heiser. Sonderbar, Brown schien es, als spreche man über ihn, denn einmal bemerkte er, wie Monsieur Georges mit einem Blick seiner Augen förmlich auf ihn deutete. Nach und nach erholte sich Brown wenigstens so weit von seiner Ueberraschung, daß er Duveen befragen konnte.
»Wer ist die Dame? Ich habe sie im Kasino gesehen; ich hätte nie erwartet, sie hier zu treffen.«
»Sie ist eines der wichtigsten Mitglieder des Verbandes. Ihr Name ist Thérèse de Mérac, und sie ist unserer guten Sache vollkommen ergeben.«
»Monsieur Georges nannte sie »Duchesse«?«
Brown genierte sich eigentlich, seinen neuen Freund so indiskret und so ohne alle Umschweife auszufragen, aber die Dame des Kasinos interessierte ihn derartig, daß er nicht geneigt war, auf die Feinheiten vornehmer Zurückhaltung viel Gewicht zu legen; aber auch Duveen fühlte sich unbehaglich, freilich aus ganz anderen Gründen. War Brown etwa doch nicht so – –« Er sah ihn verstohlen von der Seite an, ehe er antwortete:
»Duchesse? Nun, es ist der ihr gebührende Titel, den sie freilich aus guten Gründen für gewöhnlich nicht führt. Nur ihre Freunde nennen sie so. Eines Tages aber wird sie in Wahrheit vor aller Welt madame la duchesse sein.«
»Wunderbar!« sagte sich Brown. In Gedanken nannte er sie schon seine Herzogin.
Duveen aber atmete auf. »Der Prinz verlieh ihr diesen hohen Rang für ihre wertvollen Dienste«, fuhr er fort.
»Der Prinz?«
»Er, dem wir dienen.«
Brown schwamm in einem Meer von Wonne. Nur Monsieur Georges und seine Vertraulichkeit störten ihn einigermaßen. So fragte er:
»Und Monsieur Georges? Er scheint sehr intim mit ihr zu stehen?«
Duveen überlegte blitzschnell. Es war doch keine kleine Aufgabe, so rapide lügen zu müssen – –
»Jawohl! Natürlich. Sie meinen die Intimität? Aber sehen Sie – als Verschwörer – und dann ist er, jawohl, er ist ihr Vetter. Sie stammen beide aus einer uralten bretonischen Familie. Aus der Bretagne, wissen Sie; aus dem Lande der getreuen Royalisten.«
»Und ist auch Monsieur Georges – ich meine, ist das sein richtiger Name? Hat er auch noch einen anderen Namen? Einen aristokratischen Rang?«
»Jawohl!« antwortete Duveen und konnte sich kaum das Lachen verbeißen. (Es ist manchmal gefährlich für einen Gauner, allzuviel Sinn für Humor zu haben!) »Jawohl, er verfügt sogar über mehrere Namen! Ueber eine ganze Menge! In der Oeffentlichkeit kennt man ihn jedoch nur als Monsieur Georges. Das ist viel klüger!«
»Freilich«, stimmte Brown bei. »Er muß vorsichtig sein, vermute ich.« Seine Gedanken wandten sich jedoch sofort wieder der Dame des Kasinos zu:
»Ist es nicht traurig, daß – hm – daß Madame de Mérac hier die Gesellschaft dieser andern – hm – Dame ertragen muß? Sagen Sie mal, Duveen: dieses Mädel da hinter dem Stuhl mit ihrer ewigen Küsserei kann doch keine Dame sein?«
»Nein – sie ist auch keine Dame. Vergessen Sie aber nicht, mein Junge, daß Unglück und Politik Menschen sonderbar zusammenwerfen. Sie dürfen nicht nach dem Schein urteilen. Das Mädchen ist die Tochter der alten Amme Madame de Méracs und würde für sie in den Tod gehen. Sie ist treu wie Gold. Sie darf sich daher einen Scherz erlauben. Wissen Sie: Aristokraten sind viel einfacher und ungenierter als gewöhnliche Leute!«
»Dann müßte sie auch eine Aristokratin sein«, brummte Brown. »Ungeniert genug ist sie!«
Mr. Brown von England fiel von einem Erstaunen in das andere. In Romanen hatte er ja viel von den Großen dieser Welt gelesen, und er wußte, daß es 'ne komische Gesellschaft war. Aber so ungeniert – so – so sehr ungeniert hatte er sich Aristokratentum doch nicht vorgestellt. Er konnte diesem edlen Blut Frankreichs keinen Geschmack abgewinnen, so sehr er sich auch innerlich steif und unbehilflich schalt. Madame de Mérac dagegen – ah, ihr konnte man sofort ansehen, welch große Dame sie war. Diese Haltung! Diese Manieren! Und wenn es ihr beliebte, ihrer Dienerin sehr – hm – merkwürdige Freiheiten zu gestatten und um der guten Sache willen ihre Klassenvorurteile zu begraben, so war das nicht nur eigenartig, sondern vielleicht sogar bewunderungswürdig. Der Stolz der großen Dame vielleicht, der die Ungezogenheiten niedrigstehender Menschen nicht bemerkt, weil er keine Notiz davon nehmen will. Monsieur Georges dagegen schien ein bemerkenswertes Talent zu haben, die schlechten Manieren der unteren Klassen nachzuahmen – alle Franzosen waren ja Schauspieler, hatte Duveen gesagt! Vielleicht war auch Monsieur Georges ein Herzog! Er hatte etwas Großartiges. Brown überlegte. Ja, so war es. Keine Spur von Verdacht stieg in ihm auf. Im übrigen konzentrierten sich seine Gedanken völlig auf die Dame des Kasinos.
»Sie braucht einen Freund!« sagte er sich. »Einen Freund, der ihr rät, die gute Sache eine gute Sache sein zu lassen und sich erst dann mit ihr zu beschäftigen, wenn sie triumphiert hat!«
Er wäre sehr gerne dieser Freund gewesen.
»Möchten Sie Madame de Mérac vorgestellt werden?« fragte Duveen.
»Ach ja«, seufzte Brown und stand zögernd auf. Er war sehr nervös. Er fürchtete, sich ungeschickt zu benehmen und einen schlechten Eindruck auf die Herzogin zu machen.
Duveen führte ihn sehr zeremoniös in die Ecke.
»Madame«, sagte er, mit einer tiefen Verbeugung, »gestatten Sie mir, Ihnen meinen Freund vorzustellen, Mr. Brown von England!«
Die Herzogin reichte Brown eine schmale, tadellos behandschuhte Hand. Brown schüttelte diese Hand. Er hätte sie gar zu gerne an seine Lippen geführt, wie er das im Kasino an Herren beobachtet hatte, die Damen begrüßten, aber er wagte es nicht.
»Es freut mich, Sie kennen zu lernen«, sagte sie, mit einem freundlichen Blick aus den großen dunklen Augen. Nun, da er sich an sie gewöhnt hatte, schien Brown die Stimme nicht mehr so unangenehm. Sie paßte nur so gar nicht zu solch einer Dame – aber an und für sich war der Klang nicht so schlimm, wenn er auch sonderbar rauh und heiser war. Und außerdem freute er sich unbeschreiblich – denn sie sprach Englisch. Auch Monsieur Georges verstand ja anscheinend ein wenig Englisch. Es fiel Brown ein, daß Englisch ja jetzt in guter französischer Gesellschaft Mode war.
»Sie sprechen Englisch, Madame?« fragte er in ehrfurchtsvollem Ton. Er wollte ihr zeigen, daß ein Mann wenigstens ihr unter allen Umständen den gebührenden Respekt zu erweisen gedachte – selbst in dem schäbigen Café hier! Aber er hätte ja gar nicht anders sein können …, Sein Herz war ja voller Ehrfurcht.
» Oh yes, I speak English a little ich habe in England gelebt.«
»Ah, Madame, wo lebten Sie in England?«
»In London. In Regent Street, glaube ich; aber dann – ich vergesse so sehr leicht Namen. Es war vor einigen Jahren schon, aber ich erinnere mich noch sehr gut an die schönen Läden und die krumme riesengroße Straße und die vielen Menschen und die vielen Polizisten. Mon Dieu – welche Menschenmassen, welches Leben! Am besten aber gefällt mir doch Frankreich.«
Während sie sprach, veränderte sich der Ausdruck in ihrem Gesicht nicht im geringsten. In königlicher Haltung stand sie da, ein melancholisches Lächeln spielte um ihren Mund.
»Und so gedenken Sie, einer der Unsrigen zu werden?«
»Wenn Sie es gestatten!« antwortete Brown. Sein Herz klopfte.
... Duveen bestellte Getränke. Noch vor einer Viertelstunde würde es Brown überrascht haben, wenn eine Dame wie Thérèse de Mérac in solch einem Raum zusammen mit solchen Leuten eine Erfrischung eingenommen hätte. Nun aber überraschte ihn nichts mehr. Er war über das Stadium des Staunens hinaus. Nur ein ganz klein wenig erstaunte er, als die Dame ihr Glas rasch an die Lippen führte und es sehr geschickt mit einem Zug leerte! Aber vielleicht war sie sehr durstig. Außerdem sah sie ihn beim Trinken mit einem so melancholischen Blick an, daß er verstand. Der Blick bat um Entschuldigung und Verständnis (sagte sich Brown).
Monsieur Georges schien ungeduldig. Vielleicht ahnte er, welche Gefühle Brown gegen seine Cousine hegte – –
»Il laut que tu t'en ailles,« sagte er.
»Je ne sors plus,« antwortete sie.
»Tu ne das pas faire de la tête«, flüsterte Monsieur Georges und sah sehr ärgerlich aus.
Mit einer müden Bewegung stand die Dame auf, nahm mit einem Blick des Widerwillens gegen ihren Vetter die Federboa von dem Tischchen auf und legte sie sich um den Hals. Dann streckte sie Brown eine kleine zierliche Hand hin und sagte:
»Good night, Monsieur; wir sehen uns wieder, n'est-ce pas?«
Ah – sie würden sich wiedersehen. Sie würden sich wiedersehen, und wenn Brown eine Welt nach ihr absuchen mußte.
»Morgen schon, hoffe ich,« antwortete er, und beugte sich tief über die kleine Hand, wenn er auch nicht wagte, sie zu küssen.
Monsieur Georges gab Brown einen kräftigen Händedruck, der sehr weh tat, sagte Gutenacht, nickte den anderen Herren zu und folgte der Dame. Im Hinausgehen lachte er laut auf, wie Brown deutlich hörte. Es war kein angenehmes Lachen. Brown hoffte nur, daß er nett zu seiner Cousine war; sah er doch aus wie ein Mann, der sehr energisch das Gegenteil von nett sein konnte.
»Wohnen die beiden Herrschaften zusammen?« fragte er Duveen.
»Nein, aber im gleichen Hause, wissen Sie,« antwortete dieser. »Sie hat ja niemand in Mouleville als ihren Vetter. Hat sie doch ihre Familie verlassen, um sich der guten Sache zu widmen!«
»Brave Frau! Wir haben keine solchen Frauen in England!«
»Oh doch,« lächelte Duveen. »Sie kennen sie nur nicht!«
Dann schlug er vor, nach Hause zu gehen. Da auch Duveen ein Zimmer im Hause des Kaisers bewohnte, so gingen sie zusammen.
»Ich hoffe, Sie werden im Bett des Kaisers wieder ausgezeichnet schlafen. Und hoffentlich bereuen Sie es nicht, daß Sie einer der Unsrigen geworden sind.«
»Nein. Nie!«
Bereuen! Wie konnte man je einen Schritt bereuen, der einen der Dame des Kasinos näher gebracht hatte!
In dieser Nacht träumte Brown von dem großen Kaiser und von Josephinen und wie er Josephine verstoßen hatte, um Marie Louise zu seiner Kaiserin zu machen. Und merkwürdigerweise sah Josephine in diesem Traum Amelia so ähnlich und Marie Louise glich auffallend einer gewissen duchesse – nur die Gesichtszüge des großen Korsen waren ganz undeutlich …,