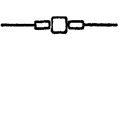|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Mr. Brown von England soll um dreitausend Pfund erleichtert werden, zeigt sich jedoch als ein tapferer kleiner Mann und zieht die Pistole vor. Die heilige Hermandad erscheint auf der Bildfläche.
Mr. Brown schlief sehr schlecht, denn schwere Träume plagten ihn. Napoleon, Thérèse und Amelia tanzten Ringelreihen miteinander und wollten ihn durchaus nicht mitspielen lassen. Duveen spielte Ziehharmonika zu dem Ringelreihen, und Monsieur Georges fuchtelte ihm fortwährend mit einem Scheckbuch vor der Nase hin und her …,
Schweißgebadet erwachte er und entsann sich mit einem Ruck der verantwortungsvollen Aufgabe, die seiner harrte. Er sah auf die Uhr. Es war fünf Uhr morgens. Rasch steckte er den Kopf in das kalte Wasser der Waschschüssel, um sich die Schläfrigkeit wegzuspülen und nahm dann seinen Beobachterposten am Fenster ein.
Der Kaiser kam – der Kaiser sollte kommen – – –
Draußen regnete es in feinen Streifen und schwere Wolken hingen über dem Meer. Sorgfältig suchte Brown mit dem altmodischen Feldstecher den Horizont ab nach dem Schiff mit dem goldenen Adler in der Flagge. Er suchte und suchte. Wie im Flug rannen die Stunden dahin; er merkte es kaum, so eifrig und gewissenhaft war er in seinem anstrengenden Beobachten. Unaufhörlich streifte sein Glas die neblige Meeresfläche ab. In all den Stunden sah er nur drei Schiffe und sie waren nur Fischerboote, die auch nicht das geringste adlerähnliche Flaggenstückchen führten. Dann und wann wurde Brown müde und nahm auf einige Sekunden das Glas von den Augen. Aber nicht länger. Denn dieses geduldige Ausschauen nach einem Kaiser und seinem Schiff hatte dennoch etwas Aufregendes. Ungeheuer wichtig kam sich Brown vor; Verantwortung lastete auf ihm, wie er sie so gar nicht gewöhnt war. Und dann war ein sonderbarer Zwiespalt in ihm; er wußte nicht recht, sollte er ungeduldig und enttäuscht sein, daß das Schiff mit der Adlerflagge sich nicht blicken ließ, oder sollte er sich freuen, daß der Kaiser nicht kam. Das Warten war unangenehm, das Kommen des Kaisers konnte noch Unangenehmeres bringen!
Um fünf Uhr hatte er seinen Posten am Fenster eingenommen, und jetzt war es neun Uhr. Da sah er einen Wagen die Promenade entlang fahren und konnte durch den Feldstecher erkennen, daß Duveen und Monsieur Georges seine Insassen waren. Darüber freute er sich sehr, denn er war des Wartens müde und fand es viel hübscher, wenn man zu dritt auf Napoleon wartete, selbst mit Monsieur Georges als Drittem. Der Wagen kam näher – nun hielt er vor dem Haus – und nun hörte er Monsieur Georges und Duveen eintreten. Brown aber blieb am Fenster sitzen, denn in seiner Gewissenhaftigkeit wagte er es nicht, den wichtigen Posten auch nur auf Minuten zu verlassen.
Er horchte. Nun würden sie die Treppen heraufstürmen und ihn mit Fragen bombardieren und furchtbar enttäuscht sein über das Ausbleiben des Schiffes, das den Triumph der guten Sache an Frankreichs Küste trug.
Aber kein Mensch kam gestürmt. Brown wunderte sich. Aber er wartete geduldig. Vielleicht mußte der Marquis über etwaige neue Beschlüsse informiert werden. Eine Viertelstunde verging. Eine halbe Stunde. Der Gedanke stieg in ihm auf, daß man ihn nicht gerade rücksichtsvoll behandle, und er fing an, ärgerlich zu werden. Er wartete noch zehn Minuten, und dann wurde er wütend. Jetzt konnte er doch wirklich verlangen, abgelöst zu werden! Wütend warf er den Feldstecher auf den Boden und hängte sich so energisch an den Glockenzug, daß minutenlang schrilles Läuten durch das Haus gellte. Ein altes Weib kam, das ihn fragend anstarrte.«
»Duveen! Moi – fatigué. Veux déjeuner!!« schrie ihr Brown zu, und sie verschwand wieder.
Nach wenigen Sekunden trat Duveen ins Zimmer.
»Mein lieber Junge,« sagte er, »ich hatte keine Ahnung, daß Sie noch hier oben seien!«
»Na, Sie hätten aber schließlich 'mal nachsehen können!« schrie Brown ärgerlich, »ich durfte doch meinen Posten nicht verlassen!«
»Ihren Posten?«
»Donnerwetter – den Ausguck! Das Schiff! Sie haben mir doch so lange Reden darüber gehalten!«
»Aber das ist ja längst erledigt! Der Prinz kommt nicht.«
»Er – – Aber weshalb haben Sie mir das nicht gesagt? Ich sitze seit vier Stunden am Fenster und habe den Feldstecher kaum von den Augen gebracht!«
»Das tut mir furchtbar leid, lieber Brown. Sagte ich Ihnen denn nicht, daß der Dampfer vor acht Uhr kommen würde, wenn überhaupt? So war es abgemacht worden. In Wirklichkeit hat sich der Prinz gar nicht eingeschifft, denn es ergaben sich im letzten Moment gewisse Schwierigkeiten.«
»Wenn ich das nur gewußt hätte,« brummte Brown. »Ich sage Ihnen, Ausguck zu halten ist kein Vergnügen. Mir tun alle Glieder weh.«
»Kommen Sie doch mit nach unten,« bat Duveen sehr liebenswürdig. Dann werden Sie hören, wie die Dinge stehen.« Dann fügte er besänftigend hinzu (denn Brown mußte bei gutem Humor erhalten werden): »Natürlich hätten wir Sie benachrichtigen müssen, aber wir hatten so viel Aerger und Aufregungen, daß wir es ganz vergaßen. Lassen Sie uns gehen; wir haben Kriegsrat gehalten und brauchen Sie – Monsieur Georges hat Ihnen eine sehr dringende Mitteilung zu machen.«
Brown machte ein mürrisches Gesicht. Dringende Mitteilungen, und besonders dringende Mitteilungen von Monsieur Georges, mißfielen ihm. Dringende Mitteilungen sind gewöhnlich unangenehme Mitteilungen.
Unten im Wohnzimmer saßen der Marquis und Monsieur Georges am Tisch, auf dem ein umfangreiches Paket lag, über das der Marquis rasch die Tischdecke warf, als Brown eintrat. Thérèse stand vor dem Spiegel und probierte eine Halskette aus wundervollen Perlen an. Aus ihrem schwarzen Haar funkelte eine Tiara aus Diamanten.
»Nimm das Zeug herunter,« sagte Monsieur Georges in scharfem Ton.
»Oh, weshalb denn?« meinte Duveen lachend. »Mr. Brown hat die Juwelen schon gesehen. Und er ist ja einer der Unsrigen. Die Herzogin probiert nämlich,« erklärte er Brown, »das Halsband und die Tiara des herzoglichen Familienschatzes an. Es sind wunderschöne Stücke. In ihrer Familie ist es Tradition, daß diese Juwelen nicht getragen werden dürfen, bis der Kaiser wieder den Thron des großen Napoleon bestiegen hat. Und dieses große Ereignis steht ja nahe bevor!«
Trotzdem legte sie die Juwelen ab, und Monsieur Georges nahm sie ihr mit einem bösen Blick aus den Händen und wickelte sie in das Paket.
»Ich habe Brown bereits mitgeteilt, daß sich Schwierigkeiten ergeben haben und daß wir seines Rates bedürfen,« sagte Duveen.
»Allright,« nickte Monsieur Georges. »Erklären Sie's ihm.«
Duveen schob Brown einen Stuhl hin und bat ihn, sich zu setzen.
»Sehen Sie,« begann er, »die Sache ist so: die Abfahrt des Prinzen und der große Schlag mußten verschoben werden, weil die Geldmittel der Partei völlig erschöpft sind. Wir mußten riesige Summen für Bestechungen und dergleichen ausgeben. Schauderhaft. Nun, Klagen hat keinen Sinn. Die Frage ist nur: Soll die Verschwörung in sich zusammenbrechen, und sollen wir unsere Pläne aufgeben, jetzt, wo wir ihrer Erfüllung so nahe sind? Nur deshalb, weil uns eine relativ unbedeutende Geldsumme fehlt? Das wäre Wahnsinn. Der Erfolg ist uns sicher, und bald werden wir das Geld zehnfach zurückerhalten. Unsere Sorgen sind ja nur augenblickliche Sorgen. Aber an wen sollten wir uns wenden! Und da dachten wir – wir dachten – daß Sie – Sie – nun, daß Sie der Mann wären, uns zu helfen.«
»Ich verstehe Sie nicht ganz,« murmelte Brown, um Zeit zu gewinnen. (Der Marquis und Monsieur Georges betrachteten ihn lauernd; Thérèse hatte ihr Gesicht abgewandt.)
»Es ist ja eine ziemliche Zumutung,« sagte Duveen. »Aber in der Sache steckt Geld für Sie, Brown. Nicht nur Ehren. Können Sie der guten Sache dreitausend Pfund leihen?«
»Dreitausend Pfund!« stotterte Brown.
»Eine kleinere Summe hätte gar keinen Zweck, während dreitausend Pfund den Erfolg verbürgen. Sie haben hier die Chance Ihres Lebens, mein lieber Brown, wenn Ihnen die Sache auch riskant erscheinen mag. Sie ist es jedoch nicht. Wir selbst sind außerstande, etwas zu tun. Der Marquis und Monsieur Georges verfügen über keinen Pfennig mehr. Doch keiner von uns macht sich Sorgen; wissen wir doch, daß wir alle in ein oder zwei Wochen reiche Männer sein werden.«
Nein, versorgt sahen diese Männer durchaus nicht aus, wie es Brown schien: sie hatten eher etwas Drohendes. Ihre Blicke gefielen ihm gar nicht. Die Sache mit den dreitausend Pfund gefiel ihm noch viel weniger. Dreitausend Pfund würden ein furchtbares Loch in die Erbschaft seiner guten Tante reißen! Aber auch davon abgesehen – die Sache gefiel ihm nicht! Dazu kannte er die Männer zu wenig. Und wenn die Pläne der Verschwörer fehlschlugen? Er hätte gerne gewußt, was Thérèse über die Sache dachte, und sah sie fragend an, aber sie wandte nur rasch ihr Gesicht ab.
»Nein, es ist mir unmöglich,« sagte er endlich.
»Aber, mein lieber Junge,« protestierte Duveen, »überlegen Sie es sich doch noch einmal. Soll um solch einer kleinen Summe willen alles zusammenbrechen? Sie sind augenblicklich der einzige unter uns, der über Geld verfügt, sonst hätten wir uns nicht an Sie gewandt. Monsieur Georges würde das Geld sofort hergeben, wenn er es hätte, was leider nicht der Fall ist. Und sieht er etwa aus wie ein Mann, der sein Vermögen dahingeben würde, wenn er nicht sicher wäre, es wieder zu bekommen und mehr dazu?«
Nein, so sah Monsieur Georges allerdings nicht aus. Monsieur Georges sah sogar sehr gewinnsüchtig aus – außerordentlich gewinnsüchtig. Und eben deshalb hatte Brown nicht die geringste Lust, sich von solch einer Summe zu trennen.
»Nein, ich kann das Geld nicht geben,« sagte er energisch.
Der Marquis sah Monsieur Georges an und lächelte.
»Thérèse!« sagte Monsieur Georges.
Die Herzogin schrak zusammen und sah Brown an.
»Monsieur –« flüsterte sie, »Sie – Sie werden doch dieses Opfer bringen – dieses kleine Opfer – für die gute Sache, Monsieur – für mich?«
Brown aber schien es, als straften ihre Augen ihre Worte Lügen. In ihnen lag keine Bitte! Sie sah ihn so kühl an, so abweisend, so warnend fast. Und fast gleichzeitig bemerkte er, daß Monsieur Georges seine Cousine drohend anblickte, als sei er nicht zufrieden mit dem, was sie gesagt hatte …,
»Kommen Sie, Brown, seien Sie vernünftig!« bat Duveen. »Gehen Sie auf Ihr Zimmer und schreiben Sie den Scheck!«
Brown überlegte. Er sah Thérèse an, in der Hoffnung, sie würde ihm zunicken, ihn bitten – aber er las nichts als Warnung in ihren Augen. Sein Vertrauen in sie war größer als je zuvor; sie schien ihm nicht mehr so königlich. Mehr ein Mensch, mehr seine Freundin. Die Sache gefiel ihm nicht. Verdacht aller Art stieg in ihm auf – diese Männer waren ihm zu energisch in ihrer Politik. Zu wenig wählerisch in der Wahl ihrer Mittel. .. Nein! Nein!!
»Weshalb soll denn gerade ich das Geld hergeben?« fragte er.
»Weil Sie einer der Unsrigen geworden sind,« antwortete Duveen. »Mann, wenn alle Leute solche Angst um ihr Geld hätten, wie Sie, dann gäbe es keine Könige!«
»Das wäre vielleicht kein Schaden,« brummte Brown. »Nicht, wenn sie so teuer sind!«
»Sie bekommen das Geld ja wieder.«
»Wenn ich es gebe, so gebe ich es für Madame und nicht um der guten Sache willen.«
Aber in ihren Augen lag keine Zustimmung –
»So ist's recht!« sagte Duveen. »Geben Sie das Geld und geben Sie es schnell! Wir könnten sonst die Gelegenheit verpassen.«
»Und weshalb sind Sie so besorgt um diese Sache?« fragte Brown. »Sie sind Engländer – weshalb mischen Sie sich in französische Politik?«
»Weil ich Imperialist bin, und weil ich mein Geld in der guten Sache stecken habe. Und dann dürfen Sie nicht vergessen, daß meine Urgroßmutter von den französischen Republikanern guillotiniert worden ist!«
»Meine aber nicht! Und mir gefällt Frankreich sehr gut, so wie es ist.«
»Wir müssen das Geld haben,« sagte Duveen scharf. »Und Sie müssen es geben. Die gute Sache ist wichtiger als die Bedenken eines einzelnen. Es würde mir sehr leid tun, wenn wir sie zwingen müßten, aber die gute Sache geht über alles!«
»Zwingen! Mich zwingen!« schrie Brown. »Wie wollen Sie mich zwingen?«
»Regen Sie sich doch nicht auf,« sagte Duveen kühl.
»Wir sind drei gegen einen!« bemerkte Monsieur Georges, ganz langsam sprechend und jedes Wort scharf betonend.
»Zwei Franzosen gegen zwei Engländer!« schrie Brown.
»Drei Imperialisten gegen einen Republikaner!« korrigierte Duveen, obgleich ein Schatten der Scham über sein Gesicht flog bei Browns Bemerkung. »Wir haben unser Ziel ja beinahe erreicht,« bat er. »Das Ende ist nahe und Sie wollen uns nicht helfen. Frankreich baut auf Sie, Brown; lassen Sie Frankreich nicht im Stich!!«
»Ich werde auf mein Zimmer gehen und mir die Sache überlegen,« sagte Brown. »Ich glaube, ich hab' gar keine dreitausend Pfund.«
»Oh doch; Sie haben ja Ihre Erbschaft. Aber gehen Sie nur auf Ihr Zimmer; wir geben Ihnen eine halbe Stunde Bedenkzeit. Und vergessen Sie nicht: reicher Lohn winkt Ihnen! Ihr Geld mit Riesenzinsen zurück – Gentleman der Kammer – Page der …,«
»Mein Geld ist mir die Hauptsache! Von Ihnen bekomme ich es nicht wieder und von Monsieur Georges erst recht nicht. Und der Prinz ist nicht hier –«
»Oh, das läßt sich arrangieren,« sagte Duveen rasch. Er suchte einen Augenblick in dem Paket auf dem Tisch und zog dann einen Ring hervor, in dem ein Diamant von bedeutendem Wert funkelte.
»Nehmen Sie diesen Ring!« sagte er. »Er repräsentiert an und für sich schon einen bedeutenden Wert, aber es ist kein gewöhnlicher Ring. Er gehört der Partei und wird »der Ring des Getreuen« genannt und demjenigen Mann anvertraut, der das größte Opfer für die gute Sache gebracht hat. Ich selbst hatte gehofft, ihn zu tragen, aber ich habe ja nichts mehr zu geben, und ich überlasse Ihnen den Ring. Er ist ein Talisman, den der Kaiser kennt – seinem Träger wird er jeden Wunsch erfüllen.«
Das Barometer Brownschen Vertrauens stieg wieder ein wenig. Der Stein war sehr wertvoll, daran konnte kein Zweifel sein (Brown verstand sich auf Edelsteine). Gar nicht übel, als erste Anzahlung auf kommende Belohnungen. Mit einer galanten Verbeugung wandte er sich an Thérèse und bat sie, sich den Ring an den Finger zu stecken. Doch sie schüttelte nur den Kopf, und es schien Brown, als formten ihre Lippen ein englisches Wörtchen:
»Don't!«
»Don't – tun Sie es nicht!«
Sie sprach es so leise, daß er das Wörtchen nur wie einen undeutlichen Hauch hörte. Doch eine Warnung war es sicherlich gewesen, eine Warnung, die sein Unbehagen unendlich steigerte. Wenn sie ihn warnte, sie, der doch die gute Sache alles bedeutete; wenn sie nicht wünschte, daß er sein Geld opferte, dann mußten Duveen und Monsieur Georges wahrlich in gewinnsüchtigem eigenen Interesse handeln! Dann waren sie nicht die selbstlosen Verschwörer, für die er sie immer noch hielt!
»Ich möchte allein sein,« sagte er. »Ich werde auf mein Zimmer gehen. Dreitausend Pfund sind eine sehr große Summe Geld für mich, und ich kann das Geld nicht hergeben, wenn ich nicht sicher bin, es rasch zurück zu bekommen.«
»Mit Zinsen!« flüsterte Duveen, der ihn zur Türe begleitete.
Während Brown die Treppe hinaufstieg, glaubte er, einen Schlag und einen leisen Schrei zu hören. Er schrak zusammen und blieb stehen.
»Was war das?« schrie er.
Die Tür ging auf.
»Nichts, nichts!« rief Duveen. »Der Marquis hat sich auf den Schenkel geschlagen – vor Freude. Er hofft, Sie würden sich doch allright zeigen und uns zum Siege verhelfen.«
»Aber ich glaubte, einen Schrei, einen Hilferuf zu hören?«
»Mein lieber Junge, Ihre Nerven gehen aus dem Leim. Sie eignen sich wirklich nicht zum Verschwörer.«
»Ich wünschte, ich wäre nie einer geworden!«
»In einer Woche werden Sie anderer Ansicht sein!«
* * *
Und Brown überlegte. War es denn wirklich recht, wenn er dieses viele Geld verborgte? Konnte er es verantworten? Hatte man ihn vielleicht gar Schritt für Schritt in eine lächerliche Narrenposse hineingelockt und ihn durch das Anerbieten von Titeln und Ehren in Versuchung führen wollen? Und er hatte sich verführen lassen wie ein grüner Junge in seinem dummen Drang, sich in Dinge zu mischen, die ihn nichts angingen? Es schien ihm, als hätten seine wirklichen Wünsche so gar keine Erfüllung gefunden. Frankreich hatte er kennen lernen wollen – die Franzosen, ihr Leben und ihre Sprache. Sonst nichts. Und nun hatte er eigentlich wenig gesehen und weniger gelernt, war aber dafür in eine Verschwörung verwickelt, die ihn in Wirklichkeit nicht im geringsten interessierte. Und die schandbar teuer war. Allerdings hatte er es nur um Thérèses willen getan; ihr hatte er helfen wollen in ritterlichem Impuls. Hm – Brown errötete – ein bißchen Egoismus war freilich bei der Ritterlichkeit auch dabei gewesen. Nun aber schien sie es gar nicht zu wünschen, daß er noch weitere Opfer brachte. Weshalb? Vielleicht nur deshalb, weil sie zu vornehm dachte, um ihn zu einer gefährlichen Fahrt zu veranlassen, nur weil sie im Schiff war? War es so, dann wollte er nicht zurückstehen an Edelmut …,
So wechselte seine Stimmung fortwährend, und die Zeit verging, ohne daß er zu einem definitiven Resultat kam. Er suchte sein Scheckbuch hervor und nahm zehnmal die Feder in die Hand – immer aber legte er sie wieder hin. Er konnte sich nicht entschließen, den Scheck zu schreiben. Er ging zur Türe, um Duveen zu rufen. Er sollte ihm noch einmal alles erklären. Doch zu seiner Ueberraschung fand er die Türe verschlossen. Da wurde Brown wütend.
Gefangen wollte man ihn halten? Ihn zwingen? Er rüttelte an der Türe, ohne sie jedoch aufbrechen zu können. Dafür hörte er Schritte auf der Treppe.
»Sind Sie das?«
Es war Thérèses Stimme.
»Ja, treten Sie ein.«
»Ich kann nicht. Man hat die Türe zugesperrt und den Schlüssel mitgenommen; sie sind ins Café gegangen.«
»Aber weshalb haben sie denn die Türe verschlossen?«
»Damit Sie Ihr Zimmer nicht verlassen sollen!«
»Unerhört!«
»In der Liebe und im Kriege ist alles erlaubt«, lachte die Stimme.
»Aber es handelt sich ja gar nicht um Kriegführen. Es handelt sich nur darum, daß ich nicht verpflichtet bin und mich nicht zwingen lasse, dieses Geld herzugeben.«
»Georges ist eifersüchtig!«
»Eifersüchtig! Thérèse! Hat er dich geschlagen, als ich vorhin das Zimmer verließ?«
»Geschlagen? Nein, natürlich nicht.«
»Aber sagen Sie mir nur eines, Thérèse – ist das alles korrekt?«
»Ich verstehe nicht.«
»Bon? Allright? Juste! Kein Schwindel?«
»Schwindel? Oh nein. Aber Sie brauchen kein Imperialist zu sein, wenn Sie nicht wollen!«
»Sie meinen also, ich sollte das Geld nicht leihen?«
»Nicht, wenn Sie es nicht wollen.«
»Aber die gute Sache? Wird es Ihnen nicht sehr wehe tun, wenn die Verschwörung zusammenbricht?«
»Sie werden sich das Geld schon wo anders beschaffen, wenn Sie es nicht geben.«
»Sie raten also, es nicht herzugeben?«
Keine Antwort.
»Ich glaube, sie kommen zurück«, antwortet die Stimme endlich. »Ich muß gehen. Nein, geben Sie das Geld nicht her, wenn Sie nicht müssen!«
Und er hörte, wie sie leise die Treppe hinabhuschte. Zum ersten Male empfand Brown so etwas wie Furcht. Was bedeuteten ihre letzten Worte? Er solle das Geld nicht hergeben, wenn er nicht müsse? Müsse? Natürlich brauchte er es nicht zu geben, wenn er nicht wollte. Nachgerade kam ihm das alles sehr sonderbar vor. Diese Männer schienen desparat und imstande, um der guten Sache willen vor nichts zurückzuschrecken. Die gute Sache! Er fing an, diese gute Sache zu Haffen.
Wieder hörte er Schritte auf der Treppe, schwere Männerschritte diesmal. Ein Schlüssel knarrte, und die Türe öffnete sich. Duveen und Monsieur Georges traten ein. Brown versuchte, unbefangen auszusehen, aber es wollte ihm nicht recht gelingen. Es war ihm mehr als unbehaglich zu Mute. Die verschlossene Türe war daran schuld.
»Weshalb haben Sie mich eingesperrt?« fragte er scharf.
»Wir können nicht vorsichtig genug sein«, antwortete Duveen mit einem liebenswürdigen Lächeln. »Ihre Person ist zu wichtig für uns; die Gegenpartei könnte sich an Sie heranmachen wollen. Wir sind von Spionen umgeben. Jawohl, wir müssen sehr vorsichtig sein!«
»Es ist aber nicht fair. Sie haben kein Recht, mich einzusperren; ich bin ein freier Mann und ich bin nicht nach Mouleville gekommen, um mich derartig behandeln zu lassen.«
»Ja. Aber wir verschwenden Zeit,« sagte Monsieur Georges kühl. »Lassen Sie uns zur Sache kommen. Sind Sie bereit, uns das Geld zu geben? Die Zeit drängt.«
Duveen hatte sich auf den Sessel beim Fenster gesetzt. Er schien nun Monsieur Georges das Reden überlassen zu wollen.
»Nehmen Sie einmal an, daß es mir ganz gleichgültig sei, ob Frankreich einen Kaiser hat oder nicht«, sagte Brown. »Weshalb verschaffen Sie sich dieses Geld nicht von einem Franzosen? Schließlich ists doch nicht meine Affäre!«
»Sie haben unsere Sache zu Ihrer Affäre gemacht!« antwortete Monsieur Georges mit einem leisen Lächeln.
»Schön. Ich gebe das Geld nicht. Das ist meine Antwort. Borgen Sie es sich von einem anderen!«
»Oh nein. Durchaus nicht!« antwortete Monsieur Georges sehr ruhig. »Wir werden es von Ihnen bekommen. Wir müssen es von Ihnen bekommen. Wir können nicht noch mehr Leute in unsere Geheimnisse einweihen. Sie haben unsere Geheimnisse kennen gelernt, und Sie müssen dafür bezahlen.«
»Müssen!« schrie Brown. »Weshalb soll ich müssen?«
»Weil Sie einer der Unsrigen sind, weil Sie sich mit uns kompromittiert haben. Und im übrigen haben Sie nicht nur sich selbst, sondern auch eine andere Persönlichkeit kompromittiert!«
»Was soll das heißen?«
»Dies: Der Marquis hat Sie und die Herzogin gestern beobachtet. Sie haben sie kompromittiert und mich beleidigt. In Frankreich gibt es dafür nur eine Sühne – Blut. In England jedoch wendet man ein anderes Heilmittel an. Da Sie ein Engländer sind und um der guten Sache willen bin ich bereit, Ihre englische Art der Sühne zu akzeptieren – Geld. Sie sehen! Da Sie das Geld unserer guten Sache nicht geben wollen, so müssen Sie es als Sühne für Ihr Liebeswerben bei der Herzogin geben!«
Brown starrte den Mann an. Die Sache entwickelte sich ja reizend. Er kam sich vor wie auf den Kopf geschlagen.
»Aber weshalb soll ich nicht um der Herzogin Liebe werben, wenn es mir so gefällt?«
Monsieur Georges ging in drohender Haltung auf ihn zu.
»Weil Sie meine Frau ist!«
»Ihre Frau! Sie sagten mir, sie sei Ihre Cousine!«
»Ist sie auch. Sie ist aber auch meine Frau, wenn wir die Tatsache auch aus politischen Gründen geheim halten.«
»Ist das wahr?« fragte Brown Duveen, und als dieser nur lächelte, murmelte er:
»Man hat mich zum Narren gehalten.«
»Wieso?« sagte Duveen. »Was ging Sie es an, ob Thérèse mit Monsieur Georges verheiratet war oder nicht? Außerdem hätten Sie es erraten müssen. Eine unverheiratete Dame hätte nicht so in Männergesellschaft verkehren können; nicht einmal in England wäre das möglich; geschweige denn hier.«
»Und«, fügte Monsieur Georges hinzu, »so müssen Sie also entweder bezahlen, oder sich schlagen.«
»Sie nehmen Geld für die Beleidigung Ihrer Frau?« höhnte Brown.
»Ich adoptiere die englische Methode. Um der guten Sache willen!«
»Und Sie werden das Geld zurückerhalten«, fiel Duveen ein. »Wir betrachten auch unter diesen Umständen die Summe natürlich nur als geliehen.«
Ein unbeschreiblicher Widerwille stieg in Brown aus gegen diese Männer, die ihn zum Narren gehalten hatten. Und er hatte ihnen sein ganzes Vertrauen geschenkt: ihnen und Thérèse! Ein Trost war ihm nur der Gedanke, daß sie ihn gewarnt hatte, sonst hätte er auch von ihr glauben müssen, daß sie nur mit ihm spielte, um ihn den Männern auszuliefern.
»Ich habe Ihrer Frau nichts getan!« sagte er trotzig.
»Nichts! Sie haben ihr von Liebe gesprochen.«
»Ich wußte nicht, daß sie Ihre Frau war.«
»Das wirft ein desto schlimmeres Licht auf Sie. Gedachten Sie etwa, sie zu heiraten? Wir Franzosen sprechen unverheirateten Damen nicht von Liebe, wenn wir sie nicht zu heiraten gedenken.«
Dieses Argument appellierte an Browns Gerechtigkeitsgefühl. Nein, die bestimmte Absicht, la duchesse zu heiraten, hatte er eigentlich doch nie gehabt. Er hatte sich einfach in sie verliebt und an zukünftige Dinge sicherlich nicht gedacht. Schon war er geneigt, nachzugeben, als sich Monsieur Georges durch seine Ungeduld alles verdarb. Er nahm, beeinflußt vielleicht durch napoleonische Traditionen – Brown beim Ohr und schrie mit bösartiger Stimme:
»Zahlen oder kämpfen!«
Brown schüttelte sich los und funkelte Monsieur Georges aus Augen an, die glänzten vor Wut …,
»Zahlen?« brüllte er. »Ich will verdammt sein, wenn ich einen Penny bezahle! Sie – Sie – ich schlage mich mit Ihnen, wann und wo es Ihnen beliebt.«
Und er riß sich den Rock vom Leibe.
Duveen starrte ihn überrascht und bewundernd an. Er war wirklich stolz auf die Schneid dieses kleinen Engländers, seines Landsmannes.
»Oh nein«, sagte er. »Ziehen Sie Ihren Rock nur wieder an; auf diese Art schlagen wir uns nicht hier, und da Sie einmal in Frankreich sind – das Sie ja so sehr lieben – so werden Sie sich schlagen müssen, wie Franzosen sich schlagen. Mit dem Degen oder mit der Pistole. Da ich der Beleidigte bin, so steht mir die Wahl der Waffen zu, und ich wähle Pistolen.«
In seinem Leben hatte Brown noch keine Pistole abgeschossen, aber das war ihm sehr gleichgültig. Er war viel zu wütend, um sich vor irgend etwas zu fürchten.
»Pistolen oder jede andere Waffe, die Ihnen beliebt –« schrie er.
»Wäre es nicht doch besser, zu zahlen, Brown?« fragte Duveen. »Unser Freund hier ist ein ausgezeichneter Schütze und tötet gewöhnlich seinen Mann.«
»Ich verzichte auf Ihre verdammten Ratschläge«, war die Antwort. »Ich habe gerade genug davon gehabt.«
»Wie Sie meinen!« sagte Duveen. »Lassen Sie uns gehen, Georges. Halten Sie sich morgen früh um sechs Uhr bereit, Mr. Brown. Ich werde Ihr Sekundant sein.«
Sie gingen, versperrten wieder die Türe und überließen Brown sich selbst und seinen Gedanken.
Zuerst war er viel zu aufgeregt und viel zu wütend, um nachzudenken. Mit Riesenschritten rannte er unaufhörlich im Zimmer auf und ab. Nach und nach aber wurde er ruhiger, und es dauerte nicht lange, so kam eine melancholische Stimmung über ihn. Er war so verwirrt und aufgeregt, daß er gar nicht imstande war, klar zu denken; er wußte eigentlich gar nicht, ob er nun im Recht oder im Unrecht war, und ob es sich nun eigentlich um die Herzogin oder um diese verdammte gute Sache handelte. Er wußte nur, daß er entweder zahlen oder sich schlagen mußte. In einem solchen Fall zahlte ein halbwegs anständiger Mensch selbstverständlich nicht. Also morgen früh um sechs Uhr würde er von einem totsicheren Schützen erschossen werden. Bon. Allright! Das ließ sich nun einmal nicht ändern. Zahlen würde er auf keinen Fall. Die Sache mußte bis zum bitteren Ende durchgeführt werden. Kam er mit dem Leben davon, so konnte er diese Leute abschütteln und ihre Geheimnisse und ihre Verschwörungen, die er nunmehr gründlichst zu hassen begann. Das bevorstehende Duell und seine verschiedenen Haßgefühle gegen Monsieur Georges nahmen ihn so in Anspruch, daß er auch nicht ein einziges Mal an Thérèse dachte. Dafür dachte er an Amelia, an seine Amelia, an seine geliebte Amelia. Sie hatte ihn schlecht behandelt, oder er hatte es sich wenigstens eingebildet, aber sie gehörte einer Welt an, die man wenigstens verstehen konnte, in der es sich leben ließ – seiner Welt. Jawohl, das gute alte England und ein englisches Mädel – das war seine Welt – wenn er diese Welt auch beinahe vergessen hatte in diesem französischen Wirrwarr.
Hm, morgen in aller Frühe fand das Duell statt. Es war doch besser, wenn er an Amelia schrieb: im Falle etwas passierte. Als seine erste Wut verflogen war, gestand er sich ganz ehrlich ein, daß er sich fürchtete. Er würde sehr viel darum gegeben haben, sich mit heiler Haut dieser Patsche zu entziehen – sehr viel Geld sogar. Nur durfte dieses Geld nicht in die großen Taschen von Monsieur Georges und in die noch größeren Taschen der guten Sache wandern. Nein, er würde sich schlagen. Um sich Mut einzuflößen und weil es den Prinzipien dieser verdammten guten Sache so wohltuend entgegengesetzt war, rief er laut ein paarmal:
»Vive la République!«
Er setzte sich hin. Je länger er über die Situation nachdachte, desto weniger gefiel sie ihm. In wenigen Stunden sollte er auf sich schießen lassen. Zwar würde auch er schießen, aber dieser Gedanke war ihm durchaus nicht so tröstlich. Der Witz war, daß man auf sich schießen lassen mußte! Monsieur Georges hätte er mit dem größten Vergnügen umgebracht …,
Endlich begann er zu schreiben:
»Meine liebe Amelia!
Ich habe ein Duell auszufechten morgen früh, und wenn Du diesen Brief erhältst, so bin ich vielleicht schon einige Stunden lang tot. Du wirst sehr überrascht sein, daß Dein Harold etwas mit einem Duell zu tun hat, aber hierzulande ist das nun einmal Sitte. Du mußt nämlich wissen, daß ich in Frankreich gewesen bin, seit ich Brixton verlassen habe. Ich sehnte mich ja so nach Frankreich, aber das Land hat auch seine Schattenseiten, und ich bin eigentlich viel länger hier gewesen, als mir lieb ist, und ich hab' leider furchtbar viel mit politischen Dingen zu tun gehabt. Dies wird Dir alles sehr sonderbar vorkommen, aber ich habe keine Zeit, es Dir eingehender zu erklären. Ich möchte ehrlich sein in diesem ernsten Moment, Amelia. Das Duell ist nicht ausschließlich das Resultat von Politik, sondern es handelt sich auch teilweise um eine Frau. Eine merkwürdige, eine wundervolle Frau, Amelia. Hoch über mir stehend im Rang, und ich will Dir gestehen, daß ich mich in sie verliebte. Im Innersten meines Herzens bin ich Dir aber treu geblieben, Amelia. Ich weiß nicht recht, ob Du das verstehen kannst, aber es ist wirklich so – wir Männer sind eben anders als Frauen, vermute ich. Wie das aber auch gewesen sein mag: ich weiß jetzt, daß ich nur Dich liebe, Amelia, und ich sende Dir meine Liebe mit meinem letzten Atemzuge (wenn ich wirklich sterben sollte). Des weiteren habe ich ein Testament gemacht. Wenn mir etwas zustoßen sollte, so bekommst Du alles. Wenn nun das Schlimmste passieren sollte, so mußt Du Dich nicht um mich abhärmen, sondern Du mußt einen guten Mann heiraten, sobald Du kannst. Und lasse ihn ja niemals ins Ausland gehen, und wenn schon, dann mußt Du wenigstens mitgehen. Ich will jetzt schließen, denn es wird mir sehr schwer, und ich brauche morgen früh meine ganze Courage. Adieu, Amelia, liebe Amelia! Dein Dich liebender
Harold.«
Brown weinte sehr, während er diesen Brief schrieb; als er ihn aber beendet hatte, war ihm viel leichter ums Herz. Seine Gedanken wandten sich von Amelia und beschäftigten sich mit Monsieur Georges. Das machte ihn so wütend, daß er sich sehr energisch auszog und sich gewissermaßen sogar auf das Duell freute. Seine Furcht jedenfalls hatte er überwunden. Eine Art fatalistischen Gleichmuts war über ihn gekommen: es war gut – wie die Sache auch enden mochte. Nach all den Aufregungen war er so müde, daß er sofort einschlief. Eine bekannte Stimme weckte ihn am frühen Morgen – Duveen stand vor seinem Bett und beugte sich über ihn.
»Sie scheinen ja sehr gut geschlafen zu haben«, sagte Duveen nicht ohne Bewunderung, obgleich es ihm gar nicht paßte, daß Brown so gefaßt schien.
Zu seiner eigenen Ueberraschung empfand Brown keine Spur von Furcht. Der Augenblick des Handelns war da und verlangte einen ganzen Mann. Und dann – Pistolen waren so etwas Einfaches. Hätte er mit dem Degen oder mit dem Säbel fechten sollen, so würde Brown sich vielleicht gefürchtet haben, denn dazu gehörten gewisse Kenntnisse. Bei der Pistole aber drückte man einfach los und verließ sich auf sein gutes Glück. Brown hatte einmal in einer militärischen Statistik gelesen, daß in modernen Kriegen auf zehntausend Schüsse nur ein einziger Feind getötet würde. Na also! Da konnte man doch einem Duell mit nur wenigen Schüssen mit ziemlicher Ruhe entgegensetzen. Jedenfalls verspürte er nicht die geringste Furcht. Er sprang aus dem Bett.
Duveen beobachtete ihn scharf.
»Ist es nicht ein fürchterlicher Gedanke, lieber Junge«, sagte er, »wenn Sie sich vorstellen, daß Sie in wenigen Minuten vielleicht eine Leiche sind – mit einem gewaltigen Loch in der Brust!«
»Jawohl«, antwortete Brown. »Und dann zieht es so unten am Strand.«
Duveen betrachtete ihn erstaunt und neugierig.
»Haben Sie auch an Ihre Lieben drüben in England gedacht?«
Brown brummte irgend etwas und putzte sich energisch die Zähne.
»Monsieur Georges schießt wie der Teufel!« fuhr Duveen fort. »Als er diente, war er der Schrecken seines Regiments.«
Brown fluchte, weil ihm beim Umbinden des Hemdkragens das Knopfloch immer wieder entwischte.
»Er schießt wie –«
»Das ist mir gleichgültig!«
»Mein lieber Junge, ich möchte Sie um alles in der Welt nicht verwundet oder gar tot sehen!« rief Duveen, und die Tränen standen ihm in den Augen. »Und es gibt so furchtbar schwere Verwundungen. Ersparen Sie sich doch dieses Furchtbare und geben Sie Monsieur Georges den Scheck! Es ist wirklich besser!«
Brown trat einen Schritt auf Duveen zu und sah ihn scharf an.
»Sagen Sie einmal, was haben Sie eigentlich im Sinn? Ich soll mich mit diesem Franzosen schlagen, und Sie geben sich offenbar die größte Mühe, mir bange zu machen. Das ist nicht sehr vornehm für einen Engländer. Ein Duell ist mir zwar etwas Neues, und mein Gegner schießt ausgezeichnet, wie Sie sagen. Nun, vielleicht ist das Glück auf meiner Seite. Und ich sage Ihnen: Ich würde diesen Scheck nicht schreiben, und wenn es nur fünf Pfund wären, anstatt dreitausend! Verstehen Sie mich jetzt?«
Duveen stöhnte.
»Ich hätte es Ihnen nicht zugetraut, Brown; ich hätte es Ihnen wahrhaftig nicht zugetraut. Hätte ich das gewußt, so würde es mir nie im Traum eingefallen sein –«
»Na, Sie brauchen doch schneidige Leute für – hm, für Ihre gute Sache und für Ihren Kaiser. Freuen sollten Sie sich!«
»Mann, weshalb haben Sie Ihren Mut nicht schon früher gezeigt!« stöhnte Duveen. »Wir dachten – nun, wir dachten, Sie würden den Scheck heute morgen nur zu gerne schreiben.«
»Das will ich nicht sagen. Wenn mir in dem Duell nichts passiert, so ist es sehr gut möglich, daß ich das Geld oder wenigstens einen Teil des Geldes doch noch zur Verfügung stelle. Aber dieser Franzose soll nicht glauben, daß ich mich vor ihm fürchte. Im übrigen hab ich Thérèse wirklich eine Liebeserklärung gemacht, und er hat ein gutes Recht auf die Knallerei.«
Duveen machte ein immer betreteneres Gesicht. Die Sache ging schief.
»Aber es schien doch, als ob Sie sich vor Monsieur Georges fürchteten.«
»Tu ich auch, offen gestanden. Und gerade deswegen schreibe ich den Scheck nicht. Aus Selbstrespekt, mein Lieber!«
Brown hatte unterdessen seine Toilette beendet und drängte zum Aufbruch, während Duveen nicht die geringste Eile zu haben und so nervös zu sein schien, als ginge nicht Brown einem Duell entgegen, sondern er selbst.
»Kommen Sie«, sagte Brown.
Duveen zögerte immer noch.
»Hören Sie einmal«, sagte er endlich, »wenn Sie also das Geld wirklich nicht hergeben wollen – zu – hm – zu schlagen brauchen Sie sich deswegen nicht!«
»Was soll das heißen?« schrie Brown und starrte Duveen an. »Was bedeutet dann diese ganze Aufregung gestern abend? War es etwa nur eine Komödie? Ich hab mirs gedacht – ich hab es mir ja gedacht. Aber da ist Thérèse. Sie wenigstens hat hoffentlich nicht Komödie gespielt; nein, dessen bin ich sicher.«
»Was – was meinen Sie mit Komödie?« stotterte Duveen.
»Eine Komödie, eine theatralische Geschichte, um Geld aus mir herauszubekommen. Sie dachten, ich würde lieber zahlen, als auf mich schießen lassen. Und als Sie und Monsieur Georges sahen, daß ich für den Kaiser kein Geld geben wollte, da brachten Sie die Geschichte mit Thérèse aufs Tapet.«
»Aber das ist ja Unsinn, Brown. Natürlich war es keine Komödie. Monsieur Georges ist einfach bereit, Ihnen die Sache mit seiner Frau zu verzeihen – um des Kaisers willen.«
»Sie meinen also –«
»Ich meine, daß Monsieur Georges vernünftig sein wird.«
»Um Entschuldigung bitte ich ihn aber nicht.«
»Hm – Sie gefallen mir wirklich, Brown. Ich – na, ich könnte Sie entwischen lassen!«
»Ich will aber nicht entwischen. Ich zahle nicht und er soll nur ruhig auf mich schießen. Mir persönlich soll es großes Vergnügen machen, auch meinerseits auf ihn zu schießen. Hoffentlich treffe ich ihn!«
Duveen verzweifelte beinahe, – jetzt wollte dieser Brown sich nicht einmal aus dem Staube machen. Noch nie hatte ihn seine Menschenkenntnis so irre geführt. Vorläufig ließ sich aber nichts weiter machen, und schweren Herzens geleitete er Brown nach unten. Monsieur Georges und der Marquis warteten schon im Wohnzimmer. Monsieur Georges ließ sich durch Browns gleichgültige Miene irre führen und rief ihm gemütlich entgegen:
»Nun, ist die kleine Affäre erledigt?«
»Den Teufel ist sie erledigt!« brummte Duveen übelgelaunt.
Beide Franzosen starrten Brown an.
»Was, er will nicht zahlen?«
»Keine Idee. Ich möchte Ihr Blut fließen sehen«, grinste Brown. Je mehr diese Leute nach seinem Gelde sich zu sehnen schienen, desto mutiger wurde er. Monsieur Georges hätte offenbar einen Scheck einem Duell vorgezogen, und es machte Brown großen Spaß, ihn zu ärgern.
»Ich will Sie nicht töten,« brummte Monsieur Georges, ein umfangreiches Lederetui vom Tisch nehmend. Er öffnete es mit gesuchter Langsamkeit und vor Browns Augen blitzten die glänzenden Läufe zweier Duellierpistolen.
»Nette Dinger, nicht wahr?« lächelte Brown und nahm eine der Pistolen in die Hand. »Sind sie geladen?« fragte er, seelenruhig auf den Marquis zielend.
»Sacré nom d'un cochon – im heiligen Namen eines Ferkels...,« rief der rotbärtige Aristokrat der unsagbaren Hosen erschrocken. »Nehmen Sie das Dings weg!«
»Allright!« grinste Brown und senkte den Lauf. »Es wäre ja auch schade, wenn ich den Falschen umbrächte.«
Er spielte noch immer mit der Pistole, als Thérèse ins Zimmer stürzte. Ihre Haare waren aufgelöst und ihre Toilette ein wenig unvollständig. Sie eilte auf Monsieur Georges zu, umschlang seinen Hals und rief weinend:
»Bring' ihn nicht um, Georges. Oh, töte ihn nicht!«
Thérèse in Tränen, Aufregung und Unterrock war nichts weniger als königlich, und ihre Schönheit litt sehr unter dem Mangel der kleinen Hilfsmittel des Toilettentischchens und der großen Hilfsmittel der Garderobe. Diese Beobachtung machte Brown ganz instinktiv, so sehr ihr Flehen für sein Leben ihn auch rührte, das er übrigens überflüssig fand. Die melancholische Schönheit war wie weggeblasen. Sie sah sehr weiblich aus, aber so gar nicht Königin. In diesem großen Augenblick, wo er sie am meisten hätte bewundern sollen, lächelte Brown fast über sie. Es war ihm so gar nicht nach Sentimentalität und Romantik zu Mute, während Thérèse und die drei Männer einen theatralischen Eindruck auf ihn machten. Wie schlechtes Melodrama.
»Dann soll er zahlen! Sonst muß das Glück der Waffen entscheiden.«
Der Marquis lachte.
»Glück! Welche Aussichten hat er in einem Duell auf Pistolen mit Ihnen!«
»Tun Sie es nicht; mein Gott, tun Sie es nicht!« flehte Thérèse Brown an. »Zahlen Sie das Geld, wenn es nicht anders geht.«
Da schlug Brown einen Ton an, den er ihr gegenüber noch nie gewagt hatte.
»Hören Sie einmal, my dear, machen Sie doch keine Szene. Es ist nicht der Mühe wert. Die Sache ist unendlich einfach. Wir gehen los und wir schießen auf einander. Er bringt mich um oder ich bringe ihn um, oder wir bringen uns gegenseitig um. Es ist ganz einfach. Und Szenen möchte ich mir verbeten haben.«
In Wahrheit war nicht nur Browns Blut in Wallung – er fühlte sich nicht nur zum erstenmal in seinem Leben als ganzer Mann, sondern es kam ihm auch so vor, als habe Monsieur Georges selbst gar keine rechte Lust, sich zu schießen. Brown war mutig, solange er einem Duell entgegenging; er wurde tollkühn, jetzt, wo das Duell sich in ein Nichts aufzulösen schien. Monsieur Georges und der Marquis sahen verlegen aus. Als ob sie nicht recht wüßten, was tun. Duveen saß niedergeschlagen da und sagte kein Wort. Es war ihm nicht nach Reden zu Mute. Der dreitausend Pfund-Scheck materialisierte sich gewiß nicht mehr, das wußte er, und das Duell, ob nun etwas aus ihm wurde oder nicht, interessierte ihn nicht im geringsten.
Diesem verlegenen Kleinmut gegenüber wurde Brown unverschämt.
»Jawohl, meine Herren,« grinste er, »es scheint mir, als begänne ich, Ihnen in die Karten zu sehen. Ich glaube nicht mehr an Ihren Kaiser noch an Ihr Schiff mit dem goldenen Adler. Sie mögen sich ja einen Napoleon auf dem französischen Thron wünschen, aber mein Scheck wäre Ihnen noch viel lieber, scheint mir.«
Kaum hatte er ausgesprochen (mit der Pistole zielte er noch immer auf den Marquis), als die Türe des Zimmers plötzlich aufgerissen wurde und sechs Gendarmen, Revolver in Händen, hereinstürzten. Einer der Gendarmen sprang auf Brown los und schlug ihm die Pistole aus der Hand. Brown war wie vom Blitz getroffen. Er schnappte nach Luft …,
Nach dem Schrecken aber faßte er sich schnell. So unangenehm die Situation auch für den Augenblick war, so schien es ihm doch ein großes Ereignis, in diese bedeutsame politische Affäre verwickelt zu sein. Er würde berühmt werden. Was für Gesichter wohl die Leute in Brixton machen würden, wenn sie in riesigen Lettern in der Daily Mail lasen:
»Die napoleonische Verschwörung von Mouleville!
Mr. Brown von Brixton verhaftet!
Mr. Brown wird auf Ehrenwort freigelassen!!«
Oho! Und Amelia! Es schien ihm nur sonderbar, daß Monsieur Georges und der Marquis und Duveen und Madame so furchtbar deprimiert aussahen. Der Marquis zitterte sogar. Das begriff Brown nicht recht. Ein politisches Vergehen war nichts Unehrenhaftes, und um einer guten Sache willen mußte man doch auch zu leiden verstehen! Die gute Sache. – Vor einem Moment noch hatte er die Ehrlichkeit dieser Männer angezweifelt. Wie leid ihm das jetzt tat!
»Hände in die Höhe!« schrie ein Herr mit einer hübschen Schärpe, der mit den Gendarmen gekommen und nicht in Uniform war. Gehorsam streckten sich drei Armpaare in die Luft, und Brown, dem ein Gendarm einen riesigen Revolver direkt vor die Nase hielt, bequemte sich nach einigem Zögern, diesem guten Beispiel zu folgen.
»Es geht nichts über eine höfliche Einladung«, grinste er.
»Taisez-vous!« rief der Gendarm.
»Was sagt er?«
»Sie sollen den Mund halten!« brummte Duveen.
»Hm.« Brown hatte französische Gendarmen für höflicher gehalten. Aber sie waren natürlich aufgeregt ob dieser wichtigen Verhaftung, und man mußte sie entschuldigen. Brown wandte sich an Monsieur Georges:
»Es tut mir außerordentlich leid, daß ich eben so scharfe und so ungerechte Worte gebrauchte …,« Aber Monsieur Georges war viel zu niedergeschmettert, um ihn zu beachten.
»Taisez-vous!« rief der Gendarm wieder.
Der Herr mit der Schärpe gab seine Befehle.
»Nous les tenons tous, et voici le chef de la bande!« rief er, Brown die Hand auf die Schulter legend.
»Was sagt er?« fragte Brown.
»Er sagt, jetzt hätte er die ganze Bande erwischt, und Sie seien der Anführer,« übersetzte Duveen lachend, aber mit einem Lachen, in dem kein rechter Humor lag.
Es schien Brown, als erwiese man ihm allzuviel Ehre. Der Anführer war er doch bestimmt nicht. Und diese französischen Gendarmen benahmen sich wirklich brutal politischen Gefangenen gegenüber. Es tat ihm wohl, daß wenigstens Thérèse mit einiger Höflichkeit behandelt wurde.
»Si Madame veut bien se retirer faire sa toilette, nous l'attendrons ici,« sagte der Herr mit der Schärpe.
Brown verstand ganz gut, was er meinte. Einer der Gendarmen geleitete Thérèse aus dem Zimmer. Schweigend warteten die anderen Gefangenen und die Männer des Gesetzes lange Zeit, denn Madame schien sich nicht besonders zu beeilen. Endlich kam sie wieder – königlich wie immer; mit eher noch röteren Lippen und noch größerer Würde als sonst. So gleichgültig und so geheimnisvoll sah sie aus, wie an jenem Abend, da Brown sie zuerst im Kasino gesehen hatte.
»Allons!« befahl der Herr mit der Schärpe, und zu Browns großer Ueberraschung und noch größerer Entrüstung begannen die Gendarmen ihre Gefangenen zu fesseln.
»Confound you!« brüllte Brown den Gendarmen an, der sich anschickte, ihn zu fesseln.
»Taisez-vous,« brummte dieser nur und ließ die Handschellen einschnappen. Ein anderer Gendarm faßte Thérèse am Handgelenk.
Da fiel Brown eine französische Geschichte ein, die er einmal in der Schule gelesen hatte, und er rief in großartigem Ton:
»Monsieur, je vous donne ma parole!«
»Faites pas des manières,« brummte der Gendarm.
Dabei gab er Brown einen gehörigen Puff, wahrscheinlich, um ihm auf den Weg zu helfen, und der Zug setzte sich in Bewegung. Das Paket, das auf dem Tisch lag, nahmen die Polizisten mit. Vorher aber durchsuchten sie das Haus und die Gefangenen gründlich. Einer von ihnen bemerkte an Browns Finger den Ring des Getreuen, den ihm Duveen tags vorher mit so schönen Worten überreicht hatte, riß ihn herunter und zeigte ihn aufgeregt den andern. –
»Der Ring …,« begann Brown.
»Taisez-vous!«
Die Polizei kannte offenbar den Ring und seine Bedeutung! Brown ahnte, daß dieser Ring ein recht unangenehmes Beweismittel gegen ihn sein würde, und fing an, nervös zu werden. Immerhin, sagte er sich, so sehr schlimm konnte die Geschichte nicht werden. Besonders nicht für ihn, der er ein Ausländer war und sich mit der eigentlichen Verschwörung doch kaum besaßt hatte.
Jedenfalls war es sehr unangenehm, das Haus des Marquis mit Handschellen an den Gelenken verlassen zu müssen, mit einem Gendarmen zur Seite, der den armen Brown fest am Kragen gepackt hielt. Brown konstatierte mit einigem nationalen Stolz, daß englische Polizisten doch bessere Menschen waren. Die hätten politische Gefangene nicht so behandelt! Draußen auf der Straße hatten sich viele Neugierige angesammelt, die den Gefangenen allerlei Unhöflichkeiten zuriefen, während sie zu den Wagen gebracht wurden. Brown verstand nicht alles, aber was er verstand, genügte ihm vollkommen. Welch ein verächtliches Ding doch ein neugieriger Straßenmob war! Wäre die Verschwörung erfolgreich gewesen, so hätten diese Menschen wahrscheinlich mit voller Lungenkraft gebrüllt:
»Vive l'empereur!«
Ein sehr kleiner und sehr schmutziger Junge warf einen Stein, der Brown am Arm traf. Brown strafte ihn mit einem würdevollen Blick, der jedoch bei den Neugierigen nur ein dröhnendes Gelächter auslöste. Nun aber wurde die Haltung der Menschenmenge so drohend, daß Brown froh war, als der Gendarm ihn in den Wagen stieß. Es schien Brown jetzt, als wären diese Leute nicht müßige Neugierige, sondern politische Demonstranten gegen die gute Sache. Wie hatten sich seine Freunde doch getäuscht! Petite Mouleville wäre entschieden der denkbar ungeeignetste Platz für die Landung des Prinzen gewesen.
Die Pferde zogen an.
Erst jetzt bemerkte Brown, daß Thérèse im gleichen Wagen mit ihm war. Darüber freute er sich. Es erinnerte ihn an ein sehr bekanntes Bild einer Szene aus der französischen Revolution. Sie saß ihm gegenüber: hochmütig, stolz, entschlossen – sie benahm sich weit besser und würdevoller, so schien es ihm, als die Männer. In ihm erwachte wieder die Bewunderung, die er ihr einst gezollt hatte. So mochten einst in jenen historischen Zeiten edle Damen zum Schafott geschritten sein. Trotzdem war es ihm ein angenehmes Bewußtsein, daß in dieser speziellen Affäre vom Schafott keine Rede sein konnte. Es war doch besser so. Ihm persönlich stand ja wahrscheinlich nur ein (allerdings höchst ungemütliches) Interview mit dem englischen Konsul und eine gesalzene Geldstrafe bevor. Hoffentlich würde es auch Thérèse nicht schlimmer ergehen. Er freute sich sehr, daß er die dreitausend Pfund nicht hergegeben hatte. So wie die Dinge standen, hätte das Geld ja der guten Sache doch nichts genützt und die Tatsache, daß es von ihm stammte, wäre nur ein neuer Beweis zu seinen Ungunsten gewesen.
Thérèse nahm nicht die geringste Notiz von ihm. Die Gendarmen plauderten miteinander, würdigten aber Brown keiner Antwort, wenn er Fragen stellte. Seiner Ansicht nach hätten sie wirklich um eine Schattierung höflicher sein können. Die Straße machte eine scharfe Biegung, und Brown konnte den vorausfahrenden Wagen sehen. Auf dem Bock saß ein Gendarm! Dieser Gendarm führte ihm das Entwürdigende seiner Lage so recht zum Bewußtsein; es war ihm unbeschreiblich unangenehm, auf diese Weise in Mouleville einzuziehen. Wenn nur die Leute vom Hôtel des deux Globes ihn nicht sahen! Wenn er auch nur ein politischer Gefangener war, so begegnete er den Whites doch lieber erst dann, nachdem die französischen und die englischen Zeitungen diese Tatsache gehörig hervorgehoben hatten. Menschen denken so leicht das Unrichtige. Von Mr. White zum Beispiel für einen gewöhnlichen Taschendieb gehalten zu werden, wäre ihm direkt peinlich gewesen.
Als aber der Wagen die Promenade entlang rollte und in die Nähe des Hôtel des deux Globes kam, wurde Brown doch neugierig und beugte sich vor. Richtig – da stand Mr. White im Hoteleingang und zeigte zwei erstaunten Touristen, welche Jongleurmöglichkeiten in einem Teller, einem Wasserglas und einem Apfel lagen. Miß Fiddle stand als pflichtgetreue Tochter daneben und bewunderte ihren Papa. Und gerade als der Wagen mit den Gendarmen und ihrem Fang vorbeifuhr, sah Mr. White auf und erkannte Brown – – –
Der Teller und das Wasserglas fielen zu Boden und gingen in Scherben; der Apfel plumpste einem der Touristen auf den Kopf. Es war ein fürchterlicher Moment für Brown.
»Er wird ja in den Zeitungen lesen, um was es sich handelt«, tröstete er sich aber. »Was er sich wohl gedacht haben mag? Vielleicht kommt er als Engländer mir zu Hilfe!«
Der Wagen fuhr am Kasino vorbei, kreuz und quer durch alle möglichen Straßen, aus der Stadt hinaus, und hielt endlich vor einem düsteren, von hohen Mauern umgebenen Gebäude. Brown brauchte sich den Kopf nicht zu zerbrechen, um zu erraten, daß dies das Gefängnis von Mouleville sein müsse. Der Wagen fuhr durch das Portal und hielt. Brown wurde zu der einen Tür hinausexpediert, Thérèse zu der anderen. Beim Aussteigen sagte sie leise zu ihm: »Pauvre petit!« – die ersten Worte, die sie seit der Verhaftung gesprochen hatte.
Brown wurde in ein kleines Zimmer geführt und einem Inspektor gegenübergestellt. Die geflüsterte und sehr rasch gesprochene Meldung der Gendarmen konnte Brown nicht verstehen, las aber aus dem zufriedenen Kopfnicken des Beamten, daß dieser ihn als einen sehr guten Fang zu betrachten schien. Nach einigen Minuten wurde Brown in ein anderes Zimmer gebracht, wo ein Mann an einem Tischchen saß, auf dem verschiedene Instrumente und ein Metermaß lagen. Das Gemach erinnerte Brown lebhaft an eine Folterkammer, und er schauderte. Schon jetzt fing er an, das Gefängnis zu hassen.
»Déshabillez vous«, befahl der Mann barsch.
»Mais –«
Aber schon hatten die beiden Gendarmen, die ihn begleiteten, ihm den Rock heruntergerissen, und es blieb ihm nichts anderes übrig, als zu gehorchen. Es war ihm furchtbar peinlich, sich auf Kommando und in Gegenwart von Gendarmen auskleiden zu müssen, und er erinnerte sich mit Entsetzen daran, daß in seinem linken Strumpf ein großes Loch war. Als Brown endlich splitternackt dastand, brachten ihn die beiden Gendarmen in die Meßpositur: gerade Haltung, gespreizte Beine, in die Höhe gestreckte Arme!
Eine Viertelstunde lang maß ihn der Mann mit allen möglichen Instrumenten und schien sehr unzufrieden zu sein, daß Browns Haut keinerlei besondere äußerliche Merkmale zeigte. Während der ganzen Prozedur platzte Brown beinahe vor Wut. Am meisten ärgerte es ihn, daß nicht einmal die Gendarmen den geringsten Respekt vor ihm zu haben schienen. Er wurde hin und her gedreht, auf den Rücken geklopft, angeschnauzt, als sei er der gewöhnlichste aller Diebe und Vagabunden. Keine Spur von jener Höflichkeit, die er erwartet hatte, und auf die er als politischer Gefangener Anspruch zu haben glaubte.
Endlich war der Mann mit seinen Messungen fertig, und Brown wurde in eine Zelle gebracht. Mit einiger Schwierigkeit brachten ihm die Gendarmen bei, daß er am nächsten Tage dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden würde, und daß ihm bis dahin kein Rechtsmittel zur Verfügung stünde. Sie boten ihm jedoch an, ihn statt der Gefängniskost mit Essen aus einem Hotel zu versorgen, wenn er dafür bezahle. (Die Summe, die sie forderten, war unverschämt hoch.) Brown hatte zwar keinen Hunger, aber er dachte, es würde einen guten Eindruck machen, wenn er um seine Mahlzeit besorgt schien, und bestellte sich ein ausgiebiges Diner. Als es kam, fand er es miserabel, und sein sowieso geringer Appetit verschwand gänzlich. Er ließ die Speisen unberührt stehen. Als jedoch der Gefängniswärter kam, um die Schüsseln wieder wegzunehmen, bedankte er sich bei ihm mit großer Liebenswürdigkeit für seine Mühe. Als politischer Gefangener mußte man doch einem Gefängniswärter gegenüber von vornehmer Liebenswürdigkeit sein! Vielleicht war der Mann selber Imperialist.
Mr. Brown von England verbrachte eine schauderhafte Nacht. In Frankreich schlummerte ein politischer Gefangener wirklich nicht auf Rosen. Sondern auf einem fürchterlich harten Strohsack – – –