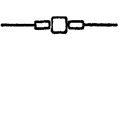|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Man sieht dem Prinzen Napoleon ähnlich und hat Unannehmlichkeiten. Man lernt Frankreich immer besser kennen! Man erinnert sich liebevoll an Amelia, allerdings auf einem kleinen Umweg.
An der Straßenecke stand ein verdächtig aussehendes Individuum. Brown, der sich merkwürdig geächtet vorkam, stieg also schleunigst in den Wagen. Ein Stoß, den Monsieur Georges ihm gab, half ihm erheblich beim Einsteigen. An seiner Seite saß Thérèse und Duveen setzte sich ihm gegenüber, während Monsieur Georges neben den Kutscher auf den Bock sprang; die Peitsche klatschte auf die Pferde nieder und der Wagen sauste davon. Sie fuhren durch die Stadt dem Strande zu, und als sie zum Kasino kamen (das Brown mit sehnsüchtigen Augen betrachtete), bog der Wagen nach links ein und fuhr die Promenade entlang.
Das Hôtel des deux Globes kam in Sicht. Brown sah Miß Fiddle und einen Herrn im Hoteleingang stehen, die beide mit bewundernden Blicken Mr. White zusahen, der emsig damit beschäftigt war, auf dem Rande eines Weinglases ein Fünffrancsstück zu balancieren. Duveen lehnte sich tief in die Kissen zurück, um nicht erkannt zu werden. Brown war zuerst sehr überrascht, daß Mr. White und Miß Fiddle, die den Wagen neugierig betrachteten, so gar keine Notiz von ihm nahmen, bis ihm einfiel, daß er ja verkleidet war. Verkleidet! Wie hell und froh die Promenade doch aussah im Sonnenlicht und wie lustig und fröhlich die müßigen Spaziergänger! Wie wenig ahnte doch Mouleville, das einfache Mouleville, die dunklen Intrigen, die sich im Städtchen abspielten – die weltgeschichtlichen Ereignisse, die hier vorbereitet wurden! Diese harmlosen Menschen lebten nur für den Tag. Brown dagegen, so sagte er sich mit einiger Bitterkeit, lebte nur für andere augenblicklich, und seine Tage waren nicht sehr erfreulich. So gar nicht wie Ferien. Es war ja sehr schön, für andere zu sorgen; aber Brown hätte sich doch lieber persönlich amüsiert.
Er sah Therese an. Sie saß da, mit unendlich gleichgültiger Miene, in die Kissen zurückgelehnt. Ihr Gesicht war ausdruckslos wie eine Maske, ausdruckslos in jener ihr eigenen tiefgründigen Stille, die ein unlösbares Rätsel aufzugeben schien. Diese starre Stille war es, die Mr. Brown von England am meisten an ihr bewunderte. In gleicher majestätischer Ruhe wäre sie zum Schaffot geschritten, darauf hätte er geschworen – wie jene großen Damen der Revolution. Und wenn der Henker den vom Rumpfe getrennten Kopf dem Volke gezeigt hätte, dann wäre sicherlich noch immer das starre Lächeln auf den Lippen gewesen, als sei die Kleinigkeit des Sterbens nicht wert, die exquisite Ruhe einer großen Dame zu stören. In Wahrheit, sie war ein wundervolles Weib und seiner grenzenlosen Bewunderung wert. Also sagte sich Brown.
Man merke: selbst ein alltäglicher Werdegang wie derjenige eines strümpfeverkaufenden Verkäufers des Emporiums zu Brixton schließt todernste Romantik nicht aus …,
Mr. Brown von England war traurig; sein Herz war ihm schwer, denn er verließ ja das lustige Städtchen wie ein Flüchtling. Fast wären ihm die Tränen in die Augen gekommen; er brauchte eine liebe, tröstende Hand, um sein schweres Los ertragen zu können – er brauchte sie furchtbar notwendig. Ganz langsam und ganz vorsichtig, mit einem scheuen Seitenblick auf Duveen, ließ er seine Hand sinken. Und diese Hand stahl sich weiter auf den Wagenkissen, bis sie ein feines, behandschuhtes Händchen berührte. Sie duldete es. Seine Finger schlossen sich um die ihrigen und ihm war, als fühle er einen leisen Gegendruck (vielleicht war es aber auch nur das Rütteln des Wagens). Der Wagen fuhr den Hügel hinauf und Hand in Hand saßen sie da.
Da war Mr. Brown von England glücklich.
Er würde sie augenblicklich zu seiner Kaiserin gemacht haben, wäre er wirklich Napoleon gewesen. Oben auf dem Hügel hielt der Wagen und Monsieur Georges schlug das Verdeck zurück. In dem Augenblick, als er den Schlag öffnete, ließ Brown das Händchen neben ihm übrigens prompt los.
»Sind bald da«, brummte Monsieur Georges.
»Allez donc, cocottes!« munterte der Kutscher seine Pferde auf und der Wagen fuhr weiter. Brown ärgerte sich, daß derartige Ausdrücke in Gegenwart einer Dame gebraucht wurden: denn jetzt verstand er diese Phrasen – er hatte sie ja im Café hunderte und aberhunderte Male gehört. Er sagte aber nichts – –
Und der Wagen fuhr weiter. Brown sah sich um. Unten im Tal lag Mouleville. Die zierlichen Minarets seines Kasinos funkelten und strahlten im Sonnenlicht. Und die Häuser dort im Vordergrund, halb verborgen zwischen den Felsen – das war Petite Mouleville, das kleine Brüderchen des größeren Bades, das die Flüchtlinge aufnehmen sollte. Monsieur Georges zündete sich eine Zigarette an und reichte das blaue Päckchen den andern hinüber, die seinem Beispiel folgten. Thérèse ließ sich von Brown Feuer geben. Monsieur Georges versuchte, eine Unterhaltung mit ihm anzufangen, aber Brown gab nur kurze Antworten.
Tiefernst war er und traurig und niedergedrückt, denn es überschlich ihn wie eine Vorahnung großer Ereignisse. Außerdem empfand er es sehr unangenehm, daß Monsieur Georges in den Wagen gestiegen war und er Thérèses Hand nicht mehr halten konnte!
Der Wagen näherte sich dem kleinen Bad zwischen den Felsen, Petite Mouleville war in jeder Beziehung ein schwacher Abklatsch des größeren Mouleville: die billige Ausgabe eines Buches, mit undeutlichen Lettern auf schlechtem Papier gedruckt; ein jüngeres Brüderchen, das gravitätisch die ihm viel zu weiten abgelegten Kleider des großen trägt und sich dabei unendlich wichtig und gewachsen vorkommt. Petite Mouleville gab sich furchtbar Mühe, so vornehm zu sein wie Mouleville selbst; aber es gelang ihm nicht recht. Während der Wagen durch die Gassen dahinrollte, konstatierte Mr. Brown mit großem Vergnügen, wie unbeschreiblich komisch die Talmi-Eleganz des kleinen Mouleville war. Es wollte so gerne lustig und froh erscheinen; aber es war eine Lustigkeit dritten Ranges und ein gedrücktes Frohsein. Das bescheidene Kasino erinnerte ihn lebhaft an Jahrmarktsbuden, und dabei waren diese Buden offenbar auch noch sehr reparaturbedürftig. Die Leute auf den Straßen taten ihr Bestes, fröhliche Badegäste zu scheinen, aber sie hatten etwas Kleinliches, etwas Unwahres, als spielten sie eine Rolle, die ihnen in Wirklichkeit gar nicht lag. Nett waren nur die vielen Kinder, die am Strande spielten und sich balgten; sie wenigstens schien der Schatten des nahen Großen Mouleville nicht zu bedrücken.
Endlich hielt der Wagen vor einem Haus am unteren Ende der schmutzigen, schlecht gepflasterten Promenade. Es war ein bescheidenes Häuschen. Zwischen ihm und den andern Häusern der Straßenseite gähnte ein leerer Raum, ein mit allerlei Gerümpel angefüllter Bauplatz, und so sah es aus wie ein einsamer Wachtposten, der es müde war, auf stiller Wacht zu stehen und sich gar zu gerne seinen Kameraden wieder beigesellt hätte. Nein, das Häuschen hatte nichts Einladendes. Dagegen bemerkte Mr. Brown mit großer Genugtuung ein kleines Café im Hintergrund, in dem er zweifellos wirkliches französisches Leben des weiteren studieren und sich an dem bewußten grünen Opalgetränk des ferneren begeistern würde.
Ein Mann trat aus dem Haus und begrüßte Monsieur Georges. Er trug eine blaue Bluse, die der liebevollen und gründlichsten Dienste einer Waschfrau sehr zu bedürfen schien, enorme sabots und Hosen, die vor vielen Jahren kariert gewesen sein mußten. Jetzt ahnte man das Muster nur noch – aber es gehörte kein geringes Ahnungsvermögen dazu. Sein Kopf war kahl und blank wie ein Billardball. Wie um ihn für diesen Mangel zu entschädigen, hatte eine gütige Natur den unteren Teil seines derben Gesichts mit einem wuchernden Wuchs roter Haare ausgestattet; mit einem solch fürchterlichen Bart, daß Brown ihn immer wieder betrachtete, denn er konnte den Verdacht nicht los werden, daß dieses Ungetüm ebenso falsch sein mußte, wie sein eigener Schnurrbart. Es war aber nicht falsch. Es kam ihm auch ein wenig sonderbar vor, daß alle diese Anhänger Napoleons so merkwürdig gewöhnlich aussahen! Diese vornehmen Patrioten steckten wirklich in merkwürdig rauhen Schalen! Nur Madame sah aristokratisch aus. Vielleicht auch Monsieur Georges. Dann hörte es aber auf.
Thérèse stieg aus dem Wagen, nickte dem Mann mit dem roten Bart zu und trat in das Haus. Sie schien nicht zum erstenmal hier zu sein.
»Der Marquis de Saint Malo!« stellte Duveen vor.
Der rote Mann machte eine linkische Verbeugung und packte Browns arme Hand mit einem Händedruck, in den er die kombinierten Kräfte einer ganzen Reihe von Vorfahren hineingelegt haben mußte. Mr. Brown von England quietschte leise auf, und die Augen traten ihm beinahe aus den Höhlen. Also dieses Räubergesicht mit dem Fuchsbart war das edle Antlitz eines Marquis! In Frankreich mußte man doch wirklich furchtbar vorsichtig sein, die Leute ja nicht nach Aeußerlichkeiten zu beurteilen. Diese Hosen! Aber Brown erinnerte sich dunkel daran, daß in England die Sage ging, wirkliche Aristokraten seien stolz auf ihre Verachtung aller Aeußerlichkeiten. Trug nicht King Eduard seit vielen vielen Jahren immer die gleiche abgenützte alte Jacke, wenn er in Sandringham auf die Jagd ging? Brown wurde fast gerührt. Wie charakterfest und treu doch diese Männer vom Verband zur Wiederherstellung des Kaiserreichs waren! Ein Marquis – der sich damit begnügte, in diesem Rest zu leben, und der höflich den Wagenschlag öffnete, als sei er es nicht anders gewöhnt.
»Ein Marquis?« fragte Brown Duveen, um seiner Sache sicher zu sein. Er wollte niemand beleidigen; ja keinen Anstoß geben. Vielleicht hatte er nicht richtig verstanden und der Rotbärtige mit den unmöglichen Hosen war sogar ein Graf.
»Marquis de Saint Malo!« antwortete Duveen. »Begeisterter Anhänger Napoleons. Hat sich ruiniert für die gute Sache.«
Schon wieder einer. Brown fing langsam an, der Aristokraten müde zu werden, die sich für die gute Sache ruiniert hatten; er hätte so gerne einmal ein Verbandsmitglied gesehen, das Geld hatte. Nur zur Abwechslung!
Duveen und Brown traten in das Haus, während der Marquis Saint Malo und Monsieur Georges sich in das kleine Café am Ende der Straße begaben. Sie schienen gute Freunde zu sein, denn Brown hörte, wie sie auf dem Wege fortwährend lachten – sehr laut lachten …,
Browns Zimmer lag ganz oben unter dem Dach. Von dem Fenster hatte man eine wundervolle Aussicht auf das Meer und den Hauptplatz des geschäftigen kleinen Mouleville. In der Ferne konnte man Mouleville selbst sehen: nebelhaft jedoch, undeutlich, ein schwarzer Fleck in der langen Küstenlinie. Duveens Zimmer lag neben seinem eigenen, während die Appartements, die Madame de Mérac bewohnte, einen Stock tiefer lagen. Monsieur Georges hatte ein Zimmer im Erdgeschoß. So sagte Duveen.
»Wie lange werden wir hier bleiben?« fragte Brown.
»Höchstens zwei oder drei Tage. Wir sind fast am Ziel. Der große Augenblick ist da.«
»Wieso denn? Was ist da?«
»Aber verstehen Sie denn nicht? Ahnen Sie nichts?« fragte Duveen ungeduldig. »Erraten Sie wirklich nicht, weshalb wir hierhergekommen sind?«
»Um die Geheimpolizisten los zu werden!«
»Auch das. Zum Teil wenigstens. Aber deshalb hätten wir doch nicht gerade in dieses Nest zu gehen brauchen. Nein, wir kamen deshalb nach Petite Mouleville, weil – –«
»Well??«
»– weil der Kaiser hier landen wird und wir ihn empfangen werden.«
Brown fiel beinahe auf den Rücken vor Ueberraschung. Also das war es! So nahe war dieses weltgeschichtliche Ereignis! Und er sollte dabei mitwirken dürfen. Es war wunderbar – –. Doch Brown war ein kühl denkender Geschäftsmann, gewöhnt, beide Seiten einer Proposition ins Auge zu fassen.
»Wenn er aber nicht kommt?« fragte er.
»Dann gehen wir wieder nach Mouleville zurück. Sollte die Verschwörung entdeckt werden, so werden wir uns trennen und uns in Paris wieder treffen.«
Brown machte ein mißvergnügtes Gesicht.
»Es ist doch sehr leicht möglich, daß die Sache schief geht. Und ich kann doch nicht in alle Ewigkeit in Frankreich bleiben; meine Ferien sind sehr bald zu Ende.«
»Ferien? Aber Sie sind doch ein freier Mann? Sie sind doch nicht an eine bestimmte Zeit gebunden?«
»Well, in gewisser Beziehung doch. Meine Geschäfte verlangen meine Anwesenheit,« erklärte Brown ausweichend. Seine Herkunft von Brixton und seine Stellung im dortigen Emporium hatte er sehr sorgfältig vor Duveen verheimlicht: aus Eitelkeit einerseits, dann aber auch aus einer gewissen echt englischen Zurückhaltung heraus.
»Wenn wir jedoch erfolgreich sind, kann ich vielleicht noch einige Zeit hierbleiben,« fügte er hinzu.
Jawohl, das war eine sehr gute Idee. Dann mochte das Emporium ruhig noch ein bißchen warten. Nach all diesen Umständlichkeiten und diesem Aerger würde es wirklich sehr hübsch sein, als Gentleman der Kammer und Page der Toilette sich einmal ein wenig in höfischem Glanz zu sonnen.
»Hoffentlich wird es kein Blutvergießen geben?« fragte Mr. Brown weiter.
»Vielleicht doch, ein wenig. Aber ich kann Ihnen versichern, daß das französische Volk sich geradezu nach dem Kaiser sehnt. Es wird eine unblutige Revolution werden – oder doch zum mindesten eine fast unblutige.«
Well, das begriff Brown. Kämpfe waren in solchen Fällen ja gewöhnlich nicht zu vermeiden. Nur würde es hoffentlich nicht sein Blut sein, das der großen Umwälzung die notwendige rote Koloratur gab. Im übrigen war er über die Aussicht, einer der ersten sein zu dürfen, die dem neuen Kaiser der Franzosen ein Willkommen zuriefen, so aufgeregt, daß er auch gerne ein bißchen Risiko mit in den Kauf nahm.
»Ich hätte nie gedacht, daß ich etwas so Großes erleben würde,« rief er strahlend.
»Nicht wahr!« antwortete Duveen ein wenig trocken. »So etwas passiert auch nicht alle Tage!«
»Und was wird Ihnen die Umwälzung bringen?«
»Das weiß ich noch nicht. Sehr viel Geld! Ehren!« antwortete Duveen ausweichend.
Natürlich. Geld! Ehren! Brown hatte nichts anderes erwartet. Er kannte Duveen nachgerade gut genug, um ganz genau zu wissen, daß dieser in Frankreich lebende Engländer bestimmt nicht nur für irgend jemands schöne Augen arbeitete, und wenn dieser Jemand auch ein Kaiser war. England – –. Es wurde Brown auf einmal sehr ungemütlich zu Mute.
»Sagen Sie 'mal, ich – ich begehe doch keinen Verrat gegen England, wenn ich an dieser – an dieser Geschichte teilnehme?«
»Aber keineswegs! Wieso denn, du meine Güte? Dies ist eine interne französische Affäre, die Großbritannien nicht im geringsten berührt. Und im übrigen werden sich die Weltmächte, auch England, außerordentlich freuen, wenn Napoleon Kaiser wird. Natürlich müssen wir sehr vorsichtig sein in unseren Arrangements und für alles sorgen. Es würde sehr unangenehme Folgen für uns alle haben, wenn die Sache fehlschlüge. Sie begreifen: Wir dürfen das Schiff nicht zu Grunde gehen lassen, weil die Lotsengebühren ein bißchen Geld kosten!«
»Hm!« brummte Brown. Das war nun wieder solch eine unangenehme Andeutung! Er beschloß prompt, sie zu überhören. »Aber Sie sind doch so gering an Zahl für solch ein Unternehmen!«
»Sie haben ja nur wenige unserer Mitverschworenen kennen gelernt! Und Sie glauben doch nicht etwa, daß wir allein stehen? Mann, Frankreich ist übersät von unseren Brüdern. Wenn der Augenblick zum Losschlagen da ist, wird eine Armee dastehen. Unsere Pläne sind bereit und bis in die kleinsten Einzelheiten ausgedacht. Die Frage ist nur, ob auch andere so treu ihre Pflicht tun wie wir.«
»Andere?«
»Man sollte niemals auf Fürsten bauen …,« orakelte Duveen geheimnisvoll. (Er war des anstrengenden Lügens schon wieder müde.) »Ah – weg mit den Sorgen, mein lieber Brown. Lassen Sie uns hinüber ins Café gehen. Sie wissen ja: Wein, Weib, Gesang!«
»Absinth, die schöne Therese und Monsieur Georges Gebrumm,« dachte Brown. Nun, etwas Begeisternderes als Absinth und etwas Entzückenderes als Thérèse konnte man sich ja wirklich nicht wünschen. Monsieur Georges freilich hätte er gerne dispensiert.
Ehe man ging, bat Brown, den Schnurrbart abnehmen zu dürfen, was Duveen nach einigem Widerstreben auch bewilligte …, Die Operation war nicht ganz einfach und entschieden nicht schmerzlos. Wie dieser Gummi klebte! Es machte einige Schwierigkeiten, das Falsche vom Echten zu scheiden, und Browns armer kleiner Schnurrbart mußte dabei Haare lassen. Er stöhnte sehr. Wenn Schauspieler sich ihre falschen Bärte auch mit solchem Gummi ankleben mußten, dann taten ihm diese Schauspieler wirklich leid. Endlich jedoch war das Ungetüm entfernt. Als Brown sich im Spiegel beguckte, kam er sich mit seinem bescheidenen Schnurrbärtchen auf einmal merkwürdig nackt vor. Es war so klein. So winzig. So bescheiden. Er wäre Therese doch lieber wieder mit dem falschen Schnurrbart gegenübergetreten. ..
Im Café fanden sie Monsieur Georges und Thérèse zusammen mit dem Marquis de Saint Malo an einem Tischchen sitzen. Der Marquis betrachtete sich Brown sehr genau und eingehend. Als schätze er ihn ab!
Langsam tröpfelten die Wassertropfen auf den geheimnisvollen grünen Saft und langsam verwandelte sich Grün und Wasser in wolkiges Opal. Es war Brown jetzt schon zur Gewohnheit geworden, des Nachmittags Absinth zu trinken, wenn er ihm auch freilich so schöne Träume nicht mehr bescherte. Doch regte er gewaltig an und warf noch immer ein Rosenmäntelchen über die Welt und die Dinge und die Menschen. Brown hatte sich Therese gegenübergesetzt. Wie eine Königin sah sie aus und immer mehr wie eine Königin wurde sie, je mehr Browns Glas sich langsam leerte. Duveen sah, wie Browns Augen glänzten.
»König Absinth macht das Herz schneller schlagen! Nicht wahr?« sagte er lachend. Und Brown errötete.
Es dauerte nicht lange, so stand Monsieur Georges auf und verabschiedete sich. Er habe eine wichtige Verabredung. Thérèses Augen folgten ihm, als er das Café verließ.
»Wohin geht er?« fragte Brown.
»Den Wagen bestellen. Um nach Mouleville zurückzufahren,« antwortete Duveen. »Wir müssen mit unseren Freunden dort in Fühlung bleiben. Monsieur Georges und ich fahren heute nacht nach Mouleville; morgen früh kommen wir wieder zurück.«
Duveen und Monsieur Georges gingen nach Mouleville und Brown blieb allein mit Thérèse! Sein Herz hüpfte in ihm vor Freuden. Wunderbar! Wonnevoll! Solches Glück hatte er nicht erhofft! Aber seine Freude wurde wesentlich gedämpft, als ihm einfiel, daß ja der Marquis da sein würde und auf ein Alleinsein mit Thérèse also doch nicht zu rechnen war. Der Marquis gefiel Brown überhaupt nicht, von seinem störenden Charakter als voraussichtlicher Dritter ganz abgesehen; der riesige rote Bart war so unaristokratisch. Blutdürstig sah er aus. Jawohl. Thérèse kümmerte sich zwar, wie der Augenschein lehrte, nicht im geringsten um diesen rotbärtigen Marquis, und so würde sich heute abend vielleicht doch endlich einmal die Gelegenheit ergeben, mit ihr zu sprechen. Denn wenn Monsieur Georges da war, verwandte sie ja kein Auge von diesem – weil er ihr Vetter war, wahrscheinlich …,
»Sie werden sich nicht langweilen, mein lieber Brown, wenn wir auch fort sind,« sagte Duveen. »Die Herzogin und Saint Malo werden Ihnen beim Diner Gesellschaft leisten. Ja, und morgen müssen Sie schon so liebenswürdig sein und recht früh aufstehen und Ausguck halten.«
»Ausguck halten?« fragte Brown sehr erstaunt.
»Freilich – Ihr Zimmer ist ja das Ausguck-Zimmer. Sobald Sie erwachen morgen früh, jedenfalls aber von sechs Uhr ab, müssen Sie von Ihrem Fenster aus Ausguck halten. Es ist anstrengend, aber – bedenken Sie: Gentleman der Kammer und Page der …,«
»Ja, ja«, sagte Brown hastig. »Ich weiß schon. Aber nach was soll ich denn Ausguck halten in Kuckucksnamen?«
»In Ihrem Schrank werden Sie einen ausgezeichneten Feldstecher finden. Durch dieses Glas beobachten Sie, bitte, sorgfältig die einlaufenden Schiffe. Das Schiff, das wir erwarten, ein kleiner Dampfer, wird eine Flagge mit einem goldenen Adler führen.«
»Und Napoleon wird an Bord sein?«
»Jawohl«, sagte Duveen gerührt.
»Und was soll ich tun, wenn ich das Schiff sehe?«
»Hinunterlaufen und es dem Marquis melden.«
»Schön.«
»Können wir uns in dieser wichtigen Angelegenheit auf Sie verlassen? Wir selbst werden alle Hände voll Arbeit haben.«
»Jawohl. Aber hoffentlich sind Sie schon wieder zurück von Mouleville, wenn der Dampfer kommt.«
»Er wird nicht einlaufen, ehe wir ihm signalisieren.«
»Ach so. Aber sagen Sie einmal, ist es nicht recht ungeschickt, daß der Dampfer Napoleons eine so auffällige Flagge führen soll? Damit läßt man doch die Katze sofort aus dem Sack!«
»Sie sind schon ein richtiger, vorsichtiger Verschwörer geworden, mein Junge. Aber wissen Sie, es wäre unter des zukünftigen Kaisers Würde, nicht unter seiner eigenen Flagge zu segeln. Und dann hat ja kein Mensch in Petite Mouleville eine Ahnung von den kommenden Ereignissen und niemand wird Ausguck halten als Sie, mein Junge.«
Duveen schüttelte Browns Hände, klopfte dem Marquis vertraulich auf den Rücken, nahm den Hut vor Thérèse ab, die mit einem kaum merkbaren Nicken dankte, und ging fort, um sich mit Monsieur Georges zu treffen. Brown hoffte sehr, Thérèse würde da bleiben, aber plötzlich sprang sie auf und eilte zur Türe hinaus. Sie hatte den Wagen vorfahren hören. Brown guckte neugierig zum Fenster hinaus und sah, wie sie mit flatterndem Taschentuch dem Wagen nachwinkte. Dann blieb sie einen Augenblick wie unentschlossen stehen und ging schließlich in des Marquis Haus, anstatt wieder ins Café zu kommen.
Browns Gesicht war eine Studie der Enttäuschung.
»Encore?« brummte der Marquis, auf Mr. Browns geleertes Absinthglas deutend.
»Non, merci«, antwortete Brown. Und zwar sprach er die beiden Wörtchen mit ganz gutem Akzent; denn sein Lernen in diesem merkwürdigen Land hatte sich nicht auf verzwickte politische Dinge beschränkt, sondern er hatte schon ganz nette Fortschritte in der Sprache des Landes gemacht. Es wurde ihm langweilig in dem dumpfen Café. Er entschuldigte sich beim Marquis, stand auf und schlenderte den Strand entlang. Aber kaum war er ein paar Schritte weit gegangen, als zu seinem Aerger der Marquis grinsend neben ihm auftauchte. Fortschicken konnte er ihn nicht; es wäre zu unhöflich gewesen. Er wandte sich und kehrte um. Der Marquis kehrte auch um. Er änderte wieder seinen Kurs – der Marquis mit ihm. Da erkannte Brown, daß der rotbärtige Aristokrat nicht abzuschütteln war und ergab sich in sein Schicksal. Traute man ihm denn nicht? Hielt man ihn gar für einen Verräter? Was nun der Marquis auch denken mochte, jedenfalls schien er entschlossen, Brown nicht eine Sekunde allein zu lassen. Nun wurde Brown im Ernst ärgerlich, wandte sich kurz um, ging zum Haus zurück und auf sein Zimmer, nicht ohne vorher den Aristokraten an seiner Seite mit einem sehr deutlichen Blick gemessen zu haben. Als Antwort grinste der Aristokrat aber nur. Auf sein Zimmer folgte er ihm aber wenigstens nicht.
Im Schrank fand Brown den Feldstecher, ein etwas altmodisches Möbel. Mit einiger Mühe schraubte er ihn zurecht und spähte auf den Ozean hinaus. Noch war kein Schiff in Sicht. Natürlich nicht – der kleine Dampfer mit der goldenen Adlerflagge sollte ja erst am Morgen einlaufen. Hoffentlich waren Monsieur Georges und Duveen bis dahin zurück; Brown fühlte sich der Aufgabe nicht gewachsen, einen Kaiser würdig zu empfangen. Was hätte man da auch sagen sollen – –
»Welcome, your Majesty –« Nein, das ging nicht. Einen französischen Kaiser konnte man doch auf französischem Boden nicht auf Englisch empfangen. Oder –
»Sire, j'ai l'honneur …,
Nein, das ging auch nicht. Nun, hoffentlich würde Monsieur Georges zur rechten Zeit kommen. Das war doch alles sehr sonderbar. Freilich, ein verbannter Prätendent konnte bei seiner heimlichen Rückkehr in sein Land nicht von einem glänzenden Hofstaat empfangen werden, aber Monsieur Georges und Duveen – – Es war so gar nicht kaiserlich. Und doch; ein Fischerboot hatte einst Karl den Sechsten nach England gebracht, und wenige Männer nur hatten ihn begrüßt. So schrieb wenigstens sein geliebter Dumas in einem seiner geliebten Romane, die so viel schlummernde Romantik in dem guten Brown erweckt hatten. Nun, aus Kleinem wurde Großes und schließlich waren Männer wie Georges und Duveen nur winzige Rädchen in einem gewaltigen Getriebe des Umsturzes. Wer war er, diesen Patrioten so kritisch gegenüber zu stehen; er, den sie zum Gentleman der Kaiserlichen Kammer und Pagen – –
Ein altes Weib klopfte, murmelte irgend etwas über ein Diner, und Brown kletterte die steile Treppe hinab. Steile Treppen schienen auch eine französische Spezialität zu sein. Unten im Eßzimmer fand er Thérèse und den Marquis, der noch immer die fragwürdige blaue Bluse trug. Sie waren bereits bei der Suppe. Brown stopfte sich hastig die Serviette zwischen Hals und Kragen (diese französische Mode hatte er auch schon gelernt), und löffelte in dem Teller, der ihm vorgesetzt wurde. Die Suppe war gut. Die langouste, die dann folgte, war ebenfalls ausgezeichnet, und der Weißwein schmeckte Brown sehr. Dieser unangenehme Marquis mit der fragwürdigen Bluse und den unmöglichen Hosen schien wenigstens über Essen und Trinken vernünftige Ideen zu haben.
Während des Diners sprach der Marquis in fast ununterbrochenem Redefluß. Das war Brown sehr angenehm, denn er hätte keine Konversation führen können – noch waren trotz aller Fortschritte seinem Französisch sehr enge Grenzen gezogen. Auch Thérèse hörte nur zu und sprach selbst kein einziges Wort. Von Zeit zu Zeit sah sie Brown an – sehr liebenswürdig, wie es ihm schien. Den Marquis und sein Reden beachtete sie kaum, was diesen übrigens nicht im geringsten zu stören schien. Er berauschte sich an seinen eigenen Worten und wurde furchtbar aufgeregt und gestikulierte und debattierte und widersprach sich selbst (so schien es wenigstens Brown), lachte bald schallend, machte bald ein böses Gesicht. Er wurde abwechselnd elegisch und dramatisch. Sein Wortschatz mußte unermeßlich sein. Brown verstand zwar so gut wie gar nichts; er konnte nicht einmal herausbekommen, um was es sich eigentlich handelte, aber schließlich faszinierte ihn der Mann doch. Er bewunderte ihn. Er freute sich neidlos über diesen bescheidenen Unterhalter, dem es so gleichgültig schien, ob man ihm auch zuhörte, und lauschte gespannt auf Worte, die er verstehen könnte. Darin jedoch wurde er enttäuscht. Er verstand gar nichts. Dagegen wurde ihm der Marquis trotz Bart und Jacke und Hose viel sympathischer. Ein Mann, der so viel redete, konnte sicherlich weder gefährlich noch schlecht sein …,
Brown fand also das Diner sehr amüsant. Als es zu Ende war, lud er Thérèse ein, mit ihm spazieren zu gehen, und war eben so maßlos wie angenehm überrascht, als er sich allein mit ihr auf der Promenade fand. Er hatte es gar nicht anders erwartet, als den energischen Marquis wieder an seiner Seite zu finden. Als Brown zurückblickte, sah er die bewußte Jacke und die bewußten Hosen gerade noch in der Türe des kleinen Cafés verschwinden.
Welch ein Glück – sie waren allein.
Er war allein mit Thérèse; zum ersten Mal allein mit ihr, seit er sie kennen gelernt hatte. Fast war sein Herz zu voll für Worte; oder vielmehr er war so voll der Worte, und diese Worte wirbelten ihm so im Kopf herum, daß er gar nicht wußte, welche er wählen und wo er anfangen sollte. Es waren auch englische Worte zum größten Teil, und Madames Englisch hatte leider genau die gleichen Grenzen wie sein Französisch. Auch sie schwieg. Und so schritten sie stumm dahin. –
Es war ein wundervoller stiller Abend. Die leichte Brise war fast ganz abgeflaut, und träge spülte die Ebbe die Meereswellen dahin. Schweigend schlenderten die beiden Menschen den fast verlassenen Strand entlang. Für den Augenblick vergaß Brown sogar, daß dieses stille Meer morgen ein Schiff mit einem Kaiser für den französischen Thron an diesen Strand tragen sollte. Er vergaß ganz, daß er ein Verschwörer war, wenn auch ein sehr unfreiwilliger, der ja nie geahnt hatte, wie weit sein Wissensdurst ihn führen würde. Nein, er war nur Brown jetzt, einfach Brown – und er ging mit der Dame des Kasinos spazieren. Nein, nicht mit der Dame des Kasinos: mit Thérèse de Mérac, einer der schönsten und königlichsten Töchter des schönen Frankreichs.
Sie war größer als er, und das schien ihm ja so richtig. Er wünschte es sich ja gar nicht anders. In scheuer Anbetung streckte er seine Hand aus und berührte die ihre. So wie im Wagen erlaubte sie ihm, ihre Hand zu umfassen. Und so schritten sie Hand in Hand dahin.
Sie kamen zu einem höher gelegenen Teil des Strandes. Von hier aus konnte man den Marktplatz von Petite Mouleville übersehen mit seinen bescheidenen fünf Bogenlampen. In der Ferne funkelte die riesige Lichterreihe der Promenade des großen Mouleville.
»Wollen wir uns setzen?« schlug Brown vor.
Thérèse nickte und sie setzten sich auf den Grasstreifen zwischen den Küstenfelsen und der Strandpromenade. Aus heißen Augen sah er sie an, und ihre melancholischen Blicke ruhten auf ihm. Weder er sprach noch sie. So ein schweigsames Weib war ihm noch nie vorgekommen, aber er war es zufrieden. Er wünschte es sich gar nicht, sie sprechen zu hören. Ihre Stimme bedeutete ihm solch einen unerklärlichen Mißklang. Ihre Blicke, ihre Bewegungen, ihre bloße Gegenwart waren viel beredter und Brown viel lieber.
Zu ihren Füßen verschwanden die Wellen langsam immer weiter vom Strand, sich müde hinschleppend, als wehrten sie sich gegen die zerrende Allgewalt der Ebbe. Als könnten sie sich gar nicht trennen von ihrem Spielplatz auf dem weißen Sand. Rechts und links tauchten in schattenhaften Umrissen Strandstühle und kleine Zelte auf. Und hier saßen die beiden unter den Felsen, einsam, getrennt von aller Welt; Brown mit Gefühlen im Herzen, die zu seiner Einsamkeit vorzüglich paßten. Bis jetzt hatte Thérèse nur eine fast unpersönliche Anziehungskraft für ihn besessen; er hatte sie bewundert, sie war ihm ein entzückendes Geheimnis gewesen; alles Gefühle, die mit seiner kräftigeren und menschlicheren Neigung für Amelia durchaus nicht unvereinbar waren. Jetzt aber existierte Amelia nicht mehr für ihn; Thérèse und nur Thérèse erfüllte die Welt seiner Gefühle. Dort zwischen den Felsen schlich sich die Liebe in sein Herz; jene Liebe, die alle Vergangenheit auslöscht, die an Zukunft auch nicht mit einem Gedanken denkt, die sich nichts wünscht, als nur die Glückseligkeit der Gegenwart.
»Thérèse!« sagte er leise.
Lächelnd sah sie auf ihn nieder, denn sie saß kerzengerade da, während er sich halb zurückgelehnt hatte. Ihre eine Hand ruhte in der seinigen.
»Tiens!« rief sie und schnellte ein Käferchen von seinem Hemdkragen.
Aber weder die Stimme (sie klang sehr kratzig heute abend), noch das Käferchen konnten Mr. Brown von England stören in seinem goldenen Traum. Er ergriff auch ihre Linke und sah ihr heiß in die Augen.
»Thérèse!«
»Quoi?«
»Thérèse!«
»Mais, qu'est ce qu'il-y-a?«
Ah, wie exquisit! Ihre Stimme klang weicher, zarter. Er hörte kaum, was sie sagte; er hörte nur, daß sie sprach und daß ihre Stimme weich klang. Und es schien ihm, als sei er im Himmel.
Sie schüttelte eine ihrer Hände frei.
»Attends un peu«, sagte sie. »Tu as quelque chose dans l'oeil.« Sie näherte vorsichtig den behandschuhten Finger dem Winkel von Browns rechtem Auge, griff zu, und das Etwas zerfloß – es war eine Träne. Eine ganz kleine Träne. Sie hatte die Träne für etwas anderes gehalten. Hätte sie das Tränchen in Ruhe gelassen, so wäre es wieder dahin zurückgewandert, wo die Tränen wohnen; war es doch keine von den heißen Tränen, die geweint werden, sondern nur einer von jenen salzigen Tropfen, die manchmal und bei manchen Menschen wie Quecksilber steigen und fallen im Barometer der Seele.
So wurde das arme Tränchen zerdrückt. Ihr Finger tat ihm ein wenig weh, und er mußte mit dem Auge zwinkern. Sein unbeschreiblich zartes Fühlen machte irdischeren Gedanken Platz.
»Thérèse«, sagte er wieder, aber seine Stimme klang kräftiger, »ich liebe dich. Willst du mein sein?«
Es war vielleicht reichlich unverschämt für Mr. Brown vom Emporium zu Brixton, einer französischen Dame von hohem Rang so ohne weiteres einen Heiratsantrag zu machen; doch wenn die Verschwörung gelang, dann war er ja Gentleman der Kaiserlichen Kammer und Page der Toilette. Wer also seine Kühnheit gar zu unbegreiflich findet, der möge dies bedenken und Mr. Brown entschuldigen. Im übrigen war er nicht ganz er selbst – die Zukunft und die mit zukünftigen Dingen verschlungenen praktischen Erwägungen waren ihm gräßlich gleichgültig …,
Thérèse sah ihn aus ruhigen, kühlen Augen an; ein Outsider hätte in diesem Blick vielleicht Verachtung oder Gleichgültigkeit gelesen. Nicht so Brown. Ihm schien es, als wolle sie in der Tiefe seiner Seele lesen, und er gab sich alle Mühe, diese Seele so präsentabel hinzustellen, als es seinen Augen nur gelingen wollte.
»Allons,« sagte sie plötzlich, »j'ai la crampe«.
Sie stand auf und zog Brown mit empor. Er fragte sich, ob ihre Bemerkung Zustimmung bedeutete oder ob sie nur Zeit gewinnen wollte.
»Ramasse ça«, rief sie und deutete auf ihren weißen Sonnenschirm, der noch auf dem Boden lag. Sie erteilte Befehle, als habe sie das gute Recht, Gehorsam zu fordern. Es war also in Ordnung, sagte sich Brown. Das bedeutete ein Ja. Wie ein großes Glück kam es über ihn. Endlich also würde er das Recht haben, dieser Stimme Heiserkeitspastillen zu kaufen!
»Dann ist es also abgemacht?« fragte er scheu (sie schritten den Strand entlang).
»Abgemacht? Was?«
»Unsere Heirat!«
»Heiraten – Sie und ich? T'es fou.« Sie wandte sich und gab ihm einen Kuß. »Voilà! C'est fini maintenant.«
So niedergeschlagen Brown auch war, so mußte er sich doch wundern über diesen eigentümlichen Landesbrauch, der einen Korb mit einem Kuß begleitete. Vielleicht irrte er sich aber. Vielleicht durfte er doch noch hoffen. Zwar hatte sie nein gesagt, aber vielleicht gelang es ihm doch noch, sie zu erobern.
Als sie schon beinahe an dem kleinen Haus am Ende der Promenade waren, blieb Thérèse stehen und sah Brown mit einem weichen, gütigen Blick an, weicher als je vorher. Dann deutete sie auf die Straße, die nach dem großen Mouleville führte.
»Weshalb gehen Sie nicht weiter auf dieser Straße?« sagte sie leise und nun hatte ihre Stimme gar keinen häßlichen Klang; »nach Mouleville zurück und nach England mit dem nächsten Dampfer? Der Weg ist frei. Sie haben doch genug Frankreich gesehen, n'est-ce pas? Soviel als gut ist für Sie!«
Brown verstand, und er hätte sie umarmen können für den lieben Rat. Gefahr drohte, und sie wußte es, und sie warnte ihn, ehe es zu spät war. Sie ahnte wohl, daß er die Gefahr viel mehr um ihretwillen auf sich nahm als um der guten Sache willen, und sie wollte nicht, daß er sich für sie opferte, wo sie ihm doch das nicht geben konnte, was er ersehnte. Das war Edelmut. Aber auch Brown hatte seine großen Momente. So gefährlich die Affäre auch aussah, so wäre es ihm doch nicht eingefallen, davonzulaufen und seine Freunde – sie! – im Stich zu lassen.
»Nein, ich bleibe, Thérèse,« rief er. »Bei dir und der guten Sache.«
Sie lachte auf, ein schrilles Lachen, das ihn sehr daran erinnerte, wie notwendig gewisse Pastillen doch für sie waren, nahm ihn beim Arm und führte ihn in das Haus. Es war schon spät – das Haus still. Der Marquis ließ sich nicht sehen. Brown sah Thérèse an; stolz und königlich war ihre Haltung noch immer, aber eine ungewöhnliche Weichheit schien über sie gekommen zu sein. Einen Augenblick lang war er versucht, sie in seine Arme zu nehmen und in heißem Werben sie sich zu erringen – er hatte gehört, daß Französinnen so gewalttätiger Werbung oft zugänglich seien. Sie liebten Kraft und starkes Wollen an einem Mann. Dann aber sagte er sich, daß sie ja geradezu unter seinem Schutz stehe …,
Mit einer tiefen Verbeugung und mit einer Grazie, über die seine Kollegen im Emporium zu Brixton furchtbar gelacht hätten, nahm er ihre Hand und küßte sie. Und an der Schwelle ihres Zimmers verließ er sie.
Er hörte sie lachen, während er die Treppe hinaufstieg. Es war ein trauriges Lachen.
– – Luft brauchte er; frische Luft. Er setzte sich an das offene Fenster und starrte hinaus. Unter ihm lag Petite Mouleville. In weiter Ferne funkelten die Lichter der großen Promenade von Mouleville wie eine riesige Kette wundervoller Juwelen, endigend in einer lichtstrahlenden Diamantenbrosche. Das war die Lichterpracht des Kasinos. Er dachte an die Menschen, die da drüben bei den petits chevaux Gold gewannen und Gold verloren und tanzten und plauderten und sich in gedankenloser Frivolität amüsierten. Und dann starrte er hinaus auf das ruhige Meer, auf dem vielleicht jetzt schon der neue Herr des großen Frankreich schwamm. Ja, er bildete sich ein, weit draußen die Umrisse eines Schiffs zu erkennen, das keine Lichter führte; aber es war eine Wolke. Brown lächelte bitter. So weit also hatte seine Leidenschaft, den Dingen auf den Grund zu gehen, ihn geführt! Und dann wieder schwellte sich sein Herz: erlebten langweilige Touristen solche Dinge? Bedeutete Mouleville nicht ein Ereignis, an das man ein ganzes Leben lang denken und von dem man ein ganzes Leben lang reden konnte? Nein, reden würde er nicht darüber. Und dann wanderten seine Gedanken nach dem anderen Ufer des Meerarmes hinüber, zu seinem englischen Vaterland. Er dachte – jawohl, er dachte an Amelia. Noch spürte er den Kuß der entzückenden Thérèse auf seinen Lippen, und er dachte an Amelia. Wie ein Blitz durchzuckte ihn die Erkenntnis, wie er Amelia liebte. Wenn ihn auch die Reize dieser Französin verblendet hatten, so liebte er im Herzen doch nur Amelia. Das wußte er jetzt. Seine Gedanken hatten sich kaum mit ihr beschäftigt, seit er England verlassen hatte. Und nun kam das Heimweh über ihn und eine unbeschreibliche Sehnsucht nach ihr. Wie sonderbar, daß er gerade jetzt an sie denken mußte!
Leise rief er: Amelia! Ob sie ahnte, wie er sich nach ihr sehnte? Ob sie wohl an ihn dachte? Und ob sie wohl fürchtete, ihn ganz verloren zu haben? Und wenn – war sie dann traurig? Ah, er hatte ihr eine Lektion erteilt! Aber hatte er nicht mehr darunter gelitten als sie? ..
In Wirklichkeit entbehrte der durchaus nicht komplizierte Gedankengang Mr. Browns von England durchaus der Tragik. Er war vielmehr komisch – aber davon hatte Brown keine Ahnung. Man merke: nichts stärkt wahre Liebe mehr als der kleine Umweg über eine törichte Liebeseskapade!
So saß Mr. Brown am Fenster, grübelte und kostete alle Wonnen der Sehnsucht in vollen Zügen. Und wunderte sich furchtbar darüber (man muß älter und klüger sein als Brown, um solche Dinge zu verstehen), daß gerade seine Leidenschaft für Thérèse ihn zu Amelia zurückgeführt hatte. Er wünschte sich in Brixton und verwünschte Thron und kaiserliche Prätendenten und kaiserliche Kammern und kaiserliche Toiletten.
Nein, fest bleiben wollte er bis zum Ende. Die Herzogin vertraute ihm; Duveen vertraute ihm – und Monsieur Georges. Was Monsieur Georges anbetraf, so hätte ihm Brown das Vertrauen, das er ihm erwies, sehr gerne geschenkt; er konnte es mit dem besten Willen nicht erwidern. Bewundern wollte er ihn ja gerne, mit Vergnügen; aber eine vertrauenswürdige Persönlichkeit schien er ihm durchaus nicht zu sein. Er konnte es wirklich nicht begreifen, daß dieser Mann aus rein idealen Motiven, um einer guten Sache willen, kämpfte. Hm – vielleicht liebte er seine Cousine und war Verschwörer um ihretwillen? Hm – nein – Monsieur Georges war entschieden der Mann, in allen Dingen des Lebens rasch zuzugreifen, ohne Umständlichkeiten.
Und mit dem vernünftigen Gedanken, ein wie unangenehmer Mensch dieser Monsieur Georges doch sei, schlief Brown endlich ein.