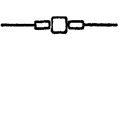|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Ein Freund in der Not taucht auf, und unser Held schläft in des Kaisers eigenem Bett, nach mancherlei merkwürdigen Erlebnissen.
Fiddle schrieb Ansichtskarten wie gewöhnlich. Mr. Brown von England starrte träumerisch in sein drittes Glas Whisky und Soda und versuchte ernsthaft, sich über seinen Gemütszustand klar zu werden. Frankreich war begeisternd; Mouleville entzückend. Nichts hätte schöner sein können als das Schauen, das Erleben dieser ersten Tage im Ausland. Das stand fest. Aber es war ihm, als flüstere ein Teufelchen ihm ohn' Unterlaß ins Ohr:
»Mr. Brown, du langweilst dich!«
»Das ist nicht wahr. Wie kann man sich langweilen – im Ausland; in Frankreich!«
»Oh doch!« (flüsterte das Teufelchen).
»Nein.«
»Ist es etwa nicht langweilig, wenn du dich den ganzen Tag in der Bar herumtreibst? Unter lauter Engländern? Und Whisky und Soda trinkst, und mit Amelia und Fiddle flirtest? Ist das Frankreich?«
»Hm …,«
»Sind denn die Mädels so nett?«
»Oh – so-so. …,«
»Sehnst du dich denn gar nicht nach deiner Amelia?«
»Nein, nein!«
»Weshalb erschrickst du immer so, wenn Madame White »Amelia« ruft?«
»Oh …,«
»Unangenehm, wenn einem immer der Name in den Ohren gellt, dem man entfliehen wollte!«
»Ist es auch.«
»Und ist nicht dieser Mr. White mit seinen ewigen Zauberkunststückchen und seinem fortwährenden Reden über England und englischen Sport und englische Politik denn doch sehr langweilig?«
– Das Teufelchen hatte recht. Solche Teufelchen haben immer recht. Mr. Brown von England konnte im Hôtel des deux Globes England nicht los werden, und er sehnte sich doch so nach Lokalfarbe! Der farbigste Eindruck, den er im Etablissement der Whites empfing, war nicht lokal und für Browns bescheidenen Geschmack zu farbig!
Am zweiten Tage fragte ihn nämlich Madame White, ob er gegen ein vis-à-vis an seinem kleinen Tischchen im Speisesaal etwas einzuwenden hätte? Mr. Brown sagte nein. Es schien ihm nur ein mäßiges Vergnügen, sich in Einsamkeit durch ein französisches Diner hindurchzuwühlen.
»Aber es darf kein Engländer sein!« stipulierte er.
»Oh nein, Monsieur …,«
Als Mr. Brown zu Tisch ging, fand er sich gegenüber einen pechschwarzen Neger!
Mr. Brown erstaunte sehr und es war ihm höchst ungemütlich zumute. Er kannte zwar keine Rassenvorurteile (weil er keine Rassen kannte), aber der Instinkt des weißen Mannes in ihm empörte sich gegen ein schwarzes Diner- vis-à-vis. Der Neger machte ihn nervös; der Wanderer von den Tropen schien ihm zu sehr Spezimen und zu wenig Mensch.
»Bonsoir, Monsieur,« sagte der Neger.
»Uih merci, – bong soir,« antwortete Brown.
Der Neger mit den wulstigen Lippen schmatzte sehr beim Essen – es war scheußlich (für Brown). Er verdarb ihm den Appetit. Obendrein kam gegen Ende des Diners ein Nigger Nummer zwei in den Speisesaal; ein Nigger mit Banjo und dröhnender Stimme, der Cakewalks sang und in seinem gräßlich schäbigen Filz milde Gaben einkassierte. Das mußte doch furchtbar unangenehm sein für den Nigger-Gentleman gegenüber, sagte sich Brown, und er fühlte sich verpflichtet, ein größeres Silberstück zu spenden (um seines Tisch- vis-à-vis willen) – und war starr, als der Nigger-Gentleman seinem Rassegenossen mit einer hochmütigen Gebärde abwinkte und gar nichts gab!
Das vis-à-vis war Brown zu farbig, und nach dem Diner remonstrierte er prompt mit Madame White.
Lokalfarbe wollte er – keine Nigger!
Und dann war zu viel des Englischen in Mouleville; aus Schritt und Tritt und Tritt und Schritt wurde er an sein fernes und doch so nahes Vaterland erinnert. – England und Englisches starrte ihm überall ins Gesicht! Da waren nicht nur die Whites und die vielen englischen Kunden des Hotels; nein, bei jedem Spaziergang, den er machte, rannte er gegen englische Dinge an: Da waren Golf-links und Tennisplätze und Cricketspiele und vor allem »Old England«; ein Kaufhaus, das ihn unangenehm an Brixton und das Emporium erinnerte. Mit unsäglichem Schrecken ertappte er sich sogar darauf, wie er vor den Schaufenstern dieses Kaufhauses stand und ganz instinktiv die Preise mit seinen Preisen, mit den Preisen des Emporiums verglich …,
Mr. Brown langweilte sich – – –
Madame White war ihm allzu geschäftsmäßig in ihrer Liebenswürdigkeit; Miß Fiddle, die sehr, sehr, sehr hübsch war, ganz abgesehen von den reizenden Mustern ihrer Strümpfe, hatte ihn schwer beleidigt, denn sie sagte einmal zu ihm:
»Man kann auf den ersten Blick sehen, daß Sie ein Engländer sind!«
Die Familie fiel ihm auf die Nerven! Sie gebärdeten sich so englisch – so, als ob sie eben erst von England angekommen wären und nicht ihr ganzes Leben in Frankreich zugebracht hätten. Untereinander sprachen sie Französisch; wenn sie aber Englisch sprachen, so machten sie sich über französische Dinge und französische Sitten lustig. Sie hatten offenbar keinen Funken Verständnis für die Schönheiten des Auslandes. Es war nicht recht von ihnen!
» Das Ausland will ich genießen!« sagte sich Mr. Brown wütend beim vierten Glas Whisky und Soda.
Er langweilte sich. Wider seinen Willen ging er Tag für Tag zur Landungsbrücke, um den englischen Tagesdampfer ankommen zu sehen …, Nein, untertags war Mouleville denn doch sehr langweilig. Nur die Nächte waren Balsam für sein Gemüt.
Denn des Nachts ging er ins Kasino, das ihm wie ein Paradies erschien. War es auch furchtbar geschmacklos, wie alle anderen Kasinos der Welt, seinen ästhetischen Geschmack beleidigte es nicht. Ein funkelndes Lichtmeer, elegante Herren und elegante Damen: – Lebensgenuß und Leichtsinn und blendender Schein. So etwas hatte Brown noch nie gesehen; das war selbst seinen hochgespannten Erwartungen ausländisch und kontinental genug. Das Zentrum all des Glanzes bildeten die Rouletten mit den kleinen Pferdchen, den petits chevaux, faszinierende grüne Spieltische, an denen croupiers vor den sausenden Teufelsmaschinen saßen und mit zierlichen Rechen Geldhäufchen über den Tisch hinschleuderten und andere Geldhäufchen mit geschickten Griffen einheimsten, unter dem monotonen: »Faites vos jeux, les jeux sont faits, rien ne va plus!«
Es dauerte nicht lange, so steckte das Spielfieber auch Mr. Brown von England an. Er spielte sehr vorsichtig und mit geringen Einsätzen; aber dabei empfand er eine wunderschöne Aufregung, die wirklich das Geld wert war. Selbstverständlich verlor er. Die kleinen Pferdchen sausten lustig im Kreise, und mit jedem Drehen der Roulette verschwand ein kleiner Bruchteil des Erbes seiner guten Tante im unersättlichen Rachen der Bank. Das Spiel gefiel ihm ausgezeichnet. Nach und nach aber siegte sein praktischer Geschäftsinstinkt und er wurde es müde, Fünf- und Zehnfrancsstücke aus seiner Tasche zu dem Geldhaufen des croupiers hinwandern zu sehen. Es war aufregend, – aber die Aufregung war ihm zu einseitig. Da gewann er auf einmal, und Brown hätte nicht ein Neuling sein müssen, wenn ihn das nicht begeistert und zum Weiterspielen verlockt hätte. Er gewann andauernd, das Häufchen von Gold- und Silberstücken vor ihm erreichte rasch eine respektable Größe – um mit gleicher Schnelligkeit auf einmal wieder zu schwinden. Es schwand immer mehr. Zufällig sah Brown auf die Uhr: Er hatte drei Stunden gespielt. Und als er sein Geld zählte, fand er, daß er zwei Francs gewonnen hatte. Das schien ihm denn doch ein schlechtes Geschäft …,
Immerhin, zwei Francs waren zwei Francs. Er schlenderte hinüber zu dem Café und bestellte einen Likör und eine Tasse Kaffee, in dem angenehmen Bewußtsein, diesen Likör und diesen Kaffee bezahle die Bank. Doch während er den Kaffee trank, stieg ein fürchterlicher Verdacht in ihm auf. Er zählte sein Geld, kopfschüttelnd, und gelangte auf einmal zu dem Resultat, daß er nicht zwei Francs gewonnen, sondern achtzehn verloren hatte!
Nein, das war aber doch nicht möglich. Er zählte nochmals – mit dem gleichen Resultat. Er dachte nach und dachte nach und konnte sich wirklich nicht mehr erinnern, wieviel Geld er eigentlich bei sich gehabt hatte. Ein unangenehmes Gefühl stieg in ihm auf, gegen das es nur ein Mittel gab: Zu den kleinen Pferdchen zurückzukehren und nochmals zu spielen. Das tat er; mit dem sonderbaren Resultat, daß er spät nachts, als das Kasino geschlossen wurde, genau denselben Betrag in seinem Besitz fand, den er im Café gezählt hatte. Das war niederträchtig; Brown war ein Geschäftsmann und es wurmte ihn, daß er nicht imstande war, die Bilanz des Spielabends zu ziehen.
Auch die petits chevaux genügten ihm auf die Dauer nicht. Er fühlte sich einsam; er wünschte sich einen Freund, einen Gefährten, und fand doch niemand, der ihm gefiel. Einen Engländer wollte er nicht – mit einem Franzosen konnte er nicht reden – und außerdem, um der Wahrheit die Ehre zu geben, schien sich auch kein Mensch irgendwie für ihn zu interessieren. Nein, das Kasino war doch nicht halb so interessant, wie es ihm zuerst geschienen hatte. Zwar spielte er noch einige Male und zwar ziemlich hoch, immer mit der Genugtuung, jetzt wenigstens genau zu wissen, daß er verlor und zwar viel verlor. Aber die kleinen Pferdchen waren ihm doch nicht aufregend genug. Er sehnte sich nach – nun, nach Großem …,
Es war an seinem zweiten Abend im Kasino. Eine dichte Menschenmenge drängte sich um die grünen Tische der petits chevaux, entweder als Spieler oder als Zuschauer. Brown fand es ganz nett, einmal nur zuzusehen und nicht selbst zu spielen. Da waren Menschen, die auf schmalen Streifen Papier rechneten und rechneten und sich Systeme ausklügelten; da waren Männer, die so aussahen, als müßten sie ihre ganze geistige Kraft auf das Spiel konzentrieren; da waren andere, die ihr Geld gleichgültig hinwarfen, mochte es rollen, auf welches Pferdchen es wollte – alle aber achteten nur auf das Spiel, hatten nur Augen für die sausenden Rouletten und das rollende Gold.
Nein, ein Mensch kümmerte sich nicht um das Spiel. Es war eine Dame. Eine Dame, die langsam in der Halle auf und ab ging, mechanisch fast, als schritte sie im Traum. Sie trug ein weißes Kostüm – ein Morgenkleid eigentlich, aber ein sehr elegantes Morgenkleid. Ein übergroßer weißer Hut mit riesigen Straußfedern umrahmte ein Gesichtchen, das faszinierend blaß war und aus dessen Blässe tiefdunkle, glänzende Augen und sehr rote Lippen hervorleuchteten. Lippen, die nicht den geringsten Versuch machten, das künstliche rouge abzuleugnen. So schritt sie auf und ab, als sei ihr das Spiel vollkommen gleichgültig. Noch nie in seinem Leben hatte Brown ein weibliches Wesen wie sie gesehen, wenn er auch manchmal in wilden Träumen von riesigen Hüten und blassen Gesichtern träumte.
Brown starrte und starrte. Uebernatürliche Klugheit, unbeschreibliche Menschenverachtung schien sich in diesen harten Augen und diesen bemalten, gekräuselten Lippen zu konzentrieren. Noch mehr überraschte Brown diese Gleichgültigkeit, diese Nichtbeachtung der geldgierig spielenden Menschenmenge.
Geheimnisvoll kam sie ihm vor; was mochte sie wohl in den Spielsaal führen? Weshalb sah sie so einsam aus? Dem guten Brown schien es, als verberge sich in den großen Augen heimliches Leid und als seien diese Lippen zu stolz, das Leid zu enthüllen. Alles schien ihm geheimnisvoll, die Augen, die Lippen, das tiefdunkle Haar, so wundervoll ausländisch in seiner Rundung, tief in die Wangen reichend – in jener Frisur, die einst Cléo de Mérode erfand. Aber das wußte Brown natürlich nicht. Die Dame erinnerte Brown an ein Gemälde, das er irgendwo gesehen hatte, er wußte nur nicht wo.
Wie müde ihre Augenlider aussahen …,
Mit einem Mal hatte das Spiel allen Reiz für ihn verloren. Er dachte nur an die Dame, dachte an sie mit einer süßen Nachdenklichkeit, mit teilnahmsvollem Herzen, und des Nachts träumte er von dem wundervollen Haar und den großen Augen und dem blassen Gesicht.
Den ganzen nächsten Tag verbrachte er in herzklopfender Ungeduld, und des Abends stürzte er nach dem Kasino, getrieben von der Sehnsucht, sie wieder zu sehen. Und seine Sehnsucht ward erfüllt.
Da war sie! Auf und ab schreitend im Spielsaal, träumerisch, gleichgültig gegen ihre Umgebung. Mit einem Male blieb sie stehen, zaudernd, und schritt dann durch die Glastüre, die auf die Promenade führte. Brown kam sich unglaublich unverschämt vor – aber sein Herz trieb ihn, ihr zu folgen. In angemessener Entfernung, natürlich. Und auf und ab schritt die Dame auf der Promenade, mit der Regelmäßigkeit eines Uhrpendels, – als sei in ihr der Geist exakter Bewegung verkörpert. Wie eine Königin erschien sie Mr. Brown von England; wie eine Königin ohne Königreich. Sein Herz ging aus zu ihr. Sie bedeutete ihm das Unbekannte, sie erregte in ihm geheimnisvolle Tiefen. Aber auch nicht ein einziges Mal kam ihm der Gedanke, höflich den Hut zu ziehen und ein Gespräch mit seiner Königin anzufangen. Das wagte er ebensowenig, wie es ihm beigefallen wäre, in den Wüsten Aegyptens die schweigende Sphynx um ihr Rätsel zu befragen.
Sein Hirn arbeitete. Was tat sie hier in Mouleville? Weshalb sprach sie zu niemand, weshalb nahm sie keinen Teil an den frivolen Vergnügungen des Kasinos? Weshalb schritt sie so stolz und so traurig in Einsamkeit? Das war splendid isolation ins Menschliche übertragen. Sie schien keine Freunde zu haben; sie beachtete auch nicht mit einem Blick die anderen Damen, deren lustiges Lachen und Sprechen und Gestikulieren aus den Menschenmengen des Kasinos ein Sprachenbabel machte. Sie schien ihm die verkörperte Poesie. Sie verdrängte das Bild Amelias aus seinem Herzen und seinem Gedenken. Und wie grob und gewöhnlich waren doch die Mouleviller Amelia und ihre Schwester Fiddle, verglichen mit der schweigenden Dame des Kasinos. Denn so nannte er sie in seinen zärtlichen Gedanken; die Dame des Kasinos.
Er wurde immer poetischer; er errichtete in seinen Träumen der weißen Dame einen Tempel. Und in diesem Tempel war Mr. Brown Hohepriester.
Die Nacht verging und der Tag schwand dahin, und am nächsten Abend suchte Brown in großer Aufregung vergeblich nach seiner Dame des Kasinos. Nirgends konnte er sie finden. Furchtbar enttäuscht wandte er sich den kleinen Pferdchen zu, um in der Aufregung, die sie boten, Trost zu finden. Diesmal hatte er entschieden Pech; er spielte so unglücklich, daß ihm bald das Wort vom Glück in der Liebe und vom Unglück im Spiel kein rechter Trost mehr war. Er wollte keinen Trost. Er wollte gewinnen. Er verdoppelte seine Einsätze, nur um sie mit erstaunlicher Regelmäßigkeit in der Bank verschwinden zu sehen, und nach einer Stunde hatte er glücklich alles Geld verloren, das er bei sich führte. Da stand er auf und verließ das Kasino in sehr unzufriedener Stimmung. Auf dem Heimwege sagte er fünfmal laut und deutlich ein englisches Wort, das in guter Gesellschaft verpönt ist, ärgerlichen Leuten aber lieb und wert zu sein scheint: Mr. Brown fluchte!
Am nächsten Nachmittag ging er wie gewöhnlich zur Landungsbrücke, um den Dampfer von England landen zu sehen. Die Vorsehung hatte beschlossen, daß diese Gewohnheit es sein sollte, die Mr. Brown von England endlich einen tiefen Einblick in höchst ausländische Dinge verschaffen würde.
Aber das wußte Brown nicht. Schon an dem Tage, an dem er in Mouleville gelandet war, hatte er auf dem Quai einen Mann bemerkt, der sich die Leute ansah, die vom Dampfer kamen. Seitdem hatte er ihn jeden Tag gesehen und auch bemerkt, daß er dann und wann Passagiere ansprach, die ihm aber sehr kurze Antworten zu geben schienen. In richtiger englischer Unverschämtheit einem Ausländer gegenüber, sagte sich Brown. Brown war sich aber doch nicht ganz klar darüber, ob der Mann wirklich ein Franzose war, denn sein Gesicht hatte mehr einen englischen Typus und auch sein Schnurrbart sah ganz entschieden englisch aus. Des Mannes Kleider vereinigten die Fehler der Herrenanzüge beider Nationen oder sie sahen vielmehr so aus, als bemühe sich ein Franzose, sich wie ein Engländer zu kleiden. Die Kleider waren übrigens durchaus nicht elegant, sondern schäbig genug, was Brown störte. Im übrigen jedoch machte der Mann einen nicht unsympathischen Eindruck auf ihn, sah er doch aus wie einer, mit dem ein einsamer Fremder eine Bekanntschaft anknüpfen könnte. Der Mann der Landungsbrücke hatte wässerige Augen und eine Nase, die ein ganz klein wenig schief war und ein bißchen abgenützt schien. Er trug »braune« Schuhe von der denkbar hellsten gelben Farbe; Schuhe, die im letzten Stadium des Reparierens waren, wie Brown mit den Augen des Kenners sofort sah. Schäbig, sagten die Schuhe – sagte der Anzug. Und doch fühlte sich Brown ganz sonderbar zu dem Manne hingezogen. Dieser Mann, sagte er sich, würde ihm Dinge über die intimen ausländischen Seiten des Lebens in Mouleville erzählen können! Aber der Mann hatte Brown bisher gar nicht beachtet. Heute nachmittag jedoch sah er ihn mit sonderbaren Blicken von der Seite an, mit Blicken, die Brown nicht sah, die aber deutlich besagten, daß der Mann der Landungsbrücke Brown taxierte, ihn abschätzte, so wie ein Kaufmann eine Ware abschätzen mag, ob sie auch gut und des Kaufens wert ist. Der Mann war anscheinend nicht zufrieden mit dem, was er sah, denn er machte keinen Versuch, ein Gespräch anzuknüpfen. Endlich, als die Passagiere schon alle gelandet waren, fanden sich Brown und der Mann allein auf der Landungsbrücke und sahen sich gegenseitig mißtrauisch an, so wie zwei fremde Hunde – sehr mißtrauisch. Endlich nahm Brown, der eine ungeheure Sehnsucht in sich spürte, einmal mit jemand zu sprechen, der nicht aggressiv englisch aussah, mit einer schlenkernden Handbewegung seine Mütze ab und sagte:
»Monsieur!«
Der Mann, der die Gewohnheit hatte, sein Terrain jedesmal mit großer Vorsicht zu sondieren, de tâter son terrain, wie er sich ausgedrückt haben würde, und dem Brown nicht gerade vielversprechend erschien, brummte »Monsieur« und sah ihn von der Seite an.
Brown zog eine Zigarre hervor und deutete auf deren unangezündetes Ende.
»Feu!«
Er sprach das Wort zwar »fuh« aus, aber das war ja gleichgültig. Der Mann schien beruhigt, und als Brown ihm eine Zigarre anbot, wurde er plötzlich liebenswürdig.
Er biß die Spitze ab, spuckte sie aus und lächelte Brown freundlich an. Der Mann hatte ein bösartiges kleines Gesicht; ein Gesicht, dessen Züge eher auf schwache Haltlosigkeit als auf ausgesprochene Kriminalität hindeuteten, ein Gesicht, dessen Augen und Nase Spuren des Trinkens zeigten. Brown war jedoch kein Physiognomist. Der Mann trug zerrissene Handschuhe, und an seinem Spazierstock fehlte der Griff.
»Engländer, nicht wahr? Verbringen Ihre Ferien hier?« fragte der Mann.
»Jawohl«, antwortete Brown, »aber ich hoffe, ich sehe nicht allzu englisch aus; ich bin schon fünf Tage hier!«
»Tun es auch nicht!« bemerkte der Mann rasch. »Ich hielt Sie für einen Franzosen, sonst hätte ich schon längst ein Gespräch mit Ihnen angeknüpft.«
»Sie sind also auch ein Engländer«, bemerkte Brown sehr enttäuscht. »Ich dachte, Sie wären vielleicht ein Franzose. Man kennt so viele Engländer in England, daß es wirklich einmal eine Erholung wäre, einen Franzosen kennen zu lernen.«
»Oh, ich bin Engländer, sozusagen. Aber ich lebe schon seit langem hier, und ich weiß mehr über Frankreich als die meisten Franzosen.«
»Wirklich!«
Da hatte er einmal Glück gehabt, dachte sich Brown. Wenn der Mann die Wahrheit sprach, so war er des Kennens wert.
»Ich kam in der Hoffnung her,« sagte Brown, »Land und Leute kennen zu lernen; aber Mouleville scheint halb englisch zu sein und die Leute reden über nichts als über England.«
Die fischigen kleinen Augen des Mannes glitzerten.
»Wo wohnen Sie?« fragte er.
»Im Hôtel des deux Globes.«
»Oh, bei der alten Mutter White! Ebensogut könnten Sie in England bleiben! Wie geht's Amelia und Fiddle?«
Der Mann lachte.
»Sie müssen sehr vorsichtig sein,« sagte er und beobachtete Brown scharf, während er sprach; »in einem Ort wie Mouleville mit seiner gemischten Bevölkerung und so weiter muß man sehr vorsichtig sein, mit welchen Engländern man verkehrt. Manche dieser Engländer haben ihr Vaterland verlassen – na, zum Wohle ihres Vaterlands. Manche dieser Engländer – er machte eine geheimnisvolle Pause – können gar nicht wieder zurück nach England!«
»Aber ich will ja gar keine Engländer kennen lernen; deswegen bin ich doch nicht hierher gekommen. Franzosen will ich kennen lernen und –«
»Französinnen!« vollendete der andere lachend. »Nun, warum denn nicht? Aber dann hätten Sie nicht zu den Whites gehen sollen!«
»Das wußte ich doch nicht. Ich war noch nie vorher in Frankreich. Ich hatte mich so aufs Ausland gefreut, aber es kommt mir jetzt vor, als hätte ich mir das Geld für die Reise sparen können.«
»Na, wenn Sie für Ihr gutes Geld auch etwas haben und Frankreich und Franzosen und Französinnen gründlich kennen lernen wollen – dazu kann ich Ihnen verhelfen. Darf ich Sie einladen, eine Erfrischung mit mir einzunehmen?«
Brown war entzückt und eine leise Hoffnung stieg in ihm auf, dieser Wissende könne ihm vielleicht etwas sagen über die Dame des Kasinos – das war sein erster Gedanke. Aber vorläufig gedachte er, seine weiße Göttin doch noch nicht zu erwähnen und sagte nur:
»Oh ja, gerne. Aber ich bringe sowieso sehr viel Zeit in der Hotelbar zu und ich bin des stout und des pale ale und der bitters und des whisky and soda müde.«
»Stout und pale ale!« rief der Mann entsetzt. »Aber man kommt doch nicht nach Mouleville, um solches Zeugs zu trinken! Kommen Sie mit und probieren Sie einen absinthe.«
Brown strahlte vor Vergnügen. Das war ein Freund von der richtigen Sorte! Aber selbstverständlich – Absinth hatte er ja schon längst kosten wollen und hatte es nur immer vergessen (sagte er); das hätten ihm diese langweiligen Whites doch auch schon vorschlagen können!
Während sie die Hafenstraße entlang schritten, zog der Mann ein Visitenkartentäschchen hervor:
»Dies ist mein Name,« sagte er und reichte Brown eine Visitenkarte.
Brown las: »Albert Duveen, Guide.«
Aha, da war er endlich an den richtigen Mann gekommen! Aber konnte denn in Mouleville ein professioneller Führer existieren?
»In Mouleville gibt es doch nicht viel zu sehen und zu führen?« fragte er.
»Nein, für den Durchschnittstouristen allerdings nicht. Aber ich kann Ihnen Dinge zeigen, die ein Durchschnittstourist niemals sehen würde, und wenn er sie wirklich selbst entdeckte, so würde er Jahre dazu brauchen. Ja, ja – erst wenn ein Mann wie Sie, der wirklich Land und Leute kennen lernen will, meine Dienste in Anspruch nimmt, fühle ich mich, als sei mein Beruf mir etwas wert.«
Es war Brown ein unbeschreiblich behagliches Gefühl, sich in der Gesellschaft eines Führers zu wissen, der Mouleville und seine Menschen wirklich kannte, gründlich kannte. Er war schon ganz aufgeregt. Und schon hatte ihn sein Begleiter in eine Straße geführt, in der er nie gewesen war, und in ein Café, in ein so schmutziges und teures, in ein so französisches Café, wie er es in Mouleville noch nie gesehen hatte.
»Wir wollen doch nicht dahin gehen, wo die Durchschnittstouristen zu finden sind!« hatte Duveen erklärt.
»Nein, freilich nicht,« gab Brown zu.
Er gab sich große Mühe, unbefangen zu erscheinen, denn er fürchtete sehr, bei seinem neuen Freunde Anstoß zu erregen. Daß das Café so schmutzig war, genierte Brown durchaus nicht. Reinlichkeit fand er genügend in England. Was er wollte, war etwas typisch Französisches. Duveen mochte zwar ein Engländer von Geburt sein, als aber Brown hörte, wie er mit der französischen patronne des Cafés sprach, da hüpfte ihm sein Herz vor Freuden. Das war französisch! Das war eine Sprache, reißend wie ein Mühlbach. Endlich fühlte er, als sei er wirklich weit weg von allem Englischen. Das perlte und strömte und rauschte in schallendem Wortstrom – das war wirklich französisch! Im Anfang war, so schien es Brown, die patronne, die Dame des Cafés, ein wenig kurz angebunden und nicht allzu höflich; aber sie änderte ihre Haltung sehr rasch, nachdem Duveen einige Minuten lang auf sie eingeredet hatte, und war von da ab ganz Lächeln und Liebenswürdigkeit. Sie war besonders nett zu Mr. Brown von England und schenkte ihm höchst eigenhändig den Absinth ein.
»Langsam trinken, mein Junge – es ist Nektar und Ambrosia!« mahnte Duveen und zeigte Brown, wie man ganz langsam die Wassertropfen über die zwei Stücke Zucker in dem silbernen Sieb fließen lassen mußte, damit Wasser und Absinth sich auch völlig vermischten. Brown fand das sehr hübsch und sah erstaunt, wie sich die dunkelgrüne Flüssigkeit zu einer wolkigen Opalfarbe verwandelte, wie endlich der Zucker schmolz und das französische Nationalgetränk bereitet war.
Er fand den ersten Schluck deliziös. Der Geruch schon gefiel ihm, der Geschmack noch besser. Es sah so unschuldig aus und schmeckte so ausgezeichnet, und kaum hatte er einen zweiten Schluck getrunken, als schon ein sonderbares Gefühl von Zufriedensein und behaglicher Wohligkeit über ihn kam.
»Sie wollen französische Dinge nicht von der Oberfläche sehen, sondern Sie möchten doch Frankreich gründlich kennen lernen, wie ich vermute?« fragte Duveen.
»So ist es,« antwortete Brown.
»Sehen Sie, Mouleville hat seine zwei Seiten. Die eine Seite mag jeder Durchschnittstourist, jeder Engländer leicht genug finden; die französische und die wirkliche Seite aber des Lebens in Mouleville, die kann ich Ihnen zeigen, und ich möchte sehr bezweifeln, ob irgend ein anderer Engländer in Mouleville das könnte, mag er auch noch so lange hier gelebt haben. Diese Leute bleiben immer englisch und lernen das wirkliche Leben der Franzosen niemals kennen. Ich garantiere Ihnen, in drei Wochen mache ich einen besseren Franzosen aus Ihnen, als es Engländer sind, die schon vierzig Jahre hier gelebt haben.«
»Das ist es ja, was ich haben will!« sagte Brown entzückt. »Ich bin nach Frankreich gekommen, nicht um der Reise willen, sondern weil ich meinen Horizont erweitern wollte. Ich will mehr von der Welt kennen lernen als nur mein eigenes Vaterland.«
»Sie sind Londoner?« fragte Duveen.
»Yes,« antwortete Brown. Er hielt es für durchaus unnötig, auf Brixton und das Emporium näher einzugehen. Er wollte ein Engländer in Frankreich sein, nicht mehr und nicht weniger.
»Und Sie?« fragte er. »Weshalb sind Sie denn nach Frankreich gekommen und weshalb haben Sie sich in Frankreich niedergelassen?«
»Nun, es ging mir wie Ihnen: England war mir zu eng. Ich wollte die Welt sehen.«
»Sie sind niemals über Mouleville hinausgewesen?«
»Ah, Mouleville ist so interessant und so französisch und so ausländisch, wie man es sich nur wünschen kann. Nur lernen die wenigsten Menschen hier seine interessanten Seiten kennen, und die meisten geben sich auch gar nicht die Mühe.«
»Ich gebe gerne zu, daß das Hôtel des deux Globes entschieden zu englisch für meinen Geschmack ist.«
»Weshalb bleiben Sie denn dort?«
»Ja, aber ich kann doch nicht gut ausziehen?« sagte Brown. »Und dann, wohin sollte ich denn gehen?«
»Ah, das wird nicht die geringste Schwierigkeit machen. Ich werde Sie schon unterbringen. Und da, wo ich Sie hinführe, werden Sie sich sofort viel französischer vorkommen.«
»Aber ich weiß doch gar nicht, was ich den Whites sagen soll!«
Duveen wandte sich und sah Brown an, ihm freundlich die Hand auf die Schulter legend. Mit jeder Minute wurde der Mann von der Landungsbrücke zutraulicher und liebenswürdiger.
»Wäre es nicht am besten, wenn ich Ihnen diese Unannehmlichkeit abnehmen würde; wenn ich Ihre Rechnung bezahlte und Ihre Koffer holen lassen würde? Wissen Sie, das ist ganz einfach: Ich werde einfach sagen, Sie hätten Freunde gefunden und wollten bei diesen Freunden wohnen.«
»Wirklich? Das wäre aber nett von Ihnen! Wissen Sie, ich möchte die Leute nicht gerne beleidigen.«
»Schreiben Sie mir einige Zeilen für die Whites, daß ich autorisiert bin, Ihr Gepäck in Empfang zu nehmen, und ich werde alles arrangieren.«
Brown überlegte sich das ein bißchen. Aber es fiel ihm ein, daß er ja all sein Geld bei sich trug, und daß die Koffer nur Kleidungsstücke und Wäsche enthielten. Das war kein so großes Risiko. Und dann machte Duveen wirklich einen sehr guten Eindruck auf ihn. Außerdem wäre es ihm wirklich unangenehm gewesen, die Sachlage den Whites zu erklären. Fiddle würde sicher allerlei neugierige Fragen stellen, und dann fand er es auch wirklich höchst unrecht von sich, diese netten Leute nach so kurzem Aufenthalt und so plötzlich zu verlassen. Der triftigste Grund aber war der Absinth. Die zwei Gläser Absinth, die er getrunken hatte, brachten ihn auf den Standpunkt, es sei das schönste und bequemste, gemütlich sitzen zu bleiben und sich sein Gepäck holen zu lassen. Denn Absinth spendet zwar wohliges Ruhegefühl, macht aber durchaus nicht energisch …,
»Ich werde die Rechnung für Sie bezahlen«, sagte Duveen mit einem bezeichnenden Blick.
»Verzeihen Sie, das hatte ich ganz vergessen«, sagte Brown und zog eine Banknote über hundert Francs hervor. »Wollen Sie so liebenswürdig sein, mit diesem Gelde für mich zu bezahlen?«
Duveen nahm das Geld, rief der patronne irgend etwas zu und ging.
Brown blieb mit der alten Dame und seinem Absinth allein; er fühlte sich jedoch durchaus nicht einsam, noch fremd. Nein, im Gegenteil; ihm war es, als sei das Café voller Menschen, voller lieber Freunde. Noch niemals war es Brown so leicht ums Herz gewesen. Er hätte mit Vergnügen eine Ewigkeit hier auf sein Gepäck gewartet – in alle Ewigkeiten. Und wenn er sichs überlegte, so wußte er gar nicht genau, ob er nicht vielleicht schon wochenlang hier gesessen sei. Die Zeit flog eben dahin. Ja, ja! Und das war ja auch so gleichgültig. Die Hauptsache war, daß man glücklich war. Und dabei hatte Brown an seinem zweiten Glas Absinth kaum genippt!
Dann fiel es ihm ein, daß Duveen doch sehr lange fortblieb. Würde er wohl jemals im Leben zurückkommen? Vielleicht war er doch kein treuer Freund? Vielleicht würde er im Leben sein Gepäck nicht wiedersehen? Aber was machte das; das war ja so gleichgültig. Wenn man immer so im Café sitzen bleiben konnte, dann brauchte man ja eigentlich gar keine Kleider. Er nickte der Dame am Buffet zu und lächelte, und auch sie lächelte ihn an. Er konnte sich keine rechte Vorstellung darüber machen, ob sie eigentlich alt oder jung war. Aber das war ja auch so gleichgültig. Was scherte ihn das Alter der Menschen oder die dahinrinnende Zeit. Komisch, daß es Leute gab, die solche Dinge für wichtig halten!
Dann erinnerte er sich an Amelia. Er hatte Amelia gerne, er liebte sie, liebte sie heiß und leidenschaftlich. Aber sie hatte ihn geärgert, ihm weh getan, sie hatte mit anderen Herren geflirtet. Wenn in Frankreich Mädchen dem Geliebten untreu wurden, so tötete sie der Geliebte. Es war also logischerweise richtig, daß er Amelia tötete. Dann fiel ihm Amelia White ein. Um ganz sicher zu gehen, würde er auch sie töten. Mrs. White ebenfalls und Fiddle erst recht. Und Mr. White – nein, den würde er nicht töten, der war zu schlau, der konnte zu viel Zauberkunststückchen. Wie kann man einen Menschen umbringen, der imstande ist, mit der großen Zehe einen Penny zu jonglieren und ihn mit dem Munde aufzufangen? Aber Fiddle würde er bestimmt töten. Und nach Erledigung dieser verschiedenen, durchaus notwendigen, kleinen Mordtaten würde er mit der Dame vom Kasino in Glückseligkeiten leben in alle Ewigkeit. Er war eben damit beschäftigt, diese angenehme Vorstellung mit allerlei Details auszuschmücken, als eine Droschke vor dem Café vorfuhr und Duveen mit den Koffern eintrat. Brown wußte nicht recht, ob er den Mann schon jemals im Leben gesehen hatte und seine Koffer waren diese doch bestimmt nicht? Oder vielmehr, diese Koffer kamen ihm eigentlich ziemlich bekannt vor, aber er wünschte, nichts mit ihnen zu tun zu haben. Er würde diese Koffer verleugnen und sie enterben. Nein, den großen Koffer konnte er doch eigentlich nehmen und ihn ausleeren. Da ließe sich Fiddle so bequem hineinstecken. Ja, und dann würde er mit Amelia, nein, mit beiden Amelias auf die Hochzeitsreise gehen und den Honigmond in Mouleville verbringen.
Als jedoch Duveen mit ihm sprach, wandten sich seine Gedanken ganz natürlich, ohne gewaltsamen Uebergang, wieder zur Wirklichkeit und zu den Dingen der Wirklichkeit zurück. Es regte ihn durchaus nicht auf, als Duveen etwas so Prosaisches wie ein Diner vorschlug, sondern er sagte im Gegenteil sehr vergnügt ja. Er war sogar sehr hungrig. Die Koffer überließen sie der Obhut der alten Dame. Später wollten sie sie dann holen. Sie stiegen in die Droschke ein, die gewartet hatte, und fuhren ab.
Wie sonderbar, Brown hatte keine Ahnung gehabt, daß Mouleville so groß war. Sie fuhren nach einem Viertel, das Brown noch nie betreten hatte. Alles Englische und englisch Aussehende war verschwunden. Nichts in diesen Straßen erinnerte an den Hafen. Endlich hielt die Droschke vor einem Restaurant und Duveen bezahlte.
»A la Vache Enragée« hieß das Restaurant. Seine innere Einrichtung war höchst bescheiden. Gegenüber der Türe war ein Buffet, an dem eine alte Dame saß, genau so wie in dem Café vorhin. Hinter dem Buffet war noch ein zweiter Raum, ebenfalls zu Dinerzwecken reserviert. Das Restaurant war leer, als die beiden Herren eintraten, und sie setzten sich an einen kleinen Tisch; die Dame am Buffet nickte Duveen zu und ein Kellner schlenderte herbei, der Messer und Gabeln vor sie hinlegte.
»Vor allem aber«, sagte Duveen, »möchte ich Ihnen den Rest Ihres Geldes zurückgeben. Mein Interview mit Madame White war nicht gerade angenehm, und ich fürchte sehr, sie hat ihrem Aerger in der Rechnung Ausdruck verliehen!«
Dabei gab er Brown zwei Francsstücke – das wäre alles, was von dem Hundertfrancsschein übrig geblieben sei. Madame Whites Rechnung zeigte er jedoch Brown nicht.
»Das ist aber gesalzen; denn ich habe die Getränke doch jedesmal an der Bar bezahlt«, sagte Brown.
»Ja, schauderhaft. Diese anglo-französischen Hotels sind immer am schlimmsten!« erklärte Duveen. »Engländer lassen sich das eben von Engländern im Ausland gefallen, denn sie haben keine Lust, ihren eigenen Landsleuten ins Gesicht zu sagen, sie seien Schwindler!«
Duveen bestellte das Diner, Brown dabei konsultierend, der zu allem ja sagte. Brown nickte nur fortwährend.
»Und was ich noch sagen wollte, alter Junge«, bemerkte er, »solange ich in Mouleville bin, müssen Sie natürlich mein Gast sein!«
Während des Sprechens noch stieg in ihm der fromme Wunsch auf, seine Tante Lucy sehe doch hoffentlich nicht, was er mit dem schönen Geld der Erbschaft, die sie ihm hinterlassen hatte, eigentlich machte …,
So bescheiden das Restaurant auch war, so ließ doch das Diner nichts zu wünschen übrig. Es war ausgezeichnet. Schon nach dem ersten Bissen verschwanden wie weggezaubert die Absinthdünste aus Mr. Browns Hirn, und er tat den Gerichten alle Ehre an; sein Kopf war vollkommen klar und denkfähig, obgleich jenes merkwürdige Gefühl der Wohligkeit und der Behaglichkeit andauerte. Er hatte nicht viel von dem opalfarbenen Zaubertrank getrunken; da jedoch Absinth ihm etwas so gänzlich Neues war, so hatte der Effekt dieser französischen Form von Alkoholliebhaberei überraschend schnell und kräftig eingesetzt. Jetzt fühlte sich Brown nur noch in wundervoller Laune und war sehr gesprächig. Zum erstenmal seit er in Mouleville war, wagte er es, einen Kellner anzusprechen, denn es war ihm ja so unendlich gleichgültig, ob der Mann ihn verstand oder nicht. Er stritt sich über den Wein mit dem befrackten Ganymed und Duveen lehnte es lachend ab, ihm dabei zu helfen. Einmal müßte er ja doch Französisch lernen. So wurde dem Kellner in einer wahnsinnigen Mischung von Englisch und Französisch bedeutet, er solle mehr Wein bringen, und er möge sich gefälligst beeilen, und er solle doch nicht so viel Lärm dabei machen, und er solle doch die Gläser vollschenken. Brown war wie so viele Leute der Ansicht, eine Sprache, die andere Leute nicht verstehen, würde verständlicher, wenn man sie recht schlecht spräche! Daher sprach er englisch wie ein Chinese:
»You – bringee – wine – very – quick …,«
Duveen wollte sich totlachen. Brown aber, daran konnte kein Zweifel sein, war in brillanter Laune und unterhielt sich ausgezeichnet. Er aß und trank und winkte Madame zu und apostrophierte den Kellner.
»Sehr voll ist es hier aber nicht!« sagte er. (Das Lokal war leer.)
»Nein«, antwortete Duveen. »Die meisten Leute dinieren nicht hier, sondern im Hinterzimmer. Gleich das erste Mal führe ich Fremde nicht gerne in das Hinterzimmer. Die Küche hier ist ausgezeichnet; die beste in Mouleville. Eine derartige Küche finden Sie in keinem hiesigen Hotel, selbst im teuersten nicht. Und dann werden wir hier besonders gut bedient – Madame verwöhnt mich gerne ein bißchen.«
Brown lachte.
»Und mein neues Zimmer?« fragte er, als sie das Diner fast beendet hatten.
»Ich wollte Sie eigentlich im Zimmer des Kaisers unterbringen.«
»Des Kaisers? Im Zimmer welches Kaisers? Wilhelm?«
»Oh nein, oh dear no! Napoleon. In dem Zimmer, das er bewohnte, als er in Mouleville war, um die französische Invasion unseres lieben Vaterlandes drüben über dem großen Wasser in Szene zu setzen.«
»Das wäre sehr schön,« sagte Brown. »Wenn das Zimmer nicht zu groß ist!«
»Es ist gar nicht groß«, erwiderte Duveen trocken. »Aber es ist ziemlich teuer, weil es eben des Kaisers Zimmer ist. Es wird auch beileibe nicht an jeden vermietet. Es ist gar nicht weit von hier. Ich will Ihnen mal etwas vorschlagen: Wir lassen Ihre Koffer aus dem Café holen und schicken den Jungen mit dem Gepäck voraus. Ja?«
»Very well«, sagte Brown. Die Idee mit dem Zimmer des Kaisers gefiel ihm. Er hoffte nur, das Zimmer möchte nicht allzu großartig sein. Dergleichen war er nicht gewöhnt. In einem fürstlich eingerichteten Saal konnte et vielleicht nicht schlafen vor lauter Befangenheit.
» Chasseur!« rief Duveen.
Ein zerlumpter kleiner Junge erschien, der Brown angrinste und die notwendigen Befehle in Hinsicht auf das Gepäck von Duveen erhielt. Im Fortgehen grinste er Brown wieder mißtrauisch an.
»Mir scheint, der Bengel mag mich nicht,« sagte Brown.
»Er ist ein treuer Diener,« erklärte Duveen, »der Fremden gegenüber ein berechtigtes Mißtrauen hegt. Nämlich …, Ja, es geht nicht anders, ich muß Sie in das Geheimnis einweihen!«
»Heh?«
»In unser Geheimnis, Mr. Brown! Dieses Restaurant hier ist das Hauptquartier des V. W. K. von Mouleville!«
»Des Verbandes zur Wiederherstellung des Kaiserreiches, Zweigloge von Mouleville; des Verbandes, der Gut und Blut dafür gibt, Napoleon wieder auf den Thron von Frankreich zu setzen!«
»Oh!« murmelte Brown. Er erinnerte sich daran, was jener Franzose im Speisezimmer des Hôtel des deux Globes über Verschwörer und Verschwörungen gesagt hatte!
»Es ist aber sehr geheim!« mahnte Duveen.
Brown sah ihn mit einem schlauen Blick an. »Ich glaube, Sie sind doch ein Franzose!« sagte er.
»Meine Großmutter war Französin«, gab Duveen zu.
»Wie hieß sie denn?«
»Isaacs.«
»Oh, ich wußte gar nicht, daß das ein französischer Name ist! Ich kenne Leute in England, die so heißen.«
»Meine Großmutter war aber Französin. Sie verlor ihr Vermögen in der guten und großen Sache.«
Es schien Brown, dieser Duveen sei doch eine wichtigere Persönlichkeit, als nach seinem Aeußeren eigentlich zu erwarten war. Der schäbige Mann, der da auf der Landungsbrücke gestanden und sich als Führer angeboten hatte, und der Mann, der jetzt sprach (über solche Dinge!), wie reimte sich das zusammen. – – Und wie ein Blitz kam ihm die Erkenntnis, daß diese anscheinende Disharmonie ja in Wirklichkeit die Wahrheit dessen bewies, was ihm sein Gegenüber erzählte. Er vertraute ihm sein Geheimnis an! Damit verschwand die Notwendigkeit, für jenes bescheidene Auftreten, das ein Mitglied des Verbandes zur Wiederherstellung des Kaiserreichs doch der Welt gegenüber annehmen mußte, eine Erklärung zu geben. Als wäre er dem Gedankengang Browns gefolgt, sagte Duveen plötzlich:
»Ich muß mich darauf verlassen können, daß Sie keiner Menschenseele gegenüber auch nur ein Wort von dem erwähnen, was ich Ihnen anvertraute. Eine einzige unvorsichtige Aeußerung könnte uns unsere Arbeit von vielen Jahren vernichten.«
»Ich sage kein Wort!«
»Ich hätte es Ihnen eigentlich nicht sagen dürfen«, murmelte Duveen.
Es schien, als bereue er seine Vertrauensseligkeit. In Wirklichkeit aber wunderte sich Duveen über seine eigene Einbildungskraft und hegte bange Zweifel, ob es ihm auch gelingen würde, mit der nötigen Wahrscheinlichkeit weiterzulügen. Die Idee mit dem Verband zur Wiederherstellung des Kaiserreiches war ihm erst während des Diners gekommen!
»Sie können mir ruhig vertrauen!« sagte Brown. »Kein Wort kommt über meine Lippen. Und dann – durch Sie will ich ja Frankreich kennen lernen. Ich werde Sie doch nicht verraten!«
Duveen streckte seine Rechte aus und Brown schüttelte sie.
»Für Frankreich!«
»Für Frankreich!« wiederholte Brown und leerte sein Glas.
»Wissen die da drinnen es auch?« flüsterte er, auf das Hinterzimmer deutend.
»Freilich!« antwortete Duveen leise (innerlich lachend). »Die meisten sind eingeweiht, vollkommen eingeweiht! Aber nicht alle. Trauen dürfen Sie niemand; Sie könnten an den Falschen geraten. Vertrauen Sie nur mir!«
Das versprach Brown. Es war ihm jetzt auch durchaus verständlich, daß dann und wann Männer in der Türe des Hinterzimmers erschienen waren und ihn angestarrt hatten. Die wollten eben wissen, wen Duveen da gebracht hatte, sie mußten es wissen als Verschwörer! Es schien ihm, als habe er einen Augenblick lang auch eine Dame auftauchen sehen; aber er war seiner Sache nicht ganz sicher.
»Das Hauptquartier des V. W. K. ist aber nicht sehr luxuriös!« bemerkte Brown endlich. »Prinz Napoleon kommt wohl nicht sehr häufig hier her?«
»Pst – nicht so laut! Pst! Der Prinz ist ein Verbannter. Er darf Frankreichs Boden nicht betreten!« flüsterte Duveen. Dann fügte er geheimnisvoll hinzu: »Wenn er jemals nach Frankreich kommt, dann wissen es nur die Mitglieder des Verbandes. Wie wir darauf warten! Sie sagen, unser Hauptquartier sei nicht luxuriös? Wir sind nicht reich; die meisten von uns haben ihr Vermögen der guten Sache geopfert. Aber das schadet ja nichts. Wenn die große Umwälzung kommt, wird sie uns alle zu reichen Männern machen. Aber selbst, wenn wir reich wären – glauben Sie etwa, wir könnten ein elegantes Klubhaus nehmen? Mann, wir dürfen nicht das geringste Aufsehen erregen. Man sieht, daß Sie niemals ein Verschwörer gewesen sind!«
»Nein – eigentlich nicht!« gab Brown zu.
Es gab ja leider keine Verschwörungen in England. Die einzige Art einer Verschwörung, die Brown jemals erlebt hatte, war, als er einer Versammlung der Angestellten des Emporiums beiwohnte, in der über wünschenswerte Gehaltsaufbesserungen und einen eventuellen Streik debattiert worden war.
»Und die Leute hier mögen einen nicht sehr großartigen Eindruck auf Sie machen«, warnte Duveen, »aber Sie dürfen nie vergessen, daß diese Leute weder ihr wahres Gesicht zeigen, noch sich benehmen dürfen, wie sie wohl möchten – denn sie sind Verschwörer. Sie müssen schauspielern und sie sind geborene Schauspieler, wie alle Franzosen.«
In diesem Augenblick traten vier Männer von der Straße aus ins Restaurant, setzten sich an einen Tisch, bestellten lärmend Wein, und begannen Domino zu spielen.
»Lassen Sie uns von etwas anderem sprechen!« bat Duveen. »Ich kenne diese Leute nicht.«
»Verstehen sie denn Englisch?«
»Das weiß ich nicht; das kann man hier nie bestimmt wissen. Vielleicht sind es Spione – Spitzel. Sie glauben nicht, wie vorsichtig wir hier sein müssen.«
Wieder fiel Brown ein, was jener Franzose im Speisesaal des Hôtel des deux Globes ihm alles erzählt hatte. Der Mann hatte offenbar nicht übertrieben.
»Ich will mal ins Hinterzimmer gehen und sehen, wer alles da ist«, bemerkte Duveen. »Warten Sie hier auf mich, ich werde gleich wieder zurück sein. Trinken Sie noch einen Kümmel! Der Kümmel hier ist ausgezeichnet!«
Brown war allein. Es kam ihm so vor, als ob das alte Weib am Buffet kein Auge von ihm abwende, und es schien ihm, als ob auch die vier Männer am Nebentisch dann und wann von ihrem Dominospiel aufblickten und ihn mit sonderbaren Augen ansahen. Wenn das nun Spione waren. Wenn man ihn für verdächtig hielt! Das wäre ja wundervoll – einfach wunderbar! Was war das für ein prachtvoller Tag ausländischen Erlebens gewesen! Noch am Morgen hatte er sich unzufrieden gefühlt und hatte schon angefangen, zu glauben, der Unterschied zwischen England und Frankreich sei doch nur minimal, mit der einzigen, allerdings wichtigen Ausnahme, daß ihm Frankreich Ferien bedeutete und England Arbeit. – Und jetzt – jetzt fand er sich mitten im schönsten Erleben; im reinsten Zauberland. Er sollte nicht nur intimes französisches Leben kennen lernen, sondern sogar in die geheimnisvollen Kreise hochinteressanter Verschwörer hineingucken dürfen. Wunderbar! Welches Glück er doch hatte. Und dabei hätte er Duveen solche Möglichkeiten niemals zugetraut, sah er doch aus wie andere gewöhnliche Menschenkinder auch; sogar wie ein sehr gewöhnliches Menschenkind – nur ein bißchen ausländisch.
Aber der Tag war denn doch sehr anstrengend für ihn gewesen, und er fühlte sich müde, und er sehnte sich nach des Kaisers Zimmer und nach des Kaisers Bett. Das Zimmer des Kaisers – welches Glück er da wieder gehabt hatte! Wie viele Leute gab es wohl, die, wenn sie nach Mouleville kamen, des Kaisers eigenes Zimmer bewohnen durften? Sehr wenige, sicherlich!
Als Duveen aus dem Hinterzimmer zurückkam, war Mr. Brown von England gerade im schönsten Zuge, sanft einzuschlafen. Der Absinth, das gute Diner, die Liköre, die Erlebnisse des Tages verbanden sich zu einem sehr wirksamen Schlafmittel.
»Was? Eingeschlafen?« rief Duveen.
»Beinahe.« – Brown sah seinen Freund schläfrig an, fragend. Dann fiel ihm das Hinterzimmer und die Verschwörung ein.
»Was sagten sie?« erkundigte er sich neugierig.
»Alles in Ordnung. Ich verpfändete mein Wort für Sie. Heute abend sind Sie, glaube ich, schon zu müde, um eingeführt zu werden; wir wollen das lieber auf morgen verschieben.«
»Bin auch müde –« gähnte Brown.
»Dann, en avant, nach dem Zimmer des Kaisers. Sie werden ausgezeichnet schlafen in des Kaisers Bett.«
So verabschiedeten sie sich herzlich von der patronne und machten sich auf den Weg – einen ziemlich langen Weg, eine ziemlich steile Straße hinan. In der frischen Luft fühlte sich Brown gar nicht mehr schläfrig. Immer steiler wurde der Weg. Kreuz und quer ging es durch Gäßchen, die sich glichen wie ein Ei dem anderen.
»Ich werd' mich hier im Leben nicht wieder zurechtfinden«, sagte Brown.
»Ist auch gar nicht nötig«, antwortete Duveen. »Dafür bin ich ja da. Morgen früh hole ich Sie ab!«
Endlich kamen sie zu dem Haus, in dem der große Kaiser gewohnt haben sollte. Von außen sah es nichts weniger als verlockend aus. Sie kletterten Treppen empor, deren Schmutzigkeit selbst in dem trüben Licht der winzigen Petroleumlämpchen allzu deutlich hervortrat. Sie kletterten – – –
»Wohnte der Kaiser im vierten Stock?« fragte Brown.
»Natürlich – er war gerne hoch droben; er war ja so ehrgeizig. Außerdem liebte er die frische Luft und die Nähe der Sterne. Von diesem Fenster aus hier pflegte er seinen eigenen Stern, wie er ihn nannte, zu beobachten.«
»Hm«, sagte Brown. »Das Fenster ist sehr klein.«
»Der Kaiser hat vor ihm gestanden.«
»Dunkel hier, nicht wahr? Gibt es kein elektrisches Licht?«
»Es gab keines zu des Kaisers Zeiten. Sie begreifen – in diesem Zimmer darf nicht die geringste Kleinigkeit verändert werden!«
»Ich verstehe. Natürlich!«
Brown genierte sich gräßlich, von einem historischen Zimmer elektrische Beleuchtung verlangt zu haben, und fürchtete, Duveen könne sich in seinen napoleonischen Gefühlen verletzt fühlen. Trotzdem; das Zimmer war unbestreitbar lächerlich eingerichtet für einen Kaiser. Es war sogar mehr als bescheiden, selbst für Brownsche Verhältnisse; sein verflossenes Zimmer im Hôtel des deux Globes war dagegen prunkvoll gewesen. Mr. Brown trat zu dem Fensterchen. Draußen war der schönste Mondschein und die Hellen Mondstrahlen beleuchteten – eine riesige Mauer, dem Fenster gegenüber, keine fünf Meter entfernt; eine Mauer, die jedes Atom von Aussicht versperrte. Browns Gesicht wurde immer länger und länger …,
»Sehr geeignetes Zimmer für Verschwörer«, lachte Duveen. »Niemand kann hier ins Fenster sehen!«
»Bestimmt nicht!« brummte Brown. »Ließ sich der Kaiser nicht gerne im Fenster sehen?«
»Nein! Das haßte er. Er hat die Mauer eigens bauen lassen.«
Das freute Brown. Wenn nicht der Kaiser selbst es gewesen wäre, der diese Mauer errichten ließ, so würde sie ihm höchlichst mißfallen haben! Die Koffer standen in einer Ecke, aber Brown war viel zu müde zum Auspacken. Er nahm nur sein Nachtzeug heraus.
»Ist dies das Bett, in dem der Kaiser schlief?« fragte er.
»Es ist des Kaisers Bett«, antwortete Duveen mit allen Anzeichen tiefer Rührung. »Sie begreifen: er schlief gern in einem Feldbett; er war Soldat.«
Eine kleine eiserne Bettstelle war es, die aber auch gar nichts Kaiserliches an sich hatte, eine Bettstelle, deren Wert Brown beruflich auf elf Shilling und elf Pence geschätzt haben würde.
»Des Kaisers Bett! Denken Sie mal an!« bemerkte Brown. »Ich hätte nicht geglaubt, daß dieses Bett hundert Jahr alt sein könne!«
»Wir mußten es frisch lackieren – zum Schutze der Reliquie gegen Rost!«
»Ah so! Dagegen der Teppich, der ist bestimmt hundert Jahre alt«, sagte Brown im Brustton vollster Ueberzeugung.
Der fadenscheinige Teppich zeigte sehr abgenützte Stellen, überall da, wo er keine Löcher hatte; seine Farbe war ein Ding geheimnisvoller Vergangenheit, und wenn man über ihn schritt, so glaubte man, auf Asphalt zu schreiten. Er war bedeutend härter als ein Brett.
»Die Einwohner von Mouleville legten ihn zu Napoleons Füßen!« rief Duveen, mit Tränen in den Augen.
»Merkwürdig, daß Mouleville nicht ein Museum errichtet aus diesen Dingen. Sie müssen sehr wertvoll sein.«
»Die Oeffentlichkeit hat keine Ahnung von der Existenz dieses Zimmers«, rief Duveen. »Mouleville weiß geschichtliche Werte nicht zu würdigen. Des Kaisers Zimmer ist nur für Leute wie Sie und ich, mein Junge, und wenige andere Auserwählte.«
Brown fand das sonderbar. Seiner Erfahrung nach wußten die meisten Leute geschichtliche Werte zu würdigen, vorausgesetzt, daß Geld in ihnen steckte; aber er war nach und nach wieder sehr schläfrig geworden und hatte gar keine Lust mehr, zu debattieren. Des Kaisers Bett, oder nicht des Kaisers Bett – ins Bett wollte er!
»Gute Nacht, Duveen.«
»Good night!« sagte dieser ingeniöse Kenner französischer Dinge. »Morgen in aller Frühe hole ich Sie ab.«
»Ja nicht zu frühe!« mahnte Mr. Brown. Das klang, als sollte er um fünf Uhr aufstehen, und dazu verspürte er nicht die geringste Lust.
»Um zwölf Uhr ungefähr. Ist das zu früh?«
»Zwölf? Oh, dear no! Stehen Sie denn immer so spät auf?«
»Oh, ich habe da keine bestimmten Gewohnheiten,« erklärte Duveen. »Wenn ich nicht gerade Arbeit an Hand habe, bleibe ich im Bett. Meine Zeit ist nicht mein Eigen, Sie verstehen.«
»Natürlich; ich vergaß!«
Visionen stiegen auf vor Browns geistigem Auge von nächtlichen und anstrengenden Verschwörungen des Verbandes zur Wiederherstellung des Kaiserreiches. Da mußte man ja müde sein. Vielleicht hatte er den armen Duveen denn doch zu schlecht behandelt eben. Durfte man kleinlich sein im göttlichen Frankreich? Und was ist schließlich ein Zimmer!
Kaum hatte sich sein neuer Freund empfohlen, als Brown schon in des Kaisers Bett kugelte, das übrigens gar nicht so übel war. Wenn man die Beine ein wenig emporzog, so war es auch lang genug. In wenigen Minuten war Brown eingeschlafen. Vielleicht träumte er von den gewaltigen Legionen, die auf einen Wink des kleinen Korporals Europa überschwemmten – von dem titanischen Riesengeist, der auf diesen bescheidenen Kissen geruht …,
Jedenfalls schlief er ausgezeichnet.