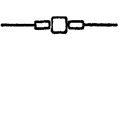|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Mr. Brown aus England findet endlich seine Sehnsucht erfüllt, betritt jubelnd französischen Boden, und ist entzückt vom Lande der Trikolore …,
Die beiden schweren Koffer, die er schleppte, rissen ihm beinahe die Schultern aus den Gelenken. Sein Herz aber war leicht, leicht wie die feinen weißen Wölkchen, die droben im blauen Raume Haschen spielten …, Brown kletterte mühevoll das steile Fallreep hinan, das den Dampfer mit der Landungsbrücke von Mouleville verband. Ein Beamter mit vielen Goldborten riß ihm die Fahrkarte aus den Zähnen (dort hatte Brown sie untergebracht, weil sonst nirgends Platz war), und einen Augenblick später trat Mr. Brown aus England auf französischen Boden.
Frankreich! Das Land seiner Träume! Das Ziel seiner Sehnsucht! Und dies hier war also Frankreich!
Freilich, das riesige Kruzifix am Hafeneingang hatte einen sonderbaren Eindruck auf ihn gemacht; ist doch dem Engländer das Bild des Gekreuzigten in freier Natur fremdartig. Und dann, Brown war zwar ein braver Mann und frommer Christ, aber – hm – der Anblick paßte nicht recht, nun, er paßte nicht recht in seine Stimmung hinein. Das stimmte nicht so ganz zu den Vorstellungen, die er sich von Frankreich gemacht hatte. Nein, das Ziel seiner Wünsche war nicht ein Kloster – ganz im Gegenteil!
Doch nur einen Augenblick lang war er verstimmt. Dieser Sonnenschein! Diese fröhlichen Menschen, die da an Land in kindlicher Neugierde zusahen, wie die Leute den Dampfer verließen!
Er stolperte und fiel, nicht gerade graziös, auf den französischen Zement der Landungsbrücke. Sein erster Impuls war, seinen Unmut in dafür geeigneter Sprache zum Ausdruck zu bringen, aber dann fiel ihm ein, das sei ja ein gutes Omen! Und mit gutmütigem Lächeln quittierte er das laute Gelächter der Zuschauer, die sich hinter dem Strick drängten, der die Landungsbrücke absperrte. So nahm er Besitz von Frankreich, dem Land seiner Träume und Sehnsüchte. Endlich trennte ihn ein gewaltiger tiefer Streifen Wassers von England …,
Mr. Brown war im Ausland!
Endlich im Ausland – um Jahre jünger machte ihn der Gedanke, und die unendliche Ruhe des Glücks kam über ihn. Er merkte es gar nicht, wie die schweren Koffer an seinen Schultergelenken zerrten; er stand himmelhoch über solchen Dingen. Welcher Friede! Welch ein Vergessen vergangenen grauen Alltagslebens. Hier war er – ein freier Mann, neugeboren in einem neuen Land.
Seit Jahren schon war es Browns Sehnsucht gewesen, ins Ausland zu reisen. Nein, es war kein eigentliches Reisefieber. Nur im Ausland wollte er einmal sein; nur einmal sich nicht eingesperrt, beengt, gefangen fühlen auf jener kleinen Insel mit dem stolzen Namen. Wie lange hatte er sich danach gesehnt! Seit seinem fünfzehnten Lebensjahre – und Brown war jetzt dreißig – hatte sich sein ganzes Leben im Emporium abgespielt, dem großen Kaufhaus des kleinen englischen Städtchens Brixton; er war (verzeihen Sie das harte Wort, würde Wippchen sagen), – ein Kommis. Es war seine Lebensaufgabe, die Nackten zu bekleiden – besonders in Bezug auf Hände und Füße – und zwar möglichst billig für die zu Bekleidenden, vorausgesetzt, daß ein kleiner Profit für das Emporium übrig blieb. Die Nackten zu bekleiden – das ist eine edle Lebensaufgabe. Aber Brown war sich leider auch vollkommen bewußt, daß die billigen Preise nicht etwa in philantropischen Motiven ihre Gründe hatten, sondern in der Furcht, der Kunde könnte wo anders kaufen. Er haßte das Geschäft; er war es müde, Herrensocken um Fäuste zu wickeln, als ob man diese notwendigen Kleidungsstücke an der zum Fuß gehörigen Männerfaust abmessen könne. Er tat es, aber er fand es unlogisch. Es ging ihm, wie so manchem Diener des Herrn, der mechanisch die Taufe vollzieht, aber unter bangen Zweifeln.
Es war immer schlimmer geworden mit dieser Sehnsucht nach Veränderung. Er zitterte, wenn ein Fremder ins Emporium kam. Von welcher fremdartigen Stadt mochte er (oder sie) wohl kommen? Eine furchtbare Verachtung für seine erbärmliche Existenz stieg in ihm auf, wenn er einen Handschuh um ein italienisches Damengelenk knöpfte – denn manchmal kamen wirklich Kinder des Südens in das Emporium von Brixton. Diese Kinder des Südens waren glücklich daran, wenn Brown sie bediente, denn dann ließ er mit sich handeln.
Selbstverständlich liebte er England. Aber es war ihm zuviel England. Er hätte England gerne gesehen, so wie einst Julius Cäsar – von Rom kommend. Ein Gefühl war in ihm, als müßte man andere Länder und andere Sitten kennen lernen. Und dann wollte er das Emporium los sein, sein Departement los sein, frei sein, wenigstens für kurze Zeit, als:
»Brown – Globetrotter – Weltmann!«
Das war Grund Nummer eins. Dann kam Grund Nummer zwei – Amelia. Diese junge Dame mit dem schönen Namen; und er hatte so lange geflirtet, bis aus den harmlosen Spaziergängen eine Verlobung geworden war. Und Amelias Ketten mußten abgeschüttelt werden!
Amelia war ein Flirt. Eine Verlobung war ihrer Ansicht nach noch lange kein Grund, nicht mit anderen Herren zu liebäugeln. Es machte ihr anscheinend großes Vergnügen, den armen Brown eifersüchtig zu sehen, denn es war ihre größte Freude, ihm ihre verschiedenen Fälle von Untreue möglichst umständlich zu erzählen. Wehrte er sich, so sagte sie: Keine Liebe ohne Vertrauen! Außerdem erklärte sie sich mit Vergnügen bereit, die Verlobung wieder aufzulösen. Das war ein sehr amüsantes Spiel (für Amelia), aber Browns Nerven gingen nach und nach zum Teufel. Und das schlimmste war, daß er weder unternehmungslustig noch mutig genug war, sich zu revanchieren.
Diese Auslandsreise, – die sollte einmal eine gründliche Lektion für Amelia sein!
Brown fand seine Erfahrungen mit Amelia beschränkt; sein weiblicher Gesichtskreis mußte erweitert werden – eine gewaltige Sehnsucht war über ihn gekommen (wie er sich ausdrückte), die ganze Welt zu umarmen. Leute in einem derartigen Zustand sagen das häufig. Wahrscheinlich wäre Brown auch mit einer weniger umfassenden Umarmung zufrieden gewesen.
So sah es in Brown aus, als die Klimax kam. Eine Tante starb plötzlich (Brown hatte schon längst auf dieses Ereignis gewartet), und hinterließ ihm ein nettes kleines Sümmchen. Wozu waren denn Tanten sonst da! Einen Teil dieses Sümmchens gedachte Brown zu verpulvern. Wie? Als Weltmann natürlich. Im Ausland! Ueber englische Vorurteile war er schon längst hinausgewachsen – seine Gefühle neigten in einer gewissen historischen Zeit den Buren zu (heimlich), obgleich diese Gefühle Schiffbruch litten, als die Nachricht von den ersten englischen Siegen kam und Brown lauter Hurra brüllte als irgend ein anderer Mann in Brixton. Damals hatte Brown sich der Khaki-Brigade als Rekrut angeboten, war aber wegen nicht genügenden Brustumfangs zurückgewiesen worden. Und da sollte man Patriot sein? Maßen vielleicht andere Länder ihre Helden mit dem Meterstabe? Was für Spießbürger doch diese Engländer waren, dachte er sich oft. Hatte jemals ein Engländer Barrikaden errichtet? Waren jemals englische Damen und englische Herren in vornehmer Gleichgültigkeit, mit Spitzentaschentüchern dem wütenden Volke zuwinkend, zum Schaffot geschritten?
Englands Politik gefiel ihm nicht; seine splendid isolation gefiel ihm nicht; sein pharisäisches Selbstbewußtsein gefiel ihm nicht. Er persönlich hatte gar keine Lust, isoliert zu sein. – – Und ehe er England für besser hielt als andere Länder, hätte er diese Länder gern erst mal gesehen. Außerdem hatte ihn da sein Beruf gewitzigt: Die Waren, die mit der Marke »made in England« protzten, waren leider nicht immer die besten.
So etwas wie Gewissensbisse waren in ihm aufgestiegen, als er Amelia mitgeteilt hatte (brieflich, der Vorsicht halber), er reise ins Ausland. Doch waren die Gewissensbisse weder sehr kräftig noch dauerten sie lange. Brown hatte nämlich tags vorher einen besonders intensiven Krach mit Amelia gehabt …, Na, das war erledigt.
England, inklusive Amelia, lag da hinten und vor ihm breitete sich dies große, schöne Land aus. Es war jedoch nicht seine Absicht, in diesem großen und schönen Land umherzureisen. Mouleville genügte ihm vollkommen als Symbol Frankreichs – Mouleville bedeutete ihm ein Muster dessen, was Französisch war. Und Musterkarten wußte er beruflich zu würdigen.
So leicht sein Herz war, so schwer waren doch die Koffer. Das spürte er endlich und fühlte sich sehr erleichtert, als er die gewichtigen Stücke auf die etwas schmutzige Plattform der douane stellte. Ein alter Mann mit mürrischem Gesicht und einem Metallschild mit einer Nummer am Arm kam auf ihn zu und redete in einem fürchterlichen Wortschwall auf ihn ein.
Brown schwankte zwischen zwei Gemütsbewegungen: maßloser Freude, für einen Franzosen gehalten zu werden, und bitterer Scham, keine Silbe von dem Zeugs zu verstehen. Mit großer Geistesgegenwart gab Brown jedoch diejenigen beiden französischen Wörtchen zur Antwort, die ihm, abgesehen von beruflichen Ausdrücken wie chic und chiffon am geläufigsten waren:
»Uih merci –«. Die Antwort war mager, aber sie schien dem alten Mann mit der Nummer vollkommen zu genügen. Denn er sagte prompt auf Englisch:
»Gepäck wird hier visitiert!«
Brown nickte ärgerlich. An was ihn dieser Mensch wohl schon als Engländer erkannt haben mochte? Da kam ein Zollbeamter auf ihn und den alten Mann zu, mit einem Stück Kreide in der Hand. Dann schien er (das ist eine Eigentümlichkeit von Zollbeamten überall in der Welt), sich die Sache anders zu überlegen, kehrte wieder um und wandte sich anderen Koffern zu. Der Gepäckträger – der alte Mann mit der Nummer war nämlich ein Gepäckträger – fluchte. Brown freute sich. Das war ja reizend; so individuell, so eigenartig; gar nicht wie in England, wo einer nach dem anderen der Reihe nach daran kam. Der Gepäckträger fluchte mit großer Ausdauer und mit anscheinend bedeutendem Talent weiter und gestikulierte fürchterlich. Das hätte vielleicht auch geholfen, wenn nicht eben zwölf andere Gepäckträger ebenso geflucht und genau so gestikuliert hätten. Endlich kam aber doch ein Zollbeamter, nachdem Browns Gepäckträger ihn zwölf Minuten lang mit Tränen in den Augen darum angefleht hatte.
»Vous n'avez rien à déclarer? Tabac, allumettes, cognac, odeurs?«
»Zündhölzer, Tabak, Brandy?« übersetzte der Gepäckträger. »Haben Sie nichts zu verzollen?«
»Nicht einmal mein Genie!« hätte Brown nach berühmtem Muster sagen können, oder er hätte dem Beamten auch versichern können, in dem Koffer stecke gewiß keine Leiche. Aber dazu besaß Brown nicht Witz genug und begnügte sich daher, ohne irgend welches Erröten glatt und unverschämt zu lügen:
»Nein!«
Dabei sah er den Beamten mit einiger Nervosität an. Scheußliche Situation! Als Junge hatte man Prügel bekommen fürs Lügen, und hier – –
Aber der Beamte begnügte sich damit, zwei Kreidezeichen auf Browns Koffer zu malen, obgleich er Brown dabei mit einem Blick ansah, als verzweifle er an der Wahrheitsliebe des Menschengeschlechts. Der Gepäckträger lud die Koffer auf seine Schulter. Sie enthielten, nebenbei bemerkt, Unmassen von Zigarren, Zigaretten, Zündhölzern und drei Flaschen Whisky. Brown war noch nicht Kosmopolit genug, um Frankreich geruhigen Herzens zuzutrauen, daß es auch dort solche Dinge gäbe. Er schleppte sie lieber mit. Der Gepäckträger ging voraus.
»Unglaublich, wie sich Leute über hohe Zollgebühren aufregen können!« sagte sich Brown. »Es ist doch ganz einfach. Man muß nur Glück haben!«
Es ging Brown wie vielen anderen Leuten: Sonst der ehrlichste Mensch der Welt, machte er sich jetzt nicht das geringste Gewissen daraus, die französische Regierung kalt um den gesetzlichen Zoll zu betrügen.
»Welches Hotel befiehlt Monsieur?« fragte der Kommissionär.
Brown machte ein verdutztes Gesicht und stand unschlüssig da.
»Hotel Metropole!« empfahl der Kommissionär. »Ein anderes Hotel kommt gar nicht in Betracht!« (Vom Standpunkt des Kommissionärs aus allerdings nicht; denn vom Hotel Metropole bekam er ein größeres pourboire für einen zugeführten Gast als irgend wo anders.)
Brown temporisierte. Er befahl dem Gepäckträger, seine Koffer im Gepäckraum zu deponieren, gab ihm ein für französische Verhältnisse geradezu blödsinnig großes Trinkgeld und entließ ihn. Er freute sich, ihn los zu werden. Allein wollte er sein – ohne Hilfe seine ersten Eindrücke empfangen – selbständig sehen! Mit jungfräulichen Augen wollte er Frankreichs Wunder schauen …,
Ah! Er war im Ausland – er war wirklich und wahrhaftig und ganz gewiß im Ausland. Die komischen blauen Reklamen an den Häusern, die Häuser selbst, die so entzückend wackelig und schmutzig aussahen; die Greise, die an den Straßenecken oder vor kleinen Cafés bummelten; die Männer, denen in so scharfem Gegensatz zu dem glattrasierten Brown überall im Gesicht Haar wuchs, wo nur ein Plätzchen dafür war; jener zwar nicht angenehme, aber doch unbestreitbar eigenartige Geruch, den seine zitternden Nasenflügel auffingen – ah, das war Ausland!
Das war die Erfüllung jahrelanger Wünsche!
Mr. Brown von England trug einen karrierten eleganten Straßenanzug, und sein Kopf war bedeckt mit einer Mütze, die zwar wesentlich zu klein war, dafür aber in desto lauteren Farben in den schönen Sonnenschein hinausschrie. Es wäre Brown im Traum nicht eingefallen, im göttlichen Frankreich einen langweiligen, steifen, englischen Hut zu tragen. Also trug er etwas noch Englischeres: eine Mütze. Und außerdem war ihm die Mütze lieb und wert; war es doch die alte offizielle Mütze in den Farben seines alten Cricket-Klubs, der vor etlichen Jahren leider zu Grunde gegangen war, weil der Sekretär mit der Geldkasse auskniff. So betrachtete sich Brown die Welt unter lieben alten Farben und sagte sich lächelnd, Dame Zufall sei doch ein sonderbares Frauenzimmer.
Dies war das Ausland! Sicher! – Liefen vielleicht in England die Eisenbahnzüge mitten durch die Straßen einer Stadt? Gab es vielleicht dort Frachtzüge, dahinpfauchend mitten durch einen Markt von Grünzeug und Eiern und Geflügel? Und wie gemütlich sah das aus. Wie engherzig und kalt waren doch dagegen englische Eisenbahnmethoden. Hier spazierte ein Mann mit einer roten Flagge in wichtigem Beamtentum dem Zug voraus und an seiner Seite schritt eine alte Frau in einem großen Strohhut, einen wohlgefüllten Marktkorb am Arm. Sie und der Mann mit der roten Flagge unterhielten sich lebhaft. Endlich blieben sie beide stehen und umarmten sich in zärtlichem Abschied. Brown schwört heute noch Stein und Bein, daß die Lokomotive noch langsamer fuhr, um dem zärtlichen Paar ja genügend Zeit zu lassen. Wie natürlich – wie entzückend – und wie ausländisch! Da verschwand der Zug um eine Ecke und Brown (auf der Suche nach einem Hotel) verschwand um eine andere Ecke. Der Mann vor dem Eisenbahnzug winkte ihm noch mit der roten Flagge freundlich zu und Brown hielt es für das richtige, dankend die Mütze abzunehmen vor der Lokomotive.
Er fand sich in einer kleinen Straße, die hinunter nach dem Hafen führte, als dicht vor ihm eine lärmende Kinderschar aus den Toren eines riesigen Gebäudes strömte. Jungen und Mädels warens in Galakleidern, und jedes Kind trug zum mindesten ein Buch unter dem Arm in wunderschönem rotem Einband; andere Kinder wieder trugen ganze Packen solcher roter Bücher – da und dort keuchte ein kleiner Kerl förmlich unter seiner Last. Und auf den Köpfen der Kinder waren künstliche Lorbeerkränze von besonders aggressiver grüner Farbe, und viele der Kinder trugen solche Lorbeerkränze auch noch in den Händen. So marschierten sie aus den Toren, begleitet von erwachsenen Leuten, die logischerweise höchst wahrscheinlich Eltern sein mußten. Brown stellte sich hin und guckte zu. Hinter den Kindern kamen Männer, die wie Lehrer aussahen, und diese Männer trugen furchtbar viel rote Bücher und noch mehr Lorbeerkränze.
Brown wunderte sich eben über die Bücher und Lorbeerkränze, als ein höflicher junger Mann ihn ansprach und ihm sehr liebenswürdig erklärte, was die Kinder, die Bücher und die Kränze bedeuteten:
»Es ist Schulschluß, Monsieur; die Kinder tragen ihre Preise nach Hause.«
Preise! So viele Preise bekamen französische Kinder! Was das für kluge Kinder sein mußten …, Kein Wunder, daß England langsam zum Teufel ging und die jungen französischen und deutschen Kaufleute sich so breit in London machten! Gab es irgendwo in England eine Schule, wo jeder Bub und jedes Mädel einen Preis gewann? Oh nein, den gewann nur der Primus. Wie klug diese französischen Kinder sein mußten! Und was die Lorbeerkränze anbetraf – na, die Lorbeerkränze kamen ihm höchst merkwürdig vor. Es wäre ihm furchtbar unangenehm gewesen, wenn man zum Beispiel ihm zu irgend einer Zeit seines Lebens einen Lorbeerkranz aufs Haupt gedrückt hätte …,
Brown übertrieb. Nicht alle Kinder hatten Preise. Eben kam ein kleiner Junge heraus, der weder ein rotes Buch noch einen Lorbeerkranz trug. Er heulte und tat Brown sehr leid. Der kleine Junge schlich in großem Bogen (laut heulend) auf einen der Lehrer zu, der ein gewaltiges Paket von Büchern und Lorbeerkränzen unter dem Arm trug. Brown verstand natürlich nicht, was der Junge zu dem Lehrer sagte, aber er erriet, daß der kleine Junge diplomatische Unterhandlungen um ein rotes Buch oder um einen Lorbeerkranz führte. Brown versetzte sich in die Seele dieses kleinen Jungen und verstand sofort, daß es ihm natürlich furchtbar unangenehm sein mußte, ohne einen Preis nach Hause zu kommen, – als verlorener Mensch ohne einen Preis in der Welt dahinzuwandern und vielleicht einmal sterben zu müssen, ohne ein rotes Buch oder einen Lorbeerkranz zu besitzen, die man ihm hätte ins Grab legen können.
Der Lehrer schritt ruhig dahin, als sei der kleine Junge neben ihm Luft. Endlich aber blieb er stehen, suchte aus seinem roten Bündel das allerdünnste Buch heraus und gab es dem Jungen, der laut aufschluchzte und furchtsam mit einem schmutzigen kleinen Finger auf das Bündel von Lorbeerkränzen deutete. Hier aber hörte die Gemütlichkeit auf. Der Lehrer war hart wie Stahl – kein Knabe dürfte mit Lorbeeren geschmückt werden, der sie nicht verdient hatte. Der kleine Junge schien auch schließlich einzusehen, daß er seine wertvolle Zeit nur nutzlos verschwendete, und verschwand im Trab, dicht an Brown vorbei. Brown sah mit großem Interesse, wie er das dünne rote Buch triumphierend an sein Herz drückte. Dieser Junge hatte soeben seine häusliche Ehre gerettet! Die Ehre seiner Eltern. Die Ehre der ganzen Familie!
Brown wurde immer neugieriger. Manche der Kinder hatten acht Bücher und fünf Lorbeerkränze – für welche Leistungen um Gottes willen sie das Zeug wohl bekommen haben mochten? Brown stellte sich hin und zählte an den Fingern:
»Geographie, Schreiben, Lesen, Rechnen …,«
Da fiel ihm wieder etwas auf. Junge Männer kamen aus der Schule, die wie Seeoffiziere aussahen. Auf jeden Fall trugen sie Uniformen und waren mit Goldborten förmlich übersät. Die meisten hatten gewaltige Bärte. Brown wunderte sich, welchen Rang sie haben mochten. Kapitäne mindestens, seiner Ansicht nach.
»Das sind die Lycée-Knaben, Monsieur; von der Ecole Condorcet«, sagte der junge Mann von vorhin, der ihm nachgegangen war.
»Knaben? Aber wie alt sind sie denn?«
»Das weiß ich nicht, Monsieur, alle Altersstufen von vierzehn bis zwanzig.«
Und Brown hatte sie für Kapitäne gehalten! Welch ein wundervolles Land! Mr. Browns Horizont erweiterte sich rapide …,
Brown sah sich vor die angenehme Aufgabe gestellt, sich ein Hotel zu suchen. Die ganz großen waren ausgeschlossen, interessierten ihn auch gar nicht. Die sahen aus wie jedes andere Hotel auch, international sozusagen – und Brown wünschte etwas ausgesprochen Französisches. Lieber nicht allzu französisch, sagte er sich aber, als er nachdachte, denn Brown war ein vernünftiges Menschenkind und machte sich keine Illusionen darüber, daß man mit einem Sprachschatz von oui und merci nicht übertrieben weit kommen kann. Also eine Art Mittelding. Es war ja wunderschön, ein Fremder in einem fremden Lande zu sein, aber Brown wollte auch nicht gerade übertrieben fremd sein. Wie traurig wäre Brown gewesen, hätte er gewußt, daß man in sämtlichen Hotels von Mouleville so gut Englisch sprach wie Französisch! Mouleville, am Kanal, mit einer halb englischen Bevölkerung, war nicht gerade der richtige Ort für einen, der allem Englischen krampfhaft auswich und dessen einziger Wunsch es war, möglichst kein Englisch zu hören.
Endlich zog ein kleines Hotel seine Blicke auf sich, in dessen Fenstern riesige Blumenkästen standen, während über der Türe in einem schwebenden Blumenkorb wunderschöne Geranien prangten. Es sah sehr hübsch aus. Die Wahl der Blumen und das Arrangement der Blumen hatten vielleicht etwas Englisches, aber das fiel Brown glücklicherweise nicht auf, sonst wäre er an diesem Hotel bestimmt vorbeigegangen. Brown stellte sich hin und guckte. Ein Page, in einer roten Uniform, die augenscheinlich sehr auf das Wachsen des kleinen Trägers berechnet war, nach jeder Richtung hin, trat aus der Türe und überreichte ihm eine Karte.
»Uih merci«, sagte Brown.
Auf der Karte stand: Hôtel des deux Globes und darunter: Hotel of two Globes. Brown betrachtete sich die Karte, ohne lange zu überlegen, welches wohl die zweite Erdkugel sein mochte, und las sie sorgfältig durch. Die Karte besagte, daß Madame White die Eigentümerin sei und daß die prix sehr modérés seien. Das verstand Brown ganz gut. Und dann kam eine Bemerkung, die den unschlüssigen Reisenden zu einem raschen Entschluß zu Gunsten der zwei Erdkugeln brachte: »Es wird englisch gesprochen. Französische Küche.«
»Das ist genau das, was ich haben will!« murmelte Brown.
»Allright!«
Er trat an dem kleinen Pagen vorbei, vor dem er höflich seine Mütze zog (aus irgend welchen Gründen war er der Ansicht, daß man im Ausland möglichst häufig den Hut abnehmen müsse, und er war fest entschlossen, sich den Landessitten in jeder Hinsicht anzubequemen). Dann stolperte er über eine Strohmatte im Hausgang und fiel sehr glücklich in einen kleinen Raum zur Linken, mit einem echt englischen Bartisch eingerichtet, der aber doch genügend ausländisch aussah, um Brown nicht allzusehr vor den Kopf zu stoßen.
Hinter der Bar saß eine Dame, die sehr energisch die Messingteile der Biermaschine putzte. Es war eine Dame jenes tatkräftigen Alters, das mit runden Schultern respektable Energie verbindet. Sie sah gutmütig und appetitlich aus. Brown wunderte sich nur ein wenig über ihre Eleganz. Der Nachmittag war heiß, und sie trug eine energisch ausgeschnittene Bluse, die einen wohlgerundeten Hals und nichts weniger als magere Schultern enthüllte. Sie sah Brown an und lächelte über sein Stolpern, sehr schöne weiße Zähne zeigend. Am anderen Ende der Bar saß ein junges Mädchen von etwa zwanzig Jahren. Die Tochter offenbar. Sie war damit beschäftigt, Ansichtspostkarten zu schreiben; eine Arbeit, die ihr viel Vergnügen machen mußte, denn sie kicherte fortwährend.
»Madame White?« sagte Brown.
»Gewiß, Monsieur, wünschen Sie Zimmer oder kommen Sie nur in die Bar?«
Die Frau gefiel Brown – sie war ein so ausgesprochener Gegensatz zu der Magerkeit englischer Damen! Zwar sprach sie englisch, doch das Wort Monsieur machte sich gut. Außerdem schien es Brown, als habe ihr Englisch einen ausländischen Akzent. Madame White nannte ihm Preise von Zimmern und Pension und rief, sich halb herumdrehend, durch eine offene Türe hinter der Bar:
Brown fuhr zusammen wie von einer Tarantel gestochen.
»Amelia!«
Brown schauderte. War es nicht sonderbar, daß der erste Frauenname, den er im Ausland hörte, der Name einer jungen Dame war, die er, den Göttern sei Dank, weit drüben über dem Wasser wußte? Und deren Namen er durchaus nicht zu hören wünschte! Mit so etwas wie Furcht starrte er auf die Türe und er hätte sich faktisch nicht gewundert, wenn im nächsten Augenblick das wohlbekannte, allzu energische Gesichtchen aufgetaucht wäre. Brown starrte.
»Allright!« murmelte er endlich mit einem Seufzer der Erleichterung, denn nun trat aus der Türe ein hübsches rundliches Mädchen, die der anderen jungen Dame hinter der Bar sehr ähnlich sah.
»Du hast gerufen, Maman?«
Das junge Mädchen war sehr elegant; offenbar stand sie im Begriff, auszugehen. Brown hatte ein Gefühl, als hätte er sie nicht stören dürfen.
»Zeige dem Herrn Nummer sechsundzwanzig, liebes Kind«, sagte die Mutter.
Miß Amelia tänzelte, sich kokett in den Hüften wiegend, voraus, und Brown folgte ihr die Treppe hinauf, mit großem Interesse das bunte Strumpfmuster betrachtend. Drei Treppen ging es hinauf. Dann öffnete das Mädel die Türe eines Zimmers und Brown trat ein. Das Zimmer sah sehr nett aus, namentlich auf den ersten Blick, obgleich Brown später entdeckte, daß die Einrichtung doch recht schäbig war. Den Boden bedeckte ein stellenweise sehr abgenutzter Teppich; vor dem Waschtisch lag ein schreiend gelbes Stück Linoleum. Aus den Fenstern konnte man auf den freien Platz und auf den Hafen sehen.
»Es ist ein sehr schönes Zimmer«, sagte Miß Amelia.
Dabei arrangierte sie mit flinken Fingern und raschen geschickten Griffen ihr Haar vor einem Spiegel, der die Türe zum armoire bildete. Dann tat sie etwas, das Brown vorkam, als risse sie riesige Stücke der Tapete ab. In Wirklichkeit aber öffnete sie nur die Wandschränke, deren Türen mit der Tapete verkleidet waren.
»Wie ausländisch«, dachte Brown.
»Das Zimmer gefällt mir gut, Miß; danke schön.«
Er traute sich nicht recht, ihr gegenüber sein stereotypes uih merci anzuwenden. Sie sah so sehr wie ein englisches junges Mädchen aus, wenn auch ihre Kleider viel farbenfreudiger und viel besser gemacht waren.
»Monsieur nimmt das Zimmer, maman«, sagte das junge Mädchen, als sie und Brown wieder in die Bar traten.
»Das ist allright«, sagte die Frau und nickte Brown freundlich zu. »Und nun wünschen Monsieur vielleicht etwas zu trinken?«
Diese Einladung gefiel Brown nicht besonders. Sie klang so echt englisch! Aber da er ein Diplomat war und außerdem Durst hatte, sagte er ja.
»Whisky und Soda?« fragte sie mit einem liebenswürdigen Lächeln.
»Uih merci,« antwortete Brown, denn es schien ihm höchste Zeit, seine französischen Kenntnisse an den Mann, pardon, an die Frau zu bringen.
Madame White lachte.
Miß Amelia lächelte. »Sie sind ja ein halber Franzose«, sagte sie.
»Und Sie? Sind Sie Französin?« fragte Brown die Maman.
»Um Gottes willen, nein! In mir ist kein Tropfen ausländischen Blutes. Ich bin Engländerin, gute Engländerin, wenn ich auch leider noch nie in England gewesen bin.«
Na, das war doch schon etwas, sagte sich Brown. Eine Engländerin, die noch niemals in England gewesen war, mußte seiner Ansicht nach fast so interessant sein wie eine Französin.
»Ist Ihr Mann Franzose?« fragte er.
»Keine Idee. Nicht um alles Geld in Rom hätte ich einen Franzosen geheiratet!«
Brown wußte zwar nicht genau, wieviel Geld es eigentlich in Rom gab, aber er fand ihre Bemerkung beleidigend. Für ihn wenigstens, der er doch mit aller Inbrunst seines Herzens sich danach sehnte, ausländische Lokalfarbe einzutrinken und England zu vergessen.
»Und – ist Miß White in England gewesen?« (Das schien ihm zwar nicht wahrscheinlich, denn dazu war das Farbenmuster ihrer Strümpfe zu lustig, aber man konnte ja fragen.)
Sowohl Amelia, als auch das Mädchen, das an der Barecke immer noch Ansichtspostkarten schrieb, brachen in ein lautes Gelächter aus, als habe Brown einen famosen Witz gemacht.
»Aber mein Name ist ja gar nicht White«, sagte Amelia. » Maman hat sich zweimal verheiratet. Mein Name ist Biggle.«
»Auch mein erster Mann war Engländer«, sagte Madame White, »und weder er noch mein zweiter Mann haben jemals in England gelebt. Die Mädels wollten schon einmal hinüberfahren, aber sie haben nie Zeit dazu gehabt. »Fiddle!« – rief Madame White dem Mädchen mit den Ansichtskarten zu – »hör' doch endlich mit deiner Schreiberei auf und unterhalte dich mit dem Herrn!«
Welchen Einfluß doch manchmal kleinste Kleinigkeiten auf uns Menschenkinder haben –: Hätte das eine Mädel nicht Amelia geheißen und wäre das andere nicht Amelias Schwester gewesen, so würde Mister Brown von England vielleicht sein Herz verloren haben – zeitweise. Die Mädels waren reizend, alle beide. Aber Brown war doch nicht nach Frankreich gekommen, um eine Engländerin zu poussieren …, Die Tatsache, die sehr für sie sprach, daß sie nämlich beide noch nie in England gewesen waren, wurde völlig aufgewogen durch die andere Tatsache: den Namen Amelia! Es war doch nicht menschenmöglich, mit einer Amelia zu flirten, nachdem man eben eine Amelia verlassen hatte! Nein, so schwach war Brown nicht. Wurde er je schwach, so durfte das Objekt seiner Schwäche nicht Amelia heißen, noch eine Amelia zur Schwester haben.
Also dachte Brown im tiefsten Innern seines Herzens. Aber er war sehr höflich und nahm mit einer tiefen Verbeugung seine Mütze vor Miß Fiddle ab.
»Wie glücklich Sie sind, in Frankreich zu leben!« sagte er.
»Glücklich!« rief Fiddle (Brown entdeckte niemals, ob sie wirklich Fiddle getauft war, oder ob sie nur so genannt wurde). »Meine Augen würde ich darum geben«, – sie blitzte Brown an, und er konstatierte, daß diese Augen bildschön waren – »meine Augen würde ich darum geben, in England zu leben. Ich hasse die Franzosen!«
Und so etwas sagte ein Mädchen, das den unbeschreiblichen Vorzug genoß, ihr ganzes junges Leben lang im Ausland gelebt zu haben!
»Eh bien, und Jean?« fragte Amelia maliziös.
Fiddle lachte. »Oh, ich werde es ihm schon beibringen, ein Engländer zu werden, wenn ich ihn einmal geheiratet habe«, rief sie.
»Ich mag die Franzosen!« sagte Brown energisch.
In diesem Augenblick betrat ein Kellner in schmutzigem Frack die Bar und verlangte zwei bocks.
»Die Franzosen gern haben?« rief Madame White aus, während sie in gewaltige Gläser die bocks einschenkte und sie auf das Tablett des Kellners stellte. »Frösche sind sie – alle sind sie Frösche! Je dis que tous les Français sont des grenouilles!« schrie sie dem Kellner zu.
»Oui, Madame«, antwortete der Kellner in geschäftsmäßigem Ton, als er mit den Gläsern verschwand.
Brown war starr. In Frankreich zu leben, die Franzosen Frösche zu nennen, und das auch noch dem Kellner zu sagen – das konnte er nicht verstehen! Noch weniger verstand er des Kellners Sanftmut. Er hatte immer geglaubt, die Franzosen seien eine heißblütige Rasse und am meisten stolz auf das, was gar nicht ihr persönliches Verdienst war: Auf ihr Franzosentum.
»Unser kleiner Bruder wird nach England in eine Schule geschickt werden!« bemerkte Amelia stolz …,
Da trat Mr. White ein, den Jungen an der Hand führend, von dem die Sprache war.
Frauen würden von Mr. White gesagt haben, er sei ein schöner Mann. Er trug eine Art Jachtanzug, elegantes Weiß, und eine leuchtend rote Halsbinde, die ein blitzender Brillant noch mehr zur Geltung brachte. Blonder Spitzbart. Eleganter Mensch. Sehr elegant; die Arbeit im Hotel überließ Mr. White vertrauensvoll seiner Frau und seinen Töchtern und lebte seinem Vergnügen. Er begrüßte Brown mit großer Höflichkeit, in einem Ton, der ans Befehlen gewöhnt schien, in einem Englisch, das ein ganz klein wenig fremdartig klang. Der Junge lief zu seiner Mutter und küßte sie. Der Bengel mit seinem frühreifen schlauen Gesicht machte einen unangenehmen Eindruck auf Brown. »Guten Abend, Sir«, sagte Mr. White majestätisch. »Es freut mich, Sie kennen zu lernen!«
Der Mann imponierte Brown. Kein Wunder – war es doch Mr. Whites einziger Beruf im Leben, imposant auszusehen. So lud denn Brown den Träger des eleganten Jachtkostüms nach guter alter englischer Sitte zu einem drink ein.
»Danke sehr – wie gewöhnlich«, sagte White, seiner Frau zunickend, die darauf einen grünfunkelnden Likör einschenkte.
»Auf Ihre Gesundheit, Sir«, sagte White und trank sein Glas mit einem Schluck aus. »Spielen Sie Golf?«
»Nein«, antwortete Brown. Er hatte noch nie Golf gespielt und verspürte nicht die geringste Lust, in Frankreich damit anzufangen.
»Feines Spiel – außerordentlich gesund. Ich bin Vizepräsident des hiesigen Golfklubs. Man muß sich Bewegung machen; das ist ein Gebot der Hygiene!«
Madame White wischte sich die perlenden Tropfen von der Stirne und sah bewundernd zu ihrem Gatten auf. Er hatte sie und das Hotel geheiratet, und sie liebte ihn in Ehrfurcht. Auch die Töchter sahen in Ehrfurcht zu ihm auf. Alles erstarb in Ehrfurcht vor Mr. White.
»Malen Sie?« fragte er. »Darf ich Sie bitten, auch ein Glas mit mir zu trinken?«
Brown sagte ja. Diesem Manne gegenüber fühlte er nicht das Bedürfnis, mit dem so bescheidenen uih merci seines französischen Sprachschatzes zu operieren …,
»Nein, ich male nicht.«
»Ich male«, bemerkte White. »Ich malte dies hier!«
Mit einer grandiosen Armbewegung deutete er auf die Wandgemälde der Bar.
Brown hatte diese Gemälde bereits bemerkt; er hätte nämlich blind sein müssen, sie nicht zu bemerken! Die Gemälde sprachen für sich selbst – sehr laut! Die Farbenkompositionen, die da von den Wänden der Bar herabschrien, repräsentierten wahrscheinlich die zweite Erdkugel, die der Name des Hotels in Ergänzung der bereits bekannten Erdkugel andeutete. Riesige Bilder waren es. Kornfelder mit kolossalen Vögeln in rot und blau und gelb; Früchte von einer Größe und Reife, unbekannt auf unserer bescheidenen Erdkugel – selbst in den Tropen. Es waren aber auch noch andere Bilder da, interessante Bilder. Diese Bilder gerade waren es ja gewesen, die in Mr. Brown die Vorstellung erweckt hatten, das Hotel könne doch nicht so englisch sein!
Die Bilder kamen Mr. Brown sehr französisch vor …, Sie zeigten weibliche Schönheit in so schwellenden Formen und mit einem so liebevollen Eingehen auf Einzelheiten, daß Brown beinahe die Mütze vom Kopf fiel – die Haare standen ihm zu Berge. Es war eigenartige weibliche Schönheit, ganz abgesehen von der Generosität der Formen; weibliche Schönheit mit knallgelbem Haar und rotviolettleuchtenden Augen! Mr. White mußte eine Phantasie besitzen, die einen Schriftsteller oder einen Auktionator zum erfolgreichen Mann gemacht haben würde. Es war sehr interessante Malerei, weder Impressionismus, noch Realismus, noch sonst ein Ismus, sondern durchaus Eigenes und Eigenartiges. Browns Bewunderung für seinen imponierenden Wirt stieg immer mehr.
»Gib mir einen Penny«, sagte da Mr. White zu seinem Sohn. Brown wunderte sich – gewöhnlich geben doch Väter ihren kleinen Jungens Pennies, und nicht umgekehrt. Nachdem der Bengel diesen bescheidenen Obolus gespendet hatte, schickte sich sein talentierter Papa an, das Kupferstück auf den Zehenspitzen seines rechten Fußes zu balancieren. Dann warf er das Geldstück in die Höhe, bog sich soweit zurück, daß Brown schon befürchtete, er werde sich das Rückgrat brechen, und fing den Penny mit den Zähnen auf.
»Hoppla! Können Sie das auch, mein Herr? fragte er.
»Nein, – leider nicht«, antwortete Brown wahrheitsgemäß.
»Ich werde es Ihnen nochmals zeigen«, sagte Mr. White.
Diesmal fiel ihm das Geldstück in den weitgeöffneten Mund und verschwand mit einem Plumpsen. Er neigte notgedrungen sein imposantes Haupt und hustete ebenso energisch wie unharmonisch, bis das Geldstück wieder aus seiner Kehle zum Vorschein kam.
Alles atmete erleichtert auf.
»Es hätte mich getötet, wenn ich es verschluckt hätte! Blutvergiftung!« sagte White, ziemlich blau im Gesicht, aber triumphierend. »Aber auch dann hätte ich es wieder gekriegt – oh ja, ich hätte es schon auf irgend eine Weise wiedergekriegt!«
Brown wußte nun nicht recht, an was Mr. White eigentlich mehr gelegen war, an dem Penny, den er so bestimmt wiederkriegen wollte, oder an seiner werten, von Blutvergiftung bedrohten Persönlichkeit …,
Mr. White war ein Genie!
Daran konnte kein Zweifel sein. Ein eigenartiges Genie, wie es Brown schien, aber ein Genie. Er zählte dem neuen Gast sämtliche Ehrenämter auf, die er in siebzehn verschiedenen Vereinen Moulevilles bekleidete; er jonglierte mit drei Sherrygläsern und vier Zitronen, während Brown atemlos darauf wartete, die Gläser möchten doch in Scherben gehen. Das taten sie aber nicht. Mr. White konnte einen Penny in seine rechte Rocktasche stecken und ihn aus seinem linken Hosenbein wieder zum Vorschein bringen – Mr. White war eben ein Genie, das die hochachtungsvolle Bewunderung vollkommen verdiente, mit der Gattin und Töchter seine hervorragenden Leistungen anstaunten.
Auch Brown wurde angesteckt, auch er bewunderte diesen Mann der vielen Talente, wenn auch weniger rückhaltslos und loyal – jedenfalls war das alles sehr sonderbar …,
»Haben Sie Ihr Gepäck schon holen lassen?« fragte Madame.
Das hatte Brown vergessen. Lärmende Glocken wurden in Bewegung gesetzt, und bald erschien ein altes Männchen in einer langen blauen Bluse, das Browns Gepäckschein in Empfang nahm, um die Koffer zu holen. Die blaue Bluse brachte Brown wieder zur Besinnung – erinnerte ihn, daß er ja wirklich im Ausland war – sie sah so sehr französisch aus. Beinahe hätte er ja das göttliche Frankreich über Mr. White und seinen Kunststückchen vergessen!
In Frankreich!
Wie englisch doch dieser Barraum war und wie englisch Mr. White und seine Familie! Fast tat es ihm leid, daß er – da war es Zeit zum Diner. Und dieses Diner beruhigte ihn; es war so französisch. Es war so ausländisch!
Das Speisezimmer, die Gäste, das Diner selbst vor allem, das war alles begeisternd fremdartig. Das Speisezimmer war mit Gemälden Whiteschen Genres geschmückt. Da prangten noch mehr Kornfelder; noch mehr Vögel; noch mehr Damen; meistens nur mit knallgelbem Haar bekleidet und Becher schwingend, als wollten sie die Gäste zum Zechen verführen. Diese Gäste waren zum größten Teil Engländer; Brown jedoch hatte Glück, denn am Nebentisch saß eine französische Familie. Er hörte wenigstens den Klang französischen Sprechens, wenn er auch kein Sterbenswörtchen verstand. Kellner – darunter auch jener, der nur ein geduldiges Ja für die beleidigende Bemerkung gehabt hatte, alle Franzosen seien Frösche, – umtänzelten ihn, ein entzückend gebrochenes Englisch parlierend. Der merkwürdige Hafengeruch, der jetzt zur Essenszeit besonders kräftig erschien, machte ihm Appetit. Von seinem Platz aus konnte Brown die Masten aussegelnder Fischerboote sehen und die Sirenen der Dampfer hören. Er sah den kleinen Leuchtturm draußen im Hafen, dessen Licht dann und wann in der Dämmerung aufblitzte; er konnte den Strand überblicken und das stille Meer. Brown schwelgte in all diesen Genüssen. Solange sich solche Aussicht ihm bot und solange Kellner so wunderschön gebrochenes Englisch schnatterten, war es Brown gleichgültig, was er aß. Er war auch gar nicht verwöhnt. Und französische Küche, ob gut oder schlecht, war ihm ja wie ein Buch mit sieben Siegeln. Er war gar nicht in der Lage, zu beurteilen, ob das Diner gut oder schlecht sei …,
Nur neugierig war er.
Die Suppe war von hellbrauner Farbe, und in ihr schwammen kleine rosa und gelbe Sternchen aus einem durchaus undefinierbaren Material, die stets dem suchenden Löffel Mr. Browns entglitten. Gelang es ihm aber wirklich einmal, einige solcher Sternchen im Löffel zu erwischen, so rutschten sie mit gleicher Bosheit ihm sofort zusammen mit der Suppe in die Kehle, ohne dem neugierigen Esser auch nur den geringsten Anhaltspunkt zu geben, wie sie eigentlich schmeckten. Er hätte das so gerne gewußt; den Sternchen aber schien es ein diabolisches Vergnügen zu sein, sich nicht erst lange bei der Zunge aufzuhalten, sondern schnurgerade in ihren Bestimmungsort zu wandern. Brown wußte, daß die Sternchen etwas Delikates sein mußten; aber sie waren zu schlüpfrig. Nach der Suppe kam eine Scholle, mit Zitronen garniert, die nicht sehr groß war, aber höchst appetitlich aussah. Freilich, als Kopf und Rückgratsgräten und Haut und Seitengräten entfernt waren, blieb merkwürdig wenig für Brown übrig.
In diesem Stadium des Diners wurde der Wein serviert. Brown hatte weißen Burgunder bestellt, weil er in England fast niemals Weißwein getrunken hatte, und weil ihm gesagt worden war, Burgunder sei etwas Festliches, Bordeaux dagegen etwas Alltägliches. Pouilly hatte er bestellt, nicht etwa, weil er die Marke kannte, denn er kannte sie nicht, sondern weil Pouilly den dritten Platz in der Weinkarte einnahm – die beiden billigeren Sorten verschmähte er und die anderen waren ihm zu teuer. Der Wein habe nicht zu viel Boden und sei nicht zu trocken, hatte der Oberkellner empfehlend bemerkt. Davon verstand Brown nicht das geringste. Ob der Wein gut oder schlecht war, wußte er nicht – jedenfalls schmeckte er ihm nicht. Er hatte etwas Scharfes, Unerklärliches, Mysteriöses in seinem Aroma. Brown vermutete, mit dem Kork müsse etwas nicht in der Ordnung sein, aber da er keine Ahnung hatte, wie Pouilly von Rechts wegen schmecken muß, so sagte er lieber gar nichts. Seine Unsicherheit wuchs, als der Franzose am Nebentisch sich über seinen Wein beschwerte. Der Franzose rief den Oberkellner herbei, ließ ihn den Wein kosten und redete und redete und redete, mit dem Kork vor des Oberkellners Nase hin und her fuchtelnd, während dieser nippte und den Kopf schüttelte und wieder nippte. Dann nippte der Franzose und schüttelte den Kopf und redete. Dann kam wieder der Oberkellner daran – dann wieder der Franzose. Brown dachte schon, sie würden die ganze Flasche miteinander austrinken und dann noch zu keiner Entscheidung gelangt sein, als endlich der Kellner Flasche und Gläser wegnahm, kopfschüttelnd, mit einem:
»Oui, Monsieur, vous avez raison, le bouchon est gâté.«
Dann brachte er eine andere Flasche, die den Franzosen prompt zufrieden zu stellen schien. Brown sah jedoch im Spiegel, wie der Kellner mit anscheinendem Genuß im Gang die Flasche austrank, über die er so sehr den Kopf geschüttelt hatte.
Wenn er nur den Mut hätte, das Gleiche zu tun, wie der Franzose! Der Mut kam ihm. Er rief den Kellner und befahl ihm mit großem Kopfschütteln, seinen Wein zu probieren. Der Kellner tat es.
»Exquis, Monsieur, exquis«, rief er, »quel parfum, quel bouquet!« und zeigte Brown irgend eine Marke auf dem Propfen in Bestätigung seines Richterspruches.
Brown hatte keine Ahnung, was die Marke bedeuten mochte, fühlte jedoch, daß diese Marke die Angelegenheit definitiv erledigte und probierte den Wein nochmals. Wirklich, das zweite Glas schmeckte ihm viel besser als das erste; es schmeckte ihm sogar sehr gut; und er genierte sich, daß er sich beklagt hatte. Bald ärgerte ihn sogar der Schluck Wein, den er dem Kellner gegeben hatte; denn das Diner war noch nicht halb vorüber und die Flasche schon zu drei Vierteln geleert. Brown tat so, als betrachte er sich die Etikette, und beguckte sich den Boden der Flasche. Er fand zu seinem Entsetzen, daß dieser Boden falsch war, tief nach innen gebaucht – es war noch weniger in der Flasche drin …, Brown fühlte, dieser Boden sei eine Niedertracht und grenze an Betrug, denn er warf alle seine Berechnungen über den Haufen.
Dem Fisch folgte vol-au-vent, und Brown wollte sich durchaus nicht eingestehen, daß dieser vol-au-vent nach gar nichts schmeckte. Die Kruste, auf der man noch die Federn sehen konnte, vermochte Browns Beifall gar nicht zu gewinnen, und da er wußte, daß sie als Delikatesse galt, so sagte er sich traurig, er sei wahrscheinlich schon zu alt, seine Geschmacksnerven noch auf so Neues zu trainieren. Dann kam eine côte de pré-salé, ein Gericht, das Brown geradezu aufgeregt erwartete, hatte er doch nicht die geringste Ahnung, was das sein mochte. Bis es endlich kam, hatte er seine Flasche Burgunder so ziemlich geleert und sich genügend Mut angetrunken, um sich sofort einzugestehen, dieses côte de pré-salé sei ja weiter nichts als ein Hammelkotelette, und zwar ein miserables Hammelkotelette. Doch das war schließlich gleichgültig – auch Frankreich mußte seine Schattenseiten haben, genau so wie England seine Lichtseiten …,
Es folgte Huhn und Salat – und von französischen Hühnern hatte Brown allerlei Liebes und Gutes und Schönes gehört. Als das Huhn auf der Tafel erschien, sah er auf den ersten Blick, daß ihm Fortuna nicht gelächelt hatte; ein knochiges Rückenstück war ihm zugefallen. Er bestellte sich noch eine halbe Flasche Wein und machte sich daran, diesen unglücklichen Teil eines schätzenswerten Vogels in Arbeit zu nehmen. Dieser Arbeit ging es wie so mancher anderen ehrlichen Arbeit in dieser schlechten Welt auch: Sie trug keine Früchte! Während er die Knochen bearbeitete, stieg die Ueberzeugung in ihm auf (die mit jedem Augenblick wuchs), dieses Huhn könne gar kein französisches Huhn gewesen sein, sondern ein armes, bedauernswertes englisches Huhn, das in Verzweiflung aus England ausgewandert war und sich in Mouleville niedergelassen hatte. Der Salat machte ihn lächeln. Salade romaine besagte das Menu. Was kam, war nicht mehr ganz frischer, in Essig und Oel gebadeter Lattich. Dann kam Gefrorenes. Dann ein Apfel und eine Banane als Dessert.
Brown hatte anderthalb Flaschen Wein getrunken und schlürfte jetzt schwarzen Kaffee und einen Benediktiner. Er sagte sich betrübt, daß das Diner in seinen einzelnen Gängen nicht sehr wundervoll gewesen sei; dagegen fühlte er sich durchaus nicht schläfrig und übersatt wie nach dem Essen in England, sondern leicht und fröhlich. Es war sehr schön. Er wäre durchaus im stande gewesen, sich sofort zu einem zweiten Diner hinzusetzen. Das mußte die französische Luft machen. Oder eine gewisse eigene Art der Zubereitung!
Und nun standen die Damen am Nebentisch auf und gingen, Gatten und Sohn bei Kaffee und Zigaretten lassend. Brown sah sehr freundlich nach dem Tisch hinüber. Hier saß er ja Tisch an Tisch mit einem wirklichen, wahrhaftigen Franzosen, der Kaffee trank und Zigaretten rauchte. Wer hätte das noch vor Monatsfrist gedacht! So etwas für möglich gehalten! Zu seinem unbeschreiblichen Entzücken sprach ihn der Franzose an:
»Sie kommen von England, Sir?«
»Jawohl,« antwortete Brown. Es war ihm eine große Erleichterung, daß der Franzose sich des Englischen bediente.
Brown selbst kam sich zwar mit anderthalb Flaschen Pouilly und einem Benediktiner im Leib nicht gerade sehr englisch vor, aber er war doch nun einmal Engländer und kam schnurgerade von England und sprach keine andere Sprache als Englisch, und Blut war doch dicker als Burgunder, wenngleich augenblicklich der Burgunder Oberhand zu haben schien.
»Ihr englisches Vaterland ist das größte und schönste Land der Welt,« sagte der Franzose. »Meine Glückwünsche!«
Brown wußte nicht recht, was er sagen sollte; er empfand nur, daß der Franzose sehr liebenswürdig sein wollte.
»Oh, England ist allright,« gab er zögernd zu, »aber ich verbringe meine Ferien doch lieber in Frankreich.«
Dies waren seine ersten Ferien in Frankreich – die ersten auf französischem Boden zugebrachten vier Stunden in seinem Leben. Aber er sprach, als sei es ihm eine liebe Gewohnheit, fortwährend hin- und herzuhüpfen über den trennenden Aermelkanal …,
»Gewiß, mein Herr; sogar der schönsten und besten Dinge kann man einmal müde werden. Ich beabsichtigte schon lange eine Reise nach England; jetzt endlich werde ich mit meiner Familie Ihr schönes Land besuchen. Dort kann man frei atmen!«
Das war ganz richtig, sagte sich Brown. Atmen konnte man in England. Frei atmen konnte man dort, was er auch persönlich augenblicklich gegen sein Vaterland einzuwenden hatte. Es fiel ihm jedoch nicht ein, sich das göttliche Frankreich verhunzen zu lassen, ohne sich zu wehren.
»Auch hier kann man frei atmen!« bemerkte er.
»Va-t-en trouver ta mère,« sagte der Franzose zu seinem Sohn, und als der junge Mann den Speisesaal verlassen hatte, wandte er sich wieder zu Brown:
»Die Luft hier ist politisch verpestet, sir! In England ist man frei.«
Allmächtiger Himmel! Zum erstenmal in seinem Leben empfand Brown so etwas wie freies Aufatmen hier in französischer Luft, auf französischem Boden stehend, und nun sagt ihm dieses Menschenkind da, man sei nur in England frei!
»Aber Frankreich ist doch das freieste Land der Erde,« warf er ein.
»Ah – wir sind eine Nation von Sklaven, sir; Sklaven einer Regierung, die eine falsche Majorität uns aufgehalst hat; wir schmachten in den Ketten unerträglicher Steuern; Verräter haben uns verraten. Es gab einmal eine Zeit, da Frankreich wirklich Frankreich war. Jetzt aber ist es ein Land, ausgebeutet von Journalisten, Kapitalisten und Juden. Heutzutage werden nicht einmal unsere religiösen Ueberzeugungen respektiert. Ein Franzose ist ein Niemand im eigenen Land, ein Vogel nur, dessen Feder ausgerissen werden, damit der Fremde sich damit schmücke.«
Dann übermannten ihn seine Gefühle, und in seiner Muttersprache sprudelte er hervor:
»Oh, La France, La France! Tu es bien perdue; va. On t'a trahie, ma fille: on t'a violée, outragée. Oh, ce sale gouvernement de traîtres et de scélérats qui t'exploite et te ruine! Oh, ces arrivistes, ces chenapans, quels tristes individus! Si je les avais ici je les étranglerais tous, comme ça.«
Er ergriff seine Serviette und zerknüllte sie in seinen Fäusten und schüttelte diese Fäuste vor Browns Gesicht.
Brown hatte kein einziges Wort verstanden; er begriff nur, daß der Mann über irgend etwas sehr ärgerlich war, daß er fürchterlich über Frankreich schimpfte, und er war erstaunt und entsetzt. Er war doch hierher gekommen, sich Frankreichs zu freuen, nicht es von einem Franzosen verfluchen zu hören!
»Aber – England zum Beispiel ist doch so eng!« protestierte er. »Man kann sich nicht rühren. Und dann – die Bars schließen so früh, und die englische Küche kann Ihnen doch gewiß nicht gefallen!«
Brown war nicht der Mann, der sich in seiner Heimat viel in Bars herumtrieb, und er war bestimmt noch nie so lange in einer Bar gewesen, bis sie geschlossen wurde. Auch war ihm ausschließlich englische Küche vorzüglich bekommen. Aber er brauchte notwendig Argumente, und augenblicklich fiel ihm nichts Besseres ein.
»Wenn die englischen Wirtschaften schließen,« brummte der Franzose, »ist es auch Zeit für ehrliche Leute, ins Bett zu gehen. Ihre Getränke und Ihre Nahrungsmittel werden auch nicht verfälscht wie bei uns. Hier ist alles teuer und verfälscht. Ah, mon cher ami, erst in England fühle ich wie ein Mann. Hier sind wir von Spionen umgeben und von allen Seiten verraten. Oh, ce gouvernement!«
»Ah,« sagte Brown, »ich verstehe nicht viel von Politik. Ich glaubte, Ihre Regierung sei eine sehr starke Regierung.«
»Heute am Ruder, morgen gestürzt,« sagte bekümmert der Franzose »Frankreich ist das reinste Mistbeet politischer Intrigen. Wir konspirieren fortwährend. Jeder Tag kann eine Verschwörung bringen. Jede Stadt, ja jedes Dorf hat seine Unzufriedenen. Ich zweifle keinen Augenblick daran, daß es auch hier in Mouleville Leute gibt, die gerne die Regierung stürzen würden. In diesem Augenblick können Verschwörer am Werk sein.«
»Wirklich?« fragte Brown höchst interessiert, denn dieses Thema gefiel ihm sehr. In England gab es leider so gar keine Verschwörungen und er sehnte sich nach Neuem. Deswegen war er ja nach Frankreich gekommen!
»Glauben Sie wirklich, daß es auch hier in Mouleville Verschwörer gibt?«
»Zweifellos. In einem Lande mit einer Regierung wie der unsrigen muß es Verschwörer geben. Haben Sie jemals gelesen, was Henry Rochefort über unsere Minister sagte?«
»Nein,« gestand Brown. Rochefort kannte er nur als Käse; er hatte sich soeben eine Portion bestellen wollen.
»Das müssen Sie lesen, mein Junge! Und Sie werden etwas über Frankreich lernen. Jedermann sollte die Zeitung Rocheforts lesen.«
»Ist er ein guter Journalist?«
»Gut ist wohl nicht der richtige Ausdruck. Aber man kann sich auf ihn verlassen; er übertreibt niemals. Dieses Land braucht einen Herrn. Kein Staat, keine Gemeinschaft kann existieren ohne eine starke leitende Hand.«
Da rief eine schrille Stimme:
»Charles, tu ne viens pas?«
Und der Franzose wurde plötzlich ganz still und stand eilig auf, Brown eine tiefe Verbeugung machend (Brown wollte diese Verbeugung erwidern, aber der Tisch war ihm im Weg). Seine Frau hatte ihn gerufen. Er wandte sich zur Türe.
»Morgen schon werden wir in Ihrem schönen und großen Lande sein,« sagte er. »Wir reisen mit dem Nachtdampfer ab. Ah, wenn wir nur Ihren König hätten, Ihren Edouard Sept, wie glücklich wären wir doch! Oh, Richard! Oh, mon roi!«
Er kam noch einmal zurück und streckte Brown die Hand hin.
»Darf ich einem Untertanen von Edouard Sept die Hände schütteln?«
»Bitte!« sagte Brown, der sich trotz allem sehr geschmeichelt fühlte und sehr stolz war.
»Sie zum Beispiel würden doch nicht meine Hände schütteln wollen, nur weil ich ein Untertan von Fallières oder Clemenceau oder Picard bin?«
»Nein, eigentlich nicht,« antwortete Brown, vollkommen der Wahrheit gemäß.
»Voilà – voilà!« sagte der Franzose.
»Voilà …,« wiederholte er, aber in einem ganz anderen Ton, denn eine höchst ungeduldige Damenstimme rief dringend: »Charles!« Und er eilte hinaus.
Eine Zeitlang saß Brown ganz niedergedrückt da. Der Franzose war ihm auf die Nerven gefallen. Weshalb hatte der Mann auch so über Frankreich sprechen müssen, gerade an diesem ersten, wundervollen Abend? Und dann, hatte nicht Madame White gesagt, die Franzosen seien alle Frösche, und hatte nicht der Kellner geantwortet:
»Oui, madame!«
Wie sonderbar das doch alles war. Höchst sonderbar. Vielleicht hatte er doch einen Fehler gemacht, als er im Hôtel des deux globes abgestiegen war. Immerhin, das Hotel war ja nur ein winzig kleines Teilchen von Frankreich, diesem wunderschönen Frankreich. Er beschloß, sich weiter keine Gedanken mehr zu machen über das, was der Franzose gesagt hatte. Frankreich! – Er war ja in Frankreich, dem Land seiner Träume, und nichts sollte ihn stören in seinem Glück.
Und wenn Franzosen wirklich so unangenehm waren, mußten es dann Französinnen auch sein? Waren Französinnen nicht die Schönsten ihres Geschlechts? Die Frauen regierten Frankreich, das hatte er immer gehört, und regierte nicht der Stärkste? Madame White, als eine geborene Engländerin, krankte ja sicher an Vorurteilen, und der Franzose hatte ja nur von Männern gesprochen.
Das war es.
In Frankreich mußte man vor allem auf Französinnen achten! Brown war wieder ganz glücklich und machte frohgemut einen Spaziergang. Eine wunderschöne Ruhe, ein großer Friede kamen über ihn. Frankreich war entschieden das Land, in dem er sich wohl fühlte. Noch nie war ihm in England so froh zu Mut gewesen. Wie nett doch die Häuser und die Straßen aussahen! Was für ein eigenartiger Geruch doch in der Luft lag. Die Leute, an denen er vorbeiging, beachteten ihn gar nicht. Am Ende sah er doch nicht wie ein Fremder aus? In England starrte man einen Fremden immer an; das hatte er selbst ja auch getan, in unbestimmter Sehnsucht nach dem Lande des Fremden.
Doch sein Spaziergang war nur kurz. Nach des Tages Ereignissen fühlte er sich müde und sehnte sich danach, im weichen Federpfühl zu liegen und geruhsam noch einmal alles zu überdenken. Was hatte er nicht alles erlebt seit dem Morgen! Welche ungeheure Veränderung diese wenigen Stunden bedeuteten: den großen Sprung ins Ausland!
Frankreich! Noch einmal wandte er sich um, ehe er ins Hotel zurückkehrte – betrachtete die Stadt, die sich am Strand entlang und zu den Hügeln hinzog. Wie friedlich das Städtchen aussah! Konnte es denn wahr sein, fragte sich Brown, daß in diesem friedlichen Städtchen romantische Verschwörer ihre Pläne ausheckten, und daß in diesen zierlichen Häuschen mit den hübschen roten Dächern gegen die Regierung konspiriert wurde? Und wenn – umso besser, umso besser! Mouleville wurde dadurch nur noch interessanter. Wenn er es nur genau wüßte. Mr. Brown von England dürstete nach Kenntnissen – intimen Kenntnissen.
In der Ferne glitzerte das blendende Lichtmeer des Kasinos. Ah, auch das Kasino würde er besuchen – aber nicht heute nacht. Heute bedurfte er keiner neuen Eindrücke mehr; die Eindrücke des Tages genügten ihm vollkommen.
Sein Bett war ausgezeichnet, wie er fand, und mit einem Seufzer des Glückes ließ er sich in die Federn sinken. Er war im Bett – in Frankreich; in Frankreich – im Bett …,