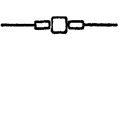|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Napoleoniden arrangieren gewisse Kleinigkeiten in ernsthafter Sitzung, und Mr. Brown von England schreibt einen Scheck!
Nachdem Duveen sich von Brown verabschiedet hatte, sprang er mit großem Holtergepolter, immer drei Stufen auf einmal nehmend, die steilen Treppen in des Kaisers Haus hinab und eilte zurück nach dem Café, so schnell ihn seine Beine nur tragen wollten. Mr. Duveen war in ausgezeichneter Laune und pfiff vergnügt vor sich hin. War er doch furchtbar froh, den guten Brown glücklich in des Kaisers Bett untergebracht zu haben und für den Rest des Abends, oder der Nacht vielmehr, der mühseligen Arbeit entronnen zu sein, fortwährend neue Lügen fabrizieren zu müssen! Es war wirklich aufreibend gewesen! Er trat in das Café und stürzte in das kleine Hinterzimmer. Jubelnde Zurufe empfingen ihn.
»Halloh, Duveen!« schrie ihm Monsieur Georges entgegen. »Na, ist das gute kleine Hühnchen endlich schlafen gegangen?«
»Mais oui. Das Kamel hat sich niedergelegt – das Schaf schläft – das Hühnchen ruht. Well, ich hoffe sehr, daß wir dem guten Hühnchen die Federn ein wenig rupfen morgen!«
»Aber sehr! Das Hühnchen muß ein goldenes Ei legen und zwar verdammt schnell,« brummte Monsieur Georges mit mürrischem Gesicht. »Das möcht ich dem Hühnchen geraten haben. Wir brauchen Geld, Duveen. Die Geschäfte gehen schlecht. Hm – Sie haben doch wahrscheinlich schon was profitiert?«
Duveen überlegte blitzschnell und beschloß klugerweise, bei der Wahrheit zu bleiben. Er hätte ja gar zu gerne nein gesagt, aber mit Monsieur Georges war wirklich nicht gut Kirschen essen – Monsieur Georges war zu schlau …, Die stahlharten Augen des Mannes waren es, die ihn zwangen, gänzlich gegen seine Gewohnheit einmal nicht zu flunkern –
»Eine Kleinigkeit,« sagte er. »Aber ein ganz netter kleiner Anfang!«
Er legte eine Hundertfrancs-Banknote auf den Tisch und sah sie betrübt an, als fiele es ihm sehr schwer, sich von ihr zu trennen. Es fiel ihm auch schwer. Hundert Francs! Da eine Banknote aussieht wie die andere, so mag es nur ein Zufall gewesen sein, daß gerade hundert Francs es gewesen waren, die Brown ihm zur Bezahlung seiner Hotelrechnung gegeben hatte …,
»Wie wollen wir teilen?« fragte Duveen.
»Halbpart! Selbstverständlich!« sagte Monsieur Georges.
»Christi! Das ist aber stark – ich hab' doch die ganze Arbeit gehabt!«
»So? Haben Sie? Das macht nichts; ich habe nicht das geringste dagegen, auch einmal Geld einzustecken, ohne dafür gearbeitet zu haben! Im übrigen mache ich Sie darauf aufmerksam, mein Lieber, daß Sie mich in dieser Sache notwendig brauchen. Noch notwendiger brauchen Sie la duchesse, was natürlich auch zählt.«
»Bis jetzt hat sie aber doch mit der Sache eigentlich gar nichts zu tun gehabt!«
»Das kommt schon noch, mein Bester!«
Duveen nickte. Das war allerdings richtig.
»Allright,« sagte er. »Ich mache halbpart mit Ihnen, und Sie machen halbpart mit mir – einverstanden?«
»Jawohl!«
Und Duveen reichte Monsieur Georges eine Banknote über fünfzig Franken hinüber.
»Sie irren sich doch auch nicht?« fragte dieser, Duveen scharf ansehend. »Waren es wirklich nur hundert?«
»So wahr ich – – Im übrigen hätte ich Ihnen ja ebensogut sagen können, es seien nur fünfzig gewesen. Und die Hälfte ist sowieso mehr als Ihnen gebührt. Ich habe den Mann aufgegabelt und ich war es, der alle Mühe hatte bis jetzt. Wenn's Ihnen nicht paßt, dann geb' ich die ganze Geschichte mit dem größten Vergnügen sofort auf. Bin sowieso nicht begeistert davon. Dieser Brown ist immerhin mein Landsmann und gar kein so übler Junge. Er tut mir fast leid.«
Monsieur Georges stand auf und stellte sich hart vor Duveen hin.
»Was wollen Sie?« schrie er.
»Oh nichts – gar nichts,« sagte Duveen rasch. »Welch sonderbarer Mensch Sie doch sind; Sie verstehen niemals Scherz!«
»Scherze dieser Sorte liebe ich nicht; Sie verschwenden Zeit. Halloh, da ist sie ja!«
Mürrisch nickte er Thérèse de Mérac zu, die soeben eintrat. Sie trug die gleiche vornehme, gleichgültige Miene zur Schau wie vorhin; sie blieb sich immer gleich – ob nun Brown anwesend war oder nicht. Sie schien jedoch gesprächiger.
»Nun, haben Sie ihn zu Bett gebracht?« fragte sie Duveen.
»Yes – er schläft in des Kaisers Bett,« lachte dieser. »Und ich wette, er träumt von Ihnen, ma chérie. Er behauptet, Sie seien eine edle Frau! Weil Sie sich der guten Sache widmen und es in solch einem Lokal aushalten und solche Leuten dulden! Komisch, nicht? Ihren Vetter findet er übrigens ziemlich gewöhnlich!«
Die Männer lachten; die Dame des Kasinos aber rümpfte nur ein zierliches Näschen und sagte: »Bah,« ohne die Spur eines Lächelns.
»Es wird sehr einfache Arbeit sein mit ihm,« bemerkte Duveen.
»Euch erscheint die Arbeit immer einfach, die mir zufällt,« rief sie mit einem Blick der Verachtung auf die beiden Männer aus. »Ihr habt freilich nichts zu tun, als euch mit der kleinen Bestie hinzusetzen und ihm zuzutrinken. Na, ja. Er scheint übrigens ein ganz netter kleiner Kerl zu sein, und ich verspüre nicht die mindeste Lust, diesmal mitzutun.«
»Was?« rief Monsieur Georges, »du willst nicht mittun? Heh?« Und er sah sie aus seinen stahlharten Augen an – so wie er vor einigen Minuten Duveen angesehen hatte. Keinen Unsinn, duchesse, wenn ich bitten darf. Du wirst einfach das tun, was man dir auftragen wird. Verstanden?«
Die anderen Männer sahen interessiert von ihren Karten auf, denn sie hofften, etwas Amüsantes, in ihren Augen Amüsantes, zu erleben. Wußten sie doch, daß la duchesse sehr – hm – energisch sein konnte, wenn die schlechte Laune über sie kam. Und das Drohende in Monsieur Georges' harter Stimme kannten sie alle.
»Du wirst es tun, wie gesagt, und Du wirst es sehr rasch tun, my lady«, fuhr Monsieur Georges fort. »Wir sind nicht sehr kapitalkräftig augenblicklich und wir müssen für das Nötige sorgen. Wenn diese Sache auch nichts Großes ist, so ist sie dafür etwas Sicheres.«
Er faßte sie am Arm. Der Griff seiner Faust war augenscheinlich etwas nicht sehr Angenehmes, denn die Dame des Kasinos zuckte zusammen. Sie sah ihn an, und zum erstenmal kam in ihre Augen so etwas wie ein leidenschaftlicher Ausdruck – eine Mischung von Furcht und Bewunderung.
»Comme tu es bête,« flüsterte sie. »Sois gentil, Georges. Tu me fais mal.«
Der Mann ließ ihren Arm los und lachte grimmig auf.
»So ist's recht, duchesse. Sei vernünftig. Du weißt, daß ich nicht der Mann bin, mit dem man spielt!« Dabei sah er aber Duveen an.
»Nein, das bist du nicht, mein Junge,« sagte Duveen, dem sehr ungemütlich zu Mute war. »Uebrigens hat auch kein Mensch die Absicht, mit dir zu spielen. Nicht wahr, duchesse?«
Die Dame hielt es nicht für der Mühe wert, Duveen eine Antwort zu geben, sondern sah ihn nur verachtungsvoll an. Sie streichelte nur Monsieur Georges Arm, als ob sie ihn besänftigen wolle. Die andern Männer mischten sich nun in die Unterhaltung. Sie wünschten zu wissen, ob auch sie ihren Anteil erhalten würden.
»Ihr bekommt euren Anteil schon, Jungens,« sagte Monsieur Georges. »Aber ihr müßt warten. Ohne Kapital können wir die Sache nicht zu Ende führen. Von diesen hundert Franken bekommt ihr nichts. Die drinks jedoch will ich gerne bezahlen.«
Er rief den Kellner, der schleunigst herbeieilte. Monsieur Georges ließ man nicht warten. Vom Buffet kam die patronne des Cafés, um mit Monsieur Georges anzustoßen. Er war ihr Liebling, er war ihr, was einer Mutter ein besonders hoffnungsvoller Sprößling sein mag. Kein Wunder; Monsieur Georges war aller Frauen Liebling, alter und junger. Thérèse aber sah die patronne, eine so alte Frau sie auch war, so eifersüchtig an, als wäre sie ihr gerne an den Hals gesprungen.
Erst lange später, nach vielem Hin- und Herreden und Beraten, entschloß sich das edelste Blut Frankreichs, endlich nach Hause zu gehen. Pfeifend machten sie sich auf den Weg, und der schläfrige Kellner ließ die Rolladen herab …,
* * *
Während Brown beim Ankleiden war am nächsten Morgen, trat Duveen ein, mit einem so ernsten, so bekümmerten Gesicht, daß Brown sofort merkte, irgend etwas müsse nicht in Ordnung sein. Der junge Engländer erschrak ein wenig. Vielleicht hatten die Herren vom Verband zur Wiederherstellung des Kaiserreichs sich die Sache doch anders überlegt und wünschten nicht mehr, ihn in ihrer Mitte zu sehen. Das wäre, obgleich es sich Brown nicht so recht eingestehen wollte, gar kein so furchtbarer Schlag für ihn gewesen, wenn man ihm nur wenigstens gestattete, die entzückende Thérèse auch fernerhin zu treffen. Das war ihm die Hauptsache. Die Männer konnten seinetwegen – – Jawohl, das konnten sie! In Brown begann sowieso ganz langsam die vorläufig noch unklare Erkenntnis aufzutauchen, daß seine Vorliebe für Frankreich und französische Dinge ihn entschieden zu weit führe. Und dann – was er in Frankreich suchte, war Freiheit. Um frei zu sein, war er doch vom Hôtel des deux Globes weggezogen. Und jetzt sah es wahrhaftig so aus, als ob er weniger sein eigener Herr sei als je vorher – weniger als im Emporium zu Brixton! Verschwörer und Verschwörungen mochten ja sehr nett sein und Brown hatte nichts gegen sie einzuwenden, solange alles hübsch gemütlich blieb. Nur mußte man sich dabei amüsieren. Schließlich (dieser Gedanke kam ihm, während er sich die Hosenträger anzog) war es ihm doch furchtbar gleichgültig, welche Partei Frankreich beherrschte und welche Regierungsform Frankreich annahm. Schließlich war es vielleicht doch ein Fehler, wenn man sich in Dinge mischte, die einen doch offenbar nicht das geringste angingen! Diese Verschwörer waren ja ganz interessant, und das war ja alles sehr ausländisch und das Milieu von Staatsgeheimnissen und Kaisertum und Umstürzlerei hatte entschieden gewaltige Anziehungskraft. Jedoch auch Schattenseiten! Im allgemeinen stand Brown (ohne es zu wissen und ohne sich darüber klar zu sein) auf dem Standpunkt, daß ihm eine Thérèse ohne Verschwörung und ohne Verschwörer bedeutend lieber gewesen wäre. Um der Einfachheit willen. Aber dann wäre sie vielleicht keine Herzogin gewesen …,
Duveen wußte den Wert der Zeit zu schätzen und sprang sofort in medias res.
»Mein lieber Brown,« sagte er zögernd, »ich habe diesen Morgen sehr, sehr ernste Nachrichten erhalten. Ein großer Schlag ist in Vorbereitung. Für die allernächste Zeit. Um erfolgreich zu sein, müssen wir jedoch Geld haben. Wir haben aber keins! Wir sind arm, alles, was wir je besaßen, gaben wir für die gute Sache dahin. Freilich wissen wir, daß wir über kurz oder lang unser Geld mit Zinsen und Zinseszinsen zurückerhalten werden. Das hilft uns aber augenblicklich nichts. Wenn wir nicht rasch Geld auftreiben können, so ist die Gelegenheit unwiederbringlich dahin – ein fast sicherer Erfolg gleitet uns aus den Händen. Das ist furchtbar, mein lieber Brown. Um einer großen und guten Sache willen – könnten Sie – würden Sie, mein lieber Brown – würden Sie uns zweitausend Francs leihen?«
»Zweitausend Francs?« schrie Brown erschrocken.
»Ja; aber nicht als Darlehen eigentlich, sondern nur als Vorausbezahlung für des Kaisers Zimmer!«
»Heh? Aber, du meine Güte, da müßte ich ja zweihundert Nächte in des Kaisers Bett schlafen!«
» Wie werden Sie aber Frankreich kennen lernen in dieser Zeit!«
»Ich weiß gar nicht, ob ich so lange – – –«
»Aber bedenken Sie nur, des Kaisers Bett!«
»Hm – ich bewundere den Kaiser sehr und so weiter und so weiter, wissen Sie, aber zweihundert Tage und Nächte lang möchte ich doch nicht in seinem Zimmer wohnen. Er selbst war ja auch nur zwei Nächte da, wie Sie mir sagten!«
»Ja, ja,« antwortete Duveen betrübt. »Ich fürchtete ja auch schon, es sei wirklich zu viel von Ihnen verlangt. Das sagte ich mir sofort, als ich den Brief der Herzogin bekam.«
»Den Brief der – – –«
»Jawohl. Madame de Mérac bekam die Nachricht spät gestern abend und schrieb mir noch in der Nacht. Ah, sie ist treu wie Gold. In einem Postskriptum schrieb sie: Wenn Ihr junger Freund, ce cher Monsieur Brown (sie schrieb natürlich Französisch), uns helfen könnte – ah, wie könnte er auf die Dankbarkeit Thérèse Méracs rechnen!«
»Hat die Herzogin das wirklich geschrieben?«
»Wörtlich. Ich würde Ihnen den Brief zeigen, aber ich mußte ihn verbrennen. Ich wage es nicht, solche Briefe bei mir zu tragen – sie sind zu gefährlich. Außerdem widerspricht es den Satzungen des Verbandes. Sie schrieb mir ganz ausführlich. Ich habe ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Der letzte Satz lautete: Drängen Sie ihn nicht; ich fürchte, die Zeiten der Ritterlichkeit sind dahingeschwunden und nur frohe und freiwillige Hilfe darf es sein, die den Kaiser auf den Thron seiner Vorfahren setzt.«
»Na,« sagte Brown, »ich weiß nicht – ich weiß nicht recht …,« Die Aussicht, sich von so viel Geld trennen zu müssen, hatte durchaus nichts Begeisterndes für ihn. »Nein, ich weiß wirklich nicht recht – – So sehr interessiere ich mich gar nicht für den Kaiser!«
»Ah, das wird schon kommen, wenn Sie erst einmal Gentleman der kaiserlichen Kammer sind und ein enormes Gehalt beziehen!«
»Hm – ich brauche nicht mehr Geld, als ich habe. Ja, und dann weiß ich auch, was die Versprechungen von Königen im Exil wert sind. Wenig, lieber Duveen. Darüber hab' ich allerlei gelesen. Einer Dame dagegen möchte ich gerne einen Gefallen erweisen – besonders der Herzogin!«
Er öffnete seinen Koffer und suchte nach seinem Scheckbuch. »Zweitausend Francs, sagen Sie? Es ist eine Unmenge Geld – achtzig Pfund!«
»Sie hätten die gleiche Summe sehr leicht in einer halben Stunde beim Baccarat verlieren können!«
»Das ist wahr,« sagte Brown (er dachte an das Kasino). »Und dann hätte mir keine Herzogin dafür gedankt. Andererseits hätte ich aber auch gewinnen können, wissen Sie!«
»Noch höher sind die Gewinnchancen bei uns!«
»Hm …,« brummte Brown, unterschrieb den Scheck und reichte ihn Duveen.
»Sie – Sie werden – ehem – Sie werden der Dame mitteilen, daß ich ihren Wunsch erfüllt habe?« (Brown war Geschäftsmann, und diese Genugtuung wenigstens wollte er für sein Geld haben!)
»Sie selbst wird Ihnen heute nachmittag danken!«
Und dann verabschiedete Duveen sich schleunigst – das Hühnchen hatte das goldene Ei gelegt und für den Augenblick war alles Weitere Zeitverschwendung. Wenn man die Hälfte von zweitausend Francs besaß, so konnte man etwas Gescheidteres anfangen – sagte sich Duveen ganz richtig.
Nachmittags jedoch empfing Brown seinen programmäßigen Dank von Madame Thérèse, die ihn gütig anlächelte, als er das Hinterzimmer des Cafés betrat. Wäre Brown weniger verliebt gewesen, so hätte er dieses liebenswürdige Lächeln vielleicht ein vergnügtes Grinsen genannt (was es auch war).
»Sie sind uns zu Hilfe gekommen, Monsieur. Im Namen von wertvolleren Menschen, als ich es bin, danke ich Ihnen!« Für diesen kleinen Speech belohnte sie ein liebenswürdiger Blick von Monsieur Georges, der sie für die kleine Mühe vollauf entschädigte.
»Niemand kann wertvoller sein als Sie, Madame,« flüsterte Brown und verbeugte sich tief. »Es mag noch höher stehende Menschen geben – aber nicht wertvollere!«
– – Duveen fühlte zu seinem großen Erstaunen, daß Brown ihn schlecht behandle. Zuerst konnte er sich das gar nicht so recht erklären. Das Hühnchen hatte doch das goldene Ei so schmerzlos gelegt, war doch so nett gewesen in der kleinen Affäre des Schecks. Nun gab ihm Brown auf einmal kurze Antworten und behandelte ihn etwas von oben herab, bis Duveen merkte, daß sein Mann von England ein wenig mißtrauisch geworden war und offenbar weitere Schröpfungen fürchtete. Er trat jetzt sehr energisch auf und Duveen begann zu fürchten, daß die Herrlichkeit recht bald ein Ende nehmen würde. Es dauerte nicht lange, so stritten sie sich. Brown bestand sehr energisch darauf, ins Kasino zu gehen, während Duveen erklärte, dies sei ganz unmöglich:
»Sie könnten doch sehr leicht den Whites begegnen und das wäre doch sehr unangenehm für Sie!«
»Aber weshalb denn? Das sehe ich durchaus nicht ein. Meine Rechnung habe ich bezahlt, und ich bin doch schließlich mein eigener Herr und kann wohnen, wo es mir beliebt! Ich fürchte die Leute nicht.«
Duveen saß wie auf Nadeln. Dieser Brown war so unangenehm logisch manchmal! Endlich fiel ihm eine Antwort ein: »Und dann könnten Sie doch sehr leicht uns erwähnen. Das wäre jetzt besonders gefährlich!«
»Ach was, ich würde überhaupt nichts reden, außerdem weiß ich ja gar nichts.«
»Sie wissen gerade genug. Und im übrigen müssen auch Sie selbst jetzt sehr vorsichtig sein. Man ist bereits auf Sie aufmerksam geworden; die Polizei hat uns beide beobachtet, als wir vorhin zusammen sprachen auf der Straße.«
»Die Polizei? Was geht mich die Polizei an, mein Lieber?«
»Unter Umständen sehr viel. Ich bin als Verschwörer bekannt, damit sind auch Sie verdächtig. Würden Sie ins Kasino gehen, so würde man Sie im Kasino bemerken, Ihnen hierher nachgehen, und wir wären verloren. Das müssen Sie doch begreifen! Ich selbst gehe ja auch nicht mehr ins Kasino.«
»Unsinn. Polizisten gibt es ja in jeder Straße!«
»Die meine ich nicht; ich meine natürlich die Geheimpolizei. Die Stadtpolizei hat keine Ahnung von unserer Existenz.«
Brown konnte sehr eigensinnig sein und ließ nicht locker. Die nächste Frage enthüllte seine geheimsten Gedanken (obgleich Duveen es nicht merkte).
»Aber Madame de Mérac geht doch ins Kasino?«
»Ah, das ist ganz etwas anderes. Sie ist eine große Dame, und die Geheimpolizei glaubt obendrein, daß sie gegen uns intrigiert. Wir spielen eben ein sehr feines Spiel, wissen Sie!«
»Jawohl – zu fein für mich!« brummte Brown. »Ich fange wirklich an, zu wünschen, ich hätte mich in dieses Spiel niemals eingelassen. Ich muß gestehen, daß ich meine Abende viel lieber im Kasino verbrächte, als in diesem dumpfen, kleinen Café. Ich finde das sehr langweilig, mein lieber Duveen. Und Madame de Mérac kommt immer erst so spät. Ich habe gute Lust, Schluß zu machen. Sie verstehen doch – Schluß!«
»Dazu ist es zu spät, mein Junge!«
»Zu spät?«
Brown überlegte sich die Situation rasch und kam zu dem Resultat, daß seine Lage keine besonders beneidenswerte war. Es paßte ihm nicht im geringsten, stets das zu tun, was diese Leute von ihm wollten. Einen Augenblick lang verspürte er sogar große Lust, diesen Duveen am Kragen zu nehmen und ihm handgreiflich einzubläuen, daß er und die Verschwörung und die Verschwörer ihm nachgerade langweilig würden. Oh ja, mit Duveen hätte er es aufgenommen, in jeder Beziehung. Hinter Duveen stand jedoch Monsieur Georges und den hätte Brown nicht gerne zum Feind gehabt! Madame de Mérac würde ihn natürlich verstehen und ganz genau wissen, daß er kein Verräter sei – aber Monsieur Georges? Sollte Monsieur Georges wirklich auf den Gedanken kommen, er sei ein Verräter, so war Monsieur Georges gerade der Mann, um – – – Der Gedanke war Brown unangenehm.
Er hatte gehofft, Thérèse würde verstehen, daß er nur um ihretwillen die schönen achtzig Pfund Sterling für die gute Sache gegeben hatte; nun aber schien es ihm, als betrachte man ihn erst recht als Mitverschwörer und als werde er immer mehr in diese unbehagliche Affäre verwickelt. Alles mit Maß, confound it …, Er half ja diesen Leuten recht gerne, und Gentleman der Kaiserlichen Kammer wäre er auch recht gerne geworden – das war so nett und ausländisch! Aber nur mit Maß, confound it! Die Geschichte konnte doch schief gehen und in diesem Fall (der Brown sehr wahrscheinlich erschien) – was würde dann aus ihm und seinem Geld?
Man sieht, Brown fing an zu denken – – –
Er ging früh zu Bett; Thérèse war nicht gekommen und er war müde.
Als Monsieur Georges und Duveen allein waren, besprachen sie sich wieder ernsthaft, wie am Abend vorher:
»Wir können ihn nicht mehr lange halten!« meinte Duveen. »Er fängt schon jetzt an, ungeberdig zu werden.«
»Es wäre auch wirklich gefährlich, wenn er ins Kasino ginge«, brummte Monsieur Georges mürrisch.
»Jawohl«, nickte Duveen. »In Gefahr schweben wir eigentlich schon, wenn er auch nur über die Straße geht. Aber was tun? Einsperren können wir ihn doch nicht! Das würde ihm ja vollends alle Lust benehmen; Parteikasse ist doch gut, nicht wahr, Georges?«
Und Duveen lachte laut auf.
»Ja, es ist höchste Zeit. Wir müssen die Sache mit der duchesse arrangieren – da ist sie ja.«
La duchesse trat ein und das Trio beschäftigte sich ernsthaft mit Brown, seinem Schicksal und vor allem seinem Gelde.