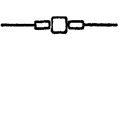|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Es wird unserem Helden klar gemacht, daß er auf einem Vulkan lebt, worauf er prompt überraschende Parallelen mit Leutnant d'Artagnan in sich entdeckt.
Es mochte ungefähr zehn Uhr am nächsten Morgen sein, als Brown höchst unsanft aus tiefem Schlaf aufgeschreckt wurde, denn eine energische Faust trommelte Generalmarsch an seiner Türe. Bum – bum …,
»Pst – –«, murmelte Brown. »Will schlafen …,« Und damit drehte er sich auf die andere Seite.
Brown hatte, ehe er zu Bett gegangen war, die Rollladen herabgelassen und die Vorhänge zugezogen. In des Kaisers Zimmer drang weder die Morgensonne noch überhaupt irgend welcher Sonnenschein (dafür sorgte die Mauer, die der große Kaiser hatte errichten lassen) –, es war also sehr dunkel, und Brown irrte sich daher einigermaßen in seiner Zeitrechnung. Seiner schläfrigen Ansicht nach mochte es etwa fünf Uhr morgens sein; ein Irrtum, für den die schlechte, dumpfe Luft des kleinen Cafés, der Absinth und die Liköre verantwortlich waren. Jedenfalls hatte Mister Brown von England nicht die geringste Lust, sich durch etwas so Gleichgültiges wie anhaltendes Klopfen in seinem Ruhebedürfnis stören zu lassen.
»Klopfe nur, mein Sohn!« murmelte er. »Auf die Dauer wird es dir langweilig werden!«
Einen Augenblick lang hörte das Geräusch auch wirklich auf, und Mr. Brown schloß mit einem zufriedenen Lächeln die Augen. Seine Zufriedenheit nahm aber rasch ein jähes Ende, denn der Mann, der da draußen vor der Türe stand, war energisch und ungeniert. Als er merkte, daß bloßes Klopfen nicht genügte für seine Zwecke, nahm er den stiefelbewehrten linken Fuß zu Hilfe und Schläge donnerten gegen die arme Türe, die selbst den hoffnungslosesten Fall von Schlafkrankheit kuriert hätten.
Brown fuhr empor und lauschte. Bum – Krach …,
»Ruhe!« brüllte er.
Bum – Krach …,
»Wer ist's?«
»Ein Freund – –« kam die Antwort, in Duveens Stimme natürlich.
»Oh, confound it …,« murmelte Brown, stieg aber doch aus dem Bett, schob den Türriegel zurück und schlüpfte schleunigst wieder unter die Decke.
Duveen trat ein.
»Mann, was fällt Ihnen denn ein, mich in aller Herrgottsfrühe aus den Federn zu reißen?«
»Na, es ist zehn Uhr«, sagte Duveen, »und ich muß Sie um Ihres gesunden Schlafes willen wirklich bewundern. Sie schlafen – in Ihrer Lage!«
»Ich möchte sogar noch mehr schlafen«, brummte Brown. »In meiner Lage? Wieso? Des Kaisers Zimmer könnte zwar etwas bequemer sein, aber des Kaisers Bett ist allright. Was meinen Sie eigentlich?«
»Sie leben auf einem Vulkan!«
»So? Ist es wirklich schon zehn Uhr?«
»Jawohl.«
»Na, dann seien Sie mal so liebenswürdig und machen Sie die Laden auf.«
Duveen ging zum Fenster, zog die Vorhänge zurück und öffnete die Laden.
»Es ist wirklich schon ganz hell«, bemerkte Brown. »Schadet aber nichts. Ich bin ein freier Mann und kann tun, was mir beliebt. Vor allem gedenke ich, zu schlafen, so lange es mir beliebt. Und nun sagen Sie einmal, weshalb haben Sie diesen Lärm eigentlich verübt?«
»Es war ein Gebot bitterer Notwendigkeit.«
Dabei starrte Duveen den jungen Engländer unverwandt an, und diesem wurde es sehr ungemütlich zu Mute. Männer sind ja bekanntlich nicht eitel, aber kein Mann läßt sich gerne beäugeln, wenn er mit verwirrtem Haar und unrasiert im Bett liegt. Natürlich ist das nicht Eitelkeit, sondern ein rein ästhetisches Empfinden …,
»Na, was haben Sie denn?«
»Das ist's! Ich hab's!« rief da Duveen aus, als habe er soeben den Stein der Weisen entdeckt. »Jawohl, das ist es. Sonderbar, daß es mir nicht schon früher aufgefallen ist.«
»Was denn, in Kuckucksnamen?«
»Die Aehnlichkeit …,«
Brown, hochrot vor Wut, richtete sich im Bett auf.
»Wollen Sie mir nun gefälligst endlich einmal eine vernünftige Auskunft geben! Weshalb haben Sie mich geweckt? Und weshalb sitzen Sie da und starren mich an und murmeln unverständliches Zeug vor sich hin?«
»Mein lieber Junge; es ist aber auch wirklich zu schlimm!«
»Was denn?«
»Sie stehen unter polizeilicher Beobachtung!«
»Was?«
»Leider – leider – – Und wie sonderbar, daß erst die duchesse mich darauf aufmerksam machen mußte!«
»Die duchesse? Auf was?«
»Darauf, daß Sie eine ganz verblüffende Aehnlichkeit mit Victor Napoleon haben!«
Victor Napoleon! Brown hatte häufig die Photographien des Prinzen in englischen Zeitschriften gesehen, und eine Aehnlichkeit war ihm noch nie aufgefallen.
»Unsinn«, sagte er. »Der Prinz trägt einen Bart …,«
»Aber er kann sich doch rasiert haben, und dann würden Sie ihm wirklich sehr ähnlich sehen!«
»Meinen Sie?« fragte Brown besänftigt und fuhr sich liebevoll mit der Handfläche seiner Rechten übers Gesicht. So trug er denn die Züge eines Prinzen – –
»Ja – die Aehnlichkeit ist leider verblüffend, mein lieber Brown. Thérèse fiel es sofort auf; dann auch Monsieur Georges und mir, und jetzt auch den andern.«
»Welchen andern?«
»Der Geheimpolizei. Sie stehen unter fortwährender Beobachtung.«
Duveen ging zum Fenster und spähte vorsichtig auf die Straße hinab. Dann kündigte er das Resultat seiner Beobachtungen an:
»Augenblicklich scheinen sie das Haus nicht zu überwachen. Ich kann niemand sehen. Wir haben keine Wahl, mein lieber Brown: wir müssen Sie aus Mouleville fortschaffen, so lange es noch geht – –«
»Aus Mouleville …, Fort? Fällt mir nicht im Traum ein!«
»Es muß aber sein. Sie können jeden Augenblick verhaftet werden!«
»Ich habe doch nichts verbrochen –«
»Sie sehen aber dem Prinzen Victor Napoleon ähnlich!«
»Na, meinetwegen mögen sie mich verhaften. Man wird sehr schnell herausbekommen, daß ich nicht Napoleon bin.«
»Aber man wird Sie nach England zurückschicken!«
»Na – –« brummte Brown. Der Gedanke, nach England zurückgeschickt zu werden, hatte merkwürdigerweise augenblicklich gar nichts Unangenehmes für ihn. »England ist schließlich doch gar nicht so übel«, meinte er nachdenklich. »Und das Ausland hab' ich gesehen …,«
»Aber die gute Sache –«
Brown wurde noch nachdenklicher.
»Wissen Sie, mein Lieber,« sagte er endlich, »ich fürchte, ich interessiere mich lange nicht mehr so für die gute Sache wie zuerst. Wenn ich mir das so recht überlege, so muß ich mir sagen, daß Ihre gute Sache und Ihr Napoleon mich eigentlich doch verdammt wenig angehen – confound it! Das ist kein Geschäft für mich.«
»Doch – und zwar ein ausgezeichnetes Geschäft. Und dann wollten Sie doch Frankreich und die Franzosen kennen lernen. Nun, lernen Sie etwa nicht?«
»Zu viel, mein Lieber, viel zu viel!«
»Und dann denken Sie doch an Thérèse. Wollen Sie etwa die Herzogin im Stich lassen, jetzt, wo sie anfängt, sich so ganz auf Sie zu verlassen?«
»Ist das wahr? Würde es ihr wohl leid tun, wenn ich –«
»Furchtbar leid! Sie haben ihr sehr gefallen, daran kann gar kein Zweifel sein, und ihr gefällt man so leicht nicht.«
Das freute Brown denn doch sehr.
»Vielleicht deshalb, weil ich dem Prinzen Napoleon ähnlich sehe?« fragte er schüchtern und vorsichtig.
»Nein, um Ihrer selbst willen.«
»Aber wenn ich von Mouleville fort soll, dann sieht sie mich doch nicht mehr; ebensowenig, als wäre ich nach England zurückgekehrt!«
»Doch – doch! Sie sollen ja gar nicht so weit fort und – das werden Sie gerne hören – sie wird Sie begleiten. Wir haben uns die Sache schon überlegt; während Sie noch schliefen heute morgen, hielten wir eine Sitzung.«
Duveen war ein kluger Mann. Er merkte, daß auch hier das ewig Weibliche wieder einmal den Ausschlag gab: daß Brown schon beinahe gewonnen war. Zärtlich legte er ihm die Hand auf die Schulter und sah ihm ernst in sein unrasiertes Gesicht.
»Verlassen Sie uns nicht, mein lieber Brown; enttäuschen Sie Thérèse nicht. Sie sind uns nötig; Sie wissen nicht, wie nötig Sie uns sind. Frankreich braucht Sie; Thérèse braucht Sie!«
»Das ist sehr schmeichelhaft. Könnte Frankreich aber nicht doch ohne mich fertig werden?«
»Und Thérèse?«
Der Gedanke, daß Madame nicht ohne ihn fertig werden konnte, war Brown schon bedeutend sympathischer.
»Sie dürfen sie jetzt nicht verlassen. Und dann kann uns Ihre Aehnlichkeit mit Victor Napoleon sehr wertvoll werden. Sie könnten ihn personifizieren, während er auf Paris marschiert.«
»Kommt er denn?«
»Wir erwarten ihn jeden Tag.«
»Aber wohin soll ich denn in Kuckucksnamen gehen?« schrie Brown, sprang aus dem Bett und begann sich anzuziehen.
»Es ist gar nicht weit. Nur nach Petite Mouleville.«
»Und die Geheimpolizei?« (Brown würgte doch an dem Wort.)
»Dafür werden wir sorgen. Sie müssen sich verkleiden und Sie müssen einige Tage sehr zurückgezogen leben.«
Brown, immer noch im Nachthemd, rasierte sich energisch und verwünschte den kalten Teppich im Zimmer des Kaisers. Da fiel ihm etwas ein, und er wandte sich fragend an Duveen, Rasiermesser in der Hand:
»Aber ich habe doch für des Kaisers Zimmer vorausbezahlt?«
»Oh, das macht nichts. Sie brauchen dafür Ihr neues Zimmer nicht zu bezahlen. Ihr Geld ist ja schließlich doch für Parteizwecke verwendet worden, und Sie werden es mit Zinseszinsen zurückerhalten.«
»Aber man muß doch so und so lange in des Kaisers Zimmer wohnen, um Gentleman der Kaiserlichen Kammer zu werden!«
»Man wird bei Ihnen eine Ausnahme machen. Mehr: Wenn Sie nach Petite Mouleville gehen und sich den Anordnungen des Verbandes fügen, so glaube ich Ihnen versprechen zu dürfen – ich glaube, sage ich, denn bestimmt versprechen kann ich es natürlich nicht – daß Sie darauf zählen können …,«
»Und?« fragte Brown.
»– zum Pagen der Kaiserlichen Toilette ernannt zu werden!«
»Gefällt mir nicht,« brummte Brown mürrisch. »Was tu' ich in der Kaiserlichen Toilette? Was wären da meine Pflichten?«
»Oh gar keine. Es ist nur eine Ehrenstellung. Eine hohe Ehrenstellung! Noch intimer als zum Beispiel der Mundschenk. Denken Sie nur: Gentleman der Kammer und Page der Toilette!«
»Ja, es klingt großartig,« sagte Brown. Allright, ich werde Sie nicht im Stich lassen. Sie – und Thérèse!«
»So ist's recht, mein Junge. Ich wußte doch, daß Sie die richtige Sorte waren – für uns und Thérèse. Ich muß jetzt gehen. Bleiben Sie ja hier, bis ich wiederkomme!«
»Wohin gehen Sie denn?«
»Ich muß Ihre Verkleidung besorgen.«
»Schön.«
Duveen ging und Mr. Brown von England beschäftigte sich mit seiner Toilette. Dabei beguckte er sich mehr als einmal nachdenklich in jenen Teilen des altersschwachen Spiegels, die noch einigermaßen reflexfähig waren. Mit einer gewissen Hochachtung. Er sah also Victor Napoleon ähnlich? Vielleicht war es ein schlummerndes Unterbewußtsein dieser merkwürdigen Aehnlichkeit, das ihn sich so sehr für Frankreich hatte interessieren lassen. Jedenfalls war diese Aehnlichkeit etwas sehr Schmeichelhaftes für ihn, wenn sie auch Nachteile haben mochte. Wenn dieser Spiegel nur nicht so miserabel gewesen wäre! Sonderbar – sonderbar …, Interessierte sich um dieser Aehnlichkeit willen Thérèse so sehr für ihn? Nun, solche Aehnlichkeiten kamen ja vor. Er selbst kannte Leute, die dem deutschen Kaiser ähnlich sahen, und in Brixton gab es einen Mann, den alle Welt »The King« nannte, weil er genau so aussah, wie Eduard VII.
Als er seine Toilette beendet hatte, setzte er sich hin und wartete. Dann und wann ging er zum Fenster und guckte verstohlen die Straßen hinauf und hinab. Niemand war zu sehen. Aber schließlich konnten sich ja die Geheimpolizisten in einem Hausgang versteckt haben – die Polizei ist so schlau!
Duveen trat mit zwei kleinen Paketen ein.
»Now we 're allright,« sagte er.
Das pflegte Amelia immer zu sagen …, Und wider seinen Willen versank Brown in träumerische Erinnerungen. Wie oft hatte doch Amelia das gesagt im guten alten England, wo das Leben in sanfter Ruhe und ohne Aufregung dahinfloß; im guten alten England, in merry old England, wo es keine Verschwörungen und keine Verschwörer gab. Und wer war an allem schuld? Amelia! Hätte Amelia nicht so unerhört geflirtet und ihn nicht so bodenlos geärgert, so würde er jetzt nicht hier sein und – –. Aber dann hätte er ja auch Thérèse nicht kennen gelernt, und – jawohl, nicht mitgearbeitet an einem gewaltigen Stück Weltgeschichte. Denn in dumpfer Ahnung schlummerte es in ihm, daß es das war, was er tat. Freilich wäre es ihm lieber gewesen, wenn diese weltgeschichtlichen Ereignisse sich ohne Verkleidungen und ohne Monsieur Georges und ohne ärgerliche Schecks abgespielt hätten. Das waren doch wenig erfreuliche Nebenerscheinungen. Deswegen war er doch nicht nach Frankreich gekommen! Wohin wohl mochte ihn dieses Sehnen, wirkliches französisches Leben kennen zu lernen, noch führen? Aber war denn dies nicht doch alles sehr französisch und sehr interessant, und war er nicht ein Undankbarer, sich über kleinen Aerger zu beklagen, wo er doch so Großes erlebte? Trotzdem – in dieser Sekunde ergab sich sein Herz in zärtlichem Erinnern wieder Amelia und wandte sich treulos von dieser so entzückenden, so französischen Thérèse ab. Was er da lebte, war freilich ein ganz neues Leben – zu neu jedoch für seinen Geschmack; zu aufregend auf die Dauer …,
Duveen hatte ausgepackt.
Auf dem Bette lag ein sehr langes und sehr mysteriöses Kleidungsstück, das Brown lebhaft an die geheimnisvollen Mäntel der melodramatischen Schurken englischer Bühnen erinnerte. Da lag ferner ein riesiger schwarzer Schlapphut. Und ein falscher schwarzer Schnurrbart von geradezu ungeheuerlichen Dimensionen.
»Zuerst müssen wir den Schnurrbart anprobieren, mein lieber Brown.«
Duveen betupfte Browns winziges blondes Schnurrbärtchen sehr sorgfältig mit zähem, klebrigem Gummi und stülpte ihm das schwarze Ungetüm auf die Oberlippe. Die Operation war ungemütlich. Dann warf Duveen ihm den Mantel über. Er paßte sehr gut und sah entschieden abenteuerlich aus. Brown kam sich schon sehr wie ein Verschwörer vor. Dann setzte er ihm den schwarzen Schlapphut auf, der viel zu groß war und ihm fast bis auf die Ohren reichte.
»Er rutscht mir ja ins Gesicht!« schrie Brown.
»Er soll ja Ihr Gesicht verhüllen, nicht wahr? Sie sehen sehr gut aus.«
»Thérèse wird mich ja gar nicht erkennen!«
»Ihre Augen werden durch die Verkleidung dringen. Und dann bewundert Sie ja an Ihnen nicht so sehr Ihr Aeußeres, als Ihr – hm – Ihr Herz!«
»Allright,« brummte Brown.
»Und nun müssen wir gehen.«
Brown kam sich in dem Mantel, in dem Hut, in dem Schnurrbart vor allem unbeschreiblich komisch vor. Er fühlte sich gar nicht als gefährlicher Verschwörer, sondern genierte sich nur furchtbar und bildete sich ein, jeder Vorübergehende müsse auf den ersten Blick erkennen, daß dieser Schnurrbart nicht echt sein konnte. Am liebsten wäre er im Laufschritt nach dem kleinen Café gerannt. Er machte Riesenschritte.
»Langsam – langsam, mein Junge,« mahnte aber Duveen. »Wir dürfen keinen Verdacht erregen.«
Gehorsam verlangsamte Brown seine Schritte. Es war ihm ein Trost, daß die Leute in den engen Straßen ihn anscheinend doch gar nicht beachteten. Sie kamen an Läden vorbei, und er wagte es, sich mit verstohlenen Blicken in dem Spiegel eines Schaufensters zu betrachten. Beinahe hätte er entsetzt aufgeschrien; denn aus dem Spiegel starrte ihm ein völlig fremdes Gesicht entgegen …, So theatralisch, so gemacht grimmig sah dieses Gesicht aus, daß Brown hinter seinem falschen Schnurrbart in tiefer Scham errötete. Und dann kam er sich so sonderbar klein vor in dem weiten, schwebenden Mantel. Mit jedem Schritt wurde er wütender. War er etwa nach Frankreich gekommen, um sich zu maskieren wie ein Hanswurst? Aber da waren sie schon in dem kleinen Café. Thérèse, die im Hinterzimmer saß, brach in ein schrilles Gelächter aus, als Brown eintrat. Sie sagte irgend etwas zu der patronne hinter dem Buffet, die sich rasch herumdrehte, Brown angaffte und dann ebensolaut lachte. Kein Wunder, daß Brown sich tief verletzt fühlte. Er hatte einen ganz anderen Empfang erwartet.
»Ich tat es für Frankreich und – für Sie, Madame,« flüsterte er. »Und Sie lachen über mich?«
Aus ihren Augen schwand das Lächeln.
»Ich lachte über Duveen,« erklärte sie. »Neben Ihnen sieht er so sonderbar aus.«
Brown war sofort beruhigt, denn Duveen sah wirklich ein wenig komisch aus. In diesem Augenblick trat Monsieur Georges ein. Er blieb stehen und sah Brown forschend an. Eine Sekunde lang. Dann brach er in ein schallendes Gelächter aus.
»Te voilà, brigand!« schrie er und schlug Brown mit solcher Wucht auf den Rücken, daß der Schlapphut herabfiel.
»Pst!« rief Brown. »Nicht so laut. Die Polizei!«
»Die Polizei!« schrie Monsieur Georges verächtlich und brach in grimmige Flüche aus. Thérèse hörte in ihrer gewohnten Ruhe zu. Brown aber, der jetzt anfing, die französischen Worte zu verstehen, erschrak. Diese Ausdrücke waren zu kräftig!
»Er haßt die Polizei,« erklärte Duveen. »Verschiedene seiner Vorfahren sind guillotiniert worden – während der Revolution.«
Als Monsieur Georges das Wort Guillotine hörte, schauderte er und summte leise einen Vers von »A la Roquette« vor sich hin.
Brown fühlte sich ungemütlich. Thérèse brach jedesmal, wenn sie ihn ansah, in ein leises Lächeln aus und Brown haßte es, ausgelacht zu werden. Außerdem war der falsche Schnurrbart etwas sehr Unangenehmes – so pappig. Die Oberlippe schmerzte ihn, denn der sich härtende Gummi hauste erbarmungslos in seinen wirklichen Schnurrbarthärchen. Wenn sie ihn aber auch auslachte, so war doch Thérèse sehr nett zu ihm. Die Unterhaltung wurde halb in Französisch und halb in Englisch geführt, und Duveen half als Dolmetscher aus, wenn es notwendig war.
»Sie gehen heute nachmittag nach Petite Mouleville?« sagte Thérèse.
»Aber nicht allein,« antwortete Brown erschrocken. Gerne ging er sowieso nicht von Mouleville fort und allein ging er auf keinen Fall.
»Ich gehe auch nach Petite Mouleville!« versicherte ihm die duchesse, und einen Augenblick lang war es ihm, als spüre er ihre Fußspitze an der seinen. Jetzt freute er sich sogar auf das Fortgehen …,
»Auch ich gehe mit!« bemerkte Monsieur Georges und sah Brown mit einem Blick an, der diesem sehr unverschämt vorkam und ihm sowohl für sich als auch für Thérèse bestimmt schien. Unter diesem Blick minderte sich seine freudige Erregung ganz merkwürdig.
»Natürlich gehen wir alle«, fuhr Monsieur Georges fort. »Von Petite Mouleville aus werden wir nämlich den großen Coup in Szene setzen. Ein Tag mag noch vergehen oder zwei, dann werden wir alle reich sein und unser Freund hier« – er klopfte Brown auf die Schultern – »wird in seinen neuen Würden als Gentleman der Kammer und Page der Toilette schwelgen!«
»Und was wird dann Madame sein?« fragte Brown.
»Ihre ergebene Dienerin, Monsieur«, antwortete sie mit einem gütigen Blick.
Die Worte waren entzückend, aber die Stimme fiel Brown noch immer auf die Nerven. Er hoffte nur, daß einmal der Tag kommen würde, wo er das Recht haben würde, ihr Heiserkeitspastillen zu kaufen. Sie brauchte sie entschieden notwendig …,
Als sie mit dem Lunch fertig waren und ihren Kaffee tranken, kamen noch einige der anderen Verschwörer in das Café und la duchesse stand auf und ging. Duveen begleitete sie. Vorher versprach sie Brown noch, rechtzeitig zurück zu sein. Man hatte einen Wagen bestellt, der Mister Brown von England und seine Freunde nach Petite Mouleville bringen sollte.
Brown jedoch solle auf keinen Fall das Café vorher verlassen, bemerkte Monsieur Georges und schlug eine Kartenpartie vor. Das Kartenspielen war Brown zwar schon längst langweilig geworden. Die anderen Spieler regten sich immer so sehr dabei auf, während er selbst das mit dem besten Willen nicht konnte, denn er hatte das Spiel noch immer nicht kapiert. Er wußte nur, daß er mit großer Regelmäßigkeit sein Geld verlor und das wurde auf die Dauer monoton. Aber er fügte sich. Was hätte er auch sonst anfangen sollen? Wenigstens bedeutete ihm das Spiel immer eine Art Unterrichtsstunde in der französischen Sprache. Zu seiner unbeschreiblichen Freude begann er, hier und da ein Wort zu verstehen; dann und wann den Sinn des Gesprochenen zu erraten. Besonders ein Wörtchen kam sehr häufig vor und er wußte nun, was dieses Wörtchen bedeutete. Ein interessantes Wörtchen. In einem Salon wäre es gar nicht am Platze gewesen, aber es klang so hübsch energisch und Brown annektierte es sofort. Er benützte es häufig. Dadurch kam er sich viel französischer vor, viel mehr eingebürgert als in jenen Tagen, da er sich noch mit dem armseligen » uih merci« behelfen mußte.
Da kam Duveen zurück, sah sehr geheimnisvoll aus und wickelte Brown liebevoll in den weiten Mantel ein.
Es war Brown, als er auf die Straße trat, als erlebe er ein wundersam abenteuerliches Märchen. Stolz streichelte er den angepappten Schnurrbart. Es war doch ein erhebendes Gefühl, ein Verfolgter zu sein, ein Abenteurer: für einen Prinzen gehalten zu werden. Er fühlte, er sei doch zu Großem berufen. Das hatte er ja schon lange geahnt. Schwellenden Herzens dachte er an sein Lieblingsbuch, an die Drei Musketiere. Ah, nun war er in Frankreich und ein Glückssoldat wie sie. So mochte d'Artagnan hinausgezogen sein, um einer großen Königin zu dienen und einem großen Kardinal ein Schnippchen zu schlagen – so wie er, der einer Herzogin diente und der guten Sache eines kaiserlichen Verbannten half. Wie nüchtern doch die englische Art war und wie entzückend dieses französische Leben …,
Sie gingen zu Fuß nach dem Haus des Kaisers, denn dort sollte der Wagen sie abholen. Rechts von ihm schritt Duveen und links Monsieur Georges – die drei Musketiere. Die drei Musketiere, wie sie leibten und lebten. Ah …, Und dann schlug seine Stimmung plötzlich um. Er kam sich verlassen vor, unsicher. Die Männer zu seiner Seite hätten ja ebensogut Gefängniswärter sein können, die einen Gefangenen eskortierten! Er wußte doch eigentlich recht wenig von diesen Männern, und vor Monsieur Georges hatte er sich eigentlich ja immer schon gefürchtet, wenn er ihm in gewisser Beziehung auch imponierte. Wo führte man ihn hin? Weshalb sollte er Mouleville verlassen? Ein impulsives Verlangen stieg in ihm auf, diese Männer von sich abzuschütteln; sich zu weigern, ihnen zu folgen. Wie im Traum hatte er dahingelebt und nun war er, einen Augenblick lang, wieder er selbst: Mr. Brown von Brixton. Was hatte er mit Napoleon und dem französischen Thron zu tun? Was würden seine Kollegen wohl von ihm denken, wenn sie ihn sehen könnten – mit einem riesigen falschen Schnurrbart, im wallenden Räubermantel, einen ungeheuren Sombrero auf dem Kopf? Wie ein Ritter war er sich vorgekommen vorhin und nun schien es ihm, als sei er nur ein Narr. Verstohlen blickte er seine Gefährten von der Seite an. Duveen machte ihm den Eindruck von Schlauheit und Verschlagenheit, und Monsieur Georges hatte wahrlich nichts Vertrauenerweckendes. Jawohl! Er wollte wieder er selbst sein – Mr. Brown von England. Er würde diesen Leuten sagen, daß das Spiel aus sei.
Und da leuchtete mitten in diese trüben Gedanken des Zweifelns ein Lichtstrahl hinein – die Dame des Kasinos, la duchesse. Er sah sie wie in einer Vision; stolz, königlich, melancholisch. Eine Dame. Sie paßte so wenig in diese Gesellschaft wie er selbst. War es nicht seine Pflicht als Mann, ihr zur Seite zu stehen? Er erinnerte sich an die leise Berührung ihres Fußes. Es war ihm, als hätte das in schüchterner Zärtlichkeit bedeutet: Komm mit mir; hilf mir; schütze mich. Durfte er sie in dieser gefährlichen Lage verlassen?
Nein! Brown von Brixton war ein mutiger kleiner Mann. Er zupfte stolz (aber vorsichtig) an seinem riesigen Schnurrbart und beschloß, die Sache zu Ende zu führen. Zwar schien ihm alles nicht mehr so romantisch: der Glanz war getrübt – wie beim Spiegel in des Kaisers Zimmer. Die Würden eines Gentleman der Kammer und eines Pagen der Toilette schienen nun auf einmal phantastisch und unwirklich. Aber da war Pflicht und Ritterlichkeit und – jawohl – ein interessantes Abenteuer.
Brown war also entschlossen. Es wäre ihm aber doch lieber gewesen, wenn seine Begleiter nicht gar so fürsorglich neben ihm hergeschritten wären! Man mußte da wirklich auf sonderbare Gedanken kommen. Als sie sich dem Hause des Kaisers näherten, ergriff Monsieur Georges sogar seinen Arm und hielt ihn fest wie in einem Schraubstock. Er mochte erraten haben, was in Brown vorging. Brown sah ärgerlich auf und Monsieur Georges nickte ihm liebenswürdig zu; lächelnd. Es war jedoch eine Eigentümlichkeit von Monsieur Georges, eine bezeichnende Eigentümlichkeit, daß sein Lächeln etwas Gezwungenes, etwas Drohendes, etwas Unwahres hatte. Und wieder zögerte Brown und wieder rang in ihm kühle Vernunft mit phantastischer Ritterlichkeit.
Doch einen Augenblick später war er schon in des Kaisers Zimmer und beim Packen seiner Koffer. Monsieur Georges bewunderte unterdessen seine Besitztümer, besonders seine Rasiermesser, deren Schneide er mit einem nikotingebräunten Daumen prüfend befühlte. Dann fuhr der Wagen vor.
Duveen nahm den einen Handkoffer und Monsieur Georges den anderen. Dies mochte französische Höflichkeit sein, weiter nichts – aber in Brown stieg doch unwillkürlich der Verdacht auf, daß man nun durch sein Gepäck sich seiner selbst versichern wollte. Besonders deshalb, weil er bis jetzt noch keine Gelegenheit gehabt hatte, an Monsieur Georges Dinge wie Höflichkeit oder gar Liebenswürdigkeit zu bewundern.
Mit einem letzten Blick auf des Kaisers Bett, das er so teuer bezahlt hatte, folgte er den beiden Herren die steile Treppe hinab. Wäre es nicht des Kaisers Zimmer gewesen, so hätte er es in vollendeter Gleichgültigkeit verlassen – als Zimmer war es gewöhnlich, sehr gewöhnlich. Immerhin; in diesem Bett hatte der Kaiser geschlafen, und auch er hatte nicht übel in ihm geträumt. Es war schließlich doch geraume Zeit lang sein Zimmer gewesen. Und nun wußte er nicht einmal, wohin man ihn brachte! Ehem – wurde er jemals Gentleman der kaiserlichen Kammer, so war's hoffentlich eine andere Kammer als diese – – –
Monsieur Georges rief irgend etwas in ärgerlichem Ton und Brown beeilte sich.