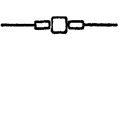|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
In einem französischen Gefängnis spielt sich eine leidenschaftliche Szene ab, die sich aber schließlich in Champagner und Wohlgefallen auflöst.
Einige Tage vor der Schwurgerichtsverhandlung wurde Brown mitgeteilt, das Gefängnis sei in der Periode der Assisen überfüllt, und man könne ihm den Luxus einer eigenen Zelle nicht mehr gewähren.
»Allright«, sagte Brown. »Ziehen wir aus. Einen Möbelwagen brauche ich ja nicht!«
Und er war sehr stolz darauf, daß er in seiner Lage überhaupt noch imstande war, Witze zu machen, wenn auch nicht besonders gute. Das Gefängnisleben gefiel ihm gar nicht, und er sehnte sich nach der Gerichtsverhandlung, wenn auch mit einiger Bänglichkeit. Auf die Aussicht, mit einem anderen Gefangenen eine Zelle teilen zu müssen, freute er sich sehr – das war wenigstens eine Abwechslung. Wenn's auch ein Verbrecher war. Das machte nichts. Uebrigens konnte es ja gar keinen schlimmeren Verbrecher geben, als ihn selbst; nach Ansicht des Herrn Untersuchungsrichters wenigstens. Brown grinste jedesmal, wenn er an diesen Untersuchungsrichter dachte. Seiner eigenen Gesellschaft jedoch war er gründlich überdrüssig. Die einzige Abwechslung bis jetzt waren ja nur die Gespräche mit den Gefängniswärtern gewesen, die ihn zwar mit einer gewissen Liebenswürdigkeit behandelten, und an seinen Fortschritten in der französischen Sprache einiges Interesse zu nehmen schienen. Sie waren nur so burschikos und nahmen es als so selbstverständlich an, er sei ein gewiegter alter Verbrecher, daß Brown manchmal wirklich gelinde Zweifel an seiner bürgerlichen Ehrlichkeit überschlichen …, Anständig kam er sich eigentlich nur vor, wenn er ganz allein war und in lapidarer Sprache seine Ansichten über französische Untersuchungsrichter im besonderen und französische Dinge im allgemeinen den Zellenwänden anvertraute, bis gewöhnlich ein Wärter klopfte und durch das Guckloch rief:
»Taisez vous!«
... Brown wurde also in eine neue Zelle gebracht und – fiel beinahe um vor Erstaunen! Denn auf der Pritsche in dieser Zelle saß Duveen, der durchaus kein erfreutes Gesicht machte, als er Brown sah, sondern dem es im Gegenteil höchst ungemütlich zu Mute zu sein schien. Auch Brown verspürte nicht das geringste Bedürfnis, dem Urheber seines Unglücks um den Hals zu fallen –
»Sie!« rief er aus.
»Moi même,« brummte Duveen.
Ein verlegenes Schweigen entstand. Gefängniszellen haben einen merkwürdig drückenden Einfluß auf Konversationstalente.
»Wir sind ja in einer netten Patsche,« sagte Duveen endlich.
»Das scheint mir auch so,« antwortete Brown trocken. Das heiße Blut stieg in ihm auf. »Mann,« schrie er, »nun sagen Sie mir aber in drei Teufelsnamen, was die Geschichte eigentlich zu bedeuten hat. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ich weiß nicht, bin ich blödsinnig oder sind's die französischen Gerichte. Der Untersuchungsrichter –«
»Oh, der ist ein Affe,« rief Duveen. Und dann fuhr er fort, in einem Ton, der um Verzeihung zu bitten schien: »Sie müssen mir es wirklich glauben, Mr. Brown, wenn ich Ihnen sage, daß ich nie ahnen konnte, Sie würden solche Unannehmlichkeiten haben!«
»Na«, meinte Brown gedrückt, »schließlich ist es meine eigene Schuld. Hätte ich mich nicht in politische Dinge gemischt, die mich nichts angingen, so säße ich nicht hier. Aber Sie haben mir redlich geholfen dabei –«
Brown schwieg. Er fühlte, es sei unklug, Duveen Vorwürfe zu machen, denn er hoffte noch immer, daß dieser ihm helfen und ihm bestätigen würde, wie wenig er eigentlich mit der ganzen Sache zu tun gehabt hatte.
»Ich hoffe nur,« sagte er endlich, »daß man diesen Blödsinn mit der Anklage wegen Raubes doch noch fallen läßt, und wir uns nur für das politische Vergehen verantworten müssen.«
Duveen starrte ihn an. – – Dann sagte er etwas, verschluckte sich aber beim Sprechen, würgte, stotterte …, und kam endlich heraus mit der Sprache:
»Mensch, Sie wollen doch nicht etwa sagen, daß Sie den Unsinn mit Napoleon und der Verschwörung noch immer glauben!«
Nun war die Reihe an Brown, sein Gegenüber anzustarren. Der napoleonische Unsinn! Zweifel waren ihm zwar dann und wann aufgestiegen, aber er hatte sie immer wieder bekämpft und bis zuletzt brav und ehrlich an die Existenz des Verbandes zur Wiederherstellung des Kaiserreiches geglaubt.
»Sie wollen doch nicht etwa sagen, daß die ganze Geschichte ein Schwindel war!« schrie er. »Ein – das ist doch unerhört. Also, Sie haben mich belogen und betrogen!«
Duveen lächelte melancholisch, gab aber keine Antwort.
»Mehr als einmal stieg der Verdacht in mir auf, daß es so sei,« fuhr Brown bitter fort. »An jenem letzten Tage war ich sogar überzeugt davon. Nach der Verhaftung glaubte ich aber wieder an Sie und – an die anderen, denn ich vermutete nie etwas anderes, als daß die Anklage wegen Raubes ein ganz gewöhnlicher Bluff sei …,«
Und plötzlich übermannte ihn die Wut, und er schüttelte Duveen bei den Schultern.
»Und was ist's mit dem Raubanfall? Heh? Ist er wirklich begangen worden? Haben Sie ihn begangen? Und weshalb bin ich dann in diese verdammte Geschichte hineingezerrt worden?«
»Von dem Raub weiß ich nicht mehr, als Sie,« sagte Duveen niedergeschlagen. »Bitte, glauben Sie mir das doch. Monsieur Georges muß hinter dieser Geschichte stecken. Uns sagte er, die Juwelen seien ihm geschenkt worden – von einer Frau. Ich weiß wirklich von nichts. Was ich weiß und worin ich die Hand im Spiel gehabt habe, ist nur, daß wir Sie rupfen wollten – und uns in die Federn teilen« Auf Ehrenwort – das ist die Wahrheit!«
»Mich rupfen?« stotterte Brown. »Mich – – – Sie gestehen es also ein?«
»Ich muß wohl,« sagte Duveen. »Und was ist auch weiter dabei? Es ist uns ja nicht gelungen; und jetzt kommen Sie und werden in diese Raubgeschichte mit hineingezerrt, die wir gar nicht begangen haben. Es ist eigentlich komisch.« Und mit einem Grinsen fügte er hinzu: »Sie – sind ja der Anführer der Bande, wissen Sie!«
»Sie infamer Betrüger!« schrie Brown außer sich, im Tiefsten verwundet. Dann kam eine Erinnerung über ihn, die ihn noch wett schwerer traf. »Und die Herzogin? Die Frau, die ich kompromittierte?«
»Ach Gott«, sagte Duveen, »die Herzogin zu kompromittieren, dürfte Ihnen schwer fallen. Sie ist drüber hinaus. Machen Sie sich nur ja darüber keine Sorgen!«
Brown stöhnte. »Und war sie – hat sie auch mitgemacht?«
»Sie ist an all den Schwindelgeschichten beteiligt, die Monsieur Georges ausheckt –«
Das war fürchterlich – das war der schwerste Schlag für den armen Brown, und nur eines tröstete ihn! Der bessere Mensch in Thérèse hatte sich doch zuletzt gegen den Schwindel gesträubt. Sie war es ja gewesen, die ihm geraten hatte, Petite Mouleville zu verlassen; sie hatte ihn gewarnt, die dreitausend Pfund herzugeben. Das war wenigstens ein Trost.
»Aber das ist ja noch lange nicht das Schlimmste!« schrie Brown. »Sie waren nicht damit zufrieden, mich zu begaunern und mich zu betrügen. Nein, Sie mußten auch noch lügen und es so hinstellen, als sei ich es gewesen, der diesen blödsinnigen Raub geplant hätte!«
»Ganz gewiß nicht,« versicherte Duveen. »Ich schwöre Ihnen, daß ich von der ganzen Geschichte nichts weiß und Monsieur Georges ebenso wenig – zum mindesten behauptet er, daß er nichts wüßte. Weshalb man gerade auf Sie gekommen ist, weiß er nicht, jedenfalls nicht durch ihn oder durch mich. Es scheint, als ob die Witwe Potin selbst Sie angezeigt hat.«
»Aber es muß doch etwas daran sein,« sagte Brown. »Die Juwelen wurden gestohlen! Monsieur Georges muß doch die Hand im Spiel gehabt haben dabei; er war es doch, der sie nach dem Hause des Marquis brachte, nicht wahr?«
»Die Witwe Potin selbst hat sie ihm geschenkt, wie er sagt. Aber er weiß auch, daß es gar keinen Sinn hat, sich damit zu verteidigen, denn kein Mensch würde es ihm glauben. Na, Sie haben es jedenfalls nicht getan und Monsieur Georges meint, es sollte Ihnen nicht schwer fallen, das zu beweisen. Monsieur Georges macht sich überhaupt über nichts viel Kopfschmerzen. Mir aber tun Sie leid, Mr. Brown. Wir sind ja jetzt alle im gleichen Boot und schwimmen oder sinken zusammen. Ihnen jedoch sollte es nicht schwer sein, sich aus der Affäre zu ziehen! Weshalb lassen Sie denn Ihre Verwandten und Ihre Freunde nicht herüberkommen als Zeugen für Sie?«
»Fällt mir nicht im Traum ein!« schrie Brown. Meinen Sie etwa, ich sei besonders stolz darauf, in einem französischen Gefängnis zu sitzen und mich vor französischen Geschworenen verantworten zu müssen – unter solch einer infamen Anklage. Nicht ein Wort sollen meine Freunde von mir hören, bis ich freigesprochen bin. Aber warum wenden denn Sie sich nicht an Ihre Freunde?«
Duveen lachte.
»Weil es mir lieber ist, wenn meine Freunde da bleiben, wo sie sind. Sie würden mir nur schaden – sie könnten wirklich nicht viel Gutes über mich aussagen. Aber bei Ihnen ist es ja anders!«
Ein neuer Wutanfall befiel Brown.
»Es ist ja unglaublich, wie Sie an mir gehandelt haben. Ich vertraute mich Ihnen völlig an, und zum Dank führten Sie mich in jene Diebeshöhle. Sie – Sie Sie, mit Ihrem Bett des Kaisers und Ihrem Gentleman der Kaiserlichen Kammer und Ihrem Pagen der …, Und dann dieser Ring des Getreuen! War das alles von A bis Z erlogen?«
»Aber freilich, jedes Wort.«
»Und Sie bringen es fertig, dazustehen und zu lachen, wenn Sie sehen, in welch entsetzliche Lage Sie mich gebracht haben!«
»Ich kann mir nicht helfen,« sagte Duveen. »Wenn ich an den Pagen der Toilette denke …, Haben Sie doch ein bißchen Humor! Und dann tun Sie mir auch wirklich sehr leid. Freilich, mein Leben ist ein hartes Leben gewesen, und ich hab' sehr wenig Gefühl übrig für andre Leute. Wenn ich wirklich noch Mitgefühl hätte, so würde ich es für mich selbst verwenden.«
Brown stöhnte.
»Großer Himmel!« (Er schlug die Hände über dem Kopf zusammen.) »Wenn ich mir vorstelle, wie ich mich nach Frankreich sehnte und wie begeistert ich war, französisches Leben kennen zu lernen – nur um einer Bande von Dieben in die Hände zu fallen! Wenn ich mir vorstelle, daß ich so tief sinken mußte – daß ich hier in einer Gefängniszelle sitze, anstatt froh und glücklich in meinem guten alten Brixton!«
Duveen sah Brown scharf an während der letzten Worte, und eine merkwürdige Erregung spiegelte sich in seinem Gesicht. Er stürzte auf Brown los.
»Brixton!« schrie er. »Sagten Sie nicht Brixton?«
»Natürlich,« sagte Brown mit gebrochener Stimme. »Natürlich sagte ich Brixton. Ich komme von Brixton und ich wünschte, ich hätt' das gute alte Brixton nie verlassen.«
»Sie kommen von Brixton!« wiederholte Duveen mit fast tonloser Stimme. Er starrte Brown an und zum erstenmal in all der Zeit lag etwas wie Bewunderung und Verehrung in seinem Blick.
»Freilich bin ich von Brixton,« wiederholte Brown, der sich über Duveens sonderbares Benehmen sehr wunderte, »und ich wüßte nicht, daß ich mich Brixtons oder meiner Stellung in Brixton zu schämen hätte, wenn ich auch nie darüber sprach. Ich bin im Emporium von Brixton angestellt.«
Da sank Duveen auf die Knie nieder, verbarg sein Gesicht in die Decken der Gefängnispritsche und brach in bittere Tränen aus. ..
Brown starrte ihn an.
»Brixton,« schluchzte Duveen endlich. »Das Emporium! Mann, weshalb haben Sie mir das nicht früher gesagt!«
»Was meinen Sie eigentlich?« fragte Brown. »Kennen Sie Brixton denn auch?«
»Ich bin ja dort geboren! Und ich war auch im Emporium angestellt!« schluchzte Duveen, und ein förmlicher Weinkrampf schüttelte ihn. Als er sich ein wenig erholt hatte, wandte er sein tränenüberströmtes Gesicht Brown zu –
»Haben Sie denn nie von Walker gehört?«
»Dem Mann, der mit der Tageskasse durchbrannte? Freilich.«
»Der bin ich ja!«
Brown starrte und starrte. Deshalb also war Duveen so gerührt und so aufgeregt! Brown erinnerte sich der Affäre sehr wohl: wie Walker, der mit außergewöhnlicher Schnelligkeit seinen Weg in der Firma gemacht hatte, dem Direktoren und Geschäftsleiter ihr vollstes Vertrauen schenkten, den man anderen Angestellten als ein Muster hinstellte, plötzlich mit der Tageskasse verschwunden war, niemand wußte, wohin. Und man war ihm nie auf die Spur gekommen. Jawohl, Brown erinnerte sich sehr gut. Er war ja in die Schule gegangen mit diesem Walker! Freilich, er war ein kleiner Junge gewesen damals, und Walker einer der großen Jungen in der obersten Klasse.
»Der Walker vom Brixton-Emporium sind Sie? Der Kassen-Walker?«
»Hätt' ich es nur nie verlassen,« stöhnte Duveen, von neuem in Schluchzen ausbrechend. »Aber das Geld hab' ich zurückerstattet. Den größten Teil wenigstens. Wenn der coup mit Ihnen mir gelungen wäre, so hätte ich auch den Rest bezahlt!«
Brown lächelte unwillkürlich; dieser Duveen stahl seelenruhig von Petrus, um als ehrlicher Mann dem Paulus das gestohlene Geld zurückzuerstatten! Niedlich! Aber jetzt fiel ihm alles ein. Von Zeit zu Zeit war unter den Angestellten das Gerücht gewesen, die Firma habe Geld von Walker bekommen. Vielleicht war er deshalb nicht energischer verfolgt worden.
»Und beinahe hätte ich einen Angestellten des Emporiums ausgeplündert, um das Emporium zu bezahlen!« rief Duveen. »Wenn ich das nur gewußt hätte, so wäre ich lieber gestorben, ehe ich Ihnen auch nur einen Pfennig Ihres Geldes abgenommen hätte. Es ist fürchterlich! Und nun hab ich einen Mann von Brixton, einen Mann vom Emporium in solch eine verzweifelte Lage gebracht …,«
Er schwieg und starrte auf die Zellenwand. Dann fuhr er fort:
»Ich fuhr damals verkleidet nach Paris; nach Mouleville kam ich erst Jahre später – man ist mir nie auf die Spur gekommen. Das Geld für das Emporium sende ich immer an einen Freund nach Italien, der es von dort aus weiterbefördert. Man wird mir auch nie auf die Spur kommen; niemand wird in Duveen den Walker vom Brixton-Emporium erkennen. Auch Sie werden mich ja sicherlich nicht verraten, es hätte ja so gar keinen Zweck. Im übrigen ist es ja auch gleichgültig, was mit mir geschieht; ich lege einen merkwürdig geringen Wert auf meine Existenz, und andere Leute wahrscheinlich noch weniger. Ich stecke im Sumpf und werde aller Logik nach natürlich immer tiefer in diesen Sumpf hineingeraten. Und that's allright. Sie aber, Brown, Mann, Sie sind ja von Brixton und vom Emporium – müssen aus dieser Geschichte reingewaschen wie ein Engel hervorgehen. Das bin ich dem guten alten Brixton schuldig. Wir müssen Sie freibekommen!«
»Hm!« brummte Brown. »Hoffentlich. Aber Sie sagen ja selbst, daß Sie keine Ahnung haben, wie ich in diese Geschichte hineingezerrt worden bin. Auch Sie wissen ja nicht, weshalb diese gesegnete Witwe Potin gerade mich beschuldigte, ihre Juwelen gestohlen zu haben, und Sie wissen ebensowenig, wer der wirkliche Dieb ist. Die Affäre kommt mir mit jedem Tag unheimlicher vor. Monsieur Georges war es doch in aller Wahrscheinlichkeit, der die Juwelen gestohlen hat?«
»Hm, er schwört, er sei nicht der Dieb gewesen, aber ich fürchte, Monsieur Georges kümmert sich verflucht wenig um die Heiligkeit eines Eides. Ich persönlich glaube allerdings nicht, daß er es gewesen ist; er arbeitet gewöhnlich mit so ganz anderen Methoden. Mit Frauen. Auch Erpressung liegt ihm vorzüglich, nackter Raub aber gar nicht. Ich fürchte, wir können augenblicklich nichts tun, als die Verhandlung selbst abwarten. Und dann werde ich die volle Wahrheit erzählen, und es müßte doch sehr sonderbar zugehen, wenn Sie nicht glänzend freigesprochen würden. La duchesse wird uns auch dabei helfen, glaube ich. Aber jetzt erzählen Sie mir, bitte, etwas von Brixton; um Himmelswillen, erzählen Sie mir etwas von Brixton. Existiert die Wirtschaft zu den »Sechseinhalb Goldenen Engeln« noch?«
»Freilich!«
»Und der große Brunnen, der damals zum Stadtjubiläum errichtet wurde; funktioniert der noch?«
»Ausgezeichnet.«
Und dann setzten sich die beiden, der Verbrecher und der Unschuldige, Seite an Seite auf die Gefängnispritsche und plauderten mit leuchtenden Augen über das kleine englische Städtchen, das ihnen beiden Geburtsort war. Brown vergaß Entrüstung und Aerger und Widerwillen und erzählte dem irrenden Schaf zu seiner Rechten, was sich in den langen Jahren alles in dem Städtchen zugetragen hatte. Die beiden Menschen vergaßen sich selbst und den nicht geringen Unterschied zwischen ihnen; sie vergaßen die Gerichtsverhandlung, die ihnen bevorstand – Brown vergaß völlig, daß der Mann neben ihm ein Verbrecher war, der sein Bestes getan hatte, um ihn um sein Vermögen zu bringen …, Brixton war das Band, das sie vereinte!
Es fing an, dunkel zu werden in der Zelle, aber sie merkten es nicht. Und als die Wärter kamen und ihnen die Abendmahlzeiten brachten, da fanden sie genau das, was sie erwartet hatten: die beiden Gefangenen schienen im herzlichsten Einvernehmen zu sein – in richtiger Gaunerfreundschaft. Vertraut, wie alte Diebe. Brown sagte gerade: und wissen Sie was, alter Junge, wenn Sie die Wahrheit sagen, und wenn ich glücklich aus dieser Patsche heraus bin, dann schreibe ich Ihnen einen Scheck aus über den Rest des Geldes, das Sie dem Emporium noch schulden. Sie können sich darauf verlassen. Das Geld gehört Ihnen, wenn Sie Ihr Bestes für mich tun. Abgemacht. Ich halte mein Wort –« und er klopfte Duveen freundschaftlich auf den Rücken.
Einer der Wärter verstand unglücklicherweise ein wenig Englisch – deswegen war er ja diesen englischen Gefangenen zugeteilt worden – und erfaßte sehr wohl den Sinn dessen, was Brown da soeben gesagt hatte.
»Very good, mon ami! Ich werde dem Direktor melden, daß Sie dem Mann da Geld anboten, um auszusagen, Sie seien nicht coupable. Ça te pique, hein?«
Grinsend verließ er die Zelle.
Brown und Duveen starrten sich an, sprachlos über ein so unbeschreibliches Pech. Der Zwischenfall brachte ihnen ihre unangenehme, mehr als unangenehme Lage so recht in Erinnerung.
»Es gibt keine Gerechtigkeit in Frankreich«, murmelte Duveen. »Die Wände haben Ohren, und fortwährend ist man von Spionen umgeben.«
Auch Brown war niedergeschlagen, aber Brown war ein Gentleman. Als er sah, wie sehr Duveen sich den Zwischenfall zu Herzen nahm, – Duveen, der, was er auch sonst sein mochte, doch Brixton seine Heimat nannte, – da sagte Brown etwas sehr Nettes und etwas sehr Großmütiges:
»Wissen Sie was? Wenn die Wände hier wirklich Ohren haben, dann mögen Sie auch hören, wie wir beide des guten alten Brixtons Gesundheit trinken. Und zwar in Sekt! Unter einer Flasche Champagner tu ich's bestimmt nicht!«
Und wahrhaftig, als die Gefängniswärter wiederkamen, um die Teller und Schüsseln wegzuräumen, gelang es Brown, sie zu bestechen, ihm eine Flasche Champagner zu besorgen. Untersuchungsgefangenen wurden zwar im allgemeinen ziemliche Freiheiten in Bezug auf Verköstigung und kleine Luxusgenüsse eingeräumt; Sekt aber durften sie wirklich nicht trinken; Geld hat jedoch auch zwischen Gefängnismauern eine gewisse Macht, und für eine Summe, die mindestens für einen halben Korb Sekt irgend einer berühmten Marke ausgereicht hätte, drückten die beiden Wärter mit dem größten Vergnügen anderthalb Augen zu. Der Champagner kam.
»Teuer ist er,« grinste Brown. »Aber schließlich repräsentiert diese Flasche doch nur einen sehr geringen Bruchteil jener dreitausend Pfund, die Sie mir so gerne abgeknöpft hätten, mein lieber Duveen!« Mr. Brown von England lächelte bei diesen Worten sehr vergnügt, aber sein Lächeln hatte nichts Verletzendes.
Duveen stöhnte.
» Hätte ich nur gewußt, daß Sie von Brixton sind!«
»Na, Sie wußten es nun einmal nicht,« erwiderte Brown, dieser Insasse einer französischen Gefängniszelle, der sich in diesen Stunden sicherlich vornehmer gezeigt hatte, als so mancher tadellose Gentleman. »Sie wußten es ja nicht, alter Junge!«
Und Duveen ergriff seine Hände. Dabei schimmerte etwas Feuchtes in seinen Augen.
»Brixton soll leben!« rief er. »Und das Emporium! Und ein Gentleman, der in diesem Emporium angestellt ist!« Und dann fangen die beiden, der Verbrecher und der Unschuldige, leise das Lied des Emporiums, jenes zwar nichts weniger als geistvolle, aber von Herzen gutgemeinte Lied, das die getreuen Angestellten des großen Warenhauses von Brixton bei festlichen Gelegenheiten anzustimmen pflegten. ..
* * *
Brown schlief einen unruhigen, von Träumen gequälten Schlaf. Duveen aber hatte kein Auge geschlossen. Und auf einmal, es war spät nach Mitternacht, stand er leise, ganz leise auf und beugte sich vorsichtig über Brown. Jawohl, er schlief – schlief fest. Und nun setzte sich dieser Gauner von Duveen an das schmale Tischchen der Zelle, mit unendlicher Vorsicht, um ja kein Geräusch zu machen, und schrieb mit dem winzigen Bleistiftstümpfchen, über das er verfügte, auf einem Stückchen Papier einen kurzen Brief. So kurz der Brief war, so machte er ihm doch viele Mühe, denn es ist anstrengend, mit verstellter Handschrift zu schreiben …,
Und als er am nächsten Morgen mit dem Gefängniswärter einen Augenblick lang allein war, steckte er dem Mann das letzte Goldstück, das er hatte, zu und bat ihn, ihm den Brief Zu besorgen. Der Gefängniswärter schüttelte zwar den Kopf, nahm jedoch die zwanzig Francs und den Brief. Er las ihn später, so gut es ihm seine bescheidenen englischen Kenntnisse erlaubten, denn selbst für ein Goldstück hätte er kein Schreiben besorgt, das einem Verbrecher irgendwie unerlaubte Vorteile gebracht hätte. Dann steckte er ihn lächelnd in den Briefkasten; denn dieser Brief war ohne Zweifel völlig harmlos – an einen Herrn Direktor So und So in einem gewissen Brixton gerichtet und nichts weiter enthaltend, als einige kurze Sätze, in denen der Adressat beschworen wurde, im Interesse eines gewissen Gentleman des Emporiums sofort nach Mouleville zu reisen, und sich bei der Schwurgerichtsverhandlung gegen Duveen, Monsieur Georges und Genossen einzufinden …,
Den Rest des Tages trug dieser Gauner von Duveen ein engelhaftes Lächeln. Er selbst würde ja hoffentlich nicht erkannt werden. Und diesem Esel von Brown durfte nichts passieren. Dafür hatte er, der Gauner Duveen gesorgt!
Man merke! Selbst ein Spitzbube vermag gelegentlich wirkliche Vornehmheit zu würdigen!