
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Mit Freuden wird sich Mancher jenes Abends erinnern, als das Leipziger Orchester unter Mendelssohn's Leitung uns alle vier Ouverturen zu Leonore nach einander hören ließ. Die Zeitschrift berichtete schon früher darüber. Wir kommen heute wieder darauf zurück, da so eben die vierte der Ouverturen (der Entstehung nach die zweite) im Stich erschienen ist, vor der Hand nur in Stimmen, denen aber bald die Partitur folgen wird.
Ueber die Reihenfolge, in der Beethoven die Ouverturen schrieb, kann kaum ein Zweifel sein. Vielleicht daß Mancher die eben erschienene für die erste halten könnte, die Beethoven überhaupt zu seiner Oper entworfen, da sie ganz den Charakter eines kühnen ersten Anlaufs hat, wie in der kräftigsten Freude über das vollendete Werk geschrieben scheint, das in den Hauptzügen sie im kleineren Raum widerspiegelt. Den Zweifel beseitigt aber Schindler's Buch auf das Vollständigste (S. 58). Nach dessen bestimmter Versicherung verhält es sich folgendermaßen damit. Beethoven schrieb erst die Ouverture, die später bei T. Haslinger als Werk 138 nach Beethoven's Tode erschien; sie wurde in Wien nur vor einer kleinen Kennerschaar gespielt, aber einstimmig für »zu leicht« befunden. Beethoven gereizt schrieb jetzt die Ouverture, die so eben bei Breitkopf und Härtel erschienen, änderte aber auch diese, woraus die bekannte in C dur als Nr. 3 zu bezeichnende entstand. Die vierte Ouverture endlich in E dur schrieb Beethoven erst im Jahre 1815, als Fidelio wieder auf das Repertoir gebracht wurde.
Daß die dritte der Ouverturen die wirkungsvollste und künstlerisch vollendetste, darin stimmen fast alle Musiker überein. Schlage man aber auch die erste nicht zu gering an; sie ist bis auf eine matte Stelle (Part. S. 18) ein schönes frisches Musikstück, und Beethovens gar wohl würdig. Einleitung, Uebergang in's Allegro, das erste Thema, die Erinnerung an Florestan's Arie, das Crescendo am Schluß – das reiche Gemüth des Meisters blickt aus allem diesem. Interessanter sind freilich die Beziehungen, in denen die zweite zur dritten steht. Hier läßt sich der Künstler recht deutlich in seiner Werkstatt belauschen. Wie er änderte, wie er verwarf, Gedanken und Instrumentation, wie er sich in keiner von seiner Florestan'schen Arie losmachen kann, wie sich die drei Anfangstacte dieser Arie durch das ganze Stück hinziehen, wie er auch den Trompetenruf hinter der Scene nicht aufgeben kann, ihn in der dritten Ouverture noch weit schöner anbringt, als in der zweiten, wie er nicht ruht und rastet, daß sein Werk zu der Vollendung gelange, wie wir es in der dritten bewundern, – dies zu beobachten und zu vergleichen gehört zu dem Interessantesten und Bildendsten, was der Kunstjünger vornehmen, für sich benutzen kann. Wie gern möchten wir die beiden Werke Schritt vor Schritt verfolgen. Dies gelingt mit den Partituren in der Hand mit Genuß weit besser als mit Buchstaben auf dem Papier, weshalb wir nur in Kurzem die wesentlichen Unterschiede berührten. Noch eines Umstandes müssen wir gedenken. In der Partitur, die sich im Besitz der HH. Breitkopf und Härtel befand, fehlten leider zum Schluß einige Blätter. Zum Zweck der Ausführung in den hiesigen Concerten wurde diese Lücke durch eine entsprechende Stelle aus der dritten Ouverture ergänzt, und diese in der gedachten Ausgabe durch Sternchen bezeichnet. Jedenfalls war dies das einzig Schickliche, das sich thun ließ. Der Dirigent hat nun aber freilich zu thun, das Orchester so anzutreiben, daß die Stelle

(21 Tacte vor dem Schluß) nicht zu langsam gegen den des Presto

hinterher komme. Der Uebelstand wäre vermieden worden, wenn man nach dem Tacte
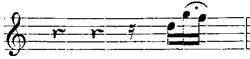
der zweiten Ouvertüre (erste Violinstimme, neuntes System, letzter Tact) vielleicht gleich mit dem fff der zweiten Ouverture auf S. 68 der Partitur fortgefahren wäre. Der Verlust der kleinen Varianten in der Instrumentation, den das gänzliche Aufgeben des Presto nach der ersten Lesart mit sich brächte, scheint uns kein großer.
Andererseits muß man freilich die Pietät gelten lassen, die keinen Tact opfern wollte. Sollte sich aber in der Welt keine zweite Abschrift der Ouverture vorfinden, die auch den vollständigen Schluß enthielte?
*
Gekrönt vom Preisinstitut des Norddeutschen Musikvereins in Hamburg.
Obige Werke lassen sich füglich aus zwei Gesichtspunkten betrachten: als Preissonaten, – als Sonaten überhaupt. Diese könnten allenfalls Versuche sein und sie würden schon der würdigen Form halber, in der sie auftreten, die Sympathieen des Kritikers für sich haben; an jene stellt man höhere Ansprüche, wie etwa an gekrönte Häupter selbst, die dem Volke vorangehen sollen in aller Art. Freilich in der Kunst gibt es kein Erbrecht; ihre Kronen wollen verdient sein; und an dem Lorbeer, ehe er auf einem Dichterhaupte fest sitzt, zerren oft tausend Hände und nicht in der besten Absicht. Künstlerische Wettkämpfe sind denn gut dazu, Talente schneller zu erforschen und der Welt bekannt zu machen. Zwar der Kritik sind sie deshalb noch nicht entzogen; aber der Masse imponirt ein Preiscollegium immer, wie den Künstlern selbst, die sich ihm ja sonst nicht unterworfen haben würden. Daß aber offenbar Schlechtem von ausgewählten Richtern ein Kranz zugesprochen würde, wäre beispiellos. Verdienstliches mag denn auch durch den letzten Wettkampf einiges erzielt worden sein.
Von den drei Siegern war dem Publicum vielleicht nur der dritte bekannt; die zwei andern hätten vielleicht noch lange arbeiten und warten müssen, ehe ihre Namen der öffentlichen Aufmerksamkeit für werth befunden worden. Man weiß, der Ruf ist jetzt nicht mehr so wohlfeil als sonst; sie werden also die Gunst Apoll's zu würdigen verstehen. Sehen wir jetzt ab von allen äußerlichen Interessen und die Compositionen selbst etwas genauer an.
Die erste Sonate geht aus G moll. Die Folge der Sätze ist die gewöhnliche. Was sie musikalisch ausspricht, ist nicht neu, alles auch nicht Musik. Der Componist steht einigermaßen noch unter der Herrschaft des Virtuosen; doch bringt er nirgends geradezu inhaltloses Passagenwerk. Hier und da blickt Hummel als Vorbild durch, auch jüngere Componisten scheint er zu kennen und lieben. Das Instrument ist wirkungsvoll, in moderner Weise behandelt, wie denn der Componist überhaupt ein brillanter Spieler scheint. Sich als letzteren zu zeigen, gibt die Sonate vielfache Gelegenheit; deshalb spielt sie auch oft in die Concertform hinüber. Damit ist zugleich gesagt, daß ihr nicht jener ausdauernd innige seelenvolle Charakter innewohne, wie z. B. Beethoven'schen Sonaten, namentlich der letzten Epoche. Wo wäre aber auch Gleiches oder nur Aehnliches zu finden? – Von den einzelnen Sätzen scheint uns der erste, wenn auch nicht von meisterlichem Guß, doch der frischeste und kräftigste. Die Partie, wo sich der Meister am sichersten erprobt, die Durchführung in der Mitte des Stückes bis zum Rückgang, ist nicht uninteressant, doch etwas schwerfällig; der Componist hatte sich nach Ges dur (von G moll aus) verirrt, da gab es denn einen schweren Rückweg; der Spieler hat dabei gewiß dieselbe Empfindung, wie der Componist hatte, während er schrieb. Einige triviale Stellen finden sich wie schon im ersten Theile des ersten Satzes, so auch im Mittelsatze dieses (so S. 5 Syst. 2 von Tact 4 an, S. 7 Syst. 4 und 5, S. 9 Syst. 6). Dagegen gefällt uns der Schluß von S. 14 Syst. 4 an vorzüglich; die Einführung des ersten Thema's geschieht hier leicht, frei und wohlthuend. Es folgt ein Scherzo im 2/4 Tact, in derselben Tonart; es ist artig und hat ein anmuthiges Trio. Stellen wie S. 19 Syst. 2 von Tact 5 scheinen uns aber zu wohlfeil und gehören am wenigsten in eine Preissonate. Im Coda sagt uns bis auf einige verbrauchte Wiederholungen wieder der Schluß sehr zu. Das Andantino beginnt mit einem innigen Gesang, der an ein Motiv des ersten Satzes anklingt; wir wünschten es in diesem Charakter festgehalten. S. 23 geräth aber der Componist in einen unbegreiflichen Zorn, der sich, wie oft bei Clavierspielern, in massigen Octavengängen ausläßt. Diese Stelle verleidet uns den Satz. Das Finale wird durch ein paar Uebergangstacte mit dem Andantino verbunden; wir müssen ihn leider für den gehaltlosesten Satz der Sonate erklären, er ist nicht einmal in der Form gerathen und voll von Gemeinplätzen, wie wir sie wohl in Virtuosenstücken entschuldigen, nicht aber in Componistenleistungen. Es thut uns leid, die Meinung der HH. Preisrichter hier nicht theilen zu können. Das Talent, das sich in den vordern Sätzen ausspricht, hat sie offenbar die Schwächen des letzten übersehen lassen.
Wir kommen zur zweiten Sonate, vom Componisten Sonata quasi Fantasia genannt; sie ist mehr sonderbar als schön, in gewisser Art originell. Der Componist hat sich nämlich darauf capricirt, die Sonate, sogar in ihren Nebentheilen, über ein Thema zu machen. Welche drückende Fessel er sich damit angelegt, wird er selbst am besten wissen; immer verdient aber eine solche Selbstbeschränkung ein gewisses Lob, das wir um so lieber spenden, je mehr wir überzeugt sind, daß es ihm Andere, die von der Schwierigkeit einer solchen Arbeit keinen Begriff haben, nicht spenden werden. Denn freilich – was hat er erreicht durch diese Sonderbarkeit? Sein Stück leidet an einer fast abmattenden Einförmigkeit und die Kunst ersetzt nicht, wo die Natur mangelt. Wir wissen wohl von Bach und andern verwickelt combinirenden Künstlern, wie sie auf wenige Tacte, oft Noten ganz wundersam gefügte Stücke gegründet, durch die sich jene Anfangslinien in unzähligen Verschlingungen hindurchziehen, von Künstlern, deren inneres Ohr so bewundernswürdig fein schuf, daß das äußere die Kunst erst mit Hilfe des Auges gewahr wird. Aber sie waren Meister der ersten Ordnung, denen in Laune gelang, was dem Jünger Schweißtropfen kostet. Ihre tiefe harmonische Kunst gewährte wenigstens von dieser Seite ein Interesse. Der obigen Sonate und ihrem Componisten wollen wir den besten Willen und das ernste Streben, aus Wenigem Viel hervorzuzaubern, nicht absprechen; aber der Eindruck seiner Composition spricht dafür, daß er mit seiner Arbeit etwas Undankbares unternommen, daß er seine Kräfte in einer unnatürlichen Spannung versucht, die auch dem wohlwollenden Beschauer ein Mißbehagen verursachen muß. Noch dazu ist das Grundthema nicht einmal sein eigen und unterscheidet sich nur rhythmisch vom ersten Thema der Beethoven'schen A-Sonate für Pianoforte und Violine, oder, geht man noch weiter zurück, von der Fuge in G moll aus dem wohltemperirten Clavier von Bach. Andererseits erinnert die Art seines Auftretens an die letzte große Sonate in C von Beethoven. Davon abgesehen, so hat der Componist aus ihm gemacht, was es nur irgend hergab. Es erscheint in wohl 50 verschiedenen Gestalten, als Melodie, als Baß, als Mittelstimme, per augmentationem simplicem und duplicem, desgleichen per diminutionem, wohl auch in Engführungen etc. etc. Im ersten Satze interessirt das noch. Beginnt aber das Adagio wieder mit der Figur, dann das Scherzo, und dann das Finale, und, wie gesagt, nicht allein in dem Haupt-, sondern auch in den Nebenthema's, so möchte sich das Ohr apathisch abwenden, das so unbarmherzig von dem

verfolgt wird. Dies ist das Zuviel der Durchführung, das nahe an künstlerische Absicht grenzt; statt lebendiger That trockene Formel. Aber auch dieser Art der Composition wollen wir nicht entgegentreten, sobald sie sich gibt als was sie ist, als Studie für den jungen Componisten selbst. Für eine Preissonate aber, um die sich ein eben ertheilter Lorbeer anschmiegt, halten wir die Sache für zu gemacht. Im Uebrigen sind wir, wie gesagt, weit entfernt, dem Componisten ein schätzenswerthes Talent, das bei guten Mustern in die Schule gegangen, abzusprechen. Er will nur vielleicht zu viel und tödtet am Ende den Rest Naivetät, der noch in ihm sein mag. Sagt ihm das nie eine innere Stimme? Oder ist er schon glücklich an jenem Kreuzweg vorüber, wo sich Natur und Affectation trennen?
Die dritte Sonate liegt uns noch vor, dieselbe, die den letzten Preis davon getragen. Da blickt uns denn gleich ein sinniges Gemüth entgegen; im schönen Flusse der Gedanken bewegt sich die Composition vorwärts; neue treten hinzu, die alten tauchen wieder auf; sie umschlingen sich, trennen sich wieder. Wie eine schöne Gruppe löst sich das Ganze und verschwindet leicht und anmuthig, wie es begonnen. Nach diesem Stücke fühlt man den Druck einer Künstlerhand; nur einer solchen konnte das gelingen. Eine Romanze hebt an, nach einem etwas herben Vorspiele, diese selbst; mit mildem Ernst wird uns was erzählt, was wir schon gehört zu haben glauben. Das Ganze fesselt noch immer, wenn es uns auch nicht den ersten Satz vergessen macht. Ein Scherzo folgt der hübschesten Art; in anmuthiger Folge wechseln starke und leise Stimmen und nahen und fliehen; das Trio erklingt wie die Mahnung eines Freundes; aber das Necken der ersteren beginnt von Neuem. Das Finale weicht vom früheren anziehenden Novellencharakter der Sonate etwas ab und greift zu stärkeren Farben, gleich als hätte der Componist ein Orchesterstück damit ersetzen wollen. Es gefällt uns an der Sonate am wenigsten; immer aber gewahrt man auch an ihm die tüchtige Hand eines Musikers, der mit Absicht etwas Künstlicheres liefern wollte. Dieser vor Allen, klang es nach der Sonate in uns, gebührt ein Preis, und in ihr wieder vor den andern dem ersten Satze. Wenn wir in der ersten (von Bollweiler) einen Clavierspieler erkannten, der sich mit Talent auch der Composition zugewendet, in der andern (von Leonhard) einen Musiker, der sich den Weg zur Vollendung durch Verstandesspiele in etwas zu erschweren scheint, so spricht aus der von J. P. E. Hartmann der Künstler zu uns, der uns versöhnt durch die harmonische Ausbildung seiner Kräfte, der, Herr der Form, kein Sclav seiner Gefühle, uns überall zu rühren und fesseln versteht.
Dies ist unsere Meinung, und weicht sie einigermaßen von der der Preisrichter ab, so sei damit in keinem Falle ihr guter Wille in Zweifel gezogen, das Verdienst nach Würden zu belohnen. Aber es ist schwieriger, aus fünfzig Menschen die besten herauszufinden, als aus dreien. Und dann – auch wir können irren, unsere Absicht aber war die beste. –
*
H. F. Kufferath, sechs Lieder von R. Burns mit Begleitung des Pianoforte.
Werk 3.
Burns ist der Lieblingsdichter der jetzigen jungen Componisten. Gewiß hat der poetische »Pflüger von Dumfries« es nie vermuthet, daß seine Lieder, zu denen er meistens durch alte Volksmelodieen angeregt wurde, nach beinahe hundert Jahren so viele andere Weisen erwecken würden, auch jenseits des Kanals. In Herrn Kufferath hat er einen sehr begabten Sänger gefunden. Der Ton der Lieder ist glücklich und athmet schottischen Charakter. Eine gewisse Einförmigkeit der Melodieen erscheint hier als unvermeidlich; sie gleichen sich alle sehr, namentlich im ersten und vierten Liede, die zugleich an das unter dem Titel » Michelemma« bekannte italienische Volkslied erinnern. Im Uebrigen zeigt der junge Componist in allen Talent und Geschmack, in vielen einzelnen Zügen auch die feinere Bildung des modernen Künstlers, so daß dies sein erstes Gesangwerk dem Musiker wie dem Laien gleich willkommen sein muß. Noch haben die Lieder fast durchgängig das Besondere, daß die Clavierbegleitung meist mit der Melodie zusammengeht, so daß jene auch ohne Gesang selbstständig bestehen könnte. Es ist dies gerade kein Vorzug einer Liedercomposition und namentlich für den Sänger beengend; wir begegnen Aehnlichem aber bei allen jungen Componisten, die sich vorzugsweise früher mit Instrumentalcomposition beschäftigten. Dies hindert aber nicht, den Liedern des unsrigen innerlichen Gesanggehalt zuzusprechen, wie sie sich denn auch sehr leicht singen und rasch anklingen. Der Componist zeige sich noch oft auf dem Gebiete, auf dem er so glücklich und aufmunterungswerth begonnen. –
*
Carl Zöllner, Liebesfrühling von F. Rückert. Neun Lieder mit Begleitung des Pianoforte.
Diese Lieder erheben sich weit über die Mittelmäßigkeit, wie sie in neuester Zeit im Liederfach wahrhaft entsetzend überhand genommen. Wir machen doppelt aufmerksam auf sie, die im Anfange schlicht, wohl gar etwas prosaisch erscheinend, bei genauerer Bekanntschaft immer mehr gewinnen müssen und einen wahren Gesangsmenschen verrathen, wie wir unter Hunderten nur zu einzelnen finden. Jene Schlichtheit geht namentlich die Begleitung an, die, umgekehrt wie bei den vorher angezeigten Liedern von Kufferath, ohne Gesang beinahe dürftig und bedeutungslos zu nennen wäre. In denen von Zöllner liegt die Kraft in der Melodie der Gesangstimme; sie eben in ihrer ganzen Innigkeit zu würdigen, dazu gehört ein Sänger, der auch zu sprechen versteht, und wie sie jeder Bewegung des Gedichtes liebend nachfolgt, so wollen wir es auch durch den Sänger wieder empfinden. Wie oft wird uns das geboten? Gute Liedersänger sind fast noch seltener als gute Liedercomponisten. Die Zöllner'schen Gesänge gradezu zu entstellen, würde zwar nur völlige Talentlosigkeit vermögen, sie sind dazu zu natürlich und stimmrecht; sie aber gegen oberflächliche Auffassung und vornehme Geringschätzung zu wahren, dazu kann ein öffentliches Wort wohl beitragen. Wir möchten so die Lieder einem edeln Gestein vergleichen, wie es sich oft unter unscheinbarer Erdrinde verbirgt; es gehört Fleiß und Liebe dazu, es hell an's Tageslicht zu fördern. Dann aber gewiß wird man sich des echten reinen Glanzes erfreuen, den sie ausstrahlen. Rückert, der Deutsche durch und durch, – nur von »östlichen Rosen« zuweilen überstrahlt, – war auch gerade der Dichter, der dem Componisten besonders zusagen mußte. Im »Liebesfrühling« steht Blüthe an Blüthe; die deutschen Componisten sind erst seit Kurzem dahinter gekommen. Der schönsten Texte einige hat sich auch Zöllner gewählt. Den Preis als Composition zollen wir vor Allem dem »O weh des Scheidens«; hier ist die Einfachheit zugleich Tiefe, das Gedicht leibhaftige Musik geworden; es ist ein schönes Lied und würde einem Beethoven nicht zur Unehre gereichen. Nach diesem fesselt uns das »Wenn die Rosen aufgeblüht« durch inniges Verständniß des Gedichtes, das nicht leicht zu componiren war. Die erste Hälfte, die recitativische Wendung, scheint uns ausgezeichnet, der Schluß nur erinnert an Weber. Vortrefflich aufgefaßt, im altdeutsch poetischen Tone, ist auch das Duett »Seligster Wunsch« und namentlich der Schluß von rührender Innigkeit. Das »Mein Sehnen, mein Ahnen« ist aus dem Herzen gesungen, ähnelt aber in etwas einer Marschner'schen Arie aus Hans Heiling, wie denn Beethoven, Weber und Marschner unverkennbare Vorbilder des Componisten sein mögen. Im Liede »Warum willst du andere fragen« gefällt uns entschieden die zweite Hälfte bis auf den tremulirenden Schluß, für den wir lieber einfach aushaltende Accorde gesetzt wünschten. Nr. 6 hat einen innigen Grundton, der sich aber in der Mitte des Liedes etwas trübt durch einige mühsame Modulationen; auch der zweite Tact, obwohl melodisch gut gesungen, auf dem Worte »Busen« gefällt uns nicht; er scheint uns für die Braut, die Rückert meint, nicht jungfräulich, nicht keusch genug. Von den zwei Volksliedern sagt uns das erste zu; es will gut gesungen und gesprochen sein. Das andere ist das am wenigsten bedeutende des Heftes, welches wir denn nach treuester Ueberzeugung Allen empfehlen, die mehr als singen, die auch denken und sprechen wollen, zur nachhaltigen Freude ihrer wie Anderer. –
*
Henry Hugh Pearson, sechs Lieder von Robert Burns für eine Singstimme mit Pianoforte.
Werk 7.
Ein eigenthümlicher Geist weht uns aus diesen Gesängen, nicht der eines Meisters, aber der einer interessanten ausländischen Persönlichkeit. Die Lieder leiden fast sämmtlich noch an einer gewissen Ueberfülle, wie sie theils Unsicherheit im Technischen, theils die Absicht, Alles gleich möglichst gut machen zu wollen, in jungen Componisten oft erzeugen. Beides, hoffen wir, wird sich mit dem reiferen Alter durch Uebung und Selbsterkenntniß mildern. Um es kurz zu sagen, es scheint uns zu viel Aufwand gerade an diese Texte verschwendet; es sind zu viel Noten zu den einfachen Worten. Das Lob des Fleißes soll damit dem jungen Künstler in keiner Weise vorenthalten sein; gerade die warme, liebevolle Behandlung, die aus den einzelnen Liedern spricht, nimmt uns für ihn ein; aber er that zu viel und fehlte ästhetisch, während er freilich überall das Beste wollte. Die Burns'schen Gedichte lehnen vornherein, zum größten Theile wenigstens, jene breitere Form der Behandlung ab, wie sie in der Composition ersichtlich ist; es sind wohl Ergüsse einer wahrhaften Dichterstimmung, aber immer schlicht, kurz und bündig; darum lieben ihn die Componisten auch so sehr, darum fügen sich seine Worte wie von selbst zum Liede, und am natürlichsten in jene Form, wie sie dem wirklichen Volksliede eigen ist. Der Componist wollte aber mehr als dieses; er gibt meistens große ausgeführte Stücke, die wohl einen strebsamen Musiker verrathen, mit der naiven Form der Gedichte aber im Widerspruche stehen; oft hat seine Musik sogar einen dramatischen oder theatralischen Anstrich, und hier scheint er am weitesten vom Ziele Zu sein. Halten wir also die Auffassung der Gedichte für zum Theil verfehlt, und namentlich das erste, dritte und fünfte Lied für viel zu anspruchsvoll und schwerfällig, so müssen wir doch auch in diesen manches Eigentümliche anerkennen und vor allem ein charakteristisches Etwas, eine kräftige edelmännische Gesinnung, wie wir sie an so vielen seiner Landsleute zu finden gewohnt sind. Dies läßt sich nicht mit Worten nachweisen; dies muß Jedem sympathisch aus seiner Musik entgegen wehen. Jedem kräftigeren männlichen Ausdruck, wenn er freilich wie hier auch noch nicht ganz gebildet erscheint, müssen wir aber das Wort reden in der musikalischen Gegenwart, die sich so überwiegend und gerade in ihren beliebteren Meistern zum Entgegengesetzten neigt, als ob nicht noch vor Kurzem ein Beethoven gelebt, der es sogar in Worten ausgesprochen: »dem Mann muß Musik Feuer aus dem Geist schlagen; Rührung paßt nur für Frauenzimmer«. Daran aber denken die Wenigsten und sinnen gerade auf stärkste Rührung. Man sollte sie zur Strafe sämmtlich in Weiberkleider stecken. Also Schluchzen und Weinen ist die Sache unsers Engländers nicht; er gibt markigere Melodieen, als man sie gemeinhin in deutschen Liederheften findet, und dies macht ihn uns werth. Sollten wir einzelne der Lieder hervorheben, die uns am meisten zugesagt, so sind es »John Anderson« und das »Soldatenlied«; jenes ist ganz von dem wehmüthigen Tone durchdrungen, der das Gedicht in so hohem Grade beseelt, und hat trotzdem charakteristische Kraft; im »Soldatenlied« umspielt uns ein Anklang an das Marlboroughlied mit eignem romantischen Reiz, daß wir uns in die schottischen Hochlande versetzt fühlen. Die Lieder sind wohl ursprünglich auf das Englische componirt; doch stehen auch deutsche Worte dabei. –
*
Alexander Fesca,
Zweites großes Trio. Werk 12. – Drittes großes Trio. Werk 23.
Leider liegen uns von diesen, wie den meisten später zu besprechenden Trio's, keine Partituren vor; auf Infallibilität des Urtheils machen die folgenden Zeilen daher keinen Anspruch, und mögen mehr als ein Hinweis auf die neuen Erscheinungen im Gebiete der Triocomposition, denn als kritisches Spiegelbild gelten. Ueberdies sind die einzelnen Verfasser bekannt genug, so daß Jedermann weiß, was er ungefähr von ihnen zu erwarten hat, was nicht.
Das erste Trio des obengenannten jungen Componisten besprach die Zeitschrift schon vor längerer Zeit und sagte dort: »es habe eine Schmetterlingsnatur, wo nicht der ganze Componist selbst«. Dieser Ausspruch, gut wie schlimm zu deuten, findet auch auf seine zwei spätern Trio's Anwendung. Wie jenes, zeichnet offenbar auch diese ein rasches, flüchtiges Wesen aus, wie es uns wohl auf Augenblicke gefallen kann. Ein ganzes Künstlerleben aber schmetterlingsartig durchzubringen, scheint uns dieses denn doch zu kurz. Wir wissen nicht, ob Hr. Fesca dies im Sinne hat; aber die Anlage geht ihm dazu nicht ab. Er hüte sich also. Die giftigen Blumen sind hier der Beifall des gewöhnlichen Haufens, gewisse Blicke sentimentaler Frauen. Der wahre Künstler gedeiht aber nur anderswie, – in der Einsamkeit oder im Umgange mit Künstlern, und nichts entnervt mehr, als der Beifall Mittelmäßiger. Tiefe kann sich freilich Niemand geben; aber lernen und streben soll man immer. Wir wissen in der That an beiden Trio's nichts auszusetzen, als die mittelmäßige Stufe, die sie überhaupt einnehmen; auf dieser leistet der Componist gewissermaßen schon Vollkommenes, die Form wird ihm leicht, es fehlt ihm nicht an hübschen Melodieen, er schreibt dankbar für den Spieler; eine gewisse jugendliche Offenheit steht ihm ganz besonders an. Aber die Form ist auch bequem und gewöhnlich, den Melodieen fehlt es an mannichfaltigem Ausdruck, und vergebens würde man in beiden Werken nach eigenthümlicherem, höherem Aufflug, ja nur nach dem Willen dazu suchen. Mit einem Worte, der Componist scheint mit seinem Talent, mit dem, was er bis jetzt gelernt, zufrieden, und glaubt damit für sein Leben auszukommen, was wir mehr wünschen als glauben möchten. Doch fürchten wir auch nicht zu viel! Hat doch jedes Künstlerleben seine Ferienzeiten, wo es sich bequem schaukeln möchte auf der Gegenwart; die ihn dann zu neuer Arbeit ruft, die Stimme wird nicht ausbleiben. Der Deutsche hat so große Vorbilder hoher Männlichkeit; an diese blicke der Jünger zuweilen hinauf, wie an Bach, der alle seine vor dem dreißigsten Jahre geschriebenen Werke als für nicht existirend erklärte, an Beethoven, der noch in seinen letzten Jahren einen »Christus am Oelberg« nicht verwinden konnte. Wird es euch, junge Künstler, da manchmal nicht bange, was nach etwa 50 Jahren ihr über eure Compositionen beschließen werdet? Aber freilich, was Könige wegwerfen, das verschlingen die Krämer noch gierig genug. Gewiß, ihr verbrennt keines eurer unsterblichen Werke, und so erfreut euch denn eures kurzen Lebens, aber scheltet die Zukunft auch nicht, wenn sie vergessen hat. Ein Totalurtheil über die neuern Werke des Hrn. Fesca liegt in dem Vorigen eingeschlossen; im Detail mögen sie gewiß noch Manches enthalten, was eines besonderen Lobes werth wäre, das uns wegen Mangels einer Partitur entgangen. In der Auffassung des ganzen Künstlercharakters glauben wir aber nicht fehlgeurtheilt zu haben, und so wollen wir uns und Andere in der Zukunft, die Alles klar macht, wieder an diese Zeilen einmal erinnern.
*
W. Neuling, großes Trio etc.
Werk 75.
Die Werkzahl läßt schließen, daß wir es hier mit einem geschickten Musiker zu thun haben. So scheint es auch nach der Clavierstimme und theilweisen Vergleichung der anderen Stimmen mit dieser, was uns den Mangel einer Partitur ersetzen mußte. Der Componist ist überdies einer der Capellmeister am Kärnthnerthortheater in Wien, der sich noch jüngst durch eine Oper bekannt gemacht. Wir haben es mithin in keinem Fall mit einem Novizen zu thun. Irren wir nicht, so wurde ihm bei Aufführung seiner Oper zum Hauptvorwurf gemacht sein Schwanken zwischen deutscher und italienischer Schule, so daß keine der Parteien, wie sie in Wien auf das Schroffste sich gegenüber stehen, sich mit dem Werke befriedigt erklärte. Hundert anderen Wiener Componisten ist schon das Nämliche mit dem nämlichen Erfolge gesagt worden; sie wollen das Eine und können das Andere nicht lassen, wollen Künstler sein und auch dem Plebs gefallen. Das hundertfältige Mißlingen solcher Bestrebungen, hat es ihnen noch nicht die Augen geöffnet, daß auf diesem Wege nichts zu erreichen ist, daß nur einer zum Ziele führt, der: nur seine Pflicht gegen sich als Künstler und die Kunst zu erfüllen? – Wir knüpfen diesen Vorwurf an dieses Trio, das, obgleich vielleicht im schwächern Grade als jene Oper, eine ähnliche Tendenz, wie sie in jener Ansicht ausgesprochen, zu verfolgen scheint. Wie gesagt, wir glauben, daß das deutsche Künstlerelement in dem Componisten zur Zeit noch überwiege; aber der entschiedene Fortschritt beginnt erst mit dem entschiedenen Aufgeben alles dilettantischen Behagens, aller italienischen Einflüsse. Haben wir Deutsche denn keine eigenthümliche Gesangweise etwa? Hat nicht die jüngste Zeit gelehrt, wie es in Deutschland noch Geister und Meister gibt, die der Gründlichkeit die Leichtigkeit, der Bedeutung die Grazie beizugesellen wissen? Spohr, Mendelssohn und Andere, sie wüßten nicht auch zu singen, nicht auch für den Sänger zu schreiben? Dies ist's, worauf wir die deutsch-italienische Zwitterschule aufmerksam machen möchten, wie sie namentlich in Wien ihre Anhänger hat. Es geht nicht: die höchsten Spitzen italienischer Kunst reichen noch nicht bis an die ersten Anfänge wahrhafter deutscher; man kann nicht mit dem einen Fuß auf einer Alpe und mit dem andern auf bequemem Wiesengrunde stehen. Daß in dem Componisten, von dem wir sprechen, ein edlerer Trieb vorwalte, zeigt schon die Gattung, für die er schrieb. Im Kammerstyl, in den vier Wänden, mit wenigen Instrumenten zeigt sich der Musiker am ersten. In der Oper, auf der Bühne, wie Vieles wird da von der glänzenden Außenseite zugedeckt! Aber Auge gegen Auge, da sieht man die Fetzen alle, die die Blößen verbergen sollen. Freudig erkennen wir es denn an, daß uns auch aus der Kaiserstadt wiedereinmal ein Werk kömmt, das wenigstens einer gediegenen Kunstform zufällt, mit Bedauern sagen wir's, aus derselben Stadt, der vordem geweihten, die »manch ein guter Geist betrat«, derselben, die uns gerade unsere Meistertrio's, die Beethoven'schen und Schubert'schen brachte. Früher hieß der Wiener Hofcomponist W. A. Mozart, jetzt ist es Gaetano Donizetti geworden, und mit einem Gehalte, der seinem innern schwerlich entspricht. Das ist in wenig Worten die Geschichte Wiens von sonst und jetzt. Scheint denn leider in jener Residenz für einige Augenblicke der Italianismus gesiegt zu haben, so wollen wir guten deutschen Philister, die noch auf Bach und Andere etwas halten, dennoch so lange wie möglich Stand halten, und wenigstens in der Stube so viel gute Musik machen, als wir sie im Theater nicht zu hören bekommen. In diesem Sinne sei denn auch das Trio begrüßt, und klimme der Componist, wie jeder, der es kann, aus schöner Kunstleiter weiter, die zu vielleicht bescheideneren, aber dauerhafteren Triumphen führt, während das morsche, mit Allerhand-Kränzen behangene Gerüst italienischer Marktschreierei doch über kurz und lang einmal wieder zusammenstürzt. –
*
H. Marschner, großes Trio etc.
Werk 111.
Es ist dies Trio das erste größere Kammermusikstück von Marschner, das wir kennen lernen. Und wie es an einem älteren Künstler immer erfreut, wenn er sich in neuen Gattungen versucht, gleichsam zum Selbstgeständniß, daß er sich selbst noch nicht am Ziele glaube, daß er noch ein warmes Streben in sich bewahre, so waren auch wir über die Erscheinung erfreut, deren genauere Bekanntschaft unser günstiges Vorurtheil auch nichts weniger als abschwächte. Zwar wir sind nicht blind gegen die einzelnen Mängel auch dieses Werkes, gegen jene schwächeren Partieen der Composition namentlich in den zweiten Thema's und in der sogenannten Verarbeitung, wo der Componist zu rasch verfahren, zu schnell mit dem zuerst Gefundenen sich begnügt; dagegen thut aber die Marschner'n immer eigenthümliche Frische wohl, die forteilende Bewegung des Ganzen, die sichere Hand, mit der er die einzelnen Sätze charakteristisch hinzustellen weiß. Man findet somit in dem Trio ungefähr denselben Künstler wieder, als man ihn aus seinen großen dramatischen Arbeiten kennt. Das Einzelne, das Detail ist nicht immer das Vorzügliche; das Ganze aber ist es, die Totalwirkung, die den Mangel kunstreicher gediegener Detailarbeit wenn nicht vergessen, so doch übersehen läßt. Wenn wir unter Vorzügen der Detailarbeit jene Selbstständigkeit und lebendige Fortbewegung der einzelnen Stimmen, jene bedeutungsvollere Behandlung auch der Uebergangsstellen (so z. B. wenn sich der Satz aus der Moll- in die Durtonart wendet), jene feineren Bezüge zwischen dem Hauptthema und der Verarbeitung der anderen Motiven meinen, wie wir es z. B. in Beethoven'schen Compositionen, die Totalwirkung keineswegs beeinträchtigend, wiederfinden, so werden uns einsichtsvolle Leser verstehen. Bei Marschner dominirt meistens die Oberstimme; zu tieferen Combinationen zu gelangen, ist es als gönne er sich die Zeit nicht; es reißt ihn unwiderstehlich nur nach Ende, nach der Vollendung des Stückes hin. Aehnlich dem wirken auch seine Compositionen; man fühlt sich fortgerissen, geblendet; große Talentzüge blitzen uns überall entgegen; bei genauerer Untersuchung stellen sich aber auch die oberflächlicher behandelten Seiten der Composition heraus. In einem Bilde zu sprechen, er gibt uns die goldenen Früchte seines Talentes in oft irdenen Schalen. Seien wir denn vor allem dankbar gegen jene, gegen die Lichtseiten des Trio's. Wie gesagt, es bildet – bis auf das Adagio, das uns nicht zu gleicher Zeit mit den andern Sätzen entstanden zu sein scheint – ein lebendiges, wirkungsvolles Ganzes. Die Tonart ist im Anfang- und Schlußsatz, wie im Scherzo G moll, die des Adagio das in dieser Folge befremdende As dur. Jene Sätze haben sämmtlich einen wilden, leidenschaftlichen Charakter, während das Adagio den ganz entgegengesetzten der Mildheit und Ruhe trägt. Der Umstand, daß das Adagio im letzten Satze wieder zum Vorschein kommt, könnte unsere Vermuthung, daß es zu anderer, früherer oder späterer Zeit als die andern Sätze geschrieben sei, etwas schwankend machen. Doch weiß man, wie einem gewandten Componisten solche Rückblicke oft mit leichter Mühe auch nach Abschluß eines Satzes noch gelingen. Im Uebrigen geschieht jener Rückblick in sehr zarter Weise und thut gerade im unruhigen Treiben des letzten Satzes wohl. Das Adagio selbst hat eine reizende, Marschner'n ganz eigenthümliche Gesangweise; wir halten es für das Ursprünglichste im ganzen Trio. Das Violoncellsolo, das sie beantwortet, ergeht sich dagegen zu breit unserer Meinung nach und scheint, uns auch in melodischem Bezug zu gewöhnlich, fast theatermäßig. Wo sich Marschner schon oft mit Glück bewegt, in der Sphäre des Spuk- und Mährchenhaften, thut er es auch im Trio mit Wirkung, im ersten Satze weniger, im Scherzo und Finale aber mit offener Lust an seinen Gebilden; diese letzteren Sätze sind auch die humoristischsten. Einige leichte Anklänge an das Franz Schubert'sche Trio in Es dur erwähnen wir flüchtig.
Das Trio wird sich, glauben wir, verbreiten; wir sind nicht überreich an geistvollen Werken der Art, und dies letztere Prädicat gebührt dem Trio in jedem Fall. In der Ausführung bietet es keine ungewöhnlichen Schwierigkeiten, namentlich ist das Clavier wirksam behandelt.
*
Louis Spohr, Trio etc.
Werk 119.
Auch das Trio dieses verehrten Meisters ist, so viel wir wissen, seine erste derartige Composition. Dieselbe freudige Bemerkung, die wir schon beim Eingang der Anzeige des Marschner'schen Trio's aussprachen, müßten wir also bei diesem wiederholen. Und das unterscheidet eben die Meister der deutschen Schule von Italienern und Franzosen, das hat sie groß gemacht und durchgebildet, daß sie sich in allen Formen und Gattungen versuchten, während die Meister jener andern Nationen sich meistens nur in einer Gattung hervorthaten. Wenn wir daher einige der beliebten Pariser Operncomponisten hier und da z. B. »große Künstler« genannt finden, so möchten wir erst fragen: wo sind denn eure Symphonieen, eure Quartette, eure Psalmen etc.? wie könnt ihr euch mit deutschen Meistern vergleichen wollen? So hat auch Spohr fast in allen musikalischen Formen gearbeitet vom Oratorium bis zum Lied, von der Symphonie bis zum Rondo für ein Instrument, und diese Vielseitigkeit ist nicht das Geringste, was ihn uns verehrungswürdig macht. Seine neue Gabe müssen wir denn als eine neue Blüthe seines reichen Geistes begrüßen, die im Kranze seiner Schöpfungen sich gar wohl mitblicken lassen darf. Zwar Duft und Farbe sind dieselben, die wir schon kennen. Aber es scheint eine unerschöpfliche Gemüthstiefe gerade in diesem Künstler zu liegen, daß er uns immer zu fesseln versteht, so sehr er sich auch gleichbleibt. Gewiß, Spohr könnte alles ohne seinen Namen herausgeben, man würde ihn auf den Augenblick erkennen. Von keinem Künstler der Gegenwart ist das in demselben Maaße zu behaupten. Aus etwas Anderes noch gründet sich aber das Interesse, das wir immer für seine Schöpfungen hegen müssen, nicht allein auf den Zauber seiner Eigenthümlichkeit, sondern auf seine reiche Kunstbildung, auf die rein musikalischen Schönheiten im Gegensatz zu den charakteristischen seiner Individualität. Denn es kann uns aus einer Musik ein bedeutender Charakter entgegentreten und ihr doch viel zur Meisterhaftigkeit fehlen. Spohr gibt uns Alles in meisterhafter Form, und selbst Gekanntes in gewählter Gewandung. Er wird nicht müde, seinem Werke die größte Vollendung zu geben. Man sehe z. B., wie er das erste Thema des ersten Satzes seines Trio's, so oft es wiederkommt, neu harmonisirt. Ein bequemer Künstler hätte es ohne Mühe einmal wie das andremal gemacht. Von seinem gewissenhaften Fleiß, der sich mit dem vorrückenden Alter des Künstlers eher gesteigert als vermindert zu haben scheint, haben Manche gar keine Vorstellung; es rächt sich aber auch genug an ihren Werken. Doch was bemühen wir uns, Spohr's große Künstlertugenden auseinandersetzen zu wollen, worüber die Welt schon längst einig ist. Auch das Trio ziert seinen Meister; es ist aus einem Guß von Anfang bis Ende, und nur das Adagio nach unserer Meinung etwas matter. Die anderen Sätze haben die eigenthümlichsten Vorzüge; der erste ist ein feines Gewebe, von sicherer Hand kunstreich ausgeführt. Das Scherzo gehört zu Spohr's vorzüglichsten, die er geschrieben; man verlangt es wieder und wieder zu hören. Der letzte Satz har ein durch Spohr selbst etwas allgemein gewordenes Motiv, im Ganzen herrscht aber ein außerordentlicher Schwung, das Violoncell-Pizzicato nicht zu vergessen und die schön eingewebte Melodie aus dem Adagio. Welchen Charakter das Trio im Uebrigen athme, wir brauchen's wohl nicht auszusprechen. Spohr im ersten, Spohr im zweiten Satz, und überall. Paßt auf irgend Jemanden Schiller's: »doch Schöneres kenn' ich nicht, so lang ich wähle« etc., so ist es auf ihn. Mög' er noch lange unter uns wirken!
*
I.
Adele de Foix, große Oper in vier Acten von R. Blum, in Musik gesetzt von C. G. Reißiger. Vollständiger Clavierauszug.
Das Sujet behandelt eine Liebesgeschichte Franz des Ersten von Frankreich, der sich, im Grunde auf wenig königliche Weise, in Besitz von Adèle de Foix, der jungen Frau eines bejahrten Edelmanns, des Grafen Chateaubriand, zu bringen versucht. Die Handlung des Königs wird noch dadurch unschöner, daß der besagte Edelmann ihm früher einmal das Leben gerettet. Zum Schluß ersticht Chateaubriand seine untreue Frau und auch sich; der König zieht frei ab, seinem Volke Reue und Besserung angelobend. So endigt das Abenteuer wenig erbaulich, wie Jemand sagte, als Scherz zu ernsthaft, als Ernst zu scherzhaft. Daß dies auf die Composition zurückwirken mußte, war natürlich. Solche verruchte Liebeleien allenfalls zu beschönigen, verstehen nur die Franzosen. Der Deutsche ist dazu viel zu ehrlich und zu moralisch. Aber was überwindet eben ein deutscher Componist nicht Alles, hat er nur einen leidlich componiblen Text, von dem er sich auch einige Wirkung auf das Publicum verspricht. Wir wünschen nicht, daß sich Herr Reißiger getäuscht haben möge: aber der Text wird schwerlich bei uns Anklang finden. Was die Musik betrifft, so darf Jeder, der den Componisten bereits kennt, davon im Voraus viel Gutes erwarten. Als gewandter Instrumentator hat er sich längst bekannt gemacht; an der Spitze eines vorzüglichen Orchesters stehend, hatte er mehr als mancher Andere Gelegenheit zur Beobachtung und Combination. Das Element, in dem er sich zeither am liebsten bewegte, war das Lied, und am glücklichsten im heiter lyrischen. Viel Gelungenes in dieser Art verdanken wir ihm. Auch als Kirchencomponist hat sich Reißiger mit Glück gezeigt; seine derartigen Compositionen athmen einen freundlichen frommen Sinn, der seines Eindruckes gewiß sein kann. Weniger glücklich war er bis jetzt als dramatischer Componist; wir finden den Grund davon im durchaus Vorwiegenden seiner lyrischen Natur, wie es auch anderwärts schon mehrfach ausgesprochen. Daß er dennoch nicht von der Oper läßt, daß er wieder mit einer sogenannten großen vortritt, wollen wir als ein Zeichen inneren Muthes begrüßen, der überall mehr zuwege bringt, als träges Stehenbleiben auf einem Fleck. Adèle de Foix wurde gegeben, mit Beifall, auch nicht ohne einzelnen Widerspruch. Wir sind so arm an einer deutschen Oper; man sollte nicht gleich über alle, die nicht auf das erstemal wie etwa der Freischütz wirken, so boshaft herfallen oder sie gar ignoriren. Verschweigen wir aber auch deshalb den Tadel nicht.
Die deutschen Componisten scheitern meistens an der Absicht, dem Publicum gefallen zu wollen. Gebe aber nur einmal einer etwas Eigenes, Einfaches, Tiefinnerliches ganz aus sich heraus, und er soll sehen, ob er nicht mehr erlangt. Wer dem Publicum immer mit ausgebreiteten Armen entgegenkommt, den gewöhnt es sich endlich über die Achsel anzusehen. Beethoven ging mit gesenktem Kopf und untergeschlagenen Armen einher, da wich der Plebs scheu auseinander, und nach und nach wurde ihm auch seine ungewöhnliche Sprache vertrauter.
An obiger Klippe, fürchten wir, ist auch Reißiger theilweise gescheitert. Der ungeheure Succeß des »Freischütz«, scheint es, hat die deutschen Componisten zu Anforderungen an Beifallsbezeugungen verleitet, die nun einmal nicht durch Absicht herausgefordert werden können. Muß denn Alles gleich Furore machen sollen? Gehören denn zu Allem Posaunen und Pickelflöten? Sie schimpfen auf die italienischen Componisten und scheuen sich doch nicht, oft mit denselben Mitteln zu wirken; man kennt den Unsinn und begeht ihn doch. Wo soll denn da die Achtung des Publicums herkommen, das auch seine Meriten hat und oft heller sieht, als man glauben sollte! Noch einmal: gebt nur einmal eine recht originelle, einfach tiefe, deutsche Oper, schreibt, als gäb' es kein Publicum, aber zeigt den echten Künstler, die echte Bildung, und wir wollen sehen, ob ihr euch dabei nicht besser steht. Vielmal ist das schon gesagt worden, aber nie war es nöthiger als jetzt, wo der Glaube des Publicums an deutsche Operncomponisten immer tiefer und tiefer zu sinken anfängt. Schon sehen wir italienische Truppen sich mehrer deutschen Bühnen bemächtigen; französische könnten leicht nachfolgen. Also Acht gegeben, daß man euch nicht euren eigenen Boden unter den Füßen wegzieht.
Gewiß, wir finden z. B. in Reißiger's neuester Oper Stücke, die in neu-italienischen oder französischen wie echte Edelsteine unter böhmischen sich ausnehmen würden. Aber mit einzelnen Nummern ist noch nichts gethan; wir wollen Styl im Ganzen, eine durchgehends edle Auffassung, ein immer frisch schlagendes Künstlerherz. Daß uns solchen Genuß die Reißiger'sche Oper durchgängig bietet, können wir leider nicht behaupten. Gibt er uns viel Würdiges, so huldigt er auch dem Tagesgeschmack; wir vermissen eben im Allgemeinen Charakter und Einheit des Styls. Bemerkenswerth ist auch, wie Reißiger, der z. B. in vielen seiner Lieder ein eigenthümliches Talent gezeigt, in seinen dramatischen Arbeiten weit weniger originell dasteht, ja so starke Anklänge an bekannte deutsche und italienische Meister bringt, daß es auch der Laie merken muß. So finden sich bedeutende Reminiscenzen aus Weber, Spohr, auch Marschner, häufig auch aus Rossini und Bellini, die einzeln aufzuzeichnen zu viel Raum wegnehmen würde, die aber gewiß Niemandem entgehen können. Einen andern Vorwurf könnten wir noch erheben gegen die unseres Bedünkens durchweg zu massenhafte Instrumentation. Wo soll der Componist die Mittel zur Steigerung herbekommen, wenn er an minder bedeutende Stellen schon alle Kräfte verschwendet, die ihm dann am rechten Orte fehlen? Andererseits ist freilich Reißiger's große Virtuosität der Instrumentation sehr auszuzeichnen und wir müssen sie wohlklingend und glänzend nennen, wo er die Orchestermassen nicht zu sehr aufeinander häuft. Abgesehen aber von diesem zweifachen Vorwurf öfterer Reminiscenzen und öfterer überladener Instrumentirung, finden wir in der Oper so viele Vorzüge, zu denen wir uns jetzt mit Vergnügen wenden.
Es herrscht in der Oper ein ausgezeichneter musikalischer Fluß, wie er eben nur dem Künstler vom Fach eigen ist. Sehr anzuerkennen ist auch die Reinheit der Harmonie, wenige grelle Accordenfolgen in einigen leidenschaftlichen Momenten ausgenommen. Sodann wir im Ganzen Wahrheit des Ausdrucks in Uebereinstimmung der Worte zur Musik zugestehen Zwei Stellen nur nicht richtiger Auffassung wollen wir hier anführen, in der Arie des Grafen S. 83 bei den Worten: »Da erfaßte meine Seele, die bewegt war, bang und wild, dein geliebtes Bild«, wo der Componist nur das bang und wild in der Musik schildert, den Nachsatz aber übersah; dann S. 96, wo beim Eintreten des Königs Adèle sagt: »nun bin ich frei, der König rettet mich«, die der Componist con tutta forza singen läßt, während sie unserer Meinung nach ganz leise für sich gesprochen werden müßten., von der wir in der neu-italienischen Opernmusik kaum die Spur antreffen. Endlich durchzieht die ganze Oper ein natürlich freundlicher Sinn, der wohlthut auf der Bühne, die uns so sehr an Mord und Todtschlag gewöhnt. Vornehme Kunstthuerei, namentlich contrapunktische, will sich nirgends geltend machen; sie wär' auch am üblen Ort angebracht. Musikalisch am charakteristischsten gehalten finden wir, außer dem König und Adèle de Foix, den Graf Chateaubriand, wenn auch das Interesse für ihn allein dem Mitleid eines hintergangenen Ehemannes gilt, der überdies schon über die Jugendjahre hinaus. Bonnivet, der Teufel im Stück, zeigt sich vielleicht zu sanft, nicht teuflisch genug. Dem Pagen fehlt es etwas an Grazie, dem Narren nicht minder an schlagender Komik. Der letztere wird von dem bekannten Marschner'schen im Templer bei Weitem überholt.
Die Chöre greifen oft wirksam ein; Popularität dürfen wir indessen keinem versprechen.
Besonders auszuzeichnen ist die Balletmusik; hier zeigt sich Reißiger's ganzes liebenswürdiges Talent. Namentlich hebt sich Lipinski's Solo mit dem später dazukommenden Hoboetriller hervor.
Die Declamation finden wir im Ganzen lobenswerth und richtig; einige Verstöße wären mit leichter Mühe abzuändern. Einen Hauptmoment finden wir zu leicht behandelt, den im letzten Act, wo Chateaubriand zum König sagt: »die Schuld, sie ist dein«. Hier, wo die Scheidewand zwischen Fürst und Unterthan zum erstenmal und auf ewig fällt, wo der Gemißhandelte die Größe des Unglücks dem Verführer recht ordentlich vor Augen stellen will, hier wirkt der recitativische Vortrag zu wenig. Der Componist hat sich diesen bedeutenden Moment entgehen lassen.
Der, beiläufig gesagt, sehr sorgfältige Clavierauszug zeigt einige Abweichungen von der Aufführung in Dresden; namentlich ist, was in jenem dritter und vierter Act ist, in einen einzigen, und gewiß zum Vortheil der Wirkung zusammengezogen worden.
Höchst undankbar finden wir den Schluß; das Ganze stiebt so unglücklich auseinander, daß der Zuhörer nur mitleidsvoll den Kopf schütteln kann, wie über eine Begebenheit, die freilich nicht anders enden konnte.
Wir scheiden von ihm, nicht ohne Tadel des einzelnen Mißlungenen, mit aller Achtung aber vor dem Fleiß, dem Talent und den Kenntnissen, die der Componist wiederum gezeigt, und in der Hoffnung, daß er sie bald wieder auf gleichem Terrain bethätigen möge.
*
II.
Heinrich Esser, Thomas Riquiqui oder die politische Heirath, komische Oper in drei Acten.
Werk 10.
Nach den Berichten, die wir über diese Oper vor und nach ihrer Aufführung gelesen, mußten wir etwas ganz Vorzügliches von ihr erwarten. In einem hieß es u. A.: Manche sähen in dem jungen Componisten einen zweiten Adam, Andere einen Boieldieu, Exaltirtere sogar einen neuen Mozart und Beethoven entstehen. Zwischen Adam und Beethoven liegt freilich viel in der Mitte, und ist der Componist klar mit sich, so wird er selbst zugestehen, daß er einen Vergleich mit ersterem allerdings eher aushalten würde, als mit dem letzteren. Doch dürfen wir den Componisten nicht entgelten lassen, was persönliche Theilnahme vielleicht an ihm überschätzt; sein Werk hat einen zu bestimmten Eindruck auf uns gemacht, als daß uns dies, wie die entgegengesetzt kalte Aufnahme, die die Oper in Mannheim erfahren, in unserem Urtheile beirren könnte. Doch ehe wir über die Musik sprechen, erst Einiges noch über den Text. Da müssen wir denn vor allem bekennen, daß wir nur wenig Komisches an ihm finden. Wenn Riquiqui, die Hauptperson der Oper, ein gutmüthiger Schuhmacher, um die Tochter seiner Wohlthäterin aus den Händen wüthender Sanscülotten zu befreien, mit dieser eine Scheinheirath eingeht, sie aber nach Beendigung der (französischen) Revolution frei und ihrem früheren Verlobten zurückgibt, so ist das brav und edelherzig, aber gewiß nicht komisch, und um jene Scheinheirath dreht sich doch das ganze Stück, das uns in vielen Beziehungen eher wie ein in eine niedere Sphäre gezogener »Wasserträger« verkommt, den doch gewiß Niemand zu den komischen Opern zählen wird. Die einzige lustige Figur ist die des Barnabè; aber sie ist viel zu unbedeutend, um das Beiwort »komisch« für das Ganze zu rechtfertigen. So wünschten wir vor Allem aus dem Titel jenen Beisatz heraus, weil sonst Jedermann etwas Anderes erwartet, als er empfängt. Uebrigens ist der Text geschickt behandelt, namentlich auch der Dialog gewandt und lebendig geschrieben, wie denn die Prosa dem Verfasser geläufiger scheint, als der Vers.
Vom Charakter der Musik einen Begriff zu geben, so können wir sie im Allgemeinen als gesund und natürlich bezeichnen. Offenbar schwebt Mozart dem jungen Tonsetzer als Ideal der Muse vor; in der Leichtigkeit und Anmuth der Formen verräth es sich namentlich, daß jener Meister in's Blut und Leben des jüngern Künstlers übergegangen. Aber auch der französischen Schule scheint er nicht unvertraut, und wir bemerken dies gern, wo er an Boieldieu, weniger gern, wo er an Adam erinnert. So könnte speciell das Motiv, das die Grundidee der Oper trägt: »Arbeit, Frohsinn, leichtes Blut sind des Daseins höchstes Gut«, vom Componisten des Postillons sein, – wir gestehen, es etwas trivial gefunden zu haben. Es haben also jene verschieden lautenden Berichte alle in etwas Recht, wenn sie von einem Einfluß Mozart's, Boieldieu's und Adam's auf die Bildung des Componisten sprechen; Beethoven'sches nur vermochten wir nirgends zu entdecken, aber ebenso wenig italienische Gemeinplätze, was wir mit Vergnügen hinzusetzen.
Für die ausgezeichnetsten Stücke der Oper halten wir die Ensemble's, und wenn es wahr ist, daß sich gerade darin der Beruf des dramatischen Componisten zeigt, so müssen wir diesen Hrn. E. zusprechen. In der Partitur, auf der Scene nimmt sich gewiß Manches noch vortheilhafter aus; aber auch der Clavierauszug läßt das entschiedene Talent des Componisten in diesem Bezug ahnen. Dies ist nicht der schwerfällige Versuch des Schülers, sondern die spielende Hand natürlichen Geschickes.
Was das melodische Element der Oper betrifft, so hält es sich in der Mitte zwischen französischem und deutschem Charakter. Zur Offenbarung tieferer Melodieenkraft bot die Oper keine Gelegenheit. Gut sangbar ist fast das Meiste, nur der Tenor (Riquiqui) hält sich oft in den höchsten Lagen auf. Die Chöre sind durchgängig sehr leicht, in Betracht, daß wir Sanscülotten aus der ersten Zeit der französischen Revolution vor uns haben, fast etwas zahm zu nennen.
Vor allem aber ist die Correctheit und Sauberkeit des Satzes zu rühmen, wie sich das durch die ganze Oper hindurch zeigt. Daß sie auch vortrefflich, – klar, einfach und natürlich instrumentirt sein mag, läßt sich, ohne sie vom Orchester gehört zu haben, beinahe mit Bestimmtheit voraussagen.
Wir haben somit in jedem Falle eine freundliche Oper mehr, und es verdienen auch die Verleger Erwähnung, die das Werk eines jungen vaterländischen Talentes im stattlichsten Gewande der Oeffentlichkeit übergaben. Gedenken wir der großen Jugend des Componisten (er soll kaum 24 Jahre zählen), so dürfen wir auf seine Zukunft erfreuliche Hoffnungen setzen. Es wird auch Zeit, daß die deutschen Componisten den Vorwurf strafen, der ihnen seit lange gemacht wird, Italienern und Franzosen das Feld nicht auf das Tapferste überlassen zu haben. Da gäb' es ein Wort zu reden, auch an die deutschen Dichter!
*
Werk 82.
Wir freuen uns der Thätigkeit des geistvollen Mannes, von der uns obiges Werk wieder Zeugniß gibt. Sein neues Oratorium reiht sich, in seiner Tendenz, den früheren derartigen Compositionen Löwe's an; es ist, schon vom Dichter, nicht für die Kirche gedacht, und hält sich, für den Concertsaal passend oder auch bei musikfestlicher Gelegenheit wohl anzubringen, zwischen Oper und Oratorium. Wir haben noch kein gutes Wort für diese Mittelgattung; bei geistlicher Oper denkt man an etwas Anderes, und dramatisches Oratorium trifft den Sinn auch nicht. Von mancher Seite ist sogar gegen die ganze Kunstgattung angestritten worden. Sollen der Musik aber Charaktere, eben wie Huß, Guttenberg, wie Luther, Winkelried und andere Glaubens- und Freiheitshelden, gänzlich entzogen bleiben, weil sie weder ganz für die Oper, noch ganz für die Kirche passen? Mir scheint, Löwe hat ein Verdienst um die Gattung, die wenn auch noch kein Epochen-Werk geliefert hat, doch auch noch nicht zu Ende gedacht ist. Das rein biblische Oratorium kann darunter nicht im Geringsten leiden und wird auch immer seine Componisten finden. Aber wir wollen uns freuen, daß die Geschichte noch allerhand große Gestalten aufzuweisen hat, die sich die Musik nur anzueignen braucht, um nach einer neuen Seite hin zu wirken und sich auszusprechen. Von diesem Gedanken scheint auch Löwe auf das Innigste durchdrungen zu sein, da er nicht abläßt, den früher betretenen Weg zu verfolgen. Und hat er darauf noch keine glänzenden Triumphe errungen, so schrecke ihn das nicht ab; es braucht nicht Alles in der Welt gleich Furore zu machen und darf doch eines ehrenden Andenkens in der Kunstgeschichte gewiß sein. Das Verdienst, einen neuen Weg mit angebahnt zu haben, muß Löwe zugesprochen werden.
Hätte er's doch in der ersten Blüthe seiner Manneskraft gethan, oder in der Zeit, der wir seine frischen kräftigen Balladen verdanken! Aber freilich, der Bildungsgang eines Künstlers läßt sich wohl hinterher erklären, vorher aber schwer lenken und vorausbestimmen. Zu stark wirken auch Leben und Verhältnisse oft ein. Aus dem Operncomponisten Händel wird ein Oratoriencomponist; Haydn, der Instrumentalist, gibt uns im Greisenalter seine »Schöpfung«; Mozart mitten in seinen Operntriumphen sein »Requiem«. Mögen solche Erscheinungen auch im tieferen inneren Wesen der Künstler begründet sein, – Leben, Umgebung, Verhältnisse bringen sie oft erst zur Reife.
Löwe, um mich eines Bildes zu bedienen, ist frühzeitig auf ein einsames Eiland geworfen worden. Was draußen in der Welt vorgeht, kommt nur erzählungsweise zu seiner Kunde, wie umgekehrt die Welt nur selten von ihm hört. Zwar Löwe ist der König dieses Eilandes und baut es an und verschönert es, denn die Natur hat ihn mit dichterischen Kräften ausgerüstet. Größeren Einfluß aber auf den Gang der Weltbegebenheiten ausüben kann er nicht und will es vielleicht auch nicht.
So gehört denn Löwe beinahe zu den Verschollenen schon, trotz seiner regen fortgesetzten Productivität. Man singt wohl seine alten Balladen noch, und sein »Was ziehet und klinget die Straße herauf« ertönt noch aus der Kehle manches alten Burschen; aber seine späteren größeren Arbeiten sind kaum dem Namen nach bekannt geworden. Ungerechterweise, aber auch natürlicherweise. Und hier muß ich etwas aussprechen, was ich nur ungern thue, und möchte es mit dem Goethe'schen Wort einleiten: »Wer sich der Einsamkeit ergibt, ach der ist bald allein«. Zu lang anhaltende Abgeschiedenheit von der Welt schadet dem Künstler zuletzt; er fängt da oft an, sich in gewisse Formen und Manieren einzugewöhnen, bis er sich plötzlich bis zum Sonderling, zum Träumer festgefahren. So weit mag er sich noch ganz wohl befinden. Aber donnert ihm nun einmal eine öffentliche Stimme ein »Hab' Acht, Freund« entgegen, so verfällt er in Grübeln, in Zweifeln an sich, und der Pedanterie gesellt sich gar noch der Unmuth, die Hypochondrie zu, dieser schädlichste Feind des Schaffens.
Wir sind weit entfernt, Obiges in seinem ganzen Umfange auf Löwe anzuwenden; aber es ist Gefahr für ihn da. Wie sein »Huß« unzweifelhaft eine Menge Stellen aufzuweisen hat, die den noch frischen elastischen Geist ihres Schöpfers bezeugen, so doch andere wieder, an denen wir die schädlichen Einflüsse einer isolirten oder sich selbst isolirenden Stellung wahrnehmen zu können glauben. Es gibt eine Pedanterie der Einfachheit, die sich zur künstlerischen echten Naivetät verhält wie Manier zur Originalität. Dem Laien sagt jene gar oft auch zu; der Künstler aber will auch immer musikalisch interessirt sein, und diesen letzteren Ansprüchen genügt der »Huß« eben nicht immer. Vielleicht empfindet das der Componist selbst manchmal; denn er verfällt stellenweise in das andere Extrem und gibt z. B. im dritten Theile seines Werkes auf einmal eine höchst künstliche canonische Messe. Aber daß er zwischen allzu großer Einfachheit und Künstlichkeit die Mittellinie treffe, den eigentlichen Kunststyl, dies wünschten wir, daß es ihm gelänge. Freilich, das Letzte ist das Schwierigste und, großes Talent vorausgesetzt, das Ergebniß vieler Studien, Erfahrungen an sich und Anderen. Möchte unserm Tondichter sein Genius hold sein und ihn diesen Weg geleiten; aber auch jener wird es nicht allein vermögen, sondern unausgesetzter Fleiß, strenges Ueberwachen der Kräfte, eiserner Wille bis in die ältesten Jahre hinauf.
Wir gehen zur Begründung einzelner oben ausgesprochener Ansichten etwas näher auf das Oratorium ein, und müssen zuerst dem Dichter, gewiß auch im Sinne des Componisten, einen Dank spenden für seinen Text. Es ist einer, der auch ohne Musik sich des Lesens lohnte, seines Gedankengehaltes, der edlen echt deutschen Sprache, der natürlichen Anordnung des Ganzen halber. Wer an Einzelnem mäkelt, an einzelnen Worten Anstoß findet, der mag sich seine Texte bei den Göttern holen. Wir würden die Componisten glücklich schätzen, die immer solche Texte zu componiren hätten.
Die Geschichte der Handlung können wir als bekannt voraussetzen; Charakter und Haltung der Nebenpersonen wird aus dem Folgenden ersichtlich werden.
Das Oratorium beginnt mit einer Einleitung, die, musikalisch nicht außergewöhnlich interessant, doch den Prolog passend einleitet. Ein Prolog folgt, der Zeit und Bedeutung der Handlung in kurzen Worten feststellt. Der Componist läßt diesen zwar einfach, doch originell vom Chor allein vortragen. Im Nachspiel zu diesem Chor treffen wir schon auf eine Stelle, wie sich ähnliche im ganzen Oratorium und zu oft wiederholen; es sind sogenannte Sequenzen. Wir sprechen uns gleich hier darüber und dagegen aus, weil sie im Verlauf einzeln anzuführen zu vielen Platz rauben würde. Durch den folgenden kleinen Satz in A dur wird einem späteren Chor vorgegriffen. Wie er schon hier erscheint, hat er keinen rechten Sinn, auch keine Wirkung.
Nr. l ist ein Chor der Schüler und Studenten von Prag, die sich ihrer Studien freuen. Die Nummer ist leicht und charakteristisch, in der Form aber fast dilettantisch einfach. Es fehlt ihm, um künstlerisch zu heißen, Detail und feinere Gestaltung, auch eine Härte findet sich:

Nr. 2 tritt Hieronymus, ein Freund des Huß, auf und meldet, daß letzterer vor das Costnitzer Concilium geladen ist. Daß Löwe das Recitativ ausgezeichnet behandelt, ist aus seinen früheren Arbeiten bekannt. Dies Lob gilt für alle Recitative des Oratoriums.
Der darauf folgende Chor: »Huß, zieh' nicht fort« hat ein lebendiges Thema. Die Behandlung des Ganzen dünkt uns aber oberflächlich.
Nr. 3. Huß tritt auf und gibt Erklärungen. Hieronymus warnt ihn:
Zu stark, o Huß, hast du die Klerisei
Ob ihrer Ueppigkeit und Tyrannei.
Ob schnöden Ablaßkrames angeklagt,
Sie wird dir's nimmermehr vergeben etc.
Die Arie (Baß) ist ausgezeichnet; nur gegen Stellen wie:

möchten wir uns stemmen: sie erinnern zu sehr an die Graun'sche Zopfzeit. Den Schluß führen wir noch an, da dies Steigen der Stimme in die Tiefe zum Schluß der Nummern eine Lieblingsmanier des Componisten scheint Wir finden sie zum Schluß von Nr. 9, Nr. 12, Nr. 17 wieder., die wir wenigstens nicht zu oft anzutreffen wünschten.
Nr. 4 bringt den schönen Choral: »Was mein Gott will, das gscheh' allzeit«. Es ist fein und so zu sagen aus dem Leben gegriffen, daß Huß die erste Periode allein anstimmt. In solchen kleinen Zügen spiegelt sich das echte Talent.
In Nr. 5 treten nach einer recitativischen Einleitung Wenzel, Sofia und Huß zu einem Terzett zusammen. Die beiden ersten sind das böhmische Königspaar. Huß greift das Papistenthum an. Im Terzett vereinigen sie sich zum Preis des Glaubens, der Liebe, der Hoffnung. Die Form des Gedichts bot dem Musiker hier Gelegenheit zu einer kunstreichen Verwebung der Singstimmen, die er sich indeß entgehen ließ. Der Rückgang von As nach Es auf S. 36 scheint uns sogar nicht ganz meisterhaft. Im Uebrigen enthält die Nummer viel Inniges. Für Theoretiker vom echten Schrot und Korn stehe auch diese Stelle da:

Nach unserm Urtheil ist das die ärgste Sünde nicht, nur Pedanterie und Geistesfaulheit in Sachen der Kunst ist es, wie sie gerade unter den Generalbassisten am meisten angetroffen wird.
Der zweite Theil beginnt mit einem Zigeunerchor, von dem wir mehr erwartet hätten. Wohlklang und Anmuth sollten niemals fehlen, auch wenn Zigeuner singen. Dies wußte Weber in der Preciosa besser zu machen.
Dagegen muß Nr. 7, wo sich zwischen den Stimmen der Zigeuner aus der Ferne der Chor der Hussiten vernehmen läßt, von bedeutender Wirkung sein.
Im Zigeunerchor Nr. 8 tritt der frühere zigeunerartige Charakter zurück, er dünkt uns, fast nur auf Tonica und Dominante basirt, doch gar zu simpel. Wenn wir oben von Stellen sprachen, an denen wir des Componisten isolirte Stellung wahrzunehmen glaubten, so meinten wir damit Chöre wie diese Nummer.
In Nr. 9 erkundigen sich die Hussiten nach dem Wege nach Costnitz. Eine Zigeunerin warnt vor der Reise in einer Arie, die uns nur wenig zusagt und melodisch wie formell mißrathen scheint. So wenigstens nach dem Clavierauszug. Vielleicht wird sie durch das Orchester gehoben.
Nr. 10. Huß zeigt keine Furcht; er hat ja auch freies Geleit vom Kaiser Sigismund versprochen bekommen. Der Chor spottet: »Freies Geleit?« und später »Sigemund Lügemund«; beide Ausbrüche des Chors sind sehr kurz; im zweiten dünkt uns der Eintritt der Bässe auf der Dominante nicht meisterhaft.
Nr. 11. Huß verabschiedet die Freunde, die ihn begleiten, in ausdrucksvoller Musik.
Nr. 13 ist fast eine wörtliche Wiederholung des Chores von Nr. 6. Die Zigeuner ziehen fort. Das in's d einmal vorschwebende e zu Schluß (S. 64) ist ein abgelauschter Naturlaut. Solche Noten fallen nur einem poetischen Kopfe ein.
In Nr. 14 begegnen wir zuerst der Aufschrift: »Liebliches Wiesenthal«, als dem Ort der Handlung. Es liegt darin etwas Sonderbares, da das Oratorium doch sicher nicht zur Aufführung auf der Bühne bestimmt ist. Der Phantasie des Hörers durch solche Andeutungen zu Hilfe zu kommen, scheint aber gar wohl zulässig. Die Musik schildert den Ort im freundlichen A dur noch schärfer. Huß, in ein Hirtenthal gekommen, bittet die Hirten um einen Trunk Milch. Chlum warnt vor Vergiftung. Dies geschieht in der Musik sehr charakteristisch im Zwiegesang zwischen Huß und Chlum (S. 67). Die späteren Worte des Hirten:
Auch euch, o Herr, verleih Gott Heil und Glück! –
Ihr mögt wohl wandeln jetzt auf schweren Wegen –
obwohl vom Componisten ausdrucksvoll recitirt, wünschten wir etwa von Beethoven componirt gesehen zu haben. Hier konnte eine tiefe Rührung erreicht werden.
Die folgende Nummer beginnt mit den Psalmworten: »der Herr ist mein Hirte« und athmet den rechten Charakter; doch hängt das Ganze zu lange in A dur fest. Der Chor bringt dann mehr Bewegung in das Stück. Wie der erste so schließt auch der zweite Theil ganz leise.
Im dritten werden wir nach Costnitz versetzt. Barbara, Kaiser Sigismunds Frau, bittet um Gnade für Huß. Jener sträubt sich. Man hört das Geläute, in der Musik in der bekannten Quintenweise wiedergegeben. Die folgende Arie der Barbara: »Augen sind der treue Spiegel« ist innig gesungen, wenn auch nicht neu. Viel bedeutender als Musikstück und von leidenschaftlicher Färbung scheint uns das nächste Duett.
Es folgt jetzt unter der Aufschrift » Missa canonica« jener künstliche Musiksatz, von dem wir oben sprachen, daß er sich im Gegensatz zu der im ganzen Oratorium vorwaltenden Simplicität wie ein Extrem ausnähme. Wie dem sei, solche Sätze gereichen jedem Musiker zur Ehre. Die Form ist die des doppelten Canons in der Unterquinte. Aus der Bach'schen Passionsmusik nach dem Evangelium Johannis erinnern wir uns eines ähnlichen, freilich noch kunstvolleren, über die Worte »Kreuzige«.
Nr. 20 enthält die Anklagescene. Huß'ens folgende Arie scheint uns eine der bedeutendsten des Werkes. Ergebung in den Willen des Himmels und Trotz gegen seine Verfolger sind die Grundzüge dieses warmen, energischen Musikstückes. Noch einmal singt er seinen Choral, den er schon im ersten Theil angestimmt, dem ein etwas matterer Chor und dann die Scene mit dem Bauern folgt, der noch ein besonderes Scheit zum Holzstoß herbeigetragen bringt. Hier folgt das weltberühmte, mit Geist componirte » O sancta simplicitas« Huß'ens.
Den folgenden, den Schlußchor, wünschten wir in vollständiger Besetzung gehört zu haben; er muß von ergreifender Wirkung sein, namentlich wie Huß zwischen dem Chor der Flammengeister das » Miserere mei Domine« aufschreit und mit immer schwächerer Stimme und den Worten » non confundar in aeternum« beschließt. Es scheint, daß der Componist gerade an dieser Nummer mit Begeisterung gearbeitet, und wir möchten sie für die würdige Krone des Ganzen erklären.
So haben wir nach besten Kräften versucht, dem Werke die Würdigung zu geben, wie sie eben nach einem Clavierauszug zu geben möglich ist. Ueber die Befähigung des Componisten hat die Welt längst entschieden; aber der Wege gibt es vielerlei. Löwe hat sich einen schwierigen gewählt. Er ermatte nicht – und wenn auch, das Verdienst muß ihm bleiben, in den ersten Reihen zur Erreichung eines neuen Zieles gekämpft zu haben. Mit diesem Bekenntniß, das wir schon an die Spitze dieses Aufsatzes stellten, beschließen wir ihn und mit den Wünschen für des Künstlers ferneres Wirken.
*
Seit längerer Zeit ist über keine Pianofortecomposition in der Zeitschrift berichtet worden; es gab eben trotz der Massen, die täglich für dieses Instrument geschrieben werden, nicht viel Neues zu bemerken. Die Meister der vorletzten Epoche sind theils verschieden, theils schweigen sie ganz; die der letzten Epoche verharren entweder in ihren Richtungen, über die schon zum Oefteren in diesen Blättern geschrieben worden, oder sind gar zurückgegangen. Daneben wuchert jenes Unkraut fort, wie es zu allen Zeiten gewuchert hat; doch hat das Dreiblatt Czerny, Herz und Hünten bedeutend in der Gunst des Publicums verloren. Es wird ebenso wenig auszurotten sein, wie eine gewisse Leihbibliothek-Literatur; in einem Kunstblatte verdient sie nur die flüchtige Andeutung ihrer Existenz. Ein neues wahrhaftes Künstlertalent, das dem Clavier seine Kräfte widmete, ist noch nicht erschienen; einzelne erfreuliche, oder doch hoffnungsvolle Erscheinungen berühren wir später.
Von den namhaften Claviercomponisten der vorletzten Epoche schaffen, außer Cramer, der einer noch früheren zufällt, in der letzten Zeit aber wieder mit einigen neuen Compositionen hervorgetreten ist Seine bedeutendste – vierhändige Etuden – konnten wir noch nicht zu Gesicht bekommen., nur noch Moscheles und Kalkbrenner. Ersterer hat in seiner » Romanesca« Werk 104. eine Persiflage jener Pseudo-Romantik geliefert, die ihren eigentlichen Sitz in der großen Pariser Oper haben mag, von da auch in die Claviermusik sich eingeschlichen, sogar über den Rhein bis zu uns vorgedrungen, – eine köstliche Persiflage, deren Sinn wohl hier und da nicht einmal verstanden wurde, so daß einige gar den Verfasser unter die Verrückten schieben mochten, die er gerade schildern wollte. Die Sache ist lustig genug, und werth, daß man sie kennen lerne. Ein anderes, aber ernsthaft gemeintes Stück desselben Componisten ist eine Serenade Werk 103., die uns wiederum zeigt, wie dem Verfasser die Bewegung der letzten Clavierspielerepoche nicht fremd geblieben ist, ohne daß wir sie gerade seinen glücklichen Leistungen beirechnen möchten.
Herrn Kalkbrenner's Namen findet man nur noch auf einzelnen Phantasieen über Thema's aus gerade in Paris beliebten Opern, über deren Zuschnitt und Zweck nicht viel zu sagen ist.
Ein Curiosum eines sehr bejahrten Tonsetzers liegt uns noch vor in Bravourvariationen von F. D. Weber Prag, bei J. Hofmann., dem Director des Prager Conservatoirs. Wir nahmen das Stück als eine liebenswürdige Laune des alten Mannes. Wenn aber einzelne deutsche Recensenten über das Werk in Ekstase geriethen und ausschrieen, dies wäre der wahre classische Bravourstyl, so kann man darüber nur lächeln. Es ist ein Gelegenheitsstück wie hundert seines Gleichen und von wahrer Musik darin keine Rede; ja wir finden nicht einmal das Thema sehr ausgezeichnet, und namentlich die Harmonie vom drittletzten zum vorletzten Tact unmusikalisch. Daß das Ganze in seiner ursprünglichen Gestalt, wie wir in einer Anmerkung lesen: mit Orchesterbegleitung und Ritornelles, sich ungleich bedeutender ausnehme, ist kein Zweifel.
Dies wären die namhaftesten der älteren Tonsetzer, die uns zuletzt Claviercompositionen gegeben, und die Auswahl freilich keine große.
Von den Componisten der letzten Epoche vermissen wir seit Jahresfrist leider Mendelssohn unter den für das Clavier thätigen. Seine zuletzt erschienenen Werke waren das vierte Heft der Lieder ohne Worte und ein Variationscyklus in dem Beethoven-Album, die beide schon in der Zeitschrift erwähnt wurden. Leider feiert auch W. Taubert in Berlin, dessen fruchtbarer Anfang eine reichere Folge erwarten ließ. Hoffen wir, daß sie, wie manche andere, mit ihren Gaben nur zurückhalten. –
Vielem Geistvollen begegnen wir wieder in einigen Compositionen Chopin's: sie sind ein Concert-Allegro (Werk 46), eine Ballade (Werk 47), zwei Notturno's (Werk 48) und eine Phantasie (Werk 49), und, wie alle von seiner Hand, im ersten Augenblick als Chopin'sche Compositionen zu erkennen. Das Concert-Allegro hat ganz die Form eines ersten Concertsatzes und ist wohl ursprünglich mit Orchesterbegleitung geschrieben. Wir vermissen in dem Stück einen schönen Mittelgesang, das sonst reich an neuem und glänzendem Passagenwerk ist; wie es dasteht, schweift es zu unruhig vorüber; man fühlt das Bedürfniß nach einem nachfolgenden langsamen Satz, einem Adagio, wie denn die ganze Anlage auf ein vollständiges Concert in drei Sätzen schließen läßt. Das Clavier zur höchsten Selbstständigkeit zu erheben und des Orchesters unbedürftig zu machen, ist eine Lieblingsidee der jüngsten Claviercomponisten und scheint auch Chopin zur Herausgabe seines Allegro in der jetzigen Gestalt vermocht zu haben; an diesem neuen Versuche sehen wir indeß von Neuem ihre Schwierigkeit, ohne deshalb vom wiederholten Angreifen der Sache abzurathen. Bei Weitem höher als das Allegro stellen wir die Ballade, Chopin's dritte, die sich von seinen früheren in Form und Charakter merklich unterscheidet und, wie jene, seinen eigensten Schöpfungen beizuzählen ist. Der feine geistreiche Pole, der sich in den vornehmsten Kreisen der französischen Hauptstadt zu bewegen gewohnt ist, möchte in ihr vorzugsweise zu erkennen sein; ihr poetischer Duft läßt sich weiter nicht zergliedern. – Die Notturno's reihen sich in ihrem melancholischen Charakter, ihrer graziösen Haltung Chopin's früheren an. Vorzüglich mag das zweite zu Mancher Herzen sprechen. – In der Phantasie begegnen wir dem kühnen stürmenden Tondichter wieder, wie wir ihn schon öfter kennen gelernt; sie ist voll genialer einzelner Züge, wenn auch das Ganze sich einer schönen Form nicht hat unterwerfen wollen. Welche Bilder Chopin vorgeschwebt haben mögen, als er sie schrieb, kann man nur ahnen; freudige sind es nicht. –
W. Sterndale Bennett hat seit seinen reizenden, schon vor Jahr und Tag in der Zeitschrift besprochenen Diversionsnur eine einzige Claviercomposition veröffentlichen lassen: Suite des Pièces Werk 24.: sie reicht aber hin, die Achtung vor seinem schönen Talente zu erneuen. Sechs Stücke sind es ziemlich gleichen Charakters, die das Heft enthält, die sämmtlich Zeugniß von der echten, Alles wie nur im Scherz und Spiel vollbringenden Schöpferkraft ihres Verfassers geben. Nicht das Tiefsinnige, Großartige ist es, was uns hier Gedanken weckt und imponirt, sondern das Feine, Spielende, oft Elfenähnliche, das seine kleinen, aber tiefen Spuren in unserm Herzen zurückläßt. Einen großen Genius wird daher Bennett Niemand nennen wollen, aber von einer Genie hat er viel. In diesen Tagen, wo so viele unerquickliche Musik sich breit macht, das Aeußere, das Mechanische bis zum Unmaaß und Unverstand hinaufgetrieben wird, wollen wir uns aber doppelt erfreuen an jener natürlichen Grazie, jener stillen Innerlichkeit, wie sie Bennett's Compositionen innewohnt. Wir zweifeln auch nicht, daß sich diese Art Musik, wie die ihr verwandten höheren und niederen Richtungen sich immer mehr Bahn brechen müssen, und daß, wie verschieden auch die Urtheile über einzelne ihrer Vertreter ausfallen mögen, die Geschichte der Kunst der Periode, die das Kunstreiche und Seelenvolle wieder zu verbinden strebt, ihren hohen Platz über das, was Mode und Laune des Glückes gehoben, einräumen und sichern wird. Vieles ist schon gethan; und unter den Componisten jener edleren, seltneren Richtung verdient auch Bennett eine Ehrenstelle. Schriebe er nur mehr! Aber es scheint, daß er selbst einsieht, er bewege sich auf einem kleinen Terrain und er dürfe nicht immer auf diesem verharren; denn, wie gesagt, wir lieben wohl die Elfenspiele, aber Mannesthaten noch mehr, und diese zu vollbringen, scheint das kleine Gebiet des Claviers zu beschränkt; dazu gehört ein Orchester, eine Bühne. Doch wir schweifen zu weit von unserer Composition ab, die ihrem Verfasser, möge seine Zukunft sein wie sie wolle, zur immerwährenden Ehre gereicht. Von einem Mißlingen der Form u. dgl. kann bei ihm schon gar keine Rede mehr sein; Anfang, Fortgang und Schluß des Stückes, alles gestaltet sich ihm meisterlich. Auf die Aehnlichkeiten seiner Compositionen mit Mendelssohn'schen ist schon öfters aufmerksam gemacht worden; man würde Bennett aber sehr Unrecht thun und Urtheillosigkeit verrathen, glaubte man mit so einem Ausspruche seinen Charakter vollständig bezeichnet zu haben. Gewisse Aehnlichkeiten sind den verschiedenen Meistern der verschiedenen Epochen immer gemein gewesen; wie in Bach und Händel, wie in Mozart, Haydn und in den früheren Compositionen Beethoven's, ist es ein gewisses gemeinschaftliches Streben, was sie verbindet, das sich auch oft äußerlich ausspricht, gleich als ob sich einer auf den andern berufen möchte. Dieses Hinneigen eines edlen Geistes zu einem andern wird Niemand mit dem Worte Nachahmung belegen wollen, und etwas Aehnliches liegt auch im Verhältnisse Bennett's zu Mendelssohn. Von Werk zu Werk hat sich aber Bennett immer eigenthümlicher herausgestaltet, und in dem jetzt vorliegenden könnte, wie gesagt, nur das verwandte künstlerische Streben im Ganzen an Mendelssohn erinnern. Eher möchten wir manchmal an ältere Meister denken, in die sich der englische Componist eingelebt zu haben scheint; das Studium Bach's, und unter den Claviercomponisten des D. Scarlatti, die Bennett vorzugsweise liebt, ist nicht ohne Einfluß auf seine Fortbildung geblieben, und er hat ganz Recht, sie zu studiren; denn wer ein Meister werden will, kann es nur bei Meistern, – wenn wir natürlich auch nicht Scarlatti mit Bach auf eine Stufe setzen wollen. Von den einzelnen Stücken der » Suite« – auch ein altes gutes Wort – möchten wir kaum einem vor dem andern den Vorzug geben. Jeder wird nach seiner Einsicht wählen. Die eigenthümlichsten scheinen uns die zweite Nummer in ihrer eigenthümlichen höchst zarten Gestaltung, und die vierte wegen ihres phantastischen Charakters. –
Wie St. Bennett war leider auch Adolph Henselt in den letzten Jahren nur wenig productiv. Vielleicht hielten ihn nur äußere Gründe ab; denn daß ein Quell, der so frisch und fröhlich zu sprudeln begann, so schnell wieder versiegt wäre, kann man nicht glauben. Sein neuestes Stück für Clavier allein heißt Tableau musical Werk 16.; einer böhmisch-russischen Volksmelodie folgt ein ländliches Thema, die sich in anmuthiger Weise später begegnen; es gibt ein Bild, als wenn etwa eine Zigeunerbande sich in moderneres Bauernvolk mischte, und vielleicht hat dem Componisten so etwas vorgeschwebt, wie zum Theil wenigstens der Titel vermuthen läßt. Das Ganze macht einen heitern, fast malerischen Eindruck und ist von jenem Wohlklang beseelt, wie er alle Compositionen dieses Künstlers auszeichnet. –
Von berühmten Virtuosen, die das Clavier neuerdings bedacht, führen wir zuerst S. Thalberg an, der, außer seiner zweiten Phantasie über Thema's aus Don Juan, die von seinen andern Phantasieen sich nur wenig unterscheidet, unter dem Titel: Thème original et Etude Werk 45. eines seiner effectvollsten Stücke veröffentlicht hat, – dasselbe, mit dem er in seinen Concerten so oft Furore machte. Der Reiz liegt zuerst in dem anmuthigen Thema, von dem Jemand sagte, es habe etwas von einem Gesang italienischer Maulthiertreiber, was den besondern Charakter der Melodie auch im Ganzen andeuten mag; den Haupteffect auf das Publicum macht aber erst die schillernde Variation, wo man nicht weiß, wo der Spieler alle die Finger herbekömmt. Dabei klingt die Etude viel schwieriger als sie ist. Hätte die Composition eine gehaltvollere Einleitung und einen weniger kurzen Schluß, sie wäre eines unbedingten Lobes würdig. Für das Publicum ist sie noch immer trefflich genug.
Liszt hat vor Kurzem, außer einigen Phantasieen über Opernthema's, sein umfangreichstes und, wie wir glauben, sein bedeutendstes Werk erscheinen lassen, seine Pélerinage, die drei starke Bände füllen wird. Wir konnten erst den ersten Band zu Gesicht bekommen und versparen unser Urtheil, bis wir das Ganze kennen gelernt, für einen spätern besondern Artikel. –
Von jüngeren Componisten, die sich als solche schon anderweitig bekannt gemacht, für Clavier aber, so viel wir wissen, erst wenig oder gar nichts veröffentlicht, müssen wir noch O. Nicolai und Julius Rietz nennen, von denen uns zwei Claviercompositionen vorliegen. Und wie wir vorzugsweise gern nach neuen Sonaten greifen, so freute uns schon der Titel auf der Nicolai'schen Composition, die eben eine Sonate ist Werk 27.. Man hat diesen Componisten wegen seiner italienischen Sympathieen vielfach angegriffen; wir kennen nichts von seinen in Italien geschriebenen Opern; in dieser Sonate steckt aber noch genug gutes deutsches Blut. Oder wäre es, daß er seine Feder so in der Gewalt hätte, daß er sich heute in italienischer Weise, morgen in anderer ergehen könnte? Dies wäre eine gefährliche Gewandtheit, der schon Meyerbeer als Opfer gefallen ist. Doch kennen wir, wie gesagt, zu wenig von Hrn. Nicolai's Compositionen, um uns ein Urtheil darüber zuzutrauen. Die Sonate bekundet in jedem Fall eine deutsche Abstammung, und im Besonderen eine große Leichtigkeit in der Erfindung und Ausführung; ist jene nicht gerade tief, diese keine außergewöhnlich kunstreiche, so fesselt doch das Stück durch andere Vorzüge, durch sein aufgewecktes rasches Wesen, das nicht grüblerisch beim Einzelnen aufhält und eben eine dem Componisten günstige Totalwirkung hervorbringt. Am wenigsten gelungen scheint uns der letzte Satz; es verändert sich in ihm das Tempo zu oft, was nur ein besonders geistreiches Spiel vergessen machen würde. Recht aus dem Ganzen ist dagegen der erste Satz, ebenso das Scherzo und namentlich das Trio gelungen. Zum Hauptmotiv des Adagio hat der Componist eine schwedische Volksmelodie (allerdings eine der schönsten) gewählt; einen Zusammenhang mit dem Uebrigen vermögen wir indeß nicht zu entdecken.
Julius Rietz, der sich durch seine beiden Ouverturen einen klangvollen Namen erworben, debütirt als Claviercomponist mit einem Scherzo capriccioso Werk 5.. Von seiner Hinneigung zu Mendelssohn's Weise war schon öfter die Rede; auch uns verleidete dies manche Stelle seiner Compositionen. Daß uns gewisse Anklänge bei manchen Componisten mehr beleidigen, als bei anderen (wie z. B. bei Bennett), mag schwer zu erklären sein, wenn es nicht vielleicht daher kommt, daß Vor- und Nachbildner von Natur aus weniger verwandt sind, und mithin das Angeeignete im letztern fremdartiger berührt, als wo (wie eben bei Bennett und Mendelssohn) die Charaktere einen Aehnlichkeitszug gleich bei ihrer Geburt mit auf die Welt gebracht zu haben scheinen. Wie dem sei, der äußerst talentvolle Componist, von dem wir sprechen, hat so viel Bildung, zeigt einen so entschiedenen Charakter, daß es vielleicht nur einer größeren Aufmerksamkeit seinerseits bedarf, Reminiscenzen zu verhüten. Im Uebrigen erinnert gerade das Scherzo weniger an Mendelssohn'sche Art; es ist dazu viel zu mißmuthig, mißtrauisch fast, wenn wir so sagen dürfen. Hinter dem wenig heitern Humor des Stückes verbirgt sich aber jedenfalls ein vortrefflicher Tonkünstler, dem wir wünschen, daß, wie er heimisch in seiner Kunst, er sich auch ganz glücklich in ihr fühlen möge. –
Noch liegt eine Reihe Compositionen vor uns, deren Verfasser weniger oder gar nicht gekannte Namen haben; wir haben sie aus einem ansehnlichen Stoße neuer Musikalien als die bemerkenswerthesten herausgewählt.
Julius Schapler, dessen Preisquartett als ein bedeutendes Musikstück bereits S. 268 ff. angezeigt wurde, hat neuerdings eine Fantasia capricciosa gebracht. Den Eindruck jenes Quartetts noch im frischen Gedächtniß bewahrend, gingen wir mit Freude an die neue Composition, fanden uns indeß diesmal getäuscht. Der Titel mag Vieles entschuldigen, aber nicht Alles. Wir vermissen in der Phantasie einen wahrhaft schönen musikalischen Gedanken und den innerlichen Faden, der auch die phantastische Unordnung durchschimmern soll, will sie anders im Bezirk der Kunst anerkannt sein. Offenbar hat der Componist mit seinem Stück etwas gewollt, – was aber? verschweigt er uns. Gegen das Ende hin erscheint nämlich auf einmal, diesmal recht wie aus den Wolken kommend, der »Mond«, d. h. ein Andante mit dieser Aufschrift. Was ihm vorangeht, ist kaum zu errathen; es fehlt uns der Schlüssel zur Auflösung. So vermuthen wir denn, der Componist hat irgend eine Begebenheit schildern wollen und, die Musik geheimnißvoller wirken zu lassen, die nöthigen Andeutungen weggelassen. Damit that er aber sich und seinem Werke Schaden, dem wir wenigstens, wie es dasteht, kein Interesse abzugewinnen wissen. Die Musik ist eben zu wenig an sich und könnte nur dadurch zu ihrer Bedeutung gelangen, wenn uns der Componist die Bilder, die ihm jedenfalls vorgeschwebt, mit Worten genannt, wie er es bei dem »Mond« that. Ein nicht gutes Zeichen für eine Musik bleibt es aber immer, wenn sie einer Ueberschrift bedarf; sie ist dann gewiß nicht der inneren Tiefe entquollen, sondern erst durch irgend eine äußere Vermittelung angeregt. Daß unsere Kunst gar Vieles ausdrücken, selbst den Gang einer Begebenheit in ihrer Weise verfolgen könne, wer würde das leugnen; die aber, die die Wirkung und den Werth ihrer so entstandenen Gebilde prüfen wollen, haben eine leichte Probe: sie brauchen nur die Überschriften wegzustreichen. Herr Schapler that es; aber die Probe fiel gegen ihn aus. Nichts desto weniger zählen wir sein Werk zu den bemerkenswerthen und würden es ohnedies in diese Revüe gar nicht aufgenommen haben. Auch im Verfehlten läßt sich oft ein Talent erkennen, und dieses ist dem Componisten in jedem Falle zuzusprechen. –
Einen anmuthigen Cyklus von Etuden gibt uns S. Goldschmidt; Six Etudes de Concert. Oe. 4. er gehört nach diesen Proben seines Talentes, den ersten, die wir von ihm zu Gesicht bekommen, mit Leib und Seele der Richtung der neuesten Zeit, aber einer ihrer edleren an. Chopin scheint er zumal in's Herz geschlossen zu haben; dabei offenbart er aber auch Eigenthümliches; das Jugendlich-Schwärmerische, das alle seine Stücke durchweht, kann kaum Jemandem entgehen. Auch schöne Kenntnisse stehen ihm zu Gebote. Am liebsten ergeht er sich in fremdartigen Tonarten; bis auf eine Etude spielt das ganze Heft in Des und Fis. Steige er späterhin aber auch manchmal zu menschlicheren herab; ein junger Componist, zu dem man sich erst durch 5 bis 6 Kreuze hindurcharbeiten muß, braucht noch einmal so viel Zeit zur öffentlichen Anerkennung. Die Hauptsache aber ist, er bewahre sich seine Natürlichkeit und schreibe dann, in welcher Tonart er wolle. Wir haben keinen Zweifel, daß Herr Goldschmidt noch Schöneres und Bedeutenderes leisten werde; sein Werk spricht dafür. Den zarteren Stücken in ihm geben wir übrigens den Vorzug; in den kräftigeren steht er weniger selbstständig da. Einige Gemeinstellen (chromatische Gänge) wünschten wir unterdrückt; er erinnere sich immer des Satzes: Nur das Beste wird fortdauern. –
Eine andere nicht unbedeutende Etudensammlung hat wiederum H. F. Kufferath veröffentlicht Werk 8.; seine erste ward schon lobend in diesen Blättern besprochen. Auch diese Etuden geben sich auf den ersten Blick als Kinder der jüngsten Zeit; man kennt jene Notengruppirungen, in denen fliegende Harpeggien eine ruhende Melodie einzuhüllen scheinen. Der Componist gibt in dieser Art wieder einige treffliche; nur schreibe er nicht zu viel in dieser Compositionsweise, sie führt zur Manier. Bach hat 30 Exercices oder Variationen geschrieben, von denen jede eine andere Physiognomie hat, – und dies schon vor 100 Jahren; er konnte freilich nicht anders und würde nicht begreifen, wie 9/10 der heutigen Componisten alle über die nämliche Weise variiren und etudiren. Herr Kufferath gehört gewiß zu den besseren unter ihnen; es thut aber Noth, die jungen manchmal an die alten zu erinnern; in Vielem machten sie sich's nicht so leicht. Von diesen höchsten Forderungen an Vielseitigkeit und Mannichfaltigkeit abgesehen, enthält die Kufferath'sche Etudensammlung aber, wie gesagt, viel Schätzenswerthes. Die Fertigkeit und Sicherheit des Componisten als Spieler zeigt sich auch in seinen Compositionen. In der Form sind sie durchgehends gelungen, wenn dieser auch oft eine gewisse Breite und Umständlichkeit anhängt. Das Figurenwerk finden wir sehr fleißig und zart behandelt, dies namentlich in der vierten und fünften. Feiner Züge voll ist auch die dritte. Die Steigerung in den glänzenderen Nummern durch Anhäufung von Bravourformen kann ihre Wirkung nicht verfehlen. Die meisten der Etuden eignen sich zum öffentlichen Vortrage und verdienen diesen mehr, als manche werthlose Composition berühmter Virtuosen. –
Stephen Heller hat uns in einem Scherzo Werk 24. und einer Caprice Werk 27. neue Beweise seines geistreichen Talentes gegeben. Besonders glücklich finden wir das Scherzo; es ist voll von Humor und dabei von künstlerischer Form; wir fühlen uns vom Anfang bis Ende in der Nähe eines höchst lebendigen, liebenswürdigen Geistes, der, wie er zu scherzen und zu unterhalten, oft auch einen tieferen Gedanken heranzubringen versteht. Und scheint uns auch nicht Alles der Erguß einer freischöpferischen Phantasie, nicht Alles unmittelbar aus dem Innersten geflossen und mehr am Instrument gefunden, so müssen wir um so mehr wünschen, der Künstler bekomme Zeit und Lust, für Orchester zu schreiben, damit sein bedeutender innerer musikalischer Sinn sich immer mehr von der Herrschaft der mechanischen Einflüsse befreie, denen sich alle, die am Instrument erfinden, nicht leicht entziehen können. Heller's Claviercompositionen tragen alle Anzeichen eines bedeutenden zukünftigen Orchestercomponisten in sich; sie wären mit wenigen Abänderungen auf das Wirkungsvollste zu instrumentiren; man hört, wie ihm hier Violinen, dort Hörner etc. vorgeschwebt. Es wäre Schade, wenn uns Paris, das zeitraubende Leben dort einen Orchestercomponisten zu Schanden werden ließe, den die Natur mit so entschiedener Befähigung ausgerüstet. Den Clavierspielern würde, wenn H. sich der Orchestercomposition zuwendete, freilich mancher Genuß entzogen werden; denn man erholt sich von dem nichtswürdigen Clavierpassagenkram gern an festeren Gebilden, wie sie symphonieartig in Heller's Compositionen oft auftauchen. Wir würden aber den Genuß gern gegen den reicheren vertauschen, den das aller Nüancen fähige Orchester zu bereiten im Stande ist; und daß er auch dieses mit der Zeit sich unterthan machen würde, dafür spricht sein Talent, die Stufe, auf der er überhaupt schon als Musiker steht. Sehen wir aber von diesen Wünschen ab, so müssen wir nochmals eingestehen, das Scherzo ist geistreich und fein genug, als daß wir unzufrieden sein dürften. Allen wird freilich seine und solche Musik überhaupt nicht zusagen, und kann es nicht. Sie zu verstehen, zu lieben, gehört wohl mehr dazu, als bloße Dilettanten-, selbst Musiker-Bildung. Aus diesem spielenden Humor erklingt mehr als blos musikalische Erfahrung. Wer Shakespeare und Jean Paul versteht, wird anders componiren, als der seine Weisheit allein aus Marpurg etc. hergeholt; wer im Strom eines reichbewegten Lebens anders, als wer den Cantor seines Ortes für das Ideal möglicher Meisterschaft hält, – und dies bei übrigens gleichen Talenten, gleich ernsten Studien. Eine andere als blos musikalische Bildung und Erfahrung spricht auch aus den Compositionen unseres jungen Künstlers; wir wollen nichts hineinklügeln, aber wir wissen, das ist nicht für Jedermann. Auch in der Caprice findet sich Ausgezeichnetes; doch steht sie an Naivetät, an Grazie gegen das Scherzo zurück. Die Gesangstelle darin scheint uns karg; dagegen sprüht auch in ihm humoristisches Feuer unausgesetzt, wie man das Ganze einem künstlichen Feuerrade vergleichen möchte, das uns in seinem buntfarbigen Umschwunge eine Weile ergötzen will. Das Crescendo (S. 11 und 12) macht eine symphonieartige Wirkung, ohne in's Triviale der gewöhnlichen Crescendo's zu fallen; wir kennen nichts Aehnliches für Clavier, der Spieler kann sich hier im größten Glanze zeigen. –
Von Hermann von Löwenskiold liegen uns zwei Hefte Charakterstücke Werk 12. vor; sie haben die Ueberschriften: An die Entfernte, Venezianisches Gondellied, der Wunsch, die Elfenschwärme, Aufregung, und sprechen sich demgemäß aus. Der Componist ist zwar zu einer entschiedenen Selbstständigkeit noch nicht vorgedrungen; die Richtung aber, die er verfolgt, zeigt sich als eine edlere. Vieles sagt uns namentlich in der Anlage zu; die Ausführung läßt Manches vermissen. Eine gewisse Flucht des Fertigwerdenwollens macht sich hier und da bemerkbar; nicht alle Stücke sind gleichmäßig, künstlerisch ruhig abgeschlossen. Ueberall aber blickt Talent hindurch, und was zur Meisterschaft noch fehlt, möge Zeit und Fleiß dem jungen strebenden Künstler erreichen helfen. –
Hier erwähnen wir gleich noch ein Werk eines anderen jungen dänischen Componisten: 12 Capricen von Emil Hornemann Werk 1. Vier Hefte., das uns durch seinen bedeutenden Umfang wie durch den erfreuenden Inhalt gleichmäßig überraschte. Schon die Form der Stücke, eine Mittelart zwischen Etude und Caprice, müssen wir eine glücklich getroffene nennen. An die Etude erinnern sie durch ihre Abgeschlossenheit, durch das öftere Festhalten der einmal gefundenen Figur, vermeiden aber, an das Capriccio anstreifend, das Aengstlich-Mechanische des Zweckes, wozu oft die Etude den Componisten verleitet. Die Musik an sich trägt einen heiteren, wohlthuenden Charakter. Nirgends stößt uns Außerordentliches, Genialisches auf; selbst hinter den kühneren Anläufen birgt sich ein bescheidener Sinn, der schnell zurückhält, wo ihn die Sicherheit im Wohlbekannten zu verlassen droht. Der Componist will mit einem Worte nicht mehr leisten, als er kann, und dies behagt immer, wenn er die triviale Sphäre überhaupt hinter sich hat. Sein Drang, überall geregelte Kunstformen zu geben, verleitet ihn freilich oft zur Breite, und wir erhalten in den zweiten Theilen meist nur die Parallelstellen des früher Dagewesenen, ohne daß er einen neuen Aufschwung versuchte; aber es ist uns diese Breite noch immer lieber, als platte Formlosigkeit, die nicht weiß, was sie will. Damit rathen wir aber dem jungen Künstler keineswegs ab, bei dem Gewonnenen zu verharren, sich nicht in schwierigeren Formen zu versuchen, seiner Phantasie nicht neue Gebiete zu eröffnen. Im Gegentheil, wir setzen dies voraus. Im tausendfachen Durcheinander der Gegenwart würde seine sanfte Stimme nur spurlos verhallen. Will er mehr, so ist es an ihm, sich zu kräftigen, den höhern Streitern sich anzuschließen. Einstweilen dürfen wir dies sein erstes Werk, mit dem er sich auf so ehrenvolle Weise eingeführt, Allen, die sich an einer weichen klangvollen Musik erfreuen wollen, auf das Beste empfehlen. –
Wir sprachen zum Schluß unseres letzten Artikels von Compositionen zweier junger dänischer Musiker, von Löwenskiold und Hornemann; so eben wird uns eine neue Claviercomposition eines dritten gleichfalls jungen Dänen N. W. Gade mitgetheilt, desselben, der schon durch seine Ouvertüre »Ossian« sich bekannt gemacht, so reiche Hoffnungen für die Zukunft erweckt. Scheint er auch im Orchester in seinem eigentlichen Elemente, so verräth doch auch die erste Claviercomposition, die mit seinem Namen vor uns liegt, den kenntnißreichen Musiker und jedenfalls ein inniges poetisch-musikalisches Gemüth; sie heißt »Frühlingsblumen« und besteht aus drei kleinen Stücken, die diesen Titel zu tragen vollkommen verdienen. Es sind eben stille bescheidene Kinder seiner Phantasie, hier und da an ähnliche Mendelssohn's, auch Henselt's erinnernd, doch auch fesselnd durch die eigene nordische Färbung, die schon in der Ouvertüre »Ossian« zu bemerken war. Was ist doch alles Virtuosengeklimper gegen solch' anspruchlose sittige Musik! Aber die Gegenwart fängt an zu erkennen, und »die sich selbst erniedrigen, sollen erhöhet werden«. Doch genug der Worte über die kleine Composition, die für sich selbst spricht. –
In den sechs »Romanesken« von Gustav Nottebohm Werk 2. wird Jedermann etwas Anderes zu finden hoffen, als sie bieten; es sind Stücke der schlichtesten bürgerlichsten Art, daß man den Titel beinahe für eine Ironie halten könnte. Wie dem sei, ein guter Kern läßt sich unter der unscheinbaren, oft herben Schale nicht verkennen. Aus einigen größeren Compositionen desselben Verfassers, die an einem andern Orte zu besprechen sind, geht dies noch deutlicher hervor. Hier, scheint es, wollte er nur etwas Leichtes, den Verlegern Gefälliges liefern. –
Eine Phantasie von F. C. Wilsing Werk 10. rief uns eine frühere in diesen Blättern schon besprochene Composition desselben in's Gedächtniß. Was damals anerkannt wurde, findet sich auch hier wieder bestätigt. Der Componist gehört einer gründlichen Schule an und scheint sich immer freier zu entwickeln. In seiner Phantasie ist Sinn und Ordnung, für eine Phantasie eher zu viel als zu wenig. In einer Zeit, wo dies schöne Wort so oft gemißbraucht worden, sei aber jeder Versuch, es wieder zu Ehren zu bringen, mit Auszeichnung genannt, auch wenn er sich zum Extreme neigte. Bei aller Anerkennung des Componisten würden wir's nicht ungern sehen, wenn sich seiner zuweilen auch jene Grazie bemächtigte, die den Ernst erst liebenswürdig macht. Einige altmodische Fiorituren (im ersten Theile) wünschten wir gänzlich unterdrückt; durch Schönpflästerchen etc. wird die elastische Zeit noch nicht zurückgebracht. Doch das sind Kleinigkeiten. Der Verfasser muß sich durch das überwiegende Gute seines Werkes die Achtung aller gebildeten Musiker erwerben; möge ihn das ermuntern zu fortgesetztem Streben. Das Liebste in der Phantasie ist uns übrigens der zweite Satz. Die Fuge zum Schluß hat im Thema Aehnlichkeit mit dem des letzten Satzes der Sonate in A dur von Beethoven, verräth sonst aber den tüchtigen Meister, wenn wir auch nicht Alles in ihr sehr wohlklingend finden können. –
Wir beschließen unsern Ueberblick mit einigen Bemerkungen über drei neu erschienene Sonaten, deren Verfasser Adolph Reichel, Ignaz Lachner und Theodor Kullak sind.
Die erstere Werk 4. scheint uns der erste Versuch in dieser schwierigen Kunstform, die lobenswürdige Arbeit eines fleißigen Schülers. Vom Druck hätten wir abgerathen, wir sind überzeugt, ähnliche Sonaten werden in Deutschland jährlich zu Hunderten componirt. Wer in einer Gattung, die so herrliche Muster aufzuweisen hat, nichts Eigenes, nichts durch und durch Meisterhaftes zu geben vermag, bleibe zurück. Der Verfasser, wenn er sonst klar mit sich, wird zugestehen, daß vor solchen Forderungen sein Werk allerdings verschwindet. Daß er nach guten Vorbildern gearbeitet, zeigt jede Seite seiner Composition; Manches erscheint auch gelungener. Das Ganze macht aber keinen andern Eindruck, als den der Copie. Eine gewisse Trockenheit hängt dem Verfasser vielleicht noch von den Studienjahren an, vielleicht fehlte ihm auch ein rechter Meister, der das Talent in ihm lebendig zu machen verstand. Der Jugend sieht man manchmal gern ein Zuviel nach; aber das Beschneiden der Flügel macht Philister, man muß den unsichern Flug zu lenken verstehen. Mit einem Worte, der Componist ist noch in pedantischen Begriffen befangen; eine Sonate soll kein Pensum sein, die feinste Blüthe der Meisterschaft duftet uns aus den Musterwerken der Gattung entgegen. Darum fort mit den Terzen- und Sextengängen, wie sie in der vorliegenden Sonate so häufig vorkommen; das ist die schlechte Classicität, der Perückenstyl. Solche und ähnliche Stellen fallen doppelt auf, da der Componist hin und wieder seinen Gedanken eine interessantere Wendung zu geben versteht; so beginnt der Mitteltheil im ersten Satz sehr glücklich, so erhebt sich die letzte Seite der Sonate zu freierem Schwunge, so gefällt uns Manches im Scherzo, wenn auch die zweite Stimme zu Anfang desselben nicht nach Meisterart auftritt. Aus diesen Beispielen möge der Verfasser in etwas einsehen, wo wir ihm beistimmen, wo nicht. In keinem Falle aber halte ihn je ein Tadel ab, rüstig fortzuschreiten. Nur einige der größten Geister haben mit ihrem Werk 4 gleich ein Meisterstück geliefert.
Ueber die Sonate von I. Lachner Werk 20. können wir uns kurz fassen: sie ist offenbar das Werk eines sehr routinirten Musikers, der seinen Stoff zu ordnen und zu beherrschen versteht. Das fließt wie vom Born, immer glatt und ruhig fort. Wir finden kaum etwas auszusetzen an Form und Schreibweise. Damit ist aber auch beinahe Alles gesagt; Ansprüche an Erfindung, an Neuheit kann sie keine machen. Im Uebrigen mag der Componist vorzugsweise im Orchestersatz geübt sein; gewisse Gemeinstellen, die im Orchester Effect machen, auf dem Clavier aber sich leicht trivial ausnehmen, wünschten wir gänzlich beseitigt. Die Fortschritte neuerer Claviercomponisten, die Wirkungen, die sie ihrem Instrumente abgewonnen, scheinen dem Verfasser ganz fremd geblieben zu sein. Die Sonate versetzt uns somit in die Haydn-Mozart'sche Periode, ohne eine Haydn-Mozart'sche zu sein. Doch auch gegen solche Werke, wenn sie sonst nicht ungesund sind, wollen wir kein Verdammungsurtheil aussprechen; für eine gewisse Mittelclasse von Spielern muß ja auch gesorgt sein, und die Ansprüche dieser befriedigen solche und ähnliche Werke vollkommen.
Noch liegt uns die Sonate von Th. Kullak Werk 7., die interessanteste, aber auch barockeste unter den drei genannten, vor; eine wahre Hexenküche, das gährt und kocht unaufhörlich durcheinander. Nur im Mittelsatz bricht ein sanfterer Mondstrahl hindurch. Ohne Vergleich, der Componist hat Geist und Phantasie und mag ein brillanter Spieler sein. Nicht Alles können wir Musik in seinem Werke heißen; zieht man einzelnen Gedanken das bestechende glänzende Gewand ab, so erscheinen sie oft dürftig genug. Oft aber erhebt sie sich auch zu edlerem Ausdruck und dies gibt uns Hoffnung auf seine Zukunft als Künstler, daß dieser nicht dem eitlen Virtuosenwesen unterliegen werde. Zu thun bleibt ihm freilich noch Manches übrig; fragt er, was? so antworten wir: habt nur helle Köpfe und spielt eure Sonaten nach einer Beethoven'schen, Mozart'schen, und seht dann zu, wo der Unterschied liegt. Was die Finger schaffen, ist Machwerk; was aber innen erklungen, das spricht zu Allen wieder und überlebt den gebrechlichen Leib. –
*