
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
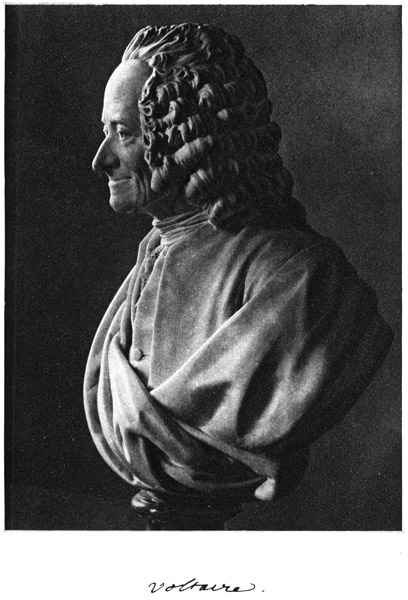
In achtzehn Bildern
»Ich bin schmiegsam wie ein Aal, lebendig wie eine
Eidechse und unermüdlich wie ein Eichhörnchen.«
In einem wattierten Pariser Rokokozimmer sitzt eine elegante Greisin, eingetrocknet, doch belebt, am Fenster, sie blinzelt in die Sonne, sie lächelt. Da tritt um seine tägliche Mittagsstunde der Abbé bei ihr ein, der dichtet, die Frauen versteht und über Musik schreibt. Er führt einen Knaben an der Hand, mit aufgeweckten Zügen, den, von dessen Versen er gestern erzählt hat. Als nämlich neulich ein Invalide aus den glänzenden Zeiten des nun hinsiechenden Sonnenkönigs in der Schule erschien, beim Lehrer um Abfassung einer Bittschrift an den Dauphin zu ersuchen, und der Lehrer war fort, da setzte sich der Knabe hin und schrieb ihm rasch ein Gedicht in zwanzig Versen; das hat man herumgegeben und auch der alten Dame gezeigt.
Nun steht er da und blickt die Alte an, sein vorlautes Wesen schweigt, er zögert, und mit Respekt küßt er die runzlige Hand, auf der, vielleicht weiß er auch das schon, vor einem halben Jahrhundert Molières Lippen ruhten, als sie noch nach der Liebeskönigin duftete. Nun lächelt sie über den Jungen, und nächstes Jahr, wenn man ihr Testament öffnen wird, dann wird man ein Legat von zweitausend Franken für ihn finden, wofür er sich Bücher kaufen soll: Ninon de Lenclos, 84jährig, und der 10jährige Voltaire.
In einem Café sitzt der 21jährige Literat und wettert, speit und spottet auf König und Hof, besonders auf den lasterhaften Herzog von Orléans. Sein Zuhörer, ein Offizier, den er flüchtig getroffen, lockt ihn nur immer heftiger heraus, ohne daß jener es merkt, der junge politische Dichter kommt ins Übertreiben und rühmt sich in eitler Erregung, gewisse Pasquille auf französisch und latein verfaßt zu haben, die, von einem andern stammend, namenlos überall herumgingen. Bald bringt der Spitzel alles zu Papier, der Regent erfährt's, und ein paar Tage später sitzt Voltaire in der Bastille, wohin er sich vom Elternhause kommen läßt: zwei Bände Homer, zwei Spitzentaschentücher, eine Kappe, zwei Kragen, eine Nachtmütze und ein Fläschchen Nelkenessenz.
Elf Monate sitzt er in dem Turm, und da man ihm Papier und Tinte verweigert, schreibt er seine Verse mit Blei zwischen die Zeilen eines Buches.
Die Comédie Française ist überfüllt. Hof und Gesellschaft, in zwei Parteien gespalten, überbieten einander in Perlen und Steinen, doch auch in Erwartung und Schadenfreude. Man wird den »Ödipus« des jungen Voltaire darstellen, und die Herzogin von Maine und die Ihrigen hoffen, der Regent und seine Tochter, die, wie alle Welt weiß, als Mann und Frau leben, werden sich von den deutlichen Anspielungen ihres dichtenden Gegners getroffen fühlen, wie das Königspaar im Hamlet, und skandalös zusammenbrechen. Vielleicht wird man sie auszischen? Aber der Orléans ist schlauer, und die Zeit ist unpathetischer als im sagenhaften Dänemark. Ruhig lächelt er neben der Tochter, stolz sitzt die Herzogin, die Schwangerschaft vor ihrem Vater nicht verbergend, unter dem Thronhimmel zwischen dreißig Damen, und wie die Tragödie vorwärtsschreitet, geben sie selbst das Zeichen zum Applaus. Voltaire, hinter der Szene, übermütig, fühlt sich siegen, läßt sich zuletzt als Page anziehen und trägt mit an der Schleppe des Hohenpriesters, um von der Bühne ins Publikum zu blinzeln.
Als am Ende der Beifall rauscht, denn es gibt noch mehr ödipeische Paare in der Gesellschaft, und sich der Autor in der Loge eines Marschalls zeigt, ruft von unten der Chor zu der schönen Marschallin empor: »Aber so küssen Sie ihn doch!« Und sie tut's unter allgemeinem Jubel.
In der Loge der großen Adrienne Lecouvreur trifft an einem Winterabend Voltaire einen jungen Adligen, dem dieser bürgerliche Literat bei der Dame recht störend kommt. »Wie heißen Sie eigentlich, fragt er ihn höhnisch, da Voltaire diesen Namen nur angenommen hatte. »Monsieur de Voltaire oder bloß Monsieur Arouet?«
»Mein Name beginnt mit mir. Der Ihrige endet mit Ihnen!« ruft der Dichter zurück. Der Chevalier erhebt seinen Stock, Voltaire greift zum Degen, die Schauspielerin fingiert eine Ohnmacht.
Als er aber einige Tage später aus dem Palais eines Herzogs tritt, bei dem er viele Jahre lang intim aus und ein gegangen, wird er von einer Rotte von Kerlen gepackt, deren Stockprügel der Ritter, einige Schritte entfernt, mit Lachen leitet. Als es dem Überfallenen endlich gelingt zu entschlüpfen, kehrt er sogleich in den Speisesaal des Herzogs zurück, um dessen Beistand anzurufen, da solcher Schimpf auch ihn den Gastfreund treffe.
Doch der Herzog lehnt ab. Voltaire blickt in den Abgrund, den er zu überbrücken dachte, als er, um seines Geistes willen, verwöhnt vom hohen Adel, Schützling der heimlichen Regentin Frankreichs, sich schon im Anfang einer großen diplomatischen Laufbahn fühlte, zu der ihn alles befähigte. Nun übt er von früh bis spät sich im Fechten, fordert wiederholt den Ritter, beleidigt ihn öffentlich, aber dessen Verwandte und Vettern, Kardinäle und Prinzen wissen ein Duell zu verhindern, lassen den Bürger vielmehr verhaften, dann verbannen.
So kommt er nach England.
In einer engen Gasse von Paris steht ein altes Haus, das gehört einem Kornhändler. Voltaire, Ende dreißig, erst heimlich, dann wieder öffentlich zurückgekehrt, mietet nach längeren Wanderschaften dem Manne eine Wohnung ab, läßt ihn zugleich für sich in Korn spekulieren, empfängt alle Welt. Heut bringt die Herzogin von St. Pierre und ihr Freund eine Freundin mit: eine Frau, nicht eben schön, doch mit bedeutenden Zügen: große Nase, schöner Mund, kräftiges Kinn, grüne, klare Augen, Stirn hoch und makellos, umlockt von schwarzem Haar. Sie tritt sehr einfach auf, obwohl sie vieles studiert und alles geprüft hat. Rasch erkennt der Dichter unter ihrem Wissen, ihrem Geiste die leidenschaftliche Natur der Marquise von Chatelet. Als sie sich zur improvisierten Mahlzeit setzen, macht er diesen kleinen Vers:
»Mein Gott, wenn diese große Ehre
Marianne, meine Köchin, säh':
daß die Duchesse de St. Pierre
und die Marquise de Chatelet
in meiner Bude zum Souper, –
Mein Gott, wie sehr verdutzt sie wäre!«
Von diesem Abend an bleibt »die göttliche Emilie« erst als Geliebte, dann als Freundin und Beraterin durch 17 Jahre ihm verbunden. Jahrelang lebt er auf dem Herrensitze dieser Familie an der Grenze von Lothringen, um, periodisch verfolgt, jeden Augenblick außer Landes treten zu können.
In einem kahlen Raum eines Schlosses bei Cleve liegt fiebernd unter seinem preußischen Reitermantel ein zarter Mensch von 28 Jahren. Er wartet auf den Abgott seines Geistes; er wartet schon vier Jahre. Ihm hat er in gereimten und in Prosabriefen die leidenschaftlichsten Elogen gemacht, ihn hat er mit Apoll und Sokrates, mit Cicero, Plinius und Agrippa verglichen. Doch der Franzose ist nicht gekommen, er hat – mit unerhörten Schmeichelworten – erst auf die Sicherung der Macht gewartet, die diesem jungen Mann einst zufallen mußte. Trajans und Virgils, des Titus und Augustus Namen hat er aufgeboten, um ihm zu sagen, wofür er ihn halte. Jetzt, bei der endlichen Zusammenkunft, liegt der Deutsche im Wechselfieber.
Aber die Wallung dieser jungen Seele beim Anblick des Meisters ist so groß, daß das Fieber aussetzt, und drei Tage lang ergötzen sich an ihrem Geist zum ersten Mal die weltverschiedenen Männer:
Friedrich und Voltaire.
Am Tische Richelieus, der durch Geist und Welt, durch Ritterlichkeit und Verschlagenheit dem Dichter ähnlich und befreundet war, spricht man kritisch von einer neuen Verherrlichung der Jungfrau von Orléans und meint, Voltaire, der dabeisitzt, hätte dies Thema weit besser behandelt. Die Geschichte einer Kellnerin, erwidert er lächelnd, die ihre Schenke verläßt, um auf dem Scheiterhaufen zu sterben, müßte man nur satirisch wiedergeben! Man dringt in ihn, er zieht sich zurück, er findet die vier ersten Gesänge, liest sie bald darauf derselben Gesellschaft vor, alle Welt applaudiert und drängt auf Fortsetzung.
Dies ist der Anfang von »La Pucelle«, einem seiner kühnsten Werke, das er wie eine geheime Sünde, wie einen Talisman heimlich und jahrelang mit seinem freidenkerischen Zynismus erfüllt, dessen Abschriften er selbst verfälscht, um nicht als Autor zu gelten, und das doch mit dem unverkennbaren Dichternamen durch die Gesellschaft von Paris gleitet.
Versailles. Er ist 50, rasch bewegt sich sein Kopf auf jene Altersformen zu, in denen er einzig unsterblich wurde. Heute spielt man vor dem König und der Königin, dem Dauphin und der Infantin, vor Rittern, Fürsten und Kardinälen auf der kleinen Hofbühne im Schlosse ein Festspiel, ein Petit-Rien nach der Etikette, Ballett und Text von Musikern, Tänzern und Malern mehr als von dem Spötter, der nur die Worte schrieb, überströmt von den hohlsten und süßesten Schmeichelworten für die Majestäten. Den Auftrag zu dieser Hofarbeit hatte ihm ein anderes, bürgerlich geborenes Menschenkind verschafft, das seine verbotenen Werke liebte und nun allmächtig war: die Pompadour. Voltaire als Nationaldichter auf dem Parkette des Königsschlosses.
»Versailles, 1. April 1743. In Anbetracht ... hat Seine Majestät keinen Würdigeren gefunden, durch einen Ehrentitel ausgezeichnet zu werden, als Sieur Arouet de Voltaire, der durch die Überlegenheit seiner Talente und durch seinen dauernden Fleiß die schnellsten Fortschritte in allen Wissenschaften, die er trieb, gemacht hat.«
Schmunzelnd steckt er die 2000 Pfund des neuen Jahresgehaltes ein und sekretiert die Verse:
»Vor meinem Henri und vor der Zaïre,
vor meiner Amerikanerin Alzire
hat seinen Blick der König eingesargt.
Viel Feind' und wenig Ruhm sind meine Brüder.
Jetzt plötzlich fließen Ehr und Güter nieder
für eine Farce – wie vom Markt.«
Spieltisch der Königin in Fontainebleau. Voltaires Freundin, die Marquise von Chatelet, verliert 400 Louisdor, er hilft ihr mit 200 aus, die er noch bei sich trägt, sie verliert sie. Ein Diener bringt vom nächsten Geldmann gegen hohe Zinsen weitere 200, eine Freundin sucht noch 180 zusammen; alles verliert die Dame, von ihrem Freund umsonst gewarnt, bis 80 000 Pfund weg sind. Voltaire, unwilliger Zuschauer, wagt es, ihr auf englisch zu sagen: »Sie haben vergessen, daß Sie mit Gaunern spielten.«
Das ist die Wahrheit, aber es ist der Tisch der Königin. Noch in derselben Nacht müssen beide fliehen, denn schreckliche Folgen drohen.
Eine Herzogin nimmt ihn auf einem nahen Schlosse auf, doch so ängstlich, daß er drei Monate in einem abgelegenen, verschlossenen Zimmer bei zugeriegelten Fensterläden verbringen muß. Jede Nacht um zwei wird er ins Schlafzimmer der alten Herzogin geführt, wo er ein Abendessen findet und der Dame vorliest, was er geschrieben: fünf kleine Romane.
Schloß Commerci. In einem alten Park ist man Gast des Königs von Polen, der dort eine Weile mit seiner Freundin Hof hält. Die Marquise, nun Anfang Vierzig, seit einem Jahrzehnt nicht mehr die Geliebte Voltaires, der sich vor den Frauen früh alt fühlt, doch beständig seine intime Freundin, hat sich vor kurzem Hals über Kopf und zwar zum letzten Mal verliebt: in einen leichten, seichten Herrn, zehn Jahre jünger als sie, Herrn de St. Lambert, der zugleich Liebhaber der Maitresse des Königs ist.
Heut abend kommt Voltaire, jetzt 54jährig, früher, als man zum Abendessen bittet, aus seinen Zimmern unangemeldet in die der Freundin; er findet sie in sehr intimer Lage mit dem jungen Manne. Szene, Beschimpfung, Erbitterung, Entschluß, noch diese Nacht zu reisen. Sein Kammerdiener als Mittler versteht es, einen Reisewagen unauffindbar zu machen; nachts hört er schließlich ein Gespräch zwischen den beiden seit anderthalb Jahrzehnt Verbundenen, denn die Marquise hat ihren Freund aufgesucht, um ihn zu besänftigen:
Voltaire: »Sie wollen, daß ich Ihnen glaube nach dem, was ich mit Augen sah? Gesundheit, Vermögen, jedes Gut habe ich Ihnen geopfert, und Sie betrügen mich!«
Marquise: »Ich liebe Sie wie immer, doch – Sie klagen seit langem über Abnahme Ihrer Kräfte. Das ist schade, doch muß ich an Ihre Gesundheit denken. Da Sie selbst sagen, Sie könnten für mein Wohlbefinden nichts ohne großen Schaden für Ihr eigenes tun, – dürfen Sie mir da zürnen, wenn einer Ihrer Freunde Ihre Stelle übernimmt?«
Voltaire: »– Sie haben recht. Aber sorgen Sie doch dafür, daß es nicht vor meinen Augen geschieht!«
Am nächsten Abend erscheint der Nebenbuhler bei ihm, bittet alle Heftigkeit zu entschuldigen. Voltaire: »Mein Sohn, ich allein habe unrecht. Sie sind im glücklichen Alter, in dem man liebt und gefällt. Nützen Sie diese kurzen Augenblicke. Ein alter Mann, dazu Patient, ist nicht mehr für Vergnügungen geschaffen!« Am dritten Abend soupieren alle drei wie gewöhnlich bei der Maitresse des Königs. Als einige Monate später seine Freundin in die Hoffnung kommt und man zu dritt beratschlagt, ob man den Ehemann zum Vater ernennen soll, sagt Voltaire: »Wir reihen das Kind einfach unter Madames gemischte Werke ein.«
Sie ist niedergekommen, und dies in Voltaires Gegenwart, der die dringendsten Einladungen des Königs von Preußen abgelehnt hat, um die Freundin bei der Geburt des Kindes seines Nebenbuhlers zu beruhigen. Alles ist heiter im Schlosse. Plötzlich, nach einer Woche, wird sie vom Fieber überfallen und stirbt. Gatte, Liebhaber und Freund stehen am Sterbebette, dann geht Voltaire langsam die Schloßtreppe hinab, unten fällt er um, den Kopf aufs Pflaster. Der Nebenbuhler eilt ihm nach, hebt den Ohnmächtigen auf. Als er erwacht, sieht er den jungen Mann an und sagt: »Sie haben sie getötet!«
In Potsdam leiht ein Berliner Schutzjude dem berühmten Franzosen, den der König für lange Monate zu sich gezogen, zum Preußischen Kammerherrn mit 20 000 Francs Jahresgehalt ernannt hat und der zeitlebens von Geldgeschäften mehr als von den schwankenden Einnahmen seiner meist anonymen Bücher gelebt hat, ein paar Diamanten, die der Dichter als Schauspieler für die Rolle des Cicero in seinem Stück vor dem König tragen will. Dabei läßt er ein Wort von Sächsischen Steuerscheinen fallen, an denen man bei der jetzigen Valuta Unsummen verdienen kann, weshalb der Ankauf in Preußen streng verboten ist. Voltaire mißt mit Pariser Maß, glaubt, daß ein Favorit des Königs auch in Preußen über solchen Verboten steht, schickt den Juden nach Dresden, um für vierzigtausend Francs sächsische Papiere zu kaufen, man hinterbringt es dem Könige, der ist außer sich.
Ein langer Prozeß, von Voltaire, der alles anders darstellt, mit Leidenschaft für seine Ehre bei Hofe geführt und schließlich durch Vergleich geschlossen, wirft nie verscheuchbare Schatten auf das Bild des Dichters im Auge des Königs.
Als ihn ein neuer Zwischenfall, Voltaires anonymer Angriff auf Maupertuis, seinen Landsmann und Tischgenossen in Sanssouci, in heftigeren Zorn versetzt und zur Verbrennung des Pamphletes auf öffentlicher Straße veranlaßt, sendet Voltaire den Schlüssel als Kammerherr, den Pour le Mérite und seine Bestallung als Pensionär mit den Versen zurück:
»Wie ich sie einst mit Zärtlichkeit empfing,
muß ich sie nun mit Schmerz zurücke geben:
so gibt ein Liebender in Zornesbeben
der sehr geliebten Frau zurück den Ring.«
Am selben Abend schickt ihm der König die Dinge wieder, läßt ihn auch nicht fort. Einige Wochen später, nach kämpferischen, dann wieder vertraulichen, dann wieder spöttischen Auftritten, läßt sich während der Parade der Dichter beim Könige melden.
»Nun, Herr von Voltaire, Sie wollen durchaus fort?«
»Sire, unaufschiebbare Dinge, meine Gesundheit –«
»So wünsche ich eine gute Reise, mein Herr.«
Sie sehen sich nicht wieder. Aber bald beginnt der Briefwechsel von neuem zwischen Bewunderung, Bosheit und Zärtlichkeit und hört erst 24 Jahre später auf: beim Tode des Dichters.
Nahe von Genf lebt der über 60jährige als Landedelmann, immer das Schlößchen von Gästen voll, aus allen Ländern kommen sie, ihn zu sehen, zu hören. Wagen, Lakaien, der Koch aus Paris, der Sekretär, und immerfort Schauspiel auf seinem kleinen Privattheater, auf dem der Adel mitspielt und vor dem sich die Bürger ärgern.
Hier, nahe der Grenze eines Vaterlandes, das ihn um Freidenkerei verfolgt, bedroht, lebt er über zwei Jahrzehnte. In grauen Schuhen und Strümpfen, weitem Seidenwams, kleiner Samtmütze oder großer Perücke geht er umher. Unablässig arbeitend, immer aktiv, zugleich immer lernend, behält er doch Zeit und Kraft, um wochenlange Besuche der ersten Frauen und Männer seiner Epoche zu unterhalten. Für alle Fälle hat er ein Gut auf Schweizer, ein anderes auf französischem Boden, um bei Verfolgung hin und her zu entweichen.
Doch mehr als die Neugier und der Geist der Besucher beschäftigt ihn im steigenden Alter Not und Hilferuf seiner Bauern. Vom Rat der Stadt Genf empfängt er die Erlaubnis, die Sümpfe um sein Gut herum trockenzulegen (ein halbes Jahrhundert, bevor der Faust vollendet wird), ganze Heidestrecken bebaut er, schützt seine Leute gegen Gewalttat der Herren.
Nun geht der Greis hinter dem Pfluge her, er sät auch selber ein Stückchen Feld, das Herrn von Voltaires Feld heißt und niemand bebauen darf, bis er es vom 79. Jahr ab nicht mehr leisten kann. Er gibt, verschwendet, gibt, begründet für die Armen dieser Gegend die Fabrikation von Uhren, dann als erster in diesem Landstrich die Seidenweberei. Der Theatersaal verwandelt sich in ein Haus für Seidenwürmer.
Zugleich befreit er durch monatelanges Wirken eine von fanatischen Richtern unschuldig verurteilte Familie in Toulouse, kämpft gegen die Schändung französischer Justiz, gegen Leibeigenschaft.
Gerechtigkeit: das ist das letzte, leidenschaftlichste Ideal Voltaires.
An einem Nachmittag im Februar hält am westlichen Tor von Paris ein Reisewagen, und als die Zollwächter nach Verbotenem fragen, erwidert eine helle Greisenstimme: »Ich glaube nicht, meine Herren, daß es hier andere Contrebande gibt als mich selbst.« Einer der Wächter blickt hinein, dann sagt er zum andern: »Bei Gott, das ist Herr von Voltaire!«
Nach Jahrzehnten war er zum ersten und war zum letzten Male nach Paris zurückgekehrt, um einer neuen Tragödie auf die Bretter zu helfen, um dies und um das, – in Wahrheit, um Paris noch einmal zu sehn. Nun will ganz Paris ihn sehn. Dem Hof, der Kirche ist er äußerst peinlich, jener hält ihn fern, diese sucht vergebens, sich ihm zu nähern. Aber Akademie, Politik und Theater pilgern zu ihm, an einem Tage empfängt er 300 Menschen. Er selber aber besucht niemand früher als seine erste Liebe, die er damals nicht bekommen und dann 60 Jahre nicht gesehen hat: entsetzt kehrt er von dem Besuch zurück, sie scheint es auch, denn andern Tages schickt sie ihm lakonisch sein Jugendbild wieder.
Zum ersten Mal seit 70 Jahren führt Voltaire, der an Blutspucken und zunehmender Schwäche leidet, ein geistliches Gespräch mit einem Priester. Ja, er beichtet, Voltaire; freilich, niemand weiß, was. Er läßt sich auch zu einer Erklärung nötigen, nach der er in der katholischen Religion zu sterben angibt, und »falls ich die Kirche je gekränkt habe, Gott und sie um Verzeihung bitte«. Er tut's aus einer seltsamen Furcht, als Leiche sonst auf den Schindanger geworfen zu werden. Als aber der Abbé ihm nun das Sakrament erteilen will, wehrt der Alte mit den Worten ab: »Bedenken Sie, daß ich immer wieder Blut spucke: wir müssen vermeiden, das Blut Gottes mit dem meinigen zu vermischen.«
Alle weiteren Versuche der Geistlichkeit lehnt er ab, sagt ärgerlich, er hätte nichts dergleichen eingeräumt, wäre er nur in Genf geblieben. Dann wird er plötzlich wieder gesund. Seine Fahrt zur Akademie ist ein Triumphzug. Im Theater kommt es zu einer Huldigung, wie sie Paris nie vorher einem Dichter erwiesen. Als er aus dem Hintergrunde einer Loge von den Freunden vorgezogen wird, verbeugt er sich so tief, daß seine Stirne den Logenrand berührt; als er das Haupt wieder erhebt, sind seine Augen, die 80 Jahre lang scharf und meist trocken geblieben waren, voll Tränen. Aber zu Hause lächelt er wieder und sagt: »Ihr kennt sie nicht, die Franzosen! Genau so haben sie Rousseau gefeiert und andern Tages doch den Haftbefehl gegen ihn erlassen!« Dann kauft er sich ein Haus und beschließt, in Paris sein Leben zu enden.
Doch das geschieht schon zwei Wochen später: rasch sinkt er zusammen und stirbt in Frieden.
Die Kirche verweigert ihm ein Grab. Bei der Sektion nimmt sich der Arzt das beispiellos umfangreiche Gehirn, ein Freund das Herz. Nachts wird die kleine Leiche im Hausrock mit Nachtmütze in Gestalt eines Schlafenden aufgepackt und heimlich fortgefahren. Die allmächtige Geistlichkeit verbietet der Akademie, für den Bösewicht eine Messe lesen zu lassen, den Zeitungen, ein Wort zu schreiben. Ein Prior, der die Wegführung nicht hindert, wird entlassen. Der Tote wird bei einem Verwandten in der Provinz heimlich beigesetzt.
12 Jahre später schreibt man 1790: da führt die Revolution Voltaires Reste durch eine via triumphalis nach Paris zurück, um ihn im Pantheon beizusetzen. Wo er einst im Turm der Bastille gesessen, strömt alles von Blumen, Liedern, Inschriften. Zwischen Fackeln und Musiken, zwischen Hunderttausenden wird der zwölfspännige Wagen durch Paris gefahren. Auf dem Sarkophage steht: »Als Dichter, Denker, Geschichtsschreiber gab er dem menschlichen Geiste gewaltigen Aufschwung. Er hat uns bereitet, frei zu sein.«
Eine Mainacht, 24 Jahre darnach: im Pantheon wird der Bleisarg erbrochen, eine Rotte junger Reaktionäre stopft seine Knochen in einen Sack, schleppt den Sack auf einen abgelegenen Bauplatz, gräbt ein Loch und läßt die letzten Reste am Rande der Weltstadt verschwinden.
Niemand weiß, wo Voltaires Leib in Staub zerfiel.