
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
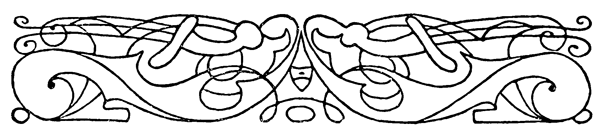
Es giebt Menschen die sich auf Großherzigkeit verstehen, aber nicht auf Demut, Königsnaturen denen die Gebärden der Gnade anstehen die aber ungelenk und störrisch sind, wenn sie die Kniee beugen sollten. Gerade unter den Armen finden sich häufig solche, so daß man glauben könnte, es wären Seelen, die bei ihrer großen Wanderung einen Fürstenthron verlassen hätten und jetzt im Gewande des Elends nachtwandlerisch, unter dem Traumzwange längst vergangener Vergangenheit, sich die armseligen Fetzen vom Leibe rissen, um sie lächelnd und nachlässig, als schöpften sie aus unversiegbarem Ueberfluß, Aermeren zu reichen. So war Galanta, die ihren Pflegebruder, den Pfarrer, im Grunde nur deshalb gehaßt hatte, weil die Reinheit seines Gemütes, die Feinheit seiner Sitten seine höhere Bildung und schließlich sein priesterliches Amt, was alles ihr Anerkennung und sogar eine gewisse Bewunderung einflößte, Unterordnung von ihr zu fordern schienen, wogegen sie sich andererseits im dunklen Gefühl ihrer kraftvollen Persönlichkeit gerade ihm gegenüber aufbäumte. Carmelo stand ihr zwar in dieser Rücksicht überall gleich, und doch, da er ein ehrlicher Mann war, sie aber wegen des Lebens, das sie geführt hatte, nicht als ehrlich galt, hätte sie ihm Dankbarkeit geschuldet, wenn er sie geheiratet hätte, und eine solche Last auf sich zu nehmen sträubte sich ihre unbändige Natur. Jetzt, da er ein Sträfling geworden war, hatte sich ihre Stellung zueinander verschoben, so daß man fast sagen konnte, sie ließe sich zu ihm herab, wenn sie seine Frau würde. Das war es eigentlich, warum sie plötzlich entschlossen war, ihn zu heiraten um jeden Preis, ohne zu bedenken, was daraus werden könnte; das Mitleid war in ihr aufgewallt und zugleich der Drang, augenblicklich zu trösten und zu helfen. Auch sagte sie sich, daß sie selbst einen großen Teil der Schuld an seinem Unglück trüge, und fühlte die Verpflichtung, wieder gutzumachen und ihn zu entschädigen; aber die Hauptsache war doch, daß er im Unglück war und daß sie beglücken konnte. Es störte sie durchaus nicht, daß Carmelo ihren Bruder getötet hatte, denselben Menschen dessen Leben sie lange Zeit geteilt und dem sie auch Verwerfliches zuliebe gethan hatte; denn gemischter Gefühle war sie nicht fähig, und da sie einmal angefangen hatte, sich in Gegensatz zu ihm zu setzen, kam sie dazu, ihn zu hassen, doppelt vielleicht, weil sie sich von der Macht seines bösen Willens hatte beeinflussen lassen, und sein Tod stimmte sie keineswegs versöhnlich. Das Gefühl, die Schenkende zu sein, lehrte sie sogar schnell die Kunst, sich zu demütigen und mit Hingebung zu bitten; denn Carmelo wollte zunächst nichts von einer Heirat mit Galanta wissen, so sehr war er in seine Niedergeschlagenheit und Reue gegen die Mutter vertieft, und sie mußte sich seine Einwilligung wie eine Bettlerin erflehen.
Auch der Jurewitsch war inzwischen ein Gefallener geworden, der Mitleid und Liebe brauchte; als nun um die Weihnachtszeit das ersehnte Kind geboren wurde, entschloß sich Galanta im Hochgefühl ihres stolzen Glückes, den Pflegebruder zu bitten, daß er die Taufhandlung vollzöge. Der Jurewitsch hatte bei den Gerichtsverhandlungen gegen Carmelo, wo er als Zeuge erscheinen mußte, das Publikum durch seine schmeichelnde Stimme und sein edeltrauriges Gesicht bezaubert, seinen Vorgesetzten hingegen hatte die nahe Verwandtschaft mit einem Menschen wie Torquato, die er mehr betonte, als nötig gewesen wäre, nicht gefallen. Dazu kam das Gerede, daß er der Vater von Anettens kürzlich geborenem Kinde, ja vielleicht auch von jenem anderen wäre, das gleich nach dem jähen Tode ihres Mannes zur Welt kam, vor allem aber die Unbeliebtheit des hochmütigen jungen Priesters, der mit dem Auswurf der Altstadt zusammenhing und mit seinesgleichen, ja mit Höherstehenden im Tone fremder Herablassung verkehrte. Gerade weil das Volk von der Sittlichkeit der Priester so schlecht dachte und denken durfte, war es der Geistlichkeit ärgerlich, wenn einer öffentlichen Anstoß gab, und eine Gelegenheit, zu zeigen wie ernst es ihnen mit den ihrem Stande auferlegten Pflichten war, wurde bisweilen gern ergriffen. So kam es, daß der Jurewitsch nach einem kleinen entlegenen Bergdorfe versetzt wurde, was einer Verbannung gleichkam oder, man könnte fast sagen, einem Lebendigbegrabenwerden; denn der Entfernte wurde wohl dort vergessen, vergaß sich am Ende selber und wurde ein bewußtloser Bestandteil der stillen Einsamkeit. Uebrigens war er weder über das Unrecht, das ihm geschah, traurig, noch über die Trennung von seiner Gemeinde; denn er zweifelte nicht daran daß er dort wie hier Herzen an sich locken und Augen voll Bewunderung und Schwärmerei auf sich gerichtet sehen würde. Auch kam ihm das willig erduldete Martyrium wie ein Opfer vor, das Gott zur Sühne für seinen Bruder annehmen würde, so daß er doch vielleicht auch jetzt noch etwas zur Rettung dieser armen Seele thun könnte.
Als er in der Weihnachtsnacht Messe las, drängten sich noch mehr Menschen als sonst in die Heidenkirche, um ihn zu sehen. In der ganzen Altstadt herrschte ausgelassener Festjubel trotz des feuchtschmutzigen Wetters; Harmonika- und Mandolinenklänge zogen wie glitzernde Silberfäden durch die krummen schwarzen Gassen, die ein Strom von Gelächter, Geschrei und Gesang, bald lauter, bald gedämpfter, rauschend erfüllte. Beim Näherkommen war es häßlicher: wenn die Thüren der zahlreichen kleinen Wirtshäuser sich aufthaten, um ein- oder auszulassen, quoll heiße, verdorbene Luft zusammen mit Gläsergeklirr und heiserem Brüllen hervor, oft wurde einem der Weg durch Betrunkene verstellt, die Arm in Arm taumelten und mit widerlich kippenden Stimmen sangen. Da es unter diesen Leuten üblich war, nachdem sie in den Wirtshäusern gezecht hatten, zur Mitternachts- und zur Frühmesse in die Kirche zu gehen, standen Polizeisoldaten am Portale des Domes, um solche am Eintritt zu verhindern, die augenscheinlich Unfug treiben wollten, wodurch es zu lautem Wortwechsel, ja zum Handgemenge und rohen Auftritten an der Kirchenthür kam; aber es gelang trotzdem nicht wenigen Unbefugten, sich einzudrängen.
Ich kam über den Domplatz und blieb in der kleinen Vorhalle stehen, wo nur wenige Menschen waren, und von wo ich zwar nicht in das Innere der Kirche hineinsehen, aber die Musik hören konnte und den freien Blick auf den unruhigen schwarzen Himmel und den feuchten Mond hatte, der unberührt in unerreichbarer Ferne jenseits des fliegenden Gewölkes ruhte. Nicht weit von mir, eingepreßt in das Gedränge, sah ich das liebe Gesicht der kleinen Anetta, die vor einigen Tagen jene Dame, bei der sie nach der Geburt des Kindes wieder eingetreten war, hatte wegschicken müssen. Sie war an einem Sonntage und dem darauffolgenden Montage ohne weiteres ausgeblieben, aus keinem anderen Grunde, als um einmal wieder frei und vergnügt zu sein. »Wie sie mich so bestürzt aus ihren großen Augen ansah«, sagte mir die Dame, »that es mir leid, sie fortzujagen, und doch mußte ich es thun, um meinen anderen Mädchen kein Aergernis zu geben, denen ich nichts Aehnliches hingehen lasse. Wer nicht fassen kann, daß das Leben Arbeit und kein Vergnügen ist, muß böse Erfahrungen machen, wer aus den Erfahrungen nicht lernt, mag hinfahren und zu Grunde gehen, es ist gut, wenn er für tüchtigere Gewächse Raum macht.« Ich mußte der Dame recht geben: mag die kleine Anetta zu Grunde gehen, weil sie ihre Lage nicht bemeistern kann, mag sie untergehen in der Traumwelt ihrer Seele, da sie doch nicht aufwachen und leben will; und wenn wir sie auf einen Königsthron setzten, würde sie es uns nicht danken, sondern die kleine thörichte Anetta bleiben, ihre Krone in einen Sumpf fallen lassen und zu Grunde gehen.
Sie sah schmal und blaß aus, woran auch das kürzlich überstandene Wochenbett schuld sein mochte, und die blauen Augen schienen mir matter als früher; sie blickten ängstlich, als fürchteten sie sich und suchten irgendwo Schutz, in die Tiefe der Kirche hinein. Was würde nun aus ihr werden? Wer würde kommen und sie nehmen und trösten oder mit ihr lachen und sich ihres Uebermutes freuen, um sie dann wieder allein stehen zu lassen zwischen den Kindern, die noch hilfloser waren als sie und die kleinen Hände zappelnd nach ihr ausstreckten. Ich weiß nicht, ob sie etwas Aehnliches dachte; ob sie sich nach ihrem guten Manne bangte, der tot war, oder nach dem Fremden, der im Taumel einer Nacht ihr Gefährte gewesen war, oder nach dem, der ihr immer gegeben und nie etwas von ihr gewollt hatte; es machte mich traurig, sie anzusehen, gerade als ob ich und alle anderen Menschen großes Unrecht gegen sie hätten, nie wieder gut zu machendes. Aus dem Innern des Domes kamen die Jubelgesänge über die Geburt des Gottmenschen, der uns von der Sünde befreien sollte, und die Klagen über unsere Verräterei und seinen Tod. Die Musik wurde mir eins mit den jagenden Wolken und dem weißen Gestirn dahinter, und alles zusammen schwebte wie etwas Ewiges, Himmelhohes und Geheimnisvolles über unserer Vergänglichkeit. Wo waren die Millionen von Menschen, die seit Jahrhunderten an dieser Stelle gebetet hatten, dumpfe Gedankenlosigkeit oder ein Gefühl von Würde und Unsterblichkeit in der Brust, alle gleich flüchtig, hinfällig und ohnmächtig unter dem ewigen unerreichbaren Monde. Wo waren sie? Vielleicht immer noch hier an derselben Stelle und ich einer von ihnen? Unser Kommen und Vorübergehen war vielleicht nur scheinbar wie das der Wellen im Meere, und mir fehlte nur die Besinnung, um zu wissen, wer die kleine Anetta war, deren Anblick mich so traurig machte.
Nachdem die Messe vorbei war und die meisten Kirchgänger sich zerstreut hatten, begrüßte ich den Jurewitsch, als er aus einer Seitenpforte der Kirche trat. Ich sagte: »Auch Ihrer Schwester Galanta ist ein kleiner Heiland geboren und hat sie vom Bösen erlöst«; aber er antwortete nur mit einem schwachen Lächeln und ging mit absichtlicher Eile an mir vorüber.
Das einzige Mal, wo ich die Geschwister zusammen sah, war Galanta unbeholfen und schweigsam, und die Lieblichkeiten seines Wesens, mit denen er sonst auch in den bewegtesten Augenblicken zu spielen wußte, wagten sich nicht hervor. Gerade das deutete mir auf eine heftige Erregung in ihnen beiden und besonders in ihm; denn die Aussöhnung mit Galanta war das Ziel seiner wärmsten Lebensströmungen gewesen. Aber was die Vergangenheit an Groll, Zorn, Mißverständnis und Entfremdung zwischen sie gehäuft hatte, konnte nicht mit einem Male ausgewischt werden. Er sah nicht mehr die goldige, ausgelassene Kleine, die ihre Aermchen in wilder Zärtlichkeit um seinen Hals drückte, sondern eine arme Frau, die sich durch trübe, schlammige Untiefen des Lebens geschlagen hatte, der häßliche Worte über die Lippen gegangen waren, und die jetzt manches Mal im zerrissenen Hemde über grober Arbeit saß. Trotzdem liebte er sie noch, und die Sehnsucht, sich hinzugeben und von starken weichen Armen ganz umfangen zu lassen, war noch nie so hoch an die Oberfläche seines Wesens gestiegen, daß sie fast aus Mund und Augen herausschrie nach ihr hin; nur daß sie es nicht vernahm und ihm nicht traute, und die gemessene Haltung, in der er festgebannt steckte, machte, daß sie sich wie Fremde, kühl und traurig, wieder trennten. Ein längerer Verkehr hätte das vielleicht ausgeglichen, aber er mußte bald darauf die Stadt verlassen, und es war vorauszusehen, daß sie einander in Jahren und Jahren nicht wiedersehen würden. Die Heirat mit Carmelo wollte ihm nicht in den Sinn, weniger weil er Torquato getötet, als weil er überhaupt Blut vergossen hatte, am meisten, weil der Jurewitsch nichts anderes als einen Plebejer in ihm zu sehen vermochte; aber aus seiner alten Scheu, sich ein geliebtes Wesen zu entfremden, indem er seinen Wünschen entgegentrat, sagte er nichts davon zu Galanta. Auf Carmelos Wunsch suchte er ihn sogar im Gefängnisse auf und versicherte ihm, daß er keinen Groll gegen ihn hege, aber er sprach wie aus einer Ferne heraus, die er nicht das Herz oder die Kraft zu überwinden hatte, was Carmelo, so einfach und arglos er auch war, wohl empfand.
An einem der ersten Frühlingstage besuchte ich Carmelo auf der Insel. Die blaue Pracht des Himmels und des Meeres, und am Ufer der dunkle Glanz der immergrünen Bäume hatten an diesem kühlen Tage etwas Hoffnungsvolles und Zukunftgläubiges, das die Brust weit machte. Man sah aus der Ferne das hochgelegene Zuchthaus, das mächtig wie ein Schloß die tieferen Häusergruppen überragte und in dessen Innerem es Tag für Tag, Jahr um Jahr immer gleich kahl, verdrossen bleiern war, ob es draußen blühte oder stürmte. Der peinliche Druck, der sich beim Betreten des widerlichen Gebäudes auf meine Brust gelegt hatte, wurde etwas leichter, als ich Carmelo sah, der mich mit lächelndem Gesicht begrüßte. Es sprach unverkennbar eine gewisse Zufriedenheit aus seinen Zügen und auch seine Worte bestätigten das: die Aussicht, nach dem Ablauf der Gefängniszeit eine Summe Geldes zu bekommen die er durch seine Arbeit zu verdienen dachte, und damit einen eigenen Herd zu gründen, an dem Galanta Hausfrau sein sollte, mochte ihm namentlich in der ersten Zeit die Gefangenschaft bedeutend erleichtern. Ich fragte, ob er es nicht auch in der Freiheit dahin hätte bringen können, wenn er ebenso fleißig gewesen wie hier; worauf er lachte und sagte: »Draußen giebt es guten Wein und das Meer und Wälder und Felder; hier giebt es nur Arbeit.« Ich sah zum erstenmal die Grübchen in seinen Wangen, von denen die Farfalla gesprochen hatte, und sein Gesicht bekam dadurch etwas so Kindliches, daß es mir im Herzen weh that, ihn nicht nehmen und auf eine saftige Wiese zwischen Blumen und Käfer setzen zu können, wohin er so viel mehr gehörte, als in diese gelbbraunen modrigen Mauern. So rosig braun wie früher waren, seine Wangen nicht mehr; fast machte sich schon jene unheimlich kranke Farbe bemerkbar, die nach der Volksmeinung jeder als eine Wirkung schleichenden Giftes aus dem Gefängnis mitbrachte, wenn er es überhaupt lebend verließ. Ich erkundigte mich nach der Ernährung, und er erklärte sich mit allem zufrieden; freilich lag es nicht in seiner Art, viel zu sprechen, geschweige denn zu klagen. Das einzige, was ihm fehlte, waren die weiten träumerischen Streifereien im Freien, wo ihm Stunden wie ein Augenblick vergingen; beunruhigen that ihn nur der Gedanke daran, daß er Riccardos Oleanderbaum ihm noch nicht auf das Grab hatte pflanzen können, wie er versprochen hatte. Aus den Beschreibungen seiner Mutter kannte er das Grab und seine Lage genau, wußte, wie es aussah, wenn früh am Morgen Tau darauf lag und wenn am Abend die Schatten der benachbarten Cypressen darauf fielen, und hatte sich ausgemalt, wie schön die roten Blüten zu der grauen Mauer stehen würden. Mein Versprechen unverzüglich Sorge zu tragen, daß der Baum an seinen Ort käme, befriedigte ihn sehr, und eine aus der Phantasie gegriffene Schilderung seines Söhnchens, die ich ihm gab, stimmte ihn vollends glückselig. Kaum je hatte ich ihn so gesprächig gesehen; sogar einen Freund hatte er hier gefunden, nämlich jenen Schwachsinnigen, der fälschlich beschuldigt war, den Wucherer ermordet zu haben. Carmelo hatte sich früher so wenig um ihn wie um andere Männer bekümmert, im Gefängnis war dieser der einzige, mit dem er Verkehr pflegte, soweit das möglich war; der kränkliche Mensch siechte langsam hin, trotzdem der Freund, um dessentwillen er das Urteil schweigend auf sich genommen hatte, allsonntäglich kam und ihn mit Wein und kräftigen Speisen versorgte. Diesem verstohlenerweise das Gefängnisleben zu erleichtern, ihm etwas Schweres abzunehmen oder ihm etwas Gutes zuzuwenden, füllte Carmelos Tage neben der Arbeit in der angenehmsten Weise aus. Als ich mich verabschiedete, sagte ich: »Carmelo, das Leben ist auch ein Gefängnis, und wenn wir es einst verlassen, händigt uns auch der Vorsteher, nämlich Gott, das aus, was wir uns erarbeitet und verdient haben. Wenn du das immer bedächtest, würde es dir später in der Freiheit ebenso gut oder besser gehen als hier.« Aber er sah mich groß an, ohne mich zu verstehen, und schüttelte mir nur herzhaft dankbar die Hand, ohne einen Anflug von Neid, daß ich nun in die Sonne und die unendliche blaue Luft zurückkehrte.
Auch den Jurewitsch habe ich später einmal in seinem Bergdorfe aufgesucht. Bis auf die Höhe des Berges fuhr ich mit der Eisenbahn, dann wurde mir ein kleines Fuhrwerk angeboten; es rasselte aber so holprig über die Steine, daß ich ausstieg und meinen Weg zu Fuß suchte. Niemals vorher hatte ich mich in solcher Oede befunden: die Erde, der Himmel, die wenigen Sträucher und Baumstümpfe, alles war grau, ein stumpfes Steingrau, ohne Schmelz, ohne Wärme, ohne Schimmer. Die niedrigen Häuser, die hier und da am Wege lagen, waren dicke, graue Steinhaufen, ohne Thüren und Fenster in den schwarzen Löchern, von niedrigen steinernen Mauern eingeschlossen. Ich sah keine Blume, kein Kraut, keine Frucht, kein helles, plätscherndes Wasser, es machte den Eindruck, als nährten sich die Menschen dort von Steinen. Das Dorf, in dem ich den Jurewitsch fand, war eine ebensolche Häusergruppe, nur daß es einige städtische Gebäude darin gab, die aber häßlicher und gemeiner aussahen als die übrigen. Er selbst war wohl noch so schön wie früher, aber er hatte das Gesicht gleichsam fallen lassen, und in seinem Wesen, als er mich begrüßte, war das Süße und Anmutige nicht mehr, womit er sonst bezaubert hatte. Ich bemerkte, daß er die öden und bösen Gesichter, denen wir begegneten, anlächelte, aber mit einem gespannten, gequälten Lächeln, das durch nichts als trauriges Glotzen erwidert wurde. Unter den Mädchen und Frauen mochte es nicht an verliebten fehlen; aber ich fühlte mit ihm, daß es ihn nur ängstigen konnte, wenn die schwarzen, inwendig glühenden Augen sich an ihm festsaugten wie verschmachtende arme Seelen. Als wir am Nachmittag durch das Dorf gingen, wo des Sonntags wegen nicht gearbeitet wurde, war es still wie unter Toten; in den schwarzen Thüren saßen alte Männer und Frauen und starrten mit blödem Ernst in den Gesichtern geradeaus, jüngere Männer saßen auf Bänken und rauchten, Mädchen gingen schweigend auf und ab.
Ein kleines Haus, das etwas abseits lag, schien mir noch freudloser als die übrigen, es sah halb wie ein Stall, halb wie ein Sarg aus, und vor der Thür lag eine tote Katze, schon in Verwesung übergehend. Dieser an sich geringfügige Umstand machte mir hier solchen Eindruck, daß ich unwillkürlich stehen blieb und den Pfarrer fragte, ob das Haus unbewohnt sei, sah aber im selben Augenblick durch das Fenster mehrere Gesichter, die mich aus einer dunklen Kammer anstierten. So schnell ich auch zur Seite blickte, hatte ich doch ein deutliches Bild von den Gesichtern, die sich untereinander ähnlich waren: fahle Männergesichter ohne Jugend, unter schmutzigen graugelben Haaren mit niedrigen Stirnen, glanzlosen Augen und großem, traurigem, grinsendem Munde. Sie waren die fünf Söhne einer Witwe, die kürzlich ihr neugeborenes Kind getötet hatte und jetzt deswegen im Gefängnis war; in derselben Kammer, wo auch die Söhne schliefen, hatte sie es nachts, unter heftigen Schmerzen erwachend, geboren, mit Weihwasser besprengt, erwürgt und unter ihr Bett geworfen, dann sich niedergelegt und bis zum Morgen geschlafen. Von den Söhnen war keiner aufgewacht und keiner hatte bemerkt, daß das tote Kind acht Tage lang unter dem Bette liegen blieb. Der Vater desselben war ein im Dorfe verheirateter, noch jüngerer Mann, dem zuliebe sie das Kind hatte beiseite schaffen wollen; sie selbst glich ihren Söhnen und schien sehr alt, älter als sie in Wirklichkeit war. Als die That bekannt geworden war, hatte die Frau kaum vor der wütenden Entrüstung anderer Frauen geschützt werden können; jetzt wurde das Haus gemieden und die Söhne blieben, wenn sie nicht arbeiten gehen mußten, in ihren Betten in der Kammer.
Der Jurewitsch erzählte mir die Geschichte ohne besonderen Anteil, während er mich durch das Dorf führte. Zuweilen hörte man Musik, eine Flöte oder eintönig schwermütigen Gesang, der etwas Schauerliches hatte, als käme er aus der steinernen Erde hervor, die klagte. Vor einem kurzen dicken Turme, der seit Jahrhunderten hier stehen mochte, gab es einen kleinen Grasflecken, auf dem Kinder Ringelreihen spielten. Sie waren in bunten schmutzigen Kleidern, und einige waren so klein, daß sie sich noch nicht auf den Füßen halten konnten und bei jedem Rundschritt der größeren umpurzelten, worüber sie aber weder lachten noch weinten, sondern sie lallten in das unverständliche, altertümliche Liedchen hinein, das die älteren sangen. Es war wie eine kleine Blumeninsel in einer unabsehbaren Wüste von Traurigkeit. Dennoch ahnte ich eine Schönheit in dieser Gegend, eine, die man fürchtet, in sich aufzunehmen, als wäre es auf immer vorbei mit aller Lust des Lebens, wenn man sie begriffen hätte.
Ich bemerkte leicht, daß keinerlei Band zwischen ihm und seiner Gemeinde war, er ging zwischen der trostlosen Häßlichkeit umher wie ein Fürst, der ins Elend geraten ist und stolz seine Besucher zwingt, die jämmerliche Umgebung nicht zu sehen, die er durch gleichgültige Blicke vernichtet. Ich machte keine Bemerkung, weder über die Landschaft, noch über die Menschen, geschweige denn, daß ich ihn bedauert hätte; es wäre mir vorgekommen, wie wenn ich einen armen Gastgeber das Kümmerliche seiner Bewirtung hätte fühlen lassen wollen. Und doch litt er unter der Stumpfheit der Menschen, unter der unsäglichen Einsamkeit; er war wie der einzig Lebende in einem Lande der Toten, die ihn neidvoll hassend oder neugierig fremd aus schwarzen Augenhöhlen anstarrten. Warum hatte das Schicksal gerade ihn in diese steinerne Einöde geworfen? Er war kein Mann mit ansteckender Lebenskraft, mit Posaunenstimme in der Brust, die wecken konnte, mit Blut im Herzen, das überschwölle und die Steine überströmte und lebendig machte; anstatt dessen wurden langsam die Toten seiner Herr.
Er führte mich aus dem Dorfe hinaus über den Bergrücken hinüber auf einen Punkt, wo man plötzlich das Meer erblickte, blau, goldig, still und unbegrenzt; dorthin sagte er, ginge er täglich. Während wir dort saßen, sagte ich: »Ich habe oft an unser Gespräch über Ihren Bruder gedacht, und ich glaube, daß Sie Unrecht haben, völlig für ihn zu verzweifeln. Mag es wahr sein, daß die Seele erlischt und für ewig verschwindet, die sich vom Lichte abkehrt, so ist es doch ebenso gewiß, daß die Liebe Licht ist. Und wenn auch keinen Menschen und sonst nichts auf der Welt, so liebte Torquato doch Galanta. Wo noch ein Funke ist, da kann nicht zugleich vollkommene Finsternis sein, und das muß doch auch von einer Liebe gelten, die von der höchsten göttlichen noch weit entfernt ist.«
Der Gedankengang, den ich geäußert hatte, schien dem Jurewitsch nicht neu zu sein; er antwortete, ohne darauf einzugehen: »Dann hätte Galanta ihn gerettet, nicht ich; alle meine Gebete, meine Schmerzen wären nutzlos gewesen und mein ganzes Leben wäre ein Wahn, ein wertloses, verworfenes Opfer.«
Er erfüllte mich mit Mitleid und Erstaunen. »Kann sich denn überhaupt«, sagte ich, »eine Seele von den Gutthaten einer anderen nähren? Und andererseits: kann etwas wahrhaft Gutes verloren gehen? Wer weiß diese Geheimnisse? Wer weiß, aus welchen unserer Thränen, aus welcher Arbeit, aus welchen Freuden uns das Kleid der Ewigkeit gemacht wird?«
Er gab mir keine Antwort, sondern sah unbeweglich über das Meer hinaus, mit einem düsteren Ausdruck, wie ich ihn noch nie in seinem Gesicht gesehen hatte. Es waren dieselben lieblichen Züge, aber sie erschienen mir in diesem Augenblicke hart und fremd und groß, so daß ich ihn nicht nur verwundert, sondern beinahe mit einer Art von Bangigkeit betrachtete. Plötzlich drehte er sich nach mir um und sagte flüsternd: »Und wer weiß, ob ich nicht alle diese Jahre schlechter und sündenvoller war, als sie beide? schlechter als der kranke, von einem bösen Dämon besessene Torquato und als Galanta, die sich an ihrer Liebeskraft läuterte? Ob meine Seele nicht ganz dunkel, leer und schwer ist und jetzt schon, während ich hier stehe, in den Abgrund des ewigen Todes versinkt?«
Ich war in einem Gefühl des Entsetzens, das ich schwerlich ganz begründen konnte, aufgesprungen; wie der Blitz kam mir die Erinnerung an verschiedene Augenblicke, wo es mir plötzlich vorgekommen war, als spielte der Jurewitsch mit sich selber, als wäre seine Miene voll Liebreiz nur eine Maske, die er vor das leere Holzgesicht einer Puppe hielte, als wäre sein ganzes Liebhaben im Grunde nichts als das Sichanklammern eines Schattens an etwas Lebendiges, das er aussaugen möchte. Aber das war nur ein Augenblick, dann setzte ich mich wieder neben ihn, streckte die Arme nach ihm aus und zog ihn an mich, der tief aufseufzend seinen Kopf auf meine Schulter legte. Wir saßen noch lange ohne zu sprechen da, bis ich am Stand der Sonne sah, daß es Zeit für mich war, aufzubrechen. Als wir in das Dorf zurückkamen lag die Dämmerung über den Steinen und die tanzenden Kinder waren nicht mehr da; in den Thüren saßen noch die Alten und starrten mit trübsinnig lauernden Augen ins Leere. Der Jurewitsch begleitete mich eine Strecke, und obgleich er nichts sagte, fühlte ich, daß ihm der Abschied schwer wurde. Mir war es fast unerträglich, ihn allein in die graue Einöde zurückkehren zu lassen, und ich blieb wohl zehnmal stehen und sah mich nach ihm um, willens, ihn zu rufen, was ich dann doch als zweck- und sinnlos unterließ; er wandte sich kein einziges Mal nach mir zurück, sondern ging langsam, mit gesenktem Kopfe seinem Dorfe zu, das ich wie einen großen einsamen Gräberhaufen im Nebel liegen sah.